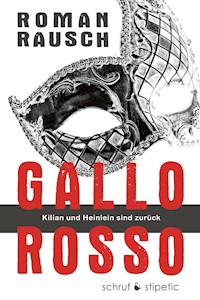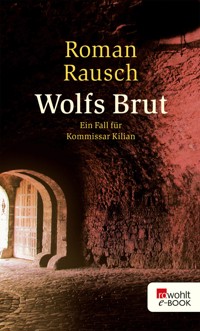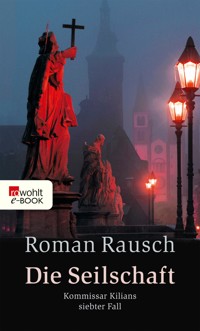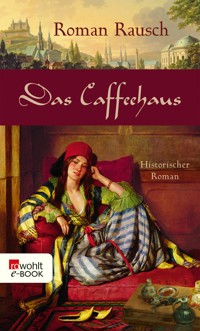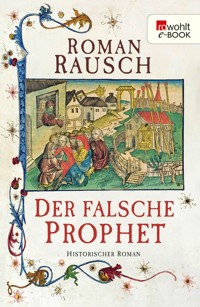9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der größter Zauberer seiner Zeit: Doktor Faust. Gretchen: alles andere als unschuldig. Die junge Novizin Margarete hat ein Laster: Wissbegier. Nicht einmal ihr geschätzter Beichtvater, der berühmte Schriftgelehrte Trithemius, will ihr einen Funken Entfaltung zugestehen. Sie streift den Habit ab – und flieht aus dem Kloster. Auf einem Markt in Heidelberg lernt sie den erfolglosen Astrologen und Alchimisten Georg Helmstetter kennen und schließt sich ihm an. Unter dem Namen Doktor Faustus schlagen sie sich als wandernde Zauberkünstler durch, bis Margarete Zweifel kommen. Ist der Mann an ihrer Seite nicht vielmehr ein Meister des Betrugs? Schmähschriften tauchen auf, die Faust im Pakt mit dem Teufel zeigen. Margarete bleibt. Und muss diese Entscheidung teuer bezahlen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Roman Rausch
Die Schwarzkünstlerin
Ein Faust-Roman
Über dieses Buch
Der größte Zauberer seiner Zeit: Doktor Faust. Gretchen: alles andere als unschuldig.
Die junge Novizin Margarete hat ein Laster: Wissbegier. Nicht einmal ihr geschätzter Beichtvater, der berühmte Schriftgelehrte Trithemius, will ihr einen Funken Entfaltung zugestehen. Sie streift den Habit ab – und flieht aus dem Kloster. Auf einem Markt in Heidelberg lernt sie den erfolglosen Astrologen und Alchimisten Georg Helmstetter kennen und schließt sich ihm an. Unter dem Namen Doktor Faustus schlagen sie sich als wandernde Zauberkünstler durch, bis Margarete Zweifel kommen. Ist der Mann an ihrer Seite nicht vielmehr ein Meister des Betrugs? Schmähschriften tauchen auf, die Faust im Pakt mit dem Teufel zeigen. Margarete bleibt. Und muss diese Entscheidung teuer bezahlen …
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg bei Reinbek, Mai 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg bei Reinbek
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Bildnachweis S. 21 Quagga Media/Alamy Stock Photo, S. 223 bpk/British Library Board (Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe)
Umschlagabbildung akg-images/British Library; Leemage/ Bridgeman Images (Eine Frau illustriert das «Livre des Prudents et Imprudents» von Catherine d’Amboise. Miniatur aus der illuminierten Handschrift des «Livre», 1509. Bibliothèque de l’Arsenal, Paris); tanatat,Vitaly Korovin/Shutterstock
ISBN 978-3-644-40535-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen.
Höllenfahrt
Staufen um das Jahr 1540
Die Alte schreckte bei meinem Anblick zurück, als hätte sie den Teufel gesehen. Sie lag nur knapp daneben.
«Fürchte dich nicht, Weib. Ich tu dir nichts.»
Schweißperlen standen ihr auf der sonnenverbrannten Stirn. Die Nase schmal und schief, eine ergraute Strähne verdeckte ein Auge. Sie schlug ein Kreuzzeichen. «Was wollt Ihr von mir?»
«Ist da vorne Staufen?» Ich war mir nicht sicher, ich war schon an so vielen Orten gewesen.
«Staufen», grummelte sie und verzog dabei das ausgemergelte Gesicht. «Was wollt Ihr dort?»
«Ich hörte von einem Unglück.»
Sie spuckte zur Seite aus. «Was schert es Euch?»
Mehr als es der Vettel lieb sein konnte. Ich musste Gewissheit haben, ob der Teufel Wort gehalten hatte. «Vielleicht kann ich helfen.»
Dieses Mal spuckte sie mir vor den Karren, sodass meine Hand zur Peitsche ging. Ruhig … Das verrückte Weibsbild wusste nicht, mit wem sie es zu tun hatte.
«Folgt dem Fingerzeig Gottes.» Sie wies in die Richtung, aus der sie gekommen war. In der flimmernden Hitze thronte eine Burg auf einem hohen Berg. «Aber ich rate Euch: Kehrt um, tut Buße.»
Dafür war es längst zu spät. «Das werde ich, gleich, nachdem ich in Staufen angekommen bin.»
Die Alte lachte höhnisch aus einem zahnlosen Mund. «Der Hölle könnt Ihr Eure Sünden beichten. Der Hölle!» Von der Not gekrümmt und der Angst getrieben, humpelte sie grußlos davon und wagte keinen Blick zurück.
«Der Hölle?»Mein Rufen verhallte.
Bevor das Weib hinter der Anhöhe verschwand, hörte ich es noch klagen. «Sodom! Oh Herr, vergib uns unsere Schuld.»
Sodom … Demnach war ich auf dem richtigen Weg. Ich gab Hekate die Zügel. Sie schnaubte widerspenstig, bockte, wie es ihre Art war, wenn sie mir zu Diensten zu sein hatte. Ich wusste aber auch von ihrer maßlosen Gefräßigkeit.
«Pfaffenherz!» Das Zauberwort.
Der Karren setzte sich in Bewegung. Er holperte über die abgewetzten Steine und die von Hitze und Dürre eingebrannten Löcher der Straße geradewegs auf die ferne Burg zu, deren karges Umland feindlich auf mich wirkte, seelenlos und verflucht.
Staufen. Faust … der Teufel. Der Wechsel ist fällig.
Nichts sorgte für mehr Schrecken, nichts klang verheißungsvoller als eine Begegnung mit dem Leibhaftigen, dem gefallenen Engel Luzifer, dem Satan … Sabellicus! Gleich welchen Namens oder welcher Gestalt er sich bemächtigte, er würde mich nicht mehr los. Ich hatte noch eine Rechnung mit ihm offen.
Der Himmel über Staufen hieß mich schwermütig willkommen, die hohe Burg lag im Feuer der sengenden Sonne. Die ummauerte Stadt zu ihren Füßen wirkte grabesstill und grau. Auf den verdorrten Feldern ringsum sah ich keine Menschenseele, nicht mal einen streunenden Hund oder darbenden Bettler. Die Vögel waren verstummt, die Luft war frei von Gerüchen des Mittagsmahls und der Kloaken.
Hier stimmte etwas nicht. Ich zog die Zügel fest an mich, sodass Hekate vor Zorn schnaubte und ungeduldig auf der Stelle trat.
«Ruhig … Warte.» Sie lenkte ein. Kluges Tier.
Auf den Mauern, in den Wachtürmen und hinter den Zinnen niemand, selbst das Stadttor war verwaist, es klaffte wie ein finsterer Orkus offen. Vor mir eine kleine Holzbrücke über den schmalen, ausgedorrten Bach. Nicht ein Tropfen Wasser darin, der meinen und Hekates Durst hätte stillen können.
Wenn ich die Brücke passierte, war eine schnelle Flucht ausgeschlossen. Der alte Karren mit den morschen Rädern würde in tausend Stücke zerspringen, und an Hekates Abneigung gegen den Galopp sollte ich erst gar nicht denken. Es wäre ohnehin nur ein widerwilliges Traben gewesen, zu mehr war sie auf ihre alten Tage nicht mehr fähig. Ich sollte sie endlich erlösen.
So verharrte ich an Ort und Stelle, wartete und hoffte auf ein Lebenszeichen aus der todgleichen Stadt. Hatte mich das alte Weibsbild in eine Falle geschickt? Würden die Wachen hinter den Toren auf mich warten?
Mir wurde bang bei dem Gedanken, obwohl sich niemand mehr an mein Gesicht erinnern würde. Jahre waren seitdem vergangen, und der Zauberer gab es viele. Andererseits keinen wie mich, ich war und bin einzigartig, meine Kunst hat mich unsterblich gemacht. Nicht durch List und Tücke, billige Jahrmarkttricks und Scharlatanerie – das ist Sabellicus’ Geschäft –, sondern durch Klugheit und Kenntnis der verborgenen Geheimnisse.
Trithemius, du wärst stolz auf mich …
Der alte Zorn flammte auf – noch immer konnte ich seiner nicht Herr werden. Zum Teufel mit deinen frommen Sprüchen, den Belehrungen und falschen Zeugnissen. Trithemius, du eitler Pfaffe bist an allem schuld. Hättest du den Brief nicht geschrieben, all das Leid wäre mir erspart geblieben. Du schuldest mir ein Leben.
Ich spuck auf dich, dein Grab, deine Schriften und Geheimnisse … deinen Namen. Möge er auf alle Zeiten mit dem des Gauners Sabellicus verbunden sein. Vater und Sohn, das seid ihr, Meister und Lehrling, Schöpfer und Kreatur. Brennt in alle Ewigkeit. Hand in Hand. Der eine sei des anderen Verderben.
«Los jetzt!» Die Zügel klatschten auf Hekates Rücken. «Bringen wir es zu Ende.»
Wenn etwas das Feuer in mir zum Lodern brachte, dann war es die Erinnerung an jene Nacht, in der ich alles verlor, in der ich zum Spielball des Hochmuts zweier Männer geworden war, ihrer Lügen, ihres Verrats.
Aber ich war nicht länger wehrlos, ich würde ihnen nehmen, was ihnen stets das Teuerste war: Name, Ruhm und Existenz. Als hätte es sie nie gegeben.
Der Wunsch nach einer vollkommenen, unumkehrbaren Tilgung jeder Erinnerung an die zwei größten Lügner aller Zeiten trieb mich durch das verwaiste Stadttor, hinein in die seltsam verlassene Stadt, vorbei an braven Bürgerhäusern und einer aus den Trümmern des Kriegs auferstandenen, überraschend stolzen Kirche. Wer je geglaubt hatte, mit Hacke und Sichel ließe sich das Geschwür der Herrschaft ausrotten, der kannte die verzweifelte Sorge nicht, die die armen Leute umtrieb: für ihre blindwütige Raserei zur Rechenschaft gezogen zu werden – hier wie im Jenseits. Vor allem dort.
Angst baute Tempel, nicht Geld. Angst stellte Glauben über Wissen. Angst gebar Ungeheuer, wo nur der Schatten einer Maus war.Ich musste es wissen, ich hatte mir den Popanz zum Knecht gemacht. Angst war der Samen des Erfolgs.
Mitunter hätte mir eine Portion Angst gutgetan, sie hätte mich vor mancher Torheit bewahrt. So wie in diesem Moment, als mir der Gestank von Verbranntem und Pulver in die Nase stieg. Auch glaubte ich Stimmen zu hören, Rufe, Befehle. Da vorne, hinter der Ecke, da tat sich was. Ich zögerte dennoch nicht, ließ Hekate weitertraben. Verfluchte Neugier, du warst immer schon mein größter Feind.
Ein Hund preschte hervor, gejagt von einer kläffenden Meute seiner Artgenossen. Achtlos rannten sie an mir vorüber, das erste Tier trug etwas im Maul … schwarz verkohlt und blutig. Ich konnte es nicht zweifelsfrei erkennen. War es eine abgerissene Hand, ein Fuß?
Hinter der Ecke würde ich auf das treffen, weswegen ich den weiten Weg auf mich genommen hatte. Meine Suche würde endlich ein glückliches Ende finden.
Hekate schnaubte zur Warnung, als sie auf den Platz trat, und ich … schnappte nach Luft – vor Überraschung. Die ganze Stadt schien auf den Beinen zu sein, Hunderte waren es. Und alle wandten mir den Rücken zu. Dazwischen erkannte ich die Torwachen, die – statt den Zugang zur Stadt zu schützen – bemüht waren, auf dem Platz für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Sie schimpften und drängten die Schaulustigen von einem gewaltigen Loch in der Erde zurück.
Die angrenzenden Häuser zeugten von einer Explosion, die Fenster und Türen eingedrückt hatte und unglückliche Nachbarn das Leben gekostet haben musste. Schwarzer Ruß an den Wänden … Spuren eines Brands.
Ich befahl Hekate den Halt, zog die schwarze Kapuze tief ins Gesicht und stieg vom Karren. Dabei stützte ich mich auf meinen Gehstock, der mir ein treuer Helfer fürs steife Bein, zugleich aber mit der versteckten Klinge eine verlässliche Waffe war. Niemand sollte sich von meinem Anblick täuschen lassen, meine Verletzungen als Schwäche deuten oder die Kerben auf meinem Gehstock übersehen – ich könnte ihn eines Besseren belehren.
Der Erste, der mich im Gedränge um die beste Sicht bemerkte, war ein Junge, der mit dem Straßendreck verschmolzen schien. Aus seinem rabenschwarzen Gesicht starrten mich zwei Augen an, unfähig zu verstehen, was sie erblickten, unfähig, dem Kopf und schließlich den Beinen die Flucht zu befehlen. Ich überließ den Jungen seiner Ehrfurcht und richtete meinen Groll gegen jene, die mir den gebotenen Respekt verweigerten.
«Zur Seite!»
Niemand hörte mich, niemand gehorchte, sodass ich meinen Gehstock sprechenließ. Ein fester Hieb an die richtige Stelle machte den Starrkopf vor mir gefügig.
Der Kerl fuhr wutentbrannt herum. «Wer wagt …» Er stockte, stammelte stattdessen nur weiter: «Heilige Mutter Maria, hilf.» Dann bekreuzigte er sich und trat zur Sei te.
Andere taten es ihm gleich und erwiesen mir den verdienten Respekt. Eine Gasse tat sich auf, an deren Ende sich die Erde in einem Loch verlor.
Es war so weit, nur noch ein paar Schritte … Ich atmete schwer, mein Herz raste. Nach all den Jahren und den unzähligen Versuchen, seiner Herr zu werden, hatte ich den Schwager des Teufels nun endlich gefunden, wie ihn der Fürst der Ketzer, Martin Luther, einst geschmäht und jeder Schafskopf seitdem nachgeplappert hatte. Oder war ich wiederum auf ein Gerücht hereingefallen …
Das ängstliche Geraune um mich herum nahm ich kaum wahr, es war unbedeutend, genauso wie der Schrecken, den ich in ihren Gesichtern hervorrief.
«Wer ist das?»
«Grundgütiger …»
«Wachen!»
Verkohlte Bretter stachen aus einem dampfenden Schlund heraus, als seien sie knöcherne Reste einer Bestie – gebrochen, verdaut, ausgewürgt. An den Seiten standen noch die Grundmauern eines Hauses, eine Steintreppe verlief ins Nichts. Geborstene Fässer, Blechtöpfe, Kannen, Becher … und endlich auch das, was ich suchte: eine Retorte, Schüsseln unterschiedlicher Größen und Beschaffenheit, ein Mörser, ein Blasebalg und weitere eindeutige Hinweise darauf, dass hier einst das Laboratorium eines Alchemisten untergebracht war.
Allerdings gab es auch Spuren von menschlichen Überresten, wenn das dort Knochen, Haare oder Innereien waren. Genauso gut hätten sie von einem Tier stammen können, es oblag der Phantasie, was man darin erkennen wollte. Und natürlich, über allem waberte der Geruch von Schwefel und Fäulnis, als gäbe es nur diese zwei Zutaten, um die Illusion von einer Höllenfahrt zu erzeugen.
Kurzum: Die Inszenierung von Tod und Teufel hätte für die hiesigen Einfaltspinsel kaum überzeugender sein können – sofern man sich mit dem Offensichtlichen zufriedengab, und das taten sie allem Anschein nach. Ich aber hielt Ausschau nach Verborgenem, nach den Dingen, die fehlten. Bücher. Schriften. Aufzeichnungen und Protokolle.In jedem Laboratorium gab es sie körbeweise – nur nicht hier. Waren sie verbrannt, in abertausend Fetzen zerrissen, lagen sie am Grund des Schlunds?
Niemand, nicht einmal der Teufel selbst hätte sie zurückgelassen, um einem unwissenden Finder nicht das größtmögliche Geschenk in den Rachen zu werfen, einfach so, ohne Gegenleistung. Nein, niemals.
Es half nichts, ich musste Gewissheit haben und setzte den Fuß auf den Kraterrand. Eine Torwache trat mir entgegen.
«Wer bist du? Was willst du hier?!»
Er hielt mir die rostige Spitze seines Spießes unter die Nase. Seine Lippen bebten, in den Augen erkannte ich Angst, Hilflosigkeit. Er spürte, dass er einen Kampf gegen mich nicht gewinnen würde. Mehr noch: Ich würde seine Seele mit einem Zauberspruch einfangen und sie erst wieder freigeben, wenn seine Sippschaft den Preis dafür gezahlt hatte.
«Gib dich zu erkennen. Wer bist du?»
Unter der Kapuze zischte ich ihm entgegen: «Das willst du nicht wissen.» Ich kehrte ihm den Rücken zu.
«Gehörst du zu den Zauberern?»
Er ließ nicht locker, der Dummkopf. Hatte er seinen Verstand verloren, oder hatte ihn die Panik im Griff, dass er mein großzügiges Geschenk, ihn nicht weiter zu beachten, ausschlug?
Aus der Menge trat ein Zweiter hervor, ich glaubte, das Gesicht schon einmal gesehen zu haben. Vor langer, langer Zeit … «Ich weiß, wer das ist.»
Mich zu benennen hieß, mit dem Leben abgeschlossen zu haben. Er war noch dümmer als die Torwache.
«Das ist Faust!»
Dummheit war damit auszuschließen, ich musste vorsichtig sein.
Faust: Was der Name auslöste, spiegelte sich in den Gesichtern der Umstehenden wider, ich sah Schrecken, aber auch Widerwillen, gar Protest gegen das Unmögliche.
«Faust hat der Teufel geholt!», rief einer, und weitere schrien durcheinander.
«Dort unten ist sein Grab.»
«Ich habe ihn jämmerlich schreien hören.»
«Hirn und Herz herausgerissen.»
«Blut überall.»
«Der Wechsel war fällig.»
Nur zu, ihr Dummköpfe, redet euch um Kopf und Kragen, mich schert es nicht.
«Es ist Faust!», bekräftigte der Mann mit dem seltsam vertrauten Gesicht. Ich glaubte ihn für einen Augenblick hinterlistig lächeln zu sehen. «Faust ist aus der Hölle zurückgekehrt!» Er zeigte auf mich mit einem Finger, dessen Spitze rabenschwarz war, ein untrügliches Zeichen für … Jetzt ahnte ich es: Er gehörte zu den lügnerischen Banden der Drucker.
Ich musste mich vorsehen, gegen diesen Gegner halfen weder Gift noch Zauberspruch.
«Ja, ich bin’s», gab ich zu, um Zeit zu gewinnen.
Der Schrecken fuhr durch die Reihen, mit ihm der klägliche Versuch, für das Unmögliche eine Erklärung zu finden.
«Ich hab’s doch mit eigenen Augen gesehen.»
«Der Teufel hat Faust geholt.»
«Mit Pulver und Schwefel.»
«Mit Haut und Haar.»
«Er hat das Zweite Gesicht.»
«Ein Wunder.»
Das war mein Stichwort. «Tretet zurück, und niemandem wird ein Leid geschehen.» Es musste schnell gehen. Ich setzte den Fuß in den Krater, ein unsicheres und gefährliches Unterfangen, denn dort unten würde ich in der Falle sitzen.
«Weg vom Loch!», befahl der Drucker. «Er wird mit Teufelsapparaten wiederkommen und uns alle töten.»
Ein Lügner und Aufwiegler, wie er im Buche stand.
Die versteckte Klinge meines Gehstocks blitzte an seiner Kehle auf. «Schweig oder büße mit deinem Leben.»
Er erstarrte, und dennoch konnte er mir zu Diensten sein, wenn ich es richtig anstellte. Er konnte mich aus dem Dilemma befreien.
«Steig hinab. Such nach meinem toten Körper.»
Er verstand nicht oder wollte es nicht, und ich war es müde, den Befehl zu wiederholen. So setzte ich einen Schnitt an seiner Kehle – genug, damit ausreichend Blut floss, zu wenig, um die Arbeit eines Quacksalbers zu vereiteln.
«Das Gift auf der Klinge lässt dir Zeit. Ich zähle bis hundert.»
Bei «zwei» war er über dem Kraterrand hinaus, bei «drei» in den qualmenden Trümmern verschwunden. Er hatte nicht einen Augenblick an meiner Ernsthaftigkeit gezweifelt. Demnach kannte er mich. Wer war der Kerl?
Das Gift meiner Lüge wirkte bei den Umstehenden gleichsam. Hätten sie sich zusammengetan, wäre ich ein leichtes Ziel gewesen. Stattdessen überwog die Neugier, ob es der vorlaute Drucker rechtzeitig schaffen würde. Alle gafften in das unbedeutende Loch, während der Zauberer seinen nächsten Trick vorbereitete.
Ich befahl Hekate zu mir, lustlos trabte sie heran. Auf dem gedeckten Karren befand sich Zaubergerät, das mir einen sicheren Rückzug ermöglichen sollte. Es war nichts Außergewöhnliches vonnöten, die Menge war bereits eingestimmt, und so griff ich in den Topf mit dem silbrig weißen Pulver und nahm eine Handvoll davon.
«Fünfundachtzig!», rief ich in die Runde, und die Anspannung um mich herum wuchs.
Ich ging in Position, stellte mich näher zu meinem Karren als zum Krater mit der fiebernden Menge und suchte einen Flecken, wo noch etwas Löschwasser stand.
«Hundert!», hörte ich jemand rufen, dann stimmten die anderen ein: «Hundert!»
Aufs Wort kam der Dreckskerl aus dem Loch empor, erschöpft, nach Luft schnappend, die Hand an der Wunde am Hals.
«Und?»
Er zeigte mir einen Fetzen Stoff. «Mehr war nicht zu finden.»
«Was soll das sein?»
Er zuckte mit den Schultern.
«Das genügt nicht.»
«Aber, es ist etwas darauf geschrieben … eingestickt.»
«Zeig es mir.»
Er hastete mir entgegen, händigte es mir aus. «Nun gib mir die Medizin, wie du es versprochen hast.»
Mich interessierte nur, was er im Kraterloch gefunden hatte. Und fürwahr, auf den zweiten Blick hatte er tatsächlich verdient weiterzuleben, auch wenn es mir zuwider war.
Das Stück Stoff stellte sich als ein Umhang mit pelzbesetztem Kragenstück heraus, und meine Augen fanden, wonach sie aufgeregt gesucht hatten – eine ehemals feine Stickerei, die ihrem Träger Ruhm und Namen verlieh: Doktor Georg Faust.
Eine Träne trat mir ins Auge. Verfluchte, unbezwingbare Wehmut.
«Die Medizin!»
Lange war es her, dass ich mich so sehr um Selbstbeherrschung hatte bemühen müssen. Ich befahl der Erinnerung zu schweigen, schluckte meinen Zorn auf die Drucker hinunter und konzentrierte mich auf meinen Abgang. Es würde nicht einfach werden.
«Vade retro, venenum sacrum», beschwor ich das Gift, aus seinen Adern zu weichen – unnütz zwar, aber der Spruch zeigte Wirkung in der Runde. Auf nichts anderes kam es an. «Du bist geheilt. Nun geh.»
Der Kerl griff sich an den Hals, misstrauisch und zweifelnd. «Mehr ist nicht notwendig?»
«Nein.»
Er seufzte erleichtert. Aber traue niemandem, dem du das Leben gerettet hast, die Schuld wird ihn auffressen. Eine bittere Erfahrung, die ich bereits in jungen Jahren gemacht hatte.
«Ergreift ihn!»
Ich war vorbereitetet und gab das Pulver in meiner Hand frei, achtete darauf, dass es auf Wasser fiel, und drohte meinen Angreifern: «Cavete magos!» Hütet euch vor den Zauberern.
Das Zauberpulver zündete, zischte, spuckte Rauch und gleißende Flammen, während ich mich auf den Karren mühte und sich die braven Bürger in Sicherheit brachten. Was ein wenig Alchemie alles bewirken konnte, erstaunte mich immer wieder.
«Lauf, meine Hexe, lauf!» Ich gab Hekate die Peitsche.
Was unnötig war, sie wusste aus Erfahrung, dass ein schneller Abgang mich vor dem Scheiterhaufen und sie vor dem Schlachter bewahrte. So zog sie einen (leider viel zu großen) Bogen, fiel zu meiner Überraschung doch in den Trab, und wir erreichten noch vor Ende des Feuerzaubers das rettende Stadttor.
Den Fetzen Stoff mit dem eingestickten Namen hielt ich fest umklammert, als wäre es ein unersetzbares Erbstück. Ich ließ ihn erst wieder los, nachdem die Nacht hereingebrochen war und als Hekate den Dienst verweigerte. Bis in die tiefen Nachtstunden kauerte ich im Mondlicht und sinnierte über das Erlebte in Staufen.
Sabellicus sollte tatsächlich tot sein?
Viel sprach dafür, wenig dagegen. Und doch wollte ich nicht so recht daran glauben. Ich kannte diesen Scharlatan und wusste um die Lage, in der er sich befand. Nichts weniger als der Tod hätte ihn vor meiner Rache bewahren können, nichts mehr als eine Höllenfahrt hätte ihn in den Annalen verewigt. Sollte er wirklich beides mit nur einem Handstreich errungen haben?
Mich schauderte bei dem Gedanken. Damit hätte er über alle Welt triumphiert, mich am Ende besiegt. Und Trithemius. Wie Galle stieß es mir auf. Nein, ich musste etwas übersehen haben, auf das Offensichtliche hereingefallen sein.
Welchen unwiderlegbaren Beweis hatte ich für seinen Tod?
Feuer, Pulver, Schwefel, Blut und Gedärm, selbst die Schaulustigen wollten mich nicht überzeugen, deren Täuschung war gängige Praxis eines jeden Zauberers.
Der Umhang mit der Stickerei jedoch war für niemand anderen als für mich vorgesehen, jeder andere hätte ihn als blutverschmierten Fetzen abgetan. Sabellicus wusste, was er mir bedeutete, und er hatte ihn eigens für mich platziert – einen Abschiedsbrief unter einst Liebenden. Fahr zur Hölle!
Hatte er sich damit unsterblich gemacht?
Sicher nicht durch das Gerede in Staufen, das würde einige Meilen reichen, danach verebben. Nein, er brauchte etwas, das hinaus in die Lande strahlte, Grenzen und Sprachen überwand, ohne an Kraft und Überzeugung zu verlieren, etwas, mit dem man immer wieder aufs Neue erfuhr, wie Faust mit dem Teufel einen Pakt …
Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. War ich denn mit Blindheit geschlagen? Der Drucker! Die Antwort war zum Greifen nahe gewesen. Ich musste schnellstens zurück nach Staufen, den hinterhältigen Kerl aufspüren, bevor er sich wieder verkroch.
Erster Teil
Sabellicus
«Homo ille, de quo mihi scripsisti …»
«Jener Mensch, von dem du mir geschrieben hast …»
Trithemius, Abt von St. Jakob zu Würzburg
IIn Flammen
Speyer, vierzig Jahre zuvor
Eine finstere Nacht. Kein einziger Stern wollte mir Flügel wachsen lassen. Nur ein roter Mond, so blass.
Selbst die Grillen waren verstummt, von diesem schrecklichen Ort geflüchtet, wo alles Leben mit nicht enden wollenden Litaneien erstickt wurde – demütig, gehorsam und still –, ein ewig murmelndes Gleichmaß, während die Welt jenseits der Klostermauern in Aufruhr war. Ich musste diesem Kerker entfliehen, bevor es mich erwürgte – meinen Geist, mein flammendes Herz. Die Natur!
Ich wand mich in der ungewohnten Kluft einer Novizin. Schwer war sie wie ein nasser Sack, eng, wo sie luftig sein sollte, und weit, wo sie die Vorzüge meines erblühenden Körpers hätte hervorheben sollen. Wo war all die Seide geblieben, wo waren mein Schmuck, die Kämme und Schuhe aus zartem Leder?
Der Betschemel unter dem Wandkreuz befahl mich zu sich – ein Folterinstrument für den hochtrabenden Geist –, mein Sprachrohr nach draußen. Ich faltete die Hände zum Gebet, vergrub mein Antlitz darin.
«Vater, Mutter, habt Erbarmen mit eurem einzigen Kind, auch wenn es nur ein Mädchen ist. Kein Vergehen kann so groß sein, dass ich diese Strafe noch länger ertragen muss. Eine letzte Chance, mehr verlange ich nicht. Ich verspreche, mich zu bessern, euch stets zu ehren und zu gehorchen. Auf meine unsterbliche Seele, hoch und heilig.»
Das Kaminfeuer knackte, ich kannte seine verborgene Sprache gut, und wie immer verspottete es mich: Du hattest deine Chance, Hunderte. Nimm die Strafe auf dich, werde ein besserer Mensch. Gehorche endlich!
Zum Teufel mit dir und dem Gehorsam, meine Knie schmerzten, meine Geduld und die Hoffnung auf Rettung waren geschwunden. Entweder hörten meine Eltern die Gebete nicht, oder sie hatten mich längst aufgegeben. Ich konnte es ihnen auch gar nicht verübeln, ich war mir selbst überdrüssig. Zu viel Drang, zu wenig Disziplin, kein Gehorsam und kein Halten. Wohin der Wind wehte, dorthin folgte mein Herz – ungestüm und unaufhaltsam, bar jeder Rücksicht auf mich oder andere. Widerstand war zwecklos, das Gefühl zu stark, um meinem überschäumenden Gemüt, meinem Herzen! zu befehlen. Einzig von Gottes Werk, dem Sternenhimmel, ließ ich mich leiten. Niemand anderem vertraute ich mein Schicksal an – so wie es die Weisen aus dem Morgenland getan hatten, und wie sie war ich von edler Herkunft. Warum wurde mir also verwehrt, was ihnen zugestanden wurde? Ich berief mich auf göttliche Führung durch den Lauf der Sterne, hin und wieder auch auf meine sorgsam erstellten Horoskope, die Gottes Wege zu ergründen suchten. Wehe dem, der daran etwas auszusetzen hatte. Er hätte Gott gelästert.
«Gnädiger Herr im Himmel, du hast mich zu dem gemacht, was ich bin. Hilf mir aus der Not, hab Erbarmen mit deinem Geschöpf. Jetzt!»
Doch Gott schwieg. Wie immer.
Ächzend zwang ich mich auf die Beine, humpelte hinüber zum kargen Stuhl und widmete mich wieder den Schriften – der einzigen Passion, die mir noch geblieben war, die mir niemand würde nehmen können.
Wie eine Mutter ihre Jungen verteidigte ich die alten, vergilbten Blätter gegen die Nachstellungen der Schwester Oberin, einer nimmermüden Schnüfflerin und Kerkermeisterin. Sie kannte jedes Versteck meiner kleinen Behausung, hatte sie schon zigmal inspiziert – bislang erfolglos, gottlob. Sie hatte keine Vorstellung von der Kraft einer Ertrinkenden, sie war die Schwäche und Phantasielosigkeit meiner Mitgefangenen gewohnt.
Und wenn sie mich dennoch eines Tages überraschte, würde ich ihr ein paar Seiten des Briefwechsels zwischen Abaelard und Heloise zum Fraß vorwerfen, die auf dem Katheder bereitlagen, während die anderen, wissenschaftlichen unter meinem Habit verschwanden. Ihr Verlust wäre nicht sonderlich schmerzhaft. An Abschriften, oder neuerdings an Drucken, der leidenschaftlichen, letztlich tragischen Liebesgeschichte eines Mönchs und einer Nonne bestand kein Mangel in diesem züchtigen Kloster für ungehörige Adelstöchter. Kein Gebet und keine Strafe konnten der Sehnsucht einer jungen Seele Einhalt gebieten. Auch das war ein unumstößliches Naturgesetz!
Wo immer eine Kirche stand, trieb der Teufel sein Unwesen.
Ich war fasziniert von derlei Weisheiten, berauschte mich regelrecht daran und würde nicht eher davon lassen, bis ich das letzte Geheimnis aufgedeckt hatte.
Wie ich allerdings dieses Monstrum von einer Weltchronik vor der Oberin verbergen wollte, blieb mir schleierhaft. Es war ein Kunststück, nicht minder eine teure Investition gewesen, den geplünderten, nur noch halb erhaltenen Folianten ins Kloster zu schmuggeln. An diesem Abend hoffte ich, von der Neugier der Oberin verschont zu bleiben, es drohte also keine Gefahr. Am nächsten Tag wollte ich ein geeignetes Versteck erkunden.
Bis dahin kostete ich vom Abenteuer und schwelgte beim Anblick der Karten und Bilder im Fernweh, selbst wenn ein Teil bereits durch Dummheit oder Not herausgerissen worden war. Wer konnte bei allem gesunden Menschenverstand überhaupt so einen Frevel begehen?
Jeder einzelne dieser fein gezeichneten Buchstaben führte geradewegs zu einer neuen, bislang unbekannten Erkenntnis. Ich las von der Erschaffung der Welt bis hin zum Sturz des Antichristen, der die Menschen mit seinen falschen Predigten verführte, und staunte über den gruseligen Frohgemut des Totentanzes. Jedes Bild offenbarte Menschen und Städte so fern und fremd, wie ich sie mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen konnte. Die Welt war größer und bunter als alles, was mir bisher erzählt worden war, und jede Karte zeigte den Weg dorthin auf. Hinaus in die weite Welt gehen, erkunden und erforschen, dem tristen Dasein entfliehen. Man … Ich! … musste nur den Mut aufbringen …
Warum nur war ich nicht als Mann geboren worden? Dann hätten sich diese Fragen nicht gestellt, es wäre gar von mir erwartet worden, nach Padua oder Bologna zu gehen, um Medizin zu studieren, nach Rom, Florenz, Paris und die vielen anderen Städte, in denen die Wissenschaften gefeiert wurden wie ein neues Glaubensbekenntnis. Ich blätterte weiter und stieß auf einen beigelegten Zettel. Ich öffnete ihn und staunte nicht schlecht.
Eine Sternenkarte! Darauf bekannte Gestirne und noch einige mehr, von deren Existenz ich bis dahin nichts wusste oder gar zu ahnen wagte. Und das sollte etwas heißen, schließlich war die Astrologie seit Kindertagen meine Leidenschaft, mein Elixier gegen Langeweile und Bevormundung – meine wahre Religion. Ich kannte den Sternenhimmel zu allen Jahreszeiten und dank der vielen Reisen mit meinen Eltern von unterschiedlichen Orten aus. Keine Nacht verging ohne Bettflucht und Blick in die glitzernde, unermessliche Tiefe des Weltenalls, meinen selbstgebauten Jakobsstab stets zur Hand, mit dem ich die Sterne und ihre Wege maß, daraus Erkenntnisse über den irdischen Lauf der Dinge gewann und zu verstehen suchte, wie der Wille und Plan Gottes lautete, was die Welt im Innersten zusammenhielt.
Doch welch wunderbares Rätsel hielt ich nun in der Hand? War es Zufall oder Fügung, sprach Gott endlich zu mir, nachdem er so lange geschwiegen, meine Gebete nicht erhört hatte?
Ich erkannte Kassiopeia und Perseus, Andromeda, Adler, Kepheus und noch einige weitere, wohlvertraute Gestirne auf dem verblassten Fetzen. Darauf folgten andere Gebilde, die sich gen Süden erstreckten, unfassbar und unendlich weit über die mir bekannten Grenzen hinaus. Fast so, als müsste man dazu auf die Unterseite der Welt wechseln, um sie zu sehen. Das war völliger Unsinn, denn dann … würde man kopfüber und haltlos ins Weltenall stürzen.
Zu meinen Fragen und Zweifeln gesellte sich schließlich Erheiterung. Natürlich, es handelte sich um den Scherz eines hinterlistigen Schlitzohrs, das sich über die Leichtgläubigkeit des Finders lustig machte. Ich gönnte ihm den Sieg ein paar quälende Augenblicke lang, doch dann gewannen erneut die Zweifel Oberhand. Die Positionen der Sterne waren viel zu präzise, um als beliebig oder unwissend zu gelten. Der vermeintliche Fälscher hatte sich große Mühe gegeben …
Schritte hallten auf dem hohlen Gang vor meiner Tür. Ich steckte die Karte zurück und schlug den Folianten zu, horchte und machte mich überstürzt dran, meinen mysteriösen Schatz zu retten.
Galten die Schritte überhaupt mir? Ungewöhnlich laut waren sie, fast schon verräterisch; die Oberin hätte es mir niemals so leichtgemacht, mich vorzubereiten. Und je näher die Schritte kamen, desto fiebriger suchte ich nach einem Versteck. Unter den Betschemel, in die Truhe meiner wenigen Habseligkeiten oder gar zwischen die Holzscheite? Wohin mit dem sperrigen Ding?
Unmittelbar vor meiner Tür verklangen die Schritte, Worte wurden gewechselt. Ich hatte keine Zeit zu verlieren und steckte das Buch kurzerhand unter die Bettdecke, eilte an den Katheder zurück und stürzte mich in die Leidenschaft von Abaelard und Heloise.
Eine Träne noch, wenigstens eine, vielleicht half es.
Die Tür ging auf.
«Margarete, du hast Besuch.»
Trithemius … Endlich!
Der Ton in der Stimme der Oberin ließ keinen Zweifel, dass ihr der Besuch nicht recht war. Doch gegen den hohen Gast aus dem Kloster Sponheim war kein Ankommen.
Ich tat überrascht, schniefte und ließ das Papier zu Boden sinken.
Noch bevor der ehrwürdige Abt die Zelle betrat, eilte die Oberin ihm voraus, klaubte es auf und ließ auch die beiden anderen auf dem Katheder hinter ihrem Rücken verschwinden, bevor sie sich einen Tadel einhandelte.
«Margarete …» Trithemius breitete die Arme aus und lächelte fürsorglich – so wie ein Hirte, wenn er eins seiner verlorenen Schäfchen wiederfindet.
Mit einem tiefen, dankbaren Seufzen nahm ich die Einladung an und flüchtete mich hinein. Trithemius, dich hat der Himmel geschickt. Wenn mich jemand aus den Irrungen meiner Eltern befreien konnte, dann war es mein treuer Beichtvater, der stets ein verständiges Ohr für mich hatte. Ich konnte mir keinen besseren wünschen.
«Oh, ehrwürdiger Abt», schniefte ich hörbar erlöst, warf aber auch einen Blick über die Schulter, wo die Oberin ihren Blick durch den Raum wandern ließ, «wie habe ich mich nach Euch gesehnt.»
«Nicht so stürmisch, Kind, die Schwester Oberin könnte auf falsche Gedanken kommen.»
«Sorgt Euch nicht deswegen, werter Abt», raunte die Oberin, und es klang nach einer Drohung, «ich weiß um die Sehnsüchte meiner Novizinnen. Sie währen nicht lange.» Ihr Blick fiel aufs ungemachte Bett.
Ich musste handeln und kam ihr zuvor. «Verzeiht, Schwester Oberin, meine Nachlässigkeit. Ich wollte gerade zu Bett gehen.» Ungeschickt warf ich die Zudecke auf, sodass die Umrisse des Folianten darunter verschwanden. «Ich hatte nicht mit Besuch gerechnet.»
«Zu dieser späten Stunde», bekräftigte sie murrend.
«Es wird nicht lange dauern», erwiderte Trithemius, «nun lasst uns allein.»
Ein widerstrebendes Seufzen der Oberin, ein stummer, erfolgloser Protest, dann folgte sie der Aufforderung. Am nächsten Morgen würde es wegen Abaelard und Heloise ein mahnendes Gespräch und eine Strafe geben, ich verlachte sie dafür. Dummes, eingebildetes Ding, du wirst meiner niemals Herr.
«Margarete», setzte Trithemius an, und ich schenkte ihm all meine Dankbarkeit mit einem strahlenden Lächeln, «deine Mutter bat mich, nach dir zu sehen.»
Eine Last fiel mir von den Schultern, meine Gebete waren also doch erhört worden. Bei Tagesanbruch würde mein Vater mich abholen, meine Mutter mich mit offenen Armen empfangen, die Stimme tränenerstickt und flehentlich ihren Irrtum bereuend. Meine Eltern hätten niemals aufgegeben, mich zu lieben, und ich würde ihnen die Absolution erteilen. Familienbande waren unzertrennbar, für die Ewigkeit geschmiedet.
«Ihr nehmt mich mit?» Ich warf mich ihm an die Brust. «Ich wollte schon nicht mehr daran glauben.»
Er aber schob mich zurück. «Beherrsche dich, Kind. Ich bin nur auf Bitten deiner Mutter gekommen …»
Mein Enthusiasmus schwand. «Nicht meines Vaters?»
«Er weiß nichts von meinem Besuch, und besser, er wird es nie erfahren. Ich will mir seinen Zorn nicht zuziehen.»
Kein Wunder, mein Vater war einer der einflussreichen Fürsten aus der Umgebung von Sponheim, wo der ehrwürdige Abt dem gleichnamigen Kloster vorstand. Mehr aber fürchtete Trithemius wohl, nicht mehr bei der lukrativen Deutung der Gestirne berücksichtigt zu werden, die mein Vater vor jeder wichtigen Entscheidung einholte.
Der Sternen Bahn weist den Weg zu Weisheit und Erfolg, nur ein unwissender Narr würde sich dem verschließen.
Dem konnte ich widerspruchslos zustimmen, nur, wo war mein Stern in dieser Nacht? Ich trat einen Schritt zurück, schluckte schwer, denn ich wusste, was das bedeutete. «Ihr seid also nicht meinetwegen gekommen?»
«Doch, ja, aber nicht nur. Ich habe morgen einen Disput in Heidelberg und nutze die Gelegenheit, deiner Mutter den Gefallen zu tun.»
Meiner Mutter. Nicht mir. Die Worte hallten in mir gleich dem höhnischen Gelächter der Oberin, wenn sie den Folianten entdecken würde. Ich fände keine Gelegenheit, ihn rechtzeitig zu retten.
Der drohende Verlust und die offenkundige Missachtung meiner flehenden Bitten stachen mir ins Herz, Tränen traten mir in die Augen, und unbändiger Zorn pochte auf der losen Zunge.
«Was wollt Ihr dann hier?!»
In Trithemius’ Reaktion spiegelte sich mein Furor, vermutlich hatte auch er längst die Hoffnung begraben, dass aus mir etwas Anständiges werden könnte. Die vornehme Blässe wich der Zornesröte. Er fuhr mich an, wie ich es zeit unserer Bekanntschaft nie bei ihm erlebt hatte, und das war sehr lange – er kannte mich seit meiner frühsten Kindheit.
«Mäßige dich, Weib!»
Trithemius hatte mich getauft, gefirmt und war der Hüter meiner Sünden und Geheimnisse im Beichtstuhl gewesen. Wenn mich jemand bis ins Innerste kannte, und das, lange bevor es meine Eltern taten, dann war es der für seine Klugheit und sein Wissen berühmte, weithin verehrte Abt vom Kloster Sponheim. Es gab keinen besseren weit und breit. In diesem Moment jedoch, in meiner größten Not und Verzweiflung, fühlte ich mich von ihm zurückgewiesen, seiner Obhut und Fürsorge beraubt, der Herde verstoßen.
«Ich will und ich werde es nicht! Niemals!» Ein Tritt gegen den Betschemel, das alte Ding knackte, und mein Fuß zahlte es mir mit Schmerzen zurück.
«Bist du des Teufels?», fuhr Trithemius mich an. «Schweig und bereue.» Er wies mich in die Ecke. Schwer atmend kam ich dem Befehl nach, auch mein Verstand beruhigte sich.
Grundgütiger, was hatte ich getan?
Ich musste mich beruhigen, mein überschäumendes Gemüt bezwingen, Trithemius war meine letzte Chance, hier rauszukommen. Ich warf mich ihm zu Füßen, küsste seine Hand.
«Verzeiht, ehrwürdiger Abt, verzeiht. Der Teufel muss in mich gefahren sein. Der Teufel … so helft mir doch.»
Er antwortete nicht, er ließ es geschehen, bis meine Tränen auf seine Hand fielen. Er zog sie zurück, ging ans Fenster und schaute durch die Gitterstäbe in die Dunkelheit – als würde er damit auf mein Schicksal blicken.
Der Sternen Bahn … allein, kein Stern wollte für mich einstehen.
«Du wirst dich fügen, so hat es mir deine Mutter aufgetragen. Es gibt kein Zurück, es ist deine letzte Chance.»
«Aber …»
«Schweig! Es ist ihr gemeinsamer Wille, dass du das Gelübde ablegst, demütig und fromm unserem Herrn Jesus Christus dienst …»
«Niemals!», und wieder gab es kein Halten mehr, ich rannte geradewegs ins Verderben.
«Andernfalls wollen sie dich nicht länger als ihre Tochter anerkennen …»
«Sollen sie, es schert mich nicht.»
«Du verlierst all deine Ansprüche, den Titel, das Auskommen …»
«Eine Last, ein Fluch ist es.» Ich spuckte es ihm entgegen.
«Vogelfrei … rechtlos, der Willkür schutzlos ausgeliefert.»
«Frei! Endlich frei!»
Er seufzte, ein langes Schweigen. «Dann kann ich nichts mehr für dich tun.»
Ich schäumte vor Wut auf diesen selbstgefälligen Pfaffen, das Sprachrohr meiner Peiniger, auf die Feigheit der Sterne. «Geht! Sagt meinen Eltern, dass ich ihnen nicht länger zur Last fallen werde, dass ich ihren wohlfeilen Namen nicht länger führen noch gebrauchen werde. Ich sage mich von ihnen los, will alles aufgeben und vergessen … es wird mein Schaden nicht sein.»
«Kind, du versündigst dich.»
«Eher gehe ich durch die Hölle, als mich ihrer Zucht noch länger zu unterwerfen.»
«Du bist im Fieber.»
«Nie war ich so klar wie jetzt. Niemand kann der Natur befehlen. Auch meine Eltern nicht.»
«Sie muss gezähmt werden, wenn sie überschäumt.»
«Wollt Ihr etwa Wind und Feuer befehlen? Dem Sternenlauf?»
«Du bist von Sinnen! Du lästerst Gott und seine Schöpfung.»
«Ihr tut es, nicht ich.»
«Du … du …»
«Ich bin nach seinem Ebenbild geschaffen, ich bin von seiner Art. Ich bin!»
Nie hatte ich Trithemius fassungslos, einer Antwort verlegen, ja, derart verloren gesehen wie in diesem Moment. Er rang um Worte. Ich gewährte sie ihm nicht.
«Und nun geht, lasst mich allein!»
Mein Befehl war unerschütterlich und der harsche Ton unzweifelhaft. Für einen langen Moment erwiderte er nichts, dachte nach, doch dann verließ er den Raum, als trüge er Schuld für meine Worte, meine Abkehr vom rechten Weg, mein Verderben … sein Versagen.
An der Tür machte er kurz halt, schien mit sich zu hadern, ob er mir einen letzten Rat geben sollte, ließ es dann aber sein – ich war nicht länger das gehorsame Kind, dem er mit Bibelsprüchen befehlen konnte. Ich war erwachsen geworden und er überflüssig.
Die Tür fiel ins Schloss, ich blieb mit dem Feuer in meiner Brust allein zurück. Niemals wieder würden sie mich auf die Knie zwingen, meinen Willen brechen. Das war ein für alle Mal vorbei.
Der Rausch der Erkenntnis trug mich in die anbrechende Nacht, ich zog die Weltchronik unter der Bettdecke hervor und blätterte selbstverloren darin, als sei nichts gewesen. Mit ihr reiste ich von Würzburg über Nürnberg nach München, überquerte die Alpen nach Genua, Bologna und Rom, traf auf meiner Traumreise andere Wissenschaftler, Künstler und Philosophen, diskutierte in allen Sprachen mit ihnen, feierte, tanzte und lachte. In Gedanken war ich frei und glücklich, höchste Zeit, es auch im wahren Leben zu sein.
Zum Morgengebet würde ich der Oberin meinen Entschluss mitteilen, den Habit abstreifen und auf große Reise gehen. Mit Gegenwehr rechnete ich nicht, die Kerkermeisterin dürfte froh sein, den rebellischen Floh endlich aus dem Fell geschüttelt zu haben.
So verstaute ich den Folianten unter meinem Bett und löschte die Kerzen, auf den Lippen mein neues Nachtgebet.
Mein Weg ist der des Gelehrten, nicht der Nonne.
Der Morgen warf bereits Licht durchs vergitterte Fenster herein, als ich jäh aus meinen Träumen gerissen wurde. Im schwarz-weißen Habit der Inquisition standen die Oberin und zwei ihrer Kerkerknechte in der Tür.
«In den Keller mit ihr!»
Ihre knochige, weiße Hand mit der Rute zitterte vor Erregung.
IIGeburtswehen
Auf den ersten Glockenschlag, immer mittwochmorgens um sechs Uhr, öffnete Schwester Frederica das Tor, um den Karren des Schlachters einzulassen. War er durch, verschloss sie es wieder und führte den Karren bis zur Küche an, wo sie das Abladen überwachte und sich den Inhalt der Töpfe zeigen ließ, sobald ihr etwas verdächtig vorkam.
Worte wurden währenddessen nicht gewechselt, es war ein eingespielter Vorgang, der nicht länger als zehn Perlen eines Rosenkranzes dauerte. Danach holperte der Karren mit leeren Töpfen zum Tor zurück. Frederica schloss auf, der Karren fuhr hindurch, und der Schlüssel drehte sich im Schloss.
Woche für Woche das gleiche Spiel. Tor auf, Karren rein, Abladen, Karren raus, Tor zu. Kein Floh hätte ungesehen durchschlüpfen oder sich in einem der Töpfe verstecken können.
Da war kein Durchkommen, nur ein Anfänger hätte sich daran versucht. Ich hatte die Idee längst aufgegeben, es musste einen anderen Weg geben. Bis ich ihn gefunden hatte, pries ich den Herrn und seine Schöpfung mit meiner Hände Arbeit. Halleluja! – unser aller, auch mein neues Credo.
Ich war seit vier Uhr auf den Beinen, hatte gebetet, die Gänge gefegt, Latrinen gereinigt, Brennholz herangeschafft, die Zuber mit heißem Wasser gefüllt, die schmutzige Wäsche eingeweicht und das Frühstück vorbereitet. Während wir auf den Glockenschlag und den Schlachter warteten, durfte ich beten, anstatt das schmutzige Geschirr in die Küche zu tragen und zu spülen, was ich mir durch meinen offensichtlichen Eifer verdient hatte. Die anderen waren damit beschäftigt, den Teig zu kneten und den Backofen anzuheizen, die Kleidung zu flicken, das Kleinvieh zu füttern, Scheren und Messer zu schleifen, eine gebrochene Winde instand zu setzen, oder sie kümmerten sich um die Gartenarbeit. Es wurde gesägt, gehämmert und geschwitzt. Wortlos, ohne Seufzer der Erschöpfung, ohne Protest gegen die Schinderei, demütig, aufopfernd und selbstvergessen. Alles im Dienste des Herrn …
Das wollte uns die Oberin glauben machen, die Herrin dieses Straflagers für ungehorsame oder abgeschobene Töchter aus hohem Hause. Nicht weniger war sie eine unerbittliche Zucht- und Kerkermeisterin, ihre flirrende Rute die Geißel eines wahrhaften Teufels, der weder Erbarmen noch Gnade mit den Verfehlungen einer Schwester kannte. Buße tun lautete das erste Gebot, es bedeutete nichts anderes als Schläge und Demütigung. Das zweite, Besinnung im stillen Gebet. Das dritte, bedingungslose Unterwerfung.
Es dauerte ein paar Wochen, bis sie glaubte, mir ihren Kanon eingeprügelt zu haben. Ich tat alles, um den Anschein zu wahren.
«Beeilt euch!», ermahnte uns Schwester Frederica, das nicht mehr frische Fleisch zu verarbeiten, es roch bereits und hatte die gesunde Farbe verloren, sodass ich mich zwingen musste, es überhaupt anzusehen. «Die Sonne kommt durch.»
Es würde ein heißer Tag werden, das Säubern, Pökeln und Abkochen durfte nicht länger warten. In den Töpfen brodelte derweil das Wasser, der Dampf stand zwischen uns und der Aufseherin. Ich ließ die scharfe Klinge über die Knochen rattern, schabte, schnitt und löste aus. Ekelhaft, ich würde mich nie daran gewöhnen.
Neben mir schwitzte Konrada, die verschmähte Tochter eines Grafen aus dem Rheingau, sie wollte mich unbedingt zur Freundin haben. Ich wusste nicht, warum, ließ sie aber in dem Glauben, dass sie mir vertrauen könne.
«Heute Nacht, wenn alle schlafen», flüsterte sie mir zu, «ist es so weit.»
«Was hast du vor?» Eine rhetorische Frage, um meine Ahnungslosigkeit zu unterstreichen und ihr das Gefühl zu geben, sie sei mir überlegen.
«An der Ecke zum Kreuzgang.»
«Du allein?»
Sie schüttelte den Kopf, schaute verstohlen zu Frederica, die am anderen Tischende stand und die Arbeiten beobachtete, Schwestern maßregelte und sie zu mehr Gewissenhaftigkeit aufforderte.
«Wer noch?», hakte ich nach.
«Philippa und Isidora.»
Ich nickte kurz.
«Bring ein Laken aus der Wäscherei mit.»
«Die Mauer?»
«Dieses Mal wird es gelingen.»
Würde es nicht, genauso wenig wie die anderen Male zuvor. Die Mauer war unüberwindlich und wurde vor allem ständig von der Oberin und ihren Adjutantinnen beobachtet. Genauso gut hätte man Kerzen aufstellen und mit Töpfen schlagen können, um die Flucht anzukündigen. Und schaffte man es dennoch auf den Mauergrat, so griff man dort in spitze, scharfkantige Steine, die die Oberin hatte anbringen lassen. Manch eine hatte es Finger oder gar die Hand gekostet, andere schlitzten sich die Bäuche auf.
Die Mauer war eine Falle, sie endete immer im Keller, wo die Oberin mit der Rute bereits auf die Bedauernswerten wartete.
«Traust du ihnen?», fragte ich.
«Philippa würde ich meine Unschuld anvertrauen.»
«Und Isidora?»
«Hat die Pferde organisiert.»
Damit war es entschieden: Konrada hatte ihre Unschuld schon längst an einen verführerischen Wandermusiker verloren, das war der Grund, warum sie hier war. Von Philippa wusste jede von uns, dass sie log und betrog, wie wir Gebete sprachen. Sie war ein selbstverliebtes, hinterhältiges Miststück, von der man sich erzählte, sie hätte ihren Beichtvater schon mit zwölf Jahren verführt. Und Isidora würde noch nicht einmal eine Hasenkeule auf dem Karren des Schlachters hereinschmuggeln können, so einfältig war sie.
Die ganze Sache war eine Falle, ich ließ mich nicht täuschen. Konrada stand im Dienst der Oberin oder Fredericas oder von wem auch immer und würde für eine Vergünstigung eine allzu vertrauensselige Schwester ans Messer liefern. Nicht mit mir, du Schlange.
«Ich werde da sein.»
Konrada nickte zufrieden, und ich wusste, wo ich in dieser Nacht sicherlich nicht sein würde.
Die Falle konnte mir jedoch zum Vorteil gereichen. Die Oberin und ihre Helferinnen würden sich in dieser Nacht auf den Kreuzgang und die Mauer konzentrieren, eine andere Fluchtmöglichkeit käme für sie nicht in Betracht.
Ich hatte lange darauf hingearbeitet, und wenn die Oberin geahnt hätte, wie sehr sie mir gerade half, hätte sie die Rute gegen sich selbst gerichtet.
Schmalz … was für ein wunderbarer, allseits unterschätzter Stoff, das Ergebnis eines einfachen, alchemistischen Prozesses, den jede Küchenmagd kannte. Allein, der Anwendungszweck würde sich vom Bekannten unterscheiden. Ich würde ein Töpfchen damit füllen und es unter dem Habit verschwinden lassen. Bis dahin sollte kein Stück Fett an diesem Knochen hängen bleiben, Frederica würde mit mir zufrieden sein.
Und dieses Mal zitterte ich vor Erregung.
Gemüse, Hirse und ein winziges Stück sehniges Fleisch, so zäh, dass selbst das stundenlange Kochen nichts daran geändert hatte – das war unser Mahl. Wir aber sollten der Schwester Oberin dankbar sein, für ihre Güte, Großzügigkeit und Liebe. Einen Dreck war ich.
Obwohl mein Magen knurrte, schob ich den Holzteller weg. Seit drei Tagen hatte ich nichts mehr gegessen, mich nur von Brühe und Gebeten ernährt, so wie jetzt: die Hände gefaltet, die Lippen stumm und demütig die Herrlichkeit unseres Schöpfers preisend.
Ich fastete, damit mein Geist rein wurde und der Körper nicht irdischen Zwängen unterworfen war, physikalischen. Vor allem achtete ich darauf, dass mich die Oberin im Blick hatte. Sie sollte sehen, staunen und zufrieden seufzen, welche Früchte ihre Zucht hervorgebracht hatte. Ich war dünn wie ein Schilfrohr geworden, ein Fähnchen im Wind ihres Regiments – aber auch geschmeidig und unzerstörbar. Zwei Seiten einer Münze.
Wer nur die Heilige Schrift las, wusste davon nichts. Er würde ein einfaches Naturgesetz als Wunder oder Teufelswerk betrachten – je nachdem, wie man es ansah. Die Oberin sollte beides erfahren, es war mein großzügiges Abschiedsgeschenk an sie und ihr Teufelsregiment.
«Warum isst du nichts?» Isidora, ein blasses, zerbrechliches Wesen, das erst seit ein paar Wochen den heiligen Geist des Klosters atmete, schaute mir nicht in die Augen, sondern auf meinen Teller. So leicht verriet man nicht seine Absichten, sie musste noch viel lernen.
Ich schob ihr das reiche Abendmahl mit einem seligen Lächeln zu, und natürlich entging es der Oberin nicht.
«Für mich?», fragte Isidora, von meiner Selbstlosigkeit überrascht.
«Selig sind die Hungernden und Dürstenden», säuselte ich schwesterlich.
«Aber …»
«Mach dir keine Gedanken und iss. Der Herr im Himmel speist mich zur Genüge.»
Kurz zögerte sie, dann seufzte sie und nahm den Köder an. «Vergelt’s Gott.»
Ich musste nicht aufschauen, ich spürte den Blick der Oberin. Als es genug war, lehnte ich mich zurück und flüsterte Isidora zu, die sich an dem zähen Stück abarbeitete. «Dafür bist du mir einen Gefallen schuldig.»
«Sicher … was immer du willst.»
«Wenn sich die Schwester Oberin nach dem Essen in ihre Kammer zurückzieht, folgst du ihr.»
«Was …?»
Ich nahm ihre Hand und drückte zu, dass sie hätte schreien wollen, wenn ihr das zähe Stück Fleisch nicht den Mund verschlossen hätte. «Nicht so laut.»
«Du … tust … mir weh!»
Den Griff lockerte ich nur ein bisschen, sie sollte an meiner Ernsthaftigkeit nicht zweifeln. «Du wirst der Oberin eure Flucht verraten.»
«Hast du den Verstand verloren?» Das war eindeutig zu laut und zu auffällig.
«Still, sie beobachtet uns.» Dabei machte ich ein entrücktes Gesicht, als ob alle Sanftmut der Welt in mich gefahren wäre. «Glaub mir, außer mir gibt es niemand in diesen Mauern, dem du vertrauen kannst.» Ich ließ los, sie seufzte erleichtert, verärgert.
«Das stimmt nicht. Konrada …»
«… wird euch in eine Falle locken.»
«Du lügst.»
«Sie hat es mir gestanden.»
«Was?»
«Sie will den Platz von Frederica einnehmen, dafür buhlt sie um die Gunst der Oberin.»
«Das glaube ich nicht.»
«Sie sagte mir im Vertrauen, du hättest Pferde für eure Flucht besorgt.»
«Ich?» Die dünnen Lippen formten ein überraschtes Lächeln, sicherlich nicht ganz frei von Stolz, dass man ihr so etwas Waghalsiges überhaupt zutraute.
Die Schmeichelei war noch immer die vollendete Form aller Lügen, ein Gift mit garantierter Wirkung. So hatte es mich meine Mutter gelehrt, die charmante und gewiefte Burgherrin, die meinen Vater in allen Dingen vertrat, wenn er auf Reisen war. Ich hatte in ihre Fußstapfen treten sollen, als sie noch die Hoffnung hegte, mich standesgemäß zu verheiraten.
«Du musst mir nicht glauben», fuhr ich fort, «das Gerücht reicht aus, um dich in den Keller zu bringen.»
Der Keller zog immer, bei jeder, gleich welchen Rang er im Gefüge einnahm.
Isidora wurde noch ein Stück blasser. «Ist das alles?»
Ich nickte. «Die Wahrheit wird dich vor Strafe schützen.»
Das sollte für Isidora genügen – die ermutigende Vorstellung von Wahrheit, Aufrichtigkeit und Treue, selbst dann, wenn man schon am Abgrund stand.
Eine Sache noch, ich drückte ihr einen Kieselstein in die Hand. «Wenn du ihre Kammer verlässt, leg das unauffällig in den Türspalt.»
Sie stellte keine Fragen und nahm ihn.
Damit blieb mir nur noch abzuwarten, demütig im Gebet versunken, und zu verfolgen, wie alles seinen vorausbestimmten Gang nahm. Jeder um mich herum hatte seine Aufgabe, und niemand ahnte, dass er mir damit in die Karten spielte.
Die Oberin hatte endlich fertig gegessen und erhob sich, die anderen taten es ihr gleich; das Abendessen war mit ihrem Rückzug aufs Zimmer beendet. Die einen räumten das Geschirr ab und spülten, die anderen gingen in ihre Kammern, um zu ruhen, bevor man sich gemeinsam zum Nachtgebet in der Klosterkirche traf.
Schwester Maria und ich waren für die anstehende Armenspeisung eingeteilt, eine ungeliebte Tätigkeit, musste man sich mit dem gottlosen, verlausten und nicht weniger gierigen Bettlervolk herumschlagen, das einem die Abfälle aus den Händen riss.
Konrada sollte sich um die Fütterung der Hühner kümmern und das Einsammeln der Eier. Durch meine Fehlinformation ging sie in die entlegene Wäschekammer, wo sie schwer zu finden war, sollte jemand nach ihr suchen.
In der Küche füllte ich Körbe mit altem Brot und Töpfe mit Brühe, danach trug ich sie in den Hof. Hoch über mir sah ich Isidora am Fenster stehen, wie sie sich gegen die bohrenden Fragen der Oberin zur Wehr setzte. Es würde ihr nicht gelingen, Misstrauen und Neugier waren Urgewalten, und die Oberin verlor darüber Verstand und Geduld. Gleich käme sie nach unten, ich würde sie an der Treppe zufällig treffen und ging los.
«Wo ist Schwester Konrada?», fuhr die Oberin mich hastig an.
«Im Zeughaus», antwortete ich beflissen.
«Was will sie dort? Um diese Uhrzeit?»
«Ich glaube, sie sucht nach einer Leiter.»
«Eine … Wofür?»
Die Antwort konnte ich mir ersparen, die Oberin ließ mich mit Isidora an der Hand und wehendem Habit stehen.
Jetzt galt es. Ich eilte die Stufen hinauf, die abgelegene Kammer am Ende des Gangs war mein Ziel. Sie war stets verschlossen und der Schlüssel in der Tasche der Oberin. Allein, die Furcht vor der Flucht eines ihrer Schafe ließ sie für das eine Mal überstürzt handeln.
Die karge, hölzerne Kammer war überschaubar: Bett, Schrank, Tisch, Stuhl und eine Truhe. Der Schrank enthielt nur Kleidung und Schuhe, blieb also die Truhe – und ein Vorhängeschloss. Der schwere Kerzenleuchter löste das Problem, offenbarte aber auch eine Überraschung – nun ja, nicht ganz. Es gab Gerüchte und Erklärungsversuche, wo Geld und Spenden geblieben waren, die zum Unterhalt des Klosters flossen. Jetzt hatte ich eine überzeugende Antwort gefunden.
Doch wegen der vielen Münzen und des feinen Geschmeides war ich nicht gekommen, ich wollte nur zurück, was mir gestohlen worden war. Auf den alten, zerfledderten Folianten konnte ich nicht mehr hoffen, auch nicht auf den Schmuck, den ich mit ins Kloster gebracht hatte und der mir abgenommen worden war. Und schon gar nicht auf meine vornehme Kleidung, die Bücher und Schriften … Nein, der einzige Grund für das irrwitzige Unterfangen, hier einzubrechen, war die alte, vergilbte Sternkarte, die ich im Folianten gefunden hatte. Sie würde die Investition in meine Zukunft als bedeutende Astronomin der neuen Zeit sein. Ich konnte nicht auf sie verzichten.
Die Oberin mochte ein elendes Miststück sein, eine Lügnerin und Betrügerin, ein sadistischer Folterknecht obendrein, ein Dummkopf war sie sicherlich nicht. Sie wusste von den Horoskopen, die sich Bischöfe, Päpste und Fürsten teuer erstellen ließen. Eine so detaillierte Sternkarte war bares Geld wert, manch einer hätte für sie gemordet. Ich jedenfalls, ohne mit der Wimper zu zucken.
Nur, wo war sie zwischen all dem nutzlosen Krempel zu finden?
Ich durchwühlte den Inhalt der Truhe, während die Rufe nach Konrada über den Hof gellten. Ich durfte keine Zeit verlieren, hätte schon längst an der Durchreiche für die Armenspeisung sein müssen. Aber ohne die Sternkarte würde ich nicht gehen, würde Züchtigung und Versklavung eher und länger ertragen, als diesen Schatz zurückzulassen.
Das konnte nur jemand verstehen, der die Macht eines Geheimnisses kannte, Wissen über Gold stellte … Oder jemand, der auf dem direkten Weg in die Hölle war. Auf mich traf das alles zu, auch wenn ich an eine Höllenfahrt noch nicht dachte.
Sie begann just in dem Moment, als ich die Sternkarte endlich zwischen Schuldverschreibungen, Schenkungen und einem seltsamen Flugblatt fand – darauf die Zeichnung von einem Mann mit lockigem Haar und gezwirbeltem Schnurrbart, finster dreinblickend und mysteriös.
Der berühmte Astrologe und Alchemist Doktor Georg Helmstetter …
Interessant. Ich würde später weiterlesen, steckte das Blatt zusammen mit der Sternkarte und meinem gestohlenen Geld nebst Zinsen in ein kleines Säckchen, meinen Wanderbeutel, und rannte die Stufen hinab auf den Hof. Mittlerweile war Konrada gefunden worden und musste sich an Ort und Stelle der Oberin gegenüber rechtfertigen, während mich die Klappe zur Armenspeisung – offen und verwaist – aufforderte, meinen Dienst zu tun. Hungrige, flehende Augen blickten herein. Sie würden gleich ein Kunststück erleben, wie sie es noch nicht gesehen hatten.
Ich streifte den Habit einer Gottesdienerin bis auf die nackte Haut ab – mein Gott, was war ich nur für ein dürres, unterernährtes Gerippe geworden. Meine Mutter hätte bei dem Anblick der Schlag getroffen, vielleicht hätte sie es sich ja noch einmal mit mir überlegt. Dafür war es nun zu spät, ich hatte meine Entscheidung getroffen. Es gab kein Zurück mehr, ich wäre nie wieder aus irgendeinem Keller freigekommen.
So nahm ich das Schmalztöpfchen aus dem Wanderbeutel, schmierte mich an Becken und Schultern ein, sodass Reibung und Widerstand mich nicht bremsen konnten.
Dennoch machte ich mir nichts vor: Es würde nicht so leicht vonstattengehen, wie ich es mir ausgerechnet hatte, es würde weh tun, und ich würde vor Schmerzen schreien.
So wie es eine werdende Mutter bei der Geburt tut.
Mir gefiel der Gedanke. Es war tatsächlich eine Geburt.
In ein neues Leben.
IIIDer Bundschuh
Die Arme ausgestreckt wie ein Adler die Flügel, die Nase im Wind und die Hölle hinter mir. Die Sonne wärmte mein Gesicht, ich hieß sie willkommen, öffnete ihr mein Herz.
Vor mir lag das weite Tal des Rheins. Aus voller Brust rief ich ihm entgegen.
«Wohin?!»
Worte konnten nicht beschreiben, was ich empfand. Ich drohte vor Glück zu zerspringen.
«Wohin?!»
Immer und immer wieder … bis mir die Stimme brach und ich vor Erschöpfung ins Gras plumpste. Am Himmel zogen dicke Wolkenberge auf, ein erfrischendes Bad im Regen käme gerade recht. Der Schmalz hatte sich mit Blut, Schweiß und meinem dünnen Hemd zu einer festen, stinkenden Einheit verbunden. Die Mücken waren darüber begeistert, ich ließ sie gewähren. Es gab ohnehin nicht viel an mir zu zehren, sie würden es bald einsehen und weiterziehen.
«Frei!» Was für ein unbeschreiblich großartiges Gefühl! «Endlich frei!»
Ich hatte es geschafft, war die Nacht hindurch gegangen, ohne zu rasten. Je weiter ich das Kloster hinter mir gelassen hatte, desto schwieriger war es geworden, dass sie mich finden würden. Und bei allen Teufeln, die Oberin würde nicht eher ruhen, bis sie es geschafft hatte. Nicht wegen des bisschen Gelds oder der Sternkarte, das würde sie verschmerzen. Ich hatte sie herausgefordert, überlistet und besiegt. Das würde an ihr nagen wie Ratten an ihrer verdorbenen Seele. Ich gönnte es ihr von Herzen. Sollte sie leiden und verzweifeln, wie ich unter ihrer Knute gelitten und vergeblich um Barmherzigkeit gefleht hatte.
Nie wieder Knecht sein! Nie wieder eine Gefangene!
Noch am Abend würde die Oberin einen Reiter zu meinen Eltern geschickt und um Verzeihung gebeten, aber auch Unterstützung für die Suche nach mir eingefordert haben. Meine Mutter würde die Sorge umtreiben, meinen Vater der Zorn, dass ich mich abermals seinen Befehlen widersetzt hatte. Seinem Willen! Ich spuckte darauf.
«Abgeschoben, eingesperrt und vergessen. Schande über euch … das einzige Kind zu verstoßen. In der Hölle sollt ihr dafür büßen. In der Hölle …»
Ich setzte mich auf, schlang die Arme um die zerkratzten Beine und schaute die Anhöhe hinunter. Im Tal floss der Rhein still und gemächlich dahin, darauf Boote und Schiffe der Händler und Fischer. Kommandos der Pferdeführer wehten zu mir herauf, die Rösser zogen an langen Leinen Schiffe rheinaufwärts. Eine elende Sklavenarbeit für Mensch und Tier, die meiner Tortur im Kloster glich – harte körperliche Arbeit unter der Knute eines Zuchtmeisters und Antreibers. Kloster und Schwestern wollten versorgt sein, für teure Handwerker gab es kein Geld.
Tiefe Erschöpfung hatte mich von Tagesanbruch bis in den Abend begleitet, die Arbeit wurde einzig durch das gleichbleibende Murmeln von Gebeten auf hartem Gestühl oder steinigem Boden unterbrochen – die Schmerzen in Knien, Rücken und Gelenken würden mich noch lange begleiten. Die Nacht hatte der Verzweiflung und dem Schmieden von Fluchtplänen gehört, bis um vier in der Frühe die Glocke zum Morgengebet geläutet und das Martyrium von neuem begonnen hatte.
Nach dieser Erfahrung brauchte ich mich meiner Entscheidung nicht zu versichern, das Richtige getan, mich von meinen herzlosen Eltern, meiner Heimat und einem Schicksal als unterwürfige Ordensschwester losgesagt zu haben. Ich hatte so viel Schmerz, Enttäuschung und Niedertracht erfahren, dass ich alles Recht der Welt besaß, mich aus den Ketten meiner Eltern und Peiniger zu befreien.
«Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist: Nie werde ich es bereuen, niemals! Und falls doch, der Himmel sei mein Zeuge, dann will ich auf der Stelle tot umfallen und in der Hölle schmoren. Dann habe ich es nicht anders verdient, dann war ich es nicht wert.» Drei Kreuzzeichen besiegelten meinen Schwur. «Auf die Freiheit! Auf ein neues, glückliches Leben!»
Das war der einzig richtige Weg, ich spürte Gewissheit und Kraft. Sie befahlen mich auf die Beine, ich streckte die Arme aus und holte tief Luft.
«Welt, wohin wirst du mich als Erstes führen?»
Alle Wege standen mir offen, es gab keine Mauern, verschlossenen Türen oder Tore mehr, nichts konnte mich aufhalten. Mein Wanderbeutel war mit Geld und Sternen prall gefüllt, mein Herz quoll vor Abenteuerlust über.
Ein Plan wäre hilfreich, was ich mit meiner Freiheit nun anstellen wollte.
Rheinabwärts gehen gen Worms und Mainz? Aus dieser Richtung würden die Häscher meines Vaters kommen.
Rheinaufwärts gen Karlsruhe und Straßburg, hinauf bis nach Freiburg? Ja, warum nicht?
In meinem Rücken gen Westen, wo ein weiter undurchdringbarer Wald lag? Vielleicht später.
Oder geradewegs der Nase nach, den Rhein überqueren. Heidelberg war nicht weit.
So viele Möglichkeiten, ich konnte mich nicht entscheiden.
Die Sternkarte … die Sterne würde mir den Weg weisen.
Was für ein verlockender Gedanke, ich war ein wenig stolz auf den Einfall. Ich holte die Karte hervor und betrachtete das Gewimmel aus Punkten, Bahnen und Positionen und wurde noch immer nicht schlau daraus. So viele unbekannte Sterne und Planeten. Wer hatte sie jemals gesehen und aufgezeichnet?
Was konnte ich mit ihnen jetzt und hier anfangen? Welchem Stern folgen, wem den Rücken kehren? Unmöglich, eine Entscheidung zu treffen, sollte das Los mein Schicksal bestimmen. Ich schloss die Augen, drehte mich im Kreise und gab mich meinem Gefühl hin.
Halt!
Kurz bevor ich zu stürzen drohte, öffnete ich die Augen. Vor mir der Rhein. Die Flussüberquerung also. Gut, dann los. Auf nach Heidelberg!