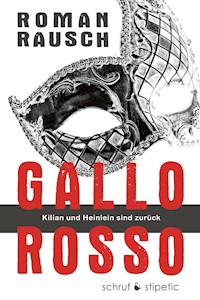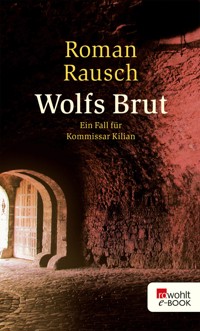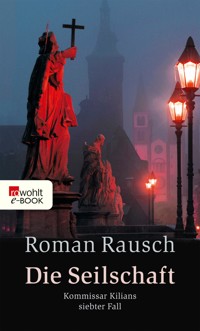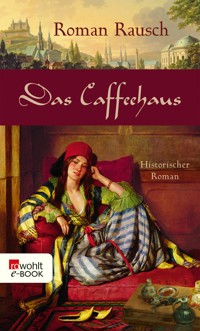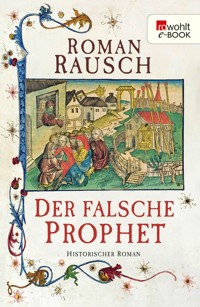7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wird Satan geboren, ist das Ende nah. Im Winter 1629 erreichen die grausamen Hexenverfolgungen in Würzburg ihren Höhepunkt: Die Stadt versinkt im Chaos. Als ein blutroter Komet am Himmel zerbirst, scheint das Ende der Welt gekommen. In ebenjener Nacht stirbt Kathis Mutter im Kindbett. Nun muss sich die Elfjährige um das lang ersehnte Brüderchen kümmern, das ein auffälliges Muttermal trägt. Antonius und Crispin, Gesandte des Papstes aus Rom, wissen um die Bedeutung des fallenden Sterns: Er ist das Zeichen für die Ankunft des Antichrist. Eine tödliche Seuche, die nur Gottesfürchtige dahinrafft, scheint die Prophezeiung zu bestätigen. Und es beginnt eine erbarmungslose Hetzjagd nach dem Teufelskind, die Kathi und ihren Freunden alles abverlangt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Roman Rausch
Die Kinder des Teufels
Historischer Roman
Über dieses Buch
Wird Satan geboren, ist das Ende nah.
Im Winter 1629 erreichen die grausamen Hexenverfolgungen in Würzburg ihren Höhepunkt: Die Stadt versinkt im Chaos. Als ein blutroter Komet am Himmel zerbirst, scheint das Ende der Welt gekommen. In ebenjener Nacht stirbt Kathis Mutter im Kindbett. Nun muss sich die Elfjährige um das lang ersehnte Brüderchen kümmern, das ein auffälliges Muttermal trägt. Antonius und Crispin, Gesandte des Papstes aus Rom, wissen um die Bedeutung des fallenden Sterns: Er ist das Zeichen für die Ankunft des Antichrist. Eine tödliche Seuche, die nur Gottesfürchtige dahinrafft, scheint die Prophezeiung zu bestätigen. Und es beginnt eine erbarmungslose Hetzjagd nach dem Teufelskind, die Kathi und ihren Freunden alles abverlangt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Dezember 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Lektorat Tobias Schumacher-Hernández
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
(Foto: akg-images; Christie’s Images/Corbis; thinkstockphotos.de)
Der Stich stammt aus «Würzburg. Bilder einer alten Stadt» von Walter M. Brod und Gottfried Mälzer (1987)
ISBN Buchausgabe 978-3-499-26080-3 (1. Auflage 2012)
ISBN 978-3-644-48041-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Motto
Abbildung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Epilog
Anmerkungen und Danksagung
Anhang
«Wenn man den Teufel nennt, kommt er gerennt.»
Sprichwort
Prolog
Rom, in einer kalten Winternacht 1629
Das Ende nahte als Zeichen am Himmel.
Im Inneren des Kometen strahlte es hell und rein, wie man es von einem Himmelskörper seiner Größe und Pracht erwarten konnte. Er zog einen goldglitzernden Schweif hinter sich her, der einer funkenstiebenden Lunte glich.
Die meisten Bewohner Roms schliefen schon zu dieser späten Stunde. Ihnen entging eine Verheißung, wie sie die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland erfahren haben mussten. Der Stern von Bethlehem hatte ihnen den Weg zum langersehnten, neugeborenen Messias gewiesen – allerdings auch zu einer äußerst schäbigen Behausung, die sie so nicht erwartet hatten. Zweifel an der Himmelserscheinung waren ihnen nicht gekommen, zumindest war in den Schriften nichts überliefert. Für die Weisen stand fest: Dieser Stern ist einzigartig. Man musste ihm folgen, um zu erfahren, welches Geheimnis er offenbarte.
Auch dieser Stern über Rom war mit anderen Kometen, die in manchen Nächten zu Hunderten den Himmel kreuzten, nicht zu vergleichen. Sein hell strahlender, makelloser Körper war eingefasst von einem roten Ring, blutgleich und unheilverkündend. Wer auf sein pochendes Herz hörte, mochte in ihm das Auge des Teufels erkennen.
Pietro Gabani, Galileis aufmerksamer, aber auch schwer zu durchschauender Hausdiener, schlich im Schutze der Nacht durch die Straßen der Ewigen Stadt. Er wollte nicht erkannt werden und zog die Kapuze seines Umhangs tief ins Gesicht. Er kannte Galileis sorgsam gehütetes Geheimnis – das Ergebnis seiner Berechnungen über die Laufbahnen der Himmelskörper. Es stellte die Sonne ins Zentrum des Universums und machte aus der Erde einen beliebigen Stern unter Myriaden von anderen.
Das war an sich nichts Neues. Giordano Bruno und Kopernikus hatten dies schon lange vorher behauptet, auch Aristarch, ein Himmelskundiger des antiken Griechenlands, wusste bereits um die Sonne als Zentrum des Universums. Nun aber machte sich einer der berühmtesten Astronomen der Welt daran, dies auch wissenschaftlich zu beweisen.
Papst Urban, ein Förderer der Wissenschaften, würde das nicht zulassen dürfen. Zum einen, weil die Kirche ihre Vorherrschaft über die Deutung der Schöpfung Gottes verlieren würde, und zum anderen, weil Urban zum Lügner gemacht würde. Die Erde musste im Zentrum allen Denkens und vor allem des Glaubens bleiben. Jeder hatte sich dem unterzuordnen, auch die Wissenschaften.
Giordano Bruno hatte für die Blasphemie bereits mit dem Leben bezahlt, Kopernikus’ Schriften waren geächtet. Und nun verabschiedete sich ausgerechnet noch Galilei, von Papst Urban gefördert und bewundert, aus dem Kreis der Gläubigen und riskierte, als Ketzer angeklagt zu werden.
Pietros Stiefelabsätze klackten verräterisch laut auf den blank gewetzten Steinen der Straßen hin zur Piazza del Sant’Uffizio, dem Sitz der Kongregation der römischen und allgemeinen Inquisition. Pietro wusste, dass Bruder Crispin – ein überzeugter Anhänger der wahren Lehre und ein nicht minder strenger Dominikaner – noch wach sein würde. Ein Fenster in der ersten Etage des dreigeschossigen Gebäudes war erleuchtet. Crispin würde wie immer über den Berichten seiner Kundschafter sitzen, um jedem Irrglauben frühzeitig auf die Spur zu kommen.
Pietro klopfte am Portal des mächtigen Hauses. Auch beim zweiten und dritten Mal wollte ihm niemand öffnen. Dabei sollte die Tür Tag und Nacht mit einer Wache besetzt sein. Kundschafter wie er kamen im Schutz der Nacht und nicht zu den täglichen Öffnungszeiten.
Schließlich hörte er ein Schlurfen und Schnauben jenseits der Tür. Der Durchguck öffnete sich, ein verschlafener Wachmann blickte ihn an.
«Was willst du?», knurrte er.
«Ich habe Nachricht für Bruder Crispin.»
«Und wer bist du?»
Diesem Niemand würde er sicherlich nicht seinen Namen verraten. Womöglich würde sein nächtliches Erscheinen im Wirtshaus diskutiert und Galilei zugetragen. Nein, das musste anders gelöst werden.
Pietro beugte sich vor und flüsterte:
«Sag Bruder Crispin, dass ich wichtige Nachricht für ihn habe. Es eilt.»
«Gib dich zu erkennen oder scher dich davon, bevor ich dich in den Kerker werfe.»
Missmutig schlug er ihm die Klappe vor der Nase zu.
Pietro machte ein paar Schritte zurück, blickte hinauf zum erleuchteten Fenster und wollte schon nach Crispin rufen, als er einen hellen Schein über dem Dach der Glaubenskongregation erkannte.
So etwas hatte er noch nie gesehen. Ein Stern drohte auf die Erde zu stürzen, sein Schweif strahlte golden und erstreckte sich weit bis hinter die Kolonnaden am nahen Petersplatz. Am Rand dieser hellen Kugel glühte und waberte es rot, als sei Blut ausgetreten.
Pietros Hals wurde trocken und seine Brust eng. Der Atem stockte ihm. Er musste Schutz suchen, schnell, bevor ihn das Ding zerschmetterte. Er lief davon, stolperte, rappelte sich wieder hoch und hörte nicht, wie ein sichtlich erzürnter Crispin auf den Platz kam.
«Pietro, komm herein, schnell, bevor dich jemand sieht.»
Doch Pietro war nicht mehr zu halten. Er verschwand in der Dunkelheit der nächsten Gasse.
Crispin folgte ihm ein paar Schritte, aber es war vergebens. Der Hasenfuß war über alle Berge.
«Hochwürden, so seht doch, dort am Himmel …», rief der Wachmann.
Crispin drehte sich um und sah den Wachmann zum Himmel zeigen.
Aus der Schwärze der Nacht blickte ein Auge auf ihn herab, bedrohlich nahe und blutumrandet, wie er es noch nie gesehen hatte.
«Heilige Mutter Maria …» Er schlug das Kreuzzeichen.
Was um alles in der Welt war das, und wo war es hergekommen?
Aber noch wichtiger: Was bedeutete es?
Er lief zurück hinter die schützenden Mauern der Kongregation.
«Verschließ das Tor!», rief er der Wache zu, eilte die Treppe hinauf in sein Dienstzimmer und öffnete eine Truhe, die verborgen in einer Ecke stand.
Darin befanden sich Bücher, gebundene und kunstvoll verzierte, wissenschaftliche und ketzerische Traktate, aber auch die Schriftrollen mit Siegelbändchen. Er sah sie durch nach dem einen Dokument, das ihm erklären konnte, was er da eben am Himmel über Rom gesehen hatte. Als er es endlich in den Händen hielt, ging er schnell an den Schreibtisch und öffnete das Siegel. Mit zittrigen Fingern und bebenden Lippen folgte er Buchstabe für Buchstabe der alten Verheißung, die ihm aus dem Wüstensand des Heiligen Landes zugetragen worden war.
Die aramäischen Schriftzeichen kannte er gut, er wusste sie zu entziffern und zu deuten:
Und es treten Ströme Belials über alle Heere, wie Feuersglut vom Himmel herab, die verzehren, um zu vernichten … Und sie breiten sich aus in lodernden Flammen, bis dass verendet jeder, der von ihnen trinkt.
Viele Straßenzüge weiter, im armen und vorwiegend von Ausländern bewohnten Stadtteil Trastevere, unweit der Piazza Santa Maria, drang ein erschöpftes Stöhnen in die Nacht. Eine junge Frau krümmte sich vor Schmerzen auf dem Bett. Um sie herum hingen Kruzifixe und Kräuter von der Decke herab. Der Geruch von Weihrauch lag in der Luft.
Die Augen der Frau waren geschlossen. Ihre Haut war bleich, im Kerzenschein schimmerte sie grünlich. Arme und Beine waren übersät mit Wunden, aus denen ein übelriechendes Sekret quoll.
Zu ihrem eigenen Schutz war sie mit Riemen an den Eckpfosten des Bettes festgebunden. Der Fieberwahn rüttelte und zerrte an ihr. Fuß- und Handgelenke bluteten.
In ihr Stöhnen mischten sich unbekannte und besorgniserregende Laute, gleich einem an- und wieder abschwellenden Gurren, als wollte sie die Vergiftung durch Brust und Kehle aus dem Körper pressen.
An der Seite der Bedauernswerten saß Bruder Antonius, ein beleibter Jesuit mit roten Wangen. Auf seiner Stirn reihten sich Schweißtropfen auf. Es war warm in diesem Raum, überraschend warm sogar. Das konnte nicht allein von den Kerzen kommen. Eine andere Macht war anwesend.
Antonius hielt die Augen geschlossen und betete gegen diese vertraute Macht an. Es schien zu gelingen, denn durch das offene Fenster schwappte kühle Nachtluft herein. Sie verschaffte ihm Erleichterung und die Gewissheit, mit dem Gebet die stärkste aller Waffen in den Händen zu halten.
Doch die Schlacht war noch nicht geschlagen. Er hörte ein Knarzen. Die Riemen gerieten wieder unter Spannung. Antonius erhob sich, schritt vorsichtig ans Bett. Die Frau bäumte sich auf. Aus weit aufgerissenen Augen starrte sie auf das Holzkreuz, das um seinen Hals hing. Sie spuckte darauf, würgte und riss an den Riemen.
Antonius nahm ein Büschel Kräuter, tauchte es in den bereitstehenden Weihwasserkessel und benetzte damit ihre Stirn. Er schlug das Kreuzzeichen.
«Im Namen und in der Kraft unseres Herrn Jesus Christus beschwöre ich dich, unreiner Geist …»
Die Frau stöhnte auf. Mit wirrem Blick sagte sie fremde Worte mit wollüstiger Stimme. Es war, als spräche jemand anderes aus ihr, jemand, der so gar nichts mit diesem mitleiderregenden Wesen und seinem geschundenen Körper zu tun hatte.
Antonius ließ sich nicht beirren. «… wer immer du bist, jede satanische Macht, jeder höllische Feind, jede teuflische Legion, Schar und Rotte: Reiß dich los und entferne dich von der Kirche Gottes und von den Seelen, die nach seinem Ebenbild erschaffen und durch sein kostbares Blut erlöst wurden.»
Die Worte zeigten Wirkung. Die Frau schrie und bettelte, dass ihr die Fesseln gelöst würden. Doch das konnte er nicht tun. Stattdessen ging er zum Fenster. Nicht alle mussten vom Elend dieser Frau erfahren. Er fasste den Griff, verharrte aber mitten in der Bewegung.
Über dem geheiligten Petersdom sah er einen gewaltigen Stern, der einen langen goldenen Schweif nach sich zog. Sein Körper war eingefasst in einen roten Ring. Noch nie hatte Antonius Ähnliches gesehen … aber wie jeder gute Christenmensch darüber gelesen.
Hinter ihm bäumte sich die Frau auf, schrie lauter und verstörender als zuvor, um schließlich aufs Bett zu fallen und nicht mehr zu atmen.
Antonius schlug das Kreuzzeichen. «Herr, erbarme dich dieser armen Seele … und gib mir Kraft, die Prüfungen zu bestehen.»
Würzburg
Der Schrei ging Kathi durch Mark und Bein. Ihre Mutter Helene lag rücklings auf dem Tisch und presste, wie es die Hebamme von ihr verlangte. Schreien, pressen, schreien, pressen. Ein zermürbender Kreislauf.
«Nicht aufhören», bekräftigte Lioba, die Hebamme, «gleich ist es so weit.»
Kathi bezweifelte das. In den frühen Stunden des vergangenen Tages hatten die Wehen eingesetzt. Seitdem waren über zwanzig Stunden vergangen, ohne dass ihre Mutter von den Qualen erlöst worden war. Wie lange würde sie diese unmenschlichen Schmerzen ertragen?
Kathi war mit so viel Vorfreude in den Tag gegangen. Bald würde sie nicht mehr alleine sein, bald würde sie stolz ein Schwesterchen oder – wenn ihr Wunsch in Erfüllung ging – ein Brüderchen in den Armen halten.
Nie wieder alleine. Was für ein Geschenk.
Lioba war nicht minder besorgt. Kathi sah es ihr an. Allerdings aus anderen Gründen, als sie dachte. Lioba hatte mehr Angst um den Verdienstausfall als um die Gesundheit von Mutter und Kind. Während sie hier vergeblich den Balg dieser Hure auf die Welt zu bringen versuchte, würden ihre Konkurrentinnen in einem anderen Haus mit Golddukaten bezahlt – zum Dank für die erfolgreiche Geburt eines Statthalters. Hier konnte sie froh sein, wenn sie ein paar Kreuzer sah.
Wieso hatte sie sich nur darauf eingelassen? Jeder wusste, dass dieses Kind keinen anständigen Vater besaß. Der war schon vor Tagen verschwunden. Wahrscheinlich, weil er sich vor der Geburt des Bastards in Sicherheit bringen wollte.
Die Nachbarn hatten Verdächtiges über dieses Haus berichtet. Von maßloser Völlerei war die Rede, von Lachen und Heiterkeit, sogar von Tanz und Gesang, während die Stadt hungerte, die Glocken zur Totenmesse läuteten und die Hexenweiber nachts zum Schalksberg ausfuhren.
Welch schändliches, verdorbenes Verhalten.
«Pressen!», fuhr Lioba Helene an. «Wenn wir das nicht bald zu Ende bringen, wirst du deinen Balg alleine zur Welt bringen müssen.»
Helene nahm die Drohung ernst. Mit aller Gewalt drückte und presste sie in den Unterleib. Ihr Gesicht wurde puterrot, das Blut schoss in angeschwollenen Adern nach unten in Bauch und Becken, um endlich die Frucht ihrer tragischen Liebe in die Freiheit entlassen zu können.
Doch von Freiheit konnte nicht die Rede sein.
Kathi kannte die Gerüchte, die seit Wochen durch die Stadt gingen. Der Teufel gehe in ihrem Haus ein und aus, in Gestalt von Christian Dornbusch, dem ehemaligen Stadtrat, dessen erste Frau sich noch vor der Hexenanklage das Leben genommen hatte. Nun habe er sich mit dieser Hure, deren verschwundener Mann den Bischof bestohlen und deren Tochter die Kinderhexen angeführt hatte, zusammengetan.
Was konnte man von dieser teuflischen Beziehung schon anderes erwarten? Wohl kaum mehr als einen weiteren Teufel oder eine weitere Hexe, die die Stadt und ihre Bürger vergiftete.
Die Stimmung war brenzlig. Wie immer hatte das Elend den Bürgern die Sinne vernebelt. Das Hexenverbrennen hatte wieder begonnen, schlimmer und grausamer als je zuvor. Niemand war vor den Hexenkommissaren des Bischofs mehr sicher. Jeder anständige Mensch konnte in Verruf geraten, und tatsächlich, viele Hochwohlgeborene, Ritter, Professoren und Stadträte, Kinder, Alte und Gebrechliche landeten schneller auf dem Scheiterhaufen, als in der Kirche Fürbitten für sie gesprochen werden konnten.
Und nun war Christian Dornbusch verschwunden. Niemand wusste, wo er sich aufhielt, niemand wollte es wirklich wissen, außer Kathi und Helene. Sie waren auf die wenigen Lebensmittel angewiesen, die er auf dem Land noch auftreiben konnte. Er war ihr Retter in der Not.
«Na endlich», seufzte Lioba erleichtert. Sie stand zwischen Helenes gespreizten Beinen. «Ich kann den Kopf schon sehen.»
Kathi, die die ganze Zeit an Helenes Seite stand und ihr die Hand hielt, spürte den Impuls, auf die andere Seite des Tisches zu wechseln. Sie wollte mit eigenen Augen die Ankunft ihres Brüderchens sehen. Aber der feste Handgriff Helenes ließ es nicht zu.
«Nicht nachlassen. Der Kopf ist schon zur Hälfte da.»
Helene schnaufte, presste und schrie. Schnaufte, presste … und dann passierte es.
Etwas platzte auf, riss eine tiefe Wunde. Ein Schwall Blut ergoss sich aus ihrem Unterleib. Helene schrie markerschütternd auf.
«Verdammt, auch das noch.»
Der Ton in Liobas Stimme klang besorgniserregend. Die Kraft wich aus Helenes Hand.
«Was ist geschehen?», fragte Kathi.
«Nichts.»
Aber natürlich war etwas geschehen. Kathi blickte in die leeren Augen ihrer Mutter. Sie starrten nach oben, an die von Kerzenrauch geschwärzte Decke.
«Mutter, was ist mit Euch?»
Sie erhielt keine Antwort.
«So sprecht doch mit mir … Mutter!»
Kathi legte ihr die Hand auf die Brust. Da bewegte sich noch etwas. Sie atmete. Gott sei es gedankt.
«Hol einen Arzt», befahl Lioba. «Nein, besser einen Priester.»
«Ist sie …»
«Widersprich mir nicht! Es geht zu Ende mit ihr.»
«Unmöglich. Sie atmet.»
«Jetzt tu endlich, was ich dir gesagt habe, du unnützes Gör!»
Doch Kathi blieb. Sie beugte sich über ihre Mutter, nahm ihr Gesicht in die Hände, beschwor sie: «Mutter, was ist mit Euch? Schaut mich an. Ich bin es, Kathi.»
Aber Helene reagierte nicht, obwohl sie noch atmete.
«Sie verblutet», sagte Lioba kühl. «Innerlich.»
Kathi keifte voller Zorn zurück. «Woher wollt Ihr das wissen?!»
«Weil ich das nicht zum ersten Mal sehe», bellte Lioba aufgebracht.
«Niemals. Ihr irrt Euch.»
Lioba zuckte die Schultern. Letztendlich war es ihr egal, was dieses verdorbene Ding sagte. Hauptsache, sie würde ihr den verdienten Lohn für diese Teufelsarbeit zahlen.
Eine Entscheidung galt es jedoch zu treffen.
«Willst du das Kind haben?»
Kathi war wie vor den Kopf gestoßen. «Was … meint Ihr?»
«Ich fragte: Willst du das Kind haben? Entscheide dich. Jetzt.»
«Natürlich», erwiderte Kathi fassungslos. «Was denn sonst?!»
«Das wird zehn Kreuzer mehr kosten.»
«So viel Ihr wollt», schrie Kathi zurück, «aber lasst meine Mutter nicht sterben!»
Lioba schüttelte verständnislos den Kopf. Dann packte sie beherzt zu. Mit der einen Hand den Kopf des Kindes, mit der anderen …
Helene bäumte sich auf, die Augen weit aufgerissen. Sie wollte schreien, doch der Schmerz schnürte ihr die Kehle zu.
«Mutter!»
Als sei alles Leben aus ihr gewichen, fiel sie zurück, gefolgt von einem Schrei vom anderen Ende des Tisches.
Kathi fuhr herum. Sie sah ein Kind, blutüberströmt und kopfüber von den Händen einer herzlosen Hebamme hängend.
«Es ist ein Junge», sagte Lioba mit Blick auf sein Geschlecht.
Aber da war noch etwas anderes auf dem Oberschenkel des Kindes. Sie konnte es nicht genau erkennen, die Kerzen brannten ab. Es war ein Fleck, mehr ein Mal, das es am linken Bein trug. Seltsam geformt war es, in sich gewunden wie die Blätter einer Rose.
Sie nahm eine Kerze, hielt sie über das Bein des Jungen und suchte zu ergründen, um was es sich handelte.
6 …
Sie schreckte zurück, ließ das Kind fast fallen.
Um Himmels willen. War das eine … Zahl?
«Gib ihn mir!»
Kathi stand vor ihr, streckte ihr fordernd die Hände entgegen.
«Jetzt, sofort.»
Es war spät, Lioba war hungrig, durstig und müde. Das Mal sollte nicht ihr Problem sein, wenngleich es schon sehr merkwürdig war. Sie wickelte das Kind in ein Tuch und drückte es Kathi in den Arm.
«Und nun meinen Lohn.» Sie hielt fordernd die Hand auf. «Auf der Stelle.»
Kathi ging hinüber zum Schrank und öffnete die Schatulle. Sie griff hinein, ohne zu wissen, wie viel sie packte, und reichte es Lioba.
Ein Blick genügte. Sie war zufrieden.
«Schick nach einem Priester. Vielleicht kann er für die verlorene Seele deiner Mutter noch etwas tun.»
Kathi antwortete nicht. Sie wandte sich von diesem herz- und gottlosen Menschen ab und ihrer Mutter zu. Hinter sich hörte sie Lioba die Türe schließen und die Treppe hinuntersteigen.
«Schau, Mama», sagte sie zärtlich und zeigte ihr das Kind, «das ist unser neuer Mann im Haus.»
Mama.
Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie es gewagt, ihre Mutter so zu nennen.
«Ist er nicht wunderschön?»
Helene reagierte nicht. Ihr Blick hatte sich im Nichts verloren, ihre Brust hob sich nicht mehr. Sie war tot.
«Ich werde ihn Michael nennen, so wie der heilige Michael, der Erzengel. Was hältst du davon?»
Kathi schaute Helene erwartungsvoll an, und als keine Antwort kam, ging sie von ihrer Zustimmung aus.
«Michael. Eine gute Entscheidung.»
Sie schniefte und wiegte ihren Bruder Michael in den dünnen Armen. Sie summte dabei ein Lied, das ihre alte Amme Babette immer gesungen hatte. Die Worte waren ihr abhandengekommen. Was zählte, war die Liebe in der Melodie.
Gott habe dich selig, dachte sie. Und Mama auch.
Lioba hastete heimwärts. In der Tasche klapperten Münzen. Sie gluckste zufrieden und zog den Umhang fest an ihren Körper. Diese dumme Gans hatte ihr tatsächlich den Lohn von drei Tagen gegeben. Wäre es doch immer so einfach.
Es war eiskalt. Die Luft schnitt ihr in Kehle und Brust. In den Gassen hielt sich zu so später Stunde niemand mehr auf. Selbst der Nachtwächter hatte sich hinter dem warmen Ofen verkrochen.
Unter ihren Füßen knirschte der gefrorene Schnee. Sie musste achtgeben. Pfützen hatten sich in spiegelglattes Eis verwandelt. Ein gebrochener Fuß oder ein verletzter Arm waren das Letzte, was man sich in diesen Tagen einhandeln sollte. Medizin war knapp geworden. Im Krankenhaus der Stadt herrschte blankes Elend und eine unvorstellbare Not. Gesund bleiben war das Gebot der Stunde.
Lioba hatte gerade die nächste Hausecke erreicht, als etwas Sonderbares ihre Aufmerksamkeit erregte. Die Hauswand des gegenüberliegenden Franziskanerklosters wurde vom Mondlicht seltsam hell angestrahlt, derart, als würden Fackeln ihr Licht darauf werfen.
Sie blickte nach oben und erschrak.
«Gütiger Gott …»
Sie nahm die Beine in die Hand, schlitterte und glitt auf dem gefrorenen Boden dahin. Mit letzter Kraft schaffte sie es hinüber zur Pforte des Klosters und klopfte so lange gegen das schwere Holztor, bis ihr geöffnet wurde.
Ein ebenso verstörter wie verschlafener Bruder gähnte sie an. «Was willst du so spät in der Nacht?»
Lioba deutete stumm nach oben.
Es dauerte einen Moment, doch dann reagierte der Mönch umso schneller. Er eilte zurück und weckte seine Brüder. Einer nach dem anderen torkelte schlaftrunken auf die Straße.
Fassungslos starrten sie zum Himmel, schlugen Kreuzzeichen und murmelten. Einer fiel auf die Knie, reckte die gefalteten Hände in die Höhe und flehte um Vergebung seiner Sünden.
Ein anderer warnte. «Satan wird in dieser Nacht neu geboren. Rettet euch, Brüder. Lauft um euer Leben.»
Lioba merkte auf. «Satan?»
Die Brüder verstreuten sich um Hilfe flehend in alle Richtungen. Nur einer bezwang die Angst, Bruder Jakobus.
«So steht es geschrieben: Es wird der große Drache – Teufel und Satan genannt, der den ganzen Erdkreis verführt – auf die Erde geworfen. Mit ihm seine Engel. Die ganze Teufelsbrut.»
Auch Lioba kannte die Heilige Schrift, nicht so gut wie ein Mönch, aber das Wichtigste war ihr präsent. Sie erinnerte sich an eine andere Textstelle.
«Aber heißt es nicht auch, dass der Teufel aus dem Schoß einer Hure geboren wird?»
«Ja, einer Hure. Aber was treibt dich um, Weib, dass du so besorgt redest?»
«Ich komme soeben aus einem Haus», stotterte sie, «einem verfluchten, in dem ein liederliches Weib, eine Ehrlose, einen Wechselbalg geboren hat. Starke Schmerzen haben sie begleitet. Stärker als normal. Und das Kind …» Sie schlug vor Schreck die Hand vor den Mund.
«Was ist mit ihm?»
«Es trägt ein Mal.»
Jakobus horchte auf. «Welcher Art?»
«Es ist … seltsam geformt. Es sieht aus wie eine Zahl.»
«Wie lautet sie?»
«Ich weiß es nicht. Es war dunkel und …»
«Führ mich zu dem Haus.»
«Nicht um alles in der Welt.»
«Komm jetzt.»
Er fasste sie fest am Arm und führte sie fort.
Über ihnen erstrahlte der Komet, verstörender und prächtiger anzusehen als zuvor. Er musste der Erde ein beträchtliches Stück näher gekommen sein. Der rote Kranz um seinen Körper war dichter geworden, brannte, glühte wie Höllenfeuer.
Die Tür zu Kathis Haus war immer noch angelehnt. Jakobus eilte nach oben. Die wie Espenlaub zitternde Lioba ließ er unten zurück.
Als er in die Kammer trat, bot sich ihm ein schreckliches Bild. Eine Frau, vermutlich die Mutter, lag mit erschlafften Gliedern und blutüberströmtem Unterleib auf einem Tisch. An ihrer Seite ein junges Mädchen. Es hielt ein in ein Tuch gewickeltes Neugeborenes im Arm und wiegte es. Dazu summte sie eine Kindermelodie.
«Darf ich es sehen?», fragte er sanft.
Kathi blickte auf. Glücklich, aber auch seltsam verstört antwortete sie: «Michael, mein Brüderchen. Ist er nicht wunderschön?»
«Lass mich ihn sehen.»
Er streckte die Arme aus. Kathi zögerte. Sie hatte keine guten Erfahrungen mit Dienern des Herrn gemacht.
«Ihr müsst Euch nicht sorgen», erwiderte sie trotzig.
Aber sein Lächeln war einnehmend, überzeugend, wenngleich hinterlistig. Sie fiel darauf herein und reichte ihm das kleine Bündel.
Von ihr unbemerkt, schob er das Tuch zur Seite. Das linke Bein kam zum Vorschein. Tatsächlich, die Hebamme hatte nicht gelogen. Da war ein Mal. Konnte es getrocknetes Blut sein? Schmutz? Vorsichtig rieb er mit dem Daumen darüber. Es ließ sich nicht wegwischen.
«Ich möchte seine Augen besser sehen», sagte Jakobus und ging zu einer Kerze, die noch ausreichend Licht spendete.
Und ja, wieder hatte die Hebamme recht behalten. Dieses Mal sah verdächtig aus. Es war anders als jene, die er bisher zu Gesicht bekommen hatte. Stellte es tatsächlich eine Zahl dar? Und zwar nicht irgendeine, sondern die des Teufels?
«Wieso schaut Ihr so ernst?», fragte Kathi.
«Nichts. Es ist …»
«Haltet Ihr ihn für krank?», fragte sie besorgt. «Lasst Euch versichern, es geht ihm gut. Meine Mutter und ich …»
Jakobus widersprach. «Nein, darum geht es nicht.»
Kathis Argwohn wuchs. «Gebt ihn mir zurück.»
«Das Kind muss näher untersucht werden.»
«Es geht ihm gut.»
«Ich fürchte, darüber hast du nicht zu entscheiden.»
«Gebt ihn mir zurück!» Kathis schrille Stimme erfüllte den Raum. «Michael ist so gesund wie jedes andere Kind.»
«Sicher ist er das», wiegelte Jakobus ab, «aber da ist noch etwas anderes, etwas, das ihn von anderen Kindern unterscheidet.»
Im Kerzenlicht zeigte er ihr das Mal. Kathi brauchte einen Moment, doch dann wurde ihr die Brisanz der Situation bewusst.
Die Offenbarung des Johannes war jedem bekannt, sie war das Evangelium der Lehrer und der Priester. Tagein, tagaus hatten sie es im Unterricht durchgenommen.
«Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens», zitierte Jakobus. «Es ist eine Menschenzahl …»
«… und sie lautet 666», führte Kathi den Satz zu Ende, so, wie sie es tausendmal in der Schule getan hatte.
Der Fleck war verschwommen, ohne klare Ränder, mehrdeutig. Es konnten drei belanglose Punkte sein, wie sie Kinder als Sommersprossen im Gesicht trugen, genauso wie das berüchtigte Stigma des Antichrist.
«Es ist keine Zahl», widersprach Kathi vehement. «Es ist viel zu früh …»
«Beruhige dich», beschwor er sie. «Auch ich bin nicht überzeugt. Noch nicht.»
Ein lauter Knall, gleich dem Donner einer Kanone, schnitt ihm das Wort ab. Darauf folgte ein Beben, das das Haus erzittern ließ. Jakobus hielt sich an der nächstliegenden Möglichkeit fest.
«Maria und Joseph.» Er schlug das Kreuzzeichen. «Was war das?» Vom Marktplatz her hörte er aufgebrachte Stimmen, ein Heulen und Zetern. Der helle Stern war in drei Teile zerborsten, jeder einen langen roten Schweif hinter sich herziehend. Gleich stiebenden Funken fielen sie zu Boden, leuchteten auf wie Edelsteine im Sonnenlicht, konkurrierten um die Gunst der Zuschauer, als gelte es, einen Preis zu gewinnen.
Die Stimmen erloschen für einen Augenblick. Angst und Verzweiflung wichen der stillen Bewunderung.
So musste es am Anbeginn der Zeit gewesen sein, als Gott Himmel und Erde schuf, einem Schmied gleich, der mit Feuer und Hammer die Elemente formte, um den Menschen ein Heim zu geben. Einen Auftrag gab er ihnen auch gleich mit: Macht euch die Erde untertan und vermehret euch, preiset mich als euren einzigen und wahren Gott.
Doch das ging gleich zu Anfang schief. Der Mensch zeigte sich des Geschenks nicht würdig und verriet seinen Gott zugunsten der Schlange – des Teufels. Der kannte den Menschen besser, wusste um seine Schwächen und Begierden.
Das Himmelsschauspiel ging mit einem dumpfen Einschlag zu Ende.
Aus der Stille des Marktplatzes erhoben sich erneut die Stimmen. Sie klagten und jammerten. Jeder wusste, dass die Abkehr von Gott ein schlimmes Nachspiel haben würde. In der Offenbarung des Johannes stand es geschrieben:
Der Teufel wird in der Nacht des fallenden Sterns auf die Erde kommen, um die Söhne der Dunkelheit um sich zu scharen und sie in die letzte große Schlacht gegen die Söhne des Lichts zu führen. Gut gegen Böse, die Gottgefälligen gegen die Teufelsanbeter.
Kathis Gedanken überschlugen sich. Um Himmels willen, wie würde sie nur ihr Brüderchen vor diesem Wahnsinn schützen können?
1
Der Tross der Verdammten zog unter ihrem Fenster vorbei.
Kathi erkannte an der Spitze des Zugs den Kruzifixträger – einen alten, klapprigen Mann, der ein schmuckloses Kreuz vor sich hertrug. Gesicht und Hände waren mit Lumpen umwickelt gegen den bissig kalten Wind. Den Körper schützte ein aus Dutzenden von Fetzen notdürftig zusammengeflickter Umhang.
Der Mann humpelte. Den linken Fuß setzte er seltsam verrenkt auf, einer Gehstütze gleich, während er den rechten eilig nachzog. Vermutlich hatte er sich den Fuß gebrochen und war, wie durch ein Wunder, nicht daran gestorben.
Diese augenscheinliche Missbildung konnte dem Alten noch gefährlich werden, dachte Kathi. So wie seinem Vorgänger, einem eitlen und gewissenlosen Geck, der erst vor kurzem auf dem Scheiterhaufen gelandet war. Sein Hochmut war ihm zum Verhängnis geworden, als er einem bettelnden Mädchen das Almosen verweigert hatte. Bei nächster Gelegenheit wollte sie ihn verkehrt herum auf einem Ziegenbock gesehen haben, im Galopp geradewegs hinauf zum Schalksberg, wo Hexen und Teufel Sabbat feierten.
Gleich hinter dem Kruzifixträger folgte zu Pferd der Hexenkommissar Faltermayer. Ein schwarzer Mantel hüllte ihn und den Rücken des Pferdes vollkommen ein. Sein ungeschütztes Gesicht wirkte fahl und leblos. Auch die Verschlagenheit und Strenge, die Kathi einst gefürchtet hatte, waren ihm genommen. Statt ihrer hatte sich Müdigkeit breitgemacht. Die besten Tage dieses gefürchteten Hexenjägers waren lange vorbei.
Neben ihm lief der Malefizschreiber, die Todesurteile fest unter den Arm geklemmt. Er sah aus, als ob er sich an ihnen festhalten würde, um nicht vom Wind fortgetragen zu werden.
Es folgte eine Handvoll bewaffneter Stadtknechte und schließlich vier Karren, auf denen die Verurteilten zur Hinrichtungsstätte am Sanderanger gebracht wurden. Sie kauerten in blutig verschmutzten Büßerhemden auf den Ladeflächen dicht beieinander, die Köpfe gesenkt, im Schnellverfahren abgeurteilt und nun auf einen schnellen Tod hoffend. An den nackten Füßen und Händen trugen sie Ketten, als fürchtete Faltermayer, seine Beute könnte auf dem Weg zum Scheiterhaufen noch flüchten.
Bilder ihrer eigenen Folter kamen Kathi in den Sinn.
Auf geschundenen Knien harrte sie aus, vornübergebeugt, Faltermayers Stockschläge auf Rücken und Kopf.
«Ist sie eine Hexe?»
Ihre frühere Verbündete Grit hatte es bejaht, aus tiefstem Herzen, als Strafe und Genugtuung für den Bruch ihres Bündnisses. Nachdem ihr Schwindel vom Hexenflug aufgeflogen war, war sie geflüchtet. Niemand wusste, wohin.
Auch Anna, das seltsam verstörte Mädchen aus dem Kinderhaus, hatte ohne Skrupel das Todesurteil über sie gesprochen.
«Ja, sie ist eine Hexe.»
Anna hatte sich daraufhin das Leben genommen. Kathi hoffte, dass sie im Himmel endlich das Zuhause gefunden hat, das sie sich auf Erden vergeblich gewünscht hatte.
Und dann waren Lene und Lotti, des Apothekers hübsche, aber missratene Zwillingstöchter, vor ihr gestanden.
«Ist sie eine Hexe?»
Natürlich war sie eine Hexe, nichts anderes hatte sie von den beiden erwartet. Doch wie hatte sie sich in ihnen getäuscht.
Ihre größten Widersacherinnen, die ihr das Leben zur Hölle gemacht hatten, traten als Einzige für sie ein.
«Nein, sie ist keine Hexe. Lasst sie frei.»
Abgrundtiefer Hass auf ihren Vater und Rache für die erschlagene Mutter hatten sie alles wagen lassen. Sie sprachen Kathi frei und den Vater schuldig. Es half Kathi nicht. Lene und Lotti wurden kurzerhand als Töchter eines Teufelsanbeters angeklagt und zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt.
Doch dazu war es nicht gekommen. Volkhardt und die Schwarzen Banden hatten sie gerettet. Danach verschwanden sie. Niemand wusste, wo sie sich versteckt hielten, ob sie tot oder lebendig waren.
Und schließlich war da noch Ursula gewesen, ihre beste Freundin. So zierlich und hilflos, wie sie gewesen war, hatte sie doch eisern bis zum Schluss jedes Geständnis verweigert, bis sie im Angesicht des Henkers tot zusammengebrochen war.
Kathi schniefte. Tränen traten in ihre Augen.
Einer dieser Unglückseligen auf dem Karren hob den Kopf, blickte geradewegs zu ihr herauf. Sie schrak zurück.
Diese Augen kannte sie gut. Es waren die von Benedikt. Er war mit Kathi in die Schule bei Vikar Ludwig gegangen, hatte stets fürchten müssen, unter Anklage gestellt zu werden, nachdem seine Tante als Hexe verbrannt worden war.
Aber war er nicht vor Monaten mit Ulrich, einem weiteren Klassenkameraden, aus der Stadt geflohen, um den Folterknechten Faltermayers zu entkommen?
Offensichtlich nicht. Nun folgte er seiner Tante ins Feuer.
Das Kind in Kathis Arm schlug die Augen auf, quengelte in den engen Tüchern und suchte die Brust seiner Mutter. Kathi begegnete dieser Forderung mit einem Trick, indem sie Milch auf ihren kleinen Finger tröpfelte und Michael daran saugen ließ. Doch jetzt war keine Milch mehr da, und Bruder Jakobus hatte sie heute noch nicht besucht, um ihr welche aus der Klosterküche zu bringen.
«Schlaf süß, mein kleiner Michael», flüsterte sie und wiegte ihn.
Eine Melodie, leise gesummt, ließ ihn die Augen wieder schließen, sicher und warm in den Schlaf zurückgleiten.
Kathi trat wieder ans Fenster, schaute vorsichtig hinunter. Die Karren waren weitergezogen. Sie verloren sich geräuschlos im trüben Kleid eines späten Wintertages.
Eine johlende Menge, wie sie stets den letzten Weg der Verurteilten gesäumt hatte, fehlte in diesen Tagen. Die Begeisterung, die ein lodernder Scheiterhaufen sonst hervorrief, war den Bürgern abhandengekommen. Zu viele geliebte Menschen waren hingerichtet worden.
Auch die, die sich aus reiner Boshaftigkeit an der Not anderer weideten, waren in ihren Löchern geblieben. Zu nahe war ihnen der Tod gekommen und zu leicht konnte das Feuer der Hexen auch auf sie überspringen.
Unmerklich begann es zu schneien. Aus einem diesigen Winterhimmel taumelten Schneeflocken herab. Sie begruben den Schmutz und den Gestank dieses Sodom unter einem weißen, unschuldigen Tuch.
Der Wahn des Hexenverbrennens würde unter ihm nicht enden, wie unter einem kalten Umschlag das Fieber, aber für ein paar Monate würde die Hitze genommen. Vielleicht so lange, dass der Verstand wieder zu Kräften kam.
Kathi wandte sich ab. Die Welt musste fortan ohne sie auskommen. Sie hatte ein Kind zu beschützen, das unter einem schlechten Stern geboren war.
Das Mal war nicht groß, drei Punkte, eng beieinander, leicht ausgefranst, nicht der Rede wert, sofern man es unvoreingenommen betrachtete. Doch wer das Böse sehen wollte, fand es selbst in der Unschuld eines neugeborenen Kindes.
Es musste etwas geschehen. Sie wollte sich nicht länger auf die Worte von Bruder Jakobus verlassen und abwarten, wie sich das Mal entwickelte. Was wäre, wenn er seine Meinung änderte, morgen zu Faltermayer ging und ihn auf Michael aufmerksam machte?
Andererseits war nicht davon auszugehen. So besorgt sich Jakobus in der Nacht der Geburt über das Mal gezeigt hatte, am nächsten Tag war er ruhiger geworden. Er war in sich gegangen, hatte er gesagt, war in ein Zwiegespräch mit seinem Herrn und Schöpfer getreten, wie in diesem Fall zu verfahren sei. Das Kind hätte noch eine Chance auf Rettung, lautete seine Antwort, wenn es dem Zugriff des Teufels entzogen würde. Daher musste es umgehend getauft werden.
Dem konnte Kathi zustimmen. Auch sie war getauft wie jedes andere Kind. Doch das schützte letztlich nicht davor, wegen Hexerei angeklagt zu werden. Schon gar nicht, wenn man ein verdächtiges Mal am Körper trug.
Was sollte sie nur tun? Wäre doch nur ihre Mutter hier, sie wüsste bestimmt Rat.
Aber Helene war seit drei Tagen tot. Jakobus hatte ihr noch die Sakramente erteilt, leider erst nachdem sie gestorben war. Er war es auch, der ein gutes Wort beim Totengräber eingelegt hatte. Noch im Laufe des Tages, schnell und unauffällig, hatte der die Bestattung vorgenommen, nicht ohne ein stattliches Grabgeld und ein noch fürstlicheres Schweigegeld zu fordern. Niemand sollte von einer Frau erfahren, die in der Nacht des Kometen im Kindbett verstorben war.
Seit Erscheinen des Teufelsauges, so wurde er von den Bürgern inzwischen genannt, war die Angst bis zur Verzweiflung gewachsen.
Der Kampf Satans gegen das Volk Gottes hatte begonnen. So stand es in der Offenbarung des Johannes, und wer würde die Schrift nach den Ereignissen der letzten Monate noch ernsthaft bezweifeln wollen? Das Ende war nah, und die letzte Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse stand bevor. Und in diesem Kampf spielte ein Kind, das in der Nacht des Kometen geboren wurde, eine besondere Rolle. Auf keinen Fall durfte Gerede aufkommen von einem unehelichen Kind oder seiner Mutter, deren erstes Kind bereits in einen der aufregendsten Hexenprozesse der letzten Jahre verwickelt war.
Aber wie sollte die Hebamme zum Schweigen gebracht werden?
Sie hatte das vermeintliche Teufelsmal gesehen. Was würde geschehen, wenn sie die Nachricht in der Stadt verbreitete? Faltermayer würde die Herausgabe des Kindes fordern. Dann war es vorbei mit dem kurzen Leben ihres geliebten Bruders.
Jakobus hatte nicht sofort eine Antwort parat gehabt, aber er wollte sich darum kümmern. Offenbar war es ihm gelungen, denn bis heute war niemand vor ihrer Tür aufgetaucht, um das Kind zu sehen – außer Barbara und Otto, Kathis beste Freunde. Und natürlich Volkhardt, ihr allerbester Freund und Lebensretter.
Kathi war hin- und hergerissen. Sie musste etwas unternehmen, bevor Schlimmes geschah. Wäre nur dieses verflixte Mal nicht da, dann wäre vieles einfacher.
Ihr Blick fiel auf eine Schale, in der Löffel, Gabel … und ein Messer aufbewahrt wurden. Kathi nahm es zur Hand. Die Klinge war kurz, halbwegs scharf, für das Schneiden von Wurst und Brot völlig ausreichend.
Ein Gedanke zwang sich ihr auf. Er war so grausam wie lebensrettend. Mit einem schnellen Schnitt könnte sie das Todesmal an Michaels Schenkel entfernen.
Mit einem Schnitt … ein drei Tage altes Kind?
Nein, das war ungeheuerlich.
Aber was würde geschehen, wenn Faltermayer das Mal zu Gesicht bekam, hineindichtete, was in seiner vergifteten Seele vor sich ging? Unvorstellbar. Dann lieber ein schneller Schnitt, der Michael vor dem Scheiterhaufen bewahrte.
Wie sollte sie es anstellen? Noch nie zuvor hatte sie mit einer Klinge in etwas Lebendiges gestochen. Ihre Mutter hatte so etwas gekonnt. Mit einem Hieb dem Huhn den Kopf abschlagen. Aber sie? Was würde passieren, wenn sie zu tief stach? Das Blut, die Wunde, das Geschrei. Womöglich eine Infektion?
Sie seufzte. Herr im Himmel, was soll ich tun?
Sie setzte die Klinge auf die zarte Haut, gleich neben den drei Punkten. Es konnte gelingen. Sie schloss die Augen, atmete tief, sammelte Kraft und die Überzeugung, das Richtige zu tun …
Da öffnete Michael die Augen. Etwas Kaltes auf seiner warmen Haut raubte ihm den Schlaf. Er begann zu weinen.
Kathi ließ das Messer fallen und wiegte ihn.
«Schschsch … Schlaf weiter.»
Sie begann die vertraute Melodie zu summen. «Du hast nichts zu befürchten. Ich passe auf dich auf.» Die Anspannung wich.
Was um alles in der Welt war ihr nur in den Sinn gekommen? Ihr eigenes Fleisch und Blut mit einem Messer zu traktieren. Mit dem Fuß stieß sie die Klinge weg.
Dann flüsterte sie Michael ins Ohr. «Niemals wird dir jemand ein Leid antun. Eher wird er sterben, durch die Hand eines Kindes … und einer Mutter.»
Das Versprechen tat seine Wirkung. Sie vernahm sein gleichmäßiges, ruhiges Atmen und mit ihm die Beruhigung ihres eigenen Herzschlags. Nie wieder durfte sie die Hand gegen ihn erheben, nie wieder durfte sie ihn in Gefahr bringen.
Gott hatte ihr Brüderchen so geschaffen, wie es war. Mit einem Zeichen. Niemand, kein Mensch, kein Hexenkommissar und auch kein Bischof, durfte darin etwas Schlechtes sehen.
Kathi legte sich mit Michael auf die Strohmatte, so wie es Helene auch mit ihr gemacht hatte, wenn sie müde und erschöpft war.
Mama. Nun lag sie tot, hastig verscharrt, in einem kalten Loch am Rande des Friedhofs.
Ich denke an dich. Möge dir der Herr im Himmel einen Platz an seiner Seite geben.
Der Wunsch war gesprochen, der Gedanke klang aus, und Kathi fiel endlich in den wohlverdienten Schlaf.
Da erwachte neues Leben in Michael. Es schien, als hätte er das Nachlassen der Hand gespürt, die ihn hielt. Er schaute sich um, suchte Blickkontakt zu seiner Mutter.
Hunger.
Ein herzerweichendes Geschrei beschloss die kurze Ruhezeit.
2
Gemeinhin hätte es keinen Unterschied gemacht, ob die Kinder die Mehllieferungen für die Würzburger Stifte überfielen oder die für die Bäcker. Aber Wilhelm, Anführer des dreiköpfigen Trupps der Schwarzen Banden – einer Notgemeinschaft aus verstoßenen, verwaisten und hungernden Kindern, die sich in die leer stehenden Kellergewölbe der Stadt geflüchtet hatten – und ehemaliger Schüler von Stift Haug, ließ keine Gelegenheit aus, um es seinen alten Schulmeistern heimzuzahlen. Jede Ohrfeige und jeden Rutenstreich sollten sie büßen, und sei es, indem er ihnen das Mehl raubte. Sollten die werten Stiftsherren sehen, wie sie ohne Hostien, den Leib Christi, ihr Abendmahl feierten.
Einzig das Mehl für die Kartäuser – die neuen Herren der Mühle – wollten sie verschonen. Die hatten ihnen nichts getan. Sie waren fromme Leute, die sich aus den Geschäften der Welt nichts machten und hinter dicken Klostermauern ein Leben in Einsamkeit und Stille führten. Wären doch nur alle Pfaffen wie sie, dann wäre ihnen viel Leid erspart geblieben.
Der kleine Adam stand auf einer Leiter, die von Georg und Wilhelm gehalten wurde. Er blickte durch einen Spalt im Fensterladen hinein in die Mühle. Der Müllermeister war gerade dabei, mit seinen zwei Knechten die Säcke zu füllen.
«Drei für Neumünster», befehligte er seine Männer, «vier für Stift Haug und jeweils zwei für Sankt Burkhard und den Dom.»
Einer der Knechte widersprach. «Aber Meister, da stimmt was nicht.»
«Was soll da nicht stimmen?»
«Der Weizen reicht niemals für …», er zählte an den Fingern seiner beiden Hände die Säcke ab, «für zehn …»
Der andere Knecht fiel ihm ins Wort. «Elf Säcke, Dummkopf.»
«Egal, wir haben zu wenig Weizen.»
Der Müller schaute in den Trichter, in dem das gemahlene Mehl aufgefangen wurde. Mindestens ein Sack Mehl fehlte, wenn nicht zwei.
Irgendetwas stimmte hier tatsächlich nicht. Er wandte sich grimmig den Knechten zu.
«Habt ihr das Getreide anderweitig vergeben?»
Die Knechte schüttelten die Köpfe.
«Nein, Meister. Ihr habt gestern für Bäcker Frobel …»
Jetzt fiel es ihm wieder ein. Ja, stimmte. Der alte Frobel wollte unbedingt ein Dutzend Säcke. Er hatte gut dafür bezahlt. Kein Wunder. Wer konnte schon wissen, mit wie viel Mehl man in diesem Jahr noch rechnen konnte? Die Ernte war knapp ausgefallen, das meiste war bereits aufgebraucht.
Der Müller kratzte sich am Kopf.
«Dann schaut mal, ob ihr irgendwo noch einen Sack auftreiben könnt.»
«Das übrige Getreide ist für den Bischof bestimmt.»
Himmelherrgott, auch das noch. Den Bischof um einen Sack Mehl zu betrügen war keine gute Idee; die Brüder in den Stiften und Klöstern allerdings auch nicht. Man wusste nie, wann man sie mal brauchte.
Auf die Schnelle war kein einziger Sack Getreide abkömmlich. Der Müller musste improvisieren.
«Du», er zeigte auf einen Knecht, «geh in den Schuppen. Da stehen noch ein paar Säcke rum. Hol einen her, am besten gleich zwei.»
«Aber die sind doch vom letzten Jahr.»
«Widersprich nicht. Los, beeil dich. Der Kutscher kann nicht ewig warten.»
Der Knecht tat wie ihm geheißen.
Derweil machte sich vor der Mühle Ungeduld breit. Wilhelm zupfte am Hosenbein Adams.
«Was passiert dadrin?»
Adam hielt den Finger an den Mund, flüsterte.
«Denen ist das Mehl ausgegangen.»
«Und, was machen sie jetzt?»
«Einer ist in den Schuppen gegangen.»
Wilhelm dachte nach. Der Schuppen. Mal sehen, was der Müller dort aufbewahrte. Vielleicht war etwas Nützliches für sie dabei. Er schlich um die Ecke, rannte hinüber zum Schuppen, wo Wagenräder standen, Werkzeug herumlag und Stroh gestapelt wurde.
Eine dürre Katze lief über die Holzverstrebungen, die das Dach des armseligen Gemäuers zusammenhielten. Sie war nicht an ihm interessiert, einzig daran, sich vor dem kalten Wind in Sicherheit zu bringen, der durch die Löcher pfiff. Der Mann, der zu ihren Füßen auf ein unerwartetes Hindernis stieß, kümmerte sie auch nicht.
«Teufelsbrut», schimpfte der Knecht, «aus dem Weg.»
Zwei Ratten hatten sich ihm entgegengestellt und fletschten den Störenfried an. Er drohte, ihnen die Beute streitig zu machen – auf dem Boden verstreute Getreidekörner.
«Verschwindet endlich.»
Er trat nach ihnen, traf sie aber nicht. Da kam ihm ein Reisigbesen gerade recht. Er schlug nach ihnen, traf auch eine, die fiepend gegen die Bretterwand schlug. Die andere war wendiger. Sie wich dem Schlag aus und griff sein Hosenbein an.
«Heilige Mutter Maria.»
Wilhelm beobachtete den Kampf mitleidlos durch einen Spalt in der Bretterwand. Ratten waren fester Bestandteil seines Lebens bei den Schwarzen Banden. Man teilte mit ihnen das Schicksal in den nasskalten Kellern der Stadt, man hatte sich mit ihnen arrangiert. Ratten waren Nachbarn, aufdringlich, wenn es Fressen gab, aber auch hilfreich, wenn Gefahr drohte. Sie witterten anrückende Stadtknechte oder Feuer weit früher als ihre besten Wachen. Gefährlich waren sie selten.
Diese Ratte hingegen war überraschend angriffslustig. Normalerweise flüchteten sie vor überlegenen Angreifern. Doch diese Ratte wich keinen Deut. Sie hatte den Rücken gekrümmt, als setze sie zum Sprung an, und fletschte die Zähne. Der Müllersknecht tat gut daran, sich in Acht zu nehmen. Eine Verletzung führte meist zu Fieber und mitunter auch zum Tod.
Von einem Fuhrwerk, das sich mitten im Hof befand und Mehlsäcke geladen hatte, schallte Gelächter herüber. Der Kutscher amüsierte sich beim Anblick der Tanzeinlage prächtig.
«He da, hoch das Bein.» Einer seiner Gäule wieherte dazu. «Ruhig …»
Ein glücklicher Tritt entschied das ungleiche Duell. Die Ratte ging zu Boden, und der Knecht trat auf sie ein, bis sich ihr Blut im gefrorenen Matsch verlor.
Dann packte er zwei Säcke, schwang sie auf die Schulter und stapfte in die Mühle zurück. Ein Sack hatte ein Loch, aus dem Körner zu Boden rieselten. Der Knecht merkte davon nichts.
Der Kutscher trieb ihn an. «Beeil dich. Es wird bald dunkel.»
Wilhelm schlich in den Schuppen und stöberte nach Verwertbarem. Die Auswahl war nicht groß. Verrottete alte Säcke, verrostete Eisen, ein paar tote Ratten und ein gebogenes altes Messer zum Öffnen der Säcke. Die Klinge war nicht sonderlich scharf, aber das ließ sich beheben. Er steckte es in die Tasche. Gerade rechtzeitig, denn aus der Mühle kamen die Knechte mit den Mehlsäcken auf den Schultern und luden sie auf den Karren.
Einer der beiden Gäule war seltsam unruhig. Das Tier wollte in den Stall zurück – wenn es nach dem Kutscher und seiner hungrigen Familie gegangen wäre, könnte es aber auch gleich zum Pferdemetzger.
«Verrücktes Vieh. Gib endlich Ruhe.»
Wilhelm lief geduckt hinüber zu Adam und Georg, die bereits auf ihn warteten.
«Wenn der Karren um die Ecke gebogen ist, springen wir auf.» Die beiden nickten und warteten auf den passenden Augenblick.
Sobald der Karren außer Sichtweite des Müllers und seiner Knechte war, liefen sie los. Sie mussten die Beine in die Hand nehmen, denn der Kutscher ließ seiner Ankündigung Taten folgen. Er gab den Gäulen die Peitsche.
Schon bald war er auf den Weg in die nächste Ortschaft eingebogen. Die Kinder holten auf und schafften es, auf die Ladefläche zu springen. Erschöpft und mit schnellem Atem verkrochen sie sich hinter die Säcke.
«Habt ihr euch gemerkt, welche für die Stifte bestimmt sind?», fragte Wilhelm.
Georg und Adam nickten.
«Wenn wir die Stadttore hinter uns haben, stoßt ihr sie vom Karren. Ich werde sie dann …»
Wilhelm brach ab, notgedrungen. Der Karren samt Ladung rutschte zur Seite weg. Ein Gaul wieherte. Über ihnen das Schnalzen der Peitsche und das Gebrüll des Kutschers. Der Karren zog unvermittelt an, die Gäule gingen durch.
Wilhelm, Adam und Georg krallten sich an den Säcken fest. Für den Moment sollte sie das auf dem Karren halten. Doch schon beim ersten großen Stein flogen sie in hohem Bogen von der Ladefläche, mit ihnen ein paar Säcke.
Der Aufprall auf dem gefrorenen Boden war schmerzhaft. Wilhelm hielt sich die blutende Nase, während er den Karren davonfahren sah. Die andere Hand ballte er zur Faust.
«Zum Teufel mit dir.»
Der Karren verlor sich schnell aus ihrer Sicht. Hinter der nächsten Anhöhe ging es hinunter in die Ortschaft. Dort brachte der Kutscher die Gäule wieder unter Kontrolle. Am liebsten hätte er dem närrischen Vieh gleich an Ort und Stelle die Kehle durchgeschnitten. Doch wollte er Anspruch auf seinen Lohn erheben, musste er die Fahrt wohl oder übel fortsetzen. Ein paar beruhigende Worte und eine Handvoll Heu brachten schließlich die Lösung.
Die Gäule blieben bis an die Pforte des Stifts ruhig. Die bestellten Säcke wurden abgeladen und in die hauseigene Bäckerei geschafft. Und die, die vom Karren gefallen waren, sollten sie beim nächsten Mal erhalten. Die Küchenknechte machten sich sogleich an die Arbeit. Brot musste gebacken werden und auch die Hostien, mit denen das Abendmahl gefeiert wurde, waren in letzter Zeit knapp geworden.
Die Herstellung der dünnen runden Scheiben war denkbar einfach: Mehl und Wasser miteinander verrühren, den Brei aufs heiße Oblateneisen auftragen, kurz warten und schon war die Opfergabe fertig. Was noch fehlte, war die Wandlung, durch die aus der unscheinbaren Scheibe der Leib Christi wurde.
Der wurde allen frommen Christenmenschen zur Erquickung ihres Seelenheils gereicht. Vielen half der Leib Christi durch diese schwierige Zeit der Hoffnungslosigkeit, des Abfalls vom Glauben und des Hasses unter den Menschen.
Manchmal jedoch half selbst das nicht mehr. Dann war alles vergebens. Und dieser Tag sollte schneller kommen, als viele befürchteten.
Bruder Jakobus hatte das Notwendigste in einen Beutel gepackt – saubere Tücher, frische Milch, Brot, Wurst und Käse. Ach ja, und Kräuter aus dem Klostergarten. Kathi hatte darum gebeten.
Was wollte ein Kind damit anstellen, fragte er sich. Selbst Bruder Hieronymus, der über den Garten wachte, ihn liebevoll hegte und pflegte, mangelte es an dem notwendigen Wissen, um aus den Kräutern wertvolle Medizin zu machen. Aber die beiden kannten Kathi nicht. Sie wussten nicht, dass sie bei einer kräuterkundigen Amme aufgewachsen war und eine Lehre in einer Apotheke absolviert hatte.
Was die Franziskanerbrüder jedoch umso genauer wussten, war, dass sowohl Amme Babette als auch Apotheker Grein des Pakts mit dem Teufel überführt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden waren. Und zu beiden hatte Kathi ein enges Verhältnis gehabt. Die Weitergabe von Kräutern war demnach nicht unbedenklich.
Im Fall des Apothekers hatte sich die ganze Tragödie der Abkehr von Gott gezeigt. Im Wahn hatte er seine Frau auf offener Straße erschlagen. Seine beiden Kinder, Lene und Lotti, bezichtigten ihn daraufhin der gemeinsamen Sache mit Hexen und dem Teufel.
Auf dem Marktplatz hatte es einen Tumult gegeben, bei dem auch dieses seltsame Kind, Kathi, beteiligt war. Sie galt als Anführerin der Kinderhexen, die die Stadt an den Rand des Wahnsinns gebracht hatte. Seitdem war nichts mehr wie vorher.
Nach einer Verschnaufpause, in der sich die Mächte der Dunkelheit neu zusammengefunden hatten, grassierte das Hexenunwesen schlimmer als zuvor. Der Teufel lauerte in jedem Winkel, und war er noch so privat – in den Stuben, in den Schlafkammern, mitunter sogar in den Beichtstühlen.
Und jetzt noch dieser Stern, der drei Nächte zuvor am Himmel über Würzburg zerborsten war. Es gab nicht viele, die ihn tatsächlich gesehen hatten, die meisten hatten zu der späten Stunde schon geschlafen, aber jeder wusste über ihn Bescheid.
Das Teufelsauge – so wurde er genannt seiner hell strahlenden Iris und des blutroten Randes wegen.
Jakobus eilte zur Pforte hinaus. Mitten auf dem Weg stand ein Fuhrwerk mit zwei Gäulen. Einer der beiden hatte Schaum vor dem Mund, und seine schwarzen, großen Augen bewegten sich aufgeregt. Der Gaul trippelte gefährlich auf der Stelle, als wolle er im nächsten Moment auf und davon. Ein Peitschenhieb schnalzte über seinem Kopf.
«Ruhig, du verfluchter Satansbraten!»
Der Kutscher hielt ein, als er Jakobus sah.
«Vergebt mir, Vater, aber in das Vieh ist der Teufel gefahren.»
Jakobus achtete nicht darauf und ging weiter.
Auf dem gefrorenen Matsch war ein zügiges Gehen nicht möglich. Spitzes Eis und allerlei Straßendreck bohrten sich in die Knöchel. Jakobus ging daher nahe an den Häusern entlang, stieg über ausgeleerte Nachttöpfe und zerbrochene Kruzifixe. Selbst vor einem Bild der Heiligen Mutter Maria hatte der Wahnsinn nicht haltgemacht. Zerfleddert lag es im Schmutz der Straße, festgefroren, geschunden und verhöhnt, wie einst Jesus mit seinem Kreuz in der Via Dolorosa.
Im letzten Licht des Tages trat Jakobus auf die Domstraße. Vor dem Portal des Kiliansdoms hatte nur noch eine Handvoll Händler ihre Stände aufgebaut. Schlecht waren die Aussichten auf ein lohnendes Geschäft, hingegen war es gut möglich, unschuldig in den Kerkern der Stadt zu landen. Eine einzige Anschuldigung genügte mittlerweile.
Eine gereizte Spannung lag in der Luft, elektrisierend wie ein aufziehender Wintersturm, bereit, sich jederzeit mit Schwert und Scheiterhaufen zu entladen.
Vom Fischmarkt schallte die anklagende Stimme eines Wanderpredigers herauf. Er hatte einige Zuhörer um sich geschart, die bei ihm keinen Fisch, aber eine Sicht der kommenden Dinge bekamen. In letzter Zeit waren immer mehr von diesen Anklägern im Namen Gottes unterwegs. Ihr Sinn für die Angst der Menschen führte sie sicher ans Ziel.
Jakobus wollte ihm keine Aufmerksamkeit schenken und beschleunigte seinen Schritt. Dennoch kam er nicht umhin, die traurige Botschaft zu hören.
«Es muss jeder gescheite Mensch erwägen, wie schrecklich der Jüngste Tag sein wird, wenn sich Gottes Sohn von seinem Thron erhebt und auf diese Welt herabsteigt. Aber nicht als Erlöser, sondern als Richter, zornig und unnachgiebig, der nicht länger geduldig ist wie das Lamm, das Gnade walten lässt. Einem brüllenden Löwen gleich wird er unter euch wüten, zu fordern Gerechtigkeit für all die Lügen und Sünden, die ihr in seinem und des Teufels Namen begangen habt.
Aber noch ist es nicht so weit, noch ist Zeit umzukehren von eurem Weg ins ewige Feuer. Tuet Buße, seid barmherzig und liebet einander, bevor die schlimmen Tage kommen, ärger als all die vorangegangenen. Denn dann, wenn die Zeit der Drangsal beginnt, ist das Ende nahe. Ihr werdet sie erkennen, wenn wahr nicht länger wahr ist, sondern alles falsch und hinterlistig wie die Schlange im Baum. Wenn alles Gute sich ins Schlechte verkehrt, so wie das Obige nach unten. Ein Heulen und ein Flehen wird dann über euch kommen, und ihr habt die Zeit vertan.
Wahrlich, ich sage euch, ich kann ihn sehen, den Tag der Lüge und des Betrugs, wenn die Gottlosen sich über die Frommen erheben und nur noch ein Narr das Knie vor dem Kreuze beugt. Wenn Gottes Diener nicht länger das wahre Wort verkünden, sondern mit dem Teufel zu Bett gehen, da sie selbst zu Teufeln geworden sind und euch verführen, um eure Seele zu rauben. Wahrlich, ich sage euch, dann ist es zu spät, dann ist das Ende gekommen.
Darum hört die Worte des Herrn. Er spricht durch mich zu euch, zu den Dürstenden und den Notleidenden: Kehret um, für das Heil eurer Seele und den Frieden im Himmel und auch auf Erden, jetzt, für alle Ewigkeit. Amen.»
Ein Junge, nicht älter als fünf Jahre, stand in zerrissenen Kleidern und vor Kälte zitternd neben dem verlausten Prediger – in Jakobus’ Augen eher ein Judas Ischariot als ein Johannes der Täufer, ein Verkünder des Messias. Der Blick des Kindes war starr und hoffnungslos in die Menge gerichtet. Offenbar kannte er die Worte seines Herrn zu Genüge. Mit dem Amen