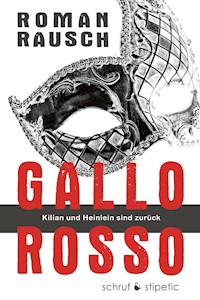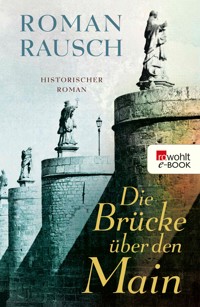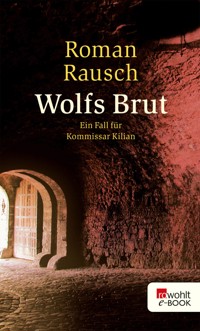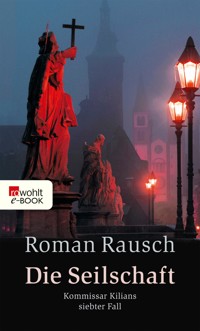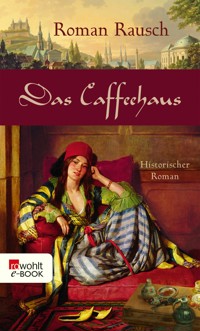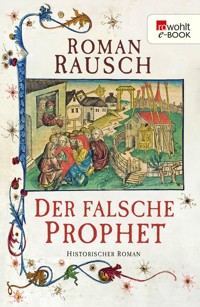6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Kilian ermittelt
- Sprache: Deutsch
Mord in Würzburg, Aufruhr im Vatikan Bei Bauarbeiten am Kilianshaus in Würzburg wird ein mysteriöser Papyrus entdeckt. Der Vatikan erklärt den Fund zur Chefsache, denn sein brisanter Inhalt droht die gesamte Heilige Katholische Kirche zu erschüttern. Kurz nach diesem aufsehenerregenden Fund wird ein Priester ermordet, und die Schriftrolle verschwindet. Ausgerechnet Kommissar Kilian, ein guter Freund und Ziehsohn des toten Geistlichen, gerät unter dringenden Tatverdacht. Bald sieht sich Kilian von seinen eigenen Kollegen und vom Opus Dei verfolgt. Die Flucht führt ihn bis nach Irland und in die Totenstadt des Vatikan. «Für Krimifreunde ein Genuss. Und für Würzburg ein echter Glücksfall.» (Bayernkurier)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Roman Rausch
Die Zeit ist nahe
Kommissar Kilians dritter Fall
Das Buch widme ich meiner Familie.
Pax nobiscum.
Introitus
«Du sollst auch sagen, dass wir es aufrichtig bekennen, Gott diese Verfolgung seiner Kirche geschehen lässt wegen der Sünden der Menschen, besonders der der Priester und der Prälaten.
Wir wissen wohl, dass auch bei diesem Heiligen Stuhl schon seit manchem Jahr viel Verabscheuungswürdiges vorgekommen ist: Missbräuche in geistlichen Dingen, Übertretungen der Gebote, ja, dass alles sich zum Ärgeren verkehrt hat. So ist es nicht zu verwundern, dass die Krankheit sich vom Haupt auf die Glieder, von den Päpsten auf die Prälaten verpflanzt hat. Wir alle, Prälaten und Geistliche, sind vom Wege des Rechtes abgewichen.
Deshalb sollst du in unserem Namen versprechen, dass wir allen Fleiß anwenden wollen, damit zuerst der römische Hof, von welchem vielleicht all diese Übel ihren Anfang genommen, gebessert werde; dann wird, wie von hier die Krankheit ausgegangen ist, auch von hier die Gesundung und Erneuerung beginnen.»
Erklärung Papst HadriansVI. Verlesen durch seinen Legaten Francesco Chieregati, 1522 vor dem Reichstag in Nürnberg.
I.
Syrien. Die Ruinen von Kuneitra auf den Golanhöhen. Im Hintergrund die Grenztürme zu Israel.
«Der Heilige Vater straft mich Lügen», krächzt der Reporter ins Mikrophon, das unter der Last des ohrenbetäubenden Jubels um ihn herum Aussetzer produziert. «Sah er noch vor ein paar Minuten bemitleidenswert krank und hilflos aus, so scheint es nun, als habe er neue Kraft getankt. Wir sehen einen Papst, der alle Widrigkeiten überstanden zu haben scheint und uns alle wieder einmal zum Staunen bringt. So wie er jetzt die Wasserkanne entgegennimmt, um den vor ihm platzierten Olivenbaum zu gießen. Dieses Symbol des Miteinanders der Völker in ganz Nahost hat er gut gewählt, gerade im Hinblick auf die tödlichen Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern in den vergangenen Tagen…»
Der Reporter stockt. Etwas stimmt nicht.
«…sein linker Arm zittert unkontrolliert… die Wasserkanne entgleitet ihm… der Papst verliert das Gleichgewicht, wird gerade noch von seinem Begleiter aufgefangen… jetzt sackt er zu Boden… die Menge stürzt auf die Absperrung zu… Sicherheitsleute gehen dazwischen, sie haben alle Mühe, die Lage unter Kontrolle zu halten… der Papst bewegt sich nicht mehr… einer seiner Begleiter öffnet ihm die Soutane… legt das Ohr auf seine Brust… setzt beide Hände auf… drückt, lässt nach, drückt, lässt nach… immer und immer wieder.»
Eine Schar weißer Friedenstauben steigt auf. In einem langen Bogen ziehen sie an den israelischen Grenztürmen vorbei und verschwinden am Horizont des Heiligen Landes.
Würzburg. Eine Woche später. Kurz vor der Sensation.
Mit einem Schlag war alles anders.
Der schwere Hammer verfehlte den tragenden Bolzen, glitt am Stahlrohr ab und krachte mit voller Wucht gegen die poröse Wand des Kilianshauses. Ein unbedeutend scheinender kleiner Stein, der über Jahre alles zusammengehalten und die Geschichte verborgen hatte, brach, bröselte und wurde schließlich mit tonnenschwerer Wucht in die Freiheit gesprengt. Ihm folgte unter Donner und Geschrei die südliche Fassade des Kilianshauses, als hätte der heilige Bonifaz die Donareiche nochmals gefällt.
Verletzt wurde niemand. Der Bauarbeiter, der den Schlag führte, hing baumelnd, mit einer Hand das Stahlrohr und mit der anderen das Corpus Delicti umklammernd, leichenblass im feingliedrigen Gestänge der nun herrenlosen Verschalung und blickte ungläubig auf sein Werk. Er wurde nach seinem Advent der Reihe nach vom Vorarbeiter bis zum Hilfsarbeiter ein Stockwerk tiefer zum Teufel befohlen; auf dass er auf ewig dort schmoren möge.
Was blieb, war ein zuvor noch nicht da gewesener Zugang zu ebenjenem Höllenschlund, um den sich die herbeieilenden Bauarbeiter versammelten und ratlos in die schwarze Tiefe blickten.
«Hundsverreck», sagte einer, «sou a Louch!»
«Fluch net», ein anderer, «du stässt auf heilichem Bodn. Aber a Louch is scho. Und glei’ was für ens.»
Eine Baulampe erhellte bald den Blick auf eine Katakombe. Der Bischof und sein Bau- und Kunstreferent Dr.Mayfarth wurden umgehend hinzugerufen. Sie zeigten sich weniger von der Nachricht überrascht, dass Verschönerungsverein, Architekten und Alt-Würzburger es ja schon immer gewusst hatten und jetzt diese ruchlose Umbauerei des ehrwürdigen Hauses lauthals beklagten. Nein, es war viel mehr die Neugier über die Entdeckung einer Gruft, von deren Existenz bei den vorangegangenen Grabungsarbeiten des Landesamtes für Denkmalpflege niemand etwas ahnen konnte.
Die erste Inspektion dieser drei mal drei Meter großen unterirdischen Grablege sorgte für erstaunte Ratlosigkeit. Außer einem knapp zwei Meter langen und einem Meter breiten Sarkophag inmitten des kahlen Raumes gab es nichts zu sehen. Keine Grabbeigaben, keine Waffen, keine Vorratskrüge und kein Pferdeskelett für die jenseitige Jagd mit Wotan. Vor allem aber, und das war das Verblüffende, gab es weder Zugang noch Ausgang zu dieser unterirdischen Ruhestätte aus massivem Stein. Es schien, als wäre hier ein für den letzten aller Tage bestimmter und von der Außenwelt luft- und wasserdicht abgeschirmter Raum geschaffen worden.
Doch für wen?, fragten sich die Archäologen und der Bischof. Wer war so wichtig, dass man ihn gegen alle möglichen Eindringversuche von außen schützen musste? Oder: Was war so gefährlich, dass man die Welt davor zu bewahren suchte?
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten.
Alle Bauarbeiten wurden sofort eingestellt und die Zufahrtstore am Bauzaun rund um das Gelände geschlossen. Kein Wort zur Presse! Die sollte außen vor bleiben, bis man Klarheit darüber hatte, worauf man hier gestoßen war. Doch die Nachricht verbreitete sich in Windeseile, und Kameras und Feldstecher klebten bald an Giebeln und Hausfronten wie Spatzen auf Stromleitungen.
Dann war es so weit. Unter Aufsicht der lokalen Kirchenführung wurde der Sarkophag geöffnet. Die Platte war schwer und musste behutsam bewegt werden, es konnte schließlich alles Mögliche darunter verborgen sein und nach draußen entweichen. Vorsicht war geboten, und so schützten weihwassergetränkte Tücher Atemwege und Augenlicht. Zudem konnte ein Auseinanderbrechen etwaige Kunstschätze unwiederbringlich zerstören. Vielleicht, spukte es manchem Anwesenden im Kopf herum, vielleicht sind wir da auf etwas ganz Besonderes, nie Dagewesenes gestoßen, auf etwas Fundiertes, was die eigene mutige Theorie endlich beweist und die anderen dem Gespött preisgibt. Würde man endlich unverrückbare Beweise für das Leben und Wirken des heiligen Kilian, des Patrons des Bistums und Wegbereiters der nachfolgenden Christianisierung des Frankenlandes durch die Angelsachsen Burkhard und Bonifatius, ganz in der Nähe seiner heutigen Gruft im anschließenden Neumünster finden?
Die Überraschung war groß.
Nachdem der Kran die Platte aus dem erweiterten Loch nach oben gehievt hatte, starrten alle fassungslos in ein leeres Rechteck aus unberührtem Stein. Nun – nicht ganz. Der Sarkophag war an seiner Außenseite rund einen Meter hoch. Jetzt, nachdem die Platte entfernt worden war, kam eine weitere Platte zum Vorschein, die auf halber Höhe angebracht war. Auf ihr war in lateinischen Buchstaben eine Inschrift angebracht, die von Staub und Dreck verdeckt wurde. Um herauszufinden, worum es sich handelte, stieg einer der Archäologen mutig hinunter und verschaffte sich mit einem Handstrich Klarheit. Wie gebannt las er, was sich ihm offenbarte.
«Was steht da?», fragte der Bischof ungeduldig vom hoch gelegenen Kraterrand aus.
«Hic expectat adventum domini»1, schallte es hohl zu ihm herauf.
«Hic expectant?», rätselte Mayfarth. «Das haben wir doch schon in der Sepultur. Wobei, expectant oder expectat?», rief er nach unten.
«Expectat», lautete die Antwort. «Aber da ist noch was…»
Eine Ewigkeit schien für die Beobachter außerhalb der Grube zu vergehen. Ungeduldig harrten sie der Nachricht aus der Vergangenheit.
«Also, was steht denn da noch?», drängte Mayfarth und setzte bereits den Fuß auf den Krater, um selbst hinabzusteigen.
«Hier steht: Priusquam longius processeris, tibi conscius sis veritatem te redempturam esse. Sin aliter acciderit, iter tuum pergas, animum tuum explores et dominum in omne tempus laudibus efferas.»
«Was soll das bedeuten?», fragte sich der Bischof. «Bevor du weitergehst, sei dir gewahr, dass die Wahrheit dich erlösen wird. Wenn nicht, dann geh deines Weges, prüfe dich und preise demütig den Herrn in alle Ewigkeit.»
Noch bevor der Bischof seinen Baureferenten Dr.Mayfarth, zugleich oberster Kunstsachverständiger aller bayerischen Bistümer, nach dem Sinn dieser verschlüsselten Botschaft fragen konnte, schallte es erneut aus der Tiefe empor.
«Da ist eine Schlaufe aus Eisen, die in die Platte eingelassen ist. Los, lasst mir nochmal den Kran mit dem Seil herunter. Schnell.»
Das Stahlseil mit Karabinerhaken surrte herunter, und der junge Mann, euphorisiert vom Rausch der Entdeckung, befestigte ihn an der Platte. «Und hoch. Vorsichtig!», gab er Befehl.
Das Seil geriet unter Spannung. Als ginge ein Riss durch den Stein, bewegte sich die Platte unheilschwanger und zitternd. Der Archäologe zwängte sich in die verbliebene Nische zwischen Mauer und ansteigender Steinplatte.
«Ja, gut so. Weiter! Gleich haben wir’s.»
Plötzlich gab es einen dumpfen Knall, als fiele ein massiger Stein zu Boden und zöge etwas anderes, etwas rostig Klirrendes hinterher. Noch bevor der Archäologe orten konnte, woher genau das unerwartete, seltsame Geräusch kam, zersplitterten die Steine der gegenüberliegenden Wand, und ein Eisengitter mit scharfen Spitzen schwang auf ihn zu. Er wich zurück, schloss die Augen und ergab sich in das Unvermeidliche.
Als würde eine Sehne reißen, einem dumpfen Ping gleich, fand das wuchtige Eisengitter einen Widerstand im Stahlseil, das die Last einer Tonne Stein trug. Der Stein schwankte gefährlich nahe an den neugierigen jungen Mann heran, der wie eine Assel in den Fugen des Gemäuers klebte.
Der junge Mann öffnete die Augen und starrte in eine Lanzenspitze, die keine Handbreit über seinem Brustkorb drohend verharrte. Diesmal weitaus vorsichtiger als zuvor, manövrierte er sich unter dem todbringenden Gitter hindurch, stieg auf die Platte und verschwand ins lichte Freie.
«Das war knapp. Da soll noch einer sagen, Archäologie wäre langweilig.»
Unter Mithilfe von Verstrebungen und starken Helfern konnte das Eisengitter in seine Ausgangslage zurückgedrängt und befestigt werden. Der zweite Versuch zur Anhebung der Platte gelang.
Ein ruhmreicher Ritter der Tafelrunde hätte nicht andächtiger und beeindruckender begraben werden können als dieser.
Den schmalen kahlen Schädel schützte noch im Tod ein mit Nieten und Edelsteinen besetzter Helm. Das schwere Kettenhemd hatte den Brustkorb vollends eingedrückt, und die Füße steckten in ledernen Stiefeln, die durch kunstvoll geschmiedete Platten die Schienbeine vor den Hieben der Angreifer bewahren sollten. Seine Arme lagen verschränkt über der Magengrube. In der linken knochigen Hand hielt er eine Franziska, ein fränkisches Wurfbeil, und in der rechten einen runden, etwa eine Armlänge messenden Zylinder. Über allem jedoch, vom Nasenbein bis zu den Füßen reichend, war ein Schwert platziert, das ihn als mutigen und treuen Kämpfer auswies.
Mayfarth war jetzt nicht mehr zu halten. Mit einem Satz war er bei dem Krieger in der Grube und griff instinktiv nach dem Zylinder, den er behutsam in die Hände nahm. Er blies den Staub weg, starrte auf die kreisrunde, münzgroße Erhebung und wischte den übrigen Dreck von der Außenseite. Pures Gold funkelte ihm entgegen.
«Was ist es?», drängte der Bischof.
«Es ist…»
«Sagen Sie schon.»
«Das Siegel des Römischen Reiches.»
«Und nun eile, rette dich vor den Hunden des Satans, die sich heute Nacht vor meiner Türe versammeln, um das wahre Wort zu töten. Vor allem, mein geliebter Sohn Chamar, hüte, vor aller Welt verborgen, was ich dir aufgeschrieben und mitgegeben. Beschütze es, als wär’s dein Leben.»
«Und du, mein Vater, ehrwürdiger Cilline, was geschieht mit dir?»
«Sorge dich nicht um meinetwillen, ich werde den Tod nicht schmecken. Wahrlich, ich sage dir, noch heute werde ich im Reich meines Herrn und Erlösers sein, mit ihm an einem Tische sitzen und für alle Zeiten an seinem Heile teilhaben…»
II.
«Jetzt mal ehrlich: Glauben Sie an Schicksal?»
Sie lehnte sich nach vorn, blickte mir tief in die Augen.
«Dass alles, was einem widerfährt, von einem höheren Wesen von langer Hand, wie in einem Theaterstück, inszeniert ist und wir nicht den Hauch einer Chance haben, selbst etwas daran zu ändern?»
Ich schwieg und überließ ihr die Antwort.
«Das würde zum einen bedeuten, dass Sie nicht zurechnungsfähig sind, und zum anderen, dass Sie unschuldig sind, da Sie ja ferngelenkt werden und nicht selbst entscheiden können. Der Strippenzieher müsste sich dann für Ihr Handeln verantworten. Eigentlich nicht schlecht, der Gedanke, könnte man diesem Wesen nur habhaft werden.»
Wieder schwieg ich.
«Oder gehören Sie eher zu der Fraktion, die meint, über einen freien Willen zu verfügen, ganz Herr über sich und die Welt zu sein und somit die Verantwortung für jede Handlung übernehmen zu müssen?»
Sie begann mich zu langweilen. Ich hörte nur noch mit halbem Ohr, was sie zu sagen hatte.
«Das klingt in der heutigen Zeit ziemlich sexy, da es einem das Hochgefühl gibt, individuell und frei zu sein, hat aber den Nachteil, dass man Sie jedes Mal am Arsch kriegen kann, wenn Sie einen Fehler machen, egal ob vorsätzlich oder fahrlässig. Ihre einzige Chance auf Rettung hieße dann Zufall. Doch selbst dann kämen Sie nicht ungeschoren davon, da unsere Gesellschaft darauf aufgebaut ist, einen Schuldigen zu präsentieren, damit die Volksseele weiter an die Gerechtigkeit glauben kann, Auge um Auge sozusagen.»
Ich gähnte hinter vorgehaltener Hand.
«Oder sind Sie eher der Kommt-drauf-an-Typ, der sich das Beste aus den beiden Varianten herausholt, gerade so, wie es ihm in den Kram passt? Jemand, der Schwarz und Weiß ablehnt und nur Grautöne auf Erden gelten lässt. Dann müsste ich Ihnen vorwerfen, dass Sie charakterlos sind. Mindestens. Vielleicht sogar gemeingefährlich. Also, entscheiden Sie sich: Wer oder was sind Sie?»
Ah ja, die harte Tour war jetzt an der Reihe, der Schlussspurt sozusagen. Ich musste grinsen und ließ den Bleistift erneut zwischen meinen Fingern kreisen. Weitaus interessanter als dieser lächerliche letzte Versuch, mich aus der Reserve zu locken, war der züchtig um den Hals gewundene rote Seidenschal, der wie ein Tulpenkelch in ihrem Dekolleté endete. Anstatt meine Aufmerksamkeit durch diese Verkleidung auf ihre bemüht bohrenden Augen und Fragen zu lenken, erreichte sie genau das Gegenteil. Ich fragte mich die ganzen geschlagenen fünfundvierzig Minuten, die diese Befragung über meinen Antrag auf vorübergehende Freistellung aus dem Staatsdienst nun schon dauerte, wohin dieser Kelch mich wohl führen wollte.
«Kommissar Kilian», fragte sie eindringlich, «haben Sie mich verstanden? Ist Ihnen bewusst, welche Tragweite das Ergebnis dieser Befragung für Sie und Ihre weitere Laufbahn haben wird?»
«Davon gehe ich aus, Frau Doktor», erlöste ich sie nach einer angemessenen und gut überlegten Pause, die ihr meine Aufmerksamkeit und die Ernsthaftigkeit ihres Unterfangens dokumentieren sollten. Ich war mir meiner Sache sicher und ließ dieses hoffentlich letzte Gespräch über mich ergehen, das den entscheidenden Aufschluss über meine psychische Verfassung und Belastbarkeit geben sollte. Burn-out-Syndrom hatte ich als Grund zur Freistellung auf dem Formular angegeben.
Ich musste weg, schnell und weit. Nur war die Sache nicht so einfach. Schröder, mein Mentor beim bayerischen LKA, war meine letzte Verbindung nach München gewesen. Nach seinem Abgang in die Hölle – möge er dort schmoren bis zum Jüngsten Tag – war ein neuer Mann von außerhalb nachgerückt und hatte gründlich aufgeräumt. Jeder, der mit Schröder, diesem korrupten Verräter, und der Jagd nach den Rosenholz-Dateien zu tun gehabt hatte, war vorsorglich in die Walachei versetzt worden oder sah sich dem Misstrauen des «Inneren Kreises», wie er genannt wurde, gegenüber. Auslandseinsätze, gleich in welcher Form, waren fortan diesem erlauchten Kreis vorbehalten. In meinem Fall war die Sache einfach: Ich wurde offiziell in die Polizeidirektion Würzburg eingegliedert. Adieu, LKA. Das kam einer Strafaktion gleich, zumal ich den Sklaventreiber Oberhammer vor mir hatte.
Selbst Susanne Straßer, meine letzte Hoffnung bei der Staatsanwaltschaft München, war dahin. Auch sie musste vor der Inquisition nach Schröders Enttarnung in Deckung gehen. Ich war ausgekontert und schachmatt. Dem Apparat ausgeliefert und unfähig, aus eigener Kraft an meinem Schicksal etwas zu ändern.
Bis auf die Freistellung, das Sabbatjahr, meine letzte Karte, die ich spielen konnte. Und selbst darum musste ich jetzt kämpfen, damit diese Psychologin ihre Unterschrift unter den Schrieb setzte und ich meine Ruhe hatte. Ein Jahr lang, auf eigenen Wunsch… und ohne Bezahlung. Ich hatte von diesem Affentheater die Nase voll und wollte der Sache nun schnell ein Ende bereiten.
«Frau Doktor», begann ich, «oder darf ich Luzia sagen?»
«Nein, das dürfen Sie nicht, Herr Kilian.»
«Nun gut, Frau Doktor Brühne-Wels…» Mein Gott, was für ein bescheuerter Name, müssen diese Zicken immer Doppelnamen haben? «…lassen Sie es mich so ausdrücken: Welcher Typ ich bin, ob ich an dieses oder jenes glaube, kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Ich weiß es schlicht selbst nicht. Wahrscheinlich glaube ich an gar nichts. Verstehen Sie, an rein gar nichts. Ob es ‹da oben› einen Strippenzieher gibt oder nicht, interessiert mich nicht, solange er mir nicht in die Quere kommt. Ob ich Herr meiner eigenen Gedanken bin, sofern ich überhaupt welche habe, kann ich Ihnen nicht beantworten. Dazu müsste ich mir einbilden, dass ich frei von Konventionen, Zwängen oder, in diesem Fall, frei von Ihrem ärztlichen Wohlwollen bin. Dass dem nicht so ist, das wissen Sie wohl besser als ich. Und zu guter Letzt, hier in diesem Verein kein Opportunist zu sein verbietet der gesunde Menschenverstand. Und weil wir’s gerade davon haben, wie schaut denn das Psychogramm unseres Polizeidirektors Oberhammer aus, nachdem er mit dem lieben Kollegen Schröder den Sicherheitsgipfel Ende Oktober gehörig in Gefahr brachte? Ich wette, das aus München angeforderte Profil liegt passwortgeschützt und in einer anderen Version, nämlich der wahren, auf Ihrem Rechner und ist Ihre letzte Trumpfkarte, wenn die Hütte brennt. Würden Sie das nun charakterlos, gemeingefährlich oder eher verschlagen nennen, Frau Doktor? So, das war’s. Ich hoffe, ich konnte Ihre Frage zu Ihrer Zufriedenheit beantworten.»
Ich lehnte mich zurück, wartete auf ihre Reaktion. Das Ping meines Zippos, ein tiefer Zug am Zigarillo und ein Lächeln ohne viel Anstrengung erfüllten die Stille des Raumes.
Sie sah mich eine ganze Weile stumm, ohne eine Miene zu verziehen, an. Dann kritzelte sie emotionslos ihren Namen unter das Gutachten, das wenige Minuten später auf dem Tisch Oberhammers landen und meine Freistellung aus dem Dienst für ein Jahr befürworten würde. Sie stand auf, packte die Unterlagen zusammen und reichte mir die Hand. Ich erhob mich ebenfalls und war gespannt, was sie sagen würde.
«Wir sehen uns in einem Jahr wieder. Ich wünsche Ihnen gute Erholung.»
Bingo. Ein Ruck durchfuhr meinen Körper und ich verspürte einen Hauch, nein, einen Windstoß, der nach Freiheit schmeckte.
Sie ging und gab Heinlein die Klinke in die Hand, der die ganze Zeit über gespannt auf dem Gang gewartet hatte.
«Und, wie ist es gelaufen?», fragte er ungeduldig.
«Geschafft. War aber ein hübsches Stück Arbeit.»
«Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll.»
«Du hast mir doch dazu geraten, ansonsten hätte ich ganz gekündigt.»
«Trotzdem finde ich es nicht gut, dass du dich vom Acker machst. Lässt mich einfach alleine zurück. Dabei haben wir doch so gut zusammengearbeitet.»
«Schorsch, jetzt hör auf. Ich weiß noch genau, wie du mich damals am Flughafen in Frankfurt abgeholt hast. Da hättest du mich am liebsten gleich in die nächste Maschine zurück nach Genua verfrachtet.»
«Kein Wunder. Wer so blasiert daherkommt wie du seinerzeit, kann gleich wieder ab. Da fackeln wir gar net lang rum.»
«Dann hast du jetzt ja, was du wolltest.»
«Jetzt hör auf, so mein ich’s doch gar nicht.»
«Wie sonst?»
«Du hast dich verändert. Aus dem Arsch von damals…»
«Na, sag schon.»
«Du blöder Affe, du weißt genau, was ich sagen will.»
«Nee, echt nich.»
«’n echter Kumpel halt.»
«Ouh, Schörschle», bemühte ich die letzten Brocken Fränkisch, die ich noch beherrschte, legte den Arm um seine Schultern, nahm ihn mit hinaus auf den Weg zum Diensthabenden, um Marke, Ausweis und Waffe abzugeben, und versprach ihm dabei: «Weißt du, ich mach jetzt erst mal ein paar Tage richtig Urlaub. Dolce far niente.»
«Was?»
«Ja, nix halt. Die Italiener nennen das sogar eine Kunst.»
«Die spinnen. Nix schaffen, wie soll denn das Kunst sein.»
«Genau so, wie wenn du den ganzen Tag an ’nem Strand in Frankreich liegst und von kleinen Französinnen träumst. Und das Tag für Tag. Sonst nix.»
«Woher weißt du das mit meinen Französinnen?»
Es gab da nur einen Haken. Ab heute war ich zwar frei und ungebunden, aber ich war blank wie eine Kirchenmaus.
Alles, was meine Brieftasche noch ausspuckte, waren lumpige 150Euro und eine goldene Diners, bei der ich nicht mal im Traum daran denken sollte, sie noch ein letztes Mal einzusetzen. Mein Konto war geräumt bis in alle Tiefen der Kreditwürdigkeit. Die mahnende Post hatte ich im Briefkasten stecken lassen, um zumindest den Eindruck zu erwecken, dass ich auf Reisen war, falls einer der Geldeintreiber mal vorbeischauen sollte.
So saß ich am Mainkai in einer angenehmen Frühlingssonne, kurz bevor sie über der Häuserzeile am Zeller Berg untergehen sollte, und blickte den Fluss hinunter. Um mich herum liebeshungrige Pärchen, Omas und Opas in stiller Eintracht sowie einige Skater, die Kreise vorm Biergarten am Alten Kranen zogen. Ein Bild für vergilbte Ansichtskarten und ihre fremdsprachigen Käufer, die Freunden und Familien in aller Welt einen Eindruck vom schönen barocken, aber auch braven Würzburg vermitteln wollten. Ich hätte gern mit einer dieser Briefmarken getauscht, um ein paar Stunden später im Flugzeug aus dem Postsack zu klettern.
Verlottert wie der letzte Penner stieg er vom Kahn. Das Schiff trug den Namen Lisa und fuhr Kohlen unter niederländischer Flagge mainaufwärts. Gestützt auf einen Wanderstab, der ihm bis zum Kopf reichte und sich am Ende einem Kreis gleich wand, dankte er dem Kapitän und schlug das Kreuzzeichen mit feingliedriger Hand über dessen Haupt. Dann drehte er sich um und schleppte sich geradewegs auf mich zu. Ein dürres Klappergestell, aber fast zwei Meter groß, wenn er sich nicht bückte. Er ließ sein linkes Bein seltsam einknicken, sobald es eine kritische Beuge erreicht hatte, und zog es dann abrupt nach, den Wanderstab stets einen Schritt voraus.
Über die Schultern hatte er eine speckige, ausgebeulte Ledertasche gehängt. Darunter kam eine teils zerrissene und notdürftig geflickte graue Kutte zum Vorschein, die mit einer Kordel um die schmale Hüfte gehalten wurde. Die Kapuze hing weit in die Stirn hinein, sodass ich sein Gesicht nicht sehen konnte. Mein Blick wanderte nach unten, und ich sah bloße Füße in offenen Ledersandalen. Ziemlich abgefahren, dachte ich, als er auf Höhe meiner Bank angekommen war.
«Pax tecum», sagte er mit freundlicher und bestimmter Stimme, die keinen Zweifel an der Ernsthaftigkeit seiner Worte offen ließ. Das Haupt hielt er geneigt, und er stützte sich weiterhin auf den Wanderstab, als gelte es, die ganze Last dieser Welt zu tragen.
«Et spiritus sanctus cum te, pater», antwortete ich, die letzten Reste meines knappen Lateinwissens aufbietend. Ich staunte über mich selbst, wie mir diese Worte noch fließend über die Lippen gingen, hatte ich sie doch so lange nicht mehr gehört, geschweige denn gesprochen. Ein Schauder lief mir über den Rücken. Alte Ministrantenzeit.
Er blieb stehen und hob den Kopf. Aus dem Dunkel seines Gesichts blitzten zwei Augen. Ein Lächeln in diesem nun sichtbaren, wundersam zerfurchten Ledergesicht strahlte mich an. Ein Totenkopf, durchfuhr es mich. Die Zähne überraschend gepflegt und, soweit ich sehen konnte, alle vorhanden, überlagert von einer langen, markanten Nase, die wie gemeißelt zwischen hohen, hervorstehenden Wangenknochen die beherrschende Achse in seinem Gesicht bildete. Darüber schwangen sich graue Brauen nach außen, die nahtlos in das reiche, gleichfarbige Haar übergingen. So hätte Jesus wohl ausgesehen, wäre er älter als dreiunddreißig Jahre geworden.
«Vater… schon lange hat mich niemand mehr so genannt.» Er zögerte einen Moment, wusste nicht, ob er weiterziehen sollte oder nicht, setzte sich aber dann doch zu mir.
Mein Gott, schoss es mir die Nase hoch, und ich musste mich abwenden. Er war nicht nur abgerissen, sondern stank auch nach Diesel, Kohlenstaub und Pisse. Zudem kam er mir gefährlich nahe. Meinem persönlichen Feiertag angemessen, hatte ich einen meiner Armanis aus dem Ruhestand erlöst.
«Wer bist du, Freund?», fragte er.
Dabei stützte er sich auf den Stab und lehnte sich vornüber, als wollte er mir die Beichte abnehmen. Sein Gesicht verschwand wieder hinter der Kapuze, sodass ich nur noch die Spitze seiner Nase sehen konnte.
«Mein Name ist Kilian», antwortete ich und schnappte über die Schulter nach frischer Luft.
Die Kapuze bewegte sich augenblicklich.
«Kilian? So hieß auch der Bruder, der das heilige Wort aus dem fernen Scotia nach Gallien und ins Frankenreich trug. Ein ehrenwerter Name. Im Gälischen wurde er ‹Cilline› genannt. Er lehrte uns alles, was wir über Gott, unseren Herrn und Schöpfer, den Glauben an ihn und über das wahre Leben wissen mussten. Aus seinem Munde hättest du augenblicklich das Himmelreich vernehmen können.»
«Das Himmelreich», schmunzelte ich.
«Glaubst du nicht», fragte er mit sanfter Stimme, «an das Reich unseres Herrn und Schöpfers, das da kommen wird?»
«Entschuldige, Vater», unterbrach ich sofort, um eine drohende Predigt über Heil und Unheil, Gott als Richter am Jüngsten Tag und die zu erwartende Ermahnung abzuwehren, noch zu Lebzeiten den einen wahren katholischen Glauben zu praktizieren, damit ich dem Höllenschlund entginge. «Ich habe meinen Frieden mit dem Herrn, heißt er nun Jesus Christus, Mohammed, Shiva, Buddha oder Winnetou, gemacht. Keiner von ihnen kann mir vorschreiben, wie ich zu leben oder woran ich zu glauben habe. Alle waren Menschen und haben zu Lebzeiten Fehler gemacht. Da soll bloß keiner auf die Idee kommen, mir zu sagen, was richtig oder falsch ist. Und das Himmelreich, wenn es das überhaupt gibt, ist eine Veranstaltung, auf die ich gar nicht so scharf bin. Kannst du dir vorstellen, bis in alle Ewigkeit zu lächeln, keine Lust auf gutes Essen und Trinken mehr zu haben? Ganz ohne Frauen…»
Der Bruder unterbrach mich mit lautem Lachen und warf den Kopf nach hinten, sodass seine Kapuze in den Nacken fiel und langes, gewelltes Silberhaar freilegte.
«O Kilian», prustete er. Das dürre Gerippe geriet gefährlich in Wallung.
Ich verstand nicht. «Was gibt es da zu lachen?»
Er beruhigte sich und zog die Kapuze wieder über Haar und Stirn.
«So wie du über Gott und sein Reich sprichst, habe auch ich keine rechte Lust darauf. Glaube mir, auch ich bin ein Mensch. Aber ich und auch du sind mehr als das.»
«Ach ja, der Odem des Herrn.»
«Wenn du so willst, auch sein Odem. Aber das Entscheidende ist doch, dass du überhaupt keine Wahl hast. Du bist sein Geschöpf, ein Teil von ihm, und ob du nun willst oder nicht, eines Tages wirst du wieder zu ihm zurückkehren, egal, wie du ihn nennst, und egal, wo er sich aufhält.»
«Ich verstehe nicht, du bist allem Augenschein nach ein katholischer Mönch oder gehörst zumindest dieser Kirche an. Wie kannst du so reden?»
«Du meinst, dass ich nicht viel von dieser Drohung der ewigen Verdammung halte, falls man nicht beizeiten umkehrt? Hör gut zu, mein Kilian, zu glauben heißt weit mehr, als die richtige Religion zu wählen, zum richtigen Gott zu beten oder ständig das Richtige zu tun. Glauben heißt, die frohe Botschaft zu verkünden, ohne Angst das Leben, das einem gegeben ist, zu leben und sich von nichts und niemandem einreden zu lassen, dass an einem etwas verkehrt ist. Ansonsten müsste ja auch an unserem Schöpfer etwas nicht stimmen. Er hat uns ja nach seinem Ebenbild geschaffen, wie es geschrieben steht.»
«Und was ist mit der Sünde, den Versuchungen des Teufels, der uns vom rechten Weg abbringen will? Wird uns nicht immer gepredigt, dass wir für das büßen müssen, was wir verbrochen haben?»
Unter der Kutte bebte es, und ich hörte ihn kichern.
«Verdammt nochmal, was ist so lustig?!»
«Beruhige dich», erwiderte er mit sanfter Stimme. «Ich lache nicht über dich persönlich. Es ist nur so… du klingst wie der Diener eines Herrn, eines sehr weltlichen natürlich, und du redest, als hättest du deinen Verstand und dein Herz an der Garderobe abgegeben. Beim ersten Widerspruch plapperst du schön brav wieder, was du über Jahre eingetrichtert bekommen hast. Fast wie im Kuhstall.
Disziplin, die für dich offensichtlich so wichtig ist, ist das Gefängnis, in dem du sitzt. Solch ein abgeriegelter Raum kann ganz angenehm sein, wenn man sich damit abgefunden hat und keine großen Ansprüche stellt. Man bekommt täglich sein Essen, wird geweckt und wieder zu Bett geschickt. Doch was ist, wenn du aus dem Fenster schaust, ich meine, aus dem kleinen, hellen Loch in der Wand deines Bewusstseins? Siehst du dort nicht freie Menschen, die sich ohne Anweisung und Befehl bewegen und leben sollten?»
«Ja, aber worauf willst du eigentlich hinaus?»
«Glauben heißt frei sein. Im Herzen, im Kopf und in der Seele. Alles, was dem widerspricht, ist unrecht, ist gegen Gott. Verstehst du? Gott ist frei, und er hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen. Jeder, der dir etwas anderes erzählen will, macht dich unfrei und will etwas von dir haben. Jeder, der gegen diese gottgegebene Freiheit in dir vorgeht, ist ein Tyrann, dein ganz persönlicher Beherrscher.
Kämpfe für die Freiheit, damit du frei sein kannst, um an das zu glauben, was bereits in dir ist und nach draußen drängt. Das ist der wahre Glauben. Nichts anderes.
So wie mein Held Jesus Christus gegen die Unfreiheit in seinem Leben, in unser aller Leben gekämpft hat, so will auch ich kämpfen. Diesen weltlichen Tempel niederreißen und ihn neu aufbauen. Einen neuen Tempel in den Herzen der Menschen, so wie es Christus uns aufgetragen hat. Den Glauben an einen wahren, freien Gott, den es noch immer gibt. In jedem von uns. Das ist der Grund für mein Leben, deswegen bin ich hier.»
Ich klebte an seinen Lippen, als er diese Worte sprach, die wie ein Grollen aus allen Himmeln, offen und hell, auf mich herniedergingen. Der Bruder stand vor mir wie ein furchtloser Kämpfer, den Stock, die Waffe der Armen, fest in der Hand, den Mut, gegen einen übermächtigen Gegner anzutreten, fest in der Seele verankert.
«Doch nun muss ich gehen», sagte er.
«Wohin willst du?»
«Du wirst es bald erfahren.»
Er schlug das Kreuzzeichen über mich und ging davon. Humpelnd, das linke Bein nachziehend, nach vorn gebückt schleppte er sich Richtung Dom.
«Wie heißt du, Vater?», rief ich ihm nach.
Er drehte sich um und lächelte mir zu. «Alvarez. Man nennt mich Bruder Alvarez. Gott segne dich.»
Gott, fragte ich mich, wieso sollte gerade er mich noch segnen? Ich hatte mich schon längst aus seiner Obhut verabschiedet. Was war eigentlich der Grund dafür gewesen? Ich überlegte eine ganze Weile. Ergebnislos. Ich wusste es nicht mehr. Er war mir irgendwie abhanden gekommen.
III.
Wer weiß, was uns da erwartet, hatte sich der Bischof gefragt. Das Siegel des Römischen Reiches versprach eine Sensation. Eigentlich hätte er die Nachricht umgehend an den Vatikan weiterleiten müssen. Bei Funden dieser Kategorie auf dem Gelände eines Bistums der heiligen katholischen Kirche würde die römische Verwaltung kaum abwarten, was unter den Augen eines Bischofs im fernen Deutschland zum Vorschein kam, sondern sofort alle weiteren Forschungen untersagt haben, bis ein Spezialist der Kurie angereist war. Dieser Order hätte sich der Bischof keinesfalls entziehen dürfen.
Auch sein Bau- und Kunstreferent Dr.Mayfarth wusste das. Gemeinsam hatten sie die Entscheidung getroffen, sich von Rom nicht in die Suppe spucken zu lassen und die Nachricht erst am Abend, wenn die meisten Würdenträger den Vatikan bereits verlassen hatten, durchzugeben. Somit blieb ihnen zumindest noch eine Nacht, bis die örtlichen Medien am folgenden Tag die Nachricht in alle Welt posaunten.
Vor den Fenstern des Landesamtes für Denkmalpflege in der Residenz hatten sie bereits Aufstellung genommen und harrten ungeduldig mit Mikrophonen und Kugelschreibern der bevorstehenden Sensation. Einige hatten Steigleitern, andere Stühle und gar kleine Bühnen für die Kameras in Erwartung einer Ansprache des Bischofs mitgebracht. Eine stattliche Ansammlung von Bauarbeitern, örtlichem Klerus, Lokalpolitikern und städtischer Prominenz bildete mit den Presseleuten eine brodelnde Gerüchteküche.
Der Bischof hatte eine gut überlegte Wahl getroffen, wer bei der Öffnung des Zylinders anwesend sein durfte. Am Tisch saßen ein Archäologe, das notwendige Arbeitszeug fein säuberlich aufgereiht, vor ihm das mirum corpus aureum, dahinter sein Chef, verantwortlich für alle Ausgrabungsarbeiten in Nordbayern, neben ihm der Bau- und Kunstreferent Dr.Mayfarth.
«Nun dann, gehen wir’s an», verlangte der Bischof und faltete die Hände vor der Brust, die das daran hängende Kreuz für den entscheidenden Augenblick verdecken sollten.
«Sind Sie wirklich sicher?», fragte der Chef der Denkmalpflege. Er legte die Hand auf die Schulter seines jungen Angestellten, der enttäuscht das dünne Messer sinken ließ.
«Nur zwei Dinge sind sicher», fuhr ihn Mayfarth an, «der Tod und das Amen. Also, legen Sie nun endlich los, bevor ich es selbst tue.»
«Herr Bischof, Sie wissen, dass wir unbefugt handeln. Das könnte Sie und mich den Job kosten. Ich bin angewiesen, jeden bedeutenden Fund, sei es auf Kirchenboden oder auf Staatsgrund, umgehend nach München zu melden.»
«Ob der Zylinder nun bedeutend ist oder nicht, wollen wir ja gerade herausfinden», entgegnete der Bischof. «Jeder von uns beiden kann anschließend seiner Pflicht nachkommen. Stellen Sie sich vor, wir öffnen ihn, und er ist leer.»
«Oder es ist ein Micky-Maus-Heft drin», witzelte der Archäologe.
«Es reicht», mischte sich Mayfarth ein. «Sollen wir warten, bis die Münchner oder die Römer kommen und uns das Ding einfach wegnehmen? Ich müsste mit allen Plagen des Alten Testaments geschlagen sein, wenn ich das zuließe. Lassen Sie uns endlich zur Tat schreiten und uns nicht länger blamieren. Die Presse wartet. Und die Vergangenheit auch.»
«Oder es ist die Büchse der Pandora», mischte sich der Archäologe erneut ungefragt ein.
«Oder ein tödlicher Bazillus wie in den Pharaonengräbern», fügte sein Chef hinzu.
«Oder das Gebiss meiner Oma, verdammt nochmal», schimpfte Mayfarth und entriss dem Archäologen das Handwerkszeug.
«Schluss jetzt!», befahl der Bischof. Seine Faust fiel auf den Tisch und schaffte endgültig Klarheit über die weitere Vorgehensweise. «Seid ihr denn alle verrückt geworden? Was soll erst werden, wenn wir herausfinden, was da drin ist?»
Die kritischen Einwände der Archäologen verstummten ob der entschiedenen Worte. Mayfarth legte zustimmend das Messer in weltliche Hände zurück. Der Archäologe setzte mit eifrigem Entdeckerdrang das Messer an der schmalen Rille an, die sich zwischen Zylinder und Deckel an der Seite befand. Das Unterfangen gestaltete sich schwieriger als vermutet. Immer wieder drang die Spitze nicht durch die harte Füllmasse, ein ums andere Mal rutschte sie ab und drohte den Mantel zu beschädigen.
«Scheint irgendeine Mischung aus Harz zu sein, die sich verhärtet hat», erklärte der Archäologe.
«Und was bedeutet das?», fragte der Bischof.
«Dass es alt ist», antwortete Mayfarth.
«Dann kommt jetzt das schwere Gerät zum Einsatz», sagte der Archäologe. Er nahm einen elektrischen Bohrer zur Hand, der jedem Zahnarzt zur Ehre gereicht hätte, und schaltete ihn an. Eine winzig kleine Scheibe fräste sich fiepend in die Ausfüllung. Wenig später war die Operation beendet. Ein Fenster wurde geöffnet, damit sich der Staubnebel lichten konnte. Die verschworene Gemeinschaft trat an den Tisch. Fiebrige Augen harrten auf den Moment der Offenbarung. Der Bischof nickte auffordernd.
Zum Vorschein kam eine vergilbte, braune Rolle, die behutsam in der Mitte des Tisches platziert wurde.
«Schaut nach Papyrus aus», sagte der Archäologe.
«Ich kann nur noch einmal warnen», ereiferte sich der Chef der Denkmalpflege über vorschnelle und folgenreiche Schritte.
«Ruhe!», beschied der Bischof. Auf einen kurzen, zustimmenden Blickkontakt mit Mayfarth folgte die Entscheidung. Nun gab es kein Zurück mehr.
«Öffnen Sie es.»
Einer der größten Irrtümer der Menschheit lautet: Alle Wege führen nach Rom.
Ich wusste, dass mir der schwerste Gang meines Leben bevorstand. Nie und nimmer wollte ich es so weit kommen lassen. Das hatte ich mir im Alter von sechzehn Jahren geschworen, als ich mit Sack und Pack zu Hause aus- und bei meiner damaligen Freundin einzog. Das war die ultimative, längst überfällige Abnabelung von Brust und Schoß meiner Mutter. Die Entscheidung, fortan selbstbestimmt, frei und eigenverantwortlich zu sein, ohne Rechenschaft ablegen oder jemanden um Erlaubnis fragen zu müssen, war längst überfällig. Endlich Mann.
Ihre unheilschwangere Prophezeiung, dass ich alsbald wieder jammernd vor ihrer Tür auftauchen würde, wenn mir das Geld und/oder die Frauen ausgingen, quittierte ich mit dem überschäumenden Elan eines Halbwüchsigen: «Lieber schlaf ich unter den Brücken.» Diese Tür war zu. Für immer.
Sag niemals nie. Noch so ein blöder Spruch. Aber er stimmte. Ich war der lebende Beweis. Ich brauchte ihre Hilfe.
«Johannes?!»
«Hallo, Mama.»
«Was machst du denn hier?»
«Ich war gerade in der Gegend und dachte, ich schau mal vorbei.»
«Das ist schön. Komm rein, ich mach uns ’nen Kaffee.»
«Mach dir bloß keinen Stress wegen mir.»
«Das ist doch keine Arbeit, wenn der einzige Sohn einen mal besucht. Obwohl man ja gleich um die Ecke wohnt.»
O Mann.
«Weißt du, es war total viel los im Büro.»
«Jaja.»
«Echt, wenn ich’s dir sage.»
«Du kannst mir doch nichts vormachen. Als Mutter weiß man Bescheid.»
Klar.
«Wie geht’s dir so?»
«Wie soll es einem schon gehen… jeden Tag das Gleiche. Man steht auf, alleine, macht sich das Frühstück, alleine…»
Nicht schon wieder diese Platte.
«Mutter, wie geht es dir?!»
«Na, wie ich schon sagte, wie soll es einer alten, kranken Frau schon gehen, so alleine.»
«Also, wie immer.»
«Mach dich bloß nicht lustig über mich. Ich sollte dich mal wieder übers Knie legen und…»
«Mama, du hast mich nie übers Knie gelegt. Du hast Kochlöffel benutzt.»
«Was für Kochlöffel?»
«Du hast mich immer mit ’nem Kochlöffel aus Holz durch die Bude gejagt, wenn was los war.»
«Ich? Dich? Niemals.»
«Und ob. Hier sind die Narben.»
«Schweig still. Ich habe dich niemals geschlagen.»
Okay, dann eben nicht. Alles nur Einbildung gewesen.
«Wie geht’s deinem Galan?»
«Wem?»
«Na, deinem Begleiter durch die goldenen Tage des Herbstes?»
«Ausdrücke hast du. Er ist auf Reisen. Erbschaftsangelegenheiten.»
«Und da lässt er dich einfach so ganz alleine hier sitzen? Na, das ist mir aber ein schöner Kavalier.»
«Johannes!»
«Ja, Mutter?»
«Misch dich nicht in fremde Angelegenheiten, die dich nichts angehen.»
Meinte ja nur.
«Wie geht’s eigentlich deiner Freundin, dieser Ärztin. Wie heißt sie gleich wieder?»
«Das weißt du ganz genau!»
«Mein Gott, jetzt brüll mich doch nicht so an. Ich habe doch nur…»
«Pia, Mama. Ihr Name ist Pia. Kurz und leicht zu merken.»
«Genau, Pia. Ihr seid so ein schönes Paar, als ich euch das letzte Mal Arm in Arm auf der Straße gesehen habe.»
«Ich bin nie mit Pia Arm in Arm auf der Straße gelaufen. Da musst du mich verwechselt haben. Oder sie war mit jemand anderem unterwegs. Das ist wahrscheinlicher.»
«Jetzt hör aber auf. Eine Mutter wird doch ihr eigenes Kind erkennen, wenn es einem mal begegnet.»
Es ist sinnlos.
«Magst du noch immer nur Zucker in deinen Kaffee?»
«Ja.»
«Johannes, das ist ungesund.»
«Was?»
«Nur Zucker in den Kaffee. Das schmeckt doch nicht, und außerdem ist er dann viel zu stark. Du musst an dein Herz denken.»
«Mein Herz ist voll okay. Ich mach mir eher Sorgen wegen deinem.»
«Wieso?»
Das war ein Fehler. Korrektur, anderes Thema.
«Sag mal, kommst du eigentlich so klar, ich meine, mit deiner Rente?»
«Hör bloß damit auf. Am ausgestreckten Arm lassen einen diese Sozis verhungern, am ausgestreckten Arm. Das bisschen Geld reicht ja nicht mal für ein anständiges Begräbnis.»
«Noch bist du nicht tot.»
«Mein ganzes Leben habe ich sie gewählt, damit es einem mal besser geht im Alter. Und was ist der Dank? Wenn das der Willy noch erlebt hätte. Der würde sich im Grab umdrehen.»
«Dann wähl sie ab.»
«Wenn ich das noch erleben sollte. Es kann ja jeden Tag vorbei sein. So aus heiterem Himmel.»
«Mama, du lebst, und so, wie du ausschaust, wirst du mich wahrscheinlich überleben.»
«Sag so was nicht, Johannes. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das eigene Kind vor einem stirbt.»
«War ja nur ein Scherz.»
«Mit solchen Sachen scherzt man nicht. Das kann jeden Tag passieren. Jeden Tag.»
Nun gut.
«Nochmal zurück zu deiner Rente. Kommst du wirklich klar?»
«Geht so. Brauchst mir nichts geben, wenn du das meinst. Aber es ist schön, wenn man spürt, dass das eigene Kind sich Sorgen um einen macht.»
Sackgasse. Wie sag ich’s ihr nur?
«Aus der Hinterlassenschaft vom Alten… von Vater ist nichts weiter übrig?»
«Da hat es nie was gegeben. Aber da warst du ja schon längst nicht mehr im Haus. Du hattest ja nur immer diese jungen Dinger im Kopf. Familie war doch nie ein Thema für dich.»
«Aber Mama, du weißt doch, dass du meine Familie bist. Das ist doch klar.»
Sie ist glücklich, und die beschämende Anfrage auf finanzielle Unterstützung liegt hinter mir.
Ich starre auf das Bild mit dem Trauerflor und auf das Kreuz an der Wand. Sie bemerkt es.
«Eine Tragödie, eine wirkliche Tragödie. Und ein großer Verlust. Nie wieder werden wir so einen Papst bekommen. Nie wieder. Die Kirche muss sich jetzt kräftig anstrengen, bei den Problemen, die die haben. Keiner will ja mehr Priester werden.»
«Kein Wunder.»
«Jetzt fang bloß nicht wieder davon an.»
«Wenn du meinst.»
«Kein Wort will ich davon hören.»
Pax nobiscum. Aber da ist noch ein anderes Bild an der Wand. Es zeigt mich als Ministranten beim Zeltlager im Kreise meiner Mitstreiter, kurz bevor die Ära der aufgebohrten Mofas beginnen sollte. In der Mitte des Lagerfeuers mein Ersatzvater.
«Sag mal, hast du eigentlich noch Kontakt zu Pater Nikola?»
«Und ob. Ich beichte ja noch jede Woche. Er nimmt sie mir ab. Er ist sehr verständnisvoll.»
«Wie bitte?»
«Unsinn, nichts von dem, was du dir in deiner schmutzigen Phantasie wieder ausmalst. Er ist ein sehr aufgeschlossener Diener des Herrn, gerade in der heutigen Zeit.»
«Soweit ich mich erinnern kann, stammt er doch aus Rom oder aus der Nähe?»
«Du müsstest dich einfach mal bei ihm melden. Er fragt oft nach dir, nach dem verlorenen Sohn, dem kleinen Kiliano.»
«Hat er nicht einen Bruder bei irgend so einer Versicherung in Rom?»
«Hatte er. Jetzt ist er Chef einer großen Bank, irgendwo im Ausland.»
«Du weißt nicht zufällig, wo?»
«Ach Gott, Johannes, was du wieder alles wissen willst.»
«Das wäre aber sehr wichtig für mich, Mama.»
«Wieso?»
Sie ahnt etwas.
«Es gibt da ein paar Entwicklungen. Nichts Dramatisches.»
«Gibt es Probleme auf der Arbeit?»
«Nein.»
«Mit Pia?»
«Nein.»
«Mit deinem Freund, dem Schorsch?»
«Nein, Mama, jetzt hör auf. Ich wollt mich nur mal erkundigen.»
Sie scheint beruhigt.
«Ich könnte ihn ja mal anrufen.»
«Das wäre Klasse, Mama. Am besten gleich noch heute Abend.»
«Ich mach doch alles für dich, mein Sohn.»
«Du bist ein Schatz.»
Ich küsse sie zum ersten Mal in meinem Leben.
Pater Nikola war der ältere der beiden d’Agostini-Brüder, und er war eine einzige Enttäuschung.
An ihm war es, die Dynastie der Bankiersfamilie in die nächste Generation zu führen. Dafür wurde ihm von Kindesbeinen an die beste Erziehung zuteil, die man für Geld bekommen konnte. Bis zu seinem 21.Lebensjahr hatte er sich der Familienräson gebeugt, bis er am Vorabend seines Geburtstags einen Schlussstrich zog. «Vater, Mutter», begann er, innerlich aufs Äußerste gespannt, «ich habe mein Studium in Harvard beendet und werde mich morgen in Bologna für Theologie einschreiben.»
Seine Mutter Alessandra schrie vor Überraschung kurz auf, bevor sie, ganz Grande Dame, ohne ein weiteres Wort in den Salon zu den wartenden Gästen zurückging.
Lorenzo, der unbestrittene und allmächtige Patriarch des Hauses und der Banco d’Agostini, schenkte sich in aller Ruhe einen Cognac nach, ging zum Kamin und blieb unter dem schweren Ölbild des übermächtigen Urgroßvaters Massimo stehen. Er würde Nikola nun für alle Zeiten zur Vernunft bringen.
«Du wirst nichts anderes und nirgendwo anders studieren, als es die Familientradition von dir verlangt», sagte er mit eisiger Bestimmtheit, kippte den Cognac in einem Zug hinunter und begab sich ebenfalls zurück in den Salon.
Das war das Letzte, was der Sohn von seinen Eltern gehört und gesehen hatte. Vor 41Jahren. Das Studium der Theologie absolvierte Nikola in Göttingen, zum Priester wurde er wenig später in Paderborn geweiht, und nach verschiedenen Auslandsaufenthalten übernahm er Ende der Sechziger schließlich eine Pfarrei im Bistum Würzburg.
Ich war einer seiner ersten Zöglinge. Mit mir erarbeitete er das System Widerstand, das eine Grundfeste meiner Persönlichkeit bilden sollte.
«Regel Numero uno: Niemand hat dir zu sagen, was du zu tun hast. Du bist ein freier Mensch, mit freien Gedanken und einem offenen Herzen.
Regel Numero due: Es gibt nur eine Ausnahme. Gott Vater, unser aller Herr, befiehlt dir anders.»
Nach all den Jahren im Ministrantendienst, wechselnden Erfahrungen im Religionsunterricht an wechselnden Schulen und unvergesslichen Erfahrungen mit anderen Seelsorgern blieb vom Nikola’schen Regelwerk nur noch die Regel Numero uno übrig. Die Stimme des Herrn hatte schon damals aufgehört, zu mir zu sprechen. Alle Versuche, selbst die von Nikola, ihr erneut Gehör zu verschaffen, schlugen fehl. Ich blieb taub auf dem göttlichen Ohr.
«Wie zum Teufel kommst du hierher?», fragte ich, Augen und Mund weit offen, als er in meiner Tür stand.
«Mit dem Teufel hat mich schon lange niemand mehr in Verbindung gebracht», antwortete Pater Nikola und trat auf mich zu. Er umarmte mich wie ein Vater seinen verlorenen Sohn und drückte mich, als gelte es, alles Leben aus mir herauszupressen.
«Genug, genug», stöhnte ich.
Er ließ los. «Schön, dass ich dich nochmal zu sehen bekomme, mein kleiner Kiliano. Wobei… aus dir ist ein richtiger Mann geworden. Groß, kräftig und, wie ich sehe», er blickte an mir vorbei auf die Umzugskartons mit den Armanis, Hemden und Schuhen aus italienischer Manufaktur, «auch ein Mann mit Geschmack.»
«Deine Schule, Onkel Nikola.»
«Lass den Onkel weg, mein Gott. Das ist ja ein Jahrhundert her. Darf ich hereinkommen?»
«Ja, klar.»
Ich gebe zu, ich war überrascht. Wie zum Teufel kam Nikola nur so schnell hierher? Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass meine Mutter der Bitte erst in den nächsten Tagen nachkommen würde.
Nikola nahm auf dem einzig vorhandenen Stuhl Platz, schenkte sich ungefragt und reichlich aus der letzten Flasche Carlos ein und prostete mir zu. Mit einem Schluck war das Glas leer, und ich wusste, dass es etwas zu besprechen gab.
«Deine Mutter hat mich angerufen», begann er wie eine Katze vor dem Sprung. «Sie hat mir erzählt, dass du in Schwierigkeiten bist und meine Hilfe brauchst.»
Ich schob einen der Kartons an den Tisch, setzte mich und füllte das Glas nach. «Und ich dachte schon, ich hätte vor ihr etwas verbergen können.»
«Du unterschätzt sie, wie immer.»
«Scheint so, sonst wärst du wohl nicht so schnell bei mir aufgetaucht.»
«Sie sagte mir, dass du Kontakt zu meinem Bruder Giulio aufnehmen willst.»
«Ich brauche einen Job. Besser, eine neue Perspektive.»
«Gefällt dir das Gendarmen-Leben nicht mehr? Ich dachte, du wärst auf dem besten Weg zum neuen Polizeipräsidenten der Stadt?»
«Ich habe gestern meinen Abschied genommen, vorübergehend zumindest, auf ein Jahr begrenzt. Wobei ich momentan nicht daran denke, nochmal in den aktiven Polizeidienst zurückzukehren. Ich suche nach einer neuen Herausforderung.»
«In einer Versicherung?»
«Wieso nicht? Sie zahlen gut, sind international tätig und brauchen immer gute Leute. So einen wie mich, der nicht viele Fragen stellt, sondern den Halsabschneidern und Betrügern auf die Schliche kommt. Und bei deinen Verbindungen habe ich mir gedacht, dass du mir diese Tür ein Stück öffnen kannst. Den Rest erledige ich selbst.»
«Du meinst, ich soll in deinem Namen Giulio anrufen.»
«Exakt. Er ist doch noch in Rom tätig?»
Nikola nickte wortlos und trank mein Glas leer. «Weißt du, Kiliano, das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Nachdem mein Vater gestorben war – und er hatte schriftlich verfügt, dass er mich zu seiner Beerdigung nicht an seinem Grabe zu sehen wünscht–, ist der Kontakt zu meiner Familie, meinen Bruder Giulio eingeschlossen, nicht gerade das, was man herzlich nennt. Giulio konnte und wollte unsere Bank nicht allein führen. Er war kein zweiter Lorenzo, obwohl unser Vater genau das von ihm erwartet und meine Mutter bis zu ihrem Ableben besessen daran gearbeitet hatte. Aber er war nicht so wie er. Niemand würde so sein wie er. Nach Vaters Tod bat mich Giulio, wieder nach Rom zurückzukehren und mit ihm zusammen den Vorsitz der Bank zu übernehmen, bevor ein anderer Teil der Familie, die Linie meiner Mutter, darauf Anspruch erhob.»
«Und wie ist es gelaufen?»
«Ich lehnte ab. Ich konnte doch nicht meiner Gemeinde den Rücken kehren, als hätte es die letzten dreißig Jahre nicht gegeben. Giulio war verzweifelt. Mit allen Mitteln hat er versucht, mich zu gewinnen. Doch vergebens. Das Ende vom Lied war, dass er aus dem Vorsitz zurücktrat und die Leitung einer Cousine und ihren Brüdern überließ. Seitdem herrscht Funkstille zwischen uns beiden.»
Auch das noch. Ich ließ den Kopf sinken und griff nach dem Glas. Doch Nikola war schneller.
«Aber es gibt da noch eine andere Möglichkeit», sagte er und kippte den Rest meines allerletzten Carlos.
Ich horchte auf. «Ja?»
«Sind die Kontakte zu meiner eigenen Familie auch schwach, so hat sich über die Jahre hinweg, nicht zuletzt durch die Verbindungen meines Vaters zur Vatikanbank und zur Politik, ein erfreulich guter Gedankenaustausch zwischen mir und Vertretern der römischen Kurie gehalten. Dort ist man unter anderem sehr an den Entwicklungen der Kirche in Deutschland interessiert. So konnte ich durch meine Arbeit den besorgten Gemütern im Vatikan die Bedenken nehmen, dass mit einer Bedrohung oder gar Zerstörung der heiligen Ordnung aus Deutschland zu rechnen sei. Eher gelte es, die vorherrschende Ordnung an die neuen Entwicklungen anzupassen. Aber das ist ein anderes Thema.
Was ich sagen will, ist, dass ich seit Jahren im Auftrag der Kurie in Europa unterwegs bin und neue Entwicklungen aufspüre, um Rom schnell damit vertraut zu machen.»
«Klingt interessant. Dann kommst du ja bestimmt viel rum. Ich beneide dich.»
«Kein Grund für Neid. Die Arbeit wächst mir dabei über den Kopf. Meine Gemeindemitglieder merken das nur zu gut und beginnen sich zu beschweren, wenn ich wieder auf Reisen bin. Daher habe ich mich entschlossen, etwas kürzer zu treten und einen Auftrag nach draußen zu geben. Und da dachte ich an dich.»