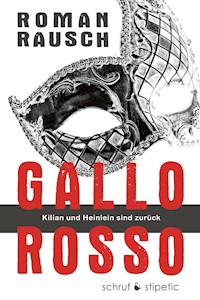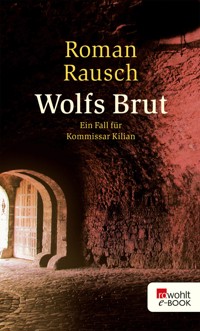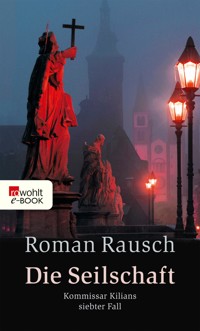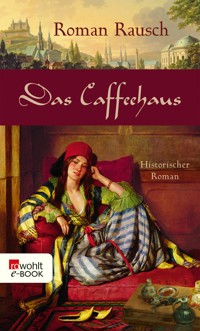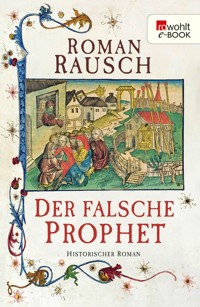7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hexen müssen brennen – und wenn es Kinder sind. Würzburg zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges: Grausam wütet der Hexenwahn, die Scheiterhaufen lodern höher als je zuvor. Als auch die alte Hebamme Babette sterben muss, schwört ihr Pflegekind Kathi Rache. Zusammen mit einer Freundin gibt sie an, auf einem Hexensabbat Bürger der Stadt gesehen zu haben. Die Nachricht vom Hexenflug der Mädchen verbreitet sich wie ein Lauffeuer, und bald kann niemand mehr seiner Haut sicher sein. Immer mehr Männer und Frauen fallen den tödlichen Bezichtigungen zum Opfer. Und am Ende sehen sich auch die Kinder selbst vom Feuertod bedroht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Roman Rausch
Die Kinderhexe
Historischer Roman
Über dieses Buch
Hexen müssen brennen – und wenn es Kinder sind.
Würzburg zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges: Grausam wütet der Hexenwahn, die Scheiterhaufen lodern höher als je zuvor. Als auch die alte Hebamme Babette sterben muss, schwört ihr Pflegekind Kathi Rache. Zusammen mit einer Freundin gibt sie an, auf einem Hexensabbat Bürger der Stadt gesehen zu haben. Die Nachricht vom Hexenflug der Mädchen verbreitet sich wie ein Lauffeuer, und bald kann niemand mehr seiner Haut sicher sein. Immer mehr Männer und Frauen fallen den tödlichen Bezichtigungen zum Opfer. Und am Ende sehen sich auch die Kinder selbst vom Feuertod bedroht …
Impressum
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Dezember 2011
Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Lektorat Werner Irro
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
(Foto: thinkstockphotos.de; Hippolyte Lecomte
© Château de Versailles, Frankreich/bridgemanart.com; Corbis.
Der Stich stammt aus der Topographia Franconiae von Matthäus Merian d. Ä. aus dem Jahr 1648, Sammlung Brod, Universitätsbibliothek Würzburg)
ISBN Buchausgabe 978-3-499-25710-0 (1. Auflage 2011)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-45431-6
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
«Wie das Ei, ...
Für Lev
Herbipolis Würzburg
Würzburg
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
«Wie das Ei, so das Küken.
Wie das Küken, so der Vogel.
Also legt er Eier.»
Spruch bei der Verfolgung von Kinderhexen
Für Lev
Herbipolis Würzburg
Bildausschnitt 1
Herbipolis Würzburg
Bildausschnitt 2
Herbipolis Würzburg
Bildausschnitt 3
Herbipolis Würzburg
Bildausschnitt 4
Würzburg
Im Jahr 1629
Die Erde ist vergiftet und mit ihr die Menschen. Überall lauern Krankheit, Verrat und der Tod.
Niemand will sich mehr erinnern, wie alles begann. Dabei ist jedem bekannt, wer die Schuld an all dem Grauen trägt.
Mit uns hat das ganze Unwesen angefangen und nicht mit jener bedauernswerten alten Amme. Sie war das Licht und das Leben im Garten des Herrn. Die Kinder liebten sie. Und wir haben sie getötet.
Als Vorboten unseres Verderbens wüteten Hunger, Pestilenz und der Große Krieg. Die Not war allerorten und kannte kein Erbarmen. Kein Haus wurde verschont, kein Gebet erhört.
O Herr, höre das Flehen deiner Kinder. Aber Gott hörte nicht. Er hatte sich von uns abgewandt und schickte uns die Zeichen. Der Himmel öffnete sich, und heraus traten die sieben Engel mit den sieben Plagen. Das Ende aller Tage war angebrochen. Die Abrechnung stand bevor.
Aber noch immer glaubten wir, das Schicksal selbst in der Hand zu haben. In unserer Vermessenheit suchten wir nach Schuldigen.
Wer hat nur unsere Kühe verhext, dass sie keine Milch mehr geben? Wer hat Frost und Hagel gezaubert, dass uns das tägliche Brot genommen wird? Und wer hat die Frucht unserer Weiber verhext, dass sie kein lebend Kind mehr zur Welt bringen?
O gnädiger Landesherr, gedenke deiner Untergebenen in ihrer größten Not und beende das gotteslästerliche Treiben, damit nicht länger Schaden über dich und dein Volk kommt.
Bischof Ehrenberg verstand. Es musste gehandelt werden, schnell und bedingungslos, bevor sich das Volk erneut gegen die Herrschaft stellte.
Als Erstes traf es alleinstehende Weiber, Bettlerinnen und Witwen, die nur wenig Schutz genossen. Wir machten sie zu Hexen, die nachts auf ihren Besen ausfuhren, um mit dem Teufel zu buhlen. Wer sich sträubte, lernte die Folterknechte kennen.
Die Scheiterhaufen brannten an vielen Orten, doch nirgends so oft wie zu Gerolzhofen und vor den Toren dieser Stadt. Wir leisteten gute Arbeit. Die panische Angst im Volk würde mit dem Brennen der Hexen bald versiegen.
Aber anstatt immer weniger Hexen und Teufelsanbeter auf die Scheiterhaufen führen zu müssen, tauchten an allen Ecken immer mehr auf, einer Epidemie gleich, die über alle Stände hinweg um sich griff. Es war, als hätten wir erst durch unseren Eifer die Pforten der Hölle geöffnet und die Heerscharen des Teufels aus ihrem Gefängnis befreit. Aus jedem Haus drangen neue Schandtaten ans Licht; sei es die eines Ratsherrn, Handwerkers oder Bauern oder die eines Edlen oder eines Priesters. Nirgends ist Gott mehr zu finden.
Es ist gekommen der große Tag des Zorns, und wer wird bestehen? Niemand. Die Herrschaft des Teufels hat begonnen, und wir folgen ihm geradewegs in die Hölle.
Doch dann, als alles verloren schien, passierte etwas, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Ein Kind erhob sich aus unserer Mitte.
Kehret um, mahnte es uns. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, bleibt euch das Himmelreich verschlossen.
Hätten wir nur auf sie gehört.
O Herr, ich bekenne vor dir, dem allmächtigen Gott, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch mein Vergehen sind viele unschuldige Seelen auf dem Scheiterhaufen gerichtet worden.
Vergib einem reumütigen Sünder … oder scher dich zum Teufel.
1
Die Ohrfeige traf Kathi mitten ins Gesicht.
Die Wucht des Schlags war so groß, dass ihr schwarz vor Augen wurde. Sie taumelte und kippte zur Seite, um hart auf dem Boden aufzuschlagen. Es folgte ein Moment der Stille, in dem Zeit und Schmerz von ihr genommen waren.
Sie seufzte. So musste es sich anfühlen, wenn man starb. Ein verlockendes Gefühl, selbst wenn man gerade erst zehn Jahre alt war.
Ein hohes, nadelspitzes Pfeifen in ihrem Kopf holte sie in das Hier und Jetzt zurück. Der Schmerz ging ihr durch Mark und Bein. Obwohl er alles andere ausblendete, hatte er doch sein Gutes: Er bewahrte sie vor den ewig gleichen Vorwürfen des Apothekers Grein und dem schadenfrohen Kichern von Lene und Lotti, seinen hübschen, aber missratenen Zwillingstöchtern. Sie standen in sicherer Entfernung von ihrem Vater, der in solchen Augenblicken unberechenbar war. Es war daher besser, ihm nicht zu nahe zu kommen und sein aufbrausendes Gemüt nicht weiter zu reizen.
Kathi wusste, dass sie keinen Fehler begangen hatte. Doch nun sollte sie für etwas bestraft werden, das sie nicht zu verantworten hatte.
Für die Zubereitung einer Wundsalbe nach altem Rezept waren weißer Essig, Honig, Natron und Ochsengalle nötig. Die Zutaten wurden zu gleichen Teilen in einen Topf gegeben und kurz aufgekocht. Fertig.
Wie es zum Anbrennen der Heilsalbe gekommen war, konnte sie sich nicht erklären. Die Flamme war klein gewesen, als sie kurz vor die Tür gegangen war, um frische Luft zu schnappen. Als sie zurückkam, schlugen die Flammen hoch, und im Topf verschmorte die Salbe zu einem eklig stinkenden Brei.
Wenn Grein seine beiden hinterlistigen Töchter nach der Ursache des Malheurs befragt hätte, wäre er der Wahrheit wohl nähergekommen. Aber im Zweifelsfall hielt man sich an Kathi, das Lehrkind, das froh sein durfte, in diesem ehrwürdigen Haus überhaupt arbeiten zu dürfen.
Andere Kinder, die mit dem siebten Lebensjahr begannen, die Arbeit von Erwachsenen zu tun, hatten es weitaus schlimmer erwischt als sie. Kathis Freundin Barbara arbeitete als Hilfsmagd in einer Gerberei. Der Gestank von toten Tieren raubte ihr den Appetit und die Gesundheit. Sie keuchte mehr, als dass sie atmete.
Otto, Kathis zweitbester Freund, schuftete bei Lothar, dem Schmied, am Ofen. Sein Körper war übersät von Brandstellen und blauen Flecken, die nicht nur von den heißen Eisen herrührten.
Und schließlich gab es da noch Ursula. Von den vier Freunden hatte sie es am schlimmsten getroffen. Sie stöberte im Dreck der Gassen nach verwertbarem Essen, das sie im Auftrag ihres Ziehvaters, des Spielmanns Karl Rußwurm, zu besorgen hatte. In diesen Zeiten, in denen es ohnehin kaum etwas zu essen gab, war das ein aussichtsloses Unterfangen. Wenn sie mit leeren Händen nach Hause kam, setzte es Prügel – weit mehr und brutaler als das, was Kathi von Grein kannte. So blieb Ursula nur das Betteln. Und selbst da sah sie sich einer erbarmungslosen Konkurrenz gegenüber. Bei ihrem letzten Kampf um ein Stück Brot hatte sie ein Ohr verloren. Ursula konnte von Glück sagen, dass sie eine gute Freundin in Kathi hatte, die sich auf die Zubereitung von Heilsalben verstand.
«Du nichtsnutziges, undankbares Kind!» Grein stand groß und bedrohlich wie ein Berg über der am Boden liegenden Kathi. Sein Gesicht glänzte rot, Schweiß rann über seinen dicken Hals. In der Hand führte er eine Weidenrute, eine rund einen Meter lange, biegsame Nachhilfe, um unbelehrbaren Schülern auf die Sprünge zu helfen.
Obwohl das Pfeifen in ihrem Kopf die lautstarke Anklage des Apothekers überdeckte, wusste sie um den Inhalt der Strafpredigt. Sie war jedes Mal gleich.
«Ist das der Dank dafür, dass wir dich zu einem anständigen Christenmenschen erziehen wollen? Wie willst du vor Gott, unserem allmächtigen Herrn und Schöpfer, bestehen, wenn du seine Gaben nicht ehrst und dich an seiner Natur versündigst? Sag deiner Mutter, dass sie dich lieber heute als morgen zurückhaben kann, bevor du uns alle mit ins Unglück reißt. Ich habe mein Möglichstes getan, um das zu verhindern. Aber leider ist das Böse in dir stärker als mein guter Wille.»
Er befahl Kathi zornig, sich zu erheben und zum Tisch zu gehen. Dort hatte sie sich zu bücken und sich mit ausgestreckten Armen gegen die Tischplatte zu stemmen, damit sie einen festen Stand hatte.
Lene und Lotti kamen herbei und stellten sich mit ausreichend Abstand vor sie hin. Kathi sah ihr schadenfrohes Grinsen. Eines Tages, so schwor sie sich, wird dies ein Ende haben, und böse Gedanken stiegen in ihr auf. Dann werde ich es sein, die euch ins Gesicht lacht, ihr kleinen, verdorbenen Hexen, wenn ihr mit Gejohle zum Scheiterhaufen geführt werdet.
Mit Blick zum Himmel und mit gefalteten Händen sprach Grein das übliche Gebet.
«Herr, du bist mein Zeuge. Ich erhebe meine Hand gegen dieses Kind, der rechten Unterweisung wegen. Gib ihm die Einsicht, mit den Gaben der Natur besonnen umzugehen, und dass es deinen Namen in alle Ewigkeit ehren und preisen möge. Amen.»
Ein Kreuzzeichen beschloss das Gebet und leitete die Unterweisung ein.
Kathi hörte das flirrend hohe Geräusch der Rute nicht, als diese mit Kraft durch die Luft getrieben wurde. Obwohl der Hieb sie nicht unvorbereitet traf, war der erste Schmerz noch jedes Mal der heftigste gewesen.
Sie bäumte sich auf, um gleich darauf wieder in die geforderte Ausgangsstellung zurückzukehren. Alles andere, ein Schrei, ein Flehen um Gnade oder gar das Weglaufen, hätte die Unterweisung nur verschlimmert. So zwang sie sich, den Schmerz zu ertragen, um mit fester Stimme das Gebet zu sprechen, das Grein von ihr verlangte.
«Pater noster, qui es in caelis …» Vater unser, der du bist im Himmel.
Das Vaterunser hatte sie in Latein zu sprechen. Das war das Erste, was sie in dem Apothekerhaushalt gelernt hatte.
Adveniat regnum tuum – Dein Reich komme.
Auf jede Zeile folgte ein Schlag.
Fiat voluntas tua – Dein Wille geschehe.
Diesen Schlag führte Grein besonders hart.
Sicut in caelo, et in terra – Wie im Himmel, so auch auf Erden.
Genau das fürchtete sie. Der Schmerz sollte irgendwann mal ein Ende haben, spätestens im Himmelreich.
Beim Amen angekommen, beendeten drei weitere Schläge die Unterweisung. Nun hatte sie sich zu erheben und folgende Worte zu sprechen:
«Ich danke Euch, Herr, für die Unterweisung. In Demut will ich versprechen, Euch keine Sorgen mehr zu machen und besonnen an meine Arbeit zurückzukehren.»
Grein nickte wohlwollend, fast schon versöhnlich. «Jetzt geh nach Hause. Deine Mutter wartet schon auf dich.»
«Zuvor will ich noch beichten und das Abendmahl erhalten», erwiderte Kathi mit gesenktem Haupt.
Auch diese Antwort war Bestandteil des Rituals. Dadurch ersparte sich Grein, noch ein Maul beim Abendessen stopfen zu müssen, wozu er als Lehrmeister eigentlich verpflichtet war. Dafür bezahlte Kathis Mutter schließlich gutes Geld.
Nur einmal hatte seine Frau Henriette ihn darauf angesprochen, mit fatalen Folgen. «Vor dem Empfang der Eucharistie darf sie ohnehin nichts essen oder trinken», grollte er. «Oder willst du mir etwas anderes unterstellen, Weib?»
Danach konnte Henriette das Haus für ein paar Tage nicht verlassen.
Noch war eine halbe Stunde Zeit, bevor Kathi und ihre Mitschüler in Neumünster erwartet wurden. Zeit, die sie mit ihren Freunden Barbara, Otto und Ursula verbringen wollte. Humpelnd und mit schmerzenden Gliedern lief sie die Domstraße hinunter, vorbei an den Läden der Handwerker, dem Geschnatter der Passanten und dem beißenden Gestank der Abwässer, vorbei am Grünenbaum, dem Rathaus der Stadt, geradewegs ans Ufer, wo die Fischerboote vertäut lagen.
Gegenüber, am anderen Mainufer, ragte der Frauenberg steil empor. Auf dessen Spitze thronte die bischöfliche Residenz mit Blick über die Stadt und das Tal. Die mächtige Burganlage war rundum geschützt von starken Mauern. Das Heer der rebellierenden Bauern hatte sie einhundert Jahre zuvor bezwingen wollen, war aber knapp gescheitert; die Rache des Bischofs, die über sie kam, war blutig.
Dort oben, weit weg von den Entbehrungen des Volks, residierte Philipp Adolf von Ehrenberg, ehrfürchtig der Hexenbischof genannt. Er war der Nachfolger von Johann von Aschhausen und dem allseits geschätzten Julius Echter von Mespelbrunn. Allen dreien war gemeinsam, dass sie Stadt und Hochstift vom Unwesen der Hexen und Teufelsanbeter befreien wollten. Jeder legte in dieser Angelegenheit großen Eifer an den Tag. Doch Philipp Adolf war derjenige, der aus diesem Wettstreit als Sieger hervorgehen wollte.
Kathi knurrte der Magen. Seit der Brotsuppe am Morgen hatte sie nichts mehr gegessen. Lange würde sie den Essensentzug nicht mehr verheimlichen können. Die Mutter achtete sehr darauf, dass es Kathi einmal bessergehen sollte als ihr. Dazu gehörte einerseits regelmäßiges Essen, andererseits eine gute Arbeitsstelle. Und genau das passte im Grein’schen Haus nicht zusammen. Ihre Mutter ahnte davon nichts, gottlob, sonst hätte Kathi eine Sorge mehr gehabt.
Bevor Kathi zum Abendgebet ins Stift von Neumünster ging, musste sie etwas essen. Dass sie dadurch gegen das Essverbot der Kirche verstieß, kümmerte sie nicht. In weiser Voraussicht hatte sie ein Töpfchen selbst hergestellter Heilsalbe aus der Apotheke mitgenommen. Unter den Fischern würde sie sicherlich jemanden finden, der ihr dafür etwas gab.
Anders als sonst lagen an diesem Abend bereits viele Boote vertäut am Ufer. Das war ein schlechtes Zeichen für das erhoffte Tauschgeschäft. Wahrscheinlich hatten die Fischer – wie in den Tagen und Wochen zuvor auch – keine Beute in dem von Leichen und durch Krankheiten verseuchten Wasser gemacht. Mit leeren Netzen waren sie an die Ankerplätze zurückgekehrt. Nun mussten sie der hungernden Bevölkerung mitteilen, dass auch im Main alles Leben erloschen war.
Kathi schaute sich um. Wo waren Barbara, Otto und Ursula? Hatte sich niemand an ihrem gemeinsamen Treffpunkt eingefunden? Es war die wertvollste Zeit des Tages: Eine halbe Stunde, in der sie nicht unter der Aufsicht der Erwachsenen standen und tun konnten, was sie wollten.
Ein alter Mann saß abseits am Ufer und flickte ein Netz, ein anderer schaute auf den Hochwasser tragenden Main. Kathis Augen folgten seinem besorgten Blick zum Himmel, wo sich von Ochsenfurt her eine dunkle Wolkenwand durchs Maintal schob.
In den vergangenen drei Wochen hatte es jeden Tag geregnet, und wie es aussah, würde auch an diesem Tag der Himmel kein Einsehen haben. Die Erde und mit ihr die Felder drohten erneut unter dem vielen Wasser zu versinken. Kniehoch überschwemmte es die Auen entlang des Mains. Die Zeichen für eine gute Ernte standen abermals schlecht.
Ein lautes Kraah! ließ Kathi aufmerken. Eine Krähe setzte zur Landung auf einem der Fischerboote an. Es war ein angsteinflößendes Tier. Das Gefieder schwarz wie Pech, die Augen leblos und kalt.
Im Gegensatz zu den Menschen hatten die Krähen keine Probleme bei der Nahrungssuche. Ringsum tobte der Große Krieg, und wenn die ersten Schwerter klirrten und Musketen krachten, fanden sie sich in Scharen auf den Bäumen ein. Dort oben verfolgten sie in aller Ruhe das Treiben, bis schließlich die Erde mit toten Leibern bedeckt war.
Krähen waren Aasfresser, so viel wusste Kathi. Auch dass man sich vor ihnen hüten sollte, nicht nur der Krankheiten wegen, die sie übertrugen. Die Krähen waren die Vorboten des Todes, und nicht wenige hielten sie für den Teufel selbst.
Doch was war mit dieser Krähe los? Wieso kam sie hier ans Ufer? Die Schlachten wurden an anderer Stelle geschlagen, hier gab es kein Fressen. Weder Fisch noch Fleisch.
Vorsichtig näherte sich Kathi dem seltsamen Vogel. Er schien keine Angst vor ihr zu haben, sondern blickte sie aus schwarzen Augen neugierig an.
Vielleicht war es besser, diesem Teufelsvieh nicht zu nahe zu kommen. Wenn der Tod mit ihm reiste, sollte man sich ihm nicht in den Weg stellen.
Andererseits hatte sie in der Bibel auch die Geschichte von dem Propheten Elia gelesen, der sich vor seinem zürnenden König an einem Wildbach versteckt hielt. Dort hatte er zwar genug zu trinken, aber kein Essen. Gott sorgt für seine Kinder, hieß es in der Bibel, und so hatte Gott Raben geschickt, die Elia mit Essen versorgten.
So schlecht konnten Raben folglich nicht sein und ihre Geschwister, die Krähen, dann auch nicht. Kathis Neugier war groß.
«Wer bist du denn?», fragte sie zögernd.
Die Krähe legte den Kopf zur Seite und schaute sie mit unruhigen Augen an. Sie war größer als alle anderen, die Kathi bisher zu Gesicht bekommen hatte. In einem der Bücher des Apothekers Grein hatte sie gelesen, dass diese Krähen wegen der Laute, die sie ausstießen, auch Kolk genannt wurden. Manche behaupteten sogar, sie hätten solche Kolks schon grunzen und rülpsen gehört. Kein anderes Tier auf der Welt konnte das. Das war verdächtig.
Sie streckte die Hand nach ihm aus.
«Sag, hast du einen Namen?»
Seine schwarzen Augen musterten die seltsame weiße Hand.
«Du musst keine Angst vor mir haben. Ich tu dir nichts.»
Diese Zutraulichkeit ging dem Kolk dann doch zu weit. Ein schneller Stoß mit dem Schnabel wies Kathi in die Schranken.
Sie zog die Hand zurück. «Autsch. Ich will dir doch nichts tun.»
«Das kann er nicht wissen», sagte der alte Mann, der das Netz geflickt und sich unbemerkt genähert hatte. «Die Fischer werfen mit Steinen nach ihm.»
«Wieso machen sie das?»
«Sie glauben, in ihm stecke der Teufel.»
Kathi trat einen Schritt zurück. «Haben sie recht damit?»
«Sie fürchten sich auch, wenn sie ihren Schatten an der Wand sehen. Sie sind wie Kinder.»
Das wollte Kathi nicht gelten lassen. «Ich habe keine Angst vor meinem Schatten.»
Der Alte schmunzelte. «Soso. Keine Angst …»
«Wirklich.»
Sie kam mutig näher, streckte die Hand nach dem Kolk aus und wurde abermals gepikst.
«Schon wieder. Was mache ich nur falsch?»
«Gedulde dich», beschwichtigte der Alte, «er muss dich erst kennenlernen. Außerdem ist er verletzt.»
Er streckte seinen Arm aus, und wie auf Kommando hüpfte der Kolk darauf.
«Was fehlt ihm?», fragte Kathi.
Der Alte zeigte auf das Bein des Vogels. An einer kreisrunden Stelle fehlte das Gefieder. Sie war rot und voller Schorf.
«Jemand hat ihm eine Falle gestellt», antwortete der Alte. «Eine Schlinge oder etwas Ähnliches. In diesen Zeiten ist niemandem mehr etwas heilig.»
«Heilig?», fragte Kathi erstaunt. «Eine Krähe?»
«Er ist keine Krähe, sondern ein Kolk, ein Rabe. Auch er ist ein Geschöpf unseres Herrn.»
Kathi ahnte, was er damit meinte. «Ich wollte nicht …»
«Schon gut.» Der Alte streichelte dem Vogel das Gefieder. «Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir etwas zu essen finden für dich.» Er stand auf und ging mit ihm zu den Netzen zurück.
Essen … Kathi hatte es fast vergessen. Ob der Alte auch etwas für sie hatte? Sie folgte ihm kurz entschlossen.
«Habt Ihr die Wunde versorgt?», fragte Kathi.
Er zuckte die Schultern. «Ich habe nichts, was Kolk helfen könnte. Dabei muss die Wunde dringend gereinigt werden. Sie hat sich entzündet.»
«Vielleicht kann ich helfen.»
«Womit könntest du diesem armen Geschöpf schon helfen?»
Sie nahm das Töpfchen aus ihrer Tasche. «Damit.»
Der Alte schaute misstrauisch. «Was ist das?»
«Eine Heilsalbe. Selbst hergestellt.»
Das klang nicht überzeugend. Er verzog das Gesicht. «Genug mit diesem Hexenzeug. Es hat schon mehr Menschen das Leben gekostet als gerettet.»
«Vertraut mir, ich arbeite in der Apotheke. Es ist ein altes Rezept, das schon vielen geholfen hat.»
Der Alte war unschlüssig. Schließlich befragte er den Raben. «Was meinst du, Kolk? Können wir der jungen Dame trauen?»
Kolk schaute mit seinen schwarzen Augen auf das geheimnisvolle kleine Gefäß. Etwas darin schien ihn neugierig zu machen, und er pickte daran.
«Das deute ich dann mal als ein Ja», sagte der Alte schmunzelnd. Und dann zu Kathi: «Kolk ist sehr klug. Er spürt, wer ihm Gutes tun und wer ihm übelwill.»
Er setzte den Raben vorsichtig ab, sodass Kathi die Wunde versorgen konnte. Derweil griff er zu einem Bündel, öffnete es, und zum Vorschein kamen ein Ranken Brot, eine Handvoll gebratener kleiner Fische und ein Stück Käse.
Kathi lief das Wasser im Mund zusammen. So viel Essen hatte sie seit Tagen nicht gesehen. Wie um alles in der Welt konnte sie es anstellen, dass der Alte ihr etwas davon abgab?
«Mir scheint», sagte er nach einer Weile, «Kolk ist nicht der Einzige, der Hunger hat.»
Er brach ein Stück Brot ab, nahm drei kleine Fische und ein Stückchen Käse und schob es Kathi zu.
«Für mich?», fragte sie überrascht, aber auch erleichtert.
Der Alte nickte, und Kathi glaubte in diesem Moment, ihn umarmen zu müssen.
So aßen die drei zu Abend, und jeder hätte zufrieden sein können, wenn ihnen nicht ein Missgeschick unterlaufen wäre. Nachdem Kolk mit der Salbe behandelt und neu verbunden worden war, stieß er ein grässliches Kraah! aus, was vermutlich seine Art war, danke zu sagen. In diesem Moment donnerte es heftig, und die Wolken entließen ihre zerstörerische Fracht.
Kathi packte rasch das Töpfchen ein und lief zurück in die Stadt.
Als sie den Fischer passierte, der sich besorgt dem aufziehenden Wetter zugewandt hatte, rief er sie an:
«Verfluchte Teufelsbrut. Müsst ihr euer Unheil schon am helllichten Tag verbreiten?»
2
Der Hahn von Nachbar Wagner hatte noch nicht gekräht, da trat Helene an Kathis Nachtlager. Sie setzte sich vorsichtig zu ihr auf die Strohmatte und stellte die Kerze auf ein schmales Brett, das an der Wand angebracht war. Darauf befanden sich ein abgegriffener Katechismus, ein Kräuterbüchlein und ein Töpfchen, das gestern noch nicht da gestanden hatte.
So wie es aussah, stammte es aus der Apotheke. Helene konnte nur hoffen, dass der Apotheker Grein davon wusste. Nicht auszudenken, wenn er sie wegen eines Diebstahls aus dem Haus werfen würde. Wo sollte sie dann mit ihr hin? Es war ausgeschlossen, Kathi mit zu sich in die Tuchmacherei zu nehmen. Helene konnte froh sein, wenn sie demnächst nicht selbst auf der Straße saß, es war nicht die Zeit für Stoffe.
Sie hatte lange nach einer geeigneten Arbeit für ihre zarte Tochter gesucht. Erst die Fürsprache von Vikar Ludwig, Kathis Lehrer, und die Zugabe von fünfzig Kreuzern für Kost und Ausbildung hatten Apotheker Grein schließlich erweicht. Seit Kathi bei diesem strengen und gottesfürchtigen Mann arbeitete, hatte Helene Zuversicht geschöpft. Es würde alles noch ein gutes Ende nehmen. Heinrich hatte sie viel zu früh verlassen, zwei Jahre war das nun her. Noch immer fehlte jede Spur von ihm.
Zu jener Zeit hatte sich ein versprengter Haufen Soldaten im Gramschatzer Wald herumgetrieben. Die hätten dem guten Heinrich den Garaus gemacht, sagten die Leute, und ihn dann in einer Grube verschwinden lassen. Die fünftausend Gulden, die Heinrich im Auftrag des Bischofs nach Bamberg hatte bringen sollen, blieben ebenfalls verschwunden.
Einigen böswilligen Gerüchten zufolge war nicht auszuschließen, dass sich Heinrich mit dem Geld selbst davongemacht hatte. Der Bischof ließ ihn steckbrieflich suchen, bisher ohne Erfolg. Das Einzige, was Helene – außer der üblen Nachrede – von ihrem Mann geblieben war, hielt nun ihre Tochter in der Hand. Es war ein kleines Bild, das Heinrich hatte anfertigen lassen. Es zeigte ihn hoch zu Ross mit der Kuriertasche und dem bischöflichen Siegel darauf. Kathi legte es jeden Abend neben das Bett, so war es das Erste, was sie beim Erwachen erblickte.
«Ist es schon so weit?», fragte sie verschlafen.
Helene nickte. «Komm, steh auf. Das Frühstück ist fertig.»
Als Helene sich erhob, fiel ihr Blick auf Kathis Beine. Das Nachthemd war ein Stück hochgerutscht und zeigte ihren Oberschenkel.
«Was ist das?», fragte sie erschrocken und schob das Nachthemd noch ein Stück höher. Mehrere Striemen traten deutlich auf der weißen Haut hervor.
Kathi versuchte sich zu entziehen, doch es gab für sie kein Entrinnen.
Helenes Befürchtung erhielt durch die Verletzungen neue Nahrung. Hatten sie etwas mit dem Töpfchen auf dem Brett zu tun?
«Woher kommt das?», fragte sie streng und zeigte auf die blutunterlaufenen Stellen.
Kathis Herz pochte. Wenn sie ihrer Mutter gestand, dass Grein sie wegen einer vermeintlichen Nachlässigkeit bestraft hatte, würde sie sich gleich das nächste Donnerwetter einhandeln. Sie wusste um die Mühen und die Kosten, die ihre Mutter auf sich nahm, um ihr eine gute Arbeitsstelle zu ermöglichen.
«Ich bin gestürzt», wich sie aus.
Doch Helene ließ sich nicht hinters Licht führen. «Lüg mich nicht an. Hat es damit zu tun?» Sie nahm das Töpfchen vom Brett und hielt es ihr vor die Nase.
«Nein, Mutter. Die Salbe habe ich selbst gemacht. Sie gehört mir.»
«Unsinn. Du kannst so etwas doch noch gar nicht.»
«Es gehört zu meiner normalen Arbeit, Heilsalben und Kräutermixturen herzustellen.»
«Weiß der Apotheker davon?»
Unschlüssig, was sie antworten sollte, wich sie dem Blick ihrer Mutter aus und gestand damit ihre Schuld ein.
Helene packte sie am Arm. «Du bringst die Salbe wieder zurück. Hörst du? Ich kann nur hoffen, dass der ehrenwerte Apotheker nachsichtig mit dir sein wird.»
Als sie ihre Tochter am Arm hielt, fiel ihr noch etwas anderes auf. Dieser Arm war seltsam dünn – zu dünn für eine gesunde Zehnjährige, die am Tag drei Mahlzeiten zu sich nahm. Hier stimmte etwas nicht.
Sie führte Kathi hinüber an den Tisch, wo eine größere Kerze stand. «Zieh dein Nachthemd aus», befahl sie. «Ich will sehen, was du sonst noch vor mir verbirgst.»
«Nein, Mutter.» Kathis Sorge wuchs, was sie sich einhandelte, würde ihre Mutter sie nackt sehen.
Helene wurde ärgerlich. «Widersprichst du etwa deiner Mutter?»
Die gottesfürchtige Erziehung ihrer Tochter ließ offensichtlich zu wünschen übrig. Die Rute hing in Griffweite, wenngleich sie bisher selten vom Nagel genommen worden war. Das letzte Mal vor drei Jahren, als ihr Mann mit Kathi das Glaubensbekenntnis geübt hatte.
«Ich sage es kein zweites Mal.»
Notgedrungen ergriff Kathi den Saum des Nachthemds und zog es sich über den Kopf.
Auch wenn das Licht der Kerze die Kammer nicht völlig erhellte, würde es ausreichen, um Helene zu zeigen, was sie besser nicht sehen sollte.
Entsetzt nahm diese die Hand vor den Mund.
«Was hast du nur angestellt?» Sie suchte Halt und sank auf einen Stuhl nieder.
Kathi blickte beschämt zur Seite. «Es tut mir leid. Ich …»
«Schweig!»
Helene schwankte zwischen Bestürzung und Zorn. Ihr Entsetzen richtete sich nicht auf ihre Tochter, vielmehr auf den Menschen, der ihr das angetan hatte – und sie meinte nicht die Striemen, sondern etwas viel Augenfälligeres.
«Seit wann geht das schon so?»
«Was meint Ihr, Mutter?»
Helene hatte Mühe, den Zorn zu unterdrücken. «Du weißt genau, was ich meine.»
«Nein, Mutter.»
«Seit wann isst du nichts mehr?»
Die Rippen konnten einzeln gezählt werden, und die Beckenknochen standen hervor. Darunter verliefen die Beine dünn bis zu den hervortretenden Knien. Das gleiche Bild bot sich ihr an den Armen und Händen. Auch sie waren schmal, nur die Gelenke waren stärker.
Sicher, in den vergangenen Wochen hatte es in der Stadt nur noch wenig zu essen gegeben, aber dieses wenige sollte dennoch ausreichen, um ein Kind bei Kräften zu halten.
Helene hatte von den Veränderungen an Kathis Körper nichts mitbekommen. Sie sah ihre Tochter nur morgens und beim Zubettgehen, und da war sie zu müde, um Veränderungen überhaupt zu bemerken. Diese Nachlässigkeit wurde ihr nun schmerzhaft vor Augen geführt.
«Erst gestern Abend habe ich gegessen», antwortete Kathi.
Um Fassung bemüht, nahm Helene die Hände der Tochter in ihre eigenen und kniete sich vor Kathi hin. Sie streifte ihr die braunen Haare aus dem Gesicht. Auge in Auge, von Mutter zu Tochter, wollte sie die Wahrheit erfahren.
«Kind, hab keine Angst. Sag mir: Bekommst du bei Meister Grein genügend zu essen? Du weißt, du hast ein Anrecht darauf. Ich zahle dafür.»
Kathi zögerte mit der Antwort. «Macht Euch keine Sorgen, Mutter. Der Apotheker meint es gut mit mir. Ich lerne viel, und er gibt sich mit meiner gottesfürchtigen Erziehung Mühe.» Sie zeigte auf die Striemen an ihrem Körper. «Diese Male erhielt ich zu Recht, da ich einen Fehler begangen habe und mit den Gaben der Natur zu sorglos umgegangen bin. Sie werden mich erinnern, zukünftig mehr achtzugeben, um weder Euch noch dem Apotheker Sorgen zu bereiten.»
Helene hörte ihrer Tochter erstaunt zu. Konnte sie glauben, was sie da erzählte? Bisher hatte sie es immer zu unterscheiden vermocht, ob Kathi log oder die Wahrheit sprach. Ihr wortloser Blick zur Seite hatte sie stets überführt. Aber jetzt?
Das Kind aß nichts, und das schon seit langem. So viel war klar. War sie krank, oder hatte jemand einen Fluch gegen sie ausgesprochen? In diesen Zeiten der Not und des Hexenzaubers war alles vorstellbar.
Sie würde mit Vikar Ludwig sprechen. Er wusste immer Rat. Oder sollte sie gleich ihre alte Amme Babette hinzuziehen? Sie hatte geholfen, Kathi zur Welt zu bringen, und sie hatte sie in den ersten Jahren auch aufgezogen. Die beiden hatten ein inniges Verhältnis. Fast schon zu innig. Man mochte meinen, Kathi fühlte sich zu ihr mehr hingezogen als zur eigenen Mutter.
Widerstrebend nahm sie sich vor, gleich heute mit ihr zu sprechen.
«Gut, dann will ich dir glauben», seufzte sie, «und jetzt iss deine Suppe. Das Morgengebet beginnt gleich. Du willst doch nicht zu spät kommen.»
Kathi lächelte zustimmend. Aber auch das war eine Lüge.
3
Grit hatte behauptet, sie sei bereits sechzehn Jahre alt. In Wirklichkeit war sie aber erst vierzehn. Das hätte gemeinhin keinen Unterschied gemacht, wenn nicht ein angesehener Stadtrat darauf hereingefallen wäre.
Grits Brüste hatten sich im letzten Jahr prächtig entwickelt, ebenso ihre Hüften, die sie mittlerweile vortrefflich zu schwenken verstand. Die Männer schenkten ihr viel Aufmerksamkeit dafür. Das kupferrote Haar reichte ihr bis auf den Rücken, und wann immer sich die Gelegenheit bot, trug sie es offen. Außerdem besaß sie ein verschmitztes Lächeln, das mitunter Begehrlichkeiten weckte. Das kümmerte Grit jedoch nicht. Solange die Kerle für ihre Gesellschaft zahlten, konnten die sich einbilden, was sie mochten.
Valthin, der Wirt des Gasthauses Stachel am Markt, wusste das zu seinem Vorteil zu nutzen. Seitdem er Grit in seine Dienste genommen hatte, waren die Tische in der Gaststube wieder besser besetzt, und der dünne Wein rann leichter die Kehle hinunter. Gerne ließen sich die Kerle von ihr den Wein einschenken – und der Phantasie freien Lauf. Meistens waren es ungehobelte Burschen, die er mit dem Stock disziplinieren musste, wenn sie zu dreist wurden.
Mitunter kam es vor, dass ein Reisender Gefallen an der hübschen Bedienung fand und alle Vorsicht in der fremden Stadt fahrenließ. Wenn Grit ein Geschäft witterte, setzte sie sich zu ihm und hörte aufmerksam zu, woher der Fremde kam, wohin er wollte und ob er alleine reiste. Jenseits der Stadttore, in sicherer Entfernung zu den Landsknechten des Bischofs, sollte sich seine Offenheit rächen. Der Überfall kam überraschend, aber präzise. Grits Komplize wusste, wo und wonach er suchen musste.
An diesem Morgen brannte Grits Herz lichterloh. Sie war zum ersten Mal in ihrem Leben verliebt. Das spürte sie genau, denn noch nie zuvor hatte sich ein Mann so sehr für sie eingesetzt wie der Stadtrat Christian Dornbusch. Vielleicht hatte er ihr sogar das Leben gerettet, denn mit dem Hexenkommissar Doktor Faltermayer war nicht zu spaßen.
Es war vor drei Nächten gewesen. Faltermayer war mit seinem Kollegen Doktor Dürr und dem Stadtrat Dornbusch im Stachel zu Gast gewesen. Die vornehmen Herren hatten Wichtiges zu besprechen und deshalb in einem Nebenraum Platz genommen. Valthin war ganz aufgeregt wegen des hohen Besuchs, der sich in diesen Zeiten nur selten einstellte. Er schickte nach dem besten Wein, den sein leerer Keller noch hergab, und trug Grit auf, besonders umsichtig mit dem Stadtrat und den Hexenkommissaren zu sein. Sie seien allesamt gottesfürchtige Männer, die es nicht schätzten, wenn sich junge Dinger allzu offenherzig benähmen.
Nach dem zweiten Krug Wein musste sie jedoch feststellen, dass Alkohol bei den hochgestellten Herren die gleiche Wirkung zeigte wie bei allen anderen. Auch sie fanden Gefallen an der jungen, hübschen Grit – mit einer Ausnahme: der Stadtrat Christian Dornbusch. Er war nicht nur jünger als die anderen, sondern auch besser aussehend und zurückhaltender. Die schwarze Robe und der weiße Kragen machten zwar einen würdevollen und distanzierten Eindruck, aber Grit merkte bald, dass sich dahinter doch ein anderer Mensch verbarg. Er wirkte weniger herrisch und prahlend als Faltermayer, dessen Blicke und Anzüglichkeiten ihm sichtlich unangenehm waren.
Grit duldete die Avancen, so wie es Valthin ihr aufgetragen hatte. Das fiel ihr nicht weiter schwer, denn sie beachtete Faltermayer überhaupt nicht. Ihre Aufmerksamkeit richtete sich ganz auf den jungen Stadtrat. Dieser erwiderte ihre Zuneigung jedoch kein bisschen, er wich den Blicken und dem koketten Lächeln sogar aus.
«Verzeiht, Herr», sprach sie ihn in einem günstigen Moment an. «Gefalle ich Euch nicht?»
Christian Dornbusch zeigte sich überrascht, fast schien es, als erröte er. «Was hast du gesagt?»
«Ich fragte, ob ich Euch unangenehm bin?»
«Wie kommst du darauf?»
«Nun, Ihr beachtet mich nicht.»
Er räusperte sich. «Du irrst. Ich habe dich durchaus gesehen, aber ich frage mich, ob das ein Ort für ein junges, hübsches Mädchen ist.»
«Ich bin kein Mädchen mehr. Ich bin älter, als Ihr denkt.»
«Recht hat sie», fiel ihr Faltermayer ins Wort. «Schaut sie Euch nur an. Sie hat alles, was eine gebärfähige Frau haben sollte.» Dabei klatschte er ihr aufs Hinterteil, wie es die Pferdehändler machten, wenn sie besonders zufrieden mit einem ihrer Gäule waren. Der andere Hexenkommissar, Dürr, lachte verhalten. Er war eine beängstigende Erscheinung – schmal und bleich, dem Tod ähnlich.
Die Bemerkung widerte Christian sichtlich an, es war klar, in welche Richtung sie zielte. Seine Frau Felicitas und er hatten zum dritten Mal eine Fehlgeburt zu beklagen. Die Hausbediensteten fragten sich allmählich, was mit der Herrin nicht stimmte. Sie war eine gesunde junge Frau. Es sprach überhaupt nichts dagegen, dass sie ihrem Mann endlich die Nachkommenschaft sicherte. Folglich musste etwas anderes dahinterstecken.
Eine Magd wollte eine Erklärung kennen. Die junge Herrin nimmt es gar zu streng mit der Sitte. Statt Rosenkranz und Weihwasser sollte sie es einmal mit dem Wein versuchen … oder mit einem Liebhaber.
Doch Wein war in den Augen von Felicitas Teufelszeug, ebenso wie das Vergnügen. Freude empfand sie allein in der Hingabe zu Gott. Christian glaubte zwar auch an die Heilsbotschaft, doch weit weniger verkrampft als Felicitas. Manchmal wünschte er, der Herr führe hernieder und gäbe seiner jungen Frau mehr Gelassenheit. Doch dieser Wunsch ging nicht Erfüllung. Das Einzige, was ihm geschenkt wurde, war ein totes Kind nach dem anderen.
Grit ahnte davon nichts. «Hört nicht auf sie, edler Herr. Sie können mir nicht wehtun. Ich sehe sie nicht einmal.»
Die anmaßende Bemerkung ging dem vornehmen Faltermayer zu weit. «Hüte deine Zunge. Du wärst nicht die Erste, die ihr Schandmaul im Feuer büßt.»
«Weil ich die Wahrheit spreche, Herr?», antwortete sie.
«Weil du ein freches und vorlautes Weibsbild bist. Weißt du nicht, mit wem du sprichst?»
Christian Dornbusch gebot ihr innezuhalten. «Schweig, Kind. Du spielst mit deinem Leben.»
Doch Grit kannte keine Hemmungen. Bisher war immer alles gutgegangen.
«Beim Wein sind alle Männer gleich. Da schert es mich nicht, wenn die Hand, die mich berührt, die eines Bischofs oder die eines Bettlers ist.»
Faltermayer fuhr auf. «Hat man dir den Verstand verhext?» Er schaute sich nach einem Stadtknecht um, der das liederliche Weibsbild festnehmen sollte.
Dornbusch trat ihm entgegen. «Werter Hexenkommissar, beruhigt Euch. Sie ist noch ein Kind, das nicht weiß, was es sagt.»
«Sie hat den Verstand verloren.»
«Daher lasst Gnade walten.»
«Viel zu lange schon treiben diese verrückten Weibsbilder ihr Unwesen in der Stadt. Erst letzte Woche hat eine ihrem Mann das Essen vergiftet. Jetzt liegt sie auf der Streckbank. Würde mich nicht wundern, wenn sie morgen brennt.»
«Nicht so eifrig mit dem Brennen», erwiderte Dürr. «Wir haben nicht mehr so viele Frauen in der Stadt, die es wert wären, geschwängert zu werden. Denkt an morgen, denkt an den Säckel des Bischofs.»
«Schweigt», entgegnete Faltermayer, «solche Reden hört unser gnädiger Herr nicht gerne. Ihr wisst, dass er alles zum Wohle seines Volkes tut. Schließlich waren es die Bürger dieser Stadt, die ihn dazu angehalten haben.»
Die Herren besannen sich. Christian Dornbusch nutzte den Moment und drängte Grit zu gehen. «Verschwinde, schnell, bevor es sich der Hexenkommissar anders überlegt.»
«Begleitet Ihr mich?», fragte sie keck.
Er glaubte, seinen Ohren nicht zu trauen. «Willst du’s drauf ankommen lassen?»
Ohne eine Antwort zuzulassen, schob er sie hinaus und setzte sich wieder.
«Jetzt lasst uns nicht länger lamentieren», sagte Dürr und erhob seinen Becher zum Prost. «Herr im Himmel, gib uns die Einsicht zu erkennen, welches Weibsbild den Tod verdient hat und welches sich besser vorher aus dem Staub hätte machen sollen.»
Sie leerten die Becher in einem Zug, nur Christian Dornbusch nicht. Er hielt den Becher zwar in der Hand, aber mit diesen beiden Hexenjägern wollte er nicht trinken.
«Was ist mit Euch, Dornbusch? Zu fein, mit uns zu trinken?»
Noch immer zögerte er.
In diesem Augenblick spürte Grit, die ihn von der Tür aus beobachtete, wie es um das Seelenheil des jungen Stadtrats bestellt war. Er gehörte nicht zu diesen feinen Herren, trotz des schwarzen Gewands und der weißen Halskrause, die nur die Rechtschaffenen trugen. Er hatte seinen eigenen Kopf, und er war gerade drauf und dran, ihn zu verlieren.
Doch so dumm würde er nicht sein, sagte sie sich. Er würde sich schnell aus der Situation befreien, so wie er es mit ihr gemacht hatte.
Christian Dornbusch erhob sich. «Habt Dank für die Einladung, werte Herren. Doch ich muss nun gehen.»
«Wohin des Wegs?», fragte Faltermayer.
«Mein Eheweib liegt krank zu Bett. Ich versprach ihr, sie nicht lange warten zu lassen.»
Jeder wusste, was damit gemeint war. Die strenge Felicitas achtete darauf, dass ihr Mann dem Alkohol fernblieb. Faltermayer und Dürr konnten sich ein hämisches Grinsen nicht verkneifen.
Grit rief ihm leise zu: «Kommt, werter Herr, bevor Ihr eine Dummheit begeht.»
Sie sah ihn zögern, doch dann kam er zu ihr hinter die Tür.
Sie nahm ihn an der Hand. «Hier entlang», sagte sie und führte ihn in den Hof.
«Was hast du vor?»
Der efeuumrankte Hof des Stachels war mit zwei Fackeln nur spärlich erleuchtet. Die Tische waren bereits abgeräumt und die letzten Zecher auf dem Weg nach Hause. Grit schnappte sich einen Krug Wein und setzte sich an einen Tisch.
«Kommt», sagte sie zu dem zögernden Dornbusch, «trinkt mit mir, bevor Ihr Euch auf den Nachhauseweg macht.»
«Wie ich schon sagte …»
Aber Grit ließ keinen Widerspruch gelten und schenkte einen Becher ein. «Ein Schluck Wein wird Euch schon nicht den Kopf kosten.»
«Darum geht es nicht.»
«Einen einzigen Schluck. Mehr verlange ich nicht. Schließlich muss ich mich noch bei Euch bedanken.»
«Wofür?»
«Habt Ihr mich etwa nicht vor einer Dummheit bewahrt?»
«Gut, dass du es einsiehst. Hüte dich davor, dem Hexenkommissar noch einmal so frech zu antworten.»
«Versprochen», sagte sie und hob den Becher.
Dornbusch seufzte, aber schließlich stimmte er zu und leerte den Becher in einem Zug. Grit tat es ihm gleich, verschluckte sich aber. Sie hustete, und Dornbusch klopfte ihr leicht auf den Rücken. «Mädchen sollten die Finger vom Wein lassen.»
Grit holte Luft. «Ich sagte Euch bereits, ich bin älter, als Ihr denkt.»
«Dann lass mich wissen, wie alt du bist.»
«Ich bin sechzehn Jahre alt.» Und sie ließ es damit noch nicht gut sein. «Im nächsten Monat werde ich siebzehn.»
Er zog die Stirn in Falten. «Das kann nicht sein. Du machst dich älter, als du bist.»
«So glaubt mir doch.»
Sie nahm seine Hand und führte sie an ihre Brust. «Das sind die Brüste einer Frau und nicht die eines Kindes. Habe ich nicht recht?»
Dornbusch zog empört die Hand zurück. «Bist du von Sinnen? Was machst du da?»
Doch Grit lachte ihm frech ins Gesicht. «Habe ich Euch in Verlegenheit gebracht?»
Das hatte sie zweifellos. Dornbusch schenkte sich erneut ein und trank. Das war ihm ja noch nie passiert, dass sich ein Mädchen derart schamlos benahm. Wobei er sich fragte, ob die Bezeichnung «Mädchen» bei ihr wirklich noch zutraf, nachdem sie ihm die Hand zur Brust geführt hatte.
«Es tut mir leid», fuhr sie fort, «das wollte ich nicht. Aber zugeben müsst Ihr schon, dass Ihr Euch getäuscht habt.»
Sie lächelte ihn offen an, und Dornbusch konnte nicht umhin, den Blick zu erwidern. Ihre Sorglosigkeit hatte etwas Ansteckendes, dem er sich nicht entziehen konnte. Zu Hause wartete seine Frau Felicitas auf ihn. Dann war es vorbei mit dem Lächeln und den kecken Worten. Natürlich würde sie von ihm wieder Rechenschaft über seinen Aufenthalt im Wirtshaus verlangen, dem Ort, wo der Teufel umherging, und natürlich würde auch dieser Abend wieder im Streit enden, wie so viele in den vergangenen Monaten.
«Sei’s drum», sagte er kurzerhand. «Auf eine Stunde mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an.»
So setzte er sich zu Grit, und beide redeten und tranken bis spät in die Nacht. Felicitas’ mahnende Worte gerieten in Vergessenheit, was ihn jedoch nicht betrübte, sondern erleichterte. Schon lange war er nicht mehr so ausgelassen gewesen, losgelöst von jedweden Sorgen und Pflichten und frei von der Erinnerung an drei tote Kinder.
Als Valthin auf den Hof kam und zum Aufbruch mahnte, waren aus dem einen Krug Wein drei geworden.
«Ist es schon so weit?», fragte Dornbusch stark angetrunken.
«Ja, werter Herr», antwortete Valthin. «Ich muss Euch leider bitten zu gehen. Der Bischof …»
«Zum Teufel mit ihm», winkte Dornbusch mürrisch ab und stand auf. Aber Sitzen war einfacher als Stehen, und so griff Grit ihm unter die Arme.
«Lasst mich Euch helfen.»
Er ließ es geschehen. Sie führte ihn allerdings nicht hinaus auf die Straße, sondern die Stufen hoch in ihre Kammer.
«Wo willst du mit mir hin?»
«Grämt Euch nicht länger. Ich will Euch vergessen lassen.»
Das war ein verlockender Gedanke, und Dornbusch ergab sich ihm schließlich.
Das war vor drei Nächten gewesen, und seitdem hatte sie nichts mehr von ihm gehört. Hatte er ihre gemeinsame Nacht etwa schon vergessen?
Grit lag hinter einem Mauervorsprung auf der Lauer, den Eingang von Neumünster im Blick. Die Bürger strömten zum Morgengebet in die Kirche, in deren Keller die Gebeine des heiligen Kilian und seiner Gefährten lagen, die in Zeiten der Not um Hilfe angerufen wurden. Allen voran kamen die Kinder, dann die Weiber und zum Schluss die ehrwürdigen Herren, unter ihnen auch einige Stadträte. Christian war jedoch nicht dabei.
Als die Kirchentür geschlossen wurde, kam Grit aus ihrem Versteck und blickte sich verwundert um. Hatte Valthin nicht gesagt, dass Christian mit den anderen Stadträten das Morgengebet besuchte?
Enttäuscht machte sie kehrt – und lief ihm direkt in die Arme. Er kam aus einer der engen Seitengassen, die zum Markt führten. Das Aufeinandertreffen mit Grit hätte er offenbar gerne vermieden, auch schien er in Eile. Er fühlte sich sichtlich unwohl.
«Grit, was machst du hier?»
«Ich wollte dich sehen. In den Stachel kommst du ja nicht mehr, und der Weg zu meiner Kammer ist dir auch zu weit.»
Wie ein Vater seine ungehorsame Tochter für eine Belehrung unter den Arm greift, führte Christian sie von der Tür weg, die sich jederzeit öffnen konnte. In der Seitengasse war es sicherer.
«Ich bin ein verheirateter Mann», sagte er streng. «Ich kann mich nicht mit einem anderen Weibsbild in der Öffentlichkeit sehen lassen.»
«Dann komm mit zu mir», antwortete Grit trotzig.
Christian legte ihr den Finger auf den Mund. «Schweig, ich will nichts davon hören. Weiß der Teufel, wie ich in jener Nacht in deine Kammer gekommen bin. Es kann nicht mit rechten Mitteln zugegangen sein. Nie würde ich ein fremdes Weib begehren.»
Grit lächelte spöttisch. «Der Teufel hat damit gar nichts zu tun.»
«Wie meinst du das?»
«Dass es keinen Teufel braucht, wenn du mir das Mieder löst. Das hast schon ganz alleine du vollbracht.»
«Ich kann mich nicht erinnern. Ich war betrunken.»
Grit kam näher und legte ihre Arme um ihn. «Berauscht ist das bessere Wort. Berauscht von mir?»
Doch Christian stieß sie zurück. «Ich habe nichts mit dir zu schaffen. Geh fort und schenke uns beiden Frieden. Hörst du?»
Dann ließ er sie stehen und eilte auf das Neumünster zu.
Grit blieb im Dunkeln zurück. Es musste einen anderen Weg zu seinem Herzen geben. Vielleicht war seine Frau Felicitas die Antwort.
4
Das Stift Neumünster war in einem bedauerlichen Zustand. Von den Decken und Wänden bröckelte der Putz, in das blanke Mauerwerk kroch die Feuchtigkeit, und durch die fingerbreiten Ritzen der Fenster pfiff der Wind herein. Vorbei war die Zeit, als die zahlreichen Pfründe dem Stift noch hohe Einnahmen verschafft hatten. Jetzt, da es an allem mangelte, wollte das Domkapitel keinen Gulden für die Ausbesserungsarbeiten der weitläufigen Klosteranlage zur Verfügung stellen. Die mehr als sechzig Kanoniker und Vikare zählende Stiftsgemeinschaft musste selbst sehen, wie sie zurechtkam.
Eine bescheidene Einnahmequelle fand sie in der Unterrichtung von Kindern. Die Eltern schickten ihren Nachwuchs gerne ins Stift. So konnten sie sicher sein, dass ihre Kinder eine züchtige und vor allem gottesfürchtige Ausbildung erhielten. Vikar Ludwig war einer dieser Lehrer. Er versah seinen Lehrauftrag weniger aus Überzeugung als auf Anweisung des Propsts. Die Verkündigung der Frohen Botschaft handhabte er – wie seine Kollegen auch – auf seine ganz eigene Weise.
«Du Sohn des Teufels, du bist voller List und Tücke und kämpfst gegen alles Gute.»
Ludwigs schmales Gesicht glühte vor Zorn. Er blickte auf den schmächtigen Otto herab, der wie erstarrt war.
«Wie lauten die Worte des Herrn?», wiederholte Ludwig.
Otto erinnerte sich an kein einziges Wort, das der Pfarrer zum Abschluss des Morgengebets in der Kirche von Neumünster gesprochen hatte. Er war in einen wohltuenden Schlaf gefallen, den Kopf gegen Kathis Schulter gelehnt.
«Mach endlich den Mund auf.»
Hilfesuchend blickte Otto zur Seite, wo Barbara saß. Sie formte mit ihren Lippen ein Wort: Achtsamkeit. Doch Otto verstand nicht.
Da krachte auch schon die Rute auf den Tisch.
«Still! Ich will es von Otto hören.» Und zu Barbara gewandt, drohend: «Untersteh dich, mich weiter zu hintergehen.»
Die Drohung war ernst zu nehmen. Ludwig war kein Mann der leeren Worte, wenn es um Züchtigung ging. Barbara senkte das Haupt. Sie konnte nur hoffen, dass die Stunde schnell vorüberging und Ludwig nicht noch einmal auf sie aufmerksam wurde.
Genauso dachten die anderen elf Schüler. Sie scheuten jeden Blickkontakt mit ihm.
Kathi wusste, was als Nächstes geschehen würde, und dennoch wollte sie nichts unversucht lassen, um ihrem Freund die Prügel zu ersparen. Sie hob zögernd die Hand.
«Ehrwürdiger Vikar, lasst mich für Otto die Worte des Herrn sprechen.»
Ungläubig drehte sich Ludwig zu ihr um. Jede Einmischung kam in seinen Augen einer Auflehnung gleich.
«Wer hat dich gefragt?», fragte er spitz.
Sie senkte den Blick. «Niemand.»
Ludwig nickte. «Korrekt, niemand.» Und wie es seine Art war, fand er auch den passenden Bibelvers dazu. «Niemand hat Gott je gesehen; der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Niemand sonst. So steht es in unserer Heiligen Schrift geschrieben. Nun, mein Kind, sag mir, bist du niemand und hast du Gott je gesehen?»
Die Frage war herausfordernd und hinterhältig. Kathi wusste keine Antwort darauf. Aber darum ging es hier auch nicht. Ludwig demonstrierte seine Macht.
«Ich habe Gott nie mit eigenen Augen gesehen», antwortete Kathi kleinlaut.
«Und warum kannst du Gott nicht sehen?»
Sie zögerte, rätselte. «Weil er für des Menschen Auge unsichtbar ist?»
Die Rute schnellte herab und traf sie quer über den Rücken.
«Nein, du dummes Gör, weil nur derjenige Gott schauen kann, der reinen Herzens ist. Die Sünde hat dich untauglich gemacht, das göttliche Licht und seine Allherrlichkeit zu ertragen. Darum kannst du Gott nicht sehen.» Er drehte sich zu seinen verschreckten Schülern um. «Ist hier noch ein Niemand, der Gott je gesehen haben will?»
Kein Einziger wagte zu antworten, alle hielten sie den Blick gesenkt, um ihn nicht weiter zu reizen.
Ludwig wandte sich wieder seinem ersten Opfer zu. «Zurück zu dir, Otto», sagte er versöhnlich. «Du hattest Zeit genug, dich der Worte des Herrn zu erinnern. Sag mir nun, wie lauten sie?»
Otto war sich der gespielten Freundlichkeit Ludwigs bewusst. Es gab keinen Grund zur Beruhigung, zu oft war dieser verständnisvolle Ton in handfeste Prügel umgeschlagen. Er suchte fieberhaft nach einer Antwort. Doch es war vergebens.
«Ich kenne sie nicht.»
Das waren die Worte, die Ludwig hören wollte. «Nun denn, bekenne deine Schuld – so wie du es gelernt hast.»
Und Otto begann unter Tränen: «Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe …»
Während Otto diese Worte sprach, zog Ludwig ihn bei den Haaren und führte ihn vor die Klasse. Dort stand ein Stuhl bereit.
«… darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Amen.»
Er wies Otto an, sich zu bücken. Die übrigen Schüler hatten das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Die Rute gab den Takt vor.
«Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde …»
Im Takt der Worte fuhr die Rute auf den kleinen Körper herab, ein ums andere Mal, während der monotone Singsang der Kinder Ottos Schreie begleitete.
Kathi flehte zu Gott, dass dieses Elend ein Ende haben möge. Aber davon war so schnell nicht auszugehen. Die Schule und die Prügel würden die Kinder während der nächsten Jahre begleiten, solange ihre Eltern das Geld noch aufbrachten, um es diesen feinen Brüdern in den Rachen zu werfen.
Sie blickte zur Seite und sah die totenbleiche Barbara, die in der Gerberei alles Leben zu verlieren schien. Nicht anders war es bei Ulrich, gleich neben ihr, der bei einem Hutmacher in die Lehre ging. Nach einigen Wochen hatten seine Glieder unwillkürlich zu zucken begonnen, drei Finger der rechten Hand waren taub. Das Quecksilber und das Arsen im Wasser würden ihn bald zum Krüppel machen. Und da war Benedikt, der Älteste unter ihnen. Er war dreizehn Jahre alt und arbeitete bei einem Drechsler. Er hatte die große Hoffnung, bald auf Wanderschaft gehen zu können, ja gehen zu müssen. Die Schwester seiner Mutter war im letzten Herbst auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Es würde nicht mehr lange dauern, bis auch Benedikt und seine Eltern die zweifelhafte Aufmerksamkeit der Hexenkommissare erregen würden. Flucht war der einzige Weg, um zu überleben.
Die Züchtigung von Otto neigte sich dem Ende zu. Die letzten Hiebe ertrug er, ohne zu schreien. Der Körper gewöhnte sich an den Schmerz.
So musste es auch bei Jesus gewesen sein, dachte Kathi.
Ringsum hingen kleine, bemalte Tafeln, die seinen Leidensweg zeigten – vom Einzug in Jerusalem und seiner Gefangennahme bis zum Tod am Kreuz. Seltsam, wie friedlich er zum Schluss seiner Peinigung aussah. Nur der Anfang war schwer gewesen. Im Garten Gethsemane war er verzweifelt gewesen, hatte Todesängste ausgestanden. Sein Schweiß war wie Blutstropfen zu Boden gefallen, hatte sie in der Bibel gelesen. Ein Engel musste vom Himmel herabkommen, um ihn zu stärken. Aber am Kreuz wirkte er erlöst. Es ist vollbracht. Danach hatte er diese Welt der Schmerzen hinter sich gelassen.
Was für ein starker Mensch dieser Jesus von Nazareth gewesen sein musste. Dabei hatte er als Kind gar nicht so ausgesehen. Drüben am Fenster hing ein Bild von seiner Geburt in Bethlehem. Darauf wirkte er nackt und zerbrechlich. Einer der Hirten hätte ihn leicht mit einem Stockschlag töten können. Oder die drei Könige hätten ihn mit ihren goldenen Dolchen aufspießen und den Wölfen zum Fraß vorwerfen können. Eigentlich waren sie dazu verpflichtet gewesen, schließlich hatte König Herodes nach ihm suchen lassen. Aber seltsamerweise war nichts von alldem geschehen. Wieso eigentlich? Statt dieses schwache und hilflose Kind den Soldaten auszuliefern, beugten Hirten und Könige das Knie vor ihm.
Rätselhaft und ein wahres Wunder. Worin hatte die Macht dieses kleinen Jesus bestanden?
Die Antwort musste warten. Es klopfte ans Fenster. Auf der Straße stand Bruder Sebastian und gab Ludwig ein Zeichen. Das Urteil würde gleich verkündet werden. Er solle sich beeilen.
«Ihr habt es gehört», sprach Ludwig zu den Kindern. «Steht auf und folgt mir nach draußen.»
So froh Kathi und die anderen auch waren, dass der Unterricht für heute beendet war, so würden sie nun Zeuge eines weiteren grausamen Spektakels werden.
Es war Brandtag in der Stadt, bereits der zweite in diesem Monat. Wegen Hexerei stand die wohlhabende Witwe Glöckner unter Anklage. Viele hatten geglaubt, ihr Reichtum und ihr Einfluss würden sie vor dem Scheiterhaufen bewahren. Doch letzten Endes war es anders gekommen. Man munkelte, dass sie gerade wegen ihres Reichtums und Einflusses besagt worden war.
Es gab da einen Neffen, einen Tunichtgut, der fortwährend in Geldnot schwebte. Nach Abzug der Verfahrenskosten – für die der Angeklagte selbst aufkommen musste – würde der verbleibende Rest an ihn fallen. So hatte er es im Überschwang und bei reichlich Wein im Gasthaus verkündet. Er war damit nicht auf dem neuesten Stand gewesen, denn die Verwandten von überführten Hexenleuten waren in letzter Zeit selbst unter Verdacht geraten. Also war ihm der Boden zu heiß geworden, und er war geflüchtet.
Als Zweiter sollte der Schultheiß Haag vom Leben zum Tode gebracht werden. Er war von einer zwielichtigen Gestalt, einem Spielmann aus Heidingsfeld, des Bündnisses mit dem Teufel bezichtigt worden, nachdem dieser selbst unter der Folter den Teufelsbund eingestanden hatte. Haags Beteuerung, der Spielmann beschuldige ihn aus Rache, weil er ihm einst zwanzig Stockhiebe als Strafe auferlegt habe, blieb vergeblich. Niemand wollte davon hören. Wie alle anderen auch hatte Haag im Verlauf des Verfahrens gestanden.
Weniger dramatisch verhielt es sich mit den fünf anderen. Es waren Fremde, Durchreisende und Vagabunden, die niemand kannte und um die sich niemand scherte. Sie sollten ein weithin leuchtendes Beispiel dafür geben, dass man in Würzburg keine Gnade kannte mit finsteren Gestalten.
Bei der letzten Angeklagten hingegen handelte es sich um jemand Besonderen. Es war die siebenjährige Johanna. Sie war das sechste Kind des Mainfischers Wilhelm Klauber und seiner Frau Agnes, zweier rechtschaffener Bürger der Stadt. Die Klaubers waren beliebt, jeder achtete sie und hielt sie für gute Christenmenschen. Nicht zuletzt, weil sie sich viel Mühe mit ihren Kindern gaben und sie zum Unterricht zu Schulmeister Friedrich schickten, einem studierten Rechtsgelehrten, der sich auf seine alten Tage mit der Kindererziehung ein Zubrot verdiente.