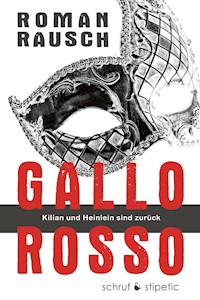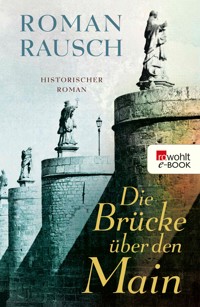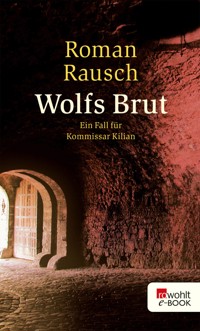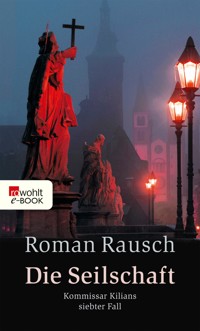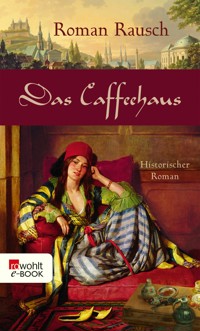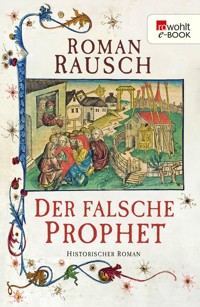6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Kilian ermittelt
- Sprache: Deutsch
Theaterdonner und Höllenfahrt 1300 Jahre Würzburg: Im Mainfrankentheater wird als kulturelles Highlight Mozarts «Don Giovanni» inszeniert. Die Proben laufen auf Hochtouren, aber ein unfähiger Hauptdarsteller und ein zögerlicher Regisseur drohen die Premiere zum Desaster werden zu lassen. Als sich der Regisseur mit einer Kugel in den Kopf verabschiedet, scheint der Vorhang für das Stück endgültig gefallen zu sein. Doch Kommissar Kilian und Kollege Heinlein glauben nicht an Selbstmord und betreten die Bühne. «Für Krimifreunde ein Genuss. Und für Würzburg ein echter Glücksfall.» (Bayernkurier)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Roman Rausch
Der Gesang der Hölle
Kommissar Kilians vierter Fall
Dieser Roman ist frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden und verstorbenen Personen wären zufällig und sind nicht beabsichtigt. Die verwendeten Ortsnamen, Werke, Gruppierungen und alle sonstigen Bezeichnungen stehen in keinem tatsächlichen Zusammenhang mit dem Roman.
Für meinen Sohn Lev.
Eine Liebe, die unermesslich ist
Stirbt das Schauspiel, folgen ihm die Dichter. Dann verliert selbst der ¾-Takt seinen Schmäh und wir unsere Sprache.
In Anerkennung für einen Könner seines Fachs.
Nie zuvor habe ich Theater lebhafter erfahren.
Gute Reise, H.
Ouvertüre
Es ist die Chance meines Lebens. Sie kehrt nie wieder.
Mein ganzer Körper bebt vor Ungeduld. Ich muss mich beruhigen, damit ich die Kontrolle nicht verliere. Denn die Kontrolle zu behalten bedeutet Macht. Kraft ohne Kontrolle ist nichts. Weiß Gott, ich habe Kraft und Kontrolle bewiesen, anders wären die letzten zehn Tage mit den Bamberger Symphonikern nicht zu bewältigen gewesen.
Doch all die Mühen scheinen umsonst. Ich ahne es.
Nun stehe ich vor ihnen, zum letzten Mal, sehe es in ihren Gesichtern geschrieben. Ich kann in ihnen lesen wie in einem Notenblatt. Jeder Augenaufschlag, jede Miene und jeder Atemzug ist eine Note, die ich höre, noch bevor sie erklingt.
Nun sprecht endlich, ich kenn die Worte zur Genüge, hab sie schon oft gehört. Es kostet Kraft und Überwindung und meine letzten Reserven. Seht her, schreie ich ihnen stumm entgegen, ich habe mich entblößt, euch mein Innerstes gezeigt, meine Seele freigelegt. Ich halte es nicht mehr länger aus.
Meine Hände auf dem Rücken zu Fäusten geballt, höre ich den Urteilsspruch.
«Eine außergewöhnliche Leistung», sagt der, der sich zum Richter über Himmel und Hölle aufschwingt. «Unerwartet und mehr als erstaunlich» sei meine Leistung gewesen, «eines Meisters würdig».
Der Richter blickt zur Seite. Seine Adjutanten pflichten ihm bei. Sie nicken, lächeln mir aufmunternd zu, einer klatscht unhörbar in die Hände.
Sollte ich mich geirrt haben?
Ein warmer, wohliger Stoß durchfährt meinen Körper. Ich spüre, wie sich mein Brustkorb weitet. Ich möchte singen, meine Freude hinausschreien über den Sieg. Nicht den, den ich errungen habe, sondern den ihrigen über ihr eigenes Mittelmaß, jetzt, da sie endlich meine Kunst verstanden haben. Ich danke euch aus tiefstem Herzen.
«Mit Ihrer Begeisterung und Leidenschaft für die Musik», fährt er fort, «haben Sie uns und die Zuhörer in den Bann gezogen. Die Stimme in Ihrer Musik hat uns bewegt. Es war die der Liebe. Ein unvergessliches Ereignis.»
Noch ein Wort und ich berste vor Glück.
«Doch wir mussten hier andere Prioritäten setzen, leider», spricht er weiter. «Wir hatten zu entscheiden, wie viel Potenzial in den Kandidaten steckt. Dies ist die erklärte Aufgabe unseres Wettbewerbs. Wir haben uns deshalb für Ihren Kollegen Gustavo entschieden. Er hat das Publikum und uns mit seiner unbekümmerten Art verzaubert. So konnten wir erfahren, welches Feuer in ihm brennt und dass es noch viel bei ihm zu entdecken gibt.
Wir gratulieren Ihnen herzlich zum zweiten Platz.»
Ich drohe den Halt zu verlieren, taumle, die Gesichter vor meinen Augen verschwimmen, ihre Stimmen hallen schwer, verhöhnen mich… «Gratulieren Ihnen herzlich zum zweiten Platz.»
Welche Schande. Ein zweiter Platz ist so viel wert, als wäre ich überhaupt nicht angetreten. Schlimmer, denn jetzt gehöre ich zu den Verlierern, gleich ob Zweiter oder Letzter. Nur der Erste gewinnt, alle anderen sind bereits jetzt vergessen, egal, wie gut ihre Leistungen waren. Wissen sie das denn nicht? Ahnen sie nicht, was sie mir damit antun?
Ich muss mich beherrschen. Diesen Triumph darf ich ihnen nicht gönnen. Ich werde ihnen eine Lehre erteilen. Besonders ihm, dem Regisseur, der so sicher ist in seinem Urteil, der glaubt zu wissen. Seine gesalbten Worte der Begründung. Er kleidet sie in Aphorismen und Metaphern, so, als wären sie dadurch weniger schmerzlich. Doch sie durchbohren mich wie Pfeile, ein ums andere Mal. Das Lob, das er abermals über mich und meine Arbeit ausschüttet, beschämt mich, beleidigt meinen Geist.
Er weiß nicht, was er mir antut, denn er weiß nichts von mir und meinem Können. Er ist blind wie ein Maulwurf und taub wie ein Fisch. Wie hatte ich mir nur einbilden können, bei diesem Wettbewerb auf offene Ohren und einen wachen Verstand zu treffen. Die Chance meines Lebens ist vertan. Er und die anderen haben mich betrogen, mich um den Lohn gebracht.
Der Schmerz ist wieder da, er durchbohrt meinen Kopf wie ein Nagel, wenn er ins Fleisch getrieben wird und den Knochen spaltet. Der hohe, sirrende Ton, der meine Nervenbahnen zu zerreißen droht, ist unerträglich. Ich halte mir die Ohren zu. Umsonst, er drängt nach draußen. Grenzenlose Wut steigt in mir auf.
Ich muss mich beruhigen, langsam atmen, den Herzschlag kontrollieren. Ich werde mit erhobenem Haupt dieser Jury trotzen. Die Schmach erdulden. Ich spüre, wie die Kraft mich neu belebt. Der Zorn macht mich stark.
«Das Potenzial nicht ausgeschöpft», das waren seine Worte.
Sie hallen in mir wider. Tausendfach. Sie mischen sich mit dem Hohn meiner Konkurrenten und dem beleidigenden Geschwätz der Jury.
Einen Lehrling ziehen sie einem Meister vor. Welcher Wahnsinn umgibt mich hier? Das darf nicht sein. Ich weigere mich, das Urteil zu akzeptieren.
Du sollst dein Potenzial bekommen, das schwöre ich bei allem, was mir heilig ist. Aus der Tiefe meiner Brust erhebt sich zornig eine Stimme:
Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen,
Tod und Verzweiflung, flammet um mich her!
1
Später würde man berichten, dass es nicht der erste, aber auch nicht der letzte Tote am Mainfrankentheater in Würzburg gewesen war.
Freddie Sandner raufte sich die Haare. Seit über einer Stunde kamen sie in der ersten Szene über einen bestimmten Punkt nicht hinaus. Auf der Bühne im Großen Saal des Mainfrankentheaters standen drei der Hauptakteure des Don Giovanni ratlos herum. Sie verstanden einfach nicht, wie der Regisseur die Umsetzung der Szene wünschte.
Aber so schnell würde Sandner nicht aufgeben. Sein grenzenloser Optimismus und seine freundliche Art, mit Schauspielern und Sängern umzugehen, waren legendär. Er galt als ein Sonnenschein unter den Regisseuren. Den Launenhaften, gar den Bösartigen zu spielen missfiel ihm zutiefst. Er war der Ansicht, dass Angst kein guter Lehrmeister sei. Stattdessen setzte er auf Begeisterung und Freude an der Arbeit.
«Alles zurück auf Anfang», sagte er ruhig und stieg die zwei Stufen hinab in den Orchestergraben. Dort warteten ein leerer Stuhl und seine unruhige Mannschaft. Hier waren alle versammelt, die man bei Proben zu einer Opernaufführung brauchte: Sue, die Pianistin an ihrem Klavier, Rainer, der zweite Kapellmeister und Dirigent des Stückes, Marianne, die Regieassistentin, und Franziska, die Souffleuse. Ihr hatte er erlaubt, statt in ihrem engen Kabuff im Orchestergraben Platz zu nehmen.
Auf der Bühne gingen die Sänger in Position. Leporello verschanzte sich unter der Treppe, Donna Anna und Don Giovanni zogen sich hinter einem Bühnenfenster hoch oben am Ende einer herrschaftlichen Treppe zurück.
«Wenn wir jetzt alle so weit sind», rief Sandner zur Bühne hinauf, «dann… bitte schön.»
Das Licht auf der Bühne erlosch und verwandelte die Szene in einen bedrohlichen Ort. Kerzenschein flackerte aufgeregt die Treppe hinauf zum Schlafzimmer der Donna Anna. Ein lustloser Leporello wartete auf seinen Herrn im dunklen Eck der Treppe; in der Tasche das geheime Verzeichnis der zweitausendfünfundsiebzig Frauen, bereit, die Zahl um eine zu erhöhen.
Rainer gab Sue den Einsatz.
Molto allegro. Das Klavier zürnte dem Hinterhalt eines spanischen Edelmannes, Don Giovanni, der hinter vorgehaltenem Mantel unerkannt zu flüchten suchte. Sein Opfer in dieser Nacht war die tugendhafte Donna Anna. Barfuß, im seidenen Nachthemd und mit aufgelöstem Haar packte sie ihn am Arm, forderte, seine Identität preiszugeben. Zweifel nagten an ihr. Die Leidenschaft ihres Verlobten Don Ottavio war in dieser Nacht ungewohnt groß gewesen.
Ihr wütender Sopran schnellte in die Höhe.
«Hoffe nicht zu entkommen, nur der Tod entreißt dich mir.»
Anklagend drängte sie zur Aufklärung; ihre Fahrlässigkeit könnte sie ein Leben lang hinter Klostermauern verbannen.
Über den Rand des Mantels funkelten die Augen Don Giovannis die Betrogene an.
Ein mächtiger Bariton nahm ihr jegliche Hoffnung.
«Rasende, du schreist umsonst. Wer ich bin, erfährst du nicht.»
Aus dem Hintergrund verfolgte Leporello die Szene. Ein tiefer Bariton, nahe an einem Bass, kommentierte das Geschehen.
«Welch ein Aufruhr! Der Herr in neuen Misslichkeiten.»
Donna Anna schrie händeringend um Hilfe.
«Diener! Auf den Verbrecher!»
Ein ungleicher Kampf begann. Don Giovanni zwang sie mühsam in die Knie.
«Schweig und zittere vor meiner Wut!»
Donna Anna ließ es geschehen. Ihr schwerer Körper ging von ihr bestimmt zu Boden. Die dünnen Arme des Peinigers mühten sich umsonst.
«Verbrecher!», schleuderte sie ihm hasserfüllt entgegen.
Leporello verzog sich in die hinterste Ecke der Treppe.
«Man wird sehen, wie dieser Leichtfuß mich ins Unglück stürzen wird.»
Einsatz Don Giovanni. «…»
Nichts, kein Laut war zu hören, Don Giovanni blieb stumm.
Das Klavier spielte weiter, hatte die Stelle bereits hinter sich gelassen.
Sandner rieb sich verärgert die Stirn. Dennoch ließ er weiterspielen.
Der Darsteller des Don Giovanni suchte nach seinem Text im Klavierauszug, den er unter dem Mantel versteckt hielt. Das laut Notenblatt furiose Terzett schrumpfte zu einem Duett der Donna Anna und des Leporello.
«Wahnsinnige!», kam ihm Franziska, die Souffleuse, zu Hilfe.
«Wahnsinnige…», nahm Don Giovanni dankbar auf.
Donna Anna fuhr fort, ihre Rache würde grenzenlos sein. «Wie eine verzweifelte Furie werde ich dich verfolgen.»
Don Giovanni erstarrte abermals in Tatenlosigkeit.
«Jetzt pack zu!», schrie Sandner vom Orchestergraben hinauf.
Don Giovanni, in einer Hand die Partitur, kraftlos in der anderen den Arm der Donna Anna, wusste nicht wie. Mit einem dämlichen Lächeln, das nach Erlösung suchte, schaute er in die Reihen vor ihm.
«Aus!», schallte es auf die Bühne.
Die Spannung wich. Das Klavier verstummte. Donna Anna rollte von den Knien auf ihr Hinterteil, wischte sich den Staub von den Händen.
«War gut?», fragte Vladimir, der russische Don Giovanni, den heranstürmenden Sandner. Hinter ihm im Zuschauerraum meldete sich lautstark ein Handy, eine Zeitung wurde umgeschlagen, und das Rascheln einer Tüte verriet, dass die Proben zum Don Giovanni nur wenig Begeisterung auszulösen vermochten.
Über ihnen in der Galerie verfolgte der Intendant das Treiben auf der Bühne. Sein Blick war leer, hoffnungslos stierte er nach unten. Der Premierentermin in zwei Wochen würde in einem Desaster enden.
«Ganz ruhig, Vladimir», sagte Sandner, «bitte keinen Stress.»
Er bat die Donna Anna nochmals auf die Knie. Vom Schmutz auf der Bühne angewidert, folgte sie der Anweisung nur zögerlich.
«Schau her», sagte Sandner zu Vladimir.
Er beugte sich über Donna Anna, packte zu und zwang sie ganz zu Boden. Kayleen, die australische Darstellerin, stöhnte auf. Er lockerte sofort den Griff, entschuldigte sich mit einem Lächeln.
«Wenn sie dir sagt: ‹Wie eine Furie…›, dann drückst du sie genau so zu Boden. Verstehst du? Wie einen räudigen Hund. Sie hat es gewagt, dir zu drohen… dir, dem Don Giovanni… und der bestimmt, was geschieht. Er ist der Herr der Lage, nicht sie. Also bestraf sie, tu ihr weh.»
Vladimir war unsicher, wusste nicht, ob er richtig verstanden hatte. «Wehtun… wem?»
«Na, ihr, der Donna Anna.»
«Richtig Schmerz?»
Raunen in den Reihen vor ihnen.
Sandner setzte ein zweites Mal an. Der zornige Blick Kayleens stoppte ihn. «So, wie ich es dir gerade gezeigt habe.»
Zu Leporello, der sich unter der Treppe verkrochen hatte: «Und du, Roman… Wo steckst du denn schon wieder?»
Leporello kam aus seinem dunklen Loch unter der Treppe hervor.
«Roman, zeig mir deine Beteiligung am Geschehen, deine Zerrissenheit, hier vorne auf der Bühne, nicht dort hinten im dunklen Eck, wo dich niemand sieht. Auf der einen Seite musst du deinem Herrn Don Giovanni zu Hilfe eilen, auf der anderen bist du ein Hasenfuß, der flüchten will.»
Der Pole Roman, ein Berg von einem Mann, nickte beflissen, aber sein Blick schweifte haltlos im Raum umher, als sei er ertappt worden.
«Hast du das verstanden, Roman?»
Ein verhaltenes «Ja» kam zurück.
«Gut. Dann alle auf Ausgangsposition.»
Sandner ging an seinen Platz, schaute nach oben in die Ränge, nickte dem Intendanten zu, signalisierte, dass er die Sache im Griff hatte, die Premiere nicht gefährdet war, er sie zum erhofften Ereignis dieses Festspielsommers machen würde.
«Die werden’s nie kapieren», raunzte seine Assistentin Marianne.
«Pst», beschwichtigte er.
«Dieser Don ist ein Hochstapler. Ich weiß nicht, wie man den engagieren konnte. Und der Leporello hat den IQ meiner Schuhgröße.»
«Sei jetzt still.»
«Mach endlich die Augen auf. Die reißen uns noch alle ins Verderben. Wir haben nur noch zwei Wochen.»
«Ich krieg das schon hin, keine Sorge.»
Die Assistentin schüttelte verständnislos den Kopf.
Sandner zur Bühne: «Sind wir so weit? Dann… bitte sehr.»
Das Klavier begann erneut mit der wütenden Anklage der Donna Anna. Don Giovanni stürzte aus dem Schlafzimmer, Gesicht und Partitur hinter dem Mantel verborgen. Sein Degen, der ihn als Edelmann auszeichnete, baumelte ihm an der Seite. Er hätte eine dritte Hand gebraucht, um auch diese Requisite zu bändigen.
Don Giovanni: «Rasende! Du…»
Souffleuse: «…schreist umsonst.»
Don Giovanni: «Wer ich bin…»
Souffleuse: «…erfährst du nie.»
Donna Anna: «Diener! Auf den Verbrecher!»
Vorausahnend ging sie auf die Knie. Don Giovanni benötigte die Hand für den Text.
Souffleuse: «Schweig und zittere vor meiner Wut.»
«Pack sie!», schallte es aus den Reihen.
Don Giovanni gehorchte und ließ Partitur und Deckung fallen. Mit beiden Armen drückte er Anna zu Boden, als wolle er sie ertränken.
Donna Anna: «Verbrecher!»
Don Giovanni: «…»
Souffleuse: «Wahnsinnige.»
Sandner: «Weiter! Bringt es zu Ende.»
Aus der Gasse stürmte mit gezücktem Degen der Komtur herbei, der Vater Donna Annas, und forderte Vergeltung. Sein Bass klang ehrfurchteinflößend.
«Lass sie, Schamloser. Schlag dich mit mir!»
Don Giovanni erhob sich, rückte den Degen zurecht. Seine schmale Brust ließ zarte Anflüge von Kampfeslust erahnen.
Souffleuse: «Geh…»
Don Giovanni: «Geh…»
Souffleuse: «…du bist nicht würdig…»
Don Giovanni: «…»
Sandner: «Weiter!»
Don Giovanni stellte sich dem Komtur. Der Degen war bereit, weiteres Unheil über die ehrenhafte Familie der Donna Anna zu bringen.
Souffleuse: «Elender, warte…»
Sandner: «Zieh jetzt deinen Degen!»
Don Giovanni, breitbeinig und siegesgewiss, zückte den Degen und legte ihn über Kreuz mit dem des Komturs. Es gelang ihm überraschend gut.
«Nun fechtet!»
Die Klingen schlugen wie geprobt genau dreimal aufeinander, bis Don Giovanni den Komtur entwaffnen und erstechen sollte. Doch nicht des Komturs Klinge, sondern die des Don Giovanni flog in hohem Bogen über die Bühne.
Ein Raunen erfüllte den Zuschauerraum. In den Rängen wurde eine Tür aufgerissen. Alle Augen richteten sich nach oben, bis die Tür ins Schloss fiel, dann fixierten sie fordernd Sandner.
Die Regieassistentin reagierte als Erste. «Schmeiß ihn raus. Jetzt sofort!»
Pianistin, Dirigent, Souffleuse und Sänger warteten auf eine Entscheidung.
«Macht bitte keinen Stress», beruhigte Sandner. «Zwanzig Minuten Pause.»
Er verließ den Zuschauerraum. Zurück blieben enttäuschte Gesichter. Nur Vladimir schien die Lage anders zu interpretieren. Er nahm seinen Degen auf und forderte den Komtur erneut.
«Lass gut sein!», sagte der Komtur und schlug ihm den Degen aus der Hand. «Gehen wir was trinken.»
Von der Bühne des Großen Saals waren es nur wenige Schritte bis zum langen Gang des Erdgeschosses. Durch zwei stählerne Feuerschutztüren hindurch und an der Inspizientin Jeanne vorbei, die von ihrem Schaltpult aus die gesamte Bühnentechnik steuerte. Sie wachte eisern darüber, dass kein Unbefugter während der Probe Sänger und Regisseur bei ihrer Arbeit störte.
Ihre Ansage «Die Proben für den Don Giovanni sind für zwanzig Minuten Pause unterbrochen» erreichte über die Lautsprecher alle Etagen des Theaters. Sie gab den an der Produktion Beteiligten Gelegenheit, sich in der Kantine im Untergeschoss zu erholen oder sich, je nach Aufgabengebiet, auf den weiteren Probenverlauf vorzubereiten.
Einige Techniker traten den Weg in die Kantine an. Ihr Urteil über die bisherige Probe war eindeutig vernichtend. Sie machten keinen Hehl daraus, wenn sie auf Kollegen trafen.
Die Sänger, die die Bezeichnung Solisten bevorzugten, zogen sich stattdessen allein an einen Ort der Stille zurück. Sie wussten, dass sie und die gesamte Inszenierung nur so stark waren wie das schwächste Glied in der Kette. Dennoch wagte keiner, offen Protest zu erheben. Letztlich waren nicht sie, sondern der Regisseur verantwortlich. Damit ließ sich an einer kleinen Bühne gut leben. Zudem wusste man nie, ob man dem gescholtenen Regisseur nicht noch einmal an einem anderen Haus begegnen würde.
Während sich das Ensemble über die drei Stockwerke verteilte, drangen aus dem Büro des Intendanten im zweiten Stock aufgebrachte Stimmen. Vorwürfe wurden im Stakkato vorgetragen, leise Beschwichtigungen folgten und fanden kein Gehör beim Adressaten.
Dann wurde es still. Eine Tür weiter hinten am Gang schloss sich, eine andere wurde geöffnet, und der Aufzug fuhr nach unten.
Sandner verließ erhobenen Hauptes das Büro des Intendanten. Seine Schritte klangen schwer auf dem Linoleumboden. Er ging in sein Büro, das er hinter sich verschloss.
Jeannes Stimme kündigte die Fortführung der Probe am Don Giovanni an. Durch das Treppenhaus waren Wortfetzen zu hören. Emsiger Betrieb erfüllte das Haus. Eine Tür wurde geöffnet, der Sopran aus der Oper Dialogues des Carmelites drang aus dem Raum. Es war die Szene der Blanche mit der Mère Marie, kurz bevor sie zum Galgen geführt wird.
Die Tür schloss sich wieder, der Sopran verstummte.
Ein Moment der Stille. Das Haus fiel in einen Sekundenschlaf, als sei es müde von der Nacht.
Ein Schuss zerriss das Tuch der Harmonie. Sein Echo verfing sich in den kahlen Wänden, wurde dabei jedes Mal leiser, bis der Ton ganz verklungen war.
Der Tod hatte die Bühne verlassen und war ins Leben getreten.
2
Es sollte nur ein kleiner Abstecher werden.
Ancona– Würzburg– Ancona. Dafür nahm sich Kriminalhauptkommissar Johannes Kilian zwei Tage Urlaub von seinem Sabbatjahr, das er vor vier Wochen angetreten hatte. Es war nun das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass er seine dienstfreie Zeit unterbrechen musste. Das erste Mal hatte ihn eine Mordermittlung um einen enthaupteten Priester nach Rom geführt. Dort hatte er auch seinen Kollegen Heinlein das letzte Mal gesehen. Er, Heinleins Frau Claudia und Kilians Liebesaffäre, die Gerichtsmedizinerin Pia Rosenthal, hatten nach der Überführung der Mörderin noch ein paar Tage in der Ewigen Stadt verbracht. Die Zeit war für alle sehr schön gewesen, nur nicht für Pia. Sie hatte gehofft, dass Kilian sie nach Hause begleiten würde. Doch sie hatte sich geirrt. Kilian bestand auf seinem Sabbatjahr, seiner Beurlaubung vom Kriminaldienst in Würzburg und seiner Ungebundenheit im Privatbereich. Es gab so einiges, über das er sich im Klaren werden wollte. Dazu gehörten sowohl seine weitere berufliche Laufbahn als auch sein Privatleben. Er war nun Ende dreißig, heimat- und partnerlos, stetig auf Reisen und unterlag keinerlei Erwartungen, die er zu erfüllen hatte. Er fühlte sich im eigentlichen Sinne glücklich. Doch irgendetwas fehlte. Er spürte es deutlich.
Von der Welt und seinen Verpflichtungen abgeschieden, genoss er das Nichtstun in den bergigen italienischen Marken, auf dem Bauernhof eines Freundes. Jener hatte ihn Kilian zur Verfügung gestellt, solange er auf sein teuer renoviertes Refugium Acht gab. Es lag zwanzig Minuten vom Meer und einen Fußmarsch in das nächste Dorfcafé entfernt. Dankbar nahm Kilian das Angebot an. In der selbst erwählten Einsamkeit hatte er genügend Raum und Zeit, über seine weitere Zukunft nachzudenken.
Heinleins Anruf hatte ihn vor zwei Tagen erreicht, als endlich klar geworden war, dass Heinlein zum kommissarischen Leiter des K1, des Dezernats für Tötungsdelikte, bestellt worden war. Nach der Strafversetzung ihres gemeinsamen Erzfeindes, des Polizeidirektors Oberhammer, in die Niederungen des Bayerischen Waldes klaffte eine Lücke in der Befehlskette zwischen Leitung und ausführenden Kräften. Auf die Schnelle konnte nach dem verordneten Sparkurs der Staatskanzlei der Posten Oberhammers nicht neu besetzt werden. Daher mussten sich die einzelnen Kriminalabteilungen bis auf weiteres selbst organisieren.
Heinlein war somit erste Wahl, nachdem Kilian auf seinem Sabbatjahr bestanden hatte. Um nichts in der Welt hätte er es vorzeitig beenden wollen.
Kilian traf am Hauptbahnhof mit dem Zug aus München ein. Der Tag war satt in Sonne getaucht und versprach einen kurzweiligen Aufenthalt. Bereits am Bahnsteig fiel ihm die auffällige Beflaggung auf. Doch erst auf dem Bahnhofsvorplatz erkannte er an den Fahnen, Plakaten und Displays die Zahl 1300. Die Stadt feierte ihr dreizehnhundertjähriges Bestehen, nachdem das Castello Virteburch im Jahr 704 erstmals urkundlich erwähnt worden war.
Kilian ließ das Taxi stehen und machte sich zu Fuß auf den Weg ins K1.Im kleinen Rahmen sollte die Ernennung Heinleins stattfinden, seine Erhebung in den Adelsstand – die ganz und gar nicht klassische Karriere eines kleinen Eisenbahnerbuben von der Streifenpolizei zum Leiter eines Dezernates. Der Traum, wenn er ihn jemals zu träumen gewagt hatte, sollte an diesem Tag in Erfüllung gehen.
Kilian platzte mitten in der Ansprache des Polizeipräsidenten in sein ehemaliges Büro. Heinlein stand in Festtagsuniform an der Seite des Polizeipräsidenten, davor Sabine, die Sekretärin, drei Kollegen aus anderen Dezernaten und als Gäste Claudia und Pia.
«Lassen Sie sich nicht stören», sagte Kilian und mischte sich unter die Gäste.
«Da ist ja auch unser Urlauber», entgegnete der Polizeipräsident, «schön, dass wir Sie mal wieder zu Gesicht bekommen.»
Kilian steckte den Seitenhieb mit einem Lächeln weg. Es war ihm schnurz, welche Seitenhiebe der Polizeipräsident austeilen wollte. Er war jetzt ganz offiziell Privatier.
Heinlein zwinkerte Kilian zu, sichtlich erfreut. Ebenso Claudia und Sabine. Pia hingegen schien ihm zu grollen. Er hatte die letzten vier Wochen nichts von sich hören lassen. Ihr Blick streifte ihn kurz. Sie schien aber weiterhin konzentriert der Laudatio des obersten Polizisten der Stadt zu lauschen.
Der Polizeipräsident sprach von den Verdiensten, die sich Heinlein in den vergangenen Jahren erworben hatte, den nicht immer einfachen Einsätzen, dem Dienst an der Gesellschaft in diesen schwierigen Zeiten und spulte all das Zeug ab, das man bei Veranstaltungen dieser Art wohl zum Besten geben muss, wenn man sonst nichts zu sagen hat. Kilian hätte ein einfaches Dankeschön genügt, verbunden mit der Beförderung zum Dezernatsleiter und dem Wechsel in eine höhere Gehaltsklasse. Doch es schien heutzutage zur Aufgabe von Führungskräften zu gehören, einfache Entscheidungen mit allerlei Firlefanz auszuschmücken, wodurch der Eindruck entstehen sollte, als hätte man die Beförderung der Gunst des Vorgesetzten zu verdanken und nicht der eigenen Leistung.
Gottlob fand die Rede während der Dienstzeit statt, was den Polizeipräsidenten davon abhielt, in noch mehr Trivialitäten zu verfallen. Schließlich erhob er eines der bereitgestellten Sektgläser, die Sabine den Gästen anbot, und stieß mit Heinlein an.
Als die Reihe an Kilian war, nahm er sein Glas und wünschte Heinlein das, was er für den Job eines leitenden Kriminalbeamten als Wichtigstes erachtete. «Lass dich nicht reinreißen.»
Heinlein prostete ihm zu. «Danke, Jo. Ich weiß es zu schätzen, dass du heute gekommen bist.»
«An so einem Tag braucht man alle Unterstützung, die man bekommen kann.»
«Ich hoffe, du nimmst es mir nicht krumm, dass ich jetzt deinen Posten habe.»
«Du tust mir damit einen Gefallen, glaub mir. Ich…»
Weiter kam Kilian nicht, Unheil zog auf.
«Wie lange dürfen wir denn dieses Mal mit Ihrer Anwesenheit rechnen, Herr Kriminalhauptkommissar in Urlaub?», giftete Pia.
Bevor Kilian antworten konnte, griff Heinlein ein.
«Lass sein, Pia. Versau mir diesen Tag bitte nicht.»
«War doch nur ’ne einfache Frage», antwortete sie und gesellte sich zu Claudia, die dem Polizeipräsidenten nicht von der Seite wich. Es war auch ihr Tag, ihre Ernennung zur Dezernatsleiterin.
«Ich hätte dich vorwarnen sollen, Jo», sagte Heinlein. «Pia kann das alles nicht so leicht wegstecken. Drei Wochen geht das nun schon so. Sie ist unausstehlich.»
Wie hatte Kilian dieses Gezicke satt. Er wünschte sich postwendend in seinen Liegestuhl zurück, den Blick frei über das Tal und die Ruhe genießend, die einem nur die Zikaden in den Olivenbäumen schenken können.
«Ich werde mit ihr reden. Später», entschied er, «doch wie schaut der Rest des Programms aus?»
«Ich hab die Galerie im Stachel für heute Abend reserviert. Ein paar Freunde und die Familie kommen. Deine Sachen bringen wir zu mir. Keine Widerrede, du bist mein Gast.»
Kilian willigte ein, wenngleich er sich einen Aufenthaltsort mit etwas mehr Freiraum gewünscht hätte.
«Das ist nett, danke. Bringt mich Claudia?»
«Wenn’s für dich okay ist? Ich muss noch ’ne Runde bei den Kollegen schmeißen. Wir sehen uns dann später.»
Sein Bündel in der Hand, war Kilian bereit, mit Claudia die Fahrt anzutreten. Heinlein versuchte sie vom Polizeipräsidenten loszueisen. Es fiel ihm nicht leicht. Wann hatte sie schon mal die Gelegenheit, auf Augenhöhe mit einem der höchsten Beamten der Stadt zu sprechen.
Sabine, die Sekretärin, hatte damit mehr Erfolg. «Herr Polizeipräsident, Telefon. Die Oberbürgermeisterin wünscht Sie zu sprechen.»
Das Telefonat dauerte nicht lange, reichte aber aus, um ihm die Stimmung gründlich zu verderben. Er zitierte Heinlein in eine Ecke zum Vieraugengespräch und setzte ihn dort kurz in Kenntnis. Heinlein überlegte. Dann winkte er Kilian zu sich.
«Wir haben ein Problem, Jo», begann er. «Ein toter Regisseur im Mainfrankentheater.»
«Und?», fragte Kilian.
«Die Angelegenheit ist heikel», mischte sich der Polizeipräsident ein. «In zwei Wochen soll die Premiere stattfinden.»
«Dann kommt eben ein neuer Regisseur. Oder gehört Regiearbeit neuerdings zu den Aufgaben des K1?», frotzelte Kilian.
«Wir haben 1300-Jahr-Feier, wie du wahrscheinlich bemerkt hast», antwortete Heinlein. «Die Oberbürgermeisterin, die auch oberste Dienstherrin des Stadttheaters ist, legt großen Wert darauf, dass die Angelegenheit nicht nur diskret, sondern für alle Beteiligten störungsfrei bereinigt wird.»
Diese Forderung kam Kilian bekannt vor. Immer sollten Ermittlungen diskret und störungsfrei verlaufen. Nur nicht die heile Welt in Frage stellen, so, als seien alle von vornherein unschuldig. Bei dem Gedanken wurde ihm schon übel.
«Nun, Sie haben einen neuen Leiter des K1», sagte Kilian zum Polizeipräsidenten, «er wird die Angelegenheit, wie Sie sie nennen, zu Ihrer und zur Zufriedenheit der Oberbürgermeisterin bereinigen. Da bin ich mir sicher.»
«Wir hätten Sie aber gerne im Team», antwortete er.
Kilian glaubte seinen Ohren nicht zu trauen.
«Bevor du dich aufregst», schritt Heinlein ein, «es war mein Vorschlag.»
«Du willst, dass ich wieder in den Dienst trete?»
«Ich möchte dich bitten, dass du mich bei der Sache unterstützt, offiziell aber nicht als Kriminalbeamter auftrittst.»
Kilian rang um Worte. «Wie soll das denn vonstatten gehen? Schnüffeln ohne Lizenz? Vergiss es. Ich bin hergekommen, um mit dir zu feiern.»
«Bitte!»
Heinlein meinte es ernst. Seine Augen wiesen auf den Polizeipräsidenten, und Kilian spürte, dass es ihm wirklich wichtig war.
«Entschuldigen Sie bitte, ich möchte mit Herrn Heinlein kurz alleine sprechen.»
Kilian nahm ihn zur Seite. «Schorsch, du bist der neue Chef im Haus, nicht ich. Was soll das?»
Heinlein atmete tief durch, tankte Kraft, um ihn zu überzeugen. «Jo, das ist mein erster Fall als neuer Leiter des K1.Es ist 1300-Jahr-Feier. Ganz Bayern, was sag ich, ganz Deutschland und selbst das Ausland sind in diesen Tagen in Würzburg zu Gast. Ich darf mir keinen Fehler erlauben. Bitte hilf mir, nur das eine Mal.»
«Ich sehe keinen Sinn darin. Meine Mitarbeit würde dich eher schwächen, als dich in deiner neuen Position zu bestätigen.»
«Hör zu, Jo, ich muss in und mit dieser Stadt leben. Wenn die Oberbürgermeisterin persönlich hier anruft, dann weiß ich, was die Stunde geschlagen hat. Zu den Feierlichkeiten werden hohe Beamte, Politiker, Vertreter aus Wirtschaft und Kultur und wer weiß ich noch alles erwartet. Ein Ausrutscher und ich bin geliefert. Also, hilfst du mir jetzt oder lässt du mich im Regen stehen?»
Kilian schaute sich um. Als hätten alle ihr Gespräch mitgehört, erwarteten sie eine Entscheidung. Niemand rührte sich, kein Laut störte die Stille.
Doch in seinem Kopf herrschte Aufruhr. Sein Refugium in den Bergen der Marken, das kleine Dorfcafé und das nahe gelegene Meer forderten ihr Recht. Er wollte sie nicht enttäuschen. Aber da stand auch die Bitte eines Freundes im Raum. Es fiel ihm nicht leicht. Schließlich gab er sich einen Ruck.
«Nun gut», entschied er, «ich bin dabei.»
Heinlein triumphierte. «Ich hab’s gewusst. Auf dich kann man sich verlassen. Danke.»
Er gab dem Polizeipräsidenten Bescheid, und ehe Kilian sich versah, saß er im Auto.
«Ich werde dir das nicht vergessen», sagte Heinlein.
Auf der Rückbank saß Pia. Kilian glaubte, ihre Gedanken lesen zu können. Auch sie schien nicht zu vergessen.
3
Die Plakate schrien es förmlich von den Wänden.
Wenn Würzburg wüsste, was es alles weiß und Kluge Köpfe bleiben hier. Eine Stadt feierte sich selbst und den Ruf seiner großen Köpfe, wie Wilhelm Conrad Röntgen und Balthasar Neumann, deren Leistungen von Würzburg aus die Welt verändert hatten.
Während der Fahrt zum Mainfrankentheater bekam Kilian eine gute Vorstellung, wovon Heinlein gesprochen hatte. Allein die Hälfte aller Veranstaltungen, die auf den Plakatwänden um Besucher warb, hätte ausgereicht, um jede andere Stadt ein ganzes Jahr bei Laune zu halten. Da sollte es ein bombastisches Feuerwerk und eine Multivisionsshow über der Stadt geben, die die Wiedervereinigung in Berlin 1990 noch in den Schatten stellen sollte, das Barbarossa-Spectaculum auf der Festung Marienberg, zu dem mehr als 30000Zuschauer erwartet wurden, bis hin zum Open-Air-Konzert mit Carlos Santana vor der Residenz.
Und was hatte das städtische Theater beizutragen? An der Fassade des Baus reihte sich die Ankündigung einer Premiere an die nächste. Darunter die Oper über den in Würzburg tätigen Bildhauer Tilman Riemenschneider, die von dem ungarischen Komponisten Casimir von Pászthory 1942 fertig gestellt und 1959 mit der noch jungen Montserrat Caballé in Basel uraufgeführt worden war. Im Vorfeld hatte die Süddeutsche Zeitung ungewollt Promotion betrieben, indem sie dem Komponisten nationalsozialistische Attitüden vorwarf. Weitere Medien griffen den Skandal, wie sie es nannten, auf und lenkten dadurch noch mehr Aufmerksamkeit auf die Stadt.
Dagegen wirkte die Inszenierung des Don Giovanni, unter der Regie von Fred Sandner und der musikalischen Leitung des Generalmusikdirektors und Shootingstars Beat Stiller, auf den Plakatwänden eher verloren.
Was sich schon bald grundlegend ändern sollte.
Der Pförtner am Bühneneingang wies ihnen den Weg in den zweiten Stock. Die Kollegen vom Erkennungsdienst seien bereits am Tatort, und der Pförtner würde den Intendanten über ihre Ankunft benachrichtigen.
Sie nahmen den Weg über das Treppenhaus nach oben. Als sie die schwere Feuerschutztür öffneten, stießen sie auf eine Gruppe Schauspieler, die sich über den Todesfall unterhielt. Sie verstummten augenblicklich, als sie in ihnen Polizeibeamte erkannten. Ihre Augen verfolgten sie misstrauisch die Treppe hinauf.
Heinlein beugte sich über den Handlauf und musterte das Treppenhaus: ein tiefer Schacht, der von oben durch einfallendes Sonnenlicht erleuchtet wurde und sich über fünf Stockwerke erstreckte.
«Von außen betrachtet hat man gar nicht den Eindruck, dass das hier so groß ist. Da geht es mindestens zwanzig Meter hoch und nochmal zehn in die Tiefe», stellte Heinlein fest.
«Der Kasten wurde in der Nachkriegszeit, 1966, wenn ich mich richtig erinnere, an der Stelle des alten Bahnhofs erbaut», kommentierte Pia. «Wenn die damals geahnt hätten, dass es mit der Stadt eines Tages so bergab geht, hätten sie bestimmt mehr gespart.»
«Wie schlimm steht es?», fragte Kilian.
«Man sagt, dass das Theater mit den drei Sparten Orchester, Schauspiel und Tanz so nicht länger existieren kann», antwortete Heinlein. «Die Stadt ist pleite. Wie viele andere auch. Die Kunst trifft es dann zuerst.»
«Und das bedeutet?», hakte Kilian nach.
«Die Gerüchte reichen von Entlassungen bis zur vollständigen Schließung des eigenen Theaterbetriebes», antwortete Pia. «Und das im zweihundertsten Jahr seines Bestehens.»
«Gibt es denn auch einen fremden Theaterbetrieb?», wollte Kilian wissen.
«Ja, sozusagen ein bespieltes Haus», erklärte Heinlein. «Dabei würde das Theater nur als Räumlichkeit zur Verfügung gestellt, und die Produktionen kämen auf ihrer Tournee eben auch hier vorbei.»
«Ihr wisst ja gut Bescheid», sagte Kilian.
«Wenn du dich öfters hier blicken lassen würdest…»
Heinlein schritt ein. «Pia, hör auf. Ich kann’s nicht mehr hören.»
Als sie in den zweiten Stock traten, hörten sie eine Frau schluchzen. Sie kauerte am Boden und wurde von zwei Männern getröstet. Einer von ihnen erblickte die Kriminalbeamten. Eilig kam er ihnen entgegen.
«Sind Sie die Herren von der Kriminalpolizei?»
Heinlein nickte. «Wo finden wir den Toten?»
Der Mann zeigte auf einen Raum weiter hinten, von dem Licht in den Gang fiel.
«Wer ist die Frau?», fragte Kilian.
«Das ist Kayleen, die Donna Anna», antwortete er. «Sie war die Lebensgefährtin von Freddie, ich meine von Herrn Sandner, dem Regisseur.»
«Braucht sie ärztliche Hilfe?», fragte Heinlein.
Der Mann winkte ab. «Wir kümmern uns um sie, danke.»
«Und wer sind Sie?», fragte Heinlein.
«Sebastian Ludewig, der Dramaturg. Ich bin für den Don Giovanni zuständig.»
«Versammeln Sie bitte alle, die mit dem Opfer vor und zur Tatzeit zu tun hatten, in einem Raum. Wir müssen noch ein paar Fragen stellen. Zuvor möchten wir aber den Tatort sehen.»
Ludewig nickte und führte sie an der Frau vorbei. Sie blickte kurz auf, als sie sie bemerkte. Ihre Augen spiegelten tief empfundenen Schmerz.
Der Raum, in dem sie den Toten fanden, war sein Büro. Der Mann saß noch im Stuhl, sein Oberkörper war nach links vorne weggeknickt, Kopf und Schulter wurden von der Tischkante gehalten. Aus der Nase war Blut auf den Tisch gelaufen. An der rechten Schläfe zeigte sich ein schwarz verbranntes Einschussloch. Ein dünnes Rinnsal von Blut hatte sich an der Wange entlang seinen Weg nach unten gebahnt. Blutspritzer zogen sich über die dahinter liegende Wand.
Blut, dachte Kilian, wie lange hatte er es schon nicht mehr gesehen, gerochen? Hatten ihn die paar Tage in den Marken vom elementarsten Begleitumstand seiner Arbeit abbringen können? Ja, sagte er sich, Blutspritzer und tote Menschen spielten keine Rolle mehr in seinem neuen Leben. Er empfand diese Einsicht als belebend, nahezu euphorisierend. Doch jetzt war es wieder da. An der Wand, auf dem Tisch und auf dem Boden. Widerwillig nahm er es zur Kenntnis.
«Hallo, Schorsch», sagte einer der Beamten vom Erkennungsdienst, im Polizeijargon EDler genannt. Noch bevor er Kilians unerwartete Anwesenheit für einen Spruch nutzte, kam Heinlein ihm zuvor und verwies ihn mit einem strengen Blick in die Schranken.
«Darf man dann wenigstens gratulieren?», fragte er Heinlein.
«Danke», antwortete Heinlein knapp, «’ne Runde für euch gibt’s später. Also, was haben wir hier?»
Pia schlüpfte derweil in den weißen Overall mit Kapuze, befestigte Überzieher an den Füßen und zog sich Latex-Handschuhe über. «Hat schon ein Arzt die Leiche gesehen?», fragte sie.
Einer der EDler blickte zu Ludewig, der verneinte, man habe sofort die Polizei gerufen.
«Kann ich dann ran?», fragte sie die EDler, die die Leiche und den Tatort vor Eintreffen der Gerichtsmedizinerin fotografiert und ausgemessen hatten.
«Die Leiche ist so weit fertig», antwortete einer, «lass nur die Finger von den Spuren an der Wand.»
Während Pia sich über den Toten beugte und das Einschussloch begutachtete, gab der Beamte preis, was er bisher in Erfahrung bringen konnte.
«Der Tote heißt Fred Sandner, freier Regisseur, der für die Inszenierung des Don Giovanni engagiert worden ist. Alter laut Personalausweis dreiundsechzig Jahre, Wohnsitz Frankfurt am Main. Er soll sich seit rund vier Wochen in Würzburg aufhalten. Er wohnte im Hotel, sagt der Dramaturg Ludewig.
Die Tür war bei unserem Eintreffen zwar offen, aber zuvor verschlossen gewesen, wie uns Ludewig weiter berichtete. Ein lauter Knall habe jemand auf dem Stockwerk alarmiert. Er sei dann an die Tür gekommen und habe mehrmals Sandner aufgefordert zu öffnen. Als keine Reaktion kam, ging er zum Intendanten, der den Hausmeister zu Hilfe rief.»
«Wurde etwas verändert oder berührt?», fragte Heinlein.
«Nach Aussage des Hausmeisters nicht», antwortete der Beamte. «Die Auffindesituation war eindeutig.»
Kilian schaute sich unterdessen im Raum um. Das Fenster war fest verschlossen, keine Anzeichen, dass sich jemand daran zu schaffen gemacht hatte. Stricke oder Seile, mit denen man von außen hätte einsteigen und das Zimmer auch wieder hätte verlassen können, waren keine zu finden. Auf der belebten Ludwigstraße wäre dies ohnehin von Passanten und Anwohnern bemerkt worden, also eher unwahrscheinlich. Eine zweite Tür zu einem anliegenden Büro gab es nicht.
Die Wand seitlich des Opfers war aussagekräftiger. Hier hingen zahlreiche Fotos und Presseberichte, eingerahmt und offensichtlich planlos und hastig an die Wand geheftet. Sie berichteten von den glorreichen Zeiten des Regisseurs, die alle mehr als fünf Jahre zurücklagen. Relikte schnell verblassenden Ruhms.
Kilian ging in die Hocke und suchte nach Hinweisen unter dem Tisch. Die Beine des Opfers standen schulterbreit auf dem Boden. Kein Anzeichen der Verkrampfung oder eines Kampfes unmittelbar vor dem Todeseintritt. An seinem rechten Fuß lag die Waffe. Eine kurzläufige .38er Smith & Wesson, brauner geriffelter Griff, Spuren der Abnutzung. Um sicherzugehen, schaute Kilian sich die Hand des Opfers an, die die Waffe gehalten und abgefeuert haben musste. Die linke Seite des Zeigefingers und die Daumenwurzel zeigten deutlich die schwarzgrauen Schmauchspuren, verbrannte Reste der Treibladung. Die Sache schien eindeutig.
«Entschuldige», sagte ein EDler zu Kilian.
Er kniete sich neben ihm nieder, nahm die .38er vorsichtig auf und sicherte mittels mehrerer Klebestreifen etwaige Spuren, wie Fingerabdrücke oder Schmutzpartikel, auf der Waffe. Danach legte er sie an den Platz zurück.
Pia wies Heinlein auf die Einschusswunde an der rechten Schläfe hin, die sich im Haaransatz nahe am Ohr befand.
Ein brauner Ring mit einer kleinen Ausziehung umgab das runde Einschussloch – die Stanzmarke, die die Laufmündung der .38er perfekt abbildete.
«Der Schuss war aufgesetzt», begann Pia und imitierte mit ausgestrecktem Zeigefinger und Daumen die Schusshand und die vermutete Schusshaltung.
«Wenn aufgesetzt, dann müsste doch die Wunde sternförmig aufgeplatzt sein?», fragte Kilian.
Der Blick Pias hätte Kilian zum zweiten Opfer des Tages machen können. «Normal schon, Sherlock, aber in diesem Fall liegt der Schläfenmuskel unter dem Einschuss.»
Kilian verkniff sich jede weitere Belehrung. Mit Pia war heute nicht zu scherzen.
Pia nahm den Schädel des Opfers in die linke Hand, mit der rechten illustrierte sie ihre Ausführungen. «Also noch einmal. Der Schuss war aufgesetzt, ihr seht den vom Projektil stammenden Abstreifring und das nicht mehr adaptierbare Einschussloch. Der Durchmesser ist auf den ersten Blick gleich dem Kaliber, bei der .38er folglich so um die 9,5Millimeter.
Aus der Nase ist Blut ausgetreten. Ich nehme an, es kam aus den vorderen Schädelgruben und ist über das Siebbein, das ist der Knochen hinter der Nasenwurzel, in die Nasengänge eingesickert.
Die Lage der Leiche ist nach dem Schuss nicht verändert worden. Die Blutablaufspur, an der Wunde entlang der Wange nach unten, lässt darauf schließen.»
Sie kippte den Schädel von der linken in die rechte Hand und fuhr fort: «Das Projektil, ich tippe auf ein Vollmantelgeschoss, ist oberhalb des linken Ohres ausgetreten. Der Ausschuss ist unauffällig, wie ihr seht. Die Platzwunde ist mehrstrahlig und adaptierbar. Einschusszeichen fehlen. Auf dem Tisch, dort, wo der Schädel lag, seht ihr eine handtellergroße Blutlache. Auch das ist normal.
Mein erstes Urteil lautet: Suizid, ein aufgesetzter Schuss mit der .38er, die am Boden liegt. Dritte Hand, sprich Fremdverschulden, ist wenig wahrscheinlich. Alles Weitere… ihr wisst schon.»
«Todeszeitpunkt?», fragte Heinlein.
«Mach ich gleich. Zuvor müssen wir das Projektil finden.»
Pia schaute über die Schulter zurück, suchte den Verlauf des Geschosses nachzuzeichnen. Heinlein tat es ihr gleich. Zwischen gebrauchten Aktenordnern, einer dahinvegetierenden Topfpflanze und der grellen Nachbildung einer goldenen Oscar-Statue suchten sie die Wand seitlich des Opfers ab. Es dauerte nicht lange, dann hatte Heinlein gefunden, wonach sie suchten.
Das Projektil ragte zwei Millimeter heraus und landete mit einem leichten Ruck auf der gummigeschützten Hand. Das Geschoss war an der Spitze breit gestaucht, einem Pilz gleich.
«Ins Labor damit», beauftragte er einen EDler, «und die Schussbahn aufzeichnen nicht vergessen. Seid ihr mit der Waffe fertig?»
Ein EDler nickte. Heinlein nahm die .38er in die Hand, roch daran und kippte die Trommel heraus. Nur ein Hütchen zeigte die Einkerbung des Schlagbolzens.
«Sucht dennoch den ganzen Raum ab, damit wir sichergehen, dass nur einmal geschossen wurde.»
Er reichte dem EDler die Waffe und fragte: «Ist ein Abschiedsbrief vorhanden?»
«Nein, wir konnten nichts finden.»
Pia verpackte währenddessen die beiden Hände des Opfers in Plastiktüten, um die Schmauchspuren nicht zu verwischen. «Kannst du mir mal helfen?», fragte sie Kilian.
«Wobei?»
«Hast du denn in den vier Wochen alles vergessen, was du mal über die Tatortaufnahme gelernt hast?»
Es dauerte eine Sekunde, bis Kilian begriffen hatte. Widerwillig half er ihr, den Leichnam vom Stuhl auf den Boden zu legen.
«Ausziehen kannst du ihn aber alleine», sagte Kilian.
«Ein wahrer Gentleman, danke.»
Pia machte sich daran, den Leichnam zu entkleiden. Totenflecke, Totenstarre und mögliche weitere Verletzungen am Leichnam mussten überprüft werden.
Nachdem der Mann nackt vor ihr lag, griff sie mit einer Hand unter dessen Oberschenkel, mit der anderen umfasste sie das Fußgelenk. Dann beugte sie das Bein im Kniegelenk. Es gelang ihr ohne Widerstand; die Leichenstarre war noch nicht eingetreten. Ein erster Hinweis, dass der Eintritt des Todes noch keine zwei Stunden her war. Grauviolette Totenflecke erstreckten sich über die Oberschenkel, den Bauch, das Gesäß, die Rückseiten der Oberschenkel bis hinunter zu den Füßen. Die Totenflecke waren leicht mit dem Finger wegdrückbar. Ein weiteres Zeichen, dass der Tod in den letzten zwei Stunden eingetreten war. Um ganz sicherzugehen, überprüfte sie die Körpertemperatur. Mit einem Skalpell machte sie einen etwa zwei Zentimeter langen Schnitt im linken Unterbauch. Mit der einen Hand zog sie die Wunde auseinander und führte mit der anderen das elektronische Thermometer ein. Das Display zeigte 36,7Grad Celsius. In der ersten Stunde post mortem verliert der Körper keine Temperatur, also wies auch diese Anzeige auf einen Todeszeitpunkt hin, der maximal innerhalb der letzten zwei Stunden gelegen hatte, wegen der unveränderten Körpertemperatur würde sie sich sogar auf eine Stunde festlegen lassen.
«Mit wem hatte der Tote zuletzt Kontakt?», fragte Kilian einen EDler.
«Keine Ahnung», erwiderte der, «aber der Ludewig könnte es wissen.»
Heinlein ging auf den Gang hinaus und rief Ludewig zu sich, der die trauernde Frau zwei Sanitätern übergab. «Wissen Sie, mit wem der Tote zuletzt gesprochen hat?», fragte Heinlein.
Ludewig musste nicht lange überlegen, vermied jedoch eine überhastete Antwort. «Meiner Kenntnis nach kam er aus dem Büro des Intendanten.»
«Woher wissen Sie das?», fragte Kilian.
Wieder ließ er sich mit der Antwort Zeit. Seine Augen suchten nach einer passenden Formulierung – mit Erfolg. «Er war fällig. Es war nur eine Frage der Zeit, wann der Intendant einschreiten würde.»
«Wie meinen Sie das?», fragte Heinlein.
Ludewig bat sie auf den Gang hinaus. «Wissen Sie, das Haus hatte weit höhere Erwartungen in die Arbeit des Herrn Sandner gesetzt, als er letztlich fähig war zu erfüllen.»
«Wie sahen diese Erwartungen aus?», fragte Kilian.
«Den Don Giovanni zum Erfolg zu führen», antwortete er, «es gibt keine anderen Erwartungen. Nur der Erfolg zählt.»
Heinlein stutzte. «Und Sie zweifelten daran, dass es Sandner gelingen würde?»
Ludewig hob seine Hände, offen, frei von Schuld. «Meine Meinung zählt nicht. Ich bin nur der Dramaturg. Es war und ist immer die Entscheidung des Intendanten.»
«Dann sollten wir mal mit dem Herrn sprechen», sagte Kilian zu Heinlein. «Was meinst du?»
Heinlein nickte. «Wo können wir ihn finden?»
Ludewig zeigte den Gang entlang, die vorletzte Tür links. Bevor sie sich auf den Weg machten, erinnerte Heinlein ihn daran, die an der Probe Beteiligten zu versammeln. Am besten dort, wo die Probe stattgefunden hatte. Ludewig willigte ein und machte sich davon.
Heinlein hielt inne und fragte Kilian: «Was hältst du davon?»
«Es deutet alles auf Selbstmord hin», antwortete er. «Ich sehe keine Anzeichen für ein Fremdeinwirken. Du etwa?»
Heinlein war noch nicht ganz überzeugt. «Die verschlossene Tür und das Fenster, die Schmauchspuren an Schläfe und Finger… ja, das alles spricht für Selbstmord. Aber, was war der Grund dafür? Bringt man sich gleich um, wenn einem das Vertrauen entzogen wird? Dann müsste ich die Leben einer Katze haben.»
«Schorsch, das sind Künstler. Da gibt es nur top oder hopp, sagt man.»
Pia kam hinzu, zog sich die Gummihandschuhe von den Händen. «Ich bin so weit fertig. Den Todeszeitpunkt würde ich synchron zum Schussgeräusch festlegen, so wie es gemeldet worden ist. Auf keinen Fall aber länger als zwei Stunden vor meiner Untersuchung. Die Leiche kann jetzt abtransportiert werden. Oder braucht ihr sie noch?»
Heinlein verneinte. «Wann nimmst du ihn unters Messer?»
Pia schaute Kilian in die Augen. «Zuvor habe ich noch was Wichtiges zu erledigen. Wenn du das Ergebnis nicht heute Abend brauchst, dann mach ich es morgen Vormittag.»
Heinlein erinnerte sich seiner geplanten Feier und ließ Kilian im Stich. «Klar, morgen reicht.»
Kilian hätte ihn erwürgen können. Pia drückte sich an ihm vorbei und murmelte etwas, das wie «Wir sprechen uns später» klang. Er schaute ihr nach im Wissen, dass sein geplanter kleiner Abstecher in diese Stadt noch manche Unannehmlichkeit für ihn bereithielt.
«Danke, Freund», beklagte sich Kilian bei Heinlein.
Der machte ein Gesicht, das unschuldiger nicht hätte sein können. «Gern geschehen.»
Eine Tür, weit hinten am Gang, wurde aufgestoßen. Ein kleiner, dicker Mann trat heraus.
4
Der Intendant war ein untersetzter, glatzköpfiger Mann mit ergrautem Schnäuzer und Lesebrille auf der Nase. Sein Gesicht war rund, fast schon hausbacken unauffällig, doch seine Augen sprühten vor Aktionswillen. Trotz seiner knapp ein Meter siebzig war er flink im Treppenhaus unterwegs. Er erreichte das Erdgeschoss eine halbe Treppe vor Kilian und Heinlein.
«Herr Intendant», rief Heinlein, «einen Moment, bitte.»
Der Mann drehte sich um. «Ja, Sie wünschen?»
«Mein Name ist Heinlein, Kriminalhauptkommissar, und das ist mein Kollege Kilian. Wir sind mit der Aufklärung des Todes von Herrn Fred Sandner betraut und möchten Ihnen ein paar Fragen stellen.»
«Ich habe Sie schon erwartet», antwortete er und winkte sie heran, ihm zu folgen. Sie traten in den Gang hinaus. «Im Moment ist es etwas ungünstig. Wenn es Sie nicht stört, beantworte ich Ihre Fragen, während ich meiner Arbeit nachgehe. Einverstanden?»
«Gerne.»
Kilian war gespannt, was es mit ihm und seiner Arbeit auf sich hatte. Wer wusste schon so genau, was ein Intendant an einem Theater zu tun hat.
«Herr Sandner hat kurz vor seinem Ableben noch mit Ihnen gesprochen. Trifft das zu, Herr…», fragte Heinlein.
Der Intendant machte Halt, reichte ihnen die Hand. «Entschuldigung, dass ich mich nicht gleich vorgestellt habe. Mein Name ist Max Reichenberg. Um Ihre Frage zu beantworten: Ja, Freddie war kurz vorher in meinem Büro.»
Er ging weiter, sie folgten.
«Worum ging es dabei?», rief Kilian ihm mehr nach, als dass er ihn fragte.
Reichenberg blickte zur Seite, so, als verfiele er geistesabwesend in Trauer. «Es gehört zu meinen eher wenig schönen Pflichten, ein Machtwort zu sprechen, wenn ich sehe, dass sich etwas in die falsche Richtung entwickelt. Bei Freddie war es so weit. Ich musste einschreiten, bevor noch mehr Zeit verstrich. Ich habe ihn gefeuert.»
«Warum?»
Reichenberg, am Ziel seines Weges angekommen, dem Künstlerischen Betriebsbüro, kurz KBB, blieb in der Tür stehen und drehte sich um. «Er war auf dem besten Weg, eine Produktion in den Sand zu setzen.»
«Wie können Sie das wissen?»
«Das ist mein Job, es zu wissen, besser, es vorauszuahnen.»
«War er so schlecht?»
«Nein, überhaupt nicht. Er war, künstlerisch gesehen, eine Koryphäe. Das Theater hat ihm viel zu verdanken. Er hatte nur einen Nachteil.»
«Und der war?»
«Er konnte die Zügel nicht straff halten. Stellen Sie sich vor, die Premiere ist in zwei Wochen, und der Don Giovanni kennt noch immer nicht seine Laufwege, verliert andauernd den Degen und weiß immer noch nichts mit den Frauen anzustellen. Unvorstellbar, der Don Giovanni hampelt auf der Bühne herum, als wäre er in der Augsburger Puppenkiste. Ich hätte mich nicht darauf einlassen sollen.»
«Worauf?»
«Freddie unter Vertrag zu nehmen, natürlich. Ich war gewarnt. Seine letzten Engagements hatte er alle frühzeitig beendet.»
«Und wieso haben Sie es dennoch gemacht?»
Reichenberg nahm die Brille ab, strich sich mit dem Handrücken über die Stirn. «Er tat mir Leid. Die Donna Anna… Kayleen hat sich sehr für ihn eingesetzt. Sie hat damit gedroht, wenn er nicht die Regie bekäme, würde sie als Donna Anna ausfallen. Und Gott weiß, wie schwer es ist, ihren Part zu besetzen. Nicht, dass es zu wenig Anwärterinnen dafür gäbe, aber es muss die richtige sein.
Es war Freddies letzte Gelegenheit, wieder ein Bein auf den Boden zu bekommen. Wer es als Regisseur mit sechzig Jahren nicht geschafft hat, ist weg vom Fenster. Die Jungen drängen nach. Also gab ich ihm noch ’ne Chance.»
Kilian erinnerte sich an die Presseberichte und Fotos, die er im Zimmer gesehen hatte. «Und seine Erfolge, die er sich erworben hatte? Zählen die nicht?»
Reichenberg schaute Kilian überrascht an, ein Lächeln huschte über seine Lippen. «Erfolg, ja, den hatte er. Doch der Erfolg ist flüchtig. Du fängst immer von neuem an, bei jeder Produktion, ganz von Anfang, als sei vorher nichts gewesen.»
Er ließ diese Worte stehen, gab ihnen Raum zur Entfaltung, zur Bedeutung. Kilian hielt ihn für einen passablen Schauspieler.
«In welcher Verfassung war Sandner, als er Ihr Büro verließ?», fragte Kilian.
Reichenberg dachte einen Moment nach. «Äußerlich gefasst. Er besaß Contenance, verstehen Sie? Er hätte niemals seine Emotionen vor anderen gezeigt, dafür war er viel zu… feinfühlig oder, besser, zu gut erzogen. Wie es jedoch in ihm drin ausgeschaut hat, tja, wer weiß das schon.
Wenn sonst nichts mehr ist…»
Heinlein verneinte, doch Kilian wollte noch etwas wissen.
«Sind Sie vom Selbstmord des Herrn Sandner überzeugt?», fragte er Reichenberg.
Jener war irritiert. «Natürlich, was denn sonst?!»
«Ich wollte es nur wissen», sagte Kilian und wandte sich Heinlein zu.
Reichenberg nutzte die Chance und ging.
Sie blickten diesem kleinen Mann nach, wie er zu den beiden Mitarbeitern schritt, als gelte es, die Last der ganzen Welt zu tragen. Nun, für die Welt, in der sie sich befanden, war es wahrscheinlich auch so.
Bevor Heinlein und Kilian sich auf den Weg zu den Sängern machten, hörten sie aus dem KBB, wie so manche Hoffnung wie eine Seifenblase platzte.
«Franzen ist in Salzburg gebunden, Hoffmann in Berlin, Fürstenberg in London. Die anderen von der Liste brauchen wir erst gar nicht zu kontaktieren. Die haben mit ihren Stücken selbst in ein paar Wochen Premiere.»
«Dann ist es vorbei. Wir müssen die Premiere absagen.»
«Es gibt noch eine allerletzte Möglichkeit.»
«Die wäre?»
«Zuerst konnte ich es gar nicht glauben…»
«Reden Sie schon.»
«Vorhin kam ein Fax herein. Ohne Absender. Und da steht dieser Name drauf.»
«Das gibt’s doch nicht!»
«…und ich habe schon Kontakt aufgenommen.»
«Weiter…»
«Wir sollen noch heute Bescheid bekommen.»
«Ich darf gar nicht daran denken. Das wäre der absolute Knaller… wir wären gerettet.»
Kilian und Heinlein betraten den Großen Saal durch die beiden Stahltüren, vorbei am Inspizientenpult, und standen unversehens auf der Bühne. Vor einer großen Treppe strahlten zwei Scheinwerfer von oben herab auf die Bühnenbauten. Vier unterschiedlich hohe Mauern, schwarz lackiert und im Viereck zueinander arrangiert, damit man zwischen ihnen hindurch die Bühne betreten und verlassen konnte. Davor, im Orchestergraben, der im Zwielicht lag, saßen die Sänger, zeitunglesend, telefonierend, gelangweilt. Einer hantierte mit einem Degen, kämpfte gegen seinen Schatten.
Eine Frau bemerkte sie, kam auf sie zu. «Sind Sie die Herren von der Kriminalpolizei?»
Heinlein nickte.
«Kommen Sie bitte», bat sie sie in den Orchestergraben, «die Drehbühne muss frei bleiben. Da kann leicht was passieren. Die Versicherung zahlt dann nicht.»
Sie folgten ihren Anweisungen, gingen bis zu einer Rampe, von der Stufen zum Orchestergraben führten.
«Bitte gehen Sie weiter», insistierte sie. «Sie stehen genau unter dem eisernen Vorhang.»
Kilian merkte, wie in Heinlein der Unmut wuchs. Er mochte es nicht, wenn er herumkommandiert wurde. «Was für ein Vorhang?», fragte er. «Ich sehe nichts.»
Die Frau deutete nach oben, wo in zehn Meter Höhe eine dicke Abtrennung, einer eisernen Wand gleich, über ihren Köpfen hing.
«Nehmen Sie es Jeanne nicht übel», sagte Ludewig, der plötzlich aus dem Orchestergraben auftauchte, «es ist ihr Job als Inspizientin, dass die Vorschriften auf der Bühne eingehalten werden.»
«Was ist der eiserne Vorhang?», fragte Kilian.
«Das ist eine Schutzwand, die ziemlich schnell herunterfährt, wenn auf der Bühne ein Feuer ausbricht und auf den Zuschauerraum überzugreifen droht. Man kann aber nie wissen, ob sich der eiserne mal selbständig macht. Dann ist es besser, wenn man nicht darunter steht. Das Ding wiegt einige Tonnen.»
Das überzeugte Heinlein und Kilian, und sie stiegen die Stufen in den Orchestergraben hinunter, der auf mittlerer Höhe angebracht war. Von hier aus konnte man leicht die Bühne und den Zuschauerraum betreten.
«Hört mal bitte alle her!», rief Ludewig seinen Kollegen zu. «Die Herren sind von der Kriminalpolizei. Sie untersuchen den Tod von Freddie und haben ein paar Fragen an uns.»
Heinlein bedankte sich, machte einen Schritt nach vorn. Kilian hielt sich im Hintergrund, setzte sich und beobachtete.
«Ich möchte Ihnen mein Beileid aussprechen», begann Heinlein, «es muss ein großer Verlust für Sie sein, so kurz vor der Premiere den Regisseur zu verlieren.»
Die Häupter der Umstehenden neigten sich, verfielen stumm und unbeweglich in einen Moment der Trauer.
Heinlein fuhr fort: «Wie Sie vermutlich wissen, ist Herr Sandner vor gut einer Stunde in seinem Büro zu Tode gekommen. Hat jemand von Ihnen etwas gehört oder gesehen, was uns bei der Aufklärung hilfreich sein könnte?»
Kilian war gespannt, wer antworten würde, wer der Meinungsführer unter ihnen war. Eine Frau, Mitte zwanzig, blond, geblümtes Kleid, an einem Klavier. Sie saß auf ihren Handrücken, wippte vor und zurück, wie auf einer Schaukel. Daneben ein Mann, an der Absperrung zum Zuschauerraum gelehnt, die Arme verschränkt, abwartend. Seine Finger klimperten nervös eine Melodie auf seinem Unterarm. An einem Tisch saß wieder eine Frau, vor ihr ein dickes Buch aufgeschlagen, mit Noten und handschriftlichen Aufzeichnungen versehen. Demonstrativ fixierte sie einen Punkt auf der Bühne, zeigte, dass sie sich nicht angesprochen fühlte. Die Nächste war eine junge Frau Ende zwanzig, knallrotes Haar, keine Naturfarbe, sondern ein grell eingefärbter Pumucklschopf, Latzhose und Turnschuhe, saß auf dem Tisch, ließ die Beine baumeln. Ihr Blick war wach, wartete darauf, angesprochen zu werden. Ganz hinten am Ende des Orchestergrabens standen drei Männer zusammen, eine verschworene Gruppe. Der eine war der Degenkämpfer, der andere ein Schrank von einem Mann und der dritte ein älterer mit grauen Haaren.
Ebenjener antwortete. «Wir werden Ihnen kaum weiterhelfen können. Zur fraglichen Zeit waren wir alle in unseren Zimmern, um uns auf die nächste Szene vorzubereiten. Die Solisten zumindest. Wo die Techniker waren, weiß ich nicht. Wahrscheinlich in der Kantine, einen heben.»
«Halt mal die Luft an!», schallte es aus den Zuschauerreihen, ganz hinten. Kilian musste die Augen gegen das Scheinwerferlicht schützen, um zu erkennen, dass in den hinteren Reihen, im Dunkel des Zuschauerraums, noch jemand saß. Es waren zwei Männer, die sich in die Sitze gelümmelt hatten.
«Michail, du bist der Letzte, der uns Alkohol während der Arbeitszeit vorzuwerfen braucht. Du nicht!»
Ludewig trat schlichtend dazwischen. «Das ist nicht die Frage. Der Kommissar will wissen, wo ihr wart.»
Jeanne, die Inspizientin, antwortete: «Wir waren in der Kantine, Hubert, der Beleuchter, und Stefan an der Drehbühne. Gemeinsam, die ganze Zeit, bis die Pause vorüber war. Da können Sie das Kantinenpersonal fragen.»
«Künstlerpack!», kam es laut und verächtlich aus dem hinteren Zuschauerraum.
Heinlein ließ sich durch dieses Intermezzo nicht vom Kurs abbringen.
«Wer sind Sie?», fragte er den Grauhaarigen.
«Michail Lermonow, ich spiele den Komtur.»
«Und die beiden anderen Herren?»
Schüchtern trat der Große einen Schritt vor, nickte beflissen. «Roman Galczynski, der Leporello.»
Auf den Degen gestützt, antwortete der Dritte. Ein hagerer Typ in blauer Stoffhose, weißem Hemd und mit ergrauten Haaren. Man hätte ihn eher hinter einem Bankschalter vermutet als auf einer Bühne. «Vladimir Sinowjew, ich singe Don Giovanni.»
«Sie waren alle drei auf Ihren Zimmern, zur fraglichen Zeit?», hakte Heinlein nach.
Bis auf Vladimir, der die Frage nicht zu verstehen schien, nickten die beiden anderen.
«Haben Sie Zeugen dafür?», fragte Heinlein.
Zwei schüttelten verneinend den Kopf, der Dritte fragte Michail, den älteren der beiden Russen, worum es ging. Michail antwortete für ihn. «Vladimir war auch auf seinem Zimmer. Er hat die Degenszene geübt, sagt er. Einen Zeugen hat er dafür nicht.»
Heinlein wandte sich den anderen zu. «Wenn wir schon dabei sind, können bitte auch Sie sich jeweils vorstellen und sagen, wo Sie sich während der Pause aufgehalten haben?»
Die mit der Latzhose und dem Rotschopf antwortete als Erste. «Franziska Bartholomä, ich bin die Souffleuse. Ich saß draußen vor dem Theater auf einer Bank und habe Tee getrunken.»
«Alleine?», fragte Heinlein.
«Ein paar Passanten warteten auf den Bus. Ich weiß nicht, ob die mich wahrgenommen haben.»
«Gut, die Nächste, bitte», sagte Heinlein und nickte der Frau zu, die sich demonstrativ für die Befragung nicht zu interessieren schien. Doch jetzt, als sie direkt angesprochen wurde, antwortete sie in unerwartet strengem Ton.