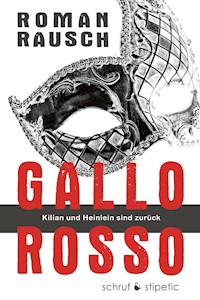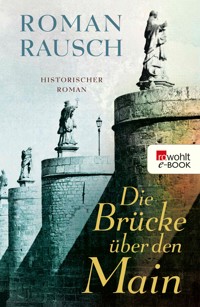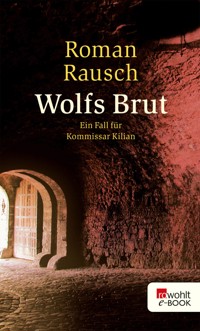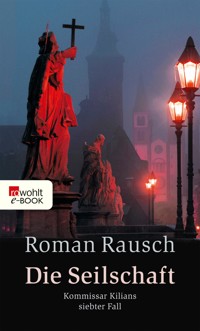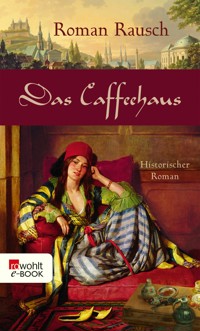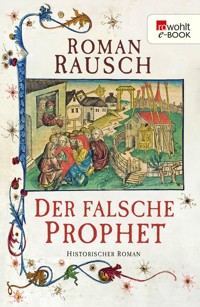6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Kilian ermittelt
- Sprache: Deutsch
Die Botin deines Todes Betrunkene Jugendliche kippen im Würzburger Umland nachts einen Bildstock – und entdecken darunter eine stark verweste Leiche. Im Davonlaufen glauben sie eine hellstrahlende Frauenfigur in der Dunkelheit zu erkennen. Als die Kommissare Kilian und Heinlein die Ermittlungen aufnehmen, stoßen sie auf eine Mauer des Schweigens. Die Dorfgemeinschaft beschäftigt offenbar nur eines: das Erscheinen der «Weißen Frau», die im Volksglauben als Vorbotin des Todes gefürchtet wird. Wer ihr begegnet, stirbt! «Ein neuer ‹Tatort› oder gar ein ‹Schimanski›? Kilian braucht den Vergleich nicht zu scheuen.» (Bayerischer Rundfunk)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Roman Rausch
Das Mordkreuz
Kommissar Kilians sechster Fall
«O MENSCH STEH STILL UND SCHAU/[MICH] ANN. G[E]DENCK DEIN SÜNDT SEINT/SCHULT DARANN.»
Inschrift eines Bildstocks in der Würzburger Straße in Estenfeld
«IT WILL NOT BE LONG LOVE, TILL OUR WEDDING DAY.»
She Moved Through the Fair, altes irisches Volkslied
Prolog
Vor vielen Jahren erzählte mir meine Großmutter die Geschichte von der Weißen Frau. Es war an einem kalten Herbstabend. Ich weiß es noch genau. Die Bäume bogen sich unter der unbarmherzigen Kraft des Windes, und der Regen drang durch die Ritzen des Hauses herein. Großmutter saß in ihrem alten Schaukelstuhl neben dem Holzofen und ich zu ihren Füßen. Die Schatten des Feuers zuckten an den Wänden entlang.
Die Weiße Frau sei kein Gespenst, sagte sie, sondern eine wahre Gestalt aus den Erzählungen der Leute. Sie erscheine in der Stunde des Todes – wehklagend und weinend. Eine eigentümliche Frau sei sie, voll von Mitleid für die Sterbenden. Das käme daher, dass auch sie viel Leid in ihrem Leben erlitten habe. In der Stunde des Todes wolle sie den Menschen beistehen, damit sie den Tod willkommen heißen, anstatt ihn zu fürchten. Denn für manche sei er ein Befreier von der Last des Schicksals.
Ich fragte Großmutter, ob sie die Weiße Frau schon einmal gesehen habe. Sie strich mir zärtlich über den Kopf. Nein, denn dann wäre sie nicht hier. Aber allzu fern sei dieser Tag nicht mehr.
Das beunruhigte mich, und ich wollte wissen, warum sie denn überhaupt sterben müsse. Wer würde sich dann um mich kümmern? Meine beiden Eltern waren ja bereits gestorben. Ich wäre dann ganz allein. Ich wäre niemals allein, antwortete sie. Die Familie wache über mich. Vom Himmel aus.
Ich mag die Weiße Frau nicht, erwiderte ich. Genauso wenig wie den Tod. Niemand solle je sterben müssen. Großmutter seufzte. Das hätten nicht wir zu entscheiden.
Wenn der Tod sie hole, fuhr sie fort, dann würde ich die Weiße Frau vielleicht zu Gesicht bekommen. Ich dürfe ihr nicht in die Augen sehen, denn dann hätte mein letztes Stündlein geschlagen. Sollte es doch unabsichtlich geschehen, müsste ich ihr mit großem Respekt begegnen. Vielleicht ließe sie mich dann am Leben.
Ihre Worte machten mir Angst.
Der Sommer kam wie Feuer in unser Tal. Er brannte so stark und lange, dass überall die Felder verdorrten und die Brunnen versiegten. Mensch und Tier litten unter der großen Hitze. Selbst die Nächte brachten nur wenig Linderung. Großmutter wurde sehr krank. Sie litt starke Schmerzen, und nichts vermochte ihr Fieber zu senken. Mein Großvater vergrub sich immer mehr in seinen Kummer und wich ihr nicht mehr von der Seite.
Anfang August kamen die ersten Gerüchte auf. Bauern wollten eine Frau, ganz in Weiß gekleidet, in den Wäldern gesehen haben. Die Männer riefen ihr nach, stehenzubleiben, doch sie verschwand auf wundersame Weise.
Als mein Großvater davon erfuhr, ließ er die Tür zu unserem Haus weit offen stehen. Er wusste, dass die Zeit gekommen war. Eines Nachts stand er auf und sah sie.
Ich verkroch mich unter dem Bett, zitterte und flehte, dass sie an meinem Zimmer vorbeigehen möge. Sie kam die Stufen herauf. Großmutter hatte sie bereits erwartet. Ich hörte sie beten. Dann ging sie zu ihr hinein. Ihr Schluchzen und Weinen nahm mir die Angst. Ich schlich mich hinaus und wagte einen Blick ins Schlafzimmer. Am Fenster sah ich sie stehen, mit einer Kerze in der Hand. Ihre Augen waren rot vom Weinen, und ihr Wehklagen war so laut und bitter, wie ich es niemals zuvor gehört hatte.
Als ein kalter Wind seinen Weg ins Zimmer fand, ergriff Großmutter die Hand der Weißen Frau. Ich fror augenblicklich und suchte Schutz in den Armen meines Großvaters. Er zeigte mir den Mond am Himmel. Der tauchte das Firmament in ein blutiges Rot, und ich hörte den Schrei der Weißen Frau.
Da wusste ich, dass der Tod zu Großmutter gekommen war.
Sieh dich vor. Eines Tages wirst vielleicht auch du den Schrei der Weißen Frau hören. Dann weißt du: Der Tod ist nahe.
1
Rosie Wilde hatte kein Ohr für die Worte ihres Mannes.
Mit einer Tasse Kaffee, an der sie sich die Hände wärmte, stand sie am Küchenfenster und blickte hinaus auf den Main. Die ersten Sonnenstrahlen bahnten sich einen Weg durch den nebelverhangenen Morgen. Die weit ins Flussbett reichenden Arme der Trauerweiden waren nur schemenhaft zu erkennen. Sie störten die Schwäne nicht, die, wie von Geisterhand getragen, über das Wasser liefen. Das kräftige Schlagen ihrer weißen Schwingen hob sie mit Anmut in die Luft, über das dumpfe Grau dieses Tals hinaus, weit weg in den Süden, wo es warm und sonnig war. Bald würde sie ihnen folgen.
«Hallo, ich spreche mit dir», hörte sie Gerald wie aus der Ferne rufen.
Doch sie weigerte sich, ihm Gehör zu schenken. Ihre Aufmerksamkeit war vollkommen von diesem Moment der Schönheit gefesselt. Sie glaubte, die Stimme der Sängerin Lisa Gerrard zu hören. Now We Are Free. Das Lied, mit dem sie nur wenige Stunden zuvor in einen tiefen, entspannten Schlaf gesunken war. Seine Hand lag in der ihren, und seine Wärme würde für ein ganzes Leben reichen.
Sie trank den Kaffee aus, stellte die Tasse auf die Anrichte und ging an Gerald vorbei in den Flur. Sie lächelte zufrieden, während sie den Mantel überstreifte und den selbst gestrickten Schal um den Hals schlang.
«Funktioniert die Heizung auch wieder?», rief sie in die Küche.
Gerald antwortete nicht.
Soll er weiter schmollen, dachte sie und zwängte die Finger in die Handschuhe. Jetzt hinaus in einen neuen, wunderbaren Tag.
Ihr alter Fiat Uno stand rückwärts geparkt vor dem Garagentor. Dann war wohl alles in Ordnung. Der Schlüssel öffnete die Tür problemlos, und auch der Motor sprang nach der zweiten Zündung an. Nachdem Francesca und Lucca aus dem Gröbsten heraus waren, hatte sie sich vor einem Jahr ihren größten Wunsch erfüllt: ein eigenes Auto.
Verloren stand er am Ende einer Reihe von schicken Kleinwagen, die eigens für die weiblichen Kunden entworfen worden waren. Doch diese herzlosen Kisten interessierten sie nicht. Sie wollte den schwarzen Uno. Den gleichen, mit dem sie vor vielen Jahren ihre ersten Ausflüge nach Italien unternommen hatte. In die Toskana, nach Venedig und sogar bis nach Rom hatte er sie gebracht. Nicht immer problemlos, aber immer bis ans Ziel.
Was holprige Straßen und der TÜV nicht schafften – den Uno aus den Verkehr zu ziehen–, erzwang die Geburt ihres ersten Kindes Francesca. Mit dem Verlust ihres eigenen Autos hatte sie auch ihre Unabhängigkeit aufgegeben. Francesca und später Lucca entschädigten sie zwar für vieles, aber dieses Gefühl, jederzeit gehen zu können, war mit dem Uno verschwunden.
Gerald konnte argumentieren, wie er wollte, dieser schwarze Uno würde sie zurück auf die Straße bringen. Der Kaufpreis, lächerliche achthundert Euro, war von ihrem Gehalt problemlos zu finanzieren, auch wenn sie sich das Geld vorab von Gerald leihen musste.
Die Rückzahlung war endlich geschafft, als die nächste Hürde anstand. Der alte Kassettenrecorder taugte nicht mehr. Zu Weihnachten hatte er ihr den Wunsch erfüllt und eine Stereoanlage eingebaut, die den Wert des Wagens auf das Doppelte erhöhte.
Und genau das brauchte sie jetzt, bevor sie den Gang einlegte. Musik. Sie drückte den Knopf. Ray of Light, Madonna. Etwas schnell für den frühen Morgen, aber es machte Laune. Sie blickte in den Rückspiegel, als sie die Auffahrt verließ. Gerald stand in der Haustür und schaute ihr nach. Heute Abend würde sie mit ihm sprechen, wenn die Kleinen im Bett waren.
Die Brücke, die hinüber auf die B13 führt, lag ganz vom Nebel eingenommen. Sie musste aufpassen, damit sie nicht auf ein wartendes Auto auffuhr. Wenn sie nur besser sehen könnte. Die Scheibenwischer quälten sich über die Windschutzscheibe. Von ihnen war nicht viel Hilfe zu erwarten. Und jetzt beschlugen auch noch die Fenster. Sie drehte den Schieber für die Lüftung auf. Nur kalte Luft kam heraus. Es war noch zu früh. Der Uno musste erst warm werden. Bis dahin wischte sie mit den Wollhandschuhen über die Scheibe. Das hätte sie besser bleiben lassen. Die Rücklichter der vor ihr fahrenden Fahrzeuge wurden durch die Schlieren verzerrt, sie konnte den Abstand nur noch erahnen.
Kurzerhand kurbelte sie das Seitenfenster herunter und schaute hinaus. Nach dem nächsten Auto würde sie auf die B13 auffahren können. Noch einmal zurückgeschaut, ja, da war eine Lücke. Sie drückte aufs Gas, und der Uno fädelte ruckelnd in den Morgenverkehr ein. Geschafft. Wenn jetzt noch bei Randersacker alles frei war, konnte sie noch rechtzeitig über die Ebertsklinge die Universität erreichen. Sie kurbelte das Seitenfenster hoch und wartete auf den warmen Luftstrom, der ihr endlich genügend Sicht auf den Verkehr verschaffen würde.
Eibelstadt passierte sie problemlos. Allmählich sollte aus den Schlitzen mal warme Heizungsluft kommen, dachte sie. Sie schob die Schieber hin und her, klopfte und schlug auf die Verkleidung. Vielleicht hatte sich was verklemmt. Doch sie traktierte nur den CD-Player, der zum nächsten Lied hüpfte.
Frozen. Sie schmunzelte. Madonnas Video fiel ihr dazu ein. Sie, in einem schwarzen Kleid in der Wüste, mit wunderschönen Ornamenten auf den Händen, sogenannten Mehndis.
Sie mochte den Refrain. You’re frozen, when your heart is not open. Ihre Aufmerksamkeit verließ die Straße. Während sie weitersummte, fragte sie sich, in welchem Land diese Verzierungen der Braut auf die Haut gemalt würden. War es Marokko oder Indien? Beim nächsten Afrika-Festival würde sie danach Ausschau halten.
Ein Schrei holte sie zurück. Woher war er gekommen? Die Antwort stand direkt vor ihr auf der Straße. Eine Frau in einem weißen Kleid. Ihre langen Haare wehten im Wind. Aus ihrem bleichen Gesicht starrten Rosie zwei rote Augen an. Oder waren es die Rücklichter eines vor ihr fahrenden Autos? Die Frau hob die Hände, als wolle sie sich gegen den drohenden Aufprall wehren.
In dem Augenblick, als Rosie mit ihrem ganzen Körpergewicht auf die Bremse stieg, glaubte sie die Frau weinen zu hören.
2
Neun Monate später.
Kilian wälzte sich unruhig im Bett. An seiner Seite schlief Pia davon unberührt. Ein wiederkehrendes Motiv hatte sich ihm in den vergangenen Wochen in sein Unterbewusstsein gegraben.
Er lag am Strand und hörte aus der Ferne ein Rufen. Es war die Stimme eines Kindes. Obgleich er die Stimme nicht kannte, wusste er, um wen es sich handelte. Er stürzte sich ins Meer und tauchte unter. Hinter einem Felsen fand er den Zugang. Er führte ihn viele Kilometer weg in eine Stadt. Dort kam er an die Wasseroberfläche. Die Passanten kümmerten sich nicht um ihn, und sie beantworteten auch seine drängende Frage nicht, wo er das Krankenhaus finden würde. Hastig lief er weiter. Die Gebäude und Straßen waren ihm völlig unbekannt. Das Schreien des Kindes wurde lauter, verzweifelter und drängender. Niemand interessierte sich dafür.
In der Straßenbahn kam eine alte Frau auf ihn zu. Sie beschimpfte ihn, wieso er so lange gebraucht habe. An der nächsten Haltestelle wies sie ihm den Weg. Vorbei an dröhnenden Krankenwagen, blutenden Unfallopfern und verwaisten Krankenbetten irrte er in den verschlungenen Gängen dieses Gebäudes umher. Keine der Türen ließ sich öffnen. Das Schwesternzimmer war leer, ein Arzt war nirgends zu sehen. Er stürzte weiter, schrie und bat um Hilfe. Doch hier war niemand, der ihm helfen wollte.
Dann sah er den ersten Tropfen am Boden. Er fädelte sich zu einer Kette auf, und Kilian folgte der Spur. Sie führte ihn in einen grell erleuchteten Gang, an dessen Ende der Kreißsaal lag. Atemlos versuchte er die Tür zu öffnen. Dahinter hörte er Schreie und die hektischen Kommandos der Ärzte. Doch die Tür blieb ihm verschlossen. Mit der Faust schlug er dagegen. Vergebens.
Er hörte erst auf, als sich zu seinen nackten Füßen Blut sammelte. Es strömte unter dem Türspalt hervor. Es war das Blut seines Kindes.
Kilian öffnete die Augen. Pia hatte ihn wachgerüttelt. «Beruhige dich», seufzte sie schlaftrunken, «es ist alles in Ordnung.»
Dann drehte sie sich wieder um und schlief weiter.
Zu spät, hörte er das Echo des Traums in seinem Kopf verhallen. Er stand auf, nahm das T-Shirt vom Stuhl und wischte sich damit den Schweiß ab. Inzwischen konnte er sich schneller von seinem Traum erholen als bei den Malen zuvor. Im Kühlschrank stand eine Wasserflasche, die er mit großen Schlucken zur Hälfte leerte. Die Zigarillos und der Brandy würden sich um den Rest kümmern. Er packte beides und stieg die Wendeltreppe hinauf. Auf dem Flachdach angekommen, setzte er sich an den Bistrotisch. Hier war es ruhig und dunkel. Niemand würde ihn sehen, so wie er war: nackt und verschwitzt.
Nachdem Pia und er die Dachgeschosswohnung in der Nähe des Sternplatzes gemietet hatten, hatte er diesen Platz zu seinem gemacht. Von hier aus hatte er freien Blick über die Stadt und das Treiben zu seinen Füßen. Zu dieser späten Stunde waren die Straßen jedoch leer. Einzig die heiße Luft, die in den Mauern gespeichert war, drang zu ihm hoch. Das Schwitzwasser der Steine roch modrig.
Er nahm einen Zug von dem Zigarillo und vergoldete ihn mit Brandy.
Wie lange soll das noch so weitergehen, fragte er sich. Hatte er sein schlechtes Gewissen nicht schon längst mit seiner Rückkehr nach Würzburg besänftigt? Er hatte sich schließlich gegen seine Freiheit und für eine Familie entschieden. Das konnte nicht jeder von sich behaupten. Viele wären einfach gegangen. Eine alleinerziehende Frau war keine Tragödie mehr. Umso weniger, als es sich bei Pia um eine starke und selbstbewusste Frau handelte.
Aber das schien nicht das Problem zu sein. Etwas anderes machte ihm zu schaffen. Es bohrte tief in seinem Innern, fraß sich durch die Träume in sein Leben.
Ein sanfter Windhauch streifte seinen Körper. Die Abkühlung war nicht der Rede wert, nur eine Erinnerung an bewegte Luft, die seit dem Beginn der Hitzewelle nur noch selten zu spüren war.
Fast hatte er vergessen, wie ein Sommer im Maintal sein konnte, wenn sich nichts mehr rührte und die Temperaturen jedes erträgliche Maß überstiegen. 2003 war so ein Sommer gewesen. Vierzig Grad und kein Ende abzusehen. Jetzt war es wieder so weit. Würde hinter dem Maintal das Meer liegen, hätte es kein Problem gegeben. Ein Bad in den Wellen, und sein Hitzkopf hätte Abkühlung gefunden.
Das Blaulicht eines Einsatzfahrzeugs tanzte über die Dächer. Er hörte den Wagen am Mainkai entlangbrausen. Wahrscheinlich zum nahe gelegenen Juliusspital. Für viele wurde die Hitze lebensgefährlich.
Kilian schenkte sich noch einen ein. So weit war es bei ihm noch nicht. Noch konnte er eine Nacht auf dem heißen Dach genießen.
Schorsch Heinlein, sein Kollege, hatte da andere Schwierigkeiten. Seitdem er dem kleinen Eisenbahnerhäuschen in Grombühl den Rücken gekehrt und eine seinem neuen Status als Erster Kriminalhauptkommissar entsprechende Wohnung im oberen Frauenland gefunden hatte, haderte er mit der Klimaanlage. Er hatte sie auf Wunsch seiner Frau Claudia einbauen lassen, die sie als unabdingbar angesehen hatte. Das wäre sie auch gewesen, wenn sich das Ehepaar auf eine für beide angenehme Raumtemperatur hätte einigen können. Heinlein hätte es gern eine Spur wärmer gehabt als sie. Schließlich fing man sich leicht einen Schnupfen bei diesen neumodischen Anlagen ein. Das konnte er sich nach seiner Beförderung nicht mehr leisten.
Nun lag er in einen Bettüberzug gewickelt auf einer Sonnenliege. Vom Balkon aus hatte er einen exzellenten Blick über das Maintal. Alles schlief, nur er nicht. Die Stechmücken raubten ihm den letzten Nerv. Eine hatte ihn bereits am Auge erwischt. Morgen würde er mit einer Schwellung im Kommissariat erscheinen – sehr zur Belustigung von Sabine, seiner Sekretärin, und natürlich von Kilian.
Einfach wieder ins Schlafzimmer zurückgehen wollte er nicht. Damit hätte er klein beigegeben. Diesen Triumph würde er Claudia nicht gönnen. Mit dem geschwollenen Auge brächte er sie schon zur Räson. Aber diese Stechmücken waren unerträglich. Es brummte und schwirrte über seinem Kopf, als sei er das Festmahl der Nacht. Gegen diese Biester gab es keinen Schutz. Kurzerhand stand er auf, schob die Balkontür vorsichtig zur Seite und schlich sich am gemeinsamen Ehebett vorbei in den Flur. Er würde es sich am Boden in Thomas’ Zimmer bequem machen. Bevor Claudia am Morgen aufstünde, wäre er längst im Bad, und sie hätte nichts von seinem Rückzug gemerkt.
Schorsch horchte ins Zimmer seines Sohnes hinein. Nichts. Kein Atmen, kein Schnarchen. Er machte Licht. Kein Wunder, Thomas war nicht in seinem Bett. Er schaute ins Bad, in die Küche und ins Arbeitszimmer. Thomas war tatsächlich nicht zu Hause.
Verdammt, wo trieb sich der Bengel wieder mitten in der Nacht herum? War er bei seinen dubiosen Freunden oder bei Vera, die das Haus in Grombühl nach ihrem Auszug übernommen hatte? Dort anrufen konnte er nicht, er hätte sie nur geweckt. Stattdessen ging er ins Arbeitszimmer, kramte sein Handy hervor und wählte Thomas’ Nummer. Er ließ es klingeln. Ein ums andere Mal, doch Thomas ging nicht ran.
Das Licht ging an. Heinlein fuhr herum.
«Was machst du hier?», fragte eine verschlafene Claudia.
Heinlein zog sich an. «Thomas ist nicht da.»
Auf einen Schlag war Claudia hellwach. «Hast du ihn nicht gehen gehört?», fragte sie vorwurfsvoll.
«Wie denn», antwortete Heinlein bissig, «wenn ich auf dem Balkon schlafen muss.»
«Was hast du vor?»
«Ich gehe ihn suchen. Was sonst.»
Heinlein drängte sich an ihr vorbei. «Ich nehme das Handy mit. Ruf an, wenn er nach Hause kommt. Ich fahr zuerst bei Vera vorbei.»
«Sie hätte sich doch gemeldet, wenn…»
Doch Heinlein war schon zur Tür hinaus.
Einige Kilometer entfernt saß eine Gruppe Jugendlicher um einen Bildstock herum, wie es viele im fränkischen Land gibt. Zu ihren Füßen lagen leere Bierflaschen. Inzwischen waren die Jungs auf Wodka umgestiegen. Ein Joint ging im Kreis herum. Das Sprechen fiel ihnen schwer.
«O Mann, ist das eine Mörderdröhnung.»
«Quatsch nicht. Lass rüberwachsen.»
«Hey, Tom. Was machst du eigentlich, wenn dein Alter merkt, dass du stiften gegangen bist?»
Thomas setzte die Flasche ab und grinste. «Der ist so dämlich… Der pennt auf’m Balkon, während meine Mutter im Bett liegt.»
«Ey, Alter, wieso’n das?»
«Sie können sich nicht über diese blöde Klimaanlage einigen. Er will’s warm und sie kalt.»
«Dann soll er sich halt noch ’ne Decke nehmen. What shall’s?»
«Hab ich ihm auch gesagt. Aber der Alte is stur. Seitdem er der Obermotz bei den Bullen ist, geht’s bei uns drunter und drüber.»
Ein anderer mit Namen Sven schaltete sich ein. «Dann soll er sich halt bei deiner Mutter aufwärmen. Ist noch ’ne ziemlich scharfe Braut für ihr Alter.»
«Lass meine Mutter aus’m Spiel. Da versteh ich keinen Spaß.»
«Haste was mir ihr laufen, oder wieso zickste hier so rum?», antwortete Sven.
Thomas sprang auf, wankte zur anderen Seite des Bildstocks und hob die Flasche. «Noch ein Wort und ich hau dir das Ding in die Fresse.»
Ein anderer hielt ihn zurück. «Ey, mach langsam. Der redet nur Scheiß, wenn er besoffen ist.»
«Los, entschuldige dich», forderte Thomas.
Sven dachte nicht daran. «Einen Scheiß werd ich.»
«Zum letzten Mal… entschuldige dich.»
«Was macht ihr hier so’n Stress. Können wir nicht mal in Ruhe abhängen, ohne dass ihr euch die Birne einschlagen wollt?»
«Komm, Sven, entschuldige dich. Peace.»
Zögernd kam Sven der Aufforderung nach. «Okay, weil ihr’s seid. Sorry.»
Für Thomas war das nicht überzeugend. «Der meint das nicht ehrlich. Ich will ’ne richtige Entschuldigung.»
«Lass gut sein, Alter», mischte sich ein weiterer Junge ein und zog ihn weg. «Er hat sich entschuldigt. Okay?»
Widerwillig ließ sich Thomas mitziehen. Er riss sich los und stapfte ein paar Meter weiter ins Dunkel, um zu pinkeln.
«Habt ihr ’ne blasse Ahnung, wo wir hier überhaupt sind?», rief er zu seinen Kumpels.
«Irgendein Kaff. Die schauen doch alle gleich aus. Hier kannste dir nur die Dröhnung geben.»
«Und wie’s hier stinkt», rief Sven dazwischen. «Hey, Tom, haste dir in die Hosen geschissen, oder was?»
Einer der Jungs schritt ein. «Halt’s Maul, Mann.»
Thomas fuhr herum. «Jetzt reicht’s.»
Er stürmte auf Sven zu, der sich auf den Sockel des Bildstocks gestellt hatte und sich provozierend die Nase zuhielt.
«Komm runter, du Scheißhaufen», brüllte Thomas. «Jetzt kriegste endlich mal eine in die Fresse. Ist schon längst fällig.»
Die anderen sprangen auf und hielten ihn zurück.
«Ey, Mann, hör doch nicht auf den Scheiß.»
«Lass mich los. Ich mach den fertig.»
Sven umarmte die Säule, rieb sein Bein an ihr. «Hat’s dein Alter mit deiner Mutter so gemacht? So wie’n Köter, wenn er pissen muss? Los, sag schon.»
Thomas riss sich los, packte Sven am Bein und zerrte daran. «Komm runter, du Drecksack.»
Ein Fußtritt ließ Thomas zu Boden gehen, was seinen Zorn nur noch verstärkte. Mit einem Satz war er auf dem Sockel, der die Säule des Bildstocks hielt. Sven wich seinen Schlägen aus, so gut er konnte. Dabei klammerte er sich an die Säule, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Das war für das jahrhundertealte Material eindeutig zu viel. Es knackte, und Sven stürzte mit der Säule zu Boden. Thomas warf sich auf ihn. Er bearbeitete ihn mit den Fäusten, bis die anderen ihn wegzerrten.
«Okay, das reicht. Er hat seine Abreibung gekriegt.»
Sven stöhnte. Einer nahm die Fackel, die in stockdunkler Nacht für Licht gesorgt hatte, und ging zu ihm hinüber.
«Alles klar, Alter?»
Sven wischte sich das Blut-Speichel-Gemisch vom Mund. Es tropfte in langen Fäden zu Boden.
«Mann, wie’s hier stinkt», sagte er.
«Jetzt halt endlich mal deine dumme Schnauze», rief ihm einer zu.
«Selber Schnauze», entgegnete Sven. «Hier stinkt’s nach was anderem. Bah, ist das eklig. Halt mal die Fackel her.»
Das flackernde Licht offenbarte ein Loch, das die herabstürzende Säule in den Boden geschlagen hatte.
Sven nahm die Fackel an sich. «Der Gestank kommt hier raus. Los, kommt mal her. Hier ist was.»
Sie gruppierten sich um Sven und schauten gemeinsam in das Loch. «Halt das Ding rein, damit wir was erkennen.»
Er folgte der Aufforderung. Im Schein erkannten sie so etwas wie Fäden, die an einer Wurzel oder einem Stein klebten.
«Was ist das?»
Als sie die Augenhöhlen und das Gebiss eines Totenschädels erkannten, war die Frage beantwortet.
Erschrocken wichen sie zurück. «Verdammte Scheiße, da ist einer begraben.»
«Was hast du anderes erwartet, du Spast. Wir sind auf einem Friedhof.»
«Der Friedhof ist da drüben, nicht hier.»
«Aber in der Nähe.»
«Was machen wir jetzt?»
Sven stand auf und griff nach einer Flasche. «Ganz einfach. Wir saufen einen auf ihn.»
«Du bist krank.»
«O Mann, der kann uns nichts mehr tun. Der ist tot. Also, wer trinkt einen mit? Auf das verschissene Wohl eines Toten.»
Niemand wollte in den Trinkspruch mit einstimmen. Sven setzte die Flasche an. Noch bevor er zu Ende trinken konnte, stoppte er. «Wer heult denn hier?»
«Was quatschst du da?»
«Hört ihr das nicht?»
«Was denn?»
«Da heult einer.»
Stumm lauschten sie in die Nacht. Ja, jetzt hörten auch sie es. Ein Weinen, ein Wimmern, das allmählich lauter wurde. Sie blickten sich um. Woher kam das?
Aus den Sträuchern, die sich entlang der Friedhofsmauer zogen, erstrahlte ein Licht, einer Kugel gleich, die rasch an Größe und Helligkeit gewann. Sie erhob sich in die Nacht. Aus ihr bildete sich eine Form. War zuerst die Silhouette eines Rocks erkennbar, so wurde schnell daraus ein Kleid und dann eine menschliche Gestalt, die es am Körper trug. Auf ihrem Kopf wuchsen lange weiße Haare. Sie wehten im Wind, wo keiner war.
Die Jungen wichen erschrocken zurück. Der Erste suchte sein Heil in der Flucht, der Zweite folgte. Auch Thomas rannte davon. Nur Sven blieb wie versteinert stehen. Die Gestalt schwebte einige Meter über dem Boden auf ihn zu. Sie schluchzte und klagte laut. Sven erkannte in ihr eine Frau – weiß wie der Schnee, mit roten verweinten Augen.
Nun endlich kapierte er, dass er schnell verschwinden musste. Er rannte ziellos ins Dunkel hinein – die Weiße Frau auf den Fersen.
3
Nachdem der letzte Stein entfernt worden war, hatten die Fliegen endlich ungehinderten Zugang zur Leiche.
Rechtsmedizinerin Dr.Pia Rosenthal strich mehrmals durch die Luft, um sie zu vertreiben. Ergebnislos. Sie fanden schnell Zuflucht in den offenen Höhlen des Schädels.
«Beeil dich, bitte», drängte sie den Kollegen von der Spurensicherung an ihrer Seite, der die Auffindesituation mit dem Fotoapparat dokumentierte.
Der Körper lag wie ein Embryo kauernd seitlich in einem Loch, das scheinbar eigens für ihn ausgehoben worden war. Es war nicht tief, aber ausreichend, um den Körper zu fassen. Das Gesicht des Mannes war mit weißen Schimmelpilzen überzogen. An den Lippen, der Nasenspitze und an den Ohrmuscheln zeigte sich Tierfraß. Die Wunden waren sauber, ohne Anzeichen von Blut. Der Mann war demnach nach Eintritt des Todes hier verscharrt worden.
Obwohl es noch nicht einmal acht Uhr morgens war, brannte die Sonne heiß vom klaren Himmel. Einer der schwarz gekleideten Bestatter, die den Leichnam nach der Freigabe ins gerichtsmedizinische Institut überführen würden, hatte einen Regenschirm über Pia ausgebreitet. Der andere stand mit verschränkten Händen ein paar Meter entfernt. Der Schweiß lief ihm über die Stirn, und er fing ihn gelegentlich ohne Hast mit einem Taschentuch auf.
Das Motorgeräusch eines sich nähernden Fahrzeugs ließ Pia aufblicken. Jenseits eines ausgetrockneten Wasserkanals der Flurbereinigung stiegen die Kommissare Kilian und Heinlein aus. Sie gingen ein paar Schritte und erreichten ihren Kollegen Karl Aumüller, der sich des zweiten Opfers angenommen hatte. Ein junger Mann lag leblos im Wasserkanal. Sie wechselten ein paar Worte, dann kamen sie auf Pia zu.
«Ich bin fertig. Du kannst ihn haben», sagte der Kollege mit dem letzten Klick seiner Kamera.
Pia nickte stumm. Bevor sie die Leiche von den Bestattern aus dem Loch bergen ließ, wartete sie die Ankunft der Kommissare ab. Sie näherten sich wie zwei Desperados in der Wüste. Jeder Schritt löste eine kleine Staubwolke auf dem ausgetrockneten Acker aus. Während Kilian dem Wetter angemessen in Jeans und weißem Hemd gekleidet war, saugte Heinleins dunkler Anzug jeden Sonnenstrahl in sich auf.
«Ihr kommt gerade richtig», begrüßte Pia sie.
Kilian nahm die Sonnenbrille ab und ging über der Leiche in die Hocke. Der strenge Verwesungsgeruch schien ihn nicht zu stören. «Was haben wir hier?», fragte er und vertrieb die Fliegen.
Pia beugte sich zu ihm hinunter. «Ich kann noch nicht viel sagen. Eine männliche Leiche. Alter Ende fünfzig, vielleicht sechzig Jahre.» Sie zeigte auf eine Zertrümmerung des rechten Hinterkopfs, die unter vertrocknetem Blut verdächtig schien. «Das könnte die oder eine tödliche Verletzung sein. Sieht nach einem Schlag aus, bei der der Schädel zertrümmert und das Gehirn verletzt wurde.»
«Wie lange liegt er schon hier?», fragte Heinlein von oben herab. Er hatte seine Sonnenbrille nicht abgenommen.
«Kann ich noch nicht sagen. Nach dem Stand der Verwesung schätze ich mehrere Wochen. Der Körper war mit Steinplatten abgedeckt und notdürftig mit Erde zugeschüttet. Dennoch wird Luft rangekommen sein.»
«Woraus schließt du das?», fragte Kilian.
Sie zeigte auf mehrere weiße, stecknadelkopfgroße Körner. «Das sind Insekteneier. Dort sind Maden, und hier unten liegen Puppenhülsen.»
«Dann brauchen wir einen Fliegenmann, einen forensischen Entomologen», schlug Kilian vor.
«Richtig. Und zwar so schnell, wie’s geht, bevor wir das Larvenwachstum beeinflussen.»
«Ich fürchte, dafür fehlt uns das Budget», widersprach Heinlein.
Kilian wollte sich damit nicht abfinden. «Frag den Chef, oder stell einen Antrag.»
Pia pflichtete ihm bei. «Wenn die Leiche länger als zwei Wochen hier liegt, dann werde ich außer der Todesursache nicht viel sagen können. Je weiter der Tod zurückliegt, desto ungenauer wird meine Bestimmung des Todeszeitpunkts. Ein Insektenkundler kann helfen.»
«So weit ist es noch nicht», entgegnete Heinlein. «Was hast du noch?»
«Nichts. Ich habe ja gerade erst angefangen.»
Heinlein nickte dem Bestatter, der an Pias Seite noch immer den Schirm hielt, auffordernd zu. Dieser reichte den Schirm an Heinlein weiter und rief seinen Kollegen herbei. Gemeinsam fassten sie den Leichnam an Schultern und Beinen, hoben ihn heraus und legten ihn auf eine bereitliegende Plastikfolie. Die Totenstarre war bereits gelöst, sodass der Körper mühelos ausgestreckt werden konnte.
Während Pia den Toten entkleidete, um die übliche erste Untersuchung vornehmen zu können, tastete Kilian den Körper nach Ausweispapieren ab. In der Innentasche des Jacketts wurde er fündig.
«Wenn es nur immer so einfach wäre», sagte er zufrieden.
Die unversehrte Brieftasche enthielt einen Personalausweis. Er nahm ihn heraus und las vor. «Dr.Gregor Zinnhobel.»
«Zinnhobel, der Richter?», fragte Heinlein erschrocken und nahm seine Sonnenbrille ab. Wie vermutet, hatte sich in den vergangenen Stunden über seinem linken Auge eine Schwellung aufgetan, die das Lid herunterdrückte, sodass er kaum sehen konnte.
«Was ist denn mit dir passiert?», fragte Pia.
«Ein Mistvieh von Stechmücke hat mich erwischt», antwortete er.
Pia kam näher. «Lass mal sehen.»
Heinlein wich vor den Handschuhen zurück, die zuvor die Leiche berührt hatten. «Ist schon in Ordnung. Danke.»
Er verglich das Foto im Ausweis mit dem verzerrten und teils verwesten Gesicht der Leiche.
«Was meinst du?», fragte er Kilian.
«Ja, das könnte er sein.»
«Verdammt, wieso muss der gerade in meinem Bezirk sterben.»
«Zinnhobel war am Landgericht tätig», erinnerte sich Kilian, «und gilt seit wann vermisst?»
«Seit etwa drei Wochen.»
«Das könnte passen», pflichtete Pia ihm bei. «Wenn wir den Todeszeitpunkt aber mit seinem Verschwinden vergleichen wollen, brauchen wir unbedingt einen Entomologen.» Heinlein seufzte. «Ich werde mit dem Chef sprechen. In diesem Fall wird er wohl kaum nein sagen können.» Er schaute sich um. Am Boden lagen die zerbrochene Säule des Bildstocks, ein halbes Dutzend leere Flaschen und eine Handvoll Zigarettenstummel. «Habt ihr was angefasst oder verändert?»
«Wir mussten ein Stück der Säule bewegen», antwortete Pia, «damit wir an die Leiche kamen. So wie es aussieht, ist sie eingestürzt und hat eine der Steinplatten durchschlagen. Dadurch wurde die Leiche erst entdeckt.»
Kilian hob indes einen Zigarettenstummel auf, der ihm verdächtig vorkam. Er roch daran. «Die haben sich ordentlich einen gegeben. Hier sind Cannabisreste, und dort drüben liegen leere Wodkaflaschen. Schaut nach einer Fete übermütiger Kids aus.»
«Weißt du, wo sie sind?», fragte Heinlein Pia.
Ohne aufzublicken, antwortete sie: «Hinten im Dorf, gleich das erste Haus.»
«Gut, dann gehen wir. Hören wir heute noch von dir?»
Sie nickte. «Gegen Abend. Wir haben ja noch eine zweite Leiche.»
«Zieh den Zinnhobel vor… sofern er es wirklich ist.»
«Dafür brauch ich Vergleichsmaterial.»
«Kriegst du. Ich schick jemand bei der Familie vorbei.»
Heinlein setzte die Sonnenbrille wieder auf und ging mit Kilian in Richtung Dorf, das sich in rund einhundert Meter Entfernung befand. Dazwischen lag der Friedhof. «Was meinst du, was letzte Nacht passiert ist?», fragte er Kilian.
«Die Kids haben einen draufgemacht, bis sie die Leiche entdeckt haben. Sie gerieten in Panik und sind auf und davon. Einer hat den Wasserkanal übersehen, ist gestürzt und schließlich an seinem Erbrochenen erstickt.»
Heinlein nickte. «Ja, so könnte es gewesen sein. Und wie passt diese übernatürliche Erscheinung ins Bild?»
Kilian erinnerte sich an den kurzen Bericht Karl Aumüllers und grinste. «Glaubst du wirklich an diesen Humbug? Eine Frau, ganz in weiß, die am Himmel schwebte. Ich denke, die Jungs haben zu viel gesoffen und gekifft.»
«Kann sein.» Heinlein schickte ein Gähnen nach.
«Noch müde?»
«Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Thomas ist mitten in der Nacht verschwunden. Ich war bis vor einer Stunde auf der Suche nach ihm, bis ich zum Einsatz gerufen wurde.»
«Hast du ihn gefunden?»
«Nein. Wenn er wenigstens Bescheid gesagt hätte, dann bräuchten wir uns keine Sorgen machen.»
«Der taucht zum Frühstück wieder auf. Wir waren genauso.»
«Da kanntest du meinen Alten Herrn nicht. Wer nicht um zehn im Bett war, brauchte erst gar nicht nach Hause zu kommen. Eine Tracht Prügel gab’s obendrein.»
Sie hatten das Dorf erreicht. Ein Dutzend Einwohner stand am Eingang zum Pfarrhaus und diskutierte den Vorfall der vergangenen Nacht. In der Mehrzahl waren es alte Leute, die sichtbar betroffen waren. Von einer Weißen Frau war die Rede, von Tod, Angst und der Rache Gottes.
«Bitte lassen Sie uns durch», bestimmte Heinlein und zwängte sich an ihnen vorbei durch das enge Eingangstor. An der Tür wartete Gruber, der Kollege vom Kriminaldauerdienst KDD. Er war als Erster am Einsatzort gewesen. «Gut, dass ihr da seid. Sie warten drin auf euch.»
Er ging voran. «Schorsch», sagte er mit unterdrückter Stimme, «mach dich auf was gefasst.»
«Was meinst du?»
«Wirst gleich sehen.»
Durch den Flur gelangten sie in ein großes Zimmer, das durch die dicken Steinwände erstaunlich kühl geblieben war. In der Mitte des Raums stand ein großer Tisch, an dem drei Jugendliche und ein älterer Mann saßen. Es war der Pfarrer. Drei von vier Augenpaaren erhoben sich, als Kilian und Heinlein hereinkamen. Gruber ging an ihnen vorbei und stellte sich hinter die Jungs.
«Einer nach dem anderen ist in den letzten zwei Stunden hier eingetroffen», sagte er. «Der Pfarrer war so freundlich, sich um sie zu kümmern, bis ihr da seid.»
«Danke, Gruber», sagte Heinlein und setzte sich an den Tisch. «Alles Weitere sollen die Jungs erzählen.»
Er konnte allen ins Gesicht sehen, nur einer hatte seinen Kopf unter einer Kapuze versteckt, als wolle er nicht erkannt werden. An seinen Ärmeln klebte vertrocknetes Blut.
«Hallo, junger Mann. Würdest du mich bitte ansehen, wenn ich mit dir spreche.»
Als Thomas den Kopf hob und seinem Vater in die Augen sah, fühlte Heinlein einen Stich in der Brust.
«Was machst du denn hier?», fragte er überrascht.
Anstelle von Thomas antwortete der Pfarrer. «Seien Sie ihm nicht böse. Es sind junge Männer…»
«Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer», fiel Heinlein ihm ins Wort. «Ich möchte von ihm hören, was er hier zu suchen hat.»
Thomas suchte nach einer Erklärung. Doch nichts schien ihm passend, um den aufkeimenden Zorn seines Vaters zu besänftigen.
«Ich höre», presste Heinlein mit unterdrückter Stimme heraus.
«Sehen Sie», sagte Thomas zum Pfarrer, «ich kann überhaupt nicht mit ihm reden. Er steckt voller Wut auf mich. Am liebsten würde er mich windelweich schlagen.»
«Das hättest du auch verdient», erwiderte Heinlein laut und schlug mit der Hand auf den Tisch.
Thomas sprang auf und rannte zum Ausgang.
«Komm sofort wieder her!», schrie Heinlein ihm nach. Er erhob sich, um seinem Sohn zu folgen, doch Kilian hielt ihn zurück.
«Lass gut sein», besänftigte er ihn. «Du kannst später mit ihm reden.» Zu Gruber gewandt: «Schaust du nach ihm?»
Gruber nickte und verließ das Zimmer.
Kilian setzte sich an den Tisch und übernahm die Befragung. Heinlein hatte mit sich zu kämpfen.
«Dann erzählt mal, was letzte Nacht passiert ist.»
Keiner der drei wollte den Anfang machen. Sie schauten verlegen auf die Gläser vor ihnen.
Kilian ermunterte sie aufs Neue. «Keine Angst, mein Kollege hat sich beruhigt.» Das war eine glatte Lüge. Kilian konnte Heinleins Aufregung förmlich spüren. «Erzählt frei von der Leber weg.»
«Linus kam als Erster zu mir», antwortete der Pfarrer, nachdem keiner Anstalten machte, den Mund aufzumachen. «Es klingelte gegen fünf Uhr an der Tür. Die alte Müllerin begleitete ihn. Sie hat ihn völlig verstört am Dorfplatz gefunden.»
«Was war passiert?», hakte Kilian nach.
«Das sollte Linus vielleicht selbst erzählen.»
Der Pfarrer legte ermutigend die Hand auf die Schulter des Jungen. Schließlich begann er mit zittriger Stimme. «Ich bin die ganze Nacht umhergelaufen. Ich weiß nicht mehr, wo. Hauptsache, nur weg. Als die Sonne aufging, habe ich eine Straße erkannt und bin ihr nachgelaufen. Irgendwann war ich dann wieder hier.»
«Du meinst, du bist im Kreis gelaufen», hakte Kilian nach. Linus nickte.
«Wovor bist du weggelaufen?»
Linus schwieg. Stattdessen griff er zum Glas und trank es mit einem Schluck leer.
Der Pfarrer füllte die Pause. «Sie haben jemand gesehen.»
«Wen habt ihr gesehen?»
Der andere Junge fasste sich ein Herz. «Eine Frau. Sie kam aus dem Holunderbusch am Friedhof.»
«Wer war sie?»
Keiner der beiden wusste darauf eine Antwort.
«Sie wollen eine Weiße Frau gesehen haben», sagte der Pfarrer.
Verärgerung stieg in Kilian hoch. Genau das wollte er vermeiden. Der Pfarrer legte ihnen Aussagen in den Mund, die sie wohl selbst nicht getätigt hätten. «Bitte, lassen Sie sie antworten», sagte er mit dem Rest verbliebener Höflichkeit.
Linus spürte das. «Es stimmt, es war eine Weiße Frau», protestierte er. «Wir haben sie mit eigenen Augen gesehen.»
«Wisst ihr denn überhaupt, was eine Weiße Frau ist?», konterte Kilian.
«Ja, der Pfarrer hat es uns erklärt», erwiderte der andere.
«Gut, dann beschreibt sie mir. Ich kenne sie nämlich nicht.»
«Sie trägt ein langes weißes Kleid», begann Linus. «Auch ihr Haar ist weiß und ihr Gesicht ebenfalls. Sie hat geweint, als sie auf uns zukam.»
«Sie kam nicht», widersprach der andere, «sie schwebte. Frei in der Luft.»
«Und wie hat sie das angestellt?»
Sie hatten keine Erklärung dafür. «Wir haben es gesehen», bestand Linus auf seiner Beobachtung. «Sie stand wie ein heller Stern am Himmel. Ihre Haare und ihre Kleider wehten im Wind. Kein Scheiß, ich schwör’s.»
«Kann es nicht eher sein, dass ihr zu viel getrunken und geraucht habt?»
Die beiden fühlten sich herausgefordert. «Nicht mehr als sonst. Wir wissen, was wir gesehen haben.»
«Und ich habe eure halb aufgerauchten Tüten gefunden. Daneben lagen leere Flaschen Bier und Schnaps. Wenn ihr nachher auf dem Revier eine Blut- und Urinprobe abgebt, werden wir erfahren, wie betrunken und bekifft ihr wart. Und ich wette, ihr seid es noch. Habe ich recht?»
Ertappt rangen sie sich zu einer Antwort durch. «Ja, es stimmt. Wir haben was getrunken und geraucht. Aber wir haben das im Griff.»
«Einen Scheiß habt ihr», fuhr Heinlein überraschend auf. «Wie lange geht das denn schon mit eurer Kifferei?»
Kilian ging entschieden dazwischen. «Beruhige dich. Das klären wir später.» Zu den Jungen: «Okay, ihr habt also ordentlich was weggedrückt. Was ist dann passiert?»
«Sven und Tom haben sich in die Haare gekriegt», begann Linus zu erzählen, und er wiederholte die Vorkommnisse der Nacht, bis zu dem Moment, als sie in alle Richtungen verstreut davonliefen. Letztlich seien sie wieder im Pfarrhaus aufeinandergestoßen. Als Letzter wäre Thomas vor einer halben Stunde eingetroffen.
«Wo war er gewesen?», fragte Heinlein.