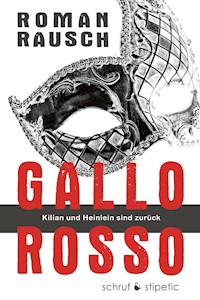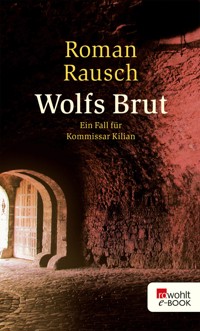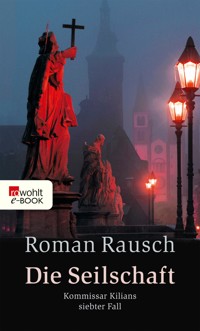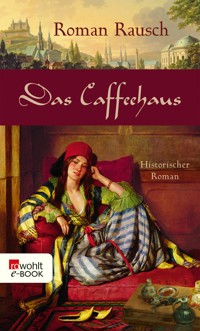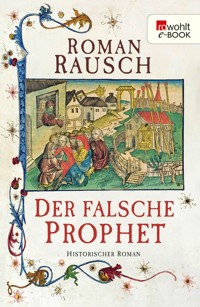7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schuldig ist, wer vergisst. Kriminalpsychologe Levy hätte nie daran gedacht, dass ihn der ungelöste Fall, der ihm damals den Job kostete, nochmals beschäftigen würde. Der Täter hat wieder zugeschlagen: Menschliche Innereien werden an einem Flussufer gefunden. Levy wird zu den neuen Ermittlungen hinzugezogen. Keiner kennt den Serienkiller so gut wie er, aber als Levy herausfindet, wie gut er ihn wirklich kennt, ist es vielleicht schon zu spät.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Roman Rausch
Und ewig seid ihr mein
Thriller
Informationen zum Buch
Schuldig ist, wer vergisst.
Kriminalpsychologe Levy hätte nie daran gedacht, dass ihn der ungelöste Fall, der ihn damals den Job kostete, nochmals beschäftigen würde. Der Täter hat wieder zugeschlagen: Menschliche Innereien werden an einem Flussufer gefunden. Levy wird zu den neuen Ermittlungen hinzugezogen. Keiner kennt den Serienkiller so gut wie er, aber als Levy herausfindet, wie gut er ihn wirklich kennt, ist es vielleicht schon zu spät.
Informationen zum Autor
Roman Rausch, 1961 in Würzburg geboren, arbeitete nach dem Studium der Betriebswirtschaft im Medienbereich und als Journalist. Für seine Trilogie um den Kommissar Johannes Kilian wurde er 2002 auf der Leipziger Buchmesse mit dem Book on Demand Award ausgezeichnet. Heute lebt er als Autor und Schreibcoach in Würzburg und Berlin.
Mehr über den Autor und sein Werk: www.Roman-Rausch.de
Weitere Veröffentlichungen:
Aus der Reihe um den Würzburger Kommissar Kilian und seinen Kollegen Heinlein:
Tiepolos Fehler
Wolfs Brut
Die Zeit ist nahe
Der Gesang der Hölle
Der Bastard
Das Mordkreuz
Die Seilschaft
Aus der Reihe um den Hamburger Profiler Balthasar Levy:
Code Freebird
Weiß wie der Tod
Und die historischen Romane
Das Caffeehaus
Die Kinderhexe
MEIN DANK GILT:
Alexander Horn und Bernd Schabel für die Hilfe bei der Recherche. Dr.Thomas Tatschner für den rechtsmedizinischen Beistand. Angela Kahlisch fürs Lesen und die Kritik. Blanka für die guten Ratschläge und deine Mitarbeit.
PROLOG
IM SCHLAFSAAL EINES
WAISENHAUSES VOR
DREISSIG JAHREN.
Er hielt die Augen geschlossen, bis das Licht erlosch und die Schritte auf dem Gang verklungen waren.
Durch die Gaubenfenster schien der Mond herein, sodass er nicht fürchten musste, an das eine oder andere Bettgestell zu stoßen. Er wartete noch eine halbe Stunde, erst dann war er sicher, dass alle fest schliefen.
In dieser Nacht würde er es beenden.
Er glitt aus dem Bett, setzte den nackten Fuß behutsam auf die Dielen – ein dünnes Knarzen. Er schreckte zurück, schaute sich um, ob jemand aufgewacht war. Dann versuchte er es erneut, dieses Mal vorsichtiger.
In seinem Geheimfach, unten im Gelenk des Gestells, hatte er alles Nötige deponiert – zwei Gürtel, die er dem Doktor aus dem Schrank gestohlen hatte, eine kleine Karaffe Waschbenzin aus der Wäscherei und die Streichhölzer aus dem Gemeinschaftsraum, wo der ewig müde Helfer Heinz Aufsicht hielt.
Mit Bedacht setzte er einen Fuß vor den anderen. Es lagen zwanzig Betten auf jeder Seite zwischen ihm und seinem Ziel. Seine Verlegung ans andere Ende des Schlafsaales hatte nichts an seinem Vorhaben geändert.
Endlich vor dem letzten Bett zu seiner Rechten angekommen, machte er Halt, horchte in die Stille hinein, ob der Junge vor ihm und auch die anderen schliefen.
Alles war ruhig. Der Junge hatte sich in seine Decke eingewickelt und schlief fest. Er hatte das Kopfkissen mit den Armen umschlungen. Der nächste Kontrollgang war erst in einer halben Stunde zu erwarten, er hatte also ausreichend Zeit.
Nun endlich war es so weit. Dieses Mal würde es klappen. Er legte die Gürtel um den Schlafenden, einen auf die Brust, einen auf die Knie, und führte beide Enden unter dem Bett zusammen. Er brauchte ihn nicht allzu fest zu zurren, nur so viel, dass sein Opfer für ein paar Augenblicke am Bett gefesselt war. Der Rest ergab sich von selbst.
Der Stöpsel von der Karaffe war schnell und geräuschlos entfernt. Ein dünner Strahl fuhr Slalom über die Zudecke und das Kopfkissen. Allerdings erwischte er auch das Gesicht des Jungen. Der öffnete die Augen und schaute dem anderen, der vor seinem Bett stand, ins Gesicht. Ein Moment der Unsicherheit. Keiner von beiden wusste, wie er sich verhalten sollte.
Erst als der Angreifer zu lächeln begann, lächelte auch der Ahnungslose. Er beugte sich auf, wollte ihn in die Arme schließen. Das Ratsch des Zündkopfs und das Aufflackern einer Flamme machten die Hoffnung zunichte. Jetzt erkannte er, wie sehr er sich in der Situation getäuscht hatte.
Er sprang auf, wurde aber vom Gürtel aufs Bett zurückgeworfen.
«Du büßt für das, was du getan hast», sagte der Angreifer und ließ das brennende Streichholz auf die Decke fallen.
Die Flamme zündete sofort. Neonblau schlängelte sie sich schnell zum Kopfkissen hoch.
Der Junge im Bett wehrte sich verzweifelt gegen die Fesseln und schrie um Hilfe. Die anderen im Raum wachten auf, sahen das Feuer. Aufgeregt rannten sie zum Gang hinaus. Nur einer nahm geistesgegenwärtig in dem Durcheinander eine Decke und warf sie über das Bett. Das Gros der Flammen erstickte, ein paar wenige züngelten an der Seite.
Der Angreifer schlug auf den jungen Helfer ein, zog ihn vom Bett weg. Zu spät. Auch er wurde von einem kräftigen Arm gepackt und zur Seite geschleudert.
Wasser aus einem Eimer ergoss sich über das Bett.
Alle schauten, ob aus der dampfenden Decke noch eine Reaktion zu erwarten war.
EIN PAAR TAGE SPÄTER.
Der Mann und die Frau, die mit dem Jungen sprachen, sahen aus, als würden sie eine Entscheidung herbeiführen. Seine Hände waren verbunden, und am Hals trug er ein braun gefärbtes Pflaster gegen die Brandwunde. Die Haare waren an der einen Seite bis auf die Kopfhaut abgesengt. Ansonsten hatte er das Feuer mit viel Glück und keinen weiteren, ernsthaften Verletzungen überlebt.
Der, der den Anschlag ausgeführt hatte, saß in der anderen Ecke des Raumes. Dazwischen, hinter dem Schreibtisch, der Heimleiter, der über die delikate Angelegenheit grübelte.
Doch das interessierte den Jungen, der sich ruhig auf den Stuhl neben dem Bett gesetzt hatte, nicht. Er hatte nur Augen für sein Opfer. Für die Angst, für den verzweifelten Kampf. Die Sache war noch nicht ausgestanden, so lange nicht, bis beendet war, was er sich vorgenommen hatte.
Doch das war ihm nicht gelungen, es war zu spät.
Als der Verletzte an der Hand der Frau den Raum verließ, blickte er nochmals herüber. Entsetzen und Traurigkeit standen ihm ins Gesicht geschrieben.
Der, der ihn töten wollte, blieb zurück.
Vorerst war er in Sicherheit.
ERSTER TEIL
ANUBIS
1
Es ist nur ein schmaler Grat zwischen Verstand und Trieb.
Der, der sich selbst den Namen Der Meister gegeben hatte, betrat den Aufzug von der Tiefgarage her. Sein Ziel war der fünfte Stock. In wenigen Minuten würde sie ihre Wohnung verlassen.
Im blanken Metall der Kabinentür korrigierte er den Sitz der Krawatte, zupfte das Revers des Anzugs zurecht und sah auf seine matt glänzenden Schuhe hinab. An seiner äußeren Erscheinung gab es nichts auszusetzen; er war eine attraktive Erscheinung. Nicht wenige Frauen würden sich in seiner Nähe wohl fühlen und sogar darauf hoffen, von ihm angesprochen zu werden.
Die Stimme aus den Ohrstöpseln trieb ihn vorwärts, ließ nicht ab, ihn zur Wohnung dieser Frau zu führen.
Dein Schweiß. Dein warmes Blut.
Sein Herz schlug im Gleichklang der pulsierenden Musikbeats. Die Erwartung, seine Hände bald auf ihr weißes Fleisch zu legen, es zu kneten und zu formen, es in Stücken aus dem Körper zu schneiden, euphorisierte ihn.
Vor zwei Wochen hatte er sie gefunden, diese Frau, die wie ein Donnerschlag in sein Leben getreten war. Sie war ursprünglich nicht seine erste Wahl gewesen, hatte sich an jenem Abend zwischen ihn und sein auserwähltes Opfer gedrängt.
Auf dem Parkplatz hinter dem Supermarkt war es gewesen. Der Wagen stand in Position, er war bereit zuzuschlagen. Doch dann kam sie, quetschte sich mit dem Sportwagen in die Lücke. Als sie ausstieg und ihm frech ins Gesicht lachte, wusste er, dass nur sie diejenige sein konnte.
Da war er, dieser Blick, den er unter all den anderen bisher nicht gefunden hatte.
Er gab die andere auf.
An der Kasse stand sie vor ihm. Er las in ihren Einkäufen.
Eine Flasche Rotwein, Tagliatelle, eine Hand voll italienische Kräuter, eine Artischocke, eine Lage fein geschnittener Schinken, zum Dessert eine kleine Honigmelone und die Nachtausgabe der Stadtzeitung. Die Einkäufe einer Alleinstehenden.
Ihr Heimweg endete in ihrer Tiefgarage. Er parkte den Wagen hinter einer Säule und schaute sich um, wo die Überwachungskameras positioniert waren.
Sie wählte den gut beleuchteten Frauenparkplatz, mühte sich mit den Einkäufen und dem Aktenkoffer das kurze Stück zum Aufzug. Die Fahrt ging in den fünften Stock. Es gab nur drei Namensschilder dort.
Auf goldglänzendem Metall las er: Tessa Fahrenhorst.
Wie er vermutet hatte: Er hörte kein Wort hinter der Tür, sie war allein stehend.
Sie war perfekt.
Tags darauf folgte er ihr quer durch die Stadt zu einer Boutique, die sie anscheinend führte. Sie hatte zwei junge Angestellte. Es herrschte Betrieb, sie hatte offenbar Erfolg. Er trat ein und schaute sich um. Einem Gespräch unter den Angestellten entnahm er, dass sie morgen zur Modemesse aufbrechen würde. Dort sollte sie zwei Tage verbringen. Zwei Tage Modemesse hießen für ihn vermutlich zwei Tage Vorsprung, bis bei der Polizei eine Vermisstenanzeige eingehen würde.
Die Mittagspause verbrachte sie in einem italienischen Restaurant. Man kannte sie gut. An einen Zugriff war hier nicht zu denken, ebenso wenig wie in der Boutique. Blieb nur die Tiefgarage.
Er entschied sich für den Morgen, gleich wenn sie ihre Wohnung verlassen würde. Sie in der Tiefgarage abzupassen wäre günstiger gewesen, da sein Wagen in der Nähe stand, aber keine Frau ließ sich in der Tiefgarage ansprechen. Der Kontakt musste vorher stattfinden.
Der Aufzug hielt mit einem Ping im fünften Stock. Er prüfte den Inhalt seiner Jackett-Tasche. Ein Tuch, satt mit Chloroform getränkt und in eine Haushaltsfolie gewickelt. Er würde es schnell zur Hand haben, wenn es so weit war.
Heute war der erste Tag der Modemesse. Dieser und der folgende waren für Fachbesucher vorgesehen, er hatte sich informiert. Die Fahrt dorthin würde im Morgenverkehr zirka eine Stunde dauern. Wenn Tessa Fahrenhorst rechtzeitig zum Öffnen der Messetore vor Ort sein wollte, dann musste sie ungefähr jetzt ihr Fahrzeug aufsuchen.
Die Fahrstuhltür öffnete sich. Er schaute hinaus in den leeren Gang. Alles war ruhig. Nirgends ein Geräusch des Aufbruchs. Er drückte die Taste für den sechsten Stock, fuhr hoch und stellte sich in die Lichtschranke.
Er musste nicht lange warten. Da war das rote Licht, das anzeigte, dass jemand im fünften Stock den Fahrstuhl wollte. Er trat zurück in die Kabine. Jetzt wurde es ernst. Er war völlig ruhig. Alles würde nach Plan gehen.
Etwas irritiert, zu solch morgendlicher Stunde auf jemanden zu treffen, stieg sie zu. Er trat an die Rückwand zurück, damit sie genügend Raum für das Gepäck hatte. Ihre Hand hob sich, um die Taste zu drücken, stoppte, als sie sah, dass die Tiefgarage bereits gewählt war.
Ein kurzer Augenblick der Neugier, dann drehte sie sich zu ihm um. «Ich habe Sie hier noch gar nicht gesehen.»
Jetzt entschied es sich. Der erste Satz war immer der schwerste. Das vorbereitete Lächeln kam zum Einsatz.
«Familienbesuch, meine Schwester», antwortete er.
Sie nickte, schaute an ihm hinunter. «Boss oder Valentino?», fragte sie.
Er hatte auf die Frage gehofft: «Wie bitte?»
«Entschuldigen Sie, es ist eine Berufskrankheit. Ich wollte wissen, von welchem Hersteller Ihr Anzug ist.»
«Keiner von beiden. Es ist eine Maßanfertigung.»
Sie lächelte anerkennend. Er hatte gewonnen.
Ping. Tiefgarage.
Sie griff nach ihren Koffern, wollte aus dem Fahrstuhl gehen, kollidierte jedoch im letzten Moment mit der engen Öffnung.
«Darf ich Ihnen helfen?», fragte er.
«Das ist sehr freundlich. Ich stehe nicht weit.»
Sie traten hinaus, und sie blickte zu dem schwarzen Van neben ihrem Sportwagen. «Wer zum Teufel belegt schon wieder einen Frauenparkplatz?»
Er schaute nach links oben, wo er gleich in das Blickfeld der Überwachungskamera treten würde. «Das bin ich», entschuldigte er sich. «Meine Schwester hat ihn mir für eine Nacht überlassen. Es wird nicht wieder vorkommen.»
Sie bereute die Schelte. «Sorry, das ist dann etwas anderes. Wissen Sie, einige würden am liebsten gleich im Fahrstuhl parken.»
Sie erreichten die Parkplätze. Er achtete darauf, dass er nur von hinten gefilmt wurde. Sein Wagen stand links von ihrem. Er stellte die Koffer ab, sie schloss den Kofferraum auf. Er öffnete die Heckklappe an seinem Wagen. Sie schwang weit nach oben und verstellte den Blick zwischen der Kamera und dem Sportwagen.
«Vielen Dank für Ihre Hilfe», sagte sie, während sie die Koffer verstaute, «vielleicht kann ich mich mit einem Tee oder einem Glas Wein revanchieren, wenn Sie das nächste Mal Ihre Schwester besuch…»
Der Meister drückte das mit Chloroform getränkte Tuch fest auf Mund und Nase. Sie wehrte sich, trat und schlug gegen den Angreifer. Vergebens.
Er stellte sich auf die Ladefläche und zog sie ins Innere seines Wagens.
2
«Ich musste sie einfach totmachen. Erst dann war ich frei.»
Balthasar Levy schloss die Augen, rief sich die Person in Erinnerung, die als Schlächter von Brunsbek die Medien in den vergangenen Monaten beschäftigt hatte.
Vom kleinen Aufnahmegerät in seiner Hand hörte er den weiteren Verlauf des Interviews, das er in den späten Abendstunden in einem kahlen Raum der Justizvollzugsanstalt geführt hatte.
Er hatte sich diesem Mann vorsichtig genähert; er durfte ihn nicht verschrecken, wollte von Anfang an sein Vertrauen gewinnen. Die Anfrage an den Inhaftierten und an die Vollzugsanstalt hatte Levy schriftlich formulieren müssen, mit dem Hinweis, Personendaten und weitere Details, die auf den Mörder und seine Taten schließen ließen, für seine Forschungsarbeit zu anonymisieren. Sie sollte seine Eintrittskarte für einen Lehrstuhl in Forensischer Psychiatrie an einer Universität werden.
Vom Band hörte Levy seine Frage: «Wieso mussten Sie sie töten? Sie hatten sich doch schon befriedigt.»
Die Bestie in Menschengestalt, die vom äußeren Erscheinungsbild eher einem Schmuseonkel glich – sanfte Augen, winzige Ohren, strubbelige Kurzhaarfrisur, einen Meter siebzig klein, kräftige Hände, ein leicht einfältiges Lächeln–, war gefasst. Er schien von der ihm entgegengebrachten Aufmerksamkeit sogar geschmeichelt.
«Ich kann es im Nachhinein gar nicht richtig beschreiben. Da war ein Drang in mir, ein unbeschreiblich starkes Gefühl, das mich hinaus auf die Straße trieb. Ich fuhr stundenlang herum, konnte jedoch niemanden finden, der meiner Vorstellung entsprach. Ich wollte schon wieder nach Hause fahren. Dann sah ich sie. Auf einem Fahrrad kam sie mir entgegen. Ich erkannte sofort, dass die passte. Ich gab ihr noch eine Chance. Wenn sie in die Seitenstraße abbog, dann würde ich sie verschonen…»
«Doch sie kam Ihnen entgegen. Sie bog nicht ab.»
«Ich wusste, nein, ich spürte sofort, dass er sie mir geschickt hat.»
«Er? Wen meinen Sie damit?»
«Ich darf seinen Namen nicht aussprechen. Aber er steckt in mir, er ist Teil von mir, er ist mein zweites Ich.»
Levy ahnte, von wem er sprach. Der Teufel, der Satan oder der Beelzebub mussten herhalten, wenn das eigene Ich das Problem nicht lösen konnte. Die Verlagerung von Schuld auf eine außenstehende oder, wie in diesem Fall, auf eine innewohnende, übermächtige Person war ein gängiges Zeichen für die Unwilligkeit dieser Menschen, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.
Levy konnte sich einen sarkastischen Unterton nicht verkneifen. Er wusste, dass das unprofessionell war, aber er wollte ihn reizen, mehr zu sagen, sich zu verteidigen. «Und Sie konnten sich nicht gegen ihn erwehren?»
Die Bestie merkte auf. Sie spürte, dass Levy sie nicht ernst nahm. Drohend antwortete sie: «Sie haben keine Ahnung, wie mächtig er ist, wenn er erwacht.»
«Was passiert dann mit Ihnen?»
«Ich werde ausgeschaltet… wie eine Lampe, die man ausknipst. Er übernimmt mich, tut, was ihm gefällt, macht mich zum Werkzeug seiner wahnsinnigen Wünsche.»
«Sie erkennen also, dass Ihre Taten einer kranken Psyche entspringen?»
«Es sind ja nicht meine Wünsche, verstehen Sie? Ich bin völlig gesund, aber er… ich weiß, dass er böse ist und Böses tut.»
«Warum hat er gerade Sie ausgewählt und nicht jemand anderen?»
«Wir kennen uns schon lange, seit ich ein kleiner Junge war, um genau zu sein. Meine Mutter drohte mir mit ihm, wenn ich nicht artig war. Dann würde er mich holen, mitten in der Nacht, wenn ich alleine im Bett lag, während sie unterwegs war. Nur wenn ich ganz still sein würde, dann würde er an meinem Fenster vorbeigehen und zu einem anderen Kind gehen.
Wir lebten damals am Rand eines Waldgebietes, die Bäume wuchsen auf Armeslänge an mein Fenster heran. Und eines Nachts, da konnte ich nicht schlafen, ich setzte mich auf, spähte durch die Gardinen auf den großen Baum vor unserem Haus… und dann sah ich ihn. Er saß im Geäst, seine Augen funkelten mir entgegen, es raschelte. Ich schreckte zurück, verkroch mich unter dem Bett und weinte, aber nur leise, damit er mich nicht hören konnte. Doch es war zu spät. Ich hatte ihn gerufen, er kam zu mir, legte sich in mein Bett und forderte mich auf, zu ihm zu kommen. Ich gehorchte und stellte fest, dass er eigentlich gar nicht so schlimm war. Zumindest fühlte ich mich nicht mehr einsam.»
«Haben Sie Ihrer Mutter davon erzählt?»
«Natürlich nicht. Ich musste ihm mein Wort geben.»
Levy hörte das Rascheln von Papier auf dem Band. Er hatte nach dem Verhörprotokoll gesucht.
«Sie haben ausgesagt, dass Sie am dreiundzwanzigsten Mai um halb elf nachts die fünfundzwanzigjährige Vera K., nachdem Sie sie mit dem Auto von der Straße in ein Waldstück abgedrängt und dort mehrfach vergewaltigt hatten, schließlich mit einem mitgebrachten Hirschfänger verstümmelten. Präzise ausgedrückt, Sie schnitten Ihrem Opfer die Brustwarzen ab und rammten ihm das Messer in den Unterleib…»
«Das stimmt so nicht. Ich habe sie in Besitz genommen.»
«Rammten ihr das Messer in den Unterleib, das Sie dann mehrmals drehten. Wenn die Vergewaltigte auf Grund dieser Verletzungen nicht bereits tot war, dann vollendeten Sie Ihr Werk, indem Sie einen tiefen Halsschnitt setzten, der, mit Kraft geführt, bis auf die Halswirbel vordrang.
Noch einmal meine Frage: Wieso mussten Sie sie töten? Diese Gewalt, die Brutalität… Hätte es nicht gereicht, sie nach der Vergewaltigung einfach liegen zu lassen? Vielleicht hätte sie noch eine Chance gehabt, wenn jemand vorbeigekommen wäre?»
«Er hat es mir befohlen. ‹Erst wenn du sie totmachst, bist du frei›, hat er gesagt. Zuerst habe ich noch dagegen angekämpft, doch ich hatte keine Chance, seine Macht ist viel zu groß. Dann habe ich es getan. Und er hatte Recht. Als ich das Leben aus ihr weichen fühlte, überkam mich ein Hochgefühl, so, als ob ich schwebte… und dann kam ich nochmal. Zuvor hatte ich nur abgespritzt. Das war nichts im Vergleich zu dem, was zum Schluss passierte. Erst als sie tot war, war ich frei, und ich fühlte mich wie neugeboren.»
Nicht eine Miene hatte er verzogen, während er dies sprach. Levy hatte in sein Gesicht geschaut und war erstarrt. Die innerliche Unbewegtheit dieses Mannes spiegelte sich auf dessen Äußerem wider. Keine Spur von Aufgewühltheit, von Scham oder Reue war zu erkennen. Fast mutete sein Ton kalt an, wäre da nicht dieser einfältige Gesichtsausdruck des Schlächters gewesen, der nach dem Fall Vera K. noch fünf weitere Frauen bestialisch tötete. Das waren zumindest die, von denen die Ermittlungsbehörden wussten und die sie mit ihm in Verbindung bringen konnten. In allen Fällen folgte auf die Vergewaltigung die Verstümmelung der Opfer und schließlich der finale Machtbeweis, Herr über Leben und Tod zu sein. Das erregte diesen Menschen, machte ihn Gott gleich. Das war stärker als jede andere Droge – und barg eine hundertprozentige Rückfallquote in sich.
Levy drückte die Stopp-Taste des Aufnahmegerätes und legte es neben das Keyboard. Auf dem Computerbildschirm wartete der Cursor auf die Eingabe der neuen Erkenntnisse, die Levy im Zuge seiner Forschungsarbeit an Serientätern in Deutschland sammelte. Er zögerte.
Fügte sich die zwanghafte Tötung des Opfers als eigentlicher Höhepunkt der Vergewaltigung in das bekannte Profil von Sexualstraftätern nahtlos ein, oder übersah er etwas? Er machte es sich nicht leicht, ging vorsichtig mit den Selbstbeweihräucherungen von Serienstraftätern in den Interviews um, wägte Aussage und Bewertung gegeneinander ab.
Doch für eine klare, zweifelsfreie Diagnose war es mittlerweile zu spät. Er hatte die Nacht durchgearbeitet und spürte, dass seine Konzentration nachließ. Der Morgen kroch zu ihm herauf ins elfte Stockwerk, einem zweihundert Quadratmeter großen Loft. Es war überaus geräumig, wies aber nur die allernotwendigsten Möbel auf. In der Mitte eine Computeranlage. Sie diente ihm als Arbeitsplatz und als Kommunikationskanal zwischen ihm und der Welt draußen. Ansonsten standen im Raum nur noch ein Bett, ein Schrank, ein Tisch und zwei Stühle.
Levy schloss das Programm und schaltete den Rechner in Standby. Er trank das Glas zur Neige. Der Alkohol hatte ihn wach, ruhig und arbeitsfähig gehalten. Jetzt war Feierabend, jetzt brauchte er nur noch ein Bad, um sich von der Gewalt und dem sinnlosen Töten zu reinigen. Das Gefühl, von den Worten und Taten der Serientäter beschmutzt zu sein, ließ sich anders nicht beseitigen.
Während das Wasser einlief, steckte er seine Kleidung in die Waschmaschine und füllte viel Waschmittel ein, das der Kleidung einen frischen, unverbrauchten und vor allen Dingen reinen Duft geben sollte. Als die Maschine in den Hauptwaschgang schaltete und in das monotone, aber beruhigende Drehen verfiel, lag Levy bereits im Wasser und entspannte sich.
Jede Drehung der Trommel entfernte ihn ein Stück mehr von Mord und Totschlag, reinigte Leib und Seele. So wie eine Mutter ihr Kind wäscht, trockenreibt und eincremt, bevor sie es zu Bett bringt.
Doch Levys Mutter war nicht mehr da, genauso wenig wie sein Vater oder seine Geschwister. Er war mit zwölf Jahren Waise geworden. Seine Eltern waren bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Aufgewachsen war er in Internaten, als Mündel eines Rechtsanwaltes. Die Erzieher hatten alles Mögliche versucht, um dem stillen und traurigen Jungen ein Heim und eine Heimat zu bieten. Levy schätzte sie dafür, wenngleich sie es nicht geschafft hatten, ihm die Traurigkeit auszutreiben. Heute waren die Stille und eine allzeit präsente Melancholie seine Wegbegleiter. Er hatte sich mit ihnen arrangiert.
Kurz bevor er sich ausreichend bettschwer fühlte, riss ihn der Computer aus seinem Dahindämmern. Der Bildschirm, den er durch die Badezimmertür von der Badewanne aus sehen konnte, zeigte die Nummer eines Anrufers, den er lange nicht mehr gesprochen hatte. Er kämpfte mit sich, ob er dieser Stimme aus der Vergangenheit folgen sollte.
Seine Neugier gewann die Oberhand. Er stieg aus der Wanne, nahm ein Handtuch und ging hinüber zum Kommunikationsterminal.
«Was willst du?», fragte er, bemüht, den aufkeimenden Widerwillen zu unterdrücken.
Der Anrufer zeigte sich diplomatisch. «Ich würde nicht anrufen, wenn es nicht wichtig wäre.»
Levy setzte sich auf den Stuhl, beugte sich vor, hatte jetzt das Computermikro direkt am Mund. «Du hast nichts, was für mich wichtig ist», flüsterte er.
«Ich denke schon», widersprach der Anrufer.
Levy antwortete nicht, wartete, was noch kommen würde. Als die Pause sich streckte, löste er die Spannung. «Also dann, rede.»
«Er ist wieder da.»
«Wer, er?»
«Unser Mann mit den Eingeweiden.»
Levy horchte auf. «Woher willst du wissen, dass er es ist und nicht ein anderer?»
«Es ist wie früher. Was am Fundort rumliegt, ist identisch mit dem von damals. Außerdem befindet sich der Fundort an einem Flusslauf. Exakt so wie damals.»
Damals war vor zwei Jahren, als Levy und sein ehemaliger Chef Sven Demandt von der Abteilung für Operative Fallanalysen beim Bundeskriminalamt einem Täter nachstellten, der nur die Eingeweide seiner drei Opfer zurückließ. Die Körper waren niemals aufgetaucht.
Levy versuchte vergeblich, diese neue Information herunterzuspielen, wenngleich er wenig Zweifel daran hegte, dass Demandt Recht hatte. Er persönlich hatte Levy ausgebildet, als er zur neu gegründeten Truppe beim BKA gestoßen war. «Vielleicht ist es das Gedärm eines Verunglückten, der in eine Schiffsschraube geraten ist», sagte Levy.
«Red keinen Unsinn», widersprach Demandt scharf. Er ließ sich nicht von einem seiner Schüler maßregeln. «Es passt alles. Unser Mann ist wieder aktiv.»
Levy schloss die Augen. Er wusste, dass er zum Angebot Demandts nicht nein sagen würde. Viel zu tief saß noch immer der Stachel von damals. Die monatelangen Ermittlungen, die aufkommende Nervosität, die sich bis zur offenen Aggression unter Kollegen steigerte, als ein Ermittlungserfolg ausgeblieben war. Schließlich der Alkohol.
Er war ein Wrack geworden, verkroch sich in eine Reha-Klinik, bis er sich vor einem Jahr auf die Füße eines freiberuflichen Fallanalytikers stellte.
«Wer leitet die Ermittlungen?», fragte Levy.
«Michaelis», antwortete Demandt trocken.
Der nächste Schock. Kommissarin Hortensia Michaelis war bereits damals im Team, wenngleich in ausführender und nicht leitender Funktion. Sie war eine der Cassandren, die Demandt vor dem labilen Levy gewarnt hatten. Darüber hinaus besaß sie den fast schon pathologischen Eifer, es zur ersten Kriminalhauptkommissarin des Landes zu bringen. Was sie jetzt offensichtlich geschafft hatte. Dass sie sich die Wiederaufnahme der Ermittlungen nicht entgehen lassen würde, war somit klar.
«Und wer ist von uns… ich meine von euch dabei?», fragte Levy.
«Nur du», lautete die Antwort.
«Kannst du das verantworten?»
«Lass das meine Sorge sein. Zuvor noch eine Frage: Bist du trocken?»
Levy antwortete nicht gleich. Er wägte zwischen Lüge und Wahrheit ab. «Wenn ich an dem Fall dran bin, kannst du dich auf mich verlassen.»
«Dieses Mal könnte es auch meinen Job kosten.»
Levy bekräftigte seine Aussage.
«Gut», sagte Demandt, «dann treffen wir uns in einer Stunde. Ich schick dir einen Wagen vorbei.»
Levy widersprach. «Es ist sechs Uhr morgens. Ich arbeite nicht mehr am Tag, nur noch in der Nacht.»
Demandt blieb hart. «Wenn du das Saufen bezwungen hast, dann kannst du dich auch am Tage wieder sehen lassen. Bis später.» Ohne eine Antwort zuzulassen, legte er auf.
Levy erhob sich, ging zur Fensterfront, die sich über die Länge des Lofts erstreckte. Hamburg erwachte zu neuem Leben, so wie auch er, der nun wieder aus der Anonymität eines Ex-Alkoholikers in das Scheinwerferlicht der Ermittlungsbehörden und der Medien treten würde. Er konnte nicht sagen, ob ihm das gefiel.
Er schenkte sich noch einen ein, kippte ihn in einem Zug hinunter und suchte nach frischer Kleidung.
3
Der Fundort lag in einer Flussbiegung an einer versandeten Stelle, wo abgestorbene Baumwurzeln Treibgut aus den flachen Wellen filterten. Ein verschlissener Plastikkanister hing in einer Kralle fest, schaukelte im Takt des schwachen Wellengangs in einem dreckig braunen Schaumkranz aus Chemikalien. Das Ufer war flach, ging nach wenigen Metern in Büsche und Haselnusssträucher über. Dazwischen mehrere Brandstellen, an denen noch vor einigen Wochen Steaks und Würste gegrillt worden waren. Verkohlte Coladosen und Zigarettenstummel lagen wie vergessenes Fallobst verstreut umher.
Auf der anderen Seite des Flusses ragten Schornsteine einer Fabrik in den verhangenen Morgenhimmel. Ihre Rauchfahnen hingen schwer in der Luft. Kein Windstoß wollte sie mit dem Grau des Morgens und dem Bodennebel vermischen, der in weiten Schlieren dem Flusslauf folgte.
Als Levy sich der Fundstelle vom Parkplatz aus näherte, erkannte er hinter dem Absperrband Demandt im Gespräch mit jemandem. Um sie herum suchten Mitarbeiter der Spurensicherung in weiten, olivgrünen Gummihosen und mit Metallstöcken ausgestattet das Flussufer ab. Andere standen kniehoch im langsam dahinfließenden Wasser. Auch sie suchten nach Spuren, förderten jedoch meist Gegenstände zutage, die vermutlich achtlos in den Fluss geworfen worden waren.
«Sie können nicht ans Ufer», sagte einer der Polizeibeamten in Uniform an der Absperrung.
Demandt drehte sich zu ihnen um, erkannte Levy und wies den Kollegen an, ihn passieren zu lassen. Demandt war in Levys Augen seit dem letzten Treffen deutlich mehr als die seither vergangenen zwei Jahre gealtert. Das graue Haar, das einst nur an den Schläfen zu sehen gewesen war, erstreckte sich mittlerweile über das ganze Haupt. Sein Gesichtsausdruck wirkte müde, gezeichnet von der Zunahme an Arbeit und Verantwortung. Seine Körperhaltung war leicht gebeugt, der Bauchansatz ein eindeutiges Zeichen für ungesunde Ernährung und wenig Bewegung. Das war nicht der Demandt, sportlich, aufrecht und voller Energie, den er in Erinnerung hatte.
Jetzt erkannte Levy auch Michaelis, die ihm bisher den Rücken zugekehrt und auf den weiten Fluss hinausgeschaut hatte. Ihre Erscheinung war völlig anders. Die frühe Morgenstunde und die zwei Jahre Karrierearbeit schienen ihr nicht zugesetzt zu haben. Noch immer blitzten ihre grünen Augen unter dem blonden Pony hervor, so, als gelte es, jede Bedrohung frühzeitig zu erkennen. Sie trug einen bronzefarbenen Hosenanzug, der seidenmatt schimmerte. Kein Gramm schien sie zugenommen zu haben. Sie wirkte in jeder Bewegung trainiert, frisch und voller Einsatzwillen.
In der internen Struktur der Kriminalbehörde musste sich viel getan haben, da sie mit ihren jetzt neununddreißig Jahren als einzige Kriminalhauptkommissarin des Landes eigentlich zu jung war, und eine Frau zu sein, half auch nicht beim Aufstieg. So klar und bestimmt ihre äußere Erscheinung war, so schnörkellos und direkt waren ihre Umgangsformen geblieben. Levy fragte sich, wie sie es trotz ihrer Ruppigkeit geschafft hatte, auf der Karriereleiter so weit nach oben zu steigen. Zweifellos hatte sie Fähigkeiten – die hatte sie bereits damals unter Beweis gestellt–, doch wie konnte man auf Dauer ihren mürrischen Ton ertragen?
Sie musste nichts sagen, um ihre Haltung ihm gegenüber zu offenbaren, ein Blick genügte. Und der, der Levy auf den paar Metern zu ihr traf, drückte eine klare Protesthaltung aus.
«Hallo Balthasar», begrüßte ihn Demandt, schüttelte ihm die Hand. «Schön, dass du gekommen bist.»
Levy nickte, versuchte ein Lächeln, das Bereitschaft signalisieren sollte. Er reichte Michaelis die Hand. Sie hatte die Arme verschränkt und machte keine Anstalten, sich zu bewegen. Stattdessen wandte sie sich Demandt zu.
«Ich halte es für unverantwortlich, diesen Mann in die Ermittlungen einzubeziehen. Er hat schon einmal bewiesen, dass er dem Druck nicht standhält.»
Levy ließ den Vorwurf über sich ergehen. Natürlich hatte er gewusst, dass sein Wiederauftauchen von ihr nicht freudestrahlend aufgenommen würde. Er wartete die nächste Reaktion ab. Wie erhofft, kam die Gegenrede von Demandt.
«Levy ist der richtige Mann für diesen Fall. Er kennt alle Details der bisherigen Ermittlungen, schließlich war er Mitglied des Teams von damals.»
Michaelis unterbrach. «Das war ich auch, und deswegen weiß ich, wovon ich spreche.» Ihre Augen funkelten Levy an. «Er ist ein unkalkulierbares Risiko. Ich werde das nicht akzeptieren.»
Demandt reagierte auf den Ausbruch nicht.
Ein Mann im weißen Overall trat zu ihnen. «Ich bin so weit fertig», sagte er, «wenn sonst nichts mehr ist, dann fahre ich in die Rechtsmedizin zurück.»
Demandt wandte sich dem Mann im Overall zu und wies auf Levy. «Das ist Balthasar Levy. Er wird das Team im Bereich der Fallanalytik unterstützen.» Dann zu Levy gewandt: «Dragan Milanovic, unser Gerichtsmediziner.»
Sie schüttelten sich die Hand.
«Freut mich», sagte Dragan.
«So ein Irrsinn», protestierte Michaelis, die sich mit der Entscheidung nicht zufrieden geben wollte.
«Es bleibt dabei», konterte Demandt, «Sie haben das BKA und damit mich um Amtshilfe gebeten. Levy ist der Mann für diesen Fall.»
«Nun gut», sagte sie, «dann auf Ihre Verantwortung.»
Michaelis würde an höherer Stelle ihren Protest zum Ausdruck bringen, da war sich Levy sicher. Sie drehte sich um, ging die paar Schritte zum Ufer, rief die Spurensicherer auf, ihre Arbeit, so weit vertretbar, zu vollenden und einzupacken.
Demandt gab Levy in die Hände Dragans. «Zeigen Sie ihm bitte den Fund. Danach können Sie fahren. Alles Weitere erfahren wir aus Ihrem Bericht.»
«Selbstverständlich», antwortete Dragan und wies Levy den Weg zu einem weißen Kombi, der an der Böschung geparkt war.
«Gehen Sie schon einmal vor», sagte Levy, «ich komme gleich nach.»
Dragan nickte und stapfte durch das Gebüsch zurück.
Levy wandte sich an Demandt, dem die Verärgerung über den Disput ins Gesicht geschrieben stand, oder sah er dort sogar Besorgnis? «Du gehst ein hohes Risiko mit mir ein», sagte Levy. «Warum?»
«Ich meine, was ich über dich gesagt habe. Du bist der beste Mann für diesen Fall.»
«Aber ich habe damals versagt.»
«Willkommen im Klub.»
«Was macht dich so sicher, dass ich dieses Mal nicht scheitere?»
Demandt seufzte. «Der eigentliche Grund ist schlicht: Alle meine Leute sind anderweitig eingesetzt. In diesem Fall muss ich auf einen Freien zurückgreifen. Und da bist du die beste Wahl. Das ist das ganze Geheimnis. Wir sehen uns dann später.» Demandt ging Richtung Parkplatz.
Levy schaute ihm noch eine Weile nach, dann ging er zu Dragan. Die Heckklappe des Kombis stand offen.
«Es ist kein schöner Anblick», sagte Dragan und nahm den Deckel von einer Wanne ab.
«Schon gut», antwortete Levy. «Ich sehe so etwas nicht zum ersten Mal.»
Was sich den beiden zeigte, mutete seltsam indifferent an. Am ehesten konnte man diese blass-grünliche Masse, die in trübem Flusswasser lag, als die abenteuerliche Mutation eines Tiefseerochens bezeichnen. Doch sie war eindeutig menschlicher Natur.
Dragan zog sich Handschuhe an, griff ins Wasser und hob den rund vierzig Zentimeter langen Atmungstrakt heraus. An ihm hingen von der Spitze nach unten sauber aufgereiht die vollständige Zunge, danach der Kehlkopf, die Luft- und Speiseröhre, die beiden Lungenflügel und schließlich der Brustteil der Aorta.
«Ich schätze, das lag rund vier Tage im Wasser», sagte Dragan. Mit einer Hand zeigte er auf die schlaffen Lungenflügel, die unterschiedlich groß und stellenweise perforiert waren. «Fischfraß.»
Doch Levy interessierte sich mehr für die Schnittränder, für diejenigen Stellen, an denen der Täter die Atmungsorgane vom Körper abgetrennt hatte.
«Suchen Sie nach etwas Bestimmtem?», fragte Dragan.
Levy schaute sich die betreffenden Stellen genauer an. «Unser Mann hat dazugelernt. Damals waren die Ränder fransig geschnitten. Das hier ist weitaus fachmännischer gelöst.»
Dragan pflichtete ihm bei. «Ein Anfänger hätte wahrscheinlich ein Skalpell benutzt. Das wäre in ein Gestochere ausgeartet. Ein scharfes Messer und eine sichere Hand haben diese sauberen Absetzungsränder bewirkt.»
«Richtig. Aus dem Lehrling ist ein Meister geworden.»
4
Balthasar Levy war nicht der Typ, der sich vor menschlichen Überresten, wie immer sie auch aussahen oder rochen, ekelte.
Selbst eine grün-blasse schleimige Masse wie die, die sich vor ihm auf dem stählernen Obduktionstisch befand, konnte Hinweise auf das Opfer, im besten Falle auf den Täter in sich tragen. Eine niedrige Übelkeitsschwelle oder übertriebene ästhetische Vorstellungen waren eindeutig am falschen Platz. Es galt, diesem Klumpen Organ sein letztes Geheimnis zu entlocken.
Insofern bestand Einigkeit zwischen Levy, Dragan Milanovic, dem Rechtsmediziner, und der Kriminalhauptkommissarin und Leiterin der Ermittlungen, Hortensia Michaelis. Zu dritt standen sie um den Obduktionstisch herum und suchten, jeder auf seine Art, nach Anhaltspunkten zur Identifizierung des Opfers. Doch was konnte man aus diesen Innereien überhaupt erschließen?
Normalerweise wurden Leichen in mehr oder weniger ganzen Stücken in die Rechtsmedizin überstellt. Anhand des Körpers konnte man sehen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Des Weiteren gab es zumeist eindeutige Hinweise auf die Todesursache und auf den Todeszeitpunkt. Auch das Alter konnte durch eine äußere Inaugenscheinnahme taxiert werden. Zahnstatus und Fingerabdrücke waren weitere konkrete Sachverhalte, mit denen die Ermittlungsbehörden arbeiten konnten.
Doch all das fehlte hier. Levy und Michaelis sahen sich der elementaren Grundinformationen beraubt, um in gewohnter Weise die Ermittlung einleiten zu können.
Die ersten Fäulnisveränderungen am Atmungstrakt hatten zwar schon eingesetzt, aber die einzelnen Organe waren noch gut zu erkennen – die Zunge, die Gaumenmandeln und der Kehlkopf, Luft- und Speiseröhre im knorpeligen Mantel und die Gabelung der Bronchien, die in die beiden Lungenflügel führte. Was fehlte, war das Herz. Es war aus der schützenden Ummantelung zwischen den Lungenflügeln herausgeschnitten worden.
Nachdem Dragan den Atmungstrakt vermessen und fotografiert hatte, begann er mit der äußeren Begutachtung. Er beugte sich über den Obduktionstisch, führte die Hängelampe nahe an die Zunge heran und hob sie mit der Pinzette an.
«Die Zunge ist sauber vom Mundboden abgesetzt worden», sagte er in ruhigem, professionellem Ton. Eine gewisse Anerkennung schwang in seiner Stimme mit.
Michaelis, sichtlich an einer schnellen Abwicklung der Untersuchung interessiert, unterbrach ihn. «Und was sagt uns das?»
An Dragans statt antwortete Levy. «Es ist ein erster Hinweis darauf, dass ein Anfänger sich wahrscheinlich nicht so viel Mühe gegeben und die vordere Zungenhälfte zurückgelassen hätte. Der Vorgang des Herausschneidens ist technisch anspruchsvoll, da man vom Hals her versucht, die Zungengrundmuskulatur komplett zu durchtrennen. Der Anfänger würde die Zunge etwa in der Mitte quer durchschneiden, weil er mit dem Messer nicht weit genug hineinkommt.»
Die Michaelis ging nicht darauf ein, blickte Levy kurz in die Augen und signalisierte damit, dass sie auf seinen Beitrag keinen Wert legte.
Levy nahm es zur Kenntnis. Was konnte sie ihm schon anhaben? Er war von seinem ehemaligen Gruppenleiter Demandt offiziell für diesen Fall eingesetzt worden. Da konnte sich die Michaelis drehen und wenden, wie sie mochte. Wenn etwas im Zuge dieser Ermittlung schief ging, konnte er zumindest für sich in Anspruch nehmen, dass er eine Grundbereitschaft zur Kooperation besaß. Das konnte man von ihr nicht behaupten.
Dennoch blieb er wachsam. Wenn sie es innerhalb der kurzen Zeit zur Ermittlungsleiterin gebracht hatte, dann musste sie gute Kontakte nach oben haben und unter Umständen, so wie er auch, einen Mentor.
Nichtsdestotrotz musste ihre Qualifizierung für den Job über jeden Zweifel erhaben sein. Weitaus mehr als eine Hand voll männlicher Kollegen hatte sie wahrscheinlich übertroffen, um es zu dieser anspruchsvollen Position gebracht zu haben. Das machte sie bestimmt nicht zu everybodys darling. Im Gegenteil, sie musste unter ständiger Beobachtung stehen. Jeder, der es auf ihren Job abgesehen hatte, würde jeden Fehler registrieren und ihn weiterleiten. Michaelis war sich darüber bestimmt im Klaren. Aus dieser Sicht betrachtet, war ihr Verhalten für Levy verständlich.
Dragan schien die Spannung zwischen den beiden wahrzunehmen, ließ sich aber nicht weiter davon beeindrucken. Er nahm das Lungenpaket in beide Hände und wendete es. «Die Aorta ist auf Höhe des Zwerchfells abgesetzt.»
Wieder mischte sich Michaelis ein. «Lassen Sie mich raten: Die Schnittränder sind sauber abgesetzt, wie Sie es ausdrücken.»
«Richtig», antwortete Dragan. «Und dass es sich keinesfalls um einen Anfänger handelt, sehen Sie hier.»
Er zeigte auf die Schnittstellen der Halsarterien. «Sie sind oberhalb der Teilungsstelle in innere und äußere Kopfschlagader abgetrennt. Genau so, wie ich es auch machen würde. Ein Anfänger schneidet gerne unterhalb dieser Stelle, weil es für ihn schwierig ist, am Hals so weit nach oben zu kommen. Zudem wären die beiden Schnittstellen nicht seitensymmetrisch.
Unser Mann scheint jedoch zu lieben, was er tut, so sauber und präzise, wie er vorgeht. Entweder hat er viel geübt, oder er hat bei einem Spezialisten gelernt.»
Michaelis vermied eine weitere Zwischenfrage. Die von Dragan aufgestellte Hypothese, dass es sich bei dem Täter um einen Mediziner, zumindest aber um eine Person handeln musste, die eindeutig anatomische Kenntnisse besaß, war vorerst ein erster Anhaltspunkt für die weitere Ermittlungsarbeit. Doch das war eindeutig zu wenig. Damit sie auf der anschließenden Gruppenbesprechung den ganzen Apparat in Bewegung setzen konnte, musste eine weitere Eingrenzung auf das Täterumfeld stattfinden.
Levy gingen ähnliche Gedanken durch den Kopf. Zwar hatte auch er keinen Tatort und damit keine eindeutige Auffindesituation einer Leiche, doch erhoffte er sich durch die Autopsie weitere Anhaltspunkte zum Opfer, um damit auf den Täter schließen zu können.
Dragan unterbrach Levy und Michaelis in ihren Gedanken mit einer neuen Erkenntnis. «Jetzt wird es interessant.» Er zeigte auf die rechte Lungenhälfte. «Der mittlere Lungenlappen fehlt.»
Levy überlegte, was diese Information bedeutete. So auch die Michaelis, allerdings blieb sie still.
Dragan klärte die beiden auf. «Die menschliche Lunge verfügt insgesamt über fünf so genannte Lungenlappen. Zwei auf dem linken und drei auf dem rechten Lungenflügel. Da einer fehlt, ist er chirurgisch entfernt worden. Medizinisch ausgedrückt: eine Lobektomie.»
«Und was kann die Ursache für den Eingriff gewesen sein?», fragte Levy.
«Einen Moment», antwortete Dragan. Er führte die Lampe nahe an die rechte obere Lungenspitze heran. Dann nahm er das Skalpell und trennte den rechten Lungenflügel vom Bronchienast ab. Aus der bereitstehenden Stahlschale wählte er ein langes, flaches Messer mit einer dünnen Klinge: das Hirnmesser. Es hatte Ähnlichkeit mit einem Tapeziermesser. Er setzte es in der Mitte des Lungenflügels an und führte einen horizontalen Schnitt, sodass er am Ende den einen Flügel in zwei Hälften aufklappen konnte.
Was sich ihm offenbarte, erhob seine Vermutung zum Sachverhalt. Er zeigte auf die Lungenspitze, wo sich grauweiße Vernarbungen im Gewebe zeigten.
«Das sind Spuren einer Tuberkulose», sagte Dragan. «Und dort», er wies auf einen kirschgroßen, umkapselten Hohlraum einige Zentimeter darunter, «ist eine Kaverne. Die Krankheit hat Lungengewebe eingeschmolzen und diesen Hohlraum hinterlassen. Vorsicht, die TBC-Bakterien können noch intakt sein.»
«Können Sie feststellen», fragte Levy, «wie lange die Krankheit zurückliegt?»
«Nicht anhand der Vernarbungen. Aber in Kombination mit der Entfernung des mittleren Lungenlappens wegen der TBC-Erkrankung kann man auf die frühen siebziger Jahre schließen. Später wurden Lobektomien nur noch selten durchgeführt.»
«Das bedeutet», schloss Michaelis, «dass unser Kandidat mindestens dreißig bis fünfunddreißig Jahre alt sein sollte.»
«Richtig», bestätigte Dragan.
«Können wir die Altersgrenze nach oben hin bestimmen?», hakte Levy nach.
«Ich müsste mir mal die großen Gefäße, die Aorta und die Schlagadern vornehmen», antwortete Dragan. «Vielleicht gibt es dort etwaige Ablagerungen.»
«Geht das jetzt noch auf die Schnelle?», fragte Michaelis, «die Gruppenbesprechung beginnt in einer Viertelstunde.»
Wortlos nahm Dragan eine Schere zur Hand und schnitt die großen Blut führenden Gefäße auf. Er wurde fündig. «Sehen Sie diese gelblichen, arteriosklerotischen Innenwandbeete? Das sind Einlagerungen, aber noch ohne Verkalkung.»
«Das heißt?», fragte Levy.
«Dass wir die obere Grenze bei der Altersbestimmung auf zirka sechzig Jahre setzen können», antwortete Dragan, «sofern keine Stoffwechselerkrankung vorlag.»
Michaelis fasste zusammen. «Unser Kandidat oder unsere Kandidatin ist also zwischen vierzig und sechzig Jahre alt und wurde bis spätestens Anfang der siebziger Jahre wegen einer Tuberkuloseerkrankung an der Lunge operiert. Ist das alles?»
Dragan nickte und nahm seine Notizen zur Hand, die er sich im Laufe der Untersuchung gemacht hatte. «Mit sehr viel Vorsicht würde ich mich bei der Geschlechterbestimmung auf männlich festlegen.»
«Wegen der Größe des Atmungstraktes?», fragte Levy.
«Ja», antwortete Dragan. «Nach meinen Schätzungen ergibt sich eine Körpergröße von rund einem Meter neunzig. Das ist für einen Mann nichts Außergewöhnliches.»
«Für eine Frau aber schon», pflichtete Michaelis ihm bei.
«Sofern ich bei der Untersuchung der anderen Teile keine abweichenden Erkenntnisse erhalte, bleibt es erst mal dabei.»
«Gut», beschied Michaelis. «Ach ja, noch etwas: Wir brauchen eine DNA-Analyse. Ihren Bericht habe ich dann bis morgen früh auf meinem Schreibtisch.»
Dragan nickte und wandte sich erneut dem Obduktionstisch zu.
Michaelis drehte sich um und ging Richtung Tür, ohne Levy ein Zeichen zu geben.
Levy folgte ihr.
5
Die Fahrt in den sechsten Stock verlief wortlos. Levy und Michaelis standen Schulter an Schulter, starrten auf die stählerne Tür vor ihnen und erwarteten die Ankunft. Kurz bevor der Fahrstuhl sich auf dem Stock einpendelte, drang es doch noch aus ihr heraus. Sie schaute dabei aber weiter geradeaus.
«Hören Sie, Levy. Ich habe wahrlich nicht darum gebeten, mit Ihnen ein weiteres Mal arbeiten zu müssen. Ich habe mich auch an entsprechender Stelle dazu geäußert. Doch wie es aussieht, haben Sie Glück. Mein Chef und Demandt sehen keine andere Lösung. Dementsprechend sind Sie meinem Team zugeteilt, ob mir das passt oder nicht. Ich erwarte von Ihnen vollen Einsatz, egal welche Schwierigkeiten Sie mit Ihrem Leben haben. Das geht mich nichts an, interessiert mich auch nicht, soweit es nicht meine Arbeit behindert.
Ob das Argument des Personalmangels jedoch für Ihre Kompetenz spricht, wage ich zu bezweifeln. Wenn es nach mir ginge, wären Sie schneller draußen, als Sie reingekommen sind. Seien Sie sich über Folgendes im Klaren: Der erste Fehler kostet Ihren Kopf. Tun Sie mir einen Gefallen: Warten Sie nicht damit.»
Die Tür öffnete sich. Levy ließ ihr den Vortritt. «Ich weiß nicht, ob ich Ihnen den Gefallen tun kann, Frau Michaelis.»
Das Großraumbüro war voll gepackt mit Technologie. Ringsum an den Wänden und an den Stützpfeilern hingen Plasmabildschirme, sodass man von jeder Position aus gut sehen konnte. Sie zeigten eine Videokonferenz, die aus Wien übertragen wurde. Levy kannte das Gesicht auf dem Bildschirm sehr gut. Es war Müller, den er in seinen Ausbildungsjahren mehrfach getroffen hatte. Müller schien ihn zu erkennen, als Levy an der kleinen Kamera eines Notebooks vorüberging.
Schreibtische, sechs an der Zahl, waren bestückt mit Notebooks, Scannern und diversen Ein- und Ausgabegeräten.
An der Stirnwand an prominenter Stelle stand der Schreibtisch der Michaelis. In Levys Augen ließ sie sich übertrieben angespannt in den Ledersessel fallen, um gleich darauf fordernd den Blick auf ihre Mitarbeiter zu richten. In Kreisformation gruppierten sich die Tische um den ihren herum. Wie der Kreis der Arbeiter um die Königin, dachte Levy. Ein Tisch genau ihr gegenüber war frei. Ein Wink von ihr wies ihn an, dort Platz zu nehmen.
«Meine Damen und Herren», begann sie, «unser Team ist komplett. Darf ich vorstellen: Balthasar Levy, Fallanalytiker, vormals in Diensten des BKA, heute freischaffend tätig. Habe ich das richtig ausgedrückt?»
Levy entging der Sarkasmus in ihrer Stimme nicht. Er bestätigte mit einem Nicken.
«Er wird uns im Bereich der Operativen Fallanalyse unterstützen. Seine Aufgabe wird es sein, uns zu einem Täterprofil zu verhelfen, mit dem wir unseren Mann fassen werden. Herr Levy wird anschließend dazu ein paar Worte sagen, denn unser Mann ist nicht erst seit heute Morgen tätig. Es gibt zu ihm eine interessante Vorgeschichte.»
Ihre Stimme klang unnötig süffisant.
«Doch zuvor darf ich Ihnen das Team vorstellen…»
Michaelis begann mit einem Mann zu ihrer Rechten, einem Afrikaner, in den Vierzigern, kurzes, gekräuseltes Haar, erste graue Flecken, mit wachen Augen und einem wohlmeinenden Lächeln im Gesicht.
«Dr.Luansi Benguela wird die Fäden in unserer Ermittlungsarbeit zusammenführen. An ihm geht keine Nachricht vorbei. Er berichtet direkt an mich. Wenn Sie versäumen, ihm etwas mitzuteilen, unterschlagen Sie mir damit die Nachricht.» Er nickte Levy freundlich zu.
Der Schreibtisch neben Benguela war besetzt mit einem jungen Mann. Vielleicht zu jung für diese Gruppe, dachte Levy. Er würde ihn nicht älter als zwanzig Jahre schätzen. Eine blonde Strähne hing ihm quer über die Stirn, vor ihm das Notebook, an dem er während der Vorstellung konzentriert arbeitete.
«Unser Computer- und Kommunikationsspezialist Alexej Naumov», fuhr Michaelis fort. «Wenn Sie eine Information brauchen, dann ist er Ihr Mann. Und ich meine jegliche Art von Information, die sich auf elektronischem Weg beschaffen lässt.»
Alexej hob kurz den Kopf, blickte Levy aus wasserblauen Augen an, ohne eine Miene zu verziehen.
«Zu meiner Linken sitzt Kriminaloberkommissarin Naima Hassiri», eine schwarzhaarig gelockte Araberin mit dunkelbraunen Augen. Sie war Ende zwanzig, vielleicht Anfang dreißig, auf jeden Fall ungewöhnlich attraktiv für eine Polizistin. Levy konnte es sich nicht verkneifen, die Vorstellung mit einer Zwischenfrage an sie zu unterbrechen.
«Libanesin oder Iranerin?»
«Deutsche», antwortete sie bestimmt. Dann weniger ernst: «Aber gut geraten. Mein Vater ist Libanese.»
«Naima Hassiri ist von der Kripo Berlin zu uns gestoßen. Dort ist sie Spezialistin für Ausländerkriminalität. Darüber hinaus ist sie eine der besten Ermittlerinnen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe.»
Als Letzter kam ein Mann an die Reihe, den Levy als den typischen Vertreter eines perfekten Schwiegersohns einschätzte.
«Inspektor Falk Gudman ist bei den deutschen Ermittlungsbehörden zu Gast. Er ist im Zuge des Austauschprogrammes zwischen Israel und Deutschland von der Kripo in Tel Aviv zu uns gestoßen. Wie man mir berichtete, soll er ein Fachmann für Vernehmungen und Befragungen sein. Sein Hobby sind, wie er mir verriet, Dialekte. Deutsche wie jiddische. Stimmt das so?»
Falk antwortete mit überraschender Dialektfärbung. «Des isch korrekt.»
Schmunzeln machte sich breit. Doch in seinen Augen erkannte Levy plötzlich Berechnung. Dieser Engel war alles andere als ein netter Mann von nebenan. Dieser Mann wusste zu manipulieren.
Nachdem Michaelis der Vorstellungspflicht nachgekommen war, gab sie das Wort an Levy.
«Begonnen hat alles mit einer menschlichen Niere vor rund zwei Jahren», berichtete Levy. «Gefunden hatte sie ein Kanufahrer, der sein Boot zu Wasser lassen wollte. Die Niere hatte er als solche erst gar nicht erkannt, wie es jeder durchschnittliche Mensch auch nicht tun würde. Doch in diesem Fall handelte es sich um einen Medizinstudenten, kurz vor dem Physikum. Er fischte die Niere mit einem Paddel aus dem Ufergebüsch und benachrichtigte die Polizei.
Die Kollegen riefen nach zwei Wochen das BKA zu Hilfe, als erneut ein menschliches Organ zum Vorschein kam und die bisherigen Ermittlungen nichts erbracht hatten. Dieses Mal handelte es sich um zirka zwei Meter Darm, die sich an einem Brückenpfeiler, rund zwei Kilometer flussaufwärts, verhakt hatten. Ein DNA-Vergleich zwischen den beiden Funden ergab, dass sie von zwei verschiedenen Menschen stammten. Die Identitäten konnten nicht ermittelt werden.
Ein weiterer Fund wenige Tage danach, ein Stück Gehirnmasse, brachte die erste Spur. Die vierzehnjährige Tatjana war im selben Zeitraum von einem Fahrradausflug in das nächste Dorf nicht nach Hause zurückgekehrt.
Ein Abgleich zwischen dem letzten Fund und einer Haarprobe von ihr war positiv. Wir ermittelten im Verwandtschafts- und Freundeskreis nach Auffälligkeiten. Ohne Ergebnis.
Wir kamen zu dem Schluss, dass ihr unbekannter Mörder sie auf dem Fahrradweg abgepasst und verschleppt haben musste. In der Umgebung waren nach tagelangen Suchaktionen keine Hinweise auf den Ereignisort eingegangen. Auch ihr Fahrrad blieb verschwunden.
Leider handelte sich bei Tatjana um die Tochter eines Abgeordneten des Landtages. Er wusste, an welchen Strippen er zu ziehen hatte, um uns das Leben schwer zu machen…»
Die Michaelis unterbrach, wohl weil Levy ihrer Meinung nach die Schuld an den fruchtlosen Ermittlungen auf jemand anderes abwälzen wollte. «Herr Levy, bleiben Sie sachlich. Fakt ist, dass unter Ihrer Leitung als Fallanalytiker des BKA die Ermittlungen nicht vorwärts kamen.»
«Das stimmt so nicht», widersprach Levy.
Der Unmut begann ihn zu kitzeln. Sie würde den Finger in seine Wunde legen und nicht davon ablassen, bis sie hatte, was sie wollte.
«Nun», fuhr er fort, «die Lage wurde zunehmend kritischer, wir standen unter erheblichem Druck…»