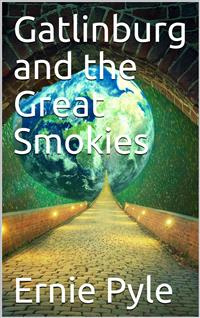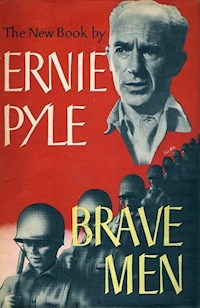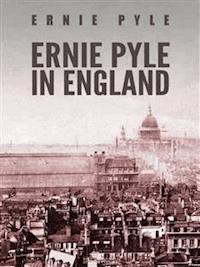8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine wunderbare, 1944 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Hommage an die amerikanischen Truppen im Zweiten Weltkrieg ist dieser Bericht über den Feldzug der Soldaten in Nordafrika. Mit unvergleichlicher Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen erzählt Pyle, wie Menschen aus allen Teilen Amerikas lernten, einen Krieg zu führen, den keiner wollte. Der Feldzug der Alliierten und der endgültige Sieg in Nordafrika war eine Mischung aus mutigen Taten, Opfern und unnötigen Verlusten, exotischen Aussichten, Ausdauer, Heimweh und dem unverwechselbaren amerikanischen Sinn für Humor. Pyle berichtet über die spannende Landung in Oran, die täglichen Risiken der Jagd- und Bomberpiloten, die erbittertenKämpfe in der Wüste und in den Bergen Tunesiens, eine grausame Panzerschlacht, die für die unerfahrenen Amerikaner mit einer Niederlage endete, und den endgültigen Sieg in Tunis. Oder, wie Präsidentengattin Eleanor Roosevelt es ausdrückte: "Jedem, der noch nie an einer Front gedient hat, vermittelt dieses Werk ein lebhaftes Bild vom Krieg."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Da habt ihr euren Krieg
Deutsche Neuübersetzung
ERNIE PYLE
Da habt ihr euren Krieg, E. Pyle
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849663506
www.jazzybee-verlag.de
Inhalt:
KAPITEL 1. DER KONVOI NACH AFRIKA.. 1
KAPITEL 2. DIE AMERIKANER SIND GELANDET.. 18
KAPITEL 3. DAS NICHT ALLZU DUNKLE AFRIKA.. 40
KAPITEL 4. DAS POLITISCHE BILD IM DEZEMBER 1942. 61
KAPITEL 5. AUF DEM LAND... 68
KAPITEL 6. AN DER MEDIZINISCHEN FRONT.. 85
KAPITEL 7. WENDUNGEN UND BEGEGNUNGEN... 102
KAPITEL 8. IN DER LUFT.. 116
KAPITEL 9. JEDER SOLDAT GEHT ANDERS DAMIT UM... 158
KAPITEL 10. KUGELN, BOMBEN UND GRANATEN.. 182
KAPITEL 11. STREIFLICHTER.. 216
KAPITEL 12. WÜSTENEINSATZ.. 229
KAPITEL 13. DIE FRANZÖSISCHE FREMDENLEGION.. 245
KAPITEL 14. REPORTER UNTERWEGS. 255
KAPITEL 15. DAS ENDE IN SICHT.. 270
KAPITEL 16. DER ENTSCHEIDENDE VORSTOß. 293
KAPITEL 17. SIEG... 326
KAPITEL 18. WAS AFRIKA FÜR UNS BEDEUTETE.. 352
KAPITEL 1. DER KONVOI NACH AFRIKA
Eine Reise mit einem Truppenkonvoi ist eine bemerkenswerte Erfahrung. Jedenfalls für mich, denn ich bin auf diese Weise nach Afrika gekommen.
Es gibt drei Arten von Konvois: langsame Verbände, die aus Nachschub transportierenden Frachtern bestehen, mittelschnelle Truppentransporte, die mit schwerem Marinegeleit fahren; und kleine Konvois aus schnellen Ozeandampfern, die große Mengen Soldaten und Material transportieren und deren Sicherheit hauptsächlich von ihrer Geschwindigkeit abhängt. Unser Konvoi von England nach Afrika gehörte zum zweiten Typ. Wir waren ziemlich schnell unterwegs, hatten eine enorme Anzahl von Truppen an Bord und verfügten über eine starke Eskorte –– aber egal, wie viele Begleitschiffe es gibt, es scheinen nie genug zu sein. Die Schiffe, aus denen unser Konvoi bestand, waren sowohl britische als auch amerikanische, aber die militärische Eskorte bestand ausschließlich aus Kriegsschiffen der Royal Navy.
An einem Tag spät im Oktober erhielt ich gegen Mittag die Nachricht, dass wir London in der kommenden Nacht verlassen würden. Es gab noch eine Menge Dinge, die in letzter Minute erledigt werden mussten. So hatte ich erst am Morgen meine Wäsche weggeschickt, und es bestand keine Hoffnung, diese pünktlich zurückzubekommen. Also musste ich in aller Eile zusätzliche Socken und Unterwäsche kaufen. Die Armee wollte um 14:00 Uhr meinen Schlafsack abholen, um ihn für die äußerst geheimnisvollen Konvoi-Etikettierungen irgendwohin zu bringen.
Alles andere musste ich in eine Segeltuchtasche und meinen Proviantbeutel packen. Vier Freunde kamen vorbei und aßen ein letztes Mal mit mir zu Abend. Beim Abschied zog ich zum ersten Mal meine Armeeuniform an und verabschiedete mich für Gott weiß wie lange von der Zivilkleidung. Mein alter brauner Anzug, mein schmutziger Hut, meine Briefe –– all die kleinen persönlichen Dinge kamen in einen Koffer, der in London bleiben würde. Vermutlich würde ich sie nie wieder sehen. In der Uniform fühlte ich mich verlegen, lächerlich und alt.
Dann wurde es Nacht. Ich nahm ein Taxi zum vereinbarten Treffpunkt, wo andere Reporter bereits warteten. Militärangehörige kassierten unsere britischen Papiere ein, damit diese sicher aufbewahrt werden konnten. Anschließend wurden wir aufgefordert, unsere Pressearmbänder abzunehmen, denn diese könnten lauernden Spionen, falls es welche gab, preisgeben, dass wir Teil eines Konvois waren. Dann holte uns ein Armeefahrzeug ab und fuhr uns quer durch das verdunkelte London. Ich hatte keine Ahnung mehr, wo wir waren. Schließlich hielten wir an einem wenig genutzten Vorortbahnhof, wo man uns mitteilte, dass wir zwei Stunden warten müssten, bis der Truppenzug käme. Also liefen wir auf dem Bahnsteig umher und versuchten, uns warm zu halten. Es war sehr dunkel, und irgendwann dachte ich, der Zug würde nie mehr kommen. Als es aber dann doch so weit war, drängten wir uns in zwei Abteile, wo ich sofort einschlief.
Wir saßen die ganze Nacht im Zug und schliefen hin und wieder –– aber nicht viel, weil es zu kalt war. Wir hatten keine Ahnung, in welchen Hafen wir fahren würden, aber unterwegs verriet uns jemand das Ziel unserer Fahrt. Wir waren alle überrascht, und einige der Jungs hatten noch nie von diesem Ort gehört.
Kurz nach Tagesanbruch hielt unser Zug neben einem riesigen Schiff. Wir meldeten uns in einem kleinen Militärbüro im Pierschuppen, nahmen dort unser Gepäck auf und begaben uns an Bord. Wir wirkten schmuddelig, uns war kalt, aber wir waren alle sehr neugierig. Unsere Gruppe bekam zwei Kabinen zugewiesen, in denen jeweils vier Männer untergebracht wurden. Die Unterkünfte waren schön, besser als jeder von uns erwartet hatte, und sahen fast aus wie in Friedenszeiten –– abgesehen von einer zusätzlichen Koje über jedem Bett. Viele Offiziere bewohnten Kabinen, die weitaus beengter waren als unsere.
Wir hatten alle erwartet, dass wir kurz nach der Einschiffung in See stechen würden, hatten bei dieser Überlegung aber vergessen, dass das Schiff erst beladen werden musste. In Wirklichkeit fuhren wir erst achtundvierzig Stunden später los. Während dieser Zeit hielten immer wieder lange Truppenzüge neben dem Schiff und entluden ihre menschliche Fracht. Die Zeit verging quälend langsam. Wir standen an der Reling und sahen zu, wie die Soldaten an Bord marschierten. Sie liefen schwer beladen durch den Regen, mit Stahlhelmen auf dem Kopf, in schweren Mänteln und mit Gewehren und riesigen Rucksäcken auf dem Rücken. Es war ein aufregender und in gewisser Weise auch ein trauriger Anblick, sie in endloser Zahl die steile Gangway hinauf marschieren zu sehen, um von dem großen Dampfer verschluckt zu werden.
Die meisten schritten schweigend dahin. Hin und wieder erblickte jemand einen Bekannten an der Reling und es gab einen kurzen Aufschrei. Für Männer, die in den Krieg zogen, trugen die Soldaten seltsame Dinge an Bord. Einige hatten Bücher in der Hand, andere waren mit Geigen- oder Banjokoffern beladen. Ein Mann führte einen großen schwarzen Hund. Und einer, so fand ich später heraus, hatte zwei Welpen unter seinem Hemd versteckt. Wie der spartanische Junge in der Geschichte wurde er fast zu Tode gekratzt, aber er hatte 32 Dollar für die Tiere bezahlt und liebte sie über alles.
Die Briten (unser Schiff war ein britisches) sind pingelig, wenn es um die Mitnahme von Hunden auf Truppentransporten geht. Die Offiziere befahlen, alle Hunde abzugeben, sagten, man würde sie an Land bringen, und versprachen, dass man ein gutes Zuhause für sie finden würde. Irgendwie aber verschwanden die Tiere und wurden von den Offizieren nie gefunden. Erst an dem Morgen, an dem wir in Nordafrika das Schiff verließen und den langen Marsch zu unseren Quartieren antraten, spazierten ein schwarzer Hund und zwei englische Welpen mit uns die seltsame afrikanische Straße hinauf.
Nachdem wir zwei Tage lang amerikanische Soldaten an Bord unseres Schiffes verladen und Tausende von Schlaf- und Seesäcken an Bord gehievt hatten, stachen wir endlich in See. Es war ein lausiger englischer Tag, kalt und mit strömendem Regen –– zu lausig, um an Deck zu sein und zuzusehen, wie die Pier weggleitet. Die meisten Männer lagen einfach in ihren Kojen. Ihnen war der traditionelle letzte Blick auf das Land ziemlich egal. Jetzt waren sie in Gottes Hand –– und in der der britischen Marine.
An Bord unseres Schiffes befanden sich Tausende von Offizieren und Soldaten sowie einige Krankenschwestern der Armee. Ich fühlte mich sogar ein wenig vertraut mit unserem Schiff, hatte ich es doch zwei Jahre zuvor in Panama liegen sehen. Damals hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich eines Tages darauf nach Afrika fahren würde.
Die Offiziere und Krankenschwestern waren in den Kabinen untergebracht, die in Friedenszeiten von normalen Passagieren benutzt wurden. Die Soldaten waren unter Deck in den Laderäumen untergebracht. Das Schiff war früher ein Kühlschiff gewesen, aber man hatte die riesigen Vorratsräume, in denen einst Lebensmittel gelagert wurden, ausgeräumt und Soldaten dort hineineingepfercht. Jedes Abteil war mit langen Holztischen mit Bänken an jeder Seite ausgestattet. An diesen Tischen aßen die Männer, während sie nachts in weißen Hängematten aus Segeltuch schliefen, die an Haken direkt über ihnen hingen.
Alles schien furchtbar überfüllt zu sein, und einige der Männer beschwerten sich bitterlich über das Essen und aßen tagelang nichts. Viele der Jungen behaupteten jedoch, dass es im Vergleich zu dem, was sie auf der Fahrt von Amerika nach England "genießen" mussten, großartig war. Manchmal aß ich mit den Soldaten unter Deck, und ich muss sagen, dass ihr Essen genauso gut war wie unseres, das aus der Offiziersmesse stammte und ausgezeichnet schmeckte. Auf jedem Truppentransporter ist eine gewisse Überfüllung unvermeidlich. Natürlich ist das nervend für die Soldaten, aber ich wüsste nicht, wie sonst genügend Männer schnell genug irgendwohin transportiert werden könnten.
Das größte Problem an Bord war der Mangel an heißem Wasser. Das Wasser zum Geschirrspülen kam nur lauwarm aus den Leitungen, und es gab kein Spülmittel. Infolgedessen wurde das Geschirr fettig und einige Soldaten bekamen davon eine leichte Dysenterie. In unseren Kabinen hatten wir nur zweimal am Tag Wasser –– morgens von 7:00 bis 9:00 Uhr und abends von 17:30 bis 18:30 Uhr. Es war allerdings nicht aufgeheizt, sodass wir uns mit kaltem Wasser rasierten. Die Soldaten duschten auf Befehl der Armee alle drei Tage mit lauwarmem Salzwasser.
Die Mannschaftsdienstgrade und Unteroffiziere durften sich an Deck frei bewegen, mit Ausnahme eines kleinen Teils, der für Offiziere reserviert war. Theoretisch war es auch den Offizieren nicht gestattet, das Deck der Mannschaften zu betreten, aber diese Regelung wurde bald außer Kraft gesetzt. Wir Reporter konnten gehen, wohin immer wir wollten –– schließlich waren wir begnadete und auserwählte Persönlichkeiten.
Irgendwann wurden Anweisungen für "Gefechtsstationen" im Falle eines Angriffs erteilt. Alle Offiziere sollten in ihren Kabinen bleiben, die Soldaten unter Deck. Nur die Männer auf den beiden untersten Decks, praktisch direkt an der Wasserlinie, mussten sich auf die beiden nächsthöheren Decks begeben. Ausschließlich uns Reportern war es während eines Angriffs erlaubt, an Deck zu gehen. Weil wir so begnadet wie nutzlos waren, wurde uns somit das göttliche Recht eingeräumt, uns erschießen zu lassen, so wir das wollten.
Die Schiffsgeschütze waren mit amerikanischen Kanonieren bemannt worden, aber diese mussten nie ernsthaft auf etwas feuern. An unserem ersten Morgen auf See testeten alle Schiffe des Konvois ihre Kanonen, und eine Zeit lang hörte man überall lebhaftes und lautes Wummern.
Wir Reporter wussten, wohin wir fahren würden, ebenso einige der Offiziere. Erstaunlich viele Soldaten hatten nicht die leistete Ahnung, wohin die Reise ging. Manche dachten, wir würden über die Murmansk-Route nach Russland fahren, andere waren der Meinung, unser Ziel sei Norwegen, und wieder andere vermuteten, es ginge nach Island. Nur einige wenige glaubten ernsthaft, wir würden nach Amerika zurückkehren. Erst am fünften Tag der Reise, als Anweisungen und Ratschläge für das Verhalten in Nordafrika erteilt wurden, wusste jeder, wohin unser Schiff unterwegs war.
Die ersten paar Tage auf See schien unser Schiff ziellos umherzufahren. Dann hielten wir ganz an und lagen einen Tag vor Anker. Schließlich schlossen andere Schiffe zu uns auf, und in der Abenddämmerung –– fünf Tage nach dem Verlassen Londons –– bildete der Verband langsam eine vorher festgelegte Formation, wie schwimmende Puzzleteile, die sich zu einem Bild zusammenfügen. Als es dunkel wurde, nahmen wir Fahrt auf, und den ersten empfindlichen Gemütern wurde übel.
Die See war ein paar Tage lang ziemlich rau, und die Seekrankheit griff massiv um sich, vor allem unter den Soldaten. Aber die meisten hielten sich gut und die Unterkünfte sahen bei weitem nicht so schlimm aus, wie es auf manchen Fahrten der Fall ist.
Nach einer Weile beruhigte sich die See, und die Überfahrt war im Großen und Ganzen recht angenehm. Die Soldaten mussten jeden Tag um 6:30 Uhr aufstehen und um 10:00 Uhr zum Appell antreten. Danach folgte eine Stunde Schiffsdrill. Ansonsten hatten die Männer wenig zu tun und vertrieben sich die Zeit damit, an Deck herumzustehen oder unten zu dösen, zu lesen oder Karten zu spielen. Während der gesamten Reise musste an Bord nicht salutiert werden. Viele ließen sich auch Bärte wachsen.
Es ist eine gewaltige Aufgabe, die Abläufe auf einem Schiff voller Soldaten zu organisieren. Erst nachdem unser Konvoi fast eine Woche auf See war, hatte sich alles eingependelt und verlief reibungslos. Ein Colonel der Air Force wurde zum kommandierenden Offizier der Truppen an Bord ernannt. Es wurden eine Schreibstube eingerichtet, Adjutanten ausgewählt, Deckoffiziere ernannt und die Schiffsordnung vervielfältigt und verteilt. Den Männern wurde ausdrücklich verboten, nachts an Deck zu rauchen oder Taschenlampen zu benutzen oder zu jeder Tageszeit Zigaretten oder Orangenschalen über Bord zu werfen. Ein U-Boot-Kommandant kann einen Konvoi noch Stunden, nachdem dieser vorbeigefahren ist, an solchen schwimmenden Überresten erkennen.
Die Warnung schien anfangs keinen großen Eindruck zu machen. Soldaten warfen jede Menge Dinge über Bord und eines Nachts spazierte eine Krankenschwester mit einer ihr den Weg leuchtenden Taschenlampe über das Deck. Ein Offizier in meiner Nähe blaffte sie an, und dies so laut und wütend, dass ich zuerst dachte, er mache nur Spaß:
"Mach das Licht aus, du verblödete, hohle Nuss! Hast du denn komplett deinen Verstand verloren?"
Dann wurde mir plötzlich klar, dass er jedes Wort ernst meinte, und dass ihr kleiner Lichtkegel uns alle hätte töten können.
Das Schiff selbst war natürlich völlig verdunkelt. Alle Eingänge zum Deck waren mit zwei Reihen schwerer schwarzer Vorhänge abgehängt. Alle Luken waren schwarz gestrichen und sollten geschlossen bleiben, nur tagsüber öffneten sie einige Leute. In den unteren Laderäumen wurden die Luken jeden Tag für kurze Zeit geöffnet, um das Schiff zu lüften. Wenn ein Torpedo einschlug, während viele Luken geöffnet waren, konnte jederzeit so viel Wasser eindringen, dass das Schiff sofort sank, wenn es Schlagseite bekommen sollte.
Jeder hatte eine Rettungsweste und musste diese ständig bei sich tragen. Es handelte sich dabei um ein neues Produkt, das wie zwei kleine, zusammengebundene Kissen aussah. Man stülpte sie sich über den Kopf, zog sie über die Schultern und die Brust herunter und band sie dort fest. Wir legten sie uns einfach nur bequem über die Schultern, wenn wir rausgingen. Die Dinger hatten sofort den Spitznamen "Sandsäcke" weg.
Am Abend des zweiten Tages wurde wir angewiesen, unser Koppel zu tragen, an dem eine Feldflasche befestigt war. Selbst wenn wir in den Speisesaal gingen, mussten wir unsere Schwimmweste und die Flasche mitnehmen.
Unsere ganz besondere kleine Gruppe bestand aus neun Mitgliedern. Wir waren offiziell als solche zusammengestellt worden und blieben während der gesamten Reise zusammen. Die einzelnen Personen waren: Bill Lang von "Time and Life", Red Mueller von der "Newsweek", Joe Liebling vom "New Yorker", Gault Macgowan von der "New York Sun", Ollie Stewart vom "Baltimore Afro-American", Sergeant Bob Neville, Korrespondent der Armeezeitungen "Yank" und "Stars and Stripes", zwei Armee-Zensoren, die Lieutenants Henry Meyer und Cortland Gillett, und meine Wenigkeit.
Sergeant Neville durfte als Unteroffizier nicht die Kabine mit uns teilen, sondern musste im Frachtraum Quartier beziehen und dort in einer Hängematte schlafen. Nach ein paar Tagen gelang es uns, ihn in eine etwas bessere Unterkunft zu verlegen. Neville war wahrscheinlich der erfahrenste und am weitesten Gereiste von uns allen –– er sprach drei Sprachen, war drei Jahre lang Auslandsredakteur der "Time" gewesen, hatte für den "Herald Tribune" und die "PM" gearbeitet, war in Spanien in diesem Krieg, in Polen in jenem, in Kairo beim ersten Wavell-Vorstoß und in Indien und China und Australien gewesen. Dennoch hatte er ein Offizierspatent abgelehnt und ging stattdessen zur Navy, was wiederum zur Folge hatte, dass er auf dem Boden schlafen, stundenlang in der Messe stehen und sich von bestimmten Decks fernhalten musste.
Ollie Stewart war ein Schwarzer, der einzige amerikanische farbige Reporter, der damals auf dem europäischen Kriegsschauplatz akkreditiert war. Er war exzellent ausgebildet, benahm sich gut und war schon viel im Ausland herumgereist. Wir alle haben ihn auf dieser Reise sehr liebgewonnen. Er wohnte in einer der beiden Kabinen mit uns, teilte sich die Mahlzeiten mit uns und spielte an Deck mit den Offizieren Handball. Alle waren freundlich zu ihm und es gab keinerlei "Probleme".
Wir Reporter kannten bereits viele der Offiziere und Soldaten an Bord, weswegen wir ständig auf dem Schiff unterwegs waren und uns viele Freunde machten. Bill Lang und ich teilten uns eine Kabine mit den beiden Lieutenants. Eines Tages holten wir die Vorschriften für Reporter heraus, in denen stand, dass wir von der Armee mit "Höflichkeit und Rücksichtnahme" behandelt werden mussten. Wir lasen den Lieutenants Meyer und Gillett diese Regeln vor und befahlen ihnen dann, uns die Zigaretten anzuzünden und unsere Schuhe zu putzen. Auf einer so langen Reise ist Humor eben, wenn man trotzdem lacht.
Unser Truppentransportschiff hatte ein großes Lazarett, das die meiste Zeit voll belegt war. Die langen Zugfahrten in ungeheizten Waggons quer durch England schienen jedem Soldaten eine Erkältung verpasst zu haben, und wer an Bord nicht irgendwann einen sich todkrank anhörenden Husten bekam, war wirklich ein armer Mann. Wir hatten sogar zwei Fälle von Lungenentzündung, die beide Gott sei Dank glimpflich ausgingen. Ich selbst erkrankte am Tag nach unserer Ankunft an Bord an einer heftigen Erkältung und verbrachte die nächsten fünf Tage im Bett. Dabei täuschte ich vor, nur seekrank zu sein. Da es auf dem Schiff kaum Militärärzte gab, bekam ich Lutschtabletten, Injektionen und gute Ratschläge, und das alles kostenlos.
Das Schiff hatte noch nie amerikanische Soldaten befördert, sodass die britischen Kellner etwas schockiert waren über den Appetit und die Tischmanieren der jüngeren Offiziere. Einige Second Lieutenants, sehr muskulös und offensichtlich noch im Wachstum begriffen, bestellten ein komplettes zweites Abendessen, nachdem sie das erste beendet hatten. Zwischendurch standen sie auf und bedienten sich selbst mit Brot, trugen ihre eigenen Teller weg, spielten mit ihren Gabeln laute Melodien auf ihren Gläsern, machten unflätige Witze über das Essen und benahmen sich ganz allgemein in einer Weise, die der Würde eines Kellners auf einem britischen Kreuzfahrtschiff nicht angemessen war. Außerdem war das Rauchen im Speisesaal verboten. Die armen Kellner hatten große Mühe, dieses Verbot durchzusetzen, aber schließlich irgendwann Erfolg damit. Zur Ehrenrettung der Briten muss ich sagen, dass sie schließlich nachgaben und sich auf die allgemein gute Laune einließen. Insgesamt glaube ich, genossen sie die Wildwest-Kameradschaft ebenso sehr wie die Amerikaner.
Ich und die Kollegen, die mit mir in den Kabinen wohnten, wurden jeden Morgen um sieben Uhr vom Kabinensteward geweckt, der Tassen mit heißem Tee brachte. Die Mahlzeiten wurden in zwei Sitzungen im Abstand von einer Stunde eingenommen. Beim Mittagessen trug der Oberkellner sogar einen Smoking, und wie ich schon sagte, das Essen war ausgezeichnet. Zum Frühstück gab es jeden Morgen Spiegeleier und echten Speck –– die ersten richtigen Eier, die ich seit vier Monaten gegessen hatte. Zusätzlich gab es nachmittags Tee und abends belegte Brote.
Einmal unterwegs, wurden zwei Kantinen für die Truppe geöffnet. In der einen gab es Zigaretten, Schokolade usw. zu kaufen, in der anderen, der so genannten "feuchten Kantine", gab es heißen Tee. Vor beiden Kantinen gab es ständig lange Schlangen und oft mussten die Soldaten drei Stunden lang anstehen.
Am Abend öffnete eine Bar, die Softdrinks ausschenkte, allerdings keinerlei Alkohol. Einige Offiziere hatten Whiskey mit an Bord gebracht, aber nach ein oder zwei Tagen war alles vernichtet, und von da an war es wahrscheinlich die trockenste Seereise, die je gemacht wurde –– oder wie jemand bemerkte: "Wir sind so oder so die Deppen. Im Speisesaal dürfen wir nicht rauchen, weil es ein britisches Schiff ist, und Schnaps können wir nicht kaufen, weil es ein amerikanisches Schiff ist."
Unter allen Orten auf der Welt, an denen Gerüchte kursieren, ist ein Truppentransportschiff wohl der Spitzenreiter. Jeden Tag kursierten Dutzende von Klatschgeschichten durch das Schiff. Wir konnten uns aussuchen, ob wir sie glauben wollten oder nicht.
So hieß es zum Beispiel, wir würden mit einem großen amerikanischen Konvoi zusammentreffen, dass ein Flugzeugträger zu uns gestoßen sei, dass wir Gibraltar in sechs Stunden, vierundzwanzig Stunden, zwei Tagen erreichen würden, dass das Schiff hinter uns die "West Point", die "Mount Vernon", die "Monterey" sei, dass wir uns achtzig Meilen vor Portugal und zweihundert Meilen vor den Bermudas befanden. Nichts davon stellte sich als wahr heraus.
Die Gerüchteküche brodelte so sehr, dass ein Offizier die Latrinenparole in die Welt setzte, wir seien auf dem Weg nach Casablanca. Dann zählte er die Zeit, die es dauern würde, bis das Gerücht durch das Schiff gewandert war und zu ihm zurückkam. Es dauerte eine knappe halbe Stunde und die Nachricht wurde ihm als blanke Tatsache direkt von der Brücke verkauft.
Kaum hatte die Reise begonnen, begannen die Proben für eine Varieté-Show der Soldaten. Ich glaube, man könnte beliebige tausend Soldaten der US Army nehmen und aus ihnen ein gutes Orchester zusammenstellen. In unserer Besatzung konnte man einen Akkordeonisten, einen Saxophonisten, einen Trompeter, einen Geiger, zwei Banjospieler, einen Tänzer, einen Tenor, einen Cowboysänger und mehrere Pianisten ausfindig machen –– alles Profis. Sie haben jeden Nachmittag geprobt. Schließlich kam der große Abend, nur wenige Tage vor unserer Ankunft in Gibraltar. Es gab zwei Aufführungen, die nur für die Mannschaften und Unteroffiziere bestimmt waren. Es handelte sich um eine Posse –– und damit meine ich eine Posse. Als sich der Erfolg herumgesprochen hatte, wollten auch die Offiziere und Krankenschwestern das Stück sehen. In der Nacht, in der wir uns dem Felsen näherten, wurde es also nochmals aufgeführt. Auf Wunsch des Colonels wurde es etwas "getrimmt", aber es war immer noch ein Riesenspaß.
Die Show kam großartig an. Einige Darsteller bewiesen echtes Talent und es wurden ernste Musik, aber auch schmissige Sachen gespielt. Der Held des Abends war ein Gefreiter, Joe Comita aus Brooklyn, der eine Striptease-Burlesque von Gypsy Rose Lee darbot. Seine Bewegungen waren einfach genial und Gypsy selbst hätte nicht sinnlicher agieren können. Joe wirbelte herum und zog sich aus, und dies immer und immer wieder. Und dann, als er nur noch seine lange, schwere GI-Unterwäsche trug, schwang er sich nach vorne auf die Bühne, hob seinen Schleier und küsste einen Colonel in der ersten Reihe auf dessen Glatze!
Die ganze Show war einfach herrlich, aber sie hatte noch eine andere Bedeutung, als die Männer zu unterhalten. Jeder wusste, dass die kommende Nacht sehr gefährlich werden würde. Der Funk hatte gerade gemeldet, dass sich einige deutsche U-Boot-Rudel in der Nähe von Gibraltar gesammelt hatten. Mehr als fünfzig dieser Jäger würden auf uns warten. Ich bezweifle, dass irgendjemand an Bord damit rechnete, dass die Nacht ohne einen Angriff vergehen würde.
Es war eine perfekte Nacht für Romantik –– oder für den Tod. Die Luft war warm und der Mond legte einen glänzenden Schimmer auf das Wasser. Es war gerade diese Sanftheit, welche die Nacht scheinbar mit dem Bösen, das unter dem Wasser wartete, zusammenarbeiten ließ. Aber trotz der riesigen Anspannung absolvierten die Jungs munter ihre Vorstellungen. Wir saßen im Publikum, die Schwimmwesten in der Hand und die Feldflaschen an unseren Koppeln. Wir lachten und jubelten und lauschten unbewusst gleichzeitig nach anderen Geräuschen.
Als die Vorstellung zu Ende war, drehte sich ein Major, den ich nicht kannte, zu mir herum und meinte: "Es ist schlicht wunderbar, wie die Jungs das machen, obwohl sie wie Galeerensklaven da unten im Frachtraum in den Krieg gefahren werden. Wenn man bedenkt, dass sich die Leute zu Hause aufregen, weil sie nur zwanzig Gallonen Benzin zugeteilt bekommen, bringt das mein Blut zum Kochen."
Unser Schiff hatte zwei Schornsteine oder Schlote. Der vordere war eine Attrappe –– innen hohl. Etwa einen Meter unterhalb seiner Spitze war eine Stahlplattform gebaut worden, die man über eine Stahlleiter erreichen konnte. Die Armee hatte diese Plattform ständig mit einem Lieutenant und drei Mannschaftsdienstgraden besetzt, die mit Ferngläsern Ausschau hielten.
Es war eine Art Tribünenplatz, und ich kletterte fast jeden Nachmittag hinauf. Lieutenant Winfield Channing, der eine Flugabwehrbatterie befehligte, hatte dort oben für gewöhnlich nachmittags das Kommando, und wir unterhielten uns stundenlang über seine Arbeit vor dem Krieg, über unsere Zukunftschancen und darüber, was wir tun würden, wenn alles vorbei war. Die Sonne schien hell, die Schornsteine schirmten uns vom Wind ab, es gab sogar Liegestühle –– der Platz war fast wie ein paar Quadratmeter Miami Beach. Wir nannten unseren kleinen Posten "den Schornsteinclub". Von dort hatten wir einen perfekten Blick auf die Zickzackmanöver des Konvois. Einmal sahen wir drei Regenbögen auf einmal, von denen einer direkt über dem Schiff ein Hufeisen bildete. Gelegentlich konnten wir am Horizont eine Segelschaluppe oder ein Fischerboot ausmachen.
Mein beliebtester Aufenthaltsort unter Deck war ein Bereich, in dem einige Soldaten aus New Mexico untergebracht waren –– meinem Wohnsitz in den Staaten. Einer von ihnen war Sergeant Cheedle Caviness, ein Neffe von Senator Hatch. Cheedle hatte sich einen blonden Schnurr- und einen Spitzbart wachsen lassen und sah aus wie ein Herzog.
Während der Reise gab es keinerlei Probleme unter den Mannschaften, dafür aber ein paar kleine "Zwischenfälle" in den Offiziersunterkünften des Schiffes. Ein Offizier, der in seiner Kabine mit seinem Revolver herumspielte, hatte offensichtlich vergessen, dass dieser geladen war, und schoss ein schönes Loch in den Schrank. Die Kugel verfehlte einige seiner Mitbewohner nur denkbar knapp. Ein anderer Offizier wurde verhaftet, weil er Fotos von unserem Konvoi gemacht hatte.
Der kommandierende Offizier ordnete an, dass während der Fahrt keine Filme gezeigt und keine elektrischen Rasierapparate benutzt werden durften. Er befürchtete, dass der Feind den Stromverbrauch messen und damit unsere Position ablesen könnte, aber wir erfuhren später, dass diese Vorsichtsmaßnahme unnötig war.
Zweimal täglich bekam wir Radionachrichten der BBC übermittelt. Es hieß, dieser Service würde nach ein paar Tagen auf See eingestellt werden, aber das war nicht der Fall. Die Nachrichten wurden über Lautsprecher im gesamten Schiff übertragen, so dass die Truppen immer auf dem neuesten Stand waren.
Die Geistlichen an Bord des Schiffes berichteten, dass die Zahl der Gottesdienstbesucher unter den Soldaten nach dem Auslaufen merklich zugenommen hatte und weiter anstieg, je näher wir den U-Boot-Gewässern kamen.
Die Krankenschwestern und Ärzte an Bord stammten hauptsächlich aus dem Roosevelt Hospital in New York. Wie wir später erfuhren, befanden sich zwei weitere Abteilungen mit Krankenschwestern auf anderen Schiffen des Verbands. Meistens waren die Frauen mit Offizieren zusammen, spielten gemeinsam Karten, gingen auf den Decks spazieren oder saßen im Salon. Das Mondlicht war wirklich bezaubernd, und es würde mich nicht wundern, wenn einige Liebschaften entstanden wären.
Mit der Zeit wurden die Bekanntschaften immer mehr, so wie es auch auf einer Kreuzfahrt in Friedenszeiten der Fall ist. Die Tage verliefen ohne Zweck, Ziel oder Pflichten, und doch schienen sie wie im Flug zu vergehen. Für viele von uns war die Reise eine echte Erholung und einige waren am Ende sogar sehr traurig darüber, dass sie zu Ende war. Wir spürten das traurige Gefühl, von neuen Freunden Abschied nehmen und zu den alten Mühen zurückkehren zu müssen, und dies widerstrebte uns. Aber der Krieg nimmt natürlich keine Rücksicht auf solche Launen.
Ich hatte mich oft gefragt, in welcher Formation sich so ein großer Konvoi bewegte, ob man immer den gesamten Verband in Sichtweite hatte oder nicht, und wie sich die Begleitschiffe verhielten.
Nun, unser Konvoi war ein mittelgroßer. An dem Tag, an dem wir ausliefen, zählten wir eine gewisse Anzahl von Schiffen. Auf diese Zahl zu kommen, gelang uns erst wieder, als wir fast im Hafen waren. Nicht, weil die Schiffe außer Sichtweite gewesen wären, sondern weil sie hintereinanderfuhren und wir die hinteren Dampfer nicht sehen konnten. Normalerweise war unser Konvoi breiter als lang, was mich sehr überraschte.
Der Konvoi schien nach drei oder vier verschiedenen geometrischen Mustern zu fahren. Immer wieder wechselte die gesamte Formation von einem Muster zum anderen, wie ein Team im American Football, das sich nach der Ansage des Quarterbacks umstellt. Es war faszinierend zu beobachten, wie einige Schiffe schneller wurden, andere zurückfielen und das neue Muster Gestalt annahm. Darüber hinaus bewegte sich der gesamte Konvoi in einem ständigen Zickzackkurs. Manchmal ging es so plötzlich und so scharf durch die Kurven, dass die Schiffe ordentlich Schlagseite bekamen. Diese Kurs- und Formationswechsel wurden in regelmäßigen Abständen durchgeführt –– noch häufiger, wenn wir uns in verdächtigen Gewässern befanden.
Britische Korvetten und andere Kriegsschiffe waren vor uns und auf allen Seiten. Sie schienen ihre Positionen innerhalb des Verbandes genauso stabil zu halten wie wir unsere. Tagsüber waren wir etwa eine halbe Meile voneinander entfernt, nachts rückte der gesamte Konvoi enger zusammen. Dann konnten wir zwei oder drei dunkle Umrisse dicht um uns herum ausmachen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es hieß, dass wir außer Sichtweite, also hinter dem Horizont, weitere Begleiter hatten.
Soweit mir bekannt, hatte der Konvoi nur einen einzigen "Zwischenfall" während der gesamten Reise. Unser Schiff fuhr an der Außenseite, und die hinter uns fahrenden Korvette als auch der Truppentransporter meldeten übereinstimmend, dass ein Torpedo direkt zwischen uns und dem Transportschiff durchgezischt war.
Die Korvetten begannen daraufhin die Jagd nach dem U-Boot und warfen Wasserbomben ab, aber das war auch schon alles. Niemand auf unserem Schiff hat den Torpedo gesehen, geschweige denn das U-Boot.
Desto weiter wir nach Süden fuhren, desto himmlischer wurde das Wetter –– schön warm und so beständig, dass das Schiff überhaupt nicht mehr schaukelte. Oft kam mir die Reise wie eine tropische Kreuzfahrt in Friedenszeiten vor, und nicht wie ein vollbepacktes Truppentransportschiff, das in den Krieg zog. Viele Soldaten schliefen bei diesem Wetter an Deck, und in den letzten drei Nächten wurde uns befohlen, dabei unsere Kleidung anzubehalten. Es wäre falsch zu leugnen, dass die Menschen in diesen Tagen angespannt waren, aber es wäre auch falsch zu behaupten, dass irgendjemand Angst zeigte.
Morgengrauen und Abenddämmerung waren die schönsten Zeiten an Bord, und an den letzten beiden Morgen gelang es mir tatsächlich, kurz vor Tagesanbruch wach und an Deck zu sein. Ich konnte zwar keine U-Boote sehen, aber zwei der prächtigsten Sonnenaufgänge, die ich je erlebt habe.
Je näher wir dem Ende der Reise kamen, desto mehr entwickelte sich ein Gefühl, das man als eine Art Liebe zu unserem Schiffsverband beschreiben könnte. Wir waren so weit zusammen gefahren, hatten die endlosen Formationswechsel, den ewigen Zickzackkurs bis zur Perfektion vollzogen. Irgendwie waren wir wie eine riesige ozeanische Maschine, die sich rhythmisch drehte, und wären in der Lage gewesen ewig weiterzufahren, weil es die Perfektion unserer eigenen Disziplin gewährleistet hätte.
Stunde um Stunde stand ich an der Reling und blickte auf diese Armada marschierender Schiffe –– sie schienen wirklich über den Ozean zu marschieren –– und ein fast erdrückendes Gefühl der Schönheit und der Kraft, der Macht des Meeres überkam mich.
Schließlich erreichten wir die Straße von Gibraltar –– mit Lichtern auf beiden Seiten –– , von wo aus es weiterging in die ruhigen Gewässer des Mittelmeers. Wir hatten noch einen langen Weg vor uns, und die Gefahr war bei Weitem noch nicht gebannt, aber es machte sich überall eine angenehme Erleichterung breit.
Wir begannen zu packen und erhielten zeitgleich unsere Wüstenausrüstung mit Staubschutzmasken, Wasseraufbereitern usw. Wir gaben unseren Stewards Trinkgeld, brachten geliehene Bücher zurück, kauften die neueste Ausgabe des "American" und notierten gegenseitig die Nummern unserer Ausrüstung, um später neu gewonnene Freunde ausfindig machen zu können.
Schließlich erreichten wir unseren Hafen. Langsam und umständlich, wie die Schnur eines irgendwo versteckten Wollknäuels, strömten die Schiffe in langen braunen Reihen zu den Docks. Wir stellten uns in einer Reihe auf und marschierten los. Manche hatten drei Meilen vor sich, andere zwanzig. Zunächst marschierten alle fröhlich, später mit großer Erschöpfung, aber immer mit dem Gefühl, dass wir endlich die letzte Reihe von Märschen begannen, die uns wieder nach Hause führen würden –– nach Hause, das einzig wahre Ziel, von dem jeder Amerikaner, der an fremden Ufern marschiert, besessen ist.
KAPITEL 2. DIE AMERIKANER SIND GELANDET
Armeefotografen sind Soldaten, die mit Kameras anstelle von Gewehren kämpfen. Sie gehören zu den Fernmeldeeinheiten und haben zwei wichtige Aufgaben: Zum einen sollen sie Wochenschauen erstellen, die in den Kinos zuhause gezeigt werden, zum anderen den Krieg in Bildern festhalten. Viele dieser Männer, sowohl der Armee als auch der Navy, sind mit unseren Streitkräften in der ganzen Welt verstreut und haben bereits einiges an historischer Arbeit geleistet. Nicht wenige werden noch hinter ihren Kameras sterben, bevor dieser Krieg vorbei ist.
Ich war erst ein paar Tage in Afrika, als ich den Private Ned Modica und den Sergeant Norman Harrington traf, beides Fotografen der Armee. Ned war fünfunddreißig und hatte kohlrabenschwarzes, hier und da schon leicht ergrautes Haar. Selbst in Kampfuniform sah er aus und sprach wie ein Offizier. Als Jugendlicher hatte er die New York School of Fine Arts besucht und dann zwei Jahre lang in Paris studiert. Vor dem Krieg hatte Ned sein eigenes Atelier in der angesagten Madison Avenue besessen.
Neds Kamerad war zu Hause in Easton, Maryland, ein Anführer der Protestbewegung gewesen – etwas seltsam für einen sechzehnjährigen Jungen, der gerade von der High School kam. Mit siebzehn wurde er der jüngste Rotarier in Amerika. Mit neunzehn eröffnete er sein eigenes Studio. Norman hatte überhaupt keine Lust darauf, seine Streifen zu tragen. Sein einziges Interesse bestand darin, für die Armee das zu tun, was er schon als Zivilist getan hatte –– hervorragend zu fotografieren. Ned behauptete, Norman sei der beste Wochenschaufilmer in der ganzen Armee.
Am Morgen des achten Novembers standen Sergeant Harrington und Private Modica in der Dunkelheit auf dem Hurricane-Deck eines Truppentransporters, der vor der Küste Algeriens lag. Sie waren wie gebannt von den Szenen, die ihre Kameras aufzeichneten –– das fantastische Treiben der Leuchtspurgeschosse auf der Suche nach Zielen entlang der Küste, das feurige Aufblitzen farbiger Leuchtsignale am Himmel, das Grau der Rauchwände, die unsere gepanzerten Schnellboote als Schutz legten.
In der Morgendämmerung näherte sich ihr Schiff schließlich der Küste. In dem Moment, als es den Anker warf, kam eine französische Mörsergranate angerauscht. Sie verfehlte die beiden Kameraleute um etwa einen Meter. Einen Augenblick später schlug eine zweite Granate an der Stelle ein, an der sie in der Nacht zuvor geschlafen hatten.
Manchmal überrascht einen das Leben, noch bevor man begreift, was eigentlich los ist.
Die beiden Kameraleute sahen sich verwundert an, doch ihre Erregung wurde jäh durch eine Stimme aus dem Schiffslautsprecher unterbrochen, die ihre Nummern aufrief. Die Aufgabe, für die sie trainiert und auf die sie gewartet hatten, stand unmittelbar bevor. Sie schnappten sich ihre Ausrüstung und sprangen in ihr stahlverstärktes Sturmboot. Sobald sie flaches Wasser erreichten, ließen sie sich aus dem Kahn gleiten und standen plötzlich hüfttief im Mittelmeer. Sie hielten ihre Kameras hoch über den Köpfen und wateten an Land. Nachdem sie ihre Taschen und den Vorrat an Filmmaterial abgeladen hatten, wateten sie zurück und begannen, die anlandenden Horden von Soldaten zu fotografieren. Damit waren sie die beiden ersten Vertreter der Wochenschau, die auf dieser Seite des Ozeans ihre Arbeit aufnahmen.
Das Wasser war kalt, aber sie spürten es nicht.
"Ehrlich gesagt, haben wir kaum etwas um uns herum wahrgenommen", sagt Ned Modica. "Wir waren so vertieft in das, was wir taten, dass wir nichts von dem mitbekamen, was außerhalb des Radius unserer Linsen geschah."
Sie arbeiteten fünfzehn Minuten lang hüfttief im Wasser und liefen dann am Strand auf und ab, um Aufnahmen von den an Land stürmenden Truppen zu machen. Als sie einige Marinesanitäter fanden, die sich um einen verwundeten, am Strand liegenden französischen Soldaten kümmerten, bannten sie zum ersten Mal Blut auf ihren Film. Der Soldat trug immer noch seinen roten Fez, eine Farbe, die zwangsläufig auf dem Technicolor-Film hervorstach –– ebenso wie die kahlen afrikanischen Berge, die sanfte Biegung des Strandes, der große wartende Konvoi im Hintergrund sowie das weiße Verbandmaterial.
Am Ende dieses ersten Tages der Schlacht um Oran lagen die beiden Fotografen auf dem Boden eines Schulhauses in der Nähe der kleinen algerischen Stadt Arzeu. Um sie herum waren weitere Soldaten verstreut. Die beiden Kameraleute waren todmüde. Sie waren den ganzen Tag ohne Unterbrechung unterwegs gewesen, mussten ständig hin- und herlaufen, hatten überschüssige Ausrüstung irgendwo deponiert und diese später wieder aufgenommen.
Ihre Kleidung war immer noch nass, und ihnen war kalt. Sie waren ohne Decken und Mäntel an Land gegangen, und statt eines Proviantbeutels trugen sie drei über den Schultern –– nur dass diese Beutel nicht mit Lebensmitteln oder Munition gefüllt waren. Sondern mir zusätzlichen Filmen für ihre Kameras, von denen sie eine Menge mitschleppten. Ned hatte zwei Filmkameras und einen Fotoapparat dabei, Norman schleppte eine riesige Kamera der Wochenschau und eine Standbildkamera. Ihre ganze persönliche Habe bestand aus zwei Zahnbürsten.
In ihren ersten zwölf Stunden auf afrikanischem Boden filmten Norman und Ned verwundete amerikanische und französische Soldaten, die Einnahme eines Stützpunktes für Wasserflugzeuge und machten Aufnahmen von ihrer ersten Kriegsleiche. Es war der Körper eines Scharfschützen, der auf sie geschossen und sie verfehlt hatte.
In dieser ersten Nacht schliefen sie kaum. Kugeln prallten von den Mauern ab oder schlugen irgendwo im Hof ein. Die Soldaten in dem Klassenzimmer waren die ganze Nacht über sehr angespannt. In der Dunkelheit konnten sie das Klicken der Magazine hören, wenn diese in die Pistolen geführt wurden. Kurz vor dem Morgengrauen warf ein übernervöser Soldat eine Handgranate aus dem Fenster, weil er einen imaginären Schatten gesehen hatte. Ein anderer saß die ganze Nacht wach und erzählte endlose Anekdoten über seine Zeit in der Burschenschaft am College.
Im Morgengrauen des nächsten Tages hatten die beiden Fotografen Glück und fanden einen Jeep, mit dem sie nach Saint-Cloud gelangen konnten, wo gerade Kämpfe stattfanden. Irgendwann mussten sie den Jeep verlassen und sich zu Fuß zur Frontlinie vorarbeiten. Bei der Infanterie lernte ein Mann, sich geschützt in Gräben fortzubewegen. Dazu gehört, immer ein wenig zu laufen, sich dann hinzulegen und darauf zu warten, dass eine Mörsergranate einschlug. Jeder Kopf zuckt unwillkürlich nach unten, wenn er das Zischen eines vorbeifliegenden Geschosses hört. Auch die beiden Fotografen lernten das sehr schnell.
Ned Modica fand eine amerikanische Maschinengewehr-Besatzung und hielt mit seiner Kamera drauf. Die Mannschaft lieferte ihm gutes Material. Dann fuhren sie weiter nach Oran und filmten den dramatischen Empfang der amerikanischen Truppen durch die Franzosen und die arabische Bevölkerung. Schließlich packten sie ihren Film in eine Kiste und machten sich auf die Suche, bis sie einen entgegenkommenden RAF-Piloten fanden, der das Material nach London mitnahm.
In ihrer zweiten Nacht auf afrikanischem Boden "schliefen" die beiden Fotografen in einem weiteren Schulhaus auf dem Land –– diesmal auf Schulbänken. In den ersten sechzig Stunden an Land waren ihnen gerade einmal drei Stunden Schlaf vergönnt. Im Morgengrauen des dritten Tages fragte ein Colonel Sergeant Harrington, ob er bei einer Erkundungstour mitfahren wolle, die Captain Paul Gale in einem Jeep unternahm. Harrington schnappte sich seine Kameras und sprang sofort hinein.
Der Fahrer, ein gutaussehender junger Mann, dessen Namen der Kameramann nicht erfuhr, fuhr in ordentlichem Tempo die Straße hinunter. Nach mehreren Meilen, in denen sie immer wieder Truppen passiert hatten, kamen sie schließlich in eine kleine Stadt. Dort stellten sie den Jeep ab. Während Captain Gale sich um seine Angelegenheiten kümmerte, holte Harrington seine Ausrüstung heraus und machte Fotos von den Einwohnern und den von Granaten gezeichneten Mauern. Alle waren sehr freundlich –– alles schien normal zu sein.
Sie wollten gerade aufbrechen, als einige amerikanische Truppen in die Stadt marschierten. Erst da wurde ihnen bewusst, dass sie, ohne es wirklich zu bemerken, eine angenehme Stunde in einer noch nicht eingenommenen Stadt verbracht hatten.
Mit ihrem Jeep ging es zurück zu einem Befehlsstand, der einige Kilometer weiter im Hinterland lag. Captain Gale saß neben dem Fahrer, Sergeant Harrington auf dem Rücksitz. Das Verdeck war heruntergeklappt, die Windschutzscheibe lag flach eingeklappt und abgedeckt auf der Motorhaube – eine Windschutzscheibe kann eine Spiegelung erzeugen, die ein perfektes Ziel für Scharfschützen darstellt. Es ist schon komisch, was man im Krieg so alles lernt. So hatten beispielsweise die Soldaten vor der Ausschiffung Sonnenbrillen erhalten, die sie aber wieder absetzen mussten, weil die Gläser die Sonnenstrahlen einfingen und eine perfekte Zielscheibe abgaben.
Die drei fuhren weiter auf der Landstraße zwischen Weinbergen hindurch, immer unter einer warmen afrikanischen Sonne. Alles war friedlich. Die algerische Phase des Krieges schien so gut wie vorbei zu sein.
Plötzlich fiel der Fahrer ohne ersichtlichen Grund auf das Lenkrad, der Jeep kam ins Schleudern und Blut spritzte über seine Uniform. Er gab keinen Laut von sich. Ungehört und ungesehen hatte ihn die Kugel eines Scharfschützen direkt über dem rechten Auge getroffen –– er war auf der Stelle tot.
Harrington griff über die Leiche hinweg nach dem Lenkrad. Captain Gale legte seinen Fuß um das Bein des toten Fahrers und drückte das Gaspedal durch. Zwei weitere Schüsse zischten heran, verfehlten aber ihre Ziele. Der Jeep brauste weiter die Straße hinunter und gelangte schließlich außer Gefahr, weil ein Mann das Steuer und ein anderer das Gaspedal bediente.
In der Zwischenzeit hatte sich Ned Modica zu Fuß an die vorderste Front des Angriffs auf Saint-Cloud begeben. Die Franzosen leisteten dort erbitterten Widerstand und beschäftigten uns Amerikaner tatsächlich eine Zeit lang aufs Heftigste. Die Schlacht war spektakulär, und Ned vergaß für einen Moment die Gefahr um ihn herum, gänzlich verloren in der Begeisterung des Fotografen, endlich seine Bilder zu bekommen.
Während Ned aufrecht dastand und seine Bilder knipste, spürte er, wie sich jemand gegen ihn lehnte. Um etwas Smalltalk zu betreiben, sagte er: "Ist ziemlich heiß geworden, nicht wahr?" Er erhielt keine Antwort, denn in diesem Moment sprangen alle Soldaten auf und begannen, den Rückzug anzutreten.
Das geschah auf Befehl ihres Kommandanten, der die Kampftaktik änderte, aber das wusste Ned zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Er sagte zu dem Kerl, der immer noch an ihm lehnte: "Lass uns von hier verschwinden", und wirbelte herum, um loszulaufen. Aber als er sich umdrehte, fiel der Soldat zu Boden –– tot.
Modica erfuhr nie, wer da gestorben war, während er an ihm lehnte.
Am nächsten Tag biwakierten die beiden Kameraleute in winzigen Schutzzelten in einem Olivenhain, kilometerweit draußen auf dem Land, und warteten auf den nächsten Einsatz. Dort habe ich sie besucht.
"Hier in Afrika habe ich zum ersten Mal selbst eine Orange von einem Baum gepflückt", sagte Modica.
"Nachdem unser Film geschnitten und zensiert ist, sollte das Material noch mindestens für eine dreißigminütige Wochenschau reichen –– das meiste davon sogar in Technicolor", meinte Harrington. "Es sollte perfekt sein."
"Wenn wir nach Italien kommen, können wir uns herrliche Dinge zum Essen bestellen", erwiderte Modica. "Zumindest können wir danach fragen, denn ich kann Italienisch."
"Du wirst Italien und noch viele andere Orte sehen", erklärte Harrington.
"Wir werden bei jeder Landung und jeder großen Schlacht dabei sein. Du wirst schon sehen."
"Wenn alles vorbei ist, werde ich mich in Paris verabschieden und mir mit meiner Frau erstmal eine Auszeit gönnen", sagte Modica. "Wir werden die Gegend als einfache Touristen bereisen."
"Du wirst in China sein, wenn der Krieg vorbei ist", antwortete Harrington.
"Ich wollte schon immer mal nach China, also können sie mich auch dort entlassen ", meinte Modica.
"Wenn wir so lange leben", sinnierte Harrington.
Als Ralph Gower ein kleiner Junge in Arkansas war, wohnte ein tauber Mann gegenüber von seinem Haus. Der Mann konnte von den Lippen lesen und Ralph lernte diese Kunst von ihm –– hauptsächlich, um vor den anderen Kindern anzugeben.
Ein Vierteljahrhundert später saß Sergeant Ralph Gower auf einer Klappliege in einem Zelt weit draußen auf einem Feld in Afrika. Es war ein Lazarettzelt, in dem sich verwundete Soldaten in roten Bademänteln räkelten. Ralph Gower konnte nur deshalb mit ihnen sprechen und verstehen, was sie sagten, weil er als Kind das Lippenlesen gelernt hatte, denn die Explosion einer feindlichen Granate hatte ihn taub gemacht.
Als ich ihn besuchte, hatte er erst einige Tage sein Gehör verloren, aber das Lippenlesen beherrschte er bereits perfekt. Trotz der fünfundzwanzig Jahre war ihm alles wieder eingefallen. Wir unterhielten uns eine halbe Stunde, und er machte nicht einen einzigen Fehler.
Sergeant Gower kam ohne ernsthafte Verletzungen davon, natürlich abgesehen vom Verlust seines Gehörs. Die Chancen, dass er es wiedererlangte, standen fünfzig zu fünfzig.
Ralph Gower war siebenunddreißig, und obwohl er in Arkansas geboren wurde, war seine Heimatstadt Sacramento, Kalifornien. Vor dem Krieg arbeitete er als technischer Zeichner und Maschinenarbeiter. Schon mit Anfang zwanzig diente er in der Armee, und als die Kämpfe zwischen England und Deutschland begannen, meldete er sich erneut. Er war Maschinengewehr-Sergeant.
Gower kam an Bord einer Gruppe von Kampfschiffen nach Afrika, die bei dem Versuch, einen algerischen Hafen einzunehmen, in große Schwierigkeiten gerieten. Die Überlebenden dieses Einsatzes hatten unverschämtes Glück.
"Willst du wissen, wie es sich angefühlt hat?", fragte Ralph.
Ich setzte mich auf die Kante der nächsten Pritsche. "Klar will ich das. Wie hat es sich angefühlt?"
"Es fühlte sich an, als würde man einmal durch die Hölle und wieder zurück spazieren", sagte er. Die Jungs um das Zelt herum lachten lauthals. Dies irritierte mich etwas, denn ich konnte beim besten Willen nicht erkennen, was es da zu lachen gegeben hätte. Aber allmählich kapierte ich. Sergeant Gowers' spröder Arkansas-Esprit brachte das ganze Zelt Tag und Nacht zum Brüllen. Er sagte nie etwas offensichtlich Kluges, sondern nur Dinge, die man so oder so interpretieren konnte, und lächelte dabei nie. Sein gesamter Gesichtsausdruck veränderte sich nie.
Sechs Dutzend verwundete Soldaten hatten sich in der Nähe auf Feldbetten versammelt und hörten zu, während Ralph mir die ganze Geschichte erzählte. Er erzählte sie wirklich ernsthaft, wurde aber immer wieder von schallendem Gelächter der Rekonvaleszenten unterbrochen –– immerhin ein freundliches und bewunderndes Lachen.
"Wir befanden uns alle unter Deck", sagte er. "als plötzlich dieses französische Schiff direkt auf uns zusteuerte und eine seiner Granaten unsere Bordwand durchschlug. Das verdammte Ding explodierte direkt in meinem Gesicht."
Einige der verwundeten Soldaten im Zelt hatten denselben gerade beschriebenen, tödlichen Alptraum durchgemacht, lachten aber dennoch über diese Bemerkung, als hätte Bob Hope einen Scherz gemacht.
"Ich habe keinen Ton gehört", fuhr Ralph fort. "Es machte einfach 'schtppfftt' –– das war alles, was ich je vernommen habe. Dann wurde ich ohnmächtig.
"Als ich wieder zu mir kam, war alles ruhig. Ich dachte, die Schlacht sei vorbei. Das Schiff war voller Ammoniak und Rauch. Ich konnte kaum atmen und wäre fast erstickt. Mein Herz schmerzte und alles tat mir weh. [Gelächter] Ich bekam nicht genug Luft zum Atmen –– ach was, nicht einmal genug Rauch, denn nur der war überall. [Mehr Gelächter]
"Schließlich begann ich, eine Leiter hochzuklettern. Als ich meinen Kopf an Deck steckte, konnte ich immer noch nichts hören, aber die Luft war voller Leuchtspurgeschosse. Dann erst bemerkte ich, dass tote Männer auf dem Deck lagen. Wieder wurde ich ohnmächtig. Die frische Luft war einfach zu viel für mich. [Gelächter]
"Als ich wieder zu mir kam, lag ich drüben an der Reling unter einem Stapel toter Kameraden. Das war nicht lustig, denn die toten Kumpels wollten sich einfach nicht bewegen lassen. [Gelächter] Ich dachte, ich käme da nie wieder raus."
In dieser Art ging die Geschichte weiter. Als es schon spät war, schüttelten wir die Hände. "Bist du verheiratet?", fragte ich.
"Ob ich verheiratet bin?", fragte er. "Nein, ich bin ledig –– besser gesagt, ich bin noch bei Sinnen."
Die verwundeten Soldaten brüllten vor Lachen.
In Oran fanden die wahrscheinlich härtesten Kämpfe während der gesamten Besetzung Nordafrikas statt. Viele der Soldaten, die ich in England kennengelernt hatte, waren dort und erzählten mir alles über die Geschehnisse. Sie gaben ausnahmslos zu, dass sie eine Heidenangst hatten.
Verstehen Sie das bitte nicht falsch. Sie haben natürlich niemals aufgegeben. Aber es war das erste Mal, dass sie unter Beschuss gerieten, und da Soldaten auch nur Menschen sind, "hatten sie eine Heidenangst". Oder, wie ein Private sagte: "In den ersten Tagen litt kein einziger Kamerad unter Verstopfung".
Ich fragte einen Offizier, wie die Männer mit ihrer Furcht umgingen. Er antwortete, dass sie sich größtenteils nur mitleidig ansahen und enger zusammenrückten, um nicht allein zu sein in ihrem Elend.
Als die erste schwere Phase vorbei war, herrschte aber bald wieder Zuversicht bei den Truppen. Plötzlich war da ein Enthusiasmus zu spüren, den es in England nicht gegeben hatte, auch wenn die Moral dort hoch war. Damals warteten alle ungeduldig darauf, dass es endlich losging und man es hinter sich bringen konnte. Nun aber, da sie erst einmal angefangen hatten, waren sie begierig darauf, weiterzumachen.
In der ersten Nacht der Landung, als die Soldaten in großen stählernen, motorisierten Booten an den Strand kutschiert wurden, passierten viele lustige Dinge. Ein durchaus bekannter Offizier wollte mit einem Jeep direkt an Land fahren, aber man ließ das klappbare Ende des Bootes zu früh herunter, sodass der Jeep in über zwei Meter tiefem Wasser landete. Andere Landungsboote wiederum fuhren so weit das Ufer hinauf, dass die Männer abspringen konnten, ohne sich die Füße nass zu machen.
Der Strand glänzte im Mondschein und es herrschte Totenstille. Ein kleiner Trupp hörte erst lange nach Tagesanbruch am nächsten Morgen einen Schuss, aber das Mondlicht, die Schatten und die überraschende Stille machten den Soldaten solche Angst, sodass jede Unterhaltung nur im Flüsterton geführt wurde, während man sich über die Hügel ins Landesinnere vorarbeitete.
Jeder Trupp hatte vor der Landung die Parole erhalten. In den Schatten konnten die Soldaten natürlich nicht erkennen, wer da in seiner Umgebung war, und jeder hatte Angst, von den eigenen Männern erschossen zu werden. Also wurde in den Hängen rund um Oran die ganze Nacht über die Parole an jeden sich nähernden Schatten geflüstert.
Ein Freund von mir, Lieutenant Colonel Ken Campbell, nahm acht französische Soldaten mithilfe einer Zigarettenschachtel gefangen. Das Ganze war purer Zufall. Er stolperte über einen Araber, der am Strand schlief, und der ihm erzählte, dass sich in einem Gebäude auf einem der Hügel Soldaten befänden. Campbell schlich sich an, den Revolver in der Hand, und öffnete die Tür. Die Franzosen schliefen tief und fest. Kurz entschlossen steckte er den Revolver zurück in seinen Holster und weckte die Männer. Sie waren zutiefst erschrocken und äußerst verwirrt. Campbell, der perfekt französisch sprach, unterhielt sich mit ihnen, spendierte ihnen Zigaretten und teilte ihnen mit, dass sie gefangen genommen worden waren. Nach einer Weile führte er sie ab.
Der Private Chuck Conick aus Pittsburgh erzählte mir, wie sich die Soldaten während der ersten Märsche fühlten –– dass alle Angst hatten, aber in den Pausen zwischen den Vormärschen nicht darüber sprachen. Sie fragten sich vor allem, was in den Zeitungen zu Hause über die Kämpfe stehen würde. Immer wieder hörte er die Jungs sagen: "Wenn meine Eltern mich jetzt nur sehen könnten!"
Die Kameraden aus New Mexico und Arizona waren erstaunt, wie sehr die nordafrikanische Landschaft ihrem eigenen wüstenähnlichen Südwesten ähnelte. Im Mondlicht jener ersten Nacht sahen die sanften, baumlosen Hügel für sie wie ihre Heimat aus.
Während des gesamten Vormarsches wurden die Truppen in fast schon ulkiger Weise von Horden arabischer Kinder verfolgt, die sich um die Geschütze drängten, bis sie tatsächlich nur noch im Weg waren. Die arabischen Männer waren sehr ruhig, ja sogar gelassen, und selbst die zerlumptesten unter ihnen strahlten eine gewisse Würde aus. Da unsere Jungs den traurigen und ausgemergelten Gesichtern der Kinder nicht widerstehen konnten, begannen sie, ihre Rationen zu verschenken.
Tagsüber war es heiß, so heiß, dass die vorrückenden Soldaten immer wieder Teile ihrer Kleidung auszogen und sogar wegwarfen, bis einige nur noch Unterhemden trugen. Nachts wurde es allerdings so empfindlich kühl, dass sie sich wünschten, sie hätten es nicht getan.
Der französische Widerstand reichte von sofortiger Aufgabe und Kooperation bis hin zu erbitterten Kämpfen auf Leben und Tod, wobei die Franzosen in den meisten Gebieten nur zu feuern schienen, wenn auf sie geschossen wurde. Später erfuhren wir, dass viele französische Truppen nur drei Kugeln für jedes Gewehr zur Verfügung hatten. An anderen Stellen leisteten dafür die 75-mm-Geschütze verheerende Arbeit.
Die erfahreneren Soldaten sagten mir, dass ihnen das MG- und Gewehrfeuer nicht so viel ausmachte, aber der schreckliche Krach und die unheimliche Genauigkeit der 75er ließen ihnen das Herz stehen bleiben.
Die Jungs, die all dies mitgemacht haben, werden für immer daran denken. Viele von ihnen meinten, sie würden sich vor allem an kleine, schöne Dinge erinnern, wie die im Mondlicht liegenden Hügel und die unheimliche Ruhe am Strand, als sie landeten.
Im Großen und Ganzen waren die amerikanischen Streitkräfte in Nordafrika willkommen. Vor allem in Oran war der Empfang überwältigend. Das Erste, was nach den Kämpfen in die Stadt rollte, war ein Panzer. Er fuhr durch die Straßen und hielt auf dem zentralen Platz an. Die sich sofort versammelnden Menschen wussten nicht, ob der Panzer ein französischer, britischer, amerikanischer oder was-auch-immer war. Die gerade passierenden Ereignisse hatten sie sehr verwirrt. Schließlich steckte ein Offizier seinen Kopf aus dem Turm, und jemand fragte laut nach seiner Nationalität. Da der Offizier kein Französisch verstand, antwortete er etwas auf Englisch. Als die Menge seinen amerikanischen Akzent erkannte, setzte frenetischer Jubel ein. Frauen küssten ihn auf die Wangen, und die Menge hätte ihn fast davongetragen. Stundenlang lief er mit Lippenstift im Gesicht herum.
Soldaten der ersten in die Stadt vorrückenden Einheiten beschrieben die Freude über die Ankunft der Amerikaner als geradezu wahnsinnig. Sie analysierten die Stimmung etwa wie folgt: Vierzig Prozent der Gefühlsausbrüche beruhten auf der Vorliebe der Franzosen für Show –– für den Jubel über alles, was vorbeikommt; zwanzig Prozent waren der Weitsicht geschuldet, dass unsere Ankunft schlussendlich die Befreiung Frankreichs bedeuten konnte, und weitere vierzig Prozent beruhten auf persönlicher und körperlicher Dankbarkeit für die Aussicht, wieder etwas zu essen zu bekommen.
Die Deutschen hatten große Mengen afrikanischer Lebensmittel über das Mittelmeer nach Frankreich und weiter nach Deutschland verschifft. Die Menschen in Oran waren in einem erbärmlichen Zustand, buchstäblich am Verhungern. Die amerikanische Besatzung machte den Ausfuhren nach Deutschland natürlich sofort ein Ende. Außerdem spendete unsere Armee der Stadt riesige Lebensmittelvorräte, sodass die Menschen allmählich wieder essen konnten –– und ein hungernder Mensch ist fast jedem, der ihm etwas zu essen anbietet, mehr als wohlgesonnen.
Die Großzügigkeit der Amerikaner grenzt bekanntlich oft an Torheit. Die Soldaten der ersten Welle gingen nur mit Feldverpflegung in Dosen an Land, spendierten aber dennoch einen Großteil dieser Nahrung den bedauernswert aussehenden arabischen Kindern. Das Ergebnis war, dass die Männer selbst bald nicht mehr viel zu essen hatten und tagelang von Orangen lebten.
In England waren Orangen so gut wie unbekannt, so dass wir uns nur zu gerne davon ernährten. Einige Soldaten aßen so viele, dass sie Durchfall und Ausschlag bekamen. Ich kaufte winzige, aber sehr saftige Mandarinen, die ich in meinen Taschen mit mir herumtrug. Sie kosteten einen Franc pro Stück, etwa einen und ein Drittel Cent.
Wir waren alle mit amerikanischem Geld für den Auslandseinsatz ausgestattet. Der kleinste Nennwert, der Eindollarschein, sah genauso aus wie unser normales Geld, trug aber einen gelben Stempel. Dieser war für den Fall gedacht, dass etwas von dem Geld in die Hände des Feindes fiel. Der Stempel würde es sofort unbrauchbar machen. Unsere Scheine wurden überall akzeptiert, aber das Wechselgeld erhielten wir in Francs. Der Wechselkurs lag bei fünfundsiebzig Francs für einen Dollar. Die Preise begannen schnell zu steigen, aber nach unseren Maßstäben waren sie immer noch niedrig. Guter Wein kostete nur vierundvierzig Francs die Flasche, und ein edler Tropfen war so ziemlich das Einzige, was man überhaupt kaufen konnte. Die Vorräte in den Geschäften waren praktisch nicht existent, und in den Restaurants stand Pferdefleisch auf der Karte.
Oran ist eine große Stadt, die mich sehr an Lissabon erinnert. Man sieht moderne Bürogebäude und schöne Wohnhäuser mit sechs und acht Stockwerken. Als wir ankamen, stand der Ausstellungsraum des Renault-Händlers voll mit nagelneuen Autos. Nach ein paar Tagen hatte die Armee alle Fahrzeuge gekauft und in ein paar weiteren Tagen das Rote Kreuz den Ausstellungsraum übernommen und ihn in einen Soldatenclub verwandelt, in dem die Soldaten um das Klavier herumstanden und "The White Cliffs of Dover" sangen.
Einige unserer Jungs sprachen Französisch, aber eben nur einige. In ganz Oran gab es nach wenigen Tagen kein einziges französisches Wörterbuch mehr zu kaufen, aber die Soldaten hatten keine Hemmungen in Sachen Sprache und kamen mit ihrem Kauderwelsch-Französisch und lautem Gebrüll ganz gut zurecht.
Kaum waren die Amerikaner da, begannen die Geschäfte, ihre Schaufenster mit Splitterband abzukleben, denn ihnen war klar, dass bald deutsche Bombenangriffe folgen würden. Es war interessant, den Unterschied zwischen dem französischen und dem britischen Naturell an der Methode zu sehen, wie die Fenster abgeklebt wurden. In England geschah dies in der Regel auf eine ziemlich konventionelle Art und Weise, hier machte man ein Kunstwerk daraus. Die Muster waren oft so kompliziert, dass sie an das Bild einer Schneeflocke unter dem Mikroskop erinnerten. Das eine Geschäft arbeitete seinen Namen in ein Muster ein, das nächste machte aus dem Band einen Rahmen für ein Dutzend Bilder, die im Schaufenster hingen.
In jenen frühen Tagen überflogen hin und wieder deutsche Flugzeuge die Stadt. Auch Bodengeschütze feuerten manchmal in unsere Richtung, aber die Bomben und Granaten richteten keinen Schaden an. Oran war nicht einmal verdunkelt. Das Licht wurde, sagen wir, etwas gedämpft, aber das Ergebnis konnte man nicht wirklich dunkel nennen. Erst wenn feindliche Flugzeuge auf die Stadt zuflogen, wurden alle Lichter gelöscht. Außerdem hatte die Armee die Stadt mit Nebeltöpfen umgeben. Wenn diese gezündet wurden, erzeugten sie so etwas wie einen dichten Rauch, der die Stadt sehr gut verbarg.
Oran, so fanden wir, war gar nicht so übel. Dennoch hätten die meisten Amerikaner die ganze Stadt gegen den schlimmsten Ort in den Vereinigten Staaten eingetauscht und noch hundert Dollar obendrauf gelegt. So sind die Amerikaner eben –– auch ich. Die meisten von uns hatten bis Kriegsbeginn noch nie etwas von Oran gehört, und doch ist die Stadt größer als El Paso. Es gibt palmengesäumte Straßen, breite Bürgersteige, Straßencafés, einen schönen Hafen, Restaurants mit sanfter, farbiger Beleuchtung und Apartments mit Aufzügen. Andererseits aber auch Araber in zerlumpten Kaftanen, Müll in den Rinnsteinen, schrecklich abgemagerte Hunde und mehr Pferdekarren als Automobile.
Die meisten Amerikaner lästerten darüber, wie schmutzig Oran war. Was wiederum beweist, dass sie nicht viel von der Stadt gesehen haben. Oran war sauberer als manche der ärmeren lateinamerikanischen Städte in unserer Hemisphäre. Und zu dieser Jahreszeit roch es nicht einmal besonders schlimm.
Einige Reisende, die bereits die ganze Welt gesehen hatten, sagten mir einmal, Oran habe eine orientalische Atmosphäre –– was ich nie nachvollziehen konnte. Mir schien es eher eine lateinamerikanische Stadt zu sein als eine orientalischem, und man könnte sie in vielerlei Hinsicht mit El Paso vergleichen, wenn man mal den Hafen außer Acht lässt. Das Klima ist in etwa das gleiche. Beide Städte liegen in halbtrockener Umgebung und in beiden ist es im Frühjahr staubig und im Sommer sehr heiß. Beide sind von fruchtbarem, bewässertem Land umgeben, auf dem Obst, Gemüse und Getreide angebaut werden.
Die Bevölkerung Orans besteht hauptsächlich aus Franzosen, Spaniern und Juden. Araber sind dort eine Minderheit. Man sieht sie in Gestalt hässlicher Bettler bis hin zu vornehmen Männern in langen weißen Gewändern und hellen Turbanen, die in den teuersten Cafés sitzen und an teuren Getränken nippen. Dennoch gibt es viel mehr Europäer als Araber.
Anfangs waren unsere Soldaten in Oran ziemlich verloren, Offiziere und Mannschaften gleichermaßen. Es gab dort nicht die üblichen Unterhaltungsetablissements wie zu Hause oder in England. Außer Wein gab es nicht viel zu trinken, und die meisten Amerikaner hatten noch nicht gelernt, wie man diesen mit Genuss trank. Es gab nur wenige und ziemlich schlechte Filme und keinerlei Tanzveranstaltungen. Die Mädchen in Oran waren sehr hübsch, aber die meisten Eltern waren sehr heikel und ließen sie meistens überhaupt nicht raus.
Es fühlte sich für alle sehr merkwürdig an, sich nicht mit den Einheimischen unterhalten zu können. Die Soldaten bemühten sich sehr, ihr Französisch zu verbessern, hatten dabei aber nicht viel Spaß. Die Offiziere, die hier an Schreibtischstühlen klebten, wollten unbedingt weiterziehen und die Truppen, die weit draußen auf dem Land kampierten –– und das waren die meisten –– fühlten sich dort besser aufgehoben als in der Stadt.
Lieutenant Nat Kenney aus Baltimore besaß ein altes, ziemlich marodes Motorrad, mit dem er das Land bereiste. Eines Tages fuhr er damit nach Arzeu, etwa zwanzig Meilen von seinem Stützpunkt entfernt. Als er an einer monströs aussehenden Eidechse vorbeikam, die auf dem Bürgersteig in der Sonne lag, hielt er an und fuhr zurück.
Die Eidechse war etwa einen Meter lang, zuzüglich sechs Zentimetern Schwanz. Das Ding wechselte irgendwie ständig die Farbe und seine Augen konnten sich einzeln und in jede Richtung bewegen. Es war in der Tat ein übel aussehender Kumpan. Nat stupste das Tier vorsichtig mit seinem Schuh an, aber es griff ihn nicht an. Dann stupste er es mit seiner behandschuhten Hand an, aber es versuchte immer noch nicht zuzubeißen. Dann hielt er ihr die Hand vor die Nase, und die Eidechse krabbelte an seinem Handschuh hoch, als hätte sie die ganze Zeit auf ihn gewartet.
Da Nat stillhielt, krabbelte die Eidechse munter weiter, seinen Arm hinauf, über die Schulter, seinen Nacken hinauf und schließlich auf seinen Kopf. Dort rollte sie sich zusammen, ruhte sich auf dem Scheitel seiner Mütze aus und schaute schlangenartig nach vorne über seine Stirn. Der von einem "Drachen" gekrönte Nat stieg wieder auf sein Motorrad und fuhr weiter nach Arzeu.
Dort stellte er das Motorrad ab und spazierte die Straße hinunter. Immer wieder begegnete er ihm bekannten Soldaten, die vor ihm salutierten, bis ihnen plötzlich die Münder offenstanden und sie glucksten: "Lieutenant, um Himmels willen, nein!"
Anschließend aß Nat zu Abend, die Eidechse immer noch bequem auf seinem Kopf liegend, und verbrachte eine für ihn sehr lustige Stunde damit, durch die Stadt zu gehen und seine Freunde zu erschrecken. Dann stieg er wieder aufs Motorrad und fuhr zurück bis fast nach Oran. Schließlich hielt er an einem Feldlazarett an, in dem er einige der Ärzte kannte. Dort ließ er seinen neuen Freund zurück, damit man ihn dort eingehend untersuchen konnte.
Insgesamt verbrachte die Eidechse etwa drei Stunden auf Nats Kopf und fuhr etwa dreißig Meilen mit ihm mit. Nach diesem Vorfall dachte die Armee darüber nach, Lieutenant Kenney nach Island zu versetzen, weil man befürchtete, dass er als nächstes mit einem Kamel auf dem Lenker durch die Stadt fahren würde.
Der amerikanische Soldat lässt sich die Verbrüderung mit seinen Mitmenschen nicht verbieten. Ungeachtet der sprachlichen Barrieren kamen unsere Jungs irgendwie mit den Einheimischen aus und verstanden sich, auch wenn sie kein Wort Französisch oder Arabisch sprachen. Ich habe einen Soldaten gesehen, der mit zwei französischen Mädchen und deren Vater an einem Tisch in einem Café saß und offenbar den ganzen Abend nur lächelte und gestikulierte. Und ich traf Amerikaner, die Arm in Arm mit Franzosen der Fremdenlegion spazieren gingen. Worüber sie sprachen oder es wenigstens versuchten, weiß ich nicht. Ein wirklich komischer Anblick war einer unserer Jungs, der mit einem englisch-französischen Wörterbuch in der Hand auf der Straße stand, sich mit einem Mädchen unterhielt und jedes Wort nachschlug, während er es sprach.
Eines Nachts, weit draußen auf dem Land, kam ich an einem kleinen Feuer am Straßenrand vorbei, an dem zwei amerikanische Soldaten und zwei Araber mit Turbanen und Schnurrbart wie alte Kumpel eng beieinander hockten –– ein wirklich rührender Anblick.
Unsere Soldaten wurden stinkreich, denn es gab ja fast nichts zu kaufen. Sie deckten sich mit Parfüm und Lippenstiften ein, die es in Hülle und Fülle gab. Das Parfüm schickten sie an ihre Mädchen in Amerika und die Lippenstifte an die in England –– die alten Schürzenjäger.
Das einheimische Kunsthandwerk definiert sich hauptsächlich durch Silberarbeiten, Teppichweberei und Lederverarbeitung. Einige der algerischen Teppiche ähnelten denen unserer Navajo-Indianer. Sie waren wunderschön und preislich ungefähr genauso angesiedelt. Ein mir bekannter Offizier wollte sich einen arabischen Ornat anfertigen lassen, um diesen nach dem Krieg auf Kostümbällen zu tragen. Dann fand er heraus, dass das gute Stück etwa hundert Dollar kosten würde, er eine Sondergenehmigung bräuchte, um die Materialien zu bekommen, und die Herstellung mehrere Wochen bis sechs Monate dauern könnte.
Anfangs waren gar nicht mal so viele amerikanische Seeleute in Oran, aber die Navy kümmerte sich wie üblich hervorragend um die, die vor Ort dienst leisteten. Eines Tages traf ich Lieutenant William Spence, einen guten Freund von mir, der mich einlud, mir das von ihm geleitete Marinehospital anzusehen.
Lieutenant Spence war vor dem Krieg in Bellevue, New York, tätig. Am Morgen der Landung der Amerikaner ging er hier mit acht Männern von Bord und verbrachte die nächsten Tage damit, verwundete Seeleute und andere Soldaten am Strand zu versorgen. Dann fuhren die Männer nach Oran und suchten nach einem Ort, um ihr Krankenhaus einzurichten. Als sie ein leerstehendes Gebäude des französischen Roten Kreuzes fanden, zogen sie dort ein. Ein oder zwei Tagen besaß die Navy das wahrscheinlich schönste Krankenhaus Nordafrikas –– das obendrein voll funktionsfähig war.
Ich bin immer gern mit Marinesoldaten zusammen, denn diese kümmern sich wirklich hervorragend um einen. Als ich den lästigen Husten von der Konvoiüberfahrt nicht losbekam, gaben sie mir eine Flasche Hustensaft und machten sogar ein Blutbild, um herauszufinden, ob ich überleben würde oder nicht.
Es stellte sich heraus, dass der Apothekergehilfe, der mir die Medizin abfüllte, ein alter Hoosier-Junge war –– er wohnte nämlich nur zwanzig Meilen von dem Ort entfernt, an dem ich aufgewachsen war. Sein Name war Ben Smith, 620 South Fifth Street, Terre Haute, Indiana.
Einer der Lazarettkommandanten, der am ersten Morgen der Besatzung an Land ging, hatte eine spannende Geschichte zu erzählen. Anscheinend hatte das Sanitätskorps eine Kaserne übernommen, die die Franzosen in aller Eile geräumt hatten, und diese in ein Krankenhaus umfunktioniert. Als die Amerikaner die Kaserne voller Munition vorfanden, bekam es der Offizier mit der Angst zu tun, dass die Franzosen nachts zurückkommen und versuchen würden, das Gebäude zurückzuerobern.
Sein Problem war gelöst, als er zwei Maschinenpistolenschützen auf der Straße sah. Er eilte hinaus und fragte sie, ob sie die ganze Nacht die Munition bewachen könnten. Sie antworteten: "Sicher", und der Doktor konnte sich endlich seiner Arbeit widmen.
Es dauerte ein paar Tage, bis die Kämpfe vorbei waren, und die beiden Wachen kamen ihm erst eine Woche später wieder in den Sinn, als er sie zufällig traf. Sie hatten sich nicht bei ihrer Einheit zurückgemeldet, sondern hingen immer noch in der ehemaligen Kaserne herum und bewachten treu die Munition.
Und warum haben sie das getan? Die Antwort ist einfach. Das Essen im Krankenhaus war schon immer besser als das der Armeeküchen. Diese Männer hatten in ihren ersten Dienstmonaten definitiv dazugelernt.