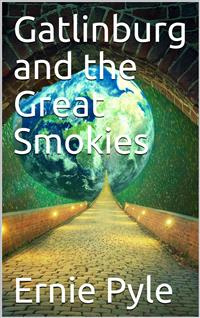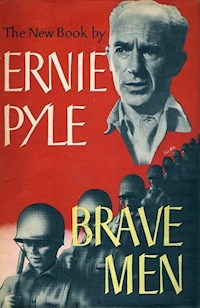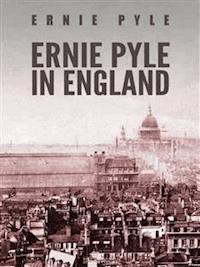5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ernest Taylor Pyle (3. August 1900 - 18. April 1945), überall als "Ernie" bekannt, war ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter amerikanischer Journalist und Kriegsberichterstatter, der vor allem für seine Geschichten über einfache amerikanische Soldaten während des Zweiten Weltkriegs bekannt ist. Als die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg eintraten, verlieh er seinen Kriegsberichten aus dem europäischen (1942-44) und pazifischen Raum (1945) den gleichen unverwechselbaren, volkstümlichen Stil wie seinen sonstigen alltäglichen Geschichten. Im Dezember 1940 meldete sich Pyle freiwillig nach London, um über die Schlacht um Großbritannien zu berichten. Er wurde Zeuge der deutschen Brandbombenangriffe auf die Stadt und berichtete über den wachsenden Konflikt in Europa. Seine Erinnerungen an die Erlebnisse dieser Zeit wurden in seinem Buch "Die Menschen sind die wahren Helden" (im Original "Ernie Pyle in England") veröffentlicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die Menschen sind die wahren Helden
Als Kriegsreporter im Winter 1940/41 in England
Deutsche Neuübersetzung
ERNIE PYLE
Die Menschen sind die wahren Helden, E. Pyle
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849662820
www.jazzybee-verlag.de
Inhalt:
VORWORT.. 1
I. UNTERWEGS. 5
II. ALLES RUHIG... 16
III. ABSCHEULICH UND WUNDERSCHÖN.. 35
IV. DIE MENSCHEN SIND DIE WAHREN HELDEN... 62
V. GESCHÜTZE UND BOMBER.. 87
VI. DIE HÖHLENBEWOHNER.. 114
VII. AUSFLUG IN DEN NORDEN.. 137
VIII. MORD IN DEN MIDLANDS. 166
IX. DAS WAR NOCH GAR NICHTS. 182
X. BOMBEN TUN DIE SELTSAMSTEN DINGE.. 203
EPILOG... 229
VORWORT
Als im letzten Herbst die großen Luftschlachten über England ausgefochten wurden und wir in Amerika zum ersten Mal das zerbombte London in voller Realität zu sehen bekamen, wuchs in mir ein fast übermächtiger Drang, mich mitten ins Geschehen zu stürzen. Bis heute kann ich nicht in Worte fassen, was mich dabei geritten hat. Ich bin von Berufs wegen dauernd unterwegs, aber es war nicht die Neugierde, "zu sehen, wie es ist", die mich auf die Idee brachte, nach England zu wollen. Ich bin Zeitungsreporter, aber die "Geschichte", die ich zurückschicken könnte, kam mir kaum in den Sinn. Ich wollte einfach nur als Mensch dort hingehen –– tief in mir drin wollte ich auf der anderen Seite des Atlantiks sein.
Mir schien, dass sich in London ein spiritueller Holocaust ereignete –– eine Art Prüfung der Menschheit ––, der sich in unserer Zeit nie mehr wiederholen würde. Ich hatte das Gefühl, ein echtes Desinteresse am Leben auszudrücken, indem ich einfach so weitermachte wie bisher und eine Gelegenheit zur Teilnahme an dem bedeutsamsten Ereignis meiner Tage ausließ. Irgendwie glaubte ich, dass jeder, der die Angst und den Schrecken der Londoner Bombenangriffe durchlebt hat, sich unweigerlich an dieser Erfahrung bereicherte.
Also reiste ich hin. Allerdings entwickelten sich die Dinge nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Zum einen erschien mir die Lage nie so dramatisch, als ich dort war. Alle Elemente, die ich mir ausgemalt hatte, waren wohl vorhanden, aber anscheinend war ich nicht in der Lage, mich von ihrer Gesamtheit in eine große neue Vollkommenheit des Geistes transportieren zu lassen. Soweit ich mich selbst beurteilen kann, fühle ich mich nicht anders als vor meiner Reise. Weder empfand ich geistig gereinigt noch erhaben in meinem Wesen zu sein. Ich durfte lediglich eine Weile meine Knochen am Rost des Krieges räuchern; sie –– die Menschen in England –– sind die Glut und die Kohlen und die Flammen, die dieses Feuer ausmachen. Wir, die wir hingehen und wieder zurückkehren dürfen, können neben ihnen nur sehr klein erscheinen.
Vom Tag seiner Kriegserklärung an stand ich leidenschaftlich auf der Seite Großbritanniens. Aber ich bin kein intellektueller Moralapostel; die Denker, die den Krieg als "Sache" begreifen, machen mich fassungslos. Ich wollte einfach, dass England gewinnt, weil es mir sicherer und vernünftiger erschien, England die Welt regieren zu lassen als Deutschland. Und heute, nachdem ich dort gewesen bin, denke ich immer noch genauso.
Irgendwie scheint es unvermeidlich, dass es eine dominierende Nation in der Welt gibt. Ich vermute, es ist dasselbe Prinzip, das bestimmte Seifen zum Schwimmen bringt oder das ein Pferd anstelle aller anderen Teilnehmer ein Rennen gewinnen lässt. Die dominierende Nation gibt das Tempo für einen großen Teil der Welt vor. Und wenn der Tempomacher nur England oder Deutschland heißen kann, dann scheint es mir äußerst klug, England zu wählen.
Die tatsächliche Politik einer Weltherrschaft wird nicht so sehr von den Führern und einzelnen Vertretern eines Landes geprägt, sondern von dem Hintergrund des Grundcharakters des ganzen Volkes. Und wenn ich es vorher nicht gewusst habe, so habe ich in diesem Winter entdeckt, dass der nationale Charakter der Briten ein sehr edler ist. Sicherlich gibt es Dinge, die wir an ihnen verachten; es gibt unerträgliche Engländer zu Hunderttausenden. Doch wenn man sie nach ihrer Herzensgüte und ihrer Art, mit dem Leben umzugehen, beurteilt –– was man tun muss, wenn man entscheiden will, wer den Rest der Welt beherrschen soll –– , dann erscheinen mir die Engländer als Führer fast perfekter als jede andere Nation der Welt.
Ich habe so gut wie keinen Hass auf die Deutschen. Das hatte ich nie und habe es auch heute noch nicht –– nicht einmal, nachdem sie den Himmel über meinem eigenen kostbaren Kopf mit Bomben gespickt hatten. Ich verstehe nicht, wie man Deutschland vorwerfen kann, "Mr. Big" in dieser Welt sein zu wollen. Will England dies etwa nicht? Und will Amerika die zweite Geige nach Italien, Deutschland oder Japan spielen? Nein, natürlich nicht.
Man kann nicht anders, als Tod und Zerstörung aufs Schärfste zu verurteilen, und manchmal versinkt man in einer verzweifelten, abgrundtiefen Hoffnungslosigkeit, wenn man im Zentrum einer völligen Verwüstung steht –– und doch ist es Krieg, und ich kann weder Deutschland noch England die Schuld geben, dass sie kämpfen und zurückschlagen. Sie sind beide Teile des Krieges und platzieren ihre Schläge, und möge der Bessere gewinnen. Und wenn England nicht der Bessere ist, möge es trotzdem gewinnen –– verflucht noch mal.
Was meine eigene Geschichte angeht, falls es Sie interessiert: Ich bin ein Landwirt, der vergessen hat, wie man Landwirtschaft betreibt, und ein Reporter, der schon so viele Jahre dabei ist, dass ich nichts anderes mehr auf der Welt kann, als für Zeitungen zu arbeiten und zu schreiben. Ich kann nicht einmal mehr einen Knopf annähen.
Es ist jetzt achtzehn Jahre her, dass ich die Schule abgebrochen habe und bei einem kleinen Tageblatt in Indiana anfing, und jede Minute dieser Zeit habe ich bei Zeitungen verbracht. Ich habe alles ausprobiert, wie man so schön sagt. Ich habe jeden Job bei einer Zeitung ausgeübt, vom Nachwuchsreporter bis zum Chefredakteur.
Fast die gesamten achtzehn Jahre habe ich bei den Zeitungen des Scripps-Howard Verlages verbracht. Ich bezweifle, dass es jemals eine glücklichere Verbindung zu einem auf Profit orientierten Unternehmen gegeben hat als die meine. Ich hatte nie einen Chef, der nicht auch ein Gentleman war; ich hatte nie einen Vorgesetzten, der nicht auch mein Freund war. Scripps-Howard ist immer gut zu mir gewesen und liberal obendrein. Es war eine verrückte Idee, als ich die Verantwortlichen vor etwa sechs Jahren bedrängte, mich vom Schreibtisch abzukommandieren, mit meinem Auto herumfahren und eine tägliche Kolumne über alles schreiben zu lassen, was mir gerade in den Sinn kam.
Aber sie sagten, okay, nur zu, versuchen Sie es. Seitdem habe ich 200000 Meilen zurückgelegt, war auf fünf von sechs Kontinenten, habe beide Ozeane überquert, jedes Land der westlichen Hemisphäre erkundet und mehr als 1500000 Wörter in dieser täglichen Kolumne geschrieben.
Es war ein fröhliches Leben. Ich bin den Yukon River auf einem Dampfer hinuntergefahren, habe mit Leprakranken auf Hawaii gelebt, Lamas auf den Gipfeln der Anden gestreichelt und mich am trägen Leben in Rio erfreut. Es gibt keinen Staat der Vereinigten Staaten, in dem wir nicht mindestens dreimal gewesen sind.
Mit "wir" meine ich die andere Hälfte dieser fantastischen Kombination, die den Lesern dieser Kolumne als "das Mädchen" bekannt ist. Fast überall, wo ich war, war sie dabei. Sie verbringt ihre Zeit damit, Bücher zu lesen, Kreuzworträtsel zu lösen, Wissen aufzusaugen und mich davor zu bewahren, aus der Haut zu fahren. Bei all unseren kleinen Triumphen und all unserem großen Kummer war sie stets dabei.
Aber dann kam England. Und England war anders. Die Regierung wollte sie nicht gehen lassen. Ihr fiel die weitaus größere Aufgabe zu, daheimzubleiben und zu warten. Aber nun, da diese "große Erfahrung" vorüber ist, haben wir uns wieder gemeinsam auf den Weg gemacht, genau wie früher, einfach umherstreunend, mit Leuten redend und über den Regen und andere Dinge schreibend. Zumindest glaube ich, dass dem so war. Vielleicht machen wir uns aber auch nur etwas vor. Vielleicht tun wir nur so, als hätten wir den Lauf der Welt dort wieder aufgenommen, wo wir ihn im letzten Herbst verlassen haben. Höchstwahrscheinlich ist an der Theorie, dass unser Leben, wie das aller anderen auch, nie wieder so wie vor 1940 sein kann, doch etwas dran.
Los Angeles
Juli, 1941
I. Unterwegs
1. Bedenken
New York,
November, 1940
Nachts hörte ich eine leise Stimme, die sagte: "Geh."
Und als ich meinen Plan meinem Boss vorlegte, lehnte dieser sich in seinem Stuhl zurück und sagte: "Geh."
Als ich schließlich mit meinem sogenannten Gewissen allein war und es fragte, was ich tun sollte, zeigte es auf mich und sagte: "Geh."
Und nun bin ich auf dem Weg nach London.
Nie zuvor habe ich eine lange Reise mit etwas anderem als Freude im Herzen angetreten. Bei dieser Reise ist das anders. Diese Reise ist kein Spaß. Es wird hart werden, das weiß ich.
Ich werde Angst haben. Ich weiß, dass ich mich klein und deplatziert fühlen werde, inmitten von Menschen, die um Leben und Tod kämpfen.
2. Überfahrt
An Bord der S.S. Exeter,
Dezember 1940
Das Auslaufen eines Schiffes ist überall auf der ganzen Welt ein fröhliches Ereignis. Ein Schiff befördert Menschen aus der Realität in die Illusion. Menschen, die eine Schiffsreise unternehmen, fahren zu schöneren Dingen. Aber als wir nach Europa fuhren, war das entschieden anders. Auf der "Exeter" war keinerlei Fröhlichkeit zu verspüren. Niemals, auf keinem Ozean und in keiner Klimazone, habe ich ein Schiff so trostlos abfahren sehen. Ich bezweifle, dass es an Bord auch nur eine einzige Person gab, die Freude empfand. Und ganz sicher reiste niemand einfach nur zum Vergnügen. Die "Exeter" brachte ihre menschliche Fracht eher in die harte Realität, als diese hinter sich zu lassen.
An Bord des Schiffes gab es keine Abschiedsfeiern. Die wenigen Leute, die von Angehörigen oder Freunden verabschiedet wurden, saßen in den Lounges in kleinen Grüppchen und unterhielten sich mit gedämpften Stimmen.
"Das Mädchen" war mit mir auf dem Schiff. Und auch ein alter Freund, den wir beide seit Jahren nicht mehr gesehen hatten –– Jim Moran, der Kerl, der die Nadel im öffentlichen Heuhaufen suchte und einem Eskimo auch einen Eisschrank verkaufen konnte. Vielleicht haben Sie über ihn gelesen. Wir kannten Moran schon, als er noch ein blutiger Anfänger war. Er war ein fröhlicher Kerl, und wir waren dankbar, dass er mit uns fuhr. Er tat sein Bestes, um die trübe Stimmung bis zur Abreise ein wenig aufzulockern.
"Seht euch nur die Passagiere an", sagte Moran. "Überall Spione. Geheimagent Y-32. Da drüben, die Mata Hari des Jahres 1940. Jeder versucht, den anderen zu belauschen.
"Ernie, du brauchst eine Aktentasche. Besorg dir eine wichtig aussehende Tasche und stopf sie mit Zeitungen voll. Mach ein großes Vorhängeschloss dran. Nimm sie überall mit hin, selbst zu den Mahlzeiten. Geh damit über das Deck. Lege sie niemals ab. Und dann, nach etwa vier Tagen auf See, stehst du von deinem Liegestuhl auf und lässt sie liegen. Ich wette, die Hälfte der Leute an Bord würden sich gegenseitig erdolchen, nur um ihrer habhaft zu werden.".
Ich sagte nur: "Oh Moran, halt einfach die Klappe."
Wir sollten um 11 Uhr auslaufen, aber dann hieß es, wir würden erst einige Stunden später abfahren. Die unangenehme Stille enttäuschter Erwartungen legte sich über das Schiff.
Moran setzte sich hin und schrieb vier Postkarten, die ich aus Lissabon abschicken sollte, damit seine Freunde dachten, er sei dort.
Sie verließen das Schiff gegen Mittag, Moran und "das Mädchen." Wir konnten einfach nicht länger herumsitzen und auf den entscheidenden Moment warten. Ich ging mit den beiden hinunter in den Schuppen am Pier. Sie steckte mir einen Zettel zu, den sie geschrieben hatte, und ich steckte ihn in meine Tasche. Wir kannten uns schon lange.
Wir haben nicht versucht, große Worte zu finden, sondern uns einfach nur verabschiedet. Und wir machten es schnell. Eine Minute lang sah ich ihnen nach, wie sie die lange Pier entlanggingen. Dann ging ich in meine Kabine und schloss die Tür.
Endlich, gegen zwei Uhr, legten wir ab. Alle waren gegangen. Die Pier war leer und wie ausgestorben. Es gab kein Geschrei, kein Konfetti, nicht einmal ein geschwenktes Taschentuch. Das einsame Dock blieb einfach hinter uns zurück, während wir an einem kalten, grauen Novembernachmittag in die Dunkelheit Europas fuhren.
Wir haben nur einunddreißig Passagiere an Bord. Das ist nur ein Viertel der Kapazität des Schiffes und nur ein Sechstel dessen, was es auf der Rückfahrt befördern würde. Dann würde man Betten in die Aufenthaltsräume stellen und dort 180 oder 190 Personen unterbringen. Aber heute sind wir so wenige, dass jeder eine Kabine für sich allein hat. Meine ist sehr geräumig, hat zwei Betten, ein Sofa, ein eigenes Bad und zwei Bullaugen. Außerdem gibt es eine sonnige Veranda direkt vor der Tür. Es ist, glaube ich, die komfortabelste Kabine, die ich je an Bord eines Schiffes hatte. Alles, was ich noch brauche, um mich häuslich einzurichten, ist ein kleiner Kocher und eine Portion Speck.
Wir waren noch keine zwei Stunden von New York entfernt, als wir eine Notfallübung durchführen mussten.
Das Ganze lief sehr konzentriert und ruhig ab. Man schwenkte die Boote aus und testete das Funkgerät im Boot Nr. 1.
Ich dachte, dass wir aufgrund der instabilen Weltlage (wie manche Leute es nennen) vermutlich jeden Tag eine Bootsübung haben würden. Aber erst am siebten Tag folgte die nächste, als um elf Uhr morgens die Pfeife ertönte und die Glocken läuteten.
Für ein britisches Mädchen an Bord wurde dies zur Erfahrung ihres Lebens. Sie war gerade aufgestanden und hatte geduscht. Als sie die Glocken hörte, kam es ihr nicht in den Sinn, dass es sich um eine Übung handeln könnte. Sie sagte zu sich: "Mein Gott, jetzt wird’s ernst!" Also sprang sie aus der Dusche und zog sich Hose und Pullover an, ohne sich abzutrocknen. Die Rettungsgürtel befinden sich auf Gestellen unter den Betten, und nachdem ihrer hängen blieb, musste sie praktisch das Bett abreißen, um ihn herauszuholen. Schließlich konnte sie ihr Geld nicht finden und rannte einfach ohne los. Sie bemühte sich weder um Lippenstift noch um Rouge. Blass und atemlos erschien sie an Deck, nur um festzustellen, dass das Ganze ein Spiel war.
Dann kommen wir in die Gewässer, in denen gelegentlich Schiffe versenkt werden. Aber an Bord macht man sich keine Sorgen um unsere Sicherheit. Nachts ist alles voll beleuchtet, und auf jeder Seite des Schiffes ist eine große amerikanische Flagge aufgemalt, auf die jeweils ein großer Scheinwerfer gerichtet ist. Jeden Abend habe ich mir vorgenommen, meine Kleidung penibel auf dem anderen Bett auszulegen und alles andere griffbereit zu halten –– nur für den Fall. Aber nun sind wir fast am Ziel, und ich habe es noch kein einziges Mal wirklich gemacht.
Einige der Passagiere hofften, dass etwas Aufregendes passieren würde. Einer würde gern ein paar Rettungsboote von einem gesunkenen Schiff aufnehmen. Einem anderen wäre lieb, dass ein Plünderer uns stoppt und durchsucht. Ein ganz Extremer plädierte sogar dafür, irrtümlich von einem U-Boot beschossen zu werden –– unter der Bedingung, dass der Torpedo das Schiff verfehlte. Was mich betrifft, so möchte ich in diesem Ozean nichts als Wellen sehen. Und wenn ich genauer darüber nachdenke, will ich nicht einmal Wellen sehen. Denn ich sehe sie gerade, und um es ganz offen zu sagen, sie machen mich krank.
Die Überfahrt nach Lissabon in diesen Tagen ist für das Personal im Speisesaal und die Kabinenstewards sehr hart. Auf der Hinfahrt sind so wenige Leute an Bord, dass man kaum Trinkgeld erhält. Und auf dem Rückweg sind alle pleite, obwohl das Schiff voll beladen ist ––das Ergebnis bleibt also dasselbe. Aber die Besatzung bekommt eine Kriegsprämie von einem Dollar pro Tag für ihre Arbeit auf dieser Strecke.
Wir haben einen Engländer an Bord, der der befriedigendste Zuhörer ist, mit dem ich mich je unterhalten habe. Er hält alles, was man sagt, für das Faszinierendste, was er je gehört hat –– und das beteuert er mit einem Repertoire von Ausrufen, die mir völlig neu sind.
Wenn man zum Beispiel erwähnt, dass man in diesem Jahr bereits einen Monat auf See verbracht hat, haut es ihn fast vom Stuhl und er sagt: "Nein! Wie außergewöhnlich bemerkenswert!" Man äußert etwas anderes und er antwortet: "Gott schütze uns! Ist das nicht unglaublich?" Man erklärt, dass Flugzeuge heutzutage ohne jede Sicht und nur per Funk landen können, und er lehnt sich vor, als wolle er über Bord springen und ruft: "Heiliger Strohsack! Was Sie nicht sagen!"
Allein dieser letzte Satz ist für mich die ganze Reise wert.
3. Zwischenstation
Lissabon,
Dezember 1940
Sie müssen sie "Lissa-BON" nennen, diese einzige freie Hafenstadt, die es in Europa noch gibt. Wenn Sie "Lissa-BON" sagen, geben Sie sich als echter Europaexperte zu erkennen. Sagen Sie stattdessen "Lisboa", sind Sie Portugiese und leben hier. Kommt Ihnen das Wort "Lisbon" über die Lippen, sind Sie –– ordinärer Amerikaner.
Heute ist Lissabon der vorübergehende Aufenthaltsort aller, die das Glück haben, Europa entfliehen zu können. Es ist das Nadelöhr, durch das alle nicht-militärischen Reisen zwischen Europa und anderen Ländern gehen müssen. Vor einem Monat schätzte man die Zahl der Flüchtlinge in Portugal auf 20000. Heute sind es wahrscheinlich weniger, denn sie werden nach und nach weiter verteilt, und das Land hat seine Grenzen für Neuankömmlinge weitestgehend dicht gemacht. Man bekommt zurzeit kein Visum, wenn man nicht ein Ticket für die Weiterreise vorweisen kann.
Die meisten Flüchtlinge halten sich in oder um Lissabon auf. Ein großer Teil von ihnen hofft, eines Tages nach Nordamerika zu gelangen. Andere zieht es nach Südamerika und in den Belgisch-Kongo, und seit unserer Ankunft ist eine ganze Schiffsladung Griechen nach Niederländisch-Ostindien aufgebrochen. Die meisten Flüchtlinge hatten ursprünglich Geld, sonst hätten sie die Flucht aus ihren Heimatländern nicht finanzieren können. Viel mitnehmen konnten die meisten dennoch nicht. Und die Lebenshaltungskosten in Lissabon sind zwar für amerikanische Verhältnisse niedrig, aber für Europäer ziemlich hoch. Also müssen die Flüchtlinge den Gürtel enger schnallen. Lissabon ist kein Ort für ein ausschweifendes Nachtleben.
Das Personal des amerikanischen Konsulats wurde stark aufgestockt und arbeitet so intensiv wie Reporter kurz vor Redaktionsschluss. Den ganzen Tag über drängen und schubsen und winken dicke Menschengruppen vor den Konsulatsschaltern mit ihren Dokumenten und versuchen, als Nächste dranzukommen, um ein Visum für dieses Paradies der Paradiese –– Amerika –– zu bekommen. Die Verzweiflung lässt die Menschen alle möglichen Tricks versuchen. Die Konsulatsangestellten haben schon so viele erfundene Geschichten gehört, dass sie praktisch jedem misstrauen. Dennoch scheinen sie auch ein gewisses Mitgefühl für alle zu empfinden, fast, als wollten sie sagen: "Ihr armen Teufel!"
Bei den meisten Flüchtlingen handelt es sich um deutsche Juden und Menschen aus den Balkanländern. In letzter Zeit sind auch viele Belgier und Franzosen darunter. Viele versuchen, nach England zu kommen –– und England wird sie aufnehmen, wenn sie es schaffen.
Die Restaurants in Lissabon sind ausgezeichnet. Es gibt ein halbes Dutzend, die jeden internationalen Feinschmecker zufrieden stellen würden. Gestern Abend hatte ich das beste Steak diesseits von Buenos Aires, und mit allen Beilagen hat es nur achtzig Cent gekostet. Essen gibt es hier in Hülle und Fülle, es wird sogar verschwendet, während der Rest Europas gegen den Hungertod ankämpft.
Lissabon ist eine hügelige Stadt –– eine wunderschön hügelige Stadt. Es gibt hier Straßen, die fast so steil sind wie in San Francisco. Alles ist sehr weiß, und aus der Ferne glitzern die Fassaden. Außerdem ist die Stadt viel größer, als ich erwartet hatte –– fast eine Million Menschen –– und es gibt Staus wie zu Hause.
Die Bürgersteige bestehen aus behauenen, walnussgroßen Steinen, die in seltsamen Mustern in Schwarz und Weiß verlegt sind, ähnlich den Gehwegen in Rio. Die Straßen selbst sind praktisch alle aus Kopfsteinpflaster. Die Stadt ist übersät mit Parks, Kreisverkehren und Statuen.
Hier und da stehen Palmen, und die Laubbäume tragen noch ihre Blätter. Aber lassen Sie sich von so viel Grün, so viel Sonne und so viel blauem Himmel nicht in die Irre führen. Die Beschreibung eines Freundes über Südkalifornien passt zu dieser Zeit perfekt auf Lissabon. Er sagte: "Du kannst dich unter einen blühenden Rosenstrauch legen und erfrieren." Auch das ist Lissabon im Dezember.
Drei große kriegführende Nationen unterhalten regelmäßige Passagierflugverbindungen nach Lissabon. Jeden Tag starten Flugzeuge nach Berlin und Rom und mehrmals wöchentlich nach England und in die USA. Die Ticketschalter der englischen und der deutschen Fluglinie befinden sich in der Innenstadt direkt nebeneinander. Versehentlich betrat ich die deutsche Niederlassung und fragte naiv nach Flügen nach London. Der junge Mann hinter dem Schalter verwies mich in ausgezeichnetem Englisch an das Büro der "British Overseas" nebenan.
Theoretisch ist die Flugverbindung nach England eine gewerbsmäßige. Dennoch legt der britische Luftattaché hier fest, wer wen wann mitnehmen soll. Wenn man aus den Vereinigten Staaten mit Weiterflug nach England ankommt, trägt man sich in ein Buch am Ticketschalter von "British Overseas Airways" ein. Das ist alles, was man tun muss. Und alles, was man tun kann. Irgendwann nachmittags, vielleicht eine Woche oder aber zwei Monate später, wird das Ticketbüro anrufen und einem sagen, dass man sich bereit machen soll.
Die Passagiere werden in der Reihenfolge ihrer "Priorität" ausgewählt. Niemand fliegt ohne Priorität. Diese wird in London festgelegt, und der Durchschnittsreisende wird niemals überhaupt eine Priorität erhalten. Als Reporter besitze ich diese. Wäre dem nicht so, könnte ich genauso gut wieder nach Hause fahren. Aber wann ich in London eintreffen werde, ist ungewiss. Alles, was man tun kann, ist warten.
Was für uns gilt, gilt auch für Abertausende, die hier auf eine Transportmöglichkeit warten. Die Züge sind überfüllt. Das Flugzeug nach Rom ist bereits drei Wochen im Voraus ausgebucht. Die Zeit drängt, und je mehr Wochen vergehen, desto enger muss man den finanziellen Gürtel schnallen. Dennoch sind die Bars zur Cocktailstunde gerammelt voll und man hört ein Dutzend verschiedener Sprachen. Die Amerikaner treffen sich meist in der "Avenida" und berichten einander dort über die Entwicklungen des Tages –– falls es welche gibt. Meistens geht es um den individuellen Kampf, dorthin zu gelangen, wohin man will.
Selbst ein Flug nach Amerika ist schwierig zu erwischen. Man sagt, dass dreihundert Menschen hier sitzen und auf eine "Clipper" warten (Die Boeing 314 Clipper war ein viermotoriges Flugboot großer Reichweite, Anm. des Übersetzers). Sitzplätze in einer dieser Maschinen wurden für 1000 Dollar "verscherbelt" –– um den Käufer anschließend feststellen zu lassen, dass er nur heiße Luft gekauft hat, da "Panair" keine Übertragung von Reservierungen erlaubt. Die "American Export Line" betreibt einen wöchentlichen Dampfer in die Vereinigten Staaten, den man zwei Monate im Voraus buchen muss. Aber viele dieser Buchungen lauten auf Personen, die noch nicht einmal aus ihren Heimatländern angekommen sind. Hunderte von Menschen, die eine Reservierung vorgenommen haben, werden nie die erforderlichen Dokumente erhalten. Es heißt, wenn das wöchentliche Boot mit etwa zweihundert Personen ausläuft, sind alle Menschen, die ausreisen dürfen, tatsächlich auch dabei.
Soweit ich das beurteilen kann, ist die Stimmung in Portugal überwiegend pro-britisch. Einige meiner Freunde behaupten, dass man hier viel Sympathie für Deutschland empfindet, was ich nicht wirklich bestätigen kann. Es stimmt, dass man gelegentlich eine deutsche Armeeuniform auf den Straßen sieht. Und man hört viele Leute Deutsch sprechen. Ich glaube aber nicht, dass es sich dabei um Unterstützer der fünften Kolonne oder Flüchtlinge handelt.
Zusammen mit George Lait vom "International News Service", einem Mitreisenden auf der "Exeter", quartierte ich mich für einige Tage in einer Pension ein, die eine Mischung aus einem Fremdenheim und einem schäbigen Hotel war. Aus meiner Erfahrung mit Unterkünften dieser Art in diesem und anderen Ländern weiß ich, dass man dort nicht zu lange verweilen sollte, und nach einigen Telefonaten erhielten wir schließlich ein Zimmer in einem richtigen Hotel.
Das neue Zimmer ist etwa zwanzig Quadratmeter groß und ist mit zwei großen Fenstern ausgestattet, die auf eine schmale Straße blicken. Jeden Morgen toben alle Zeitungsjungen und Straßenverkäufer Lissabons durch diese Straße, um ihre Lungen zu testen. Wenn es ihnen nicht gelingt, uns zu wecken, sind sie zu schwach und dürfen den Rest des Tages krank zu Hause verbringen –– selbstredend ohne Bezahlung.
Unser Zimmer ist altmodisch, aber recht komfortabel (abgesehen von der Temperatur darin). Die Decke erstreckt sich weit, weit über uns und ist mit riesigen Schnörkeln aus violettem Putz übersät. Die Nasszelle ist einfach eine Ecke des eigentlichen Zimmers, die mit beweglichen Paneelen abgetrennt ist, die einen halben Meter unterhalb der Decke enden. Unsere Badewanne hat drei Wasserhähne, einen kalten und zwei heiße. Der eine ist ein bisschen heißer als der andere. Ich weiß nicht, wozu das gut sein soll. Mir ist nur wichtig, dass einer der beiden Hähne überhaupt heißes Wasser ausspuckt, und das tut er auch –– sehr heißes. Leider hat unser Heizkörper nicht die gleiche Fähigkeit. Es scheint in Portugal ein jahrhundertealter Glaube zu sein, überhaupt keine Heizung zu benötigen. Alle Heizkörper sind nur lauwarm und keiner wird jemals heiß. Sie haben überhaupt keinen Einfluss auf die Raumtemperatur.
Ich habe schon überall auf der Welt gefroren, in Alaska und Peru, in Georgia und Maine unter der Kälte gelitten. Aber mir war noch nie so kalt wie hier in diesem Zimmer. Die Temperatur draußen liegt merkwürdigerweise gar nicht unter dem Gefrierpunkt. Im Gegenteil, es ist wunderschön. Aber die Kälte frisst sich in dich hinein und durch dich hindurch. Man zieht sich Pullover an, bis man keine mehr hat –– und es wird einem nicht wärmer.
Als Folge daraus wechseln Lait und ich uns in der Badewanne ab; ich wette, wir sind die beiden am gründlichsten gewaschenen Caballeros in ganz Portugal. Wir nehmen mindestens vier heiße Bäder am Tag. Und am Nachmittag, wenn ich versuche zu schreiben, muss ich etwa alle fünfzehn Minuten heißes Wasser über meine Hände laufen lassen, um sie geschmeidig zu machen. Und das ist nicht gelogen!
Wir sind runter zum Hafen, um zuzusehen, wie die "Exeter" ausläuft. Man hätte sie nicht als das verhältnismäßig stille und spärlich bevölkerte Schiff wiedererkannt, mit dem wir gekommen waren. Im Salon standen reihenweise Feldbetten. Über die Teppiche waren Kanthölzer gelegt worden, in deren nachträglich eingebohrten Löcher die Füße der Betten gesteckt wurden, damit diese bei rauem Wetter nicht verrutschen konnten. Unten war jede einzelne Kabine vollgestopft mit Passagieren. In Räumen mit drei Betten waren vier Personen untergebracht. Das Schiff war voller Kinder und überall stapelte sich das Gepäck.
Die Stewards waren kurz davor, durchzudrehen. Jeder brauchte irgendetwas. Und niemand konnte irgendjemanden verstehen. Als Bernie Garland, mein Steward auf der Hinfahrt, zu uns kam, meinte er, er könne so ziemlich jede europäische Sprache erkennen, aber er hätte eine Kabine voller Menschen, die etwas ihm völlig Unverständliches sprachen.
Auf diesen Heimfahrten konnte man froh sein, überhaupt an Bord sein zu dürfen. Gerade deshalb klang das Ansinnen einer ziemlich hochmütigen Frau so lächerlich. Ich habe es selbst mit angehört. Sie hatte eine der besten Kabinen, aber sie gefiel ihr nicht. Also ging sie zum Steward und fragte, ob sie in der ersten Klasse untergebracht sei. Er erklärte ihr, es gäbe nur eine Klasse. Daraufhin sagte sie: "Sie müssen doch bessere Kabinen haben! Ändern Sie meine Kabine sofort, selbst, wenn ich mehr dafür bezahlen muss." Sie wollte partout umquartiert werden –– und das bei achtzig Menschen, die in einem Gemeinschaftsraum auf Feldbetten schliefen!
II. ALLES RUHIG
1. VOM FRIEDEN ZUM KRIEG - SIEBEN STUNDEN
England, Dezember 1940
In unserem Hotelzimmer in Lissabon klingelte das Telefon, und man sagte uns, wir sollten heute Morgen noch vor Tagesanbruch am Flughafen sein. Nun glaube man aber nicht, dass ich deswegen in helle Aufregung verfiel. Unsere fast zwei Wochen des Wartens neigten sich dem Ende zu, und Lait und ich beschlossen, sicherheitshalber nicht einmal ins Bett zu gehen.
Jeder von uns ließ einen kleinen Koffer in Lissabon zurück, und um das Gewicht zu reduzieren, packte ich meine überflüssigen Sachen in einen weißen Zuckersack, den mir ein Schiffssteward gegeben hatte. Und so kam ich heute in England mit einer kleinen gelben Tasche, einer Schreibmaschine und einem zugeknoteten Zuckersack über der Schulter an.
Es war kalt und unheimlich in dem schwach beleuchteten Flughafengebäude in Lissabon. Wir liefen auf und ab, um uns warm zu halten, bis der Flugkapitän schließlich sagte: "Es geht los." Wir folgten der Besatzung ein Pier entlang und stiegen in ein Motorboot. Schwach konnten wir die Umrisse von zwei großen Flugbooten erkennen, die weiter draußen vor Anker lagen. Als unser Boot vor einem davon Halt machte, sprangen wir durch die Tür.
Das Flugzeug hatte vier Motoren und war größer als die "Baby Clipper" der Pan American Airways. Dennoch war es nicht so groß wie die regulären Flugzeuge dieses Typs. Man hatte es sorgfältig getarnt.
Die Fahrgastkabine war in drei Abteile unterteilt. Im hintersten war Rauchen erlaubt. Ich hatte angenommen, dass diese Flugzeuge jeglichen Reisekomforts aus Friedenszeiten beraubt worden waren, um Gewicht zu sparen, aber dem war nicht so. Die Sitze waren gepolstert und bequem, der Boden mit Teppich ausgelegt.
Der Steward reichte uns Decken. Dann wurden die Motoren angelassen, die Tür geschlossen, und wir fuhren weit hinaus auf den Fluss. Die Lichter der Stadt waren an beiden Ufern klar erkennbar. Plötzlich heulten die Motoren auf, und die Gischt vernebelte die Fenster. Wir fuhren eine gefühlte Ewigkeit auf dem Wasser dahin, bis wir schließlich spürten, wie das Flugboot abhob. Die Sicht durch die Fenster wurde klarer, die Lichter des Ufers verschwanden immer mehr in der Tiefe und die heißen Abgase der Motoren leuchteten dramatisch rot in der Dunkelheit. Wir waren auf dem Weg nach England.
Es hätte ein Flug in Friedenszeiten sein können. Jeder Passagier legte sich sofort schlafen. Ich selbst döste eine Weile, aber da die Neugierde mich nicht wirklich losließ, blieb ich ab Tagesanbruch wach.
Als es hell wurde, befanden wir uns über dem Meer, ohne dass Land in Sicht gewesen wäre. Man hatte mir gesagt, dass der Flug zehn Stunden dauern würde, aber wir hatten jede Menge Rückenwind und schafften die Strecke in weniger als sieben Stunden. Die Zeit zog sich überhaupt nicht. Als ich fünf Stunden nach Abflug durch das Flugzeug ging, schliefen alle Passagiere. Soweit ich beobachten konnte, sprach während der gesamten Reise kein einziger Fluggast mit einem anderen. Es waren sieben Amerikaner an Bord, ein Schweizer und drei Engländer.
Der Steward servierte Kaffee und Sandwiches, später auch Obst. Dann ging er durch die Kabine und verdunkelte die Fenster, damit die Passagiere nicht hinaussehen konnten. Zu diesem Zweck befestigte er Stücke aus Milchglas mit Gummisaugnäpfen über den normalen Fenstern. Das lässt zwar Licht herein, verhindert aber, dass man selbst etwas erkennen kann. Ich vermute, dass die Passagiere so nicht die Konvois im Wasser unter ihnen sehen können. Witzig war aber, dass der Steward alle Fenster außer meinem verdunkelte. Entweder gingen ihm die Milchglasscheiben aus, oder er dachte, ich sei blind. Auf jeden Fall starrte ich den ganzen Flug über aus dem Bullauge.
Auf der linken Seite kam schließlich Land in Sicht. Es war dunkelbraun und kahl, eine hohe, zerklüftete Küste. Ich dachte, es sei Irland. Eine Stunde flogen wir an dieser Küste entlang. Die Luft wurde turbulent und als Folge davon fünf Passagieren ziemlich übel. Irgendwie bin ich davon verschont geblieben. Wir überflogen nur zwei Schiffe, beide offensichtlich ziemlich klein. Eines begrüßte uns mit einem Blinkfeuer. Während des ganzen Fluges sahen wir keine einzige andere Maschine.
Plötzlich drosselte der Pilot seine Motoren und wir verloren an Höhe. Da wurde mir klar, dass wir nicht an Irland entlang geflogen waren, sondern an der Küste Englands. Wir landeten weit draußen vor der Küste inmitten vieler ankernden Boote und getarnten Flugzeugen, die dort vor sich hindümpelten. Als wir auf der Wasseroberfläche aufsetzten, hörte ich dieses vertraute, lang gezogene, knirschende Geräusch.
Ich fühlte mich wie in einem Traum. Die Reise von Amerika war zu Ende –– wir waren angekommen. Aber es schien nicht wirklich real zu sein. Jeden Moment erwartete ich, aufzuwachen und mich immer noch zwischen den Mauern des "Hotels Europa" in Lissabon wiederzufinden.
Ein paar britische Beamte in Regenmänteln und Stiefeln kamen mit einem Motorboot heraus und nahmen alles in Augenschein, während ein Arzt die von uns ausgefüllten Formulare an sich nahm. Dann stiegen wir alle in das Boot. Die Männer unterhielten sich mit uns auf dem Weg zum Ufer. Sie sagten, sie würden versuchen, uns so rechtzeitig durch die Formalitäten zu bringen, dass wir den Nachmittagszug nach London noch erwischten. Versprechen konnten sie es leider nicht.
Es regnete. Wir liefen hundert Meter an den Docks entlang und bogen dann in die Hauptstraße der kleinen Stadt ab. Dort standen Soldaten, an deren Koppeln Helme und Gasmasken baumelten. Ich sah Frauen in khakifarbenen Uniformen und viele Menschen, die auf Fahrrädern unterwegs waren. Alle Schaufenster waren mit Papierstreifen überklebt worden. Das sollte verhindern, dass sie durch die Erschütterung zerspringen, wenn Bomben ganz in der Nähe explodierten. Die vielfarbigen, gemusterten Streifen ließen die Stadt aussehen, als sei sie weihnachtlich geschmückt und nicht für den Krieg hergerichtet worden.
Ich wünschte, Sie könnten diese Dorfstraße sehen. Sie wirkte wie ein Bild aus einem Dickens-Roman. Die gegiebelten Häuser, die Wörter auf den Schildern, die vielen rauchenden Schornsteine, all das war das England der Klassiker der Weltliteratur, so friedlich, ordentlich und sicher. Ich war noch keine drei Minuten unterwegs, als ich mich bereits in das Land verliebt hatte.
Man begleitete uns in einen großen Raum im Erdgeschoss, wo sich das improvisierte Büro der "British Overseas Airways" befand. Dort standen Sessel und Sofas, im Kamin prasselte ein Kohlenfeuer und ein Bediensteter servierte heißen Tee. Es dauerte zwei Stunden, bis wir alle Formalitäten hinter uns gebracht hatten. Wir wurden einzeln in einen Raum geführt, wo wir jeweils von zwei Männern befragt wurden. Sie erkundigten sich nach dem Grund unseres Kommens, nach dem mitgeführten Geldbetrag, danach, wen wir kannten, und so weiter. Es war keineswegs ein Verhör. Sie taten dies auf eine Art und Weise, die einem das Gefühl vermittelte, man säße einfach nur da und plauderte. Die Prozedur war mehr als höflich, sie wirkte sogar äußerst freundlich.
Danach wurde unser Gepäck genauestens untersucht. Sogar unsere Briefe wurden gelesen. Aber die sprichwörtliche englische Höflichkeit ist so groß, dass der Zollbeamte mich sogar bat, jeden Brief für ihn aus dem Umschlag zu nehmen. Offensichtlich dachte er, es würde zu neugierig wirken, dies selbst zu tun! Kurz vor der Abfahrtszeit unseres Zuges sagte er, wir müssten uns beeilen, um diesen noch zu erwischen; also schloss er die Taschen, ohne die Untersuchung zu beenden, gab uns Ratschläge über Züge und die Verdunkelung in London und drängte uns förmlich in ein wartendes Fahrzeug, das von der Fluggesellschaft bereitgestellt worden war.
Wir fuhren eine Viertelstunde lang durch einen dicht besiedelten Vorort. Man erzählte uns, dass dort erst vor einigen Nachmittagen Bomben gefallen seien, aber wir sahen keine Anzeichen dafür. Der gesamte Vorort wirkte wie eine Fortsetzung der Hauptstraße unseres Ankunftsortes –– blitzsauber, urgemütlich, wohnlich und schön.
Der Zug lief pünktlich ein. Der Gepäckträger, ein alter Mann, verstaute unsere Sachen sorgfältig und erklärte uns, wann wir in London ankommen würden. Es würde nach Einbruch der Dunkelheit sein, meinte er, und die Deutschen würden wahrscheinlich Angriffe fliegen, aber wir sollten uns keine Sorgen machen.
Mein allererster Eindruck von den Engländern war, dass dieses Völkchen aus liebenswerten und zuvorkommenden Menschen bestand. Und damit meine ich nicht so sehr ihr Verhalten uns Besuchern gegenüber, sondern untereinander. Es stimmte zwar, dass sie gerade besonders nett zu Amerikanern waren, dennoch habe ich festgestellt, dass sie untereinander genauso aufmerksam sind.
Vorher hatte ich nur in den Kolonien Kontakt mit Engländern. Ich war davon ausgegangen, dass der gewöhnliche Vertreter dieses Volkes dieselben Allüren hat wie die Menschen in fernen Ländern, die sich nachmittags in den Clubs und Hotels zu einem Gin Tonic treffen und sich über alles andere an Land oder auf See erhaben fühlen. Aber der Engländer in seiner Heimat hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit diesen Leuten. Er scheint immer eine nette kleine Bemerkung parat zu haben. Er interessiert sich für einen und ist mitnichten blasiert. Er ist rücksichtsvoll und scheint es einfach zu genießen, noch am Leben zu sein.
Ein englischer Freund von mir behauptet, dass dies schon immer so war. Aber er sagt weiter, dass es jetzt mehr der Fall ist als je zuvor. Er sagt, der Krieg habe den englischen Charakter sehr verbessert –– und dass er die Menschen zusammengeschweißt, sie stolzer aufeinander und gleichzeitig demütiger gemacht hat, und damit sowohl sanfter als auch stärker.
Jedenfalls weiß ich, dass ich auf all meinen Reisen noch nie ein neues Land besucht habe, das mich in wenigen Stunden mit der Zuneigung erfüllt hat, die ich für England empfinde.
2. "SIE SIND NOCH NICHT EINGETROFFEN, SIR."
London,
Dezember 1940
Den Weg nach London Innenstadt verbrachten wir in regelrechtem Luxus. Wir fuhren in einem Privatabteil, rauchten, lasen Londoner Zeitungen, tranken Tee und aßen Schinkensandwiches. An unseren Augen zog eine herrlich grüne Landschaft vorüber. Die Felder sahen eher wie Parks als wie Agrarflächen aus. Es erschien mir merkwürdig, dass im Dezember alles so grün war. Es war ein schöner Nachmittag, nicht zu kalt, und es regnete eine Weile, bis die Sonne wieder zum Vorschein kam.
Unsere ersten drei Stunden in England waren überaus angenehm, die Landschaft heiter, der Tee der Tradition des Landes entsprechend. Es schien fast unmöglich, dass Tod und Zerstörung nur drei Stunden entfernt liegen könnten. Aber sie lagen viel näher.
Wir tranken gerade Tee, als Lait sagte: "Sieh mal!" Vor uns am Himmel schwebten silberne Sperrballons. Es waren nicht nur ein paar, sondern Dutzende, ja Hunderte. Sie dehnten sich kilometerweit aus. Wir wussten, dass ihre Anwesenheit auf unsere baldige Ankunft in einer größeren Stadt hinwies.
Und dann folgte der erste Eindruck der Zerstörung. Ich weiß nicht mehr genau, was das erste zerbombte Objekt war, das wir sahen, denn kaum hatten wir dieses bemerkt, erkannten wir ein zweites und ein drittes. Dann legte das Tempo der Schreckensbilder ständig zu. Ich erinnere mich an einen Krater in einer Vorortstraße, dann an zerstörte Häuser in der Nähe, und eine kleine Fabrik, die in Flammen stand. Danach war Block für Block die Hälfte der Gebäude, die wir sahen, in Trümmern. Einige der Vorortbahnhöfe, an denen der Zug hielt, lagen in Trümmern. Nichtsdestotrotz stiegen Hunderte Menschen aus und ein.
Wenn ich sagen würde, dass die Gesichter der Menschen angespannt, besorgt oder gar ängstlich wirkten, würde ich sicher meine Phantasie überstrapazieren. Abgesehen von der grässlichen Szenerie schien das Leben völlig normal zu verlaufen.
Dann setzte sich ein alter Mann in unser Abteil. Er war zerlumpt und kraftlos, und bis er sprach, hätte ich ihn nicht von einem achtzigjährigen Farmer aus Missouri unterscheiden können. Als der Schaffner die Fahrkarten überprüfte, sagte er zu dem alten Mann: "Tut mir leid, aber Sie müssen zurückgehen. Sie haben eine Fahrkarte dritter Klasse, und hier sitzen Sie in der ersten." Der alte Mann sagte mit einem Akzent, der überall auf der Welt als britisch erkannt worden wäre: "Oh je, oh je", und war im Nu verschwunden. Wir wünschten, er hätte bleiben können.
Zu Hause hatte ich Wochenschau-Bilder von zerbombten Gebäuden gesehen, aber irgendwie dachte ich, die Realität würde anders aussehen. Das tat sie aber nicht. Der einzige Unterschied war tatsächlich der Wechsel von gefilmten Bildern zur Wirklichkeit –– und man spürte einen Abscheu und ein leichtes, einen nach unten ziehendes Gefühl des Begreifens um die furchtbare Kraft einer einzigen Bombe. Man verstand, was sie einem persönlich antun könnte.
Schließlich ließen wir die Stadt und ihre Trümmer hinter uns und befanden uns wieder im Grünen. Auf jedem offenen Feld befand sich etwas, das feindliche Flugzeuge von der Landung abhalten sollte. Einige Anbauflächen waren von einer Reihe hoher weißer Pfähle durchzogen. Andere waren mit Drahtrollen bestückt worden, wieder andere von flachen Gräben durchzogen. Auf einigen Feldern waren Erdhügel in so regelmäßigen Reihen aufgeschüttet worden, dass man meinen konnte, es handele sich um Vorrichtungen zum Getreideanbau statt um Hindernisse.
Gelegentlich erhaschte man einen Blick auf einen silbernen Ballon, der in einen Wald eingezogen wurde, um sich dort bis zum Einbruch der Nacht zu verstecken. Zweimal passierten wir Flugabwehrkanonen auf den Feldern. Diese waren mit Planen abgedeckt worden, die so sehr an Sträucher erinnerten, dass sie kaum als Waffen zu erkennen waren.
Jeder Baum, jedes Feld, jeder Kricketplatz, jedes Haus und jede Straße, alles schien seinen Beitrag zu leisten. In den Hinterhöfen der Vorstadthäuser entlang der Bahngleise gab es düstere Zeichen dafür, wie der Krieg die englische Lebensweise entstellt hat. Damit meine ich die privaten Luftschutzbunker, von denen es fast in jedem Hinterhof einen gab.