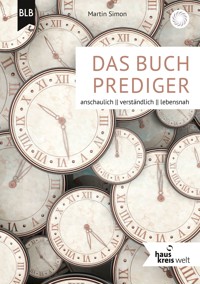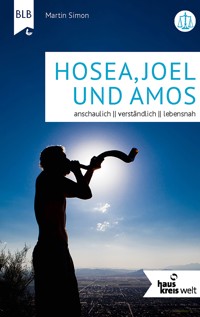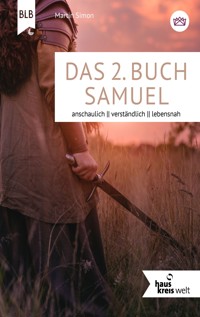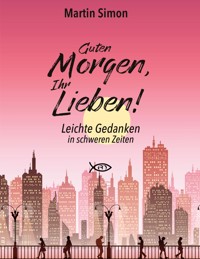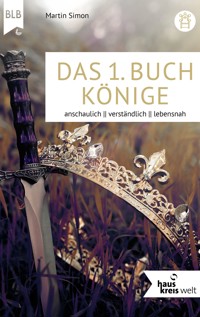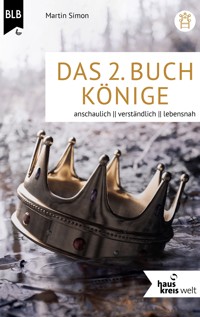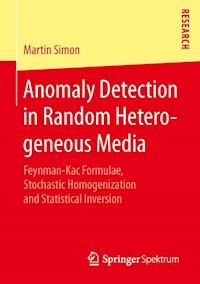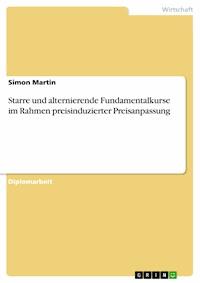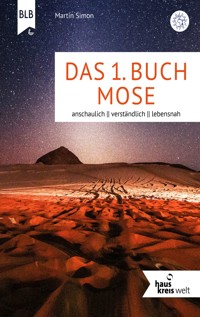
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibellesebund
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Hauskreiswelt
- Sprache: Deutsch
Das erste Leben, der erste Mord, der erste Ozeanriese, Liebe, Romantik, Eheprobleme, Erbstreitigkeiten, Betrug, Hinterlist, Homosexualität, Inzucht, Begegnungen mit Engeln, Glaube, Prophetie: nichts Menschliches und nichts Unmenschliches ist dem 1. Buch Mose fremd. Spannend, wie Gott auch auf krummen Linien gerade schreiben kann!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Simon
Das 1. Buch Mose
anschaulich, verständlich, lebensnah
www.bibellesebund.net
Impressum
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
2. Auflage 2019
© 2023 Bibellesebund Verlag, Marienheide
© 2025 der E-Book-Ausgabe
Lockenfeld 2
51709 Marienheide
Autor: Martin Simon
Titelfoto: © Omar Elsafwani - istockphoto.com
Titelgestaltung: Luba Siemens
Layout des E-Books: Connie Waffenschmidt
Printausgabe: ISBN 978-3-87982-991-0
E-Book: ISBN 978-3-95568-589-8
www.bibellesebund.net
Hinweise des Verlags:
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des Textes und der Bilder kommen.
Noch mehr E-Books des Bibellesebundes finden Sie auf
ebooks.bibellesebund.de/
Inhalt
Titel
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser
Einführung in das 1. Buch Mose
Start ins Leben (1. Mose 1,1–2,3)
Tischlein deck dich! (1. Mose 2,4-25)
Das Böse schlängelt sich herein (1. Mose 3,1-24)
Brudermord (1. Mose 4,1-26)
Gottessöhne (1. Mose 6,1-8)
Ein unmöglicher Auftrag (1. Mose 6,9-22)
Kein Grund zur Schadenfreude (1. Mose 7,1-24)
Warten auf Hilfe (1. Mose 8,1-22)
Hinter uns die Sintflut (1. Mose 9,1-28)
Strafe oder Schutz? (1. Mose 11,1-9)
Der historische Hintergrund der Vätererzählungen
Vertrauen und Zweifel (1. Mose 12,1-20)
Auf Recht verzichten – Konflikte lösen (1. Mose 13,1-18)
Familienbande (1. Mose 14,1-24)
Ist Gott verlässlich? (1. Mose 15,1-20)
Ein eigener Versuch (1. Mose 16,1-16)
Ein Bund fürs Leben (1. Mose 17,1-27)
Eine englische Begegnung (1. Mose 18,1-15)
Ist Gott gerecht? (1. Mose 18,16-33)
Dramatische Rettungsaktion (1. Mose 19,1-38)
Doppelt peinlich (1. Mose 20,1-18)
Gott erfüllt seine Verheißung (1. Mose 21,1-34)
Ein schwerer Gang (1. Mose 22,1-19)
Keine Kompromisse (1. Mose 23,1-20)
Von Gott geführt (1. Mose 24,1-67)
Die Stammbäume
Familie im Kriegszustand (1. Mose 25,19-28)
Segen als Schleuderware (1. Mose 25,29-34)
Konflikte meiden? (1. Mose 26,1-35)
Die Familie zerbricht (1. Mose 27,1-46)
Vorsicht, heilig! (1. Mose 28,1-22)
Ein Liebesmelodram (1. Mose 29,1-30)
Der Wunsch nach Anerkennung (1. Mose 29,31–30,24)
Nomadenleben
Klugheit zahlt sich aus (1. Mose 30,25-43)
Erneute Flucht (1. Mose 31,1–32,3)
Ausweglos? (1. Mose 32,4-22)
Angriff im Dunkeln (1. Mose 32,23-33)
Wandlung und Versöhnung (1. Mose 33,1-20)
Eine Frage der Ehre (1. Mose 34,1-31)
Der Kreis schließt sich (1. Mose 35,1-29)
Der Glaube der Erzväter
Hass unter Brüdern (1. Mose 37,1-36)
Ein bedeutungsvolles Intermezzo (1. Mose 38,1-30)
Glückskind (1. Mose 39,1-23)
Ein Hoffnungsschimmer (1. Mose 40,1-23)
Das Blatt wendet sich (1. Mose 41,1-57)
Tag der Abrechnung (1. Mose 42,1-38)
Eine erzwungene Entscheidung (1. Mose 43,1-34)
Verantwortung übernehmen (1. Mose 44,1-34)
Endlich versöhnt! (1. Mose 45,1-28)
Rentenversicherung (1. Mose 46,1-34)
Vorerst am Ziel (1. Mose 47,1-26)
Wieder mal der Kleine! (1. Mose 47,27–48,22)
Klare Ansage (1. Mose 49,1-33)
Abschied (1. Mose 50,1-26)
Kleines Lexikon
Landkarten
Liebe Leserin, lieber Leser,
das erste Buch Mose ist eines der faszinierendsten Bücher der Bibel. Thematisch geht es darum, wie die Welt so geworden ist, wie wir sie heute vorfinden. Warum sind die Menschen so erschütternd böse? Warum sind sie so gottlos und damit auch Gott los geworden und ziehen die ganze Schöpfung mit sich in den Abgrund? Was tut Gott dagegen? Dann beginnt auch schon Gottes Heilsplan mit der Berufung Abrahams. Von dort zieht sich der rote Faden der Gnade Gottes und der Rettung der Menschen durch die ganze Bibel bis zur Offenbarung. Unglaublich, dass alles so klein anfängt! Gottes Plan scheint ständig auf der Kippe zu stehen, weil er mit Menschen arbeitet, die ihren eigenen Willen haben. Die versuchen, ihren Glauben nach bestem Wissen und Gewissen zu leben. Aber sie scheitern darin kläglich und lassen sich oft von eigenen Wünschen und Gefühlen leiten. Sie sind verstrickt in die Sorgen und Probleme ihres Alltags.
Das erste Buch Mose besteht vor allem aus Familiengeschichten. Das macht es für uns so spannend und lebensnah, denn was die Menschen damals erlebt haben, kann man heute in leicht veränderter Form auch erleben. Wir hören von Liebe und Hass, von Bruderzwist und Versöhnung, von weiblicher Not und Klugheit und männlicher Tatkraft und Feigheit. Die Bibel berichtet in schonungsloser Offenheit von ihren Helden, ohne sie dabei zu verurteilen. Und sie berichtet von der Treue Gottes, von seiner Verheißung, die trotz aller Dummheit und Schwachheit der Menschen zum Ziel kommt. Darum versetzten mich diese Geschichten in demütiges Erstaunen. Ich hätte es anders gemacht! Ich hätte schon Abraham in jungen Jahren zwölf Söhne gegeben. Wahrscheinlich hätte ich – wenn ich Gott wäre – die Sache sowieso selbst in die Hand genommen und alleine durchgezogen. Aber das tut Gott nicht. Er begegnet Menschen. Er beteiligt die Menschen an seiner Heilsgeschichte. Wir werden Zeugen dieser Geschichte. Die einzige für mich mögliche Reaktion auf diese Geschichte Gottes ist die Anbetung.
Den Erklärungen liegt übrigens die revidierte Lutherübersetzung von 1984 zugrunde.
Martin Simon
Einführung in das 1. Buch Mose
Einteilung
Das Buch lässt sich leicht in zwei große Abschnitte unterteilen.
I. Die Urgeschichte Kapitel 1–11
II. Die Vätergeschichte Kapitel 12–50
Abraham Kapitel 12–25
Isaak Kapitel 24.26–27
Jakob Kapitel 27–36
Josef Kapitel 37–50
Quellen und Quellenscheidung
Ich bin bei meinen Erklärungen von den Texten ausgegangen, wie sie dastehen, ohne mich um etwaige Schichtungen und Quellenscheidungen zu bemühen, die ich in aller Regel für nutzlos halte. Letztlich muss uns heute interessieren, was da steht, und nicht, wie es dazu gekommen ist, dass es so dasteht. Entscheidend ist für uns die Endgestalt der Texte.
Historische Zuverlässigkeit
Ich gehe weiter davon aus, dass in den Geschichten der Väter historische Begebenheiten überliefert worden sind, denn der Glaube der Väter entsteht in der persönlichen Erfahrung, die sie mit dem lebendigen Gott gemacht haben. Glaube entsteht nicht dort, wo – überspitzt formuliert – irgendjemand eine schöne Geschichte erfindet und damit die Gegenwart zu deuten versucht. Glaube ohne Geschichte ist pure Dogmatik, die mit dem Leben nichts zu tun hat. Das 1. Buch Mose ist alles andere als das. Hier ist das pralle Leben, in das Gott eingreift und Menschen begegnet. Die neueren Forschungen und die Archäologie bestätigen schließlich immer wieder die historische Zuverlässigkeit der biblischen Texte.
Verfasserschaft
Allerdings meine ich nicht, dass das Buch von Mose stammt. Nirgendwo wird dieser Anspruch erhoben. In der hebräischen Bibel heißt es Bereschit („Am Anfang“) nach den ersten beiden Wörtern des Buches. Im Lateinischen wird es Genesis (Entstehung) genannt. Sicher hat Mose, wenn vielleicht auch nicht alles, so doch einen Großteil des Pentateuchs geschrieben (vergleiche 2. Mose 17,14; 24,4 und 34,27- 28 sowie 4. Mose 33,2 und 5. Mose 31,22 und 24). Jesus selbst spricht klar vom „Buch des Mose“ (Markus 12,26) und von „seinen Schriften“ (Johannes 5,46-47). Ich meine, dass die Verfasserschaft für uns eine zweitrangige Frage ist und wir schlicht nicht wissen, von wem speziell die Genesis geschrieben worden ist. Das ist nicht dramatisch. Vom Hebräerbrief wissen wir das auch nicht, und trotzdem ist er Gottes Wort. Weder die Autorität des Buches noch unser Glaube hängt an der Verfasserfrage. Entscheidend ist für mich, dass Gott durch dieses Wort spricht und er auch über der Entstehung seines Wortes gewacht hat. Wie es dann letztlich geworden ist, ist für mich weniger wichtig. Ich vertraue darauf, dass die Genesis, wie die ganze Bibel, Gottes Wort ist.
Start ins Leben
1. Mose 1,1–2,3
Erklärungen zum Text
Schon der erste Satz der Bibel kann für angeregte Gespräche sorgen. Dass Gott die Welt erschaffen hat, wird nicht allgemein akzeptiert. Das hebräische Wort für schaffen wird nur für Gott gebraucht. Er kann erschaffen wie Menschen es nicht können. Er braucht nur ein Wort und kein Material. Der Geist Gottes wird schon im zweiten Vers erwähnt. Im Hebräischen ist der Geist übrigens weiblich; ein Hinweis darauf, dass Gott keinem Geschlecht zuzuordnen ist.
Dass die Gestirne erst am vierten Tag erschaffen werden, und damit auch unsere Zeitrechnung in Stunden, Tagen und Jahren, zeigt meines Erachtens, dass die Schöpfungstage nicht als 24-Stunden-Tage zu verstehen sind. Ausgeschlossen ist das natürlich nicht. Gott kann die Welt auch in ein paar Tagen schaffen. Letztlich kommt es darauf nicht an. Wichtig ist, dass dem Geschöpflichen, wie Sonne und Mond, die in der Umwelt Israels göttliche Verehrung genossen, sein Platz angewiesen wird. Was uns auf dieser Welt vor Ehrfurcht erstarren lässt, ist bei Gott verschwindend klein. Wenn Gott ruht, dann heißt das nicht, dass er nichts mehr tut. Er schafft aber nichts grundlegend Neues mehr; seine Schöpfung ist vollendet und alles ist gut.
Als Mann und Frau ist der Mensch geschaffen zum Bild Gottes (Kapitel 1,27). Der Mensch ist Schöpfung, nicht Schöpfer. Er ist als Gegenüber geschaffen. Das ist die höchste Würdigung, die ein Geschöpf erfahren kann. Der Mensch hat als Einziger die Möglichkeit, mit Gott in Beziehung zu treten. Diese Fähigkeit gehört zum Wesen des Menschen. Und sie ist allen Menschen mitgegeben, ob sie glauben oder nicht und gleichgültig, was sie glauben. Darum kann ein Mensch die Ebenbildlichkeit nicht verlieren.
Fragen zum Text
Welches Schema lässt sich im Schöpfungsbericht erkennen?
Inwiefern bricht Vers 26 aus dem Gestaltungsschema der Schöpfungstage aus und was bedeutet das für den Inhalt?
Wie ist der Plural in Vers 26 zu verstehen („Lasst uns Menschen machen“)?
Übertragung ins Leben
Schon lange wird unterschieden zwischen biologischem und soziologischem Geschlecht, also dem natürlichem Geschlecht und den Geschlechterrollen in der Gesellschaft. Heute wird im Zuge des „Gender Mainstreaming“ auch die biologische Festlegung des Menschen auf ein Geschlecht infrage gestellt. Neben allen guten Impulsen dieser Bewegung (zum Beispiel Gleichstellung und Gleichbehandlung der Frauen in der Arbeitswelt) halte ich das für mehr als bedenklich. „Er schuf sie als Mann und Frau“ (Vers 17)!
Gesprächsimpulse
Evolution oder Schöpfung – oder beides? Wie wirkt es sich auf unser Leben aus, ob wir glauben, dass Gott uns geschaffen hat, oder ob wir meinen, wir seien das Produkt eines Zufalls?
Wie erleben Sie das Zusammenleben der Geschlechter?
Tischlein deck dich!
1. Mose 2,4-25
Erklärungen zum Text
In diesem Abschnitt geht es mehr um den Menschen als um die Schöpfung selbst. Gott legt selbst Hand an, er töpfert oder modelliert (wörtlich in Vers 7) den Menschen und bläst ihm den Lebensatem ein. Dann wird er mit allem versorgt, was er braucht. Der Garten wird offenbar um seinetwillen gemacht und ebenso die Tiere. Von Anfang an gehört die Arbeit zum Menschsein. Sein Auftrag ist es, sich um den Garten zu kümmern. Ein Versuch, den Garten Eden zu lokalisieren, muss scheitern. Das kann auch nicht Sinn der Sache sein. Die großen Lebensadern der Erde entspringen alle dem Garten, den Gott für die Menschen angelegt hat.
Die zwei Bäume weisen dem Menschen seine Grenzen. Warum er nicht vom Baum der Erkenntnis essen darf, wird nicht gesagt, aber was geschieht, wenn er es doch tut. Gott droht Adam nicht mit dem Tod, sondern warnt ihn vor den Folgen des Ungehorsams. Die Bäume erst ermöglichen es Adam, eine Wahl zu treffen. Er kann sich für oder gegen das Gebot Gottes entscheiden. Das heißt, er muss sich nun zum Gebot und damit auch zu Gott irgendwie verhalten. Das ist die Grundbedingung der Freiheit, dass wir eine Wahl haben. Und Gott lässt den Menschen die Freiheit, die so weit geht, dass sie sich auch gegen ihn entscheiden können.
Das einzige „Nicht gut“ der Schöpfung betrifft den einsamen Menschen. Auch hier wird der Mensch zu dem, was er ist, in der Begegnung und Gemeinschaft mit anderen, durch die er erst vollendet wird. Er wird von Anfang an als Gemeinschaftswesen geschaffen. Mann und Frau ergänzen und brauchen einander. Das ist noch keine Begründung für die Ehe. Es wird nur ganz grundsätzlich festgehalten, dass die Geschlechter nicht ohne das jeweils andere sein können. Ein unverheirateter Mensch ist darum keine „halbe Portion“. Die beiden kennen noch keine Scham, weil sie sie noch nicht nötig haben. Die Tiere werden nicht zu Adam gebracht, damit sie ihm die ersehnte Hilfe sind, sondern damit er sie benennt und in seine Welt einordnet.
Fragen zum Text
Wie ist Vers 17 zu verstehen? Adam und Eva sind ja nicht gestorben, als sie von den Früchten des Baumes gegessen haben!
Warum soll der Mensch nicht selber wissen, was für ihn gut und schlecht ist (Verse 9 und 16)?
Warum wird der Baum des Lebens hier nicht mehr erwähnt (vergleiche Kapitel 3,22)? Warum gilt das Verbot nicht für ihn?
Übertragung ins Leben
Es gibt nichts, was so schön und überwältigend ist wie die leidenschaftliche Liebe zwischen Mann und Frau. Jeder, der das schon einmal erlebt hat, kann sicher Adams Freudenruf verstehen. Um dieser Liebe willen geben wir gerne die stärksten Bindungen auf, die wir bis dahin kannten: die zu den Eltern. Schade, dass diese Liebe heute so oft banalisiert wird.
Gesprächsimpulse
Oft höre ich: „Gott hätte den Baum der Erkenntnis besser nicht in den Garten gestellt und selber alles bestimmt. Dann wäre es besser gelaufen.“ Was meinen Sie dazu?
Wie können wir unserem Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, nachkommen? Denken Sie dabei nicht nur an die große Politik.
Wie bewerten und deuten Sie die „Schamlosigkeit“ von Adam und Eva?
Was bedeutet Vers 24 für die Beziehung von Mann und Frau?
Das Böse schlängelt sich herein
1. Mose 3,1-24
Erklärungen zum Text
In der Erzählung spricht die Schlange. Sie wird erst später auf den Satan gedeutet. Woher das Böse plötzlich kommt, wird nicht gesagt. Woher kommen diese teuflischen Fragen? Sie sind einfach da. Sie schlängeln sich in Evas Bewusstsein. Die Schlange beginnt harmlos, fast fromm. Ganz ungläubig fragt sie, ob Gott denn wirklich so ein Verbot ausgesprochen hat. Eva verneint, muss aber immerhin zugeben, dass es diesen einen Baum gibt, der tabu ist. Allerdings sagt sie, die Früchte dürften nicht einmal berührt werden. Davon war nie die Rede. Der Satz danach (Vers 5) ist nur halb gelogen, denn den Menschen werden die Augen aufgetan; aber sie sind nicht wie Gott geworden – im Gegenteil! Was die Früchte so verlockend macht, ist nicht ihr Aussehen oder Geruch, sondern die Verheißung, die an sie geknüpft wird: Ihr werdet sein wie Gott. Erst dieses Versprechen lässt sie auch gut aussehen. Die Frau beginnt Gott zu misstrauen: Woher wissen wir, dass er uns nicht das Beste vorenthält? Damit hat die Schlange ein wichtiges Zwischenziel erreicht.
Gott muss sich durch seine Fragen natürlich nicht erst informieren. Er weiß längst Bescheid aber will den Menschen, die sich vor ihm versteckt halten, die Chance geben, sich zu verantworten. Aber die schieben die Verantwortung und die Schuld weiter auf den nächsten. Hier wird schnell deutlich, was die Sünde bewirkt: den Bruch zwischen Mensch und Gott. Dem Menschen genügt es nicht, Geschöpf zu sein. Er will selber Gott sein und Gott nicht Gott sein lassen. Er wird zum Rebellen. Der Bruch herrscht nun auch zwischen Mensch und Mensch. Die Schuld schiebt er auf den Mitmenschen, den er doch eigentlich geliebt hat. Es besteht nun plötzlich ein Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnis. Und auch zwischen Mensch und Umwelt ist nun etwas zerbrochen. Adam muss der Natur seinen Lebensunterhalt abtrotzen und erkämpfen. Dass Gott die Menschen aus Eden und damit vom Baum des Lebens vertreibt, ist nicht nur Strafe. Ewig leben würde ja heißen: den Fluch auf immer tragen. So aber bleibt er begrenzt.
Fragen zum Text
Mit welcher Taktik geht die Schlange vor?
Worin bestehen die Strafen?
Wieso können die Menschen ihre Nacktheit voreinander nicht mehr ertragen?
Wie ist Vers 22 zu verstehen?
Übertragung ins Leben
Rebellen sind uns oft gar nicht so unsympathisch, vor allem, wenn sie sich gegen ein Unrechtssystem erheben, zum Beispiel beim Widerstand gegen Adolf Hitler. Im Film sind die Rebellen oft die Guten (zum Beispiel in „Star Wars“). Die Rebellion der Menschen gegen Gott aber hat ihren Ursprung in Misstrauen und Undankbarkeit und hat an sich nichts Heroisches.
Gesprächsimpulse
Worin besteht das Wesen der Sünde und was bedeutet es, dass Christus unsere Sünden ans Kreuz getragen und vergeben hat?
Wie empfinden Sie ihr Verhältnis zu Gott, wenn Sie schuldig geworden sind?
Warum fällt es oft so schwer, Gott und seinem Wort zu vertrauen?
Brudermord
1. Mose 4,1-26
Erklärungen zum Text
Abel bedeutet „Hauch, Nichtigkeit“. Und genau das ist er auch. Ihm ist kein langes Leben vergönnt, er ist der erste Mensch, der stirbt. Warum Gott Kains Opfer nicht annimmt, wird nicht begründet. Er bringt von den Früchten seines Ertrages und es wird nicht gesagt, dass sein Opfer mangelhaft gewesen sei. Die Rüge Gottes bezieht sich auf seinen Zorn, der aber erst entstand, als sein Opfer abgelehnt wurde. Kains Opfer wird sogar zuerst erwähnt. Hat er damit begonnen? Und warum? Gott schreibt noch keine Opfer vor. Offenbar sind sie von selbst darauf gekommen und verstehen es als einen Dank an Gott. Auch wird man Kain schwerlich unterstellen können, er habe schon vor oder während des Opfers üble Gedanken gehegt und man sollte dies darum auch nicht als Begründung für die Ablehnung seines Opfers heranziehen. Der böse Plan wird doch eher durch den Neid geweckt. In Hebräer 11,4