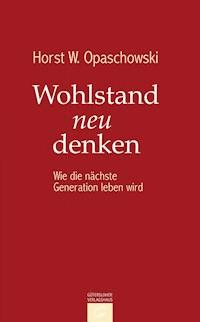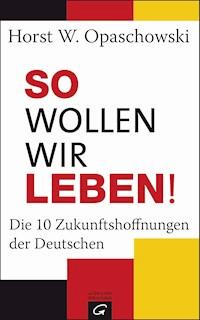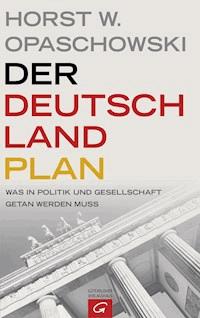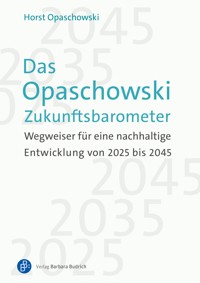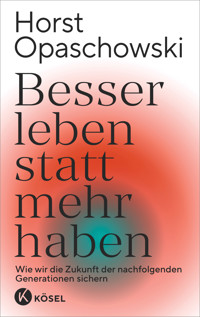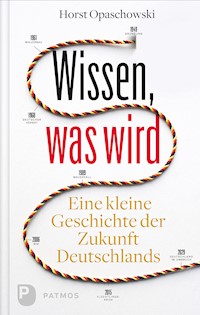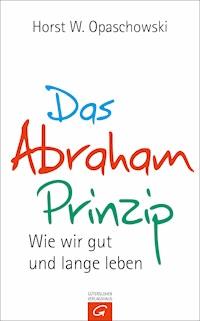
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Deutschen leben immer länger – und besser!
Noch nie hatten wir eine so hohe Lebenserwartung wie heute: Alle zwei Wochen verlängert sich unser Leben um ein langes Wochenende. Die Karten des Lebens werden neu gemischt.
Mit diesem Buch gibt Opaschowski Antworten auf die Frage: Wie können wir den Jahren mehr Leben und nicht nur dem Leben mehr Jahre geben?
Immer mehr ältere Menschen fühlen sich fit und gesund. Eine Revolution auf leisen Sohlen kündigt sich an: Die Ära des Alterspessimismus geht zu Ende! Eine langlebige Gesellschaft mit alterslosen Zügen entsteht. Jedes Lebensalter zählt. Die Zukunftsformel lautet: durchstarten in ein langes und gutes Leben!
- - Das neue Buch des bekannten und renommierten Zukunftsforschers
- - Opaschowski zieht positive Bilanz des demografischen Wandels: Länger leben »lohnt« sich
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Horst W. Opaschowski
Das
Abraham
Prinzip
Wie wir gut und lange leben
Unter Mitarbeit vonIrina Pilawa
Gütersloher Verlagshaus
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Copyright © 2016 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-16622-9V002
www.gtvh.de
Für unsere Kinder und Enkelkinder
»Wir müssen in den nächsten 30 Jahren
ganz neu lernen zu altern
oder jeder Einzelne der Gesellschaft
wird finanziell, sozial und seelisch gestraft.«
Frank Schirrmacher
(1959 bis 2014, Publizist, aus »Das Methusalem-Komplott«, 2004, S. 12)
Inhalt
Vorwort
1. Das Abraham-Prinzip
»Auf dass es dir wohlergehe und du lange lebest auf Erden!«
2. Am besten mehrere Leben leben?
Die Vision einer langlebigen Gesellschaft
3. Von Siebzig auf Hundert!
Durchstarten in ein langes Leben
4. So geht Langlebigkeit!
Das Leben bejahen, sich jünger fühlen
5. Den Geist nicht aufgeben
Geistige Fitness als lebenslange Herausforderung
6. Wohlfühlen in der eigenen Haut
Gesundsein als Lebenselixier
7. Auf Nummer sicher gehen
Für finanzielle Absicherung sorgen
8. Beziehungsreichtum
Die Familie als beste Lebensversicherung
9. Freunde als zweite Familie
Nachbarn als Wahlverwandte
10. Zusammenhalt mit Zukunft
Die neue Solidarität der Generationen
11. Generation Superior
Leben im Zeitwohlstand
12. Länger arbeiten können
Leben ist die Lust zu schaffen
13. Zuhause sein im Vertrauten
Selbstbestimmt wohnen bis ins hohe Alter
14. Gemeinsam statt einsam
Öfter das Schneckenhaus verlassen
15. Gebraucht werden
Wer eine Arbeit hinter sich hat, soll eine Aufgabe vor sich haben
16. Bestzeit
Das Beste aus dem machen, was man am besten kann
17. Lebensunternehmer
Das Leitbild der Zukunft
18. Wissen, wofür man lebt
Von der Flucht in die Sinne zur Suche nach dem Sinn
19. Gut leben statt viel haben
Vom Wohlleben zum Wohlergehen
»Erfüllt leben«: Wie geht das wirklich?
Das Generationengespräch zwischen der Tochter Irina Pilawa (44) und dem Vater Horst Opaschowski (75)
Empirische Grundlagen der Studie »Das Abraham Prinzip«
Anmerkungen
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Abraham soll 175 Jahre alt geworden sein. Das ist biblisch überliefert. Im Vergleich zu ihm bin ich mit meinen 75 Jahren geradezu ein Jugendlicher, weil mir hundert Lebensjahre fehlen. Damit Sie es gleich wissen: Ich bin wirklich 75. Mir geht es gut. Und ich bereue nichts – privat nicht und beruflich auch nicht. Ein ganzes Forscherleben lang aber beschäftige ich mich mit den Veränderungen in den Generationenbeziehungen zwischen Jung und Alt.
Schon als 29-Jähriger brandmarkte ich in meiner ersten Buchveröffentlichung den »Jugendkult in der Bundesrepublik« (1970) und kritisierte den Jugendwahn in den Betrieben (»Mit 50 zum alten Eisen«). Mitte der achtziger Jahre (1984) machte ich mir frühzeitig Gedanken über die Folgen der »demografischen Veränderungen« und die wachsende Diskrepanz zwischen dem »subjektiven Sich-alt-Fühlen und dem objektiven Alt-Sein«. Und ich prognostizierte schließlich für die nahe Zukunft: »Wir entwickeln uns zu einer langlebigen Gesellschaft!«
Jetzt sind wir auf dem besten Weg dorthin. Und Mitautorin Irina Pilawa, meine Tochter, bemerkt lakonisch: »Wer kennt schon dein Forscherleben? Viel wichtiger ist doch die Frage: Wo bleiben deine Forschungsergebnisse? Wenn sie nicht als Datenfriedhöfe in den Archiven verstauben sollen, musst du sie auf den Punkt bringen und gebündelt und persönlich bewertet veröffentlichen.« Recht hat sie - wieder einmal.
Denn seit wir gemeinsam vor zwei Jahren ein eigenes Institut für Zukunftsforschung in Hamburg gegründet haben, macht sie sich zur engagierten Anwältin für die nächste Generation, damit auch sie eine lebenswerte Zukunft vor sich hat. So entstand relativ spontan das Vater-Tochter-Gespräch, das sich in diesem Buch wiederfindet.
Von hier aus war es nicht mehr weit zur Entwicklung und praktischen Umsetzung der Buch-Idee, die meine Tochter mit begleitet hat. Was wir – leicht biblisch erhöht – das »Abraham-Prinzip« nennen, ist nur eine symbolische Umschreibung für das menschliche Streben, ein langes Leben auch zu einem guten Leben werden zu lassen. Wie sagt Irina Pilawa? »Gut und lange leben wollen: Das betrifft doch uns alle – die Enddreißiger in der rush-hour des Lebens genauso wie die Mittfünfziger in der nachelterlichen Lebensphase, von der Generation 65plus ganz zu schweigen.«
Da schließt sich der Lebenskreis. Wir müssen uns nicht neu erfinden, wohl aber ernsthafter über die Qualität eines immer länger werdenden Lebens nachdenken. Eins ist doch klar: Wer gut und lange leben will, sollte nicht den Arzt oder Apotheker fragen, sondern seinen Lebensstil ändern – mental und auch sozial.
1. Das Abraham-Prinzip
»Auf dass es dir wohlergehe und du lange lebest auf Erden ...«
Die Bibel kann uns viel erzählen. Aber hat Abraham je gelebt? Es gibt doch keinen Nachweis für seine Existenz. Warum – um Gottes willen – berufen sich gleich drei Religionen auf ihn: das Judentum, das Christentum und der Islam. Für diese drei nach ihm benannten »abrahamitischen« Religionen ist er ein Stammvater und eine Symbolfigur zugleich.
Abraham gilt als Vorbild für ein gutes und langes Leben.
Im biblischen Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus lässt das Lukas-Evangelium Lazarus am Ende von den Engeln in »Abrahams Schoß«1 tragen. Johann Sebastian Bach hat diese Symbolik an den Schluss seiner Johannes-Passion gesetzt: »Ach Herr, lass dein lieb‘ Engelein / Am letzten End‘ die Seele mein / In Abrahams Schoß tragen.« Selbst in Friedrich Schillers »Wallenstein« wird gefragt: »Wie machen wir’s, dass wir kommen in Abrahams Schoß?«
Auch im bekannten Kinderspiel von der goldenen Brücke, in dem sich das gefangene Kind zwischen Himmel und Hölle, für Engel oder Teufel entscheiden muss, spiegelt sich die Vorstellung von Abrahams Schoß wider. Und Seeleute, die in der Mecklenburgischen Bucht einen guten Ankerplatz finden, sagen voller Stolz: »Nu liggen wi as wenn wi in Abrahams Schot liggen.« Das Bild von Abrahams Schoß findet sich in vielen Sprachen wieder: Im Englischen heißt es »Abrahams bosom«, im Französischen »le Sein d’Abraham« und im Italienischen »il Seno di Abramao«.
Wer in Abrahams Schoß ruht, kann sicher und geborgen leben.
Und wer heute – wie die Große Koalition in Berlin – gar programmatisch über das »gute Leben« in Deutschland nachdenkt, kommt in diesen Krisenzeiten nicht ohne den Hinweis auf Sicherheit und Stabilität des Lebens aus – symbolisiert in den »4F«: Frieden, Freiheit, Freunde und Familie.
Das Abraham-Prinzip gilt als Chiffre für ein erfülltes Leben.
Nach dem Abraham Prinzip leben, heißt im biblischen Sinne: im »Gelobten Land« ankommen! Erst dann bewahrheitet sich das Buch Hiob: »Und er starb - alt und lebenssatt«. Bis dahin aber dominiert der Lebenshunger, damit es sich auch lohnt, so lange zu leben. Die Erfahrung zeigt: Nur wer gut zu leben versteht, kann auch länger leben.
Wir müssen uns nicht ständig neu erfinden, um das lange Leben als Herausforderung und Aufgabe zu begreifen. Bis ins hohe Alter mit Leib und Seele an sich arbeiten und für andere da sein, heißt: abrahamitisch leben und dem Leben einen Sinn geben. Wer aber kann schon erfülltes Leben konkret beschreiben? Davon gibt es doch kein Bild und kein Foto, allenfalls Sinnelemente, die als Ganzes das Mosaik eines guten und langen Lebens zusammenhalten.
Wer gut und lange zu leben versteht, wird am Ende des Lebens sagen können: »Ich habe Abraham gesehen!«
Erinnern wir uns: Abraham ist mit seinen 175 Jahren in die lange Reihe der Langlebigkeitsmythen2 einzuordnen – in die
• Zeit vor der SintflutMethusalem (969 Jahre),
Noah (950), Adam (930),
Kain (910) und die
• Zeit nach der SintflutIsaak (180), Abraham (175),
Jakob (147).
Die überlieferten Langlebigkeitsmythen vermitteln den Eindruck eines Goldenen Zeitalters, in dem die Menschen sehr, sehr lange lebten, nie wirklich alt wurden (Genesis 5:9:29) und am Ende sanft entschliefen. Im Vergleich zu Methusalem ist Abraham geradezu im jugendlichen Alter gestorben.
2. Am besten mehrere Leben leben?
Die Vision einer langlebigen Gesellschaft
1922, vor einem knappen Jahrhundert, beklagte sich der tschechische Schriftsteller und Erfinder des Wortes »Roboter« (tschechisch »robots«) Karel Capek in seinem Drama »Die Sache Makropulos« (Vec Makropulos) über eine menschliche Unzulänglichkeit: Zu einem Zeitpunkt des Lebens, da wir genügend Erfahrung und Weisheit besitzen, um der Welt und uns selbst das Beste zu geben, lassen unsere körperlichen Kräfte nach und beginnen unsere geistigen Fähigkeiten zu verkümmern.
Die logische Konsequenz für Capek, der Aldous Huxley und George Orwell nahestand, war: »Geben wir jedem 300 Jahre zum Leben. 50 Jahre, um ein Kind und Schüler zu sein. 50 Jahre, um die Welt und wie es in ihr zugeht, verstehen zu lernen. 100 Jahre, um zu arbeiten. Und dann, wenn wir alles begriffen haben, 100 Jahre, um ein weises Leben zu führen, zu lehren und ein Beispiel zu geben. Wie kostbar wäre das Leben, wenn es 300 Jahre dauerte!«1. Wären 300 Jahre wirklich ein Segen oder ein Fluch? Käme dann nicht die große Langeweile auf?
Eine Paradoxie des Lebens wartet auf uns: Jedes Jahr nimmt die Lebenserwartung der Deutschen um zwei bis drei Monate zu. Schön und gut?
Die meisten Bundesbürger wollen heute schon länger leben – aber nicht zu lange.
Vor einem biblischen Alter graut vielen. »Möchten Sie 150 Jahre alt werden?« Diese hypothetische Frage des Allensbach Instituts hat die Zahl der Befürworter in den vierzig Jahren zwischen 1964 (55%) und 2004 (Ost: 33% - West: 24%) fast halbiert2. Die Deutschen haben keine Angst vor dem Älterwerden – aber »Lust auf Alter« oder gar auf »Langlebigkeit« sieht anders aus. Es ist mehr die Sorge um den möglichen Verlust an Lebensqualität in den letzten Lebensjahren.
Wir »müssen« möglichst frühzeitig durchstarten lernen in ein langes Leben, das fast unausweichlich auf die meisten von uns wartet. Was ist zu tun? Gibt es auch mit hundert Jahren ein erfülltes Leben? Und wenn ja, wie?
Der demografische Wandel spricht eine deutliche Sprache: Eine Altersrevolution kommt auf uns zu. Die Bevölkerung altert dramatisch. Jeder Fünfte (21%) in Deutschland gehört zur Generation 65plus, 2060 wird es jeder Dritte (33%) sein.
Bis zum Jahr 2040 wird sich allein der Anteil der über 60-Jährigen in Deutschland verdoppeln.
Die demografische Revolution bleibt nicht allein auf Deutschland beschränkt. Nach Berechnungen des UN-Bevölkerungsfonds (unfpa) wird die allgemeine Lebenserwartung in den westlichen Industrieländern bis Ende des Jahrhunderts auf 87,5 Jahre (bei Männern) und 92,5 (bei Frauen) steigen. Selbst ein Leben über 100 könnte mit Hilfe der Genforschung Wirklichkeit werden – wenn wir dies denn wollen. Eines kann man sicher voraussagen: bedrückende Aussichten für die arme Erbengeneration, die so lange warten muss ...
Unter allen westlichen Industriegesellschaften weist Deutschland die stärkste Alterung auf. Drastischer Geburtenrückgang und steigende Lebenserwartung bewirken geradezu eine Überalterung der Gesellschaft, die in Zukunft allenfalls durch Einwanderung gestoppt werden kann. Es zeichnen sich zwei Entwicklungen für die Zukunft ab: Deutschland wird Einwanderungsland und/oder Deutschland wird grau. Solange zu wenige Kinder geboren werden und gleichzeitig die Lebenserwartung stetig zunimmt, altert die Gesellschaft als Ganzes.
Wir entwickeln uns zu einer langlebigen Gesellschaft. In Zukunft wird Hochaltrigkeit, immer wahrscheinlicher.
Wer hat Angst vor Methusalem? Ein ganzer Forschungszweig droht, seinen Gegenstand zu verlieren. Weil sich die Alternsforschung zur Langlebigkeitsforschung wandelt, wird auch eine präzise Definition von »Jungbleiben« und »Älterwerden«, von »Jung« oder »Alt« immer schwieriger. Vielleicht gibt es bald den »alten Menschen« nicht mehr. Der Altersbegriff wird einfach wegdefiniert: objektiv alt, aber subjektiv jung. Bis Anfang siebzig gehört man zu den »Neuen Alten« oder »Jungen Alten«. Alt ist in Zukunft nur noch der, der sich offen dazu bekennt. Nicht mehr über das Alter, sondern über persönliche Lebensbedürfnisse und das soziale Umfeld (z.B. gute medizinische Versorgung, bedienerfreundliche Technik, generationsübergreifende Wohn-, Kultur- und Reiseangebote) wollen die älteren Generationen erreichbar und ansprechbar sein.
Die »Grauen Giganten« kommen. Damit sind die neuen Centenarians gemeint, die über hundert Jahre alt sind. 1965, vor einem halben Jahrhundert, bekamen 225 Hundertjährige in Deutschland ein persönliches Glückwunschschreiben des Bundespräsidenten und einen Scheck über 250 DM überreicht. Diese goldenen Jubiläumszeiten sind längst vorbei. Denn schon zehn Jahre später hatte sich die Zahl der Hundertjährigen auf 716 erhöht. Und seither nimmt die Zahl der Hundertjährigen in Deutschland fast explosionsartig zu (1995: 2.496 – 2015: 5.523). Langlebigkeit wird ein Teil der Normalität.
Um 2030 scheiden die Babyboomer aus dem Erwerbsleben aus. Dreißig Jahre später wird man in Deutschland eine ganze Kleinstadt mit Hundertjährigen füllen können, die körperlich und geistig vitaler sind als jede Generation im gleichen Alter zuvor. Nach der Hundertjährigen-Studie der Universität Heidelberg (Institut für Gerontologie) lebt jeder zweite Hundertjährige autonom im eigenen Haushalt – und regelt auch seine Finanzangelegenheiten selbst. Die Angst vor dem Lebensqualitätsverlust im höheren Alter ist weitgehend unbegründet.
Die zunehmende Langlebigkeit erklärt sich wesentlich aus einschneidenden Veränderungen des Lebensstils vieler Menschen, insbesondere ihrer Ernährungsgewohnheiten in Verbindung mit gesünderen Umweltbedingungen und Fortschritten der Medizin.
Noch nie haben so viele Menschen in Deutschland und der westlichen Welt ein so hohes Alter erreicht.
Und ein noch längeres Leben wartet auf sie. Müssen wir bald unsere Kinder darauf vorbereiten, dass sie hundert Jahre alt werden können und nicht aufhören dürfen, sich weiterzuentwickeln und weiterzulernen? Und ist dann die provokative Forderung aus dem George-Orwell-Jahr »1984« nicht bald politische Wirklichkeit: »Schafft den Ruhestand ab!«3? Wer wird sich in Zukunft schon mit 63, 65 oder 70 Jahren einfach stilllegen lassen wie einen alten Hochofen, wenn noch dreißig Lebensjahre auf ihn warten? Und gleichen dann nicht viele langlebige Menschen einer alten Bibel, die so zerlesen ist, dass beim Umblättern einige Seiten wegbrechen, aber der Inhalt nicht veraltet ist, weil die Aussagen »taufrisch« bleiben4? Sind alte Menschen alten Büchern vergleichbar, die im Laufe der Jahre zerlesen und zerbrechlich werden, aber immer noch lesens- und lebenswert sind?
Trotz verminderter Gehgeschwindigkeit und mancher Knieprobleme bleiben alte Menschen länger gesund und sind seltener krank. Die medizinische Forschung weist nach: Ein Teil unseres Körpers, die DNA, altert nicht: »In der DNA ist der genetische Code für unser Leben festgelegt. Kopien unserer DNA bleiben in unseren Nachkommen erhalten, der Code degeneriert also nicht«5.
Langlebigkeitsgene (»Gerontogene«) entscheiden mit darüber (allerdings nicht allein), wie alt wir werden.
Die Alternsforschung über Hundertjährige (sogenannte »Centenarians«) und langlebige Familien weist nach, dass auch ihre Nachkommen überdurchschnittlich lange leben.
Die Deutschen leben immer länger. Seit 2006 hat sich die Lebenserwartung um zweieinviertel Jahre erhöht – Tendenz weiter steigend. Neugeborene Jungen haben eine Lebenserwartung von 78 Jahren und zwei Monaten vor sich, Mädchen 83 Jahre und einen Monat.
Innerhalb der letzten hundert Jahre hat sich unsere Lebenserwartung von vierzig auf achtzig Jahre verdoppelt. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht absehbar. Die Lebenserwartung der Deutschen nimmt jedes Jahr um zwei bis drei Monate zu (z.Zt. 2,76 Monate pro Jahr). Die medizinische Alternsforschung6 prognostiziert daher für die nahe Zukunft:
Alle zwei Wochen verlängert sich unser Leben um ein langes Wochenende.
Die Millennials, die um 2000 Geborenen, können mit jedem Jahrzehnt mindestens zwei bis drei Jahre älter werden als ihre Elterngeneration und lange leben – wenn sie gut und maßvoll zu leben verstehen.
In der Mitte des Lebens machen sich viele Menschen Gedanken über die zweite Lebenshälfte. Die wichtigste Erwartung lautet: endlich Muße. Bei den antizipierten Vorteilen dominieren zwei Bereiche: der Genuss der neuen Freiheit (frei von Verpflichtungen sein, selbst bestimmen, was man tun will, keine Rücksicht mehr nehmen müssen) und die Ruhe (kein Stress, keine Hektik, keine Termine mehr und endlich Zeit für sich selbst haben). Besonders der Aspekt viel Zeit wird anschaulich ausformuliert, wobei in den Schilderungen Begriffe wie »unbegrenzt«, »ausgiebig« und »endlos« fallen. Hier deutet sich ein starkes Bedürfnis nach Erholung und Entspannung an – nach einem offensichtlich immer belastender werdenden Berufsleben. Aktive Aspekte (z.B. die Vorfreude auf bestimmte Unternehmungen) fehlen in dieser Vorausschau.
Die primäre Erwartungshaltung der Mittvierziger: Ausruhen vom Arbeitsleben und viel Zeit und Muße haben.
Was sie nachher konkret mit dieser Zeit anfangen wollen, darüber machen sie sich vorher wenig Gedanken. Sie haben nur den einen Vorsatz, sich zu bemühen, ihr Leben möglichst »sinnvoll zu gestalten«.
Die zweite Erwartungshaltung lautet: einfach nachholen. Man will das nachholen oder intensivieren, wozu man bisher aus Zeitmangel nicht oder nicht ausgiebig genug kam. Man denkt hier vor allem an Lektüre jeder Art: »Die Zeitung von vorne bis hinten lesen« oder »mal wieder ein gutes Buch lesen«. Auch dem Garten will man sich mehr widmen als bisher, häufiger spazieren gehen und natürlich viel Reisen und Ausflüge machen. Bei den Mittvierzigern ist eine starke Tendenz erkennbar, den kommenden Wechsel und die damit verbundenen Konsequenzen von sich wegzuschieben. Die Folge ist eine Ausweichreaktion nach dem Motto: »Kommt Zeit, kommt Rat«.
Langlebigkeit ist nur gut, wenn auch die Lebensqualität gut ist.
Die langlebigste Gesellschaft aller Zeiten kommt auf uns zu. Der »Jugendkult« des 20. Jahrhunderts ist Geschichte. Und Lebensfreude und Lebensfreunde gibt es auch im hohen Alter. Wer lange »lebenshungrig« zu leben versteht, wird sich nach dem Abraham-Prinzip am Ende des Lebens »alt und lebenssatt«, d.h. zufrieden für immer von der Bühne des Lebens verabschieden können.
Von den heute geborenen Deutschen wird 100 Jahre später noch die Hälfte am Leben sein.
Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen: Wie kann sichergestellt werden, dass ein langes Leben auch ein »gutes Leben« wird – materiell und mental, physisch und sozial? Was müssen Eltern heute tun, um die nächste Generation darauf vorzubereiten, sehr alt zu werden? Und werden wir uns nicht alle spätestens in der Mitte des Lebens die Frage stellen müssen: Beruf, Familie – und was dann?
3. Von Siebzig auf Hundert!
Durchstarten in ein langes Leben
Früher galt eine Frau mit vierzig Jahren als Matrone, nannte sich Calvin mit fünfzig Jahren einen alten, verbrauchten Mann und dankte Karl V. mit 55 Jahren restlos erschöpft als Greis ab. Heute werden wir immer älter, wollen auch gut und lange leben – aber möglichst nicht alt sein.
Eine Agenda zur Vorbereitung auf ein langes Leben gibt es bisher noch nicht.
Seit 1855 hat sich die Lebenserwartung der Deutschen von 37 Jahren auf 81 Jahre mehr als verdoppelt. Und eine immer längere Lebenszeit steht uns bevor. Dieses als Gesellschaft des langen Lebens bezeichnete Phänomen wird zur großen Herausforderung für jeden Einzelnen. Die Fortschritte in Medizin, Ernährung und Versorgung der Menschen zwingen zu Veränderungen in der individuellen Lebensplanung sowie im gesellschaftlichen Zusammenleben.
Doch: Wie und mit welcher Lebensqualität wird man eigentlich 100 Jahre alt? Diese Frage habe ich mir vor drei Jahren gestellt, als sich die Schwester meiner Mutter und die Patentante meiner Frau im Alter von jeweils über hundert Jahren nach einem langen erfüllten Leben für immer verabschiedeten. Beide wirkten zeitlebens zufrieden und glücklich. Beide hatten entbehrungsreiche Kriegs- und Nachkriegsjahre überlebt. Und beide meisterten ihr Leben trotz schwerer persönlicher Schicksalsschläge. Ihr Lebenselixier?
Bescheiden in den Ansprüchen, beständig in der Sorge für andere und beschäftigt rund um die Uhr.
Beide waren ein Leben lang aktiv – und hatten doch immer Zeit. Alma, die Schwester meiner Mutter, wuchs während des 1. Weltkriegs unter ärmsten Verhältnissen auf: Statt Brot gab es Kohlrüben. Und am Ende des 2. Weltkriegs reihte sie sich ein in die Masse der Flüchtlinge von Beuthen in Oberschlesien bis nach Bernburg an der Saale. Es war eine »Flucht mit tausend Ängsten«. Ein Jahr nach der Hochzeit erlitt sie die erste Fehlgeburt. Ihr einziges Kind, das wenige Jahre später geboren wurde, starb im Alter von 28 Jahren an einem Gehirntumor: »Das war das Schlimmste in meinem Leben«. Fortan setzte sie ihre ganze Hoffnung auf die Beziehung zu ihrem Mann: »Einer musste den anderen halten«. Und beide versuchten gemeinsam, »dem Leben Sinn und Frohsinn zu geben«. Sie suchten und fanden schließlich ein Patenkind in der Nachbarschaft. »Die schönen Stunden mit ihm heilten unsere Wunden«.
In den folgenden Jahrzehnten versöhnten sie sich mit dem Leben. Sie fanden Erfüllung in ihren Beziehungen – in der Partnerschaft, dem Freundeskreis und der Nachbarschaft. Das war »ihre« neue Wahl- und Großfamilie, die sich gegenseitig half und unterstützte. Sie wohnten bescheiden in einem DDR-Plattenbau ohne Bad und Balkon – und vermissten nichts. Und als Alma 99 Jahre alt wurde, konnte sie aus dem 2. Stock wegen ihrer Kniebeschwerden die Wohnung nicht mehr verlassen. Kein Grund zur Resignation: »Wenn ich Sonne haben will, öffne ich das Fenster und mache meine Gymnastik«. Ansonsten wirkte sie fröhlich und ausgeglichen, bescheiden und fast demütig. Ihr Wahlspruch des Lebens lautete:
Was ich brauche, das habe ich. Was ich nicht habe, brauch ich nicht.
Mit dieser Lebenseinstellung war bei ihr geradezu Langlebigkeit vorprogrammiert – ganz im Gegensatz zum Szenespruch der Jugend aus der Nach-68er Zeit: »Was ich habe, das will ich nicht. Was ich will, das kriege ich nicht.« Was wir aus diesem Lebensentwurf einer Hundertjährigen lernen können? Auch in einem entbehrungsreichen Leben können wir Glück empfinden und Zufriedenheit finden.
Diese Vorstellung erinnert an das Bild des französischen Schriftstellers Albert Camus, der die philosophische Frage stellte, ob sich das Leben als Sisyphusarbeit überhaupt lohnt1. Können wir uns Sisyphus, der dazu verurteilt ist, ständig den Stein den Berg hinauf zu rollen, nicht auch als glücklichen Menschen vorstellen? Getrieben von dem Wunsch, genau das tun zu wollen, wozu er eigentlich verurteilt ist? Sisyphus hätte dann ein Ziel im Leben. Das wäre geradezu ein mentaler Optimismus, der im Kopf beginnt – in der Bereitschaft und Fähigkeit, das Wünschbare offensiv anzugehen. Wohlwissend, dass das Leben nicht nur eine Aneinanderreihung von guten Nachrichten sein kann. Das Alma-Beispiel zeigt:
Langlebige spielen nicht sich und anderen etwas vor. Sie arrangieren sich und resignieren nicht.
Das Arrangement gibt persönliche Stabilität in einem krisenreichen Leben. Es ist mehr das kleine Glück, das gewonnen und bewahrt werden soll. Damit verbunden ist der Vorsatz »Ich möchte so weiterleben wie bisher.« Und die Einstellung »Was ich brauche, das habe ich!« erhält Vitalität und Lebensfreude.
Die zweite konkrete Antwort auf die Frage »Wie wird man 100 Jahre alt?« bezieht sich auf das Leben der Patentante »Godel«, die 103 Jahre alt wurde. Ich habe sie nur unter diesem Namen kennengelernt. Mit dieser Bezeichnung ist ein alter Brauch verbunden, nach dem bei der Taufe eines Mädchens die »Godel« (bei einem Jungen der »Pate«) den Täufling in der Kirche über das Taufbecken hält. Damit ist zugleich die soziale Verpflichtung verbunden, für das Kind zu sorgen und es notfalls auch großzuziehen, falls den Eltern etwas zustoßen sollte.
Godel war die Patentante meiner Frau, die als armes Flüchtlingskind am Ende des 2. Weltkriegs mit ihrer Schwester und ihrer verwitweten Mutter mittellos in einem hessischen Dorf untergebracht wurde. Die Eltern und Großeltern hatten nach der Flucht aus Schlesien alles verloren, aber hier eine neue soziale Heimat gefunden. Die Mutter versorgte die kleinen Kinder mit dem Notdürftigsten, so dass sie weder hungern noch frieren mussten.