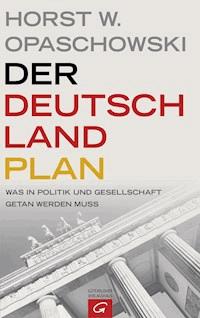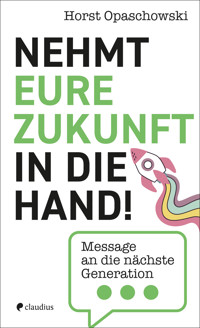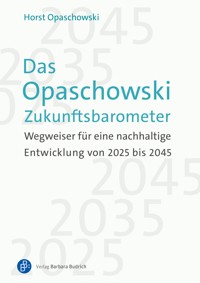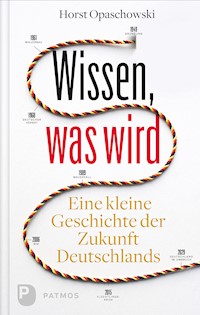Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Barbara Budrich
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie sehen die Deutschen angesichts der Corona-Pandemie in die Zukunft? Diese erste repräsentative Studie über das neue Leben der Deutschen vor und während der Corona-Krise zeigt: Viele Menschen wurden ärmer, aber nicht unglücklicher. Ihr Wohlstandsdenken veränderte sich, und Gesundheit wurde so wertvoll wie Geld. Zeitwohlstand und Beziehungsreichtum kamen als neue Lebensqualitäten hinzu, und auch der Staat strahlte soziale Wärme aus. Die Zuversicht wächst also wieder – auch in unsicheren Zeiten. Die repräsentative Deutschlandstudie umfasst den Zeitraum von der Prä-Corona-Zeit im Januar 2020 über die Corona-Krise im März 2020 bis zu den Corona-Lockerungen ab Juli 2020.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horst Opaschowski
Die semiglückliche Gesellschaft
Das neue Leben der Deutschen auf dem Weg in die Post-Corona-Zeit. Eine repräsentative Studie
Verlag Barbara BudrichOpladen • Berlin • Toronto 2020
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier
Alle Rechte vorbehalten
© 2020 Verlag Barbara Budrich GmbH, Opladen, Berlin & Toronto
www.budrich.de
ISBN 978-3-8474-2466-6
eISBN 978-3-8474-1605-0
DOI 10.3224/84742466
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung: Bettina Lehfeldt, Kleinmachnow – www.lehfeldtgraphic.de
Titelbildnachweis: Bettina Lehfeldt, Kleinmachnow – www.lehfeldtgraphic.de
Lektorat & Satz: Ulrike Weingärtner, Gründau – [email protected]
Druck: Books on Demand GmbH, Norderstedt
Printed in Europe
Für meine fünf EnkelkinderEmmy und NovaMaximilian, Julius und Juri
AN DIE NACHGEBORENEN
„Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten ...Ihr aber, wenn es so weit sein wird, Dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, Gedenkt unsererMit Nachsicht!“
BERTOLT BRECHT: Gedicht (1934)
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Leben in schwieriger Zeit
I. Am Horizont ist Licht in Sicht! Die Menschen machen das Beste aus ihrem Leben
1. Ohne Gesundheit geht gar nichts. Wohlstand fängt mit dem Wohlergehen an
2. Die Zuversicht wächst – trotz Krise. Vor allem Familien mit Kindern blicken optimistisch in die Zukunft
II. Darauf können wir bauen! Die stabile Wagenburg in unsicheren Zeiten
1. Die Familie wird wichtigster Lebensinhalt. Das Zuhausesein im Vertrauten zählt
2. Eine neue Solidarität der Generationen entsteht. Die Unterstützung bei vielen Krisen
3. Freunde und Nachbarn sind wie eine zweite Familie. Verlässliche Wegbegleiter im Leben
4. Helferbörsen im Wohnquartier. Freiwillige Hilfeleistungen sind gefragt
5. Aus Mitgliedern werden Mitmacher. Initiativen verdrängen Institutionen
6. Bürger wollen eine bessere Gesellschaft schaffen. Konturen einer neuen Mitmachgesellschaft
7. Arbeiten zwischen Homeoffice und Netzwerken. Berufs- und Privatleben nähern sich an
8. Hilf dir selbst, bevor der Staat dir hilft. Die Anspruchshaltung verändert sich
9. Volksabstimmungen im Trend. Mehr Macht bei politischen Entscheidungen
10. Der fürsorgende Sozialstaat hat sich bewährt. Der Staat strahlt soziale Wärme aus
III. Die veränderte Wertehierarchie der Deutschen. Die Prioritäten des Lebens wandeln sich
1. Der unaufhaltsame Aufstieg der Ehrlichkeit. Die Antwort auf Defizite in Wirtschaft und Gesellschaft
2. Die große Sehnsucht nach Stabilität. Mehr Sicherheit garantiert mehr Freiheit
3. Vertrauen wird zur neuen Währung. Der soziale Kitt der Gesellschaft
4. Selbstständigkeit ist das wichtigste Erziehungsziel. Lebensunternehmertum gilt als Leitbild
5. Die Wiederentdeckung des Wir-Gefühls. Vom Auseinanderdriften zum Zusammenhalten
6. Zeit ist so wertvoll wie Geld. Mehr Zeitwohlstand durch Entschleunigung
7. Umweltverhalten muss zur Herzenssache werden. Auf Verbote kann dann weitgehend verzichtet werden
8. Medien werden zu Erziehern. Mehr Einfluss als Schule und Elternhaus
9. Mehr teilen als besitzen. Das Eigentumsdenken verändert sich
10. Besser leben statt mehr haben. Ein grundlegender Einstellungswandel zeichnet sich ab
IV. Rettet das gute Leben! Wann, wenn nicht jetzt
1. Schluss mit schlechter Stimmung. Überwiegend negative Nachrichten erzeugen Zukunftsangst
2. „Ich reise – also bin ich!“ Reisen bleibt die populärste Form von Glück
3. Mit neuer Zuversicht in die Zukunft. Die Rettung für Rückschläge
4. Besonnenheit statt Betriebsamkeit. Kühler Kopf in Krisenzeiten
V. „Wir sind semiglücklich!“ Das neue Leben auf dem Weg in die Post-Corona-Zeit
1. „Glückauf“: Es geht aufwärts. Leben in der semiglücklichen Gesellschaft
2. Wunsch nach mehr Optimismus in unserer Gesellschaft! Sehnsucht nach optimistischerer Stimmung im Land
3. Rezession sorgt jeden zweiten Deutschen nicht. Aber Bevölkerung bleibt wirtschaftlich gespalten
4. „Ich vermisse nichts!“ Bescheidener werden als neue Glücksformel
5. Sinn. Besinnung. Besonnenheit. Corona-Krise löst Nachdenklichkeit aus
6. Die Politiker schaffen es! Hohe Zufriedenheit mit dem Krisenmanagement der Regierung
7. Politik muss Jugend Mut zur Zukunft machen! Bevölkerung fordert weitsichtige Lösungsansätze
VI. Anhang
1. „Hilf dir selbst – bevor der Staat dir hilft!“ (M)ein Leben in Krisenzeiten
2. Zukunftshaus Deutschland. Das neue Leben der Deutschen auf dem Weg in die Post-Corona-Zeit
3. Quellen und Belege
4. Stichwortverzeichnis
[11] Vorwort
Leben in schwieriger Zeit
Die Corona-Krise verändert uns und die Gesellschaft – für immer? Wir dürsten nach Freiheit, Geborgenheit und Glück und wollen nicht länger in schwieriger Zeit leben. In dieser Sehnsucht nach dem guten Leben fühlen wir uns bisher von Wissenschaft und Forschung vielfach alleingelassen und enttäuscht. Monatelang, ja täglich und stündlich werden wir mit den Aussagen von Politikern und Experten konfrontiert. Doch mit der Flut der medial vermittelten Informationen entsteht der Eindruck, dass die nahe Zukunft – die Welt und das Leben nach der Krise – immer weniger prognostizierbar ist.
So gesehen haben Wissenschaft und Forschung gerade in Krisenzeiten eine besondere soziale Verantwortung. Sie müssen Antworten und Erklärungen für offene Fragen geben: Können wir den neuen Herausforderungen noch mit alten Gewohnheiten begegnen? Wird sich unser Leben wirklich grundlegend verändern? Und wie sieht die Gesellschaft danach aus? Fahren wir dann alle mehr auf Sicht oder Zuruf, weil niemand weiß, was kommt, was geht und was bleibt? Die folgende Zukunftsstudie beschreibt die Gefühls- und Lebenslage der Deutschen, wenn sich die Krisenlage Zug um Zug beruhigt und das Leben zurückkehrt – in Schulen, Kirchen und Läden, Restaurants und Shoppingcentern, in Parks, Passagen und auf öffentlichen Plätzen, wenn also der Alltag des öffentlichen Lebens wieder Einzug hält.
Während der erzwungenen „Bleib-zu-Hause“-Zeit hatten wir das Wohngefühl als Wohlgefühl erlebt und uns damit auch arrangiert. Jetzt muss der öffentliche Raum als „zweites Zuhause“ wiederentdeckt und neu erobert werden. Schließlich hatte der erzwungene Rückzug ins Private auch seine sozialen Schattenseiten („social distancing“), bei dem die Wohnung zur Isolierzelle nach draußen wurde.
„Am Horizont ist Licht in Sicht“ lautet das überraschende Ergebnis der folgenden Studie. Die Bevölkerung meldet trotz allgemeiner [12] Krisenstimmung ganz persönlich große Zuversicht an. Wer aber ist „die Bevölkerung“? In meinen Auswertungen stütze ich mich nicht auf Meinungen von Minderheiten, die vielleicht schon immer positiv gestimmt waren oder sind. Nein. Alle ausgewerteten Antworten auf die Frage „Was macht die Krise mit den Menschen und der Gesellschaft?“ sind repräsentativ ermittelte Mehrheitsmeinungen der deutschen Bevölkerung. Der Zustimmungsgrad der Befragten liegt beispielsweise bei 59 Prozent („Mehr teilen als besitzen“), 90 Prozent („Ohne Gesundheit ist fast alles nichts wert“) und 91 Prozent („Sehnsucht nach Sicherheit“).
Diese positiven Befunde haben allerdings auch ihre Schattenseiten. Denn je besser es der Mehrheit geht, desto aggressiver wird die Stimmung bei Minderheiten, die sich vom allgemeinen „Alles-wird-gut“-Gefühl der Bevölkerungsmehrheit ausgeschlossen und ausgegrenzt fühlen. Dann kippt nicht die Stimmung im Land, sondern die gefühlte Kluft zwischen Krisengewinnern und Verlierern wird größer und konfliktreicher, was auch die öffentlichen Demonstrationen während der Corona-Krise erklärt. Kritische Zeithistoriker weisen zudem nach, dass es grundsätzliche Vorbehalte, ja Ressentiments gegen die Mehrheitsgesellschaft gibt. Dahinter stehen Minderheiten, die sich mitunter „als moralisch höherwertig inszenieren und deshalb die Mehrheit explizit anfeinden“ (Vukadinovic 2020, S. 2). Sie fühlen sich als Minderheit von Rang und wollen entsprechend anerkannt werden. Ist das Demokratie pur, wenn die meisten Bürger und nicht Politiker oder Experten sagen, wie das Leben vor, während und nach der Krise weitergeht? Die Bürger sind doch der Souverän und die gewählten Politiker nur ihre Vertreter.
Die vorliegenden O.I.Z-Forschungsergebnisse stellen eine empirische, keine spekulative Bestandsaufnahme dar. Die Gedanken zum Wohlergehen und zur Lebenszufriedenheit der Menschen basieren ausschließlich auf gesicherten Daten aktueller Repräsentativumfragen von 3.000 Personen ab 14 Jahren in Deutschland, die in drei Befragungswellen durchgeführt wurden – vor der Krise (Januar 2020), in der Corona-Krise (März 2020) und nach den ersten Lockerungen (Juli 2020):
• Die erste Welle begann mit Repräsentativerhebungen vor der Krise. „Wir leben in schwierigen Zeiten: Umwelt-, Wirtschafts- und [13] Gesellschaftskrisen hinterlassen Spuren auf dem Weg in die Zukunft ...“ Mit diesen Worten startete ich am 20. Januar 2020 eine erste bundesweite Repräsentativumfrage und stimmte die Bevölkerung auf gesellschaftliche Veränderungen in naher Zukunft ein – bevor das Corona-Virus Deutschland erreichte und der erste Corona-Fall in Deutschland am 27. Januar gemeldet wurde.
• Die zweite Befragungswelle fand zwei Monate später vom 09. bis 19. März mit Beginn der Top-Corona-Zeit statt, als die WHO am 12. März die Verbreitung des Corona-Virus zur Pandemie erklärte, Ausgangsbeschränkungen in Deutschland drohten und politische Gebote und Verbote eskalierten: Veranstaltungen und Versammlungen wurden untersagt, Schulen und Kitas, Kinos, Läden und Restaurants geschlossen. Bundeskanzlerin Angela Merkel stimmte die Bevölkerung am 18. März auf die „größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg“ ein und rief zu „Verzicht und Opfern“ auf. In dieser Krisenstimmung, als das öffentliche Leben in Deutschland stillgelegt wurde, fand die zweite Befragungswelle statt.
• Die dritte Befragungswelle wurde vom 13. bis 19. Juli 2020 in Deutschland durchgeführt, als es spürbare Lockerungen für die Bevölkerung gab, die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes für die EU-Länder aufgehoben waren und die Deutschen wieder massenhaft ins Ausland reisen konnten. In dieser Aufbruchsstimmung wurde die Bevölkerung erneut nach ihren Lebenseinstellungen und Zukunftsperspektiven repräsentativ gefragt. Kontaktsperren, Versammlungs- und Reiseverbote waren aufgehoben und Gaststätten, Geschäfte und Einkaufscenter wieder geöffnet.
In allen drei Zeitphasen von Januar bis Juli 2020 herrschte überraschenderweise in der Bevölkerung eine relativ große Gelassenheit, wie die Umfragen des Opaschowski-Instituts für Zukunftsforschung (O.I.Z) zeigen. Dieses positive Stimmungsbild zwischen Zuversicht und Zufriedenheit wurde zeitgleich auch durch die Repräsentativumfrage der R+V Versicherung über die „Ängste der Deutschen“ (R+V 2020) bestätigt: So wenig wie seit 30 Jahren nicht mehr bangten die Deutschen um ihren Job (24%) – zur Zeit der Finanzkrise war der Anteil doppelt so hoch[14] (48%). Auch der ARD-DeutschlandTrend bestätigte diesen Eindruck: Deutlich positiver als die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland betrachteten die Bundesbürger ihre persönlichen wirtschaftlichen Lebensumstände: 80 Prozent der Befragten beurteilten ihre wirtschaftliche Situation als „gut“ bzw. „sehr gut“ (ARD-DeutschlandTrend vom 4. Juni 2020).
Wie ist es zu erklären, dass die Deutschen ruhig und beruhigt waren und sind, also relativ angstfrei in die Zukunft blicken? Aus der internationalen Glücksforschung (vgl. Layard 2005) ist bekannt: Wenn alle Bürger von den Folgen einer Krise betroffen sind, gibt es keine Prestigewettkämpfe, weil alle mit sich selbst beschäftigt und weitgehend zufrieden sind. Subjektiv stellt sich mitten in der Krise ein Zustand des Sich-wohl-Fühlens ein, obwohl es den Menschen objektiv schlechter geht, sie sich aber im Vergleich zu anderen glücklich fühlen. Wenn also am Ende eines dunklen Tunnels Licht am Horizont zu sehen ist oder hoffnungsvolle Zeichen (z. B. „Kurzarbeitergeld“, “Staatlicher Rettungsschirm“, „Steuersenkung“) zu erkennen sind, steigt die positive Stimmung auf breiter Ebene.
Dies erklärt den Optimismus der Deutschen – trotz oder gerade wegen der Pandemie. Je gleichmäßiger die Risiken im Land und in der Welt verteilt sind, desto glücklicher sind die Bürger. Ein Geheimnis wachsender Zufriedenheit in Krisenzeiten ist auch die relativ gerechte Einlösung eines sozialpolitischen Gemeinwohl-Versprechens: Allen soll es nicht schlechter gehen!
Es ist absehbar: Corona hat uns und die Gesellschaft verändert. Der schier unvorstellbare Shutdown hat nachhaltige Spuren hinterlassen. Es setzt ein Nachdenken über den „wahren Wohlstand“ ein: Offensiv, positiv und proaktiv nehmen die Menschen die Herausforderungen der Zeit an. Hilfsbereitschaft ersetzt Hilflosigkeit. Und Zukunftshoffnungen siegen über Angst und Sorgen. „German Angst“ ist Geschichte, „No future“ auch.
„Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten.“ Bertolt Brecht hatte in seinem 1934 geschriebenen Gedicht „An die Nachgeborenen“ das Lebensgefühl der Menschen in Krisenzeiten treffend beschrieben. Zugleich aber ahnte er voraus: Die Menschen werden gestärkt aus der Krise hervorgehen. [15] Die nächste Generation der „Nachgeborenen“ wird eine andere sein: Sie wird mehr für andere da sein und sich gegenseitig mehr helfen: „Wenn es so weit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist …“
Kommt nach der Pandemie die Empathie? Die Corona-Krise setzte in Deutschland tatsächlich positive Energien und Widerstandskräfte frei. Die Bürger bewiesen Mut und Stärke für Gemeinsamkeiten in Familie, Nachbarschaft und Freundeskreis. Ihre Erfahrung des Aufeinander-angewiesen-Seins machte sie sozial sensibler und politisch selbstbewusster – von Familienkontakten über Freundschaftspflege und Nachbarschaftshilfen bis zu Bürgerinitiativen und sozialen Engagements. Die Krise erwies sich auch als Chance für eine neue Generationensolidarität.
Das neue Leben auf dem Weg in die Post-Corona-Zeit wird keine Reise ins Ungewisse sein. Die Deutschen erobern langsam ihr Leben und ihre Zukunft zurück: Sie bauen sich „ihr“ Haus der Zukunft neu. Alles, was sie für ein gutes Leben brauchen, findet sich in diesem Zukunftshaus wieder: Gesundheit, Geld und soziale Geborgenheit. Die stabilen Bausteine für die Nach-Corona-Ära sind die „3V“: Vertrauen. Verantwortung. Verlässlichkeit. Um persönliche Krisenerfahrungen reicher sehen die Bundesbürger mit Zuversicht in ihre Zukunft. Sie leben in einer semiglücklichen Gesellschaft und stellen dabei die Fragen nach ihrem persönlichen Wohlergehen neu:
• Wie viel Geld und Güter braucht der Mensch zum Glücklichsein?
• Was macht ein Mensch ohne Familie?
• Wird Gesundheit unsere neue Zukunftsreligion?
Horst Opaschowski
[17] I. Am Horizont ist Licht in Sicht! Die Menschen machen das Beste aus ihrem Leben
1. Ohne Gesundheit geht gar nichts. Wohlstand fängt mit dem Wohlergehen an
Es gab einmal vor über 3.000 Jahren ein kleinasiatisches Reich namens Lydien. Und dieses Land wurde damals von einer großen Hungersnot heimgesucht. Eine Zeitlang ertrug das Volk die Härten, ohne zu klagen. Als sich aber keine Besserung der Lage abzeichnete, dachten die Lydier in ihrer Not über einen Aus-Weg nach. Sie entwickelten einen – würden wir heute sagen – geradezu mentalen Plan: Er bestand nämlich darin, wie Herodot in seinen „Persischen Kriegen“ (1. Buch/Kap. 54) berichtete, sich jeweils einen Tag so vollständig Spielen zu widmen, dass dabei kein Hunger aufkommen konnte, um dann am anderen Tage jeweils zu essen und sich der Spiele zu enthalten. Auf diese Weise verbrachten sie 18 Jahre (Csickszentmihalyi 1991, S. 11). Und in dieser Zeit erfanden sie den Würfel, den Ball und viele Spiele, die wir heute kennen ...
Dieser Bericht von Herodot mag historisch wahr oder erfunden sein, er weist zumindest auf eine interessante Parallele zur Corona-Krise 2020 hin: In Not- und Krisenzeiten können Menschen mental und sozial so kreativ und erfinderisch sein, dass sie darüber ihre Ängste, Sorgen und Probleme vorübergehend vergessen und aus der Not eine Tugend machen. Dabei fühlen sie sich „ganz gut“, weil es anderen auch nicht besser geht. Sie definieren sich subjektiv als wohl und gesund, obwohl sie objektiv keinen Grund dazu haben. Jenseits der Schreckensnachrichten in aller Welt konzentrieren sie sich auf ihr persönliches Wohlergehen. Sie machen sich fast beschwerdefrei und coachen sich mental. Alles zielt auf Wohlbefinden. Das Ergebnis während der Corona-Krise: Die Menschen konnten sich auch über die kleinen Dinge des Alltagslebens freuen – trotz oder gerade wegen der Shutdown-Situationen: Brettspiele, Basteln und [18] Nähen, Gartenarbeit, Reparaturen und do it yourself, Joggen, Fitness und Fahrradfahren. Selbermachen und gemeinsam etwas tun stand hoch im Kurs. Der Kampf gegen den Zeitbrei war angesagt. Abwechslung tat gut, Aktivität auch.
Nach der weitgefassten Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Gesundheit ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Doch was ist letztlich gesund und was ist krank? Diese Fragen werden in Zukunft vor dem Hintergrund eines langen Lebens immer schwerer zu beantworten sein. Deshalb bekommt das Gesundheitssystem eine fundamentale Bedeutung. Diese ergibt sich zentral aus der Beantwortung der Frage, was wohl tut und wichtig für das persönliche Wohlergehen ist. Erst danach stellt sich die Frage nach der Finanzierbarkeit. Neben der Gestaltung gesunder Lebens- und Arbeitsbedingungen kommen der Prävention und Gesundheitsförderung eine vorrangige Bedeutung zu. Sogenannte primärpräventive Maßnahmen, die gesundheitsförderlich sind und Erkrankungswahrscheinlichkeiten senken helfen, rücken stärker in den Blickpunkt.
Die Krise und ihre Folgen auf den Punkt gebracht: Ohne Gesundheit ist fast alles nichts wert. Jeder und jede muss mehr für das eigene Wohlbefinden tun, also körperlich und seelisch, geistig und sozial fit bleiben, um im Leben nicht allein zu sein oder sich im Alter als fünfte Generation wie das fünfte Rad am Wagen zu fühlen. Positive Gesundheitstrends werden immer wichtiger. Wir können mit einem langen – und über lange Jahre in Gesundheit verbrachten – Leben rechnen, wenn wir selbst etwas dafür tun. Ein seit den 70er Jahren zu beobachtender Zukunftstrend setzt sich weiter fort: Die Gesundheit verbessert sich. Der Anteil der Bevölkerung, der seinen Gesundheitszustand als „sehr gut“ bezeichnet, nimmt überraschend stetig zu.
Das hat Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Die Gesundheit wird zum Megamarkt der Zukunft. Es boomen Bio- und Gentechnologien, Pharmaforschung und Forschungsindustrien gegen Krebs, Alzheimer und Epidemien sowie gesundheitsnahe Branchen, die Care, Vitalität und Revitalisierung anbieten. Der Megamarkt Gesundheit einschließlich Pflege, Reha und Gesundheitssport wird in den nächsten Jahren [19] zum Wachstumsmotor Nr. 1: größer als die Automobilindustrie und vor allem personalintensiver. Rund sieben Millionen Beschäftigte zählt die Gesundheitsbranche. Die Pandemie beschleunigte diesen Expansionsprozess.
„Ohne Gesundheit ist fast alles nichts wert.Deshalb achte ich im Berufs- und Privatleben darauf, gesund und fit zu sein.“(O.I.Z 2020: 90%)
Noch im November 2017 hielten knapp drei Viertel der deutschen Bevölkerung (73%) die Gesundheit für einen besonders hohen Wert. Doch auf dem Höhepunkt der Corona-Krise im Frühjahr 2020 schnellte der Wert plötzlich nach oben. Mit 94 Prozent Zustimmung wurde jetzt die Gesundheit als das höchste Gut im Leben eingeschätzt. Eine Werteexplosion! Weder Wachstum und Wohlstand noch Geld und Güter oder Medien und Konsum erreichen diesen Spitzenwert. Das Votum der Bevölkerung ist klar und eindeutig: Ohne Gesundheit geht gar nichts.
Glück im Leben fängt mit der Gesundheit an. Das gesundheitliche Befinden der Menschen ist entscheidend für ihre Lebenszufriedenheit und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Der Gesundheitszustand der Bevölkerung lässt auch Rückschlüsse auf die Wirtschaftskraft des Landes zu. 90 Prozent der deutschen Bevölkerung achten seit der Krise im Berufs- und Privatleben darauf, „gesund und fit zu bleiben“. Das eint die Deutschen – quer durch alle Sozial- und Altersgruppen, die Singles (91%) wie die Familien (91%) und die Ruheständler (90%).
Corona hat die Einstellung der Menschen grundlegend und nachhaltig verändert. Die Gesundheitsorientierung des Lebens löst die bisher dominante Konsumhaltung ab. Gesünder leben können – das wird das wichtigste Lebensziel und „die“ Herausforderung für die Gesellschaft und die Zukunftsmedizin. Hilft hier die Digitalisierung der Gesundheit weiter? Stellt sich die Frage ‚Was ist ein gesunder Mensch‘ neu? Wird die digitale Medizin das Gesundheitsverständnis neu erfinden und bewerten? Silicon Valley hat längst die Medizin entdeckt. Amazon-Gründer [20] Jeff Bezos verbreitet die Vision: Stell dir eine Zukunft vor, in der du alterst – aber ohne die Krankheiten deiner Eltern. Eine Zukunft, in der Krankheit und Altern vermeintlich nicht schmerzen (vgl. Schulz 2018).
Gesundheit wird zum neuen Statussymbol und verdrängt die dominante Konsumhaltung im Leben. Infolgedessen wird der Systemcharakter des Gesundheitswesens immer bedeutsamer. Das Gesundheitsministerium wird so wichtig wie das Wirtschaftsministerium, die Charité so wichtig wie VW. Die Entdeckung des Megamarkts Gesundheit hat gerade erst begonnen. Pfleger und Ärzte werden als Helden des Alltags gefeiert. Sie können in Zukunft die neuen Heiligen in Deutschland sein, weil die Gesundheit beinahe Religionscharakter bekommt? Und immer öfter wird die Frage gestellt: Was sind wirklich wertvolle Berufe?
Nach wie vor sind Lebensgewohnheiten – und nicht Medizin und Medikamente – die wichtigsten Bestimmungsfaktoren für Gesundheit. Die Gesundheit lässt sich etwa zur Hälfte durch Veränderungen von Lebensstil und Lebensgewohnheiten beeinflussen. Hinzu kommen Umwelteinflüsse, humanbiologische Faktoren, Gesundheitssystem und die medizinische Versorgung (vgl. Hauser 1983). Das Wohlfühlen in der eigenen Haut wird zur lebenslangen Aufgabe. Andernfalls bewahrheitet sich ein Wort des französischen Philosophen Voltaire: „In der ersten Hälfte unseres Lebens opfern wir die Gesundheit, um Geld zu erwerben; in der zweiten Hälfte opfern wir unser Geld, um die Gesundheit wiederzuerlangen.“ Die Gesundheitsversorgung wird so wichtig wie die finanzielle Sicherheit. „Gut leben“ heißt aber auch, sich eine gute medizinische Versorgung leisten können. Die Corona-Krise hat nach Meinung der Bevölkerung (89%) gezeigt, wie „wichtig und systemrelevant eine gute medizinische Versorgung und eine forschungsstarke Pharmaindustrie im eigenen Land sind“. Subjektiv gesehen wird die Charité so wichtig wie VW.
Der schier unaufhaltsame Aufstieg der Gesundheitsorientierung des Lebens verändert unsere Lebensprioritäten. Die Frage ist berechtigt: Steht uns fast eine „religiöse Karriere der Gesundheit“ (Lütz 2012) bevor? Werden wir bald gesundheitsfromm die Halbgötter in Weiß, die Heil und Heilung versprechen, geradezu anbeten? Wird Gesundheit zum Synonym für Glückseligkeit und gutes Leben? Die Achtung, ja die [21] Hochachtung vor der eigenen Gesundheit wird immer bedeutsamer. Gesundheit bedeutet dabei aber mehr als körperliche Fitness: Es geht im wahrsten Sinn des Wortes um das Wohlfühlen in der eigenen Haut.
2. Die Zuversicht wächst – trotz Krise. Vor allem Familien mit Kindern blicken optimistisch in die Zukunft
Es war einmal ein deutsches Sommermärchen – zur Zeit der Fußball-WM im Jahr 2006. Die positive Stimmung während der Spiele hatte unser Land verzaubert. Die Nationalmannschaft wurde als „Weltmeister der Herzen“ auf der Berliner Fan-Meile von einer halben Million Fans gefeiert. Und auch international fanden Deutschland und seine Menschen hohe Anerkennung für die Leichtigkeit, Fröhlichkeit und Freundlichkeit, die das Land weltweit für über dreißig Milliarden TV-Zuschauer ausstrahlte. „War“ das einmal? Hat sich Deutschland seither grundlegend verändert? Weicht mittlerweile die Leichtigkeit der Spiele einer bleiernen Pandemie-Angst mit resignativen Zügen? Wartet ein Leben in Moll auf uns? Oder sind die Deutschen für Zukunftsängste empfänglicher als andere? Derzeit spricht alles dafür, dass die Deutschen eher die Lebenskunst beherrschen, auch und gerade inmitten schwieriger Zeiten die eigene Lebenszufriedenheit zu bewahren und gleichzeitig die Hoffnung auf bessere Zeiten nicht zu verlieren. Gut leben im Krisenmodus: Das beschreibt eher eine neue Form deutscher Gelassenheit (und nicht eine neue deutsche Ängstlichkeit). Die Deutschen wollen einfach ihr Leben leben.
Muss man deshalb als Optimist oder als Däne geboren sein? Nach dem „World Happiness Report“ der Vereinten Nationen sind die Dänen unter 160 untersuchten Staaten die glücklichsten Menschen der Welt. Als wichtigsten Grund führt das von den UN beauftragte Earth Institute der New Yorker Columbus Universität neben der hohen Lebenserwartung die geistige Gesundheit bzw. mentale Fitness auf der Basis einer positiv-optimistischen Selbstwahrnehmung an. Die Dänen gelten als besonders bescheiden, weil sie sich auch über die kleinen Dinge des Lebens freuen können. Fragt man einen Dänen: „Bist du ein Optimist?“ Dann antwortet [22] er: „Ich hoffe es.“ Mit der Hoffnung wächst die Lebensbejahung als Voraussetzung für ein glückliches Leben.
Für das positive Denken haben die Dänen kein Monopol. Zuversichtlich in die eigene Zukunft schauen gehört seit jeher zum Menschen wie der aufrechte Gang. Ohne positives Denken, ohne Hoffnungen und Träume kann der Mensch – das einzige Wesen, das die Unausweichlichkeit seines Verfalls und Todes kennt – nicht leben, ohne von dem Gedanken daran erdrückt zu werden. Mit der Entwicklungsgeschichte der Menschheit ist von Anfang an das Wunschdenken, der Glaube an ein besseres Leben, auch und gerade in krisenhaften Zeiten verbunden. Wenn das Leben in Gefahr ist oder die Lebensqualität spürbar schlechter wird, setzt der menschliche Wille zum Leben ein: Der Kampf ums Überleben, der Abschluss einer Lebensversicherung, die Teilnahme am Glücksspiel, die Begeisterung für eine neue Idee oder Religion, die Hoffnung auf persönliches Wohlergehen, Gesundheit, die Zuversicht, das gute Gefühl und der positive Glaube daran, dass es besser wird.
Die Repräsentativerhebungen von O.I.Z „vor“, „während“ und „nach“ der Corona-Krise weisen nach: Wir leben nicht in einem Land, in dem „Angst und Pessimismus“ (Wolfrum 2020, S. 233) vorherrschen und die Zukunft ziemlich düster und finster erscheint. Und auch die Aussagen einer Reihe von Angstpsychologen „In Krisenzeiten neigen wir dazu, pessimistisch zu denken“ (Endres u. a. 2020, S. 44) treffen in der Corona-Krise nicht zu. Ganz im Gegenteil: In der persönlichen Einschätzung der Bevölkerung ist 2020 repräsentativ nachweisbar: In Zeiten von Corona neigten und neigen die Deutschen dazu, optimistisch zu sein. Diese Zuversicht schützte, motivierte und machte Mut, obwohl Psychologie, Biologie und Pathologie der Angst negatives Denken apokalyptischen Ausmaßes geradezu nahelegten und prognostizierten. Für die Deutschen ist die Zuversicht nicht am Ende und geht das Vertrauen in die Zukunft nicht verloren. Eher gilt: Am Horizont ist Licht in Sicht!
Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung verhält sich weitgehend krisenresistent und gibt ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht auf. „Trotz weltweiter Umwelt-, Wirtschafts- und Gesellschaftskrisen blicke ich optimistisch in die Zukunft“ sagt die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung: Tendenz während der Krise sogar steigend [23] (Januar 2020: 79% – März 2020: 84% – Juli: 84%). Die Zuversicht wächst – trotz Krise. Bei den Bundesbürgern überwiegt nach eigener Einschätzung die positive Einstellung zum Leben. Krisen machen stark und zuversichtlich.
„Bei mir überwiegt die positive Einstellung zum Leben.
Trotz weltweiter Umwelt-, Wirtschafts- und Gesellschaftskrisen blicke ich optimistisch in die Zukunft.“
(O.I.Z Januar 2020: 79% – März 2020: 84% – Juli 2020: 84%)
Besonders glücklich kann sich schätzen, wer sich in solchen Krisenzeiten auf eine Familie stützen und verlassen kann. Es gibt keine andere Bevölkerungsgruppe in Deutschland, die so optimistisch in die Zukunft blickt wie die Familien mit Kindern (88%). Ihr Zukunftsoptimismus scheint kaum mehr steigerbar zu sein. Auch die mittlere Generation der 35- bis 54-Jährigen, die in der Rushhour ihres familiären und beruflichen Lebens steht, beweist Verantwortung für die nachwachsende junge Generation und hält ebenfalls weiterhin an ihrer positiven Zukunftsperspektive (84%) fest.
Die repräsentativen Umfrageergebnisse von O.I.Z weisen nach: Mitte Januar 2020 – VOR dem ersten Corona-Fall am 27. Januar in Deutschland – waren über drei Viertel der Bundesbürger positiv gestimmt. Verständlich auf den ersten Blick: China war schließlich „weit weg“ – und Deutschland (noch) nicht betroffen. Zwei Monate später – mitten in der Corona-Krise – wurde die Umfrage im Zeitraum vom 9. bis 19. März wiederholt. Die Überraschung: Statt Zweifel, Resignation oder Pessimismus herrschte wachsende Zuversicht vor. Die positive Einstellung zum Leben und zur Zukunft nahm weiter zu: Von 79 auf 84 Prozent und bei den jungen Familien mit Kindern sogar von 89 auf 95 Prozent. Im gleichen Zeitraum sank der Zufriedenheitsgrad der Singles geradezu erdrutschartig von 78 auf 68 Prozent. In Not- und Krisenzeiten ziehen sich die Menschen seit jeher in ihre „Burg“ zurück, an den „Ankerplatz“ und in den „sicheren Hafen“ der Familie.
[24] Die Frage stellt sich schon in dauerhaften Krisenzeiten: Was macht ein Mensch ohne Familie – ob alt oder jung? Das Single-Dasein hat immer zwei Gesichter. Die einen leben allein, weil sie es wollen, die anderen, weil sie es müssen – auch ein Grund, warum Einsamkeit in Zukunft ein Regierungsthema werden kann. Großbritannien hat bereits ein eigenes Einsamkeitsministerium eingerichtet.
Für die überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung aber gilt: Ein Großteil der Bevölkerung will sich trotz Krise seine Freude am Leben nicht nehmen lassen (jeweils 84 Prozent im März und Juli 2020). Er setzt darauf, dass in naher Zukunft alles wieder gut wird. Die „German Angst“ ist von gestern. Und das positive Lebensgefühl siegt über eine vermeintlich „deutsche Depression“. Die Politik setzt noch zu wenig auf diese Positiv-Potentiale der Bürger, insbesondere der Jugend. Die Krise kann doch zur Chance werden, wenn die Politik mehr darauf vertraut, dass die Bürger in der Lage sind, ihr Leben selbst zu meistern und an der Schaffung einer besseren Gesellschaft aktiv mitzuwirken. Mit dem positiven Denken ist immer auch ein Gefühl der Hoffnung verbunden, das Problemlösungen erleichtert.
In ein Bild gebracht: Im biblisch-lutherischen Sinne noch am Vorabend des Weltuntergangs einen Baum pflanzen ist bildhafter Ausdruck eines positiven Impulses im Menschen. Selbst hochaltrige Menschen haben Zukunftserwartungen, die sie als erwünscht, vorteilhaft oder genussvoll empfinden. Solange sie sich eine gute Zukunft ausmalen können, solange ist ihr Lebenswille ungebrochen. Ein positives Lebensgefühl erweist sich also als die beste Lebensversicherung. Die ‚positive Brille’ ist die wirksamste Medizin zur Lebensverlängerung. Eine solche Einstellung zum Leben geht erfahrungsgemäß mit größerer Selbstsicherheit einher. Entsprechend gering ist die Anfälligkeit für Depressionen (Lehr 1982, S. 241ff.). Selbst mit schwierigen oder unangenehmen Situationen haben positiv Gestimmte weniger Probleme. Sie beherrschen Lebenstechniken, die eine aktive Auseinandersetzung mit Problemsituationen (z. B. Partnerverlust, Pensionierung, Ausbruch einer Krankheit) begünstigen.
Meist handelt es sich um Personen, die von Kindheit an ein positives Selbsterleben haben oder in einer solchen Atmosphäre aufgewachsen [25] sind. Elternhaus, Erziehung und Bildung beeinflussen die positive Einstellung zum Leben am stärksten. Sie sind die beste Vorbereitung auf das Alter. Vorbereitungsseminare können die lebenslange Prägung durch die eigene Biographie kaum mehr ausgleichen