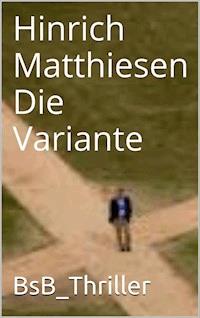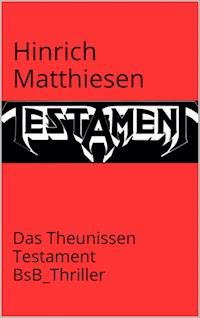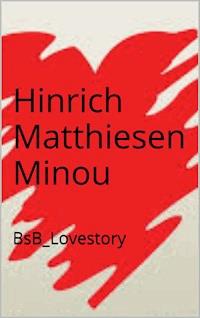Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Best Select Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Hinrich Matthiesen Werkausgabe Die Romane
- Sprache: Deutsch
Der Kampf um das Erbe ist erbarmungslos: Jeder ist des anderen Feind. Wer stirbt zuerst: der alte todkranke Vater oder dessen ebenso schwerkranker Sohn? Ein undurchsichtiges Testament löst zügellose Habgier und einen erbitterten Streit aus. Unter den nächsten Angehörigen, die das Erbe bereits unter sich aufteilen, wird der Tod der Kranken zum Spekulationstermin – bis sich die Situation zuspitzt, die Verwirrung vollkommen ist. Ein spannungsgeladener, brillant geschriebener Roman mit Gegenwartsbezug für eine Erbengeneration.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinrich Matthiesen
Jahrgang 1928, auf Sylt geboren, wuchs in Lübeck auf. Die Wehrmacht holte ihn von der Schulbank. Zurück aus der Kriegsgefangenschaft, studierte er und wurde Lehrer, viele Jahre davon an deutschen Auslandsschulen in Chile und Mexiko. Hier entdeckte er das Schreiben für sich.
1969 erschien sein erster Roman: MINOU. Dreißig Romane und einige Erzählungen folgten. Die Kritik bescheinigte seinem Werk die glückliche Mischung aus Engagement, Glaubwürdigkeit, Spannung und virtuosem Umgang mit der Sprache. Die Leser belohnten ihn mit hohen Auflagen.
Immer stehen im Mittelpunkt seiner Romane menschliche Schicksale, Menschen in außergewöhnlichen Situationen. Hinrich Matthiesen starb im Juli 2009 auf Sylt, wo er sich Mitte der 1970er Jahre als freier Schriftsteller niedergelassen hatte.
»Zum literarischen Markenzeichen wurde der Name Matthiesen nicht zuletzt durch die Kunst, in eine pralle Handlung Aussagen zu verweben, die außer dem aktuellen stets auch einen davon unabhängigen Bezug haben. Gedankliche Strenge, sprachliche Disziplin und ein offensichtlich unauslotbarer verbaler Fundus lassen Matthiesen zu einem Kompositeur in Prosa werden.«
Deutsche Tagespost
»Matthiesen ist zu beneiden um seine Fähigkeiten: Kompositionstalent, menschliche Einfühlung, scharfe Beobachtungsgabe – und vor allem um seinen Stil«
Deutsche Welle
»Matthiesen ist für seine genauen Recherchen bekannt. Seine Bücher weichen nicht einfach in exotische Abenteuer aus, sondern befassen sich immer wieder mit deutscher Vergangenheit und Gegenwart. Unterhaltsam sind sie allemal.«
FAZ-Magazin
Werkausgabe Romane Band 18
Herausgegeben von Svendine von Loessl
Der Roman
Der Kampf um das Erbe ist erbarmungslos: Jeder ist des anderen Feind. Wer stirbt zuerst: der alte todkranke Vater oder dessen ebenso schwerkranker Sohn?
Ein undurchsichtiges Testament löst zügellose Habgier und einen erbitterten Streit aus.
Unter den nächsten Angehörigen, die das Erbe bereits unter sich aufteilen, wird der Tod der Kranken zum Spekulationstermin – bis sich die Situation zuspitzt, die Verwirrung vollkommen ist.
Ein spannungsgeladener, brillant geschriebener Roman mit Gegenwartsbezug für eine Erbengeneration.
Titelverzeichnis der Werkausgabe in 31 Bänden am Ende des Buches
Hinrich Matthiesen
Das Córdoba-Testament
Roman
:::
BsB_BestSelectBook_Digital Publishers
Werkausgabe Romane
Herausgegeben von Svendine von Loessl
Band 18
1.
An diesem Maiabend war es ungewöhnlich still im Hause der Familie Urban.
In einem der oberen Zimmer lag, wie seit nunmehr anderthalb Jahren, der fast achtzigjährige kranke Friedrich Urban, General a.D., und wartete auf den Tod, der ihn schon mehrmals halb herübergeholt, dann aber doch wieder ins Leben zurückgestoßen hatte.
Im Zimmer nebenan arbeitete seine neunzehnjährige Enkelin Elisabeth für die Schule. Die übrigen Familienmitglieder, Elisabeths Eltern und ihr Vetter Manfred, hatten gleich nach dem Abendessen das Haus verlassen.
Elisabeth hatte die Acht-Uhr-Nachrichten gehört. Sie schaltete das Radio aus und kehrte an ihren Schreibtisch zurück. Es war gar nicht lange her, da hatte sie das Abitur noch in genügend weiter Ferne gesehen, und jetzt schien ihr der Tag der Prüfung erschreckend nah, ja, fast so nah, als könnte die Zeit nicht mehr ausreichen, die Lücken in ihrem Wissen zu füllen. Sie war immer eine gute Schülerin gewesen, hatte nie schlechte Zensuren nach Haus gebracht, nicht einmal in den naturwissenschaftlichen Fächern, die ihr mehr Schwierigkeiten bereiteten als die Fremdsprachen. So war sie nun selbst überrascht, mehr noch, sie war betroffen von dem Gefühl der Unzulänglichkeit, das sie plötzlich so stark empfand, aber sie tröstete sich schließlich mit einem Wort, das der Großvater ihr kürzlich gesagt hatte: Das Selbstbewusstsein sei eine gute Waffe im Leben, doch hin und wieder bedürfe es auch der Zweifel am eigenen Vermögen, sonst büße man viel Menschliches ein und damit auch die Fähigkeit zur Liebe.
Dieses Wort ging ihr im Kopf herum, und besonders berührte sie die Erwähnung der ›guten Waffe im Leben‹. Das klingt, dachte sie, ja fast so, als sei vor allem Feindschaft zwischen die Menschen gesetzt. Aber vielleicht, überlegte sie weiter, hat er sich auch nur deshalb so ausgedrückt, weil er sein ganzes Leben lang Soldat gewesen ist.
Sie kehrte zu ihrer Aufgabe zurück. Es handelte sich dabei um die Berechnung von Satelliten-Flugbahnen. Ihr fiel ein, dass sie zwischen den vielen Büchern ihres Vaters ein Werk über Ballistik gesehen hatte. Sie stand auf, wollte sich das Buch holen. Schon auf der Treppe befiel sie das Unbehagen, das sie jedes Mal empfand, wenn es um die Bücher ihres Vaters ging. Es waren an die zweitausend Exemplare, die er, zusammen mit dem Haus und den Möbeln, von seinem Vater übernommen hatte. Schon wenige Monate nach dem Besitzwechsel war eine derartige Unordnung in die Regale geraten, dass man nur selten ein Buch auf Anhieb fand. Immer wieder hatte sie es erlebt: Kant stand neben einer Anleitung zur Herstellung von Humus, zwischen den Kriegstagebüchern des Oberkommandos der Wehrmacht steckte Rowohlts ›Indiskrete Liste‹, und es konnte passieren, dass sich in engster Nachbarschaft der Bibel eine Playboy-Ausgabe flegelte.
Aber sie brauchte das Buch und ging also weiter die Treppe hinunter, betrat das Arbeitszimmer, schaltete das Deckenlicht ein und begann die Suche, nahm sich Bord für Bord vor, brauchte fast eine Viertelstunde, bis sie den schmalen Band gefunden hatte. Sie zog ihn heraus und war dabei durchaus darauf gefasst, gleichzeitig noch etwas ganz anderes zu entdecken, nämlich Geld. Ihr Vater hatte die Angewohnheit, hin und wieder, wenn er über eine etwas größere Summe verfügte, ein paar Scheine zwischen die Bücher zu stecken, irgendwohin. Auf ihre Frage, warum er das tue, hatte er geantwortet: »Es macht Spaß, nach Wochen oder Monaten die Scheine wiederzufinden.« Seit jenem Tag wusste sie, dass er nicht nur mitBüchern nachlässig umging.
Diesmal flatterte ihr zwar kein Hunderter entgegen, auch kein Fünfhunderter, wohl aber ein einzelner Briefbogen, der zwischen dem Lehrbuch und einer dickleibigen Canaris-Biografie gesteckt hatte. Sie entfaltete ihn, erkannte die Handschrift ihres Onkels Johannes und las über einem etwa zehn Zeilen langen Text das zweimal unterstrichene Wort ›Testament‹, legte daraufhin das Blatt in das entnommene Buch und ging damit hinauf in ihr Zimmer.
Sie setzte sich wieder an den Schreibtisch, aber statt nun die Gesetze der Ballistik zu studieren, las sie, was ihr Onkel Johannes vor gut fünf Jahren verfasst hatte:
›Ich, Johannes Urban, zur Zeit dieser Niederschrift im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, bestimme hiermit meinen Vater, den General a. D. Friedrich Urban, zu meinem Universalerben. Nach meinem Tode soll er alles erhalten, was ich an Geld, Immobilien und beweglichen Gütern besitze. Sollte er zum Zeitpunkt meines Ablebens schon gestorben sein, so geht mein gesamter Besitz zu gleichen Teilen an meine Geschwister Wolfgang Urban und Vera Kaminski, geb. Urban, die unter sich Akkreszenz genießen.
Córdoba, den 2. Februar1981‹
Darunter stand die Unterschrift des Onkels, und dann folgte ein mit Maschine geschriebener spanischer Text, den sie nicht verstand, dessen Inhalt sich ihr jedoch aus einer weiteren, allerdings unleserlichen Unterschrift und dem dazugehörigen Notariatsstempel erschloss.
Sie las das Testament ein zweites Mal, erinnerte sich daran, dass Onkel Johannes den Winter 1980/1981 in Südspanien verbracht und dort einen Herzinfarkt erlitten hatte. Ebenso erinnerte sie sich an sein langes, in einer Klinik von Córdoba überstandenes Krankenlager. Es erschien ihr also sinnvoll, dass er damals sein Testament gemacht hatte, zumal er vermögend und alleinstehend war.
In groben Zügen kannte sie den Werdegang ihres Onkels und überdies ein paar Geschichten, die zwar keinen leichtfertigen Umgang mit Büchern und Geld offenbarten, wohl aber einen solchen mit Frauen, wodurch er sich anfangs die Kritik der Familie eingehandelt hatte. Später dann, als sich unter seinen glücklichen Händen ein Vermögen angesammelt hatte, waren diese Stimmen verstummt.
Sie wusste, Onkel Johannes besaß ein Haus in der Nähe von Frankfurt und zwei Wohnungen in der FerienanlageMontemarinaauf Gran Canaria, außerdem Anteile an einigen bekannten deutschen Firmen und einen Bauernhof in Niederbayern, den er an einen Freund verpachtet hatte. Auch war ihr, was den Besitz ihres Onkels anging, hin und wieder eine in der Familie mit Respekt geraunte Zahl zu Ohren gekommen. Danach belief sich sein Vermögen, den Wert der Immobilien eingeschlossen, auf vier bis fünf Millionen Mark. Ihr Vater dagegen war hoch verschuldet, und Manfred, ihr Vetter, hatte nach dem Tode seiner Eltern nur eine Wohnungseinrichtung übernommen, mit der er als Student nichts anfangen konnte und die deshalb erst mal ausgelagert worden war. Dabei hatten, was sie ebenfalls wusste, die drei Kinder ihres Großvaters bei Erreichen der Volljährigkeit je fünfundzwanzigtausend Mark aus dem Besitz einer damals schon verstorbenen Großtante bekommen, sodass für alle der gleiche Start gegeben war. Ihrem Vater war dieses Geld, wie er selbst gern sagte, wie Flugsand davongeweht. Ihre Tante Vera, Manfreds Mutter, die zusammen mit ihrem Mann vor zwei Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, hatte ihren Anteil in die Ehe eingebracht und Hausrat angeschafft. Johannes indes, damals schon wegen seiner Mädchengeschichten von der Familie als Bruder Leichtfuß eingestuft, hatte sich eine Mietwohnung genommen und war mit seinem Geld an die Börse gegangen.
Längst hätte Elisabeth zu ihren ballistischen Bahnen zurückkehren müssen, aber eine bestimmte Vokabel im Testament des Onkels ließ ihr keine Ruhe. Das Wort ›Akkreszenz‹ hatte sie noch nie gehört. Vom Lateinunterricht her wusste sie, dass das Verb ›crescere‹ mit ›wachsen‹ zu übersetzen war und das Präfix ›a‹ mit ›dazu‹ oder ›hinzu‹, und dennoch kam sie nicht dahinter, was es mit diesem Begriff auf sich hatte.
Sie schlug ihr Lexikon auf, fand das Wort nicht, ging also noch einmal hinunter in das ›literarische Chaos‹, wie sie für sich die väterliche Bibliothek nannte, hatte diesmal, weil schon mehr als nur Unordnung dazugehört hätte, zwanzig Brockhaus-Bände auseinanderzutreiben, keine Mühe mit dem Suchen, schlug, um den Band gleich wieder wegstellen zu können, an Ort und Stelle nach, las, war irritiert, ging wieder nach oben und setzte sich, sehr nachdenklich geworden, auf ihr Bett.
Alle Flugbahnen von Satelliten waren weit weggerückt, denn was sie herausgefunden hatte, war in der Tat befremdlich. Johannes Urban hatte für den Fall seines Todes verfügt, dass seine Geschwister sich das Vermögen teilen sollten, sofern der alte Vater als Universalerbe entfalle. Wenn allerdings Bruder oder Schwester auch schon vorverstorben seien, gehe ihr Anteil nicht auf deren gesetzliche Erben über, sondern werde dem noch Lebenden der beiden Geschwister zugeschlagen.
Natürlich fiel ihr nun gleich ihr Vetter Manfred ein. Nach dem Tod seiner Eltern hatte der Großvater darauf bestanden, dass der Junge unter sein Dach ziehe. Aber so ohne Weiteres war dieser Wunsch nicht in die Tat umzusetzen gewesen, weil das Haus dem Großvater ja gar nicht mehr gehörte. Da er es seinem Sohn Wolfgang, ihrem Vater also, übertragen hatte, musste dieser sein Einverständnis zum Einzug des Neffen geben. Es hatte den Großvater schwer getroffen, dass die Aufnahme des verwaisten Neffen keine Selbstverständlichkeit gewesen war. Nur durch den schlichtenden Zuspruch Dr. Krämers, des langjährigen Hausarztes der Familie, war erreicht worden, dass Manfred im Haus der Urbans wohnen durfte.
O Gott, dachte Elisabeth, Onkel Johannes wird Großvater doch bestimmt überleben, und dann geht Manfred leer aus! Sein Anteil wird meinem Vater zufallen!
Sie faltete das Papier zusammen, brachte es, wie auch das Lehrbuch, das sie nun doch nicht mehr benutzen wollte, ins Arbeitszimmer, schob beides wieder ins Regal, stieg erneut die Treppe empor. Auf dem oberen Korridor lauschte sie an der Tür des Großvaters, hörte, dass er sich räusperte, klopfte und trat ein.
Er lag, von drei Kissen halb aufgerichtet, in seinem Bett, lächelte, als er sie sah.
»Hallo Großvater! Ich habʼ dich gehört und also wohl nicht geweckt.«
»Hast du nicht, Elisabeth. Und solltest du es doch mal tun, wärʼs nicht schlimm. Wer so dicht am großen Schlaf ist wie ich, freut sich, wenn jemand kommt, um ihn zu wecken.«
Sie setzte sich auf die Bettkante, griff nach der mageren, gelblichen Hand, drückte sie. Vor Jahren hatte sie bei einer Schlossbesichtigung vor einem Bild von Blücher gestanden, und seitdem fand sie, dass der Großvater ihm ähnlich sah. Jetzt allerdings, da der Altersverfall den einst so stattlichen Mann gezeichnet hatte, erinnerte höchstens noch das volle silberne Haar an den Helden von Belle-Alliance. Vielleicht aber war es auch von Anfang an nur eine gewisse Übereinstimmung der beiden Biografien gewesen, die ihr diese Ähnlichkeit vorgegaukelt hatte. Sie wusste nämlich seit frühester Kindheit, dass ihr Großvater zwar nicht als Feldmarschall einer schon verloren geglaubten Schlacht die Wende herbeigeführt, aber doch als Hauptmann und Kompaniechef im Zweiten Weltkrieg einen wichtigen Brückenkopf am Donez zurückerobert hatte. Er war dafür zum Major befördert und mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet worden.
»Du siehst so nachdenklich aus«, sagte der alte Mann. Er sprach langsam, und sie spürte, wie viel Mühe das Reden ihm bereitete.
Sie mochte ihm nicht sagen, dass sie gerade das Testament seines ältesten Sohnes gelesen hatte, und so antwortete sie:
»Mein Abitur steht vor der Tür.«
»Na, das schaffst du doch mit der linken Hand!«
»Kaum. Die rechte brauche ich auch dazu und natürlich den Kopf, und in dem schwirren zurzeit ein paar Flugbahnen herum, die ich berechnen soll.«
»Sind deine Eltern ausgegangen?«
»Ja.«
»Zusammen?«
Seine kurze, besorgt nachgeschickte Frage machte sie verlegen. »Weiß ich nicht«, antwortete sie und ließ die welke Hand los, stand auf, ging aber nicht, sondern blieb, ein wenig ratlos, neben dem Krankenbett stehen, sah auf eine gerahmte Fotografie, die an der Wand hing. Sie stammte aus glücklicheren Tagen. Das Bild war am fünfundsechzigsten Geburtstag des Großvaters aufgenommen worden. Es zeigte den Jubilar, seine drei Kinder Johannes, Wolfgang und Vera, den Schwiegersohn Herbert, die Schwiegertochter Irene und die beiden Enkelkinder.
Manfred war damals neun, sie selbst vier Jahre alt gewesen. Die Aufnahme war im Garten gemacht worden.
»Du siehst dir das Bild an?«
»Ja.«
»Es ist fünfzehn Jahre alt.«
»Bald ist wieder ein großes Fest. Vierzehn Tage noch, dann wirst du achtzig.«
Der Großvater konnte von seinem Bett aus das Foto nicht sehen, doch er sagte:
»Du trägst einen roten Rock und eine weiße Bluse und im Haar eine große Schleife, und Manfred hat – sehr gegen seinen Willen, wie ich mich erinnere – einen braunen Anzug an. Links blüht der Flieder und rechts die Clematis, und hinter uns stehen die dunkelgrünen Kiefern, die damals zwei Meter hoch waren. Heute sind sie mindestens doppelt so hoch, aber an vielen Stellen braun. Der Flieder ist eingegangen, und ›Clematis‹ ist für meinen Sohn ein lästiges Fremdwort.
»Ja, der Garten sieht schlimm aus.«
Friedrich Urban richtete sich noch ein Stück auf. »Vielleicht«, sagte er, »ist es nicht in Ordnung, mit einer Neunzehnjährigen über die Fehler ihrer Eltern zu sprechen, aber wenn überhaupt jemand das darf, dann bin ich es.«
»Tu es ruhig, Großvater! Wenn du dich über meinen Vater beklagst, dann beklage ich mich eben über deinen Sohn.« Sie lachte und fügte hinzu: »Das gleicht sich dann aus.«
Er nahm ihre Hand. »Ich finde eher, es addiert sich. Deine Eltern haben sich in den letzten Jahren sehr verändert. Vielleicht ist es das Älterwerden, das für manche schwerer ist als das Altwerden.«
»Ich hätte Vater so gern etwas gewissenhafter und Mutter etwas weniger hochmütig.«
»Das klingt sehr hart.«
»Ja, aber Vater hat, glaube ich, einen Berg Schulden, und Mutter kehrt immer die Frau mit der guten Adresse heraus, obwohl es doch eigentlich deine Adresse ist.«
»Es war mal meine; meine und die deiner Großmutter.«
»Du hättest ihm das Haus nicht überschreiben dürfen.«
»Das weiß ich längst, mein Kind. Ich bete zu meinem Herrgott, dass ich eher unter die Erde komme als das Haus unter den Hammer.«
Sie setzte sich wieder auf die Bettkante. »Vielleicht hättest du es lieber Onkel Johannes geben sollen.«
Der General wiegte den Kopf. »Ich wollte so gern in einer Familie leben und nicht neben einem eingefleischten Junggesellen. Außerdem wäre Johannes ja fast nie zu Haus gewesen. Ich sagʼs dir ehrlich: Ich wollte keine ruppige Zweimännerwirtschaft, sondern Geborgenheit. Die einzige, die mir davon etwas gibt, bist du. Dein Vater kommt nur in dieses Zimmer, wenn er Geld braucht.« Er fasste sich an die Brust, klopfte ein paarmal darauf, hüstelte.
»Wie ist eigentlich Onkel Johannes?«, fragte Elisabeth. »Ich habe ihn nur selten gesehen, weil er ja die meiste Zeit in Spanien verbringt.«
»Als junger Bursche war er ein Enfant terrible, und ich fürchte, er ist es noch heute.«
»Aber er hat es zu was gebracht.«
»Ja. Vielleicht, weil er nie geheiratet hat, denn wenn er damit erst mal angefangen hätte, wären heute sicher drei, vier Ehefrauen da und Gott weiß wie viele Kinder, die er versorgen müsste.«
Elisabeth stand wieder auf. »Eigentlich«, sagte sie, »sind wir eine ziemlich verhuschte Familie.«
»Ich weiß nicht, was ›verhuscht‹ bedeutet.«
»Ein bisschen verrückt, alles in allem.«
»Na, das geht ja noch. Viel schlimmer wäre eine zerstrittene Familie. Von denen gibt es ja auch genug. Streit entsteht meistens da, wo Geld ist, und in der Regel geht es um das Geld, das keiner der Beteiligten selbst verdient hat. Nur wo Leistung und Geld sich die Waage halten, geht es gut.«
»Auch nicht immer. Dann streiten sie um die Leistung, weil sie die unterschiedlich bewerten.«
Der Großvater schloss die Augen. »Ich bin müde«, sagte er, aber dann fügte er hinzu: »Gott sei Dank sind wir nur verhuscht und nicht zerstritten.«
Sie küsste ihm die Stirn. »Schlaf gut, Großvater!«, sagte sie. Er nickte.
Sie ging zur Tür. Doch bevor sie dann draußen war, kamen noch ein paar Worte vom Bett her, leise gesprochen:
»Gute Nacht, mein Kind! Wenn dein Vater später nach Hause kommt als deine Mutter, dann lies ihm die Leviten!«
Als sie wieder in ihrem Zimmer war, fragte sie sich, wie sie es denn wohl anstellen sollte, ihrem Vater die Leviten zu lesen. Sie dachte an die vielen nächtlichen Szenen, die sie, von den erregten Stimmen der Eltern aus dem Schlaf gerissen, mitgehört hatte. Erst kürzlich war sie Zeugin eines unerfreulichen Dialogs geworden. Sie erinnerte sich genau:
»Aber Irene, versteh doch! Den ganzen Abend kamen die Finalen Zwei, Fünf, Acht einfach zu oft, als dass ich diese Chance ungenutzt lassen konnte. Ich hatte schon siebzehntausend Mark vor mir liegen, und dann wollte ich, mit diesem Kapital in den Fingern, endlich raus aus der Misere, wollte um vier, wenn das Casino schließt, nach Hause fahren, an dein Bett treten und zu dir sagen: ›Liebling, es ist überstanden!‹«
»Ja, und stattdessen kommst du um drei und verkündest: ›Wir müssen morgen leider wieder eine kleine Hypothek aufnehmen.‹«
»Aber nur eine kleine. Dreißigtausend werden genügen.«
»Und der Herr General müssen mit seinem Versorgungskontrakt wieder mal ein Stück rutschen im Grundbuch, und bestimmt bin wieder ich es, die ihm das klarmachen muss. Du bist ein Versager, bist immer einer gewesen!«
»Ach? Und deine Pelze? Deine Kleider und dein Schmuck? Wer hat denn die Tausender dafür hingeblättert? Der Versager, der also wohl doch nicht von Anfang an einer war, sondern von seiner Frau dazu gemacht wurde!«.
Ja, solche und ähnliche Dialoge hatte sie oft mitangehört, und nun, eingedenk der Aufforderung, ihrem Vater die Leviten zu lesen, kam sie zu dem Schluss, dass wahrscheinlich auch der Großvater dann und wann Zeuge einer dieser nächtlichen Auseinandersetzungen geworden war.
Sie ging ins Bad, kämmte ihr langes blondes Haar, sah in ihr Gesicht. Die leichte Frühjahrsbräune schien verschwunden, weggewischt vom kalten Licht der Neonröhre. Sie sah traurig aus.
Ob ichʼs mal mit einem Lotterielos versuche?, dachte sie. Dann könnte ich vielleicht–natürlich nicht nachts um vier, sondern mittags, wenn ich aus der Schule komme und meine Post aufmache–vor ihn hintreten und zu ihm sagen: Vater, wir sind raus aus der Misere!
2.
Sie hörte die Haustür gehen, stand aber nicht auf, um nachzusehen, sondern stellte sich nur vor, was nun unten in der großen Diele wahrscheinlich ablaufen würde:
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!