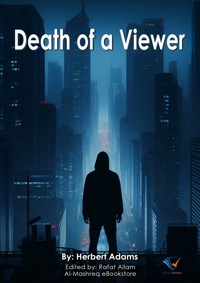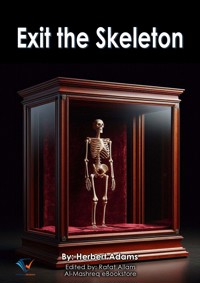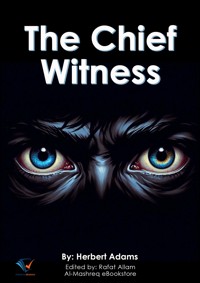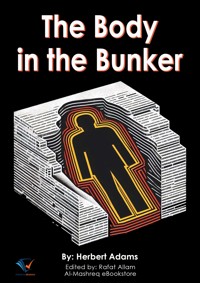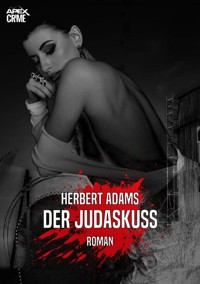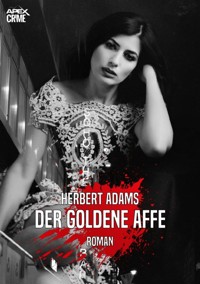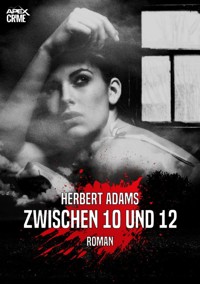6,99 €
Mehr erfahren.
Als Roger am Morgen erwachte, erkannte er zuerst weder seine Umgebung, noch konnte er sich daran erinnern, was ihm zugestoßen war. Sein Kopf schmerzte, was bei ihm sonst kaum vorkam, und er sah sich nach Ruth um. Dann berührte er mit der Hand den Verband am Kopf, und langsam kehrte die Erinnerung an die Ereignisse des vergangenen Tages zurück.
Es war fast acht Uhr. Er war überrascht, so lange geschlafen zu haben. Er wusste nicht, dass ihm Lady Mills mit seinem letzten Glas Tee ein Schlafpulver verabreicht hatte...
Herbert Adams (* 1874 in Dorset, South West England; † 1958) war ein englischer Schriftsteller. Adams veröffentlichte beinahe sechzig Kriminalromane; viele unter seinem eigenen Namen, einige unter dem Pseudonym Jonathan Gray. Seine Leser – wie auch die Literaturkritik – verglichen Adams oft mit seiner Kollegin Agatha Christie.
Der Roman Das Doppelleben der Miss Phoebe erschien erstmals im Jahr 1954; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1960.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
HERBERT ADAMS
Das Doppelleben
der Miss Phoebe
Roman
Apex Crime, Band 178
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DAS DOPPELLEBEN DER MISS PHOEBE
ERSTER TEIL
ZWEITER TEIL
DRITTER TEIL
Das Buch
Als Roger am Morgen erwachte, erkannte er zuerst weder seine Umgebung, noch konnte er sich daran erinnern, was ihm zugestoßen war. Sein Kopf schmerzte, was bei ihm sonst kaum vorkam, und er sah sich nach Ruth um. Dann berührte er mit der Hand den Verband am Kopf, und langsam kehrte die Erinnerung an die Ereignisse des vergangenen Tages zurück.
Es war fast acht Uhr. Er war überrascht, so lange geschlafen zu haben. Er wusste nicht, dass ihm Lady Mills mit seinem letzten Glas Tee ein Schlafpulver verabreicht hatte...
Herbert Adams (* 1874 in Dorset, South West England; † 1958) war ein englischer Schriftsteller. Adams veröffentlichte beinahe sechzig Kriminalromane; viele unter seinem eigenen Namen, einige unter dem Pseudonym Jonathan Gray. Seine Leser – wie auch die Literaturkritik – verglichen Adams oft mit seiner Kollegin Agatha Christie.
Der Roman Das Doppelleben der Miss Phoebe erschien erstmals im Jahr 1954; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1960.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
DAS DOPPELLEBEN DER MISS PHOEBE
ERSTER TEIL
Erstes Kapitel
»John! John! Wach auf! Ein Mann ist im Haus!«
Ein weicher, runder Arm glitt aus den Kissen heraus und zupfte an der Decke des Nachbarbettes. Ein schweres Atmen war die einzige Antwort.
»Wach auf, John! Wach auf! Ein Mann ist im Haus!«
»Was ist los?«
»Wach auf! Ich sage dir doch, es ist ein Mann im Haus! Soeben war er noch hier im Zimmer!«
»Du träumst ja. Schlaf nur weiter!«
Durch das Erwachen ihres Gatten ermutigt, drehte sich die junge Frau auf die Seite und knipste das Licht an.
»Ich habe ihn doch ganz deutlich gesehen! Wir werden noch beide im Bett umgebracht werden! Was willst du dagegen tun?«
Sie setzte sich auf und sah sich in dem elegant möblierten Zimmer um. Einen Augenblick später eilte sie über den dicken Teppich und öffnete die Fächer ihrer Frisiertoilette.
»Sie sind fort! Meine Perlen! Ich wusste es ja! Was machen wir nun?«
Ihre scharfen erregten Worte hatten den Mann jetzt völlig wachgerüttelt. Er starrte sie an; dann stieg er, wenn auch langsam, aus dem Bett.
»Meine Brieftasche ist auch fort«, murmelte er.
Jetzt ging er schon viel rascher zur Tür. Er drückte die Türklinke herunter und rüttelte, aber die Tür blieb verschlossen.
»Abgeschlossen - von außen! Wer, zum Teufel...?«
»Davon bin ich ja aufgewacht, dass sich jemand an der Tür zu schaffen machte!«
»Klingle doch Summers, - klingle so lange, bis er kommt.«
Sie eilte zu den Ehebetten zurück und zog an der langen seidenen Schnur, die zwischen ihnen hing. Im Hause schrillte eine Glocke, allerdings so weit entfernt, dass sie hier nicht zu hören war. Es war drei Uhr morgens, aber kein Diener sollte schlafen, wenn er so dringend gebraucht wurde.
»Was hast du denn gesehen?«
»Ich sagte es dir doch! Mir war, als ob sich im Zimmer etwas bewegte und dann machte sich dieser Mann an der Tür zu schaffen.«
»Warum hast du mich nicht früher geweckt?«
»Im ersten Augenblick war ich vor Angst wie gelähmt - er hätte mich ja anfallen können! Und nachher dachte ich, dass du nie wach werden würdest!«
»Wie sah er denn aus?«
»Es war zu dunkel, ich konnte nur eine verschwommene Silhouette erkennen. Ich glaube, er hatte das Gesicht verhüllt.«
»Du sagtest doch eben, dass du ihn ganz deutlich gesehen hast.«
»Treib doch keine Haarspaltereien! Ich sah, dass jemand da war; Einzelheiten konnte ich nicht erkennen.«
»Du hättest mich eben wecken sollen!«
»Du hast geschnarcht wie ein Murmeltier.«
Sie waren im Allgemeinen nicht streitsüchtig, aber in Momenten nervöser Spannung ist jeder Mensch reizbar. Sie drückte stärker auf die Klingel und lauschte, ob sie das Läuten hören konnte.
Dann sagte sie: »War das etwa dieser - dieser - Aal, von dem die Leute immerfort reden?«
Er gab keine Antwort. Er hatte sich zum Fenster gewandt, die Vorhänge zurückgezogen und die Fensterrahmen untersucht. Alles war ordentlich geschlossen. Dann warf er einen Blick über den Garten und den Golfplatz jenseits der Mauer. Es war dunkel, nur die schattenhaften Umrisse der Bäume waren zu erkennen.
Die Ehegatten waren recht verschieden. Er war groß und stark, etwa sechzig Jahre alt, und sein grau meliertes Haar wurde auf dem Scheitel schon dünn. Sie war schlank, hatte eine gute Figur und war halb so alt wie er oder noch jünger. Ihr dünnes Nachthemd, ärmellos, ganz aus Seide und Spitzen, enthüllte ihre Figur mehr, als es sie verbarg.
An der Tür ließ sich ein Klopfen hören.
»Haben Sie geläutet, Sir John?«
»Machen Sie die Tür auf! Wir sind eingeschlossen!« brüllte Sir John Mills. Leiser fügte er, zu seiner Frau gewendet, hinzu: »Zieh dir etwas an, Anthea.«
Sie griff nach einem Morgenrock und hatte ihn schon fast angezogen, als sich die Tür öffnete und der Diener schlaftrunken auf der Schwelle erschien.
»Wir sind beraubt worden, Summers«, sagte die Dame des Hauses. »Ich sah den Mann gerade noch, wie er das Zimmer verließ. Ist er etwa noch im Hause?«
»Ich glaube nicht, Mylady«, erwiderte Summers. »Ich bemerkte allerdings, als ich heraufkam, dass das Fenster auf dem Treppenabsatz offenstand.«
»Dort muss er hereingekommen sein«, unterbrach ihn Sir John. »Aber daraus geht nicht hervor, dass er schon wieder fort ist.«
»Das Läuten der Klingel...«, meinte Summers.
»Wir werden es sofort feststellen.« Sir John nahm vom Kamin einen starken Messingfeuerhaken und zog seine Pantoffeln an.
»Soll ich die Polizei anrufen?«, fragte der Diener.
»Wenn er schon wieder fort ist, hat das in der Nacht keinen Sinn mehr«, antwortete Sir John scharf. »Die Polizisten würden nur überall herumtrampeln und alle Spuren verwischen, die der Kerl vielleicht zurückgelassen hat. Rufen Sie sie an, sobald es hell geworden ist. Sagen Sie, dass es der Aal war. So eine Unverschämtheit - ausgerechnet zu mir zu kommen!«
Roger Bennion saß mit Ruth, seiner Frau, am Frühstückstisch. Von hier aus hatte man einen herrlichen Blick auf den Garten, in dem jetzt Krokusse und andere Frühlingsblumen blühten. Draußen im Freien schlief ihre kleine Tochter Penelope Anne friedlich in ihrem Kinderwagen. Für die Jahreszeit war es schon recht warm und sonnig. Ruth sah sich die Bilder in einer Zeitschrift an, während Roger seine Post las.
»Roger!«, sagte Ruth plötzlich. »Ich möchte, dass du dir Urlaub nimmst.«
»Sehr nett von dir, mein Kind. Ich glaube, ich kann das einrichten. Wohin wollen wir fahren?«
»Ich möchte, dass du allein fährst, damit du nach Herzenslust Golf spielen und angeln kannst. Schon lange hast du dir das nicht mehr gegönnt.«
»Hoho!«, rief er. »Was steckt dahinter? Wer ist die Natter im Grase, die mich aus meinem Heim verjagen will? Nenne mir den Namen, und ich werde das Pack zertreten! Ich weiß zwar nicht genau, was und wo ein Pack ist, aber ich glaube, edle Ritter pflegten es immer zu zertreten.«
»Sprich nicht so dumm, Liebling. Es ist ein Gedanke von Doktor Bennett. Er glaubt, Penny sollte Seeluft haben und er kennt einen wundervollen Ort an der Küste von Cornwall, wohin er sie gern schicken möchte. Es gibt dort nur ein paar Fischerhütten, aber es soll genau das sein, was sie braucht.«
»Was ist denn mit ihr nicht in Ordnung?«
»Eigentlich gar nichts. Aber er ist für Luftveränderung. Er glaubt, auch für mich sei Ruhe und eine Luftveränderung angebracht. Natürlich nehme ich das Kindermädchen mit.«
»Und ich werde fortgejagt, während meine Tochter in Unkenntnis der Tatsache, dass sie einen Vater hat, heranwachsen soll?«
»Nein. Wir werden ihr schon sagen, dass sie einen Vater hat - sogar einen wundervollen Vater -, und wenn sie einen ganzen Monat lang artig ist, soll sie ihn auch wiedersehen.«
»Willst du denn das wirklich, Ruth?«
»Ich - ich glaube ja. Doktor Bennett legt großen Wert darauf...«
Roger zog einen seiner Briefe hervor.
»Merkwürdigerweise habe ich gerade eine Einladung bekommen, in Northumberland Golf zu spielen.«, sagte er.
»Northumberland!«, sagte sie. »Das ist aber sehr weit weg von Cornwall!«
»Etwa so weit, wie das im kleinen England überhaupt möglich ist. Mit dem Düsenflugzeug vielleicht eine Stunde.«
»Roger, du sollst in so einem Ding nicht fliegen! Mir macht diese schreckliche Geschwindigkeit Angst. Es gibt auch in Cornwall oder Devon eine Anzahl guter Golfplätze. Du könntest dorthin fahren und uns alle paar Tage besuchen.«
»Ein guter Gedanke! Aber...«, Roger Bennion zögerte ein wenig«-es ist eigentlich keine gewöhnliche Einladung. Erinnerst du dich noch an Jimmy Davies von der Universal-Versicherungsgesellschaft?«
»Ja.«
»Er schreibt mir, dass in einem Ort namens Brimpton - in der Nähe von Newcastle - kürzlich in verschiedenen Häusern Schmuck geraubt wurde, ohne dass die örtliche Polizei die Diebe fassen konnte. Zu den Bestohlenen gehört auch Sir John Mills, Direktor der Universal-Versicherungsgesellschaft für den Nordbezirk.
Sir John betrachtet den Diebstahl bei ihm als persönliche Beleidigung und möchte, dass ich hinfahre, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ich habe ihn einmal kennengelernt - ein sehr sympathischer Mensch. Er schlägt vor, ich soll bei ihm wohnen - sein Haus grenzt an den Golfplatz -, dann könnte ich beim Golfspielen vielleicht etwas in Erfahrung bringen.«
»Hat er denn die Klubmitglieder wegen der Einbrüche im Verdacht?«, fragte Ruth.
»Nicht unbedingt. Es soll schließlich auch ehrliche Golfspieler geben. Aber die meisten der beraubten Häuser grenzen an den Golfplatz, und man nimmt an, dass eine örtliche Bande die Einbrüche begangen hat. Mein Golfspiel würde gewissermaßen der Vorwand sein, der meinen Besuch dort rechtfertigt.«
»Aber warum wenden sie sich an dich und nicht an Scotland Yard?«
»Scotland Yard arbeitet im Allgemeinen, außer in Mordfällen, nicht außerhalb Londons, und auch bei Morden nur, wenn der Yard von der Ortspolizei um seine Hilfe ersucht wird.«
»Bist du sicher, dass das nicht wieder ein Mordfall ist?«, fragte seine Frau rasch. »Davon hast du doch wirklich genug gehabt!«
»Hier geht es nur um Brillanten und Perlen, Liebling«, sagte er. »Ich habe Jimmy Davies schon einmal geholfen, und er sagt, seine Gesellschaft vergütet mir alle Spesen und gibt mir, je nach Erfolg, ein angemessenes Honorar.«
»Aber liegt denn das auf deiner Linie? Kannst du das machen?«
»Das bezweifle ich selbst. Ich hätte kaum einen Gedanken daran verschwendet, wenn du mich nicht hättest loswerden wollen. Ich habe übrigens gehört, dass der Golfplatz von Brimpton recht gut sein soll.«
»Du sollst nicht sagen, dass ich dich loswerden will, Liebling. Auch nur für einen Tag nicht. Musst du sofort antworten?«
»Die Versicherung betrachtet die Sache als dringend.«
Zweites Kapitel
Es war Mittag, als Roger Bennion in Brimpton in der Villa Overlinks, dem Hause von Sir John Mills, anlangte. Die Nacht hatte er unterwegs in York verbracht. Bevor er London verließ, hatte er noch zwei Besuche gemacht. Sein erster Besuch galt Dr. Bennett. Er kannte den Arzt schon viele Jahre und hatte volles Vertrauen zu ihm.
»Ich machte den Vorschlag mehr um Ruths willen«, hatte Dr. Bennett seine Frage beantwortet. »Sie hat sich zu viel zugemutet. Sie ist sehr beliebt, und den ganzen Tag kommen Freunde, die sie besuchen oder anrufen. Das Baby ist gegenwärtig für sie eine völlig ausreichende Beschäftigung. An dem Ort, den ich ihr empfohlen habe - er liegt in einer geschützten Bucht hinter Hellstone -, wird sie von allen gesellschaftlichen Verpflichtungen frei sein. Das Haus wird von einer meiner früheren Krankenschwestern geleitet, die Ihre Familie nebst Kindermädchen bemuttern wird. Wahrscheinlich werden sie bis zu Ostern dort überhaupt die einzigen Gäste sein.«
»Könnte die Krankenschwester nicht auch mich bemuttern?«, fragte Roger.
»Wenn Sie dort wären, würde sich Ruth fortwährend mit Ihnen beschäftigen müssen; dabei würde sie sich nicht erholen.«
Dazu war weiter nichts zu sagen gewesen, und Roger war zu dem Gebäude der Universal-Versicherungsgesellschaft gefahren, in dem Mr. James Davies seine verantwortungsvolle Tätigkeit ausübte.
»Wie lange gehen diese Einbrüche in Brimpton schon vor sich?« hatte Roger gefragt, nachdem sie sich die Hände geschüttelt und gegenseitig nach ihrem Wohlergehen erkundigt hatten.
»Vor einem Jahr erfolgten mehrere Einbrüche, aber es handelte sich dabei nur um Kleinigkeiten, und der Dieb wurde gefasst. Erst in der letzten Zeit kam es zu Diebstählen größeren Stils. In den letzten Wochen sind uns Verlustanzeigen in Höhe von über zwanzigtausend Pfund zugegangen. Die letzte Verlustanzeige bezog sich auf Schmuck, der Sir John Mills gestohlen wurde.«
»Außerdem gab es wohl noch andere Einbrüche, die nicht bei Ihrer Gesellschaft Versicherte betrafen?«
»Ein paar, aber wir sind die bei weitem größten Leidtragenden.«
»Und die Polizei hat keine Spur von den Einbrechern?«
»Offenbar nicht.«
»Warum glaubt man, dass diese Einbrüche von einer örtlichen Bande begangen wurden?«
»Aus mehreren Gründen«, hatte Mr. Davies geantwortet. »Zunächst einmal wurden in der Gegend keine Fremden beobachtet, obgleich man sehr sorgfältig nach ihnen Ausschau hielt.«
»Aber der Golfplatz wird doch wohl von fremden Gästen besucht? Dort soll es ja auch ein Gästehaus geben, nicht wahr?«
»Das ist richtig. Brimpton selbst ist nur ein Dorf. Aber wegen der schönen Lage wurden am Rande des Golfplatzes dort eine Anzahl eleganter Villen gebaut. Diese Villen, deren Besitzer der Polizei gut bekannt sind, waren es, die unter den Einbrüchen zu leiden hatten. Der Klub hat nur im Sommer zahlreiche Gäste, und jeder, der auch nur einen Tag dort spielen will, muss seinen Namen in das Gästebuch eintragen und dabei angeben, in welchem Klub er Mitglied ist.«
»Aber es würde für einen Mr. Smith ganz leicht sein, sich unter dem Namen James Montague einzutragen und zu behaupten, er sei im Golfklub von Sunningdale Mitglied. Das kann man ja im Augenblick gar nicht überprüfen.«
»Auch das ist richtig«, stimmte Mr. Davies zu, »aber die Polizei hat das nicht übersehen. Sie hat alle Besucher überprüft und festgestellt, dass die Angaben, die die Gäste gemacht hatten, in jedem einzelnen Falle zutrafen. Sie ist sogar so weit gegangen, jeden dieser Gäste in seiner Wohnung anzurufen, um sich zu vergewissern, dass sich nicht etwa jemand anders unter seinem Namen in die Gästebücher in Brimpton eingetragen hat. Nichts dergleichen war geschehen; die betreffenden Herrschaften waren alle hoch achtbar.«
»Brimpton liegt nahe bei Newcastle, Gateshead und andern Großstädten, deren Einwohner nicht alle hoch achtbar sein dürften.«
»Gewiss, aber in keinem Falle wurden in der Nähe der beraubten Häuser Autospuren oder Spuren von Fahrrädern gefunden, deren Ursprung nicht festgestellt werden konnte. Der Dieb ließ übrigens Silber stehen und nahm nur Juwelen und herumliegendes bares Geld mit.«
»Also nur etwas, das er in die Tasche stecken konnte?«
»So ist es.«
»Es könnte also auch ein Einzelgänger und nicht eine Bande sein?«
»Ja. Ich wollte Ihnen gerade erzählen, dass ein Mann - und zwar offenbar der gleiche Mann - bei zwei oder drei Gelegenheiten gesehen wurde, aber es gibt keine Beschreibung von ihm, nach der man ihn identifizieren könnte. Die Polizei nennt ihn den Aal.«
»Die Polizei bemüht sich also schon Wochen hindurch und hat ohne Ergebnis alles durchgeackert?«, bemerkte Roger. »Und dann erwarten Sie von mir, dass ich hingehe und den Aal im Handumdrehen fasse?«
»Das beweist Ihnen, welches Vertrauen wir in Sie setzen.« Mr. Davies lächelte. Er war eben nicht nur liebenswürdig, sondern auch sehr schlau. »Weitere Einzelheiten können Sie von Sir John und den andern Opfern erhalten. Auch die Polizei wird mit Ihnen in jeder Weise Zusammenarbeiten.«
»Von den gestohlenen Gegenständen ist noch nichts aufgetaucht?«
»Bis jetzt nicht.«
»Pelze wurden nicht gestohlen? Sie sind doch auch eine große Versuchung!«
»Nur Juwelen und bares Geld.«
»Führt der Dieb Waffen bei sich?«
»Darauf deutet nichts hin.«
»Na, wenigstens ein Trost. Hoffentlich ist der Golfplatz gut. Wie lange soll ich mich denn dort amüsieren?«
»Das steht ganz bei Ihnen«, antwortete Mr. Davies.
Roger hätte Ruth gern mit seinem Wagen in ihren Ferienort gebracht, aber sie wollte noch ein paar Tage in London bleiben. Da er wusste, dass er die Spuren nicht noch älter werden lassen durfte, als sie es schon ohnehin waren, fuhr er also in seinem neuen Jaguar nach Norden.
Während der Fahrt dachte er über das nach, was er von Jimmy Davies gehört hatte. Die Polizei schien bei ihren Nachforschungen sehr gründlich vorgegangen zu sein, sodass ein Fremder kaum etwas Neues würde finden können, wenn ihm nicht ein Zufall zu Hilfe kam.
Roger verließ York früh am Morgen, bewunderte unterwegs die Berglandschaft von Cheviot, entschloss sich aber, um Newcastle mit seinen verkehrsreichen Straßen herumzufahren, und kam gegen Mittag in das hübschen Dorf Brimpton. Brimpton lag weit genug von dem Kohlengebiet entfernt, um seinen ländlichen Reiz bewahren zu können.
Die Villa von Sir John Mills stand in einem etwa zwei Morgen großen Garten. Roger hielt vor dem breiten Eingangsportal an, dessen Tor einladend offenstand. Er stieg aus und entnahm seinem Wagen mit betonter Sorgfalt seine Golfschläger, die gewissermaßen den Zweck seines Besuches dokumentieren sollten. Fast sofort erschien auch sein Gastgeber auf der Bildfläche.
»Hallo, Bennion! Sehr erfreut, Sie zu sehen. Hoffentlich hatten Sie eine gute Fahrt. Ich möchte Sie meiner Frau vorstellen.«
Sir John Mills trug einen bequemen Tweed-Golfanzug, der seine Korpulenz noch unterstrich. Hinter ihm kam Anthea. Bei ihrem Anblick erhielt Roger seinen ersten Schock - wenn das der angebrachte Ausdruck dafür ist -, obwohl er sich nichts anmerken ließ.
»Kommen Sie herein!«, sagte sie. »Summers wird sich um Ihr Gepäck kümmern. Trinken wir erst einen Whisky - und dann werden wir sehen, wie es mit dem Mittagessen steht.«
Sie war eine der schönsten Frauen, die er je kennengelernt hatte, aber nicht etwa eine kühle und unpersönliche Schönheit. Es war an ihr etwas Bezauberndes - oder vielleicht auch Behexendes. Sie hatte dunkelgraue Augen, goldblondes Haar und einen wunderbaren Teint, aber am meisten fesselte Rogers Aufmerksamkeit der ausdrucksvolle Mund. Er zeigte das halb amüsierte, halb ironische und jedenfalls herausfordernde Lächeln der Mona Lisa. Dazu sprach sie mit einer leicht belegten, dunklen Stimme, der zu lauschen ein reines Vergnügen war. Roger hatte Sir John schon früher kennengelernt. Seine Frau hatte er sich als sein molliges Gegenstück vorgestellt. Anthea musste wohl, dachte er, seine zweite Frau sein. Aber war es wirklich klug von einem alternden Mann, sich eine so junge und derartig anziehende Gattin zu nehmen?
Einen weiteren Schock - obwohl dieses Wort auch hier wieder zu stark sein mag - empfing er bei Tisch.
»Das ist mein Sekretär Gilbert Fletcher«, stellte Sir John vor.
Er fordert das Schicksal geradezu heraus, dachte Roger. Der Sekretär stand etwa im gleichen Alter wie Lady Mills und konnte als ein schöner Mann bezeichnet werden. Es war allerdings die Schönheit der Wachsfigur in einem Schaufenster: blond, mit gelocktem Haar und einem sorgfältig gepflegten Schnurrbärtchen. Sein Anzug, sein Kragen und seine Krawatte sahen aus wie aus einem Modejournal. Es war schwer zu glauben, dass er sich, nur um seinem Arbeitgeber zu gefallen, der Mühe einer solchen Aufmachung unterzogen hatte.
Die Unterhaltung bei Tisch wandte sich bald dem Anlass von Rogers Besuch zu. Da Summers, der bediente, über das Geschehen im Bilde war, bestand keine Notwendigkeit, sich bei der Unterhaltung Zwang aufzuerlegen.
»Können Sie mir sagen, was geschah und woran Sie sich bei Ihrem unwillkommenen Besucher noch erinnern?«, fragte Roger Lady Mills.
Sie beschenkte ihn mit ihrem eigenartigen Lächeln. »Das ist bald getan. Etwas weckte mich aus dem Schlaf. Ich sah, wie sich ein dunkler Schatten von der Frisiertoilette zur Tür bewegte. Ich war zu verängstigt, um einen Laut von mir zu geben. Mein Mann schlief fest; also stellte ich mich, als ob auch ich schliefe, bis der Mann die Tür öffnete und hinter sich wieder schloss.«
»Es war kein Licht?«
»Nein. Schwaches Licht kam wohl durch die Fenstervorhänge, sonst hätte ich ja nicht einmal den Schatten sehen können.«
»Können Sie mir den Schatten beschreiben?«
»Kann man das?«, antwortete sie. »Ich sah nur seinen Rücken. Die Gestalt war mittelgroß, mit dünnen Beinen. Das war jedenfalls mein Eindruck. Mrs. Dilleigh, die ihn einige Nächte zuvor gesehen hatte, bestätigt das. Er verschloss die Tür, sodass wir warten mussten bis Summers uns herausließ. Und dann war es zu spät.
»Der verdammte Kerl hatte eine kurze Leiter im Garten gefunden,« fügte Sir John hinzu. »Er lehnte sie an die Mauer unter das Treppenfenster, schnitt eine der kleinen, bleigefassten Scheiben heraus, griff durch das Loch hindurch und riegelte das Fenster auf. So kam er herein und wieder hinaus.«
»Hatten Sie etwas gehört?« Roger richtete diese Frage an Gilbert Fletcher, der ihm gegenübersaß.
»Gilbert wohnt nicht im Hause«, sagte Lady Mills, bevor der Sekretär antworten konnte. »Er ist nur tagsüber hier oder in Newcastle, aber er schläft im Dorf.«
»Und ein Alibi für alle kritischen Zeiten haben Sie natürlich auch«, sagte Roger lächelnd zu dem Sekretär.
Wieder erhielt er keine Antwort. Der Sekretär sah nur die Dame des Hauses an. Ein Gedanke ging Roger durch den Kopf. Könnte der Raub etwa eine abgekartete Sache zwischen Gilbert und Anthea sein? Wobei Anthea ihm genügend Zeit zum Entkommen gegeben hatte, bevor sie ihren Mann weckte? Aber das war kaum wahrscheinlich. Warum sollte sie sich selbst berauben?
»Gilbert ist ein viel zu großes Unschuldslamm, um ein Alibi nötig zu haben«, sagte sie. »Er könnte höchstens im Winter ins Eis einbrechen nicht wahr, Gilbert?«
»Aber auch das nicht gern«, antwortete der junge Mann.
»Ihre Erfahrungen und die von Mrs. Dilleigh stützen jedenfalls die Annahme, dass alle Einbrüche das Werk eines einzelnen Mannes sind.«, bemerkte Roger.
»Dafür gibt es noch weitere Beweise«, sagte Sir John. »Am gleichen Tage, an dem ich Jimmy Davies schrieb, ereignete sich etwas Merkwürdiges. Einer unserer Polizisten war auf Nachtstreife, als ein Mann, der um eine Ecke bog, beinahe mit ihm zusammenstieß. Sanders, so heißt der Wachtmeister, wollte ihn gerade fragen, wer er sei und wohin er unterwegs sei, als ihm der Mann einen Stoß oder einen Fußtritt in den Bauch versetzte. Sanders ist ziemlich korpulent, und es verschlug ihm sofort die Sprache. Bevor er sich erholen konnte, war sein Angreifer schon wieder verschwunden. Nun blies Sanders zwar auf seiner Polizeipfeife, und es kam auch ein zweiter Wachtmeister herbei, aber es gibt dort viel Gebüsch, und die Suche war hoffnungslos.«
»Kann Sanders den Mann beschreiben?«, fragte Roger.
»Nicht viel besser als meine Frau oder Mrs. Dilleigh. Mittelgroß, dünne Beine und ein blasses Gesicht, das zum Teil durch einen Schlapphut verborgen war.«
»Also wahrscheinlich der gleiche Mann?«
»Gar kein Zweifel«, antwortete Sir John. »Zwei Tage später erhielt Sanders folgenden Brief von ihm: Ich hoffe, ich habe Ihnen weiter nichts getan. Beiliegend Schmerzensgeld. Der Brief enthielt drei Pfund. Er war unterzeichnet: Der Aal und in Klammern: Ich glaube, so nennt man mich.«
»Merkwürdig«, meinte Roger. »Ich höre zum ersten Mal, dass ein Einbrecher so etwas tut. Ist der Brief identifizierbar?«
»Er war in Druckbuchstaben auf ein Stück Packpapier geschrieben. Keine Fingerabdrücke. Ein billiger, überall erhältlicher Briefumschlag; hoffe war nur mit einem f geschrieben, und Schmerzensgeld mit tz, was darauf hindeutet, dass der Schreiber ein ungebildeter Mensch ist.«
»Oder sich ungebildet stellt. Aber es stützt die Theorie, dass der Dieb ein Dorfbewohner ist, denn sonst hätte er den Namen des Wachtmeisters nicht gekannt. Der Brief war doch an den Wachtmeister mit vollem Namen adressiert?«
»Ja. An die Polizeistation. Die größte Frechheit aber ist, dass die drei Pfundnoten, die er enthielt, mir gestohlen worden waren. Ich hatte mir eine ganze Menge Pfundnoten von der Bank geholt, und da die Noten aus einem neuen Paket stammten, konnten wir die Nummern feststellen.«
»Ihr Dieb scheint ein bisschen naiv zu sein. Ich werde mir tatsächlich die Dorfbewohner einmal unter diesem Gesichtspunkt ansehen müssen.«
»Dazu haben Sie heute Nachmittag die beste Gelegenheit«, sagte Anthea. »Wir wollen Sie zu einem Kirchenfest zugunsten unseres Kindererholungsfonds mitnehmen.«
»Sie haben doch nicht etwa die Mitglieder Ihres Kirchenvorstands im Verdacht?«, fragte Roger.
»Nicht, bevor wir gegen sie mehr Beweise bekommen«, lachte sie. »Aber John meinte, dort könnten Sie die andern Opfer kennenlernen.«
»Unser Fest fand früher zugunsten des Kinderkrankenhauses statt«, bemerkte Sir John. »Aber da die Regierung die Krankenhäuser verstaatlicht hat, haben wir einen Ferienfonds gegründet. Eigentlich weniger für die Dorfkinder als für die Stadtkinder aus Newcastle, die es nötiger haben.«
»Gilbert hilft bei der künstlerischen Gestaltung«, fügte seine Frau hinzu. »Er ist für uns eine geradezu unschätzbare Hilfe.« Sie sprach mit ihrem üblichen, schwer deutbaren Lächeln und Roger hielt jede Bemerkung zu ihren Worten für überflüssig.
Sie fuhren zu dem Fest in Sir Johns großem Wagen. Anthea wollte selbst fahren und forderte Roger auf, sich neben sie zu setzen, damit sie ihm unterwegs alles Interessante zeigen konnte. Da Sir John nicht gern chauffierte, nahm man ihren Vorschlag an. Er und der Sekretär setzten sich in den Fond des Wagens.
»Da heute ein so schöner Tag ist«, meinte Anthea, als sie den Motor anließ, »wird das Fest im Pfarrgarten abgehalten werden. In früheren Jahren fand es stets im großen Dorfsaal statt.«
»Was gibt es denn für besondere Attraktionen?«, fragte Roger.
»Für jeden Geschmack etwas. Volkstänze, Chorgesänge, ein Orchester und dann Buden, in denen Sachen verkauft werden, die kein Mensch braucht.«
»Und was tun Sie auf dem Fest?«
»Ich helfe bei den Erfrischungen.«
»Und Gilbert Fletcher?«
Sie sah ihn von der Seite an. »Gilbert hat sehr viel zu tun. Er leitet die Bude mit den Ringen. Sie wissen ja, man kauft drei Ringe für einen halben Schilling und wirft damit. Dann bekommt man das, worauf der Ring fällt. - Was halten Sie übrigens von ihm?«
»Ein schöner Mann«, sagte Roger.
»Ja. Ich beobachtete, wie Sie erst ihn und dann mich ansahen, aber Sie vermuten falsch! Ich will nicht behaupten, dass er nichts für mich übrig hat, aber ich bin mehr für Männer, die - wie soll ich sagen,« - sie warf ihm wieder ein rasches Lächeln zu -, »ein bisschen männlicher sind.«
Er antwortete nicht, und sie fuhr fort: »Auch eine Wahrsagerin ist da. Das ist vielleicht eher etwas für Sie.«
»Eine echte?«
»So echt wie alle andern.«
»Ich war einmal auf einem Dorffest, wo ein Mädchen aus dem Ort, das sich als alte Hexe verkleidet hatte, als Wahrsagerin auftrat. Da sie jeden Menschen kannte, konnte sie jedem erstaunlich viel erzählen.«
»Das muss ja großen Spaß gemacht haben. Ich möchte so etwas auch einmal versuchen.«
»Sie würden aber erkannt werden«, sagte Roger.
»Warum?«
»Sie brauchen nur in den Spiegel zu sehen, wenn Sie die Antwort wissen wollen. - Aber ich werde mir wirklich die Hexe ansehen«, meinte Roger und lenkte auf ein unverfänglicheres Thema über. »Vielleicht kann sie mir einen Wink geben. Es sieht aus, als ob ich so etwas brauchen könnte.«
»Ach, Sie sind schon wieder ganz Detektiv«, sagte sie mokant. »Vielleicht wollen Sie mich daran erinnern, dass ich meine Pflicht, Sie zu orientieren, ganz vergessen habe. Also: Das Haus, an dem wir soeben vorüberfuhren, ist die Villa der Dilleighs. Hier wurde der Aal zuerst gesehen. Das Haus, das nun kommt, ist Fairways und gehört dem Ehepaar Greenshields. Dort machte der Dieb die größte Beute. Das Ehepaar war allein im Haus und sah sich eine Fernsehsendung an, während er die Villa in aller Ruhe ausräumte. Er erbeutete dabei Schmuck im Werte von achttausend Pfund.«
»Da konnte er es sich leisten, drei Pfund einem harmlosen Polizisten zu schenken. - Was ist denn das dort?« Roger wies auf eine Ruine, etwas abseits vom Golfplatz, um den sie eben herumfuhren.
»Das ist Schloss Channon - oder das, was davon noch übrig ist. Der Familie Channon gehörte einmal das ganze Land hier herum, aber sie verspielten alles. Nur das Schloss blieb übrig, und das wurde so vernachlässigt, dass es in Trümmer fiel.«
»Dort wohnt jetzt niemand?«
»Doch, die alte Phoebe Channon - die Letzte der direkten Linie. Sie hat das Burgverlies zu einem ganz hübschen Häuschen mit vier Zimmern umgebaut. Sie ist ein armes Ding, so vom Rheuma geplagt, dass sie nicht mehr gehen kann. Eigenartigerweise traf die einzige Bombe, die während des Krieges hier in der Gegend fiel, ihre Ruine. Sie verlangte vom Staat, ihr als Entschädigung ein neues Schloss zu bauen. Die Leute vom Kriegsentschädigungsamt aber lachten sie aus und sagten ihr, dadurch, dass die Bombe die alten Mauern niedergelegt habe, sei ihre Ruine erst einsturzsicher geworden. Als Entschädigung für zwei Fenster, die bei der Explosion zerbrochen waren, schickten sie ihr ein Pfund. Trotz ihrer Armut schickte sie das Geld zurück und erklärte, dass das keine Regelung sei.«
»So etwas ist auch ein schwieriger Fall«, meinte Roger.
»Sie ist eine komische alte Jungfer und leicht verrückt. Eigentlich ist sie gar nicht die Letzte der Channons. Sie hat eine Nichte, die bei ihr lebt, Jacqueline Channon. Wenn allerdings Jacqueline heiratet, erlischt der Name. Sie könnten sich übrigens durchaus in Jacqueline verlieben.«
»Das habe ich, als ich heiratete, ein für alle Mal getan.«
»Wirklich?«, antwortete sie ironisch. »Jacqueline sieht bemerkenswert gut aus - sehr dunkles Haar, tiefblaue Augen, ein süßes Gesichtchen und ein reizendes Lächeln.«
»Mit all diesen Vorzügen kann es ihr ja an Bewunderern kaum fehlen.«
»So sollte man meinen. Aber die alte Phoebe lässt sie kaum aus den Augen. Sie werden die beiden vielleicht heute Nachmittag kenne lernen.
Drittes Kapitel
Das Fest wurde von Lady Pilgrim, der Witwe eines reichen Kohlemagnaten, eröffnet. Ihre Eröffnungsrede war erfreulich kurz, denn sie hatte die Regeln für solche Eröffnungsreden - aufstehen, ein Dutzend Worte sagen und Schluss machen - gelernt. Sie sprach nur von dem guten Zweck, dem die Überschüsse des Festes dienen sollten.
Nachdem sie geendet hatte, lösten sich ihre vielen Zuhörer in verschiedene Gruppen auf. Sir John Mills, der jetzt den Führer für Roger Bennion machte, brachte ihn zu einer Gruppe, wo Pastor Septimus Tucker, der Organisator des Festes, einige seiner Gemeindemitglieder begrüßte.
»Das ist Major Bennion, Tucker«, sagte Sir John. »Man hat ihn mir auf meine Bitte wegen dieser Einbrüche von London hergeschickt. Sie werden wohl schon von ihm gehört haben.«
»Das habe ich auch«, sagte der Geistliche und schüttelte ihm ausdauernd die Hand. »Pater Savrola, ein Freund von mir, den ich sehr bewundere, erzählte mir von Ihnen. Ich weiß, wie Sie ihn von jedem Verdacht reinigten und den wirklichen Verbrecher fassten. Ich hoffe, Sie werden auch hier Erfolg haben.«
»Das hoffe ich auch«, sagte Roger. Er war auf Sir John böse, weil dieser den Zweck seines Hierseins öffentlich ausposaunt hatte. Er hatte angenommen, er würde als Feriengast vorgestellt werden, der nach Brimpton gekommen war, um Golf zu spielen. Und jetzt war alle Welt darüber orientiert, dass dies keineswegs der Fall war. Denn natürlich hatte jeder der Herumstehenden Sir Johns Worte neugierig mitgehört; es war kein Zweifel, dass bald jeder Mensch im Dorf von seiner Mission wissen würde.
»Sie müssen einmal zu uns ins Pfarrhaus kommen und meine Frau kennenlernen, Major Bennion«, sagte Mr. Tucker.
Roger versicherte, er würde das mit Vergnügen tun, und Mr. Greenshields sagte: »Ich erinnere mich an den Fall. Die Zeitungen nannten ihn: Ein Gespenst in Braun. Hoffentlich werden Sie uns nicht sagen, dass sich ein Gespenst mit unserem Eigentum aus dem Staube machte.«
»Kaum«, lachte Roger.
Eine Dame in einem Rollstuhl, der von einem sehr gut aussehenden Mädchen geschoben wurde, näherte sich der Gruppe, aus der inzwischen einige Herren fortgegangen waren.
»Ah! Miss Phoebe!«, sagte der Pastor. »Wie schön, dass Sie kommen konnten. Hoffentlich fühlen Sie sich besser. Leider sehe ich Sie nicht oft bei mir in der Kirche.«
»Ich würde schon kommen, Herr Pastor, wenn ich Ihre Knie hätte.« Sie sprach kurz, aber ihr Lächeln war freundlich.
»Leider kann ich die Knie nicht mit Ihnen tauschen. Aber ich kann es so einrichten, dass Ihr Stuhl in das Seitenschiff gerollt wird, dann brauchen Sie ihn gar nicht zu verlassen.«
»Dann könnte ich aber auch nicht unbemerkt verschwinden, wenn Sie diese hässlichen Lieder singen -...«
»Hässliche Lieder?« wiederholte der Pastor, »Welche meinen Sie denn?«
»Letztes Mal, als ich in der Kirche war, sang der Chor ein Lied, in dem die Rede davon war, dass wir alle tot und im Himmel sein möchten. Nun, ich wünsche mir das nicht, und ich glaube, Sie sich auch nicht. Und die Kinder im Chor schon ganz bestimmt nicht. Warum machen Sie aus uns allen Heuchler?«
»Ich kann mich nicht an eine solche Hymne erinnern.«
»Oh, Paradies, oh, Paradies, wer will nicht in dir ruhen...«, zitierte das junge Mädchen und lächelte ihn an.
»Ach so, dieses Lied«, sagte der Pastor. »Nun, Miss Phoebe, Kirchenliedertexte sind von Menschen geschrieben, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein müder Mensch diese. Worte sehr aufrichtig gemeint hat. Das Lied hat überdies eine schöne Melodie, und darum liebt es der Chor. - Kann ich Ihnen nicht aus Ihrem Stuhl heraushelfen?«
»Das wird Jacqueline schon machen.«
Das Mädchen und der Pastor halfen gemeinsam der alten Dame, sodass sie, auf zwei Stöcke gestützt, gehen konnte. Ihr Rücken war zwar gebeugt, aber ihr Gesicht energisch und entschlossen.
»Ich möchte mir die Verkaufsstände ansehen«, sagte sie. »Ich habe ein paar Handarbeiten gestiftet. Hoffentlich lassen sie sich verkaufen.« Mit einem kurzen Nicken ging sie, gefolgt von ihrer Nichte, fort.
»Das ist Miss Phoebe Channon«, flüsterte der Pastor Roger zu. »Eine bemerkenswerte Frau! Leider lebt sie nicht gerade im Überfluss, aber wenn es sich um Kinder handelt, ist sie sehr freigiebig. Sie spielt zu gern die gute Fee, die ihre Gaben verteilt, so weit es ihre Mittel gestatten. Die Dorfleute empfinden für sie die größte Hochachtung. Aber mir fällt gerade ein - Sie sind ja zu uns gekommen, um uns von einem Plagegeist zu befreien. Es gibt aber noch eine andere unangenehme Plage bei uns, Major Bennion. Vielleicht können Sie uns auch bei ihrer Beseitigung behilflich sein?«
Die gut geschnittenen Züge des Pastors wurden ernst. Es war nicht daran zu zweifeln, dass er in seinem Beruf aufging und sich seiner Gemeinde widmete, ohne sich zu schonen.
»Wir leben hier unter einem Fluch, den man in Dörfern häufiger als in Städten antreffen kann«, fuhr er fort, »dem Fluch der Giftfeder. Wissen Sie, was ich damit meine?«
»Vielleicht bösartige anonyme Briefe?«
»Jawohl. So weit ich weiß, hat die Seuche erst kürzlich eingesetzt, und ich möchte sie ausmerzen, bevor sie schlimmer wird.«
»Glauben Sie, dass die Angelegenheit irgendwie mit den Raubzügen des Aals zusammenhängt?«, fragte Roger.
»Dieser Gedanke ist mir noch gar nicht gekommen.«
»Ich glaube kaum, dass eine solche Verbindung besteht«, meinte Sir John. »Ich habe eines dieser anonymen Schreiben gesehen und auch den Brief, den Wachtmeister Sanders erhielt. Beide sind in Druckbuchstaben geschrieben, aber Stil und Form der Buchstaben sind gänzlich verschieden.«
»Anonyme Briefe sind im Allgemeinen die Waffe einer Frau«, bemerkte Roger. »Einer vom Leben enttäuschten, gehemmten und eifersüchtigen Frau. Haben Sie die Polizei schon zurate gezogen?«
»Noch nicht«, erwiderte der Pastor. »Die Sache ist mir erst kürzlich zu Ohren gekommen. Ich habe einige Mitglieder des Kirchenvorstandes heute Abend zu mir gebeten. Wir müssen uns darüber schlüssig werden, wie wir vorgehen sollen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie auch kommen könnten.«
»Da ich hier vollkommen fremd bin, fürchte ich, Ihnen nicht viel nützen zu können«, entgegnete Roger. »Aber wenn Sir John es wünscht, werde ich natürlich kommen.«
»Aber gewiss ist mir das recht«, sagte der Lord.
Der Garten war selbst für ein altes Pfarrhaus ungewöhnlich groß. Es war kein Versuch gemacht worden, ihn prunkvoll herzurichten, dafür hatte Mr. Tucker weder Zeit noch Geld. Aber es gab viele schöne Bäume, blühende Sträucher und Schneeglöckchen, Primeln und Krokusse in großer Zahl. Auf der kleineren Wiese standen die verschiedenen Verkaufsbuden; die größere war für Tanz und Musik reserviert. Hier hatte Mr. Fenwicks Chor schon mit großem Erfolg einige alte Lieder vorgetragen. Die Sänger standen unterhalb der Terrasse, auf der Tee gereicht wurde, sodass die Gäste ihre Darbietungen in Ruhe genießen konnten.
Nachdem er sich von seinen Bekannten getrennt hatte, schlenderte Roger allein herum und sah sich an, was es sonst noch gab. Er war missgestimmt. Die Dinge gingen nicht so, wie er es gehofft hatte. Die Ankündigung von Sir John Mills, dass er hier sei, um die Diebstähle aufzuklären, war seiner Ansicht nach fehl am Platz. Man konnte, falls notwendig, die Betroffenen einweihen, aber es war sicherlich falsch, diese Tatsache in alle Welt hinaus zu posaunen. Und jetzt sollte er noch bei der Jagd nach einem anonymen Briefschreiber helfen! Eigenartig, dass in einer so kleinen und scheinbar so harmlosen Gemeinschaft zwei voneinander unabhängige, verbrecherische Machenschaften vor sich gehen sollten!
Ein junger Mann kam ihm entgegen, der eine riesige Puppe trug. An seiner Seite ging ein Mädchen, das Roger vorhin schon gesehen hatte. Als sie ihn erblickte, eilte sie auf ihn zu.
»Möchten Sie nicht ein Los für die Verlosung der Puppe kaufen?«, fragte sie mit einem reizenden Lächeln. »Es ist eine ganz wunderbare Puppe! Man kann ihr die Kleider an- und ausziehen, und sie kann sogar gehen. Lady Pilgrim hat sie für das Fest gestiftet.«
Ihr Begleiter stellte die Puppe auf die Füße, die wirklich ein paar Schritte vorwärtsmachte.
»Sie sind doch Jacqueline!«, sagte Roger lächelnd zu dem Mädchen.
»Ja, und Sie sind Major Bennion. Alle Leute sprechen ja von Ihnen. Das ist Don Garvey.«
Die beiden Männer verbeugten sich, und Don sagte, während er die Puppe hochnahm: »Möchten Sie nicht selbst versuchen, sie gehen zu lassen?«
»Nein. Ich glaube alles, was Sie mir sagen. Sind Verlosungen denn polizeilich erlaubt?«
»Es ist keine wirkliche Verlosung«, lachte das Mädchen. »Sie zahlen zwei Schilling in unseren Fonds, und wir geben Ihnen einen Teilnahmeschein für die Verlosung von Shirley oder wie Sie die Puppe sonst nennen wollen.«
»Großartig«, sagte er. »Ich habe ein kleines Mädchen, das erst ein paar Monate alt ist. Ist die Puppe nicht zu groß für sie?«
»Vielleicht, aber das gibt sich. Ihre Tochter wird ja wachsen.«
Jacqueline war wirklich ein schönes Mädchen, und Lady Mills hatte weder ihr gutes Aussehen noch ihren Charme übertrieben.
»Wie viele Lose kann man für ein Pfund bekommen?«
»Zehn«, antwortete sie. Sie bot ihm einen Abreißblock an, aus dem viele Nummern bereits verkauft worden waren.
»Wählen Sie die Nummern für mich. Sie haben wahrscheinlich mehr Glück als ich.«
Er gab Don die Pfundnote und Jacqueline riss zehn Teilnahmescheine aus ihrem Block und notierte seinen Namen auf den Abschnitten.
»Sie sind alle glückbringend«, sagte sie. »Aber leider kann nur eine Nummer gewinnen.«
»Eine genügt ja, wenn es die Richtige ist. Was haben Sie mit Ihrer Tante gemacht? Sie kamen doch mit ihr her?«
»Wir haben sie zwischen den Teetassen und den Klatschbasen abgesetzt«, antwortete Don. »Dort fühlt sie sich wohl, und Jackie ist für kurze Zeit frei.«
»Wie lange ist sie denn schon gehbehindert?«, fragte Roger.
»Sie war es vor drei Jahren schon, als ich zu ihr zog«, sagte das Mädchen.
»Kann ihr nicht eine gute Behandlung helfen?«
»Sie hat schon alle Einreibemittel versucht, die es überhaupt gibt.«
»Oder richtiger - Jackie hat sie an ihr ausprobiert!«, meinte Don.
»Nein, sie reibt sich selbst ein. Bei ihr sind es die Knie, wissen Sie, und sie sagt, das Einreiben hält Hände und Arme gelenkig. Aber sonst hat es ihr nicht viel genützt.«, verbesserte Jacqueline.
In diesem Augenblick trat ein junger Mann zu ihnen. Er hatte einen kleinen, aus Flecken zusammengesetzten Teppich über dem Arm.
»Ach Jackie, helfen Sie mir doch, dieses verrückte Ding zu verkaufen. Sie können so etwas viel besser als ich!« Er lächelte sie verschmitzt an.
»Das geht leider nicht. Ich bin mit Don und der Puppe beschäftigt. Fordern Sie doch Gloria Quain auf.«
»Sie muss bei Fenwicks Mundakrobaten im Chor singen. Kann Don nicht ohne Sie fertig werden?«
»Bestimmt nicht. Erzählen Sie allen Leuten, dass so ein Teppich in Paris die große Mode ist und dass es Stunden und Stunden kostete, ihn herzustellen.«
»Wenn mir das nur jemand glaubt«, murmelte er und eilte fort, da er ein mögliches Opfer sah.
»Wer war denn das?«, fragte Roger.
»Tommy Tucker, der Sohn des Pastors«, antwortete Jacqueline.
»Er wird sich schon weibliche Hilfskräfte verschaffen, so viel er braucht«, murmelte Don. »Frechheit, hierher wildern zu kommen!«
»Ich möchte Sie nicht aufhalten«, sagte Roger. »Es soll hier eine Wahrsagerin geben, aber ich habe sie nicht gefunden.«
»Sie ist dort im Zelt unter der Zeder«, antwortete Jackie.
»Und dort prophezeit sie?«, fragte er.
»Oh, nein. Das würde Mr. Tucker nicht gestatten. Sie hat ein Schild in ihrem Zelt: Wie steht es mit Ihrer Zukunft? Ich prophezeie nicht, aber ich kann Ihnen vielleicht helfen.«
»Haben Sie beide sie schon zurate gezogen?« lachte Roger. »Oder kennen Sie schon Ihre Zukunft?«
Er bemerkte, wie die beiden einen raschen Blick tauschten und das junge Mädchen errötete. Man brauchte kein Hellseher zu sein, um zu wissen, wie sie miteinander standen.
»Vielleicht gehen wir zu ihr, wenn wir unsere Lose verkauft lieben«, sagte sie. »Aber ich glaube wirklich nicht an so etwas.«
»Nun, jedenfalls viel Glück!«
»Auch Ihnen! Wir werden Sie das Resultat der Verlosung wissen lassen. Los, vorwärts, Don!«
Sie eilten fort, um sich nach einem andern Kunden umzusehen, und Roger schlenderte zu dem Zelt, das sie ihm gezeigt hatten. Offenbar war das Geschäft im Augenblick ruhig, denn La Mystique, wie sich die Seherin nannte, war allein. Er betrachtete einen Augenblick lang das Schild, von dem ihm das Mädchen erzählt hatte.