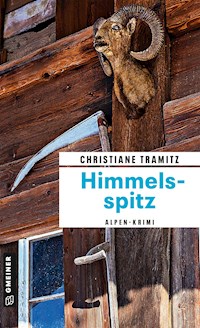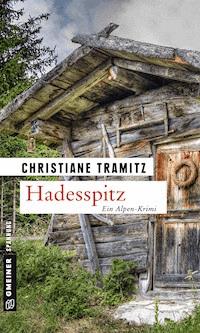13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine furchtbare Entscheidung, die hundert Jahre zurückliegt. Eine ausgelöschte Familie. Und ein Dorf, das bis heute schweigt.
1995, ein idyllisches Dorf in Oberbayern. Kurz vor Weihnachten geschieht dort ein bestialischer Mehrfachmord. Drei Menschen sterben, der Täter begeht Suizid, die Polizei kommt zu dem Schluss, dass „Hass“ das Mordmotiv gewesen ist, und stellt die Ermittlungen ein. Doch woher kommt dieser unbändige Hass?
Christiane Tramitz, selbst in diesem Ort aufgewachsen, macht sich auf die Suche und stößt auf furchtbare Ereignisse, die über hundert Jahre zurückliegen: Alles begann mit einer jungen Frau, einer unglücklichen Liebe und einer tragischen Entscheidung, die sich über zwei Generationen hinweg auswirkte und in die ebenso grauenhafte wie verzweifelte Tat mündete. Basierend auf dieser wahren Geschichte und ihren eigenen Recherchen hat die Bestsellerautorin einen True-Crime-Roman geschrieben, der den alten Fall neu aufrollt – abgründig, erschütternd und packend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Eine furchtbare Entscheidung, die hundert Jahre zurückliegt. Eine ausgelöschte Familie. Und ein Dorf, das bis heute schweigt.
1995, ein idyllisches Dorf in Oberbayern. Kurz vor Weihnachten geschieht dort ein bestialischer Mehrfachmord. Drei Menschen sterben, der Täter begeht Suizid, die Polizei kommt zu dem Schluss, dass »Hass« das Mordmotiv gewesen ist, und stellt die Ermittlungen ein. Doch woher kommt dieser unbändige Hass?
Christiane Tramitz, selbst in diesem Ort aufgewachsen, macht sich auf die Suche und stößt auf furchtbare Ereignisse, die über hundert Jahre zurückliegen: Alles begann mit einer jungen Frau, einer unglücklichen Liebe und einer tragischen Entscheidung, die sich über zwei Generationen hinweg auswirkte und in die ebenso grauenhafte wie verzweifelte Tat mündete. Basierend auf dieser wahren Geschichte und ihren eigenen Recherchen hat die Bestsellerautorin einen Tatsachenroman geschrieben, der den alten Fall neu aufrollt – abgründig, erschütternd und packend.
Die Autorin
Christiane Tramitz wuchs in Oberbayern in einem kleinen Dorf auf, zeitweise auch in den rauen Ötztaler Alpen. Zudem sammelte sie während ihrer Berliner Zeit ausreichend Großstadterfahrung. Ihre Leidenschaft gilt dem Reisen, den Menschen und, seit über 30 Jahren, dem Schreiben. Nachdem die promovierte Verhaltensforscherin zahlreiche Sachbücher über menschliches Verhalten verfasst hatte, wandte sie sich vermehrt dem Genre True Crime bzw. Tatsachenroman zu. Neben den Erfolgstiteln »Irren ist männlich« und »Unter Glatzen« verfasste sie auch den Spiegelbestseller »Harte Tage, gute Jahre«. Für ihre Veröffentlichung über Straßenkinder erhielt sie den Karl-Buchrucker-Förderpreis. Die Autorin hat zwei Kinder und lebt in Oberbayern.
CHRISTIANE TRAMITZ
DAS
DORF
UND DER
TOD
Kriminalroman
nach einer wahren Begebenheit
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Ludwig Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Heike Fischer
Umschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie, Zürich
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-25535-0V003
www.Ludwig-Verlag.de
TEIL EINS
VRONI
Simon Weber ist zurück im goldenen Dorf, viele Jahre sind seit dem Abschied vergangen. Der alte Mann steht in seiner alten Heimat mitten auf der Wiese des Dorfangers. Er trägt einen ihm zu großen schwarzen Anzug, in dessen Brusttasche drei Rosen stecken. Das Haar ist grau meliert und nach hinten gekämmt, der Körper schlank, die Haltung aufrecht. Simon Weber dreht sich langsam im Kreis. Früher, als er ein Bub war, durfte man nicht auf dieser Wiese sein. Sie war nämlich der Privatbesitz eines reichen Herren, der dort in einer großen Villa logierte, umgeben von einer hohen Mauer. Jetzt stehen hier weder Villa noch Mauern, nur noch zwei Bänke, auf der einen sitzt eine junge Mutter mit ihrem Säugling und stillt, auf der anderen wiegt ein junger Kerl mit Kopfhörern seinen Körper im Takt der Musik. Simon Weber schaut auf die Häuser, die ihn umgeben, dann blickt er hoch in den Himmel. Nur drei dicke Wolken sind dort zu sehen. Sie werfen einen Schatten über den Ort und lassen ein paar Tropfen fallen. Nicht der Rede wert.
Der Mann setzt seinen gewohnten Weg fort, er schlägt die gleiche Route ein, wie er sie damals, vor siebenundsiebzig Jahren genommen hatte, wenn er zusammen mit seinem Freund, den Leiterwagen hinter sich herziehend, den Kunden ihre Waren brachte. Vom Schwaigerbauern über den Sonnbichlerhof quer über den Kirchplatz hoch zum Feistlhof und weiter, dann einen großen Bogen schlagend, am Waldesrand über den Bach und auf der anderen Seite wieder dorfabwärts. Die Wege sind die gleichen geblieben, nur sind sie jetzt geteert, nicht mehr erdig, kiesig, matschig, löchrig, staubig, so wie sie einst je nach Witterung waren. Es gibt keine Pferdeäpfel mehr und keine Kuhfladen, es liegen keine Heuhalme herum, keine Blätter. Es fühlt sich anders an, wenn man auf diesen Wegen geht. Härter. Gewöhnlicher. Die Straßen und Wege schlängeln sich von unten nach oben, teilweise am Bach entlang, sie führen über kleine Brücken, vorbei an den alten Höfen. Vor jedem dieser Gebäude bleibt Simon Weber stehen und kramt in seinem Gedächtnis nach den verlorenen Bildern. Alles ist gleich und doch unnennbar anders. Die Höfe, die die Zeiten überlebt haben, sind schmuck wie damals, vor ihnen stehen noch die alten Hausbänke, Geranien hängen vor den Fenstern, wie immer, prachtvoller Wuchs in den Bauerngärten, in denen Bienen von einer Blüte zur anderen tanzen. Und doch fehlt das Leben, die Alten auf den Bänken, die spielenden Kinder, die pickenden Hühner und der vertraute Geruch. Die Misthaufen sind verschwunden, in den Ställen steht kein Vieh mehr. Neben manch einer Türe verweisen Schilder auf Fremdenzimmer. Simon scheint es, als habe der Ort kein Gesicht, keine Seele mehr, sondern trüge eine Maske, in makelloser Schönheit erstarrt.
Die drei schweren Wolken haben sich verzogen, den Regen mit sich getragen. Auf dem Boden versprenkelt kleine dunkle Tropfenflecken. Simon Weber fällt das Gehen schwer. Doch es treibt ihn weiter. Jene Menschen, denen er begegnet, sind ihm unbekannt, trotzdem grüßt er alle freundlich, so ist er es gewöhnt. Die meisten grüßen zurück, andere gehen stumm weiter. In jedem einzelnen Gesicht der älteren Menschen versucht Simon Vertrautes zu lesen. Es könnte der Schorsch sein, Franzerl oder jemand, dessen Namen Simon Weber vergessen hat, nicht aber, wie deren Aussehen in jungen Jahren war. Ein buckliges Weiblein, älter noch als er, schiebt einen Rollator vor sich her. Als sich ihre Blicke treffen, fragt Simon: »Kann es sein, dass wir uns von früher kennen?«
Sie zuckt mit den Achseln. »Zimmer 15, erster Stock.« Simon überlegt kurz, doch dann erklärt die Alte: »Kenn im Altersheim noch nicht alle, bin erst seit zwei Wochen da, weißt du, junger Mann?« Herr Weber lächelt. »Jung, na ja. Kommen Sie von hier?« Die Frau schüttelt den Kopf. »Regensburg. Und Sie?« – »Ich habe meine jungen Jahre hier verbracht.«
»Ach, die jungen Jahre«, die Alte erhebt sich, steht schwankend da. »Die sind so lange her, es waren schlimme Jahre dabei, der Krieg, Sie wissen«, sagt sie.
Simon Weber weiß es, das Vergangene ist ihm gegenwärtiger denn je. Deswegen ist er wieder hierhergekommen, ins goldene Dorf, die Vergangenheit lässt ihn nicht los, ihre Bilder erscheinen ihm in seinen Träumen. Schuldig oder nicht?, fragt die Vergangenheit.
Simon verabschiedet sich und zieht weiter. Als er an einer kantigen, neu erbauten Villa vorbeikommt, überlegt er, ob nicht hier einst der »König« Trachsler gelebt hat. Der Garten, in dem das Gebäude steht, hat mit dem einstigen nichts mehr gemein. Die große Buche hatte man gefällt, stattdessen zwei japanische Ahornbäumchen gepflanzt. Der Rasen ist kurz rasiert, hellgrün, ohne Blumen, ohne Getier. Der Zaun, früher aus morschem Holz und in sich zusammengefallen, wurde durch Bambusbüsche ersetzt. Ja, ja, gewiss, denkt Simon, im rechten hinteren Teil des Grundstücks stand damals das schwarze Haus des Alois Trachsler, der Warzen wegsprechen konnte und die einzigartigste Krone auf seinem Haupt trug, die ein Herrscher nur tragen konnte. Simon lächelt, als er in Gedanken den kauzigen Alten vor sich sieht, eine Seele von König, das war er. Simon würde ihn so gerne besuchen, so wie er all die anderen jetzt gleich besuchen wird. Doch der König ruht woanders, wo, das kann man sich denken, wenn man die Geschichte kennt. Doch damals, als alles geschah, kannte sie niemand. Oder wollte sie nicht kennen, nicht hören und schon gar nicht sehen, diese verdammte Geschichte.
Simon erreicht den Friedhofsplatz. Die uralte Linde zeigt sich in vollem Saft, die Blätter zittern im lauen Wind. Die Bank unter ihr gibt es noch, wenngleich man sie durch eine neue, grün gestrichene ersetzt hat. Simon reibt mit dem Hemdsärmel die Sitzfläche trocken und nimmt Platz. Ein Bub auf einem Skateboard rattert vorbei und tippt mit der rechten Hand an seine Schiebermütze zum kurzen Gruß. Simon grüßt nickend zurück. 1935, so erinnert er sich, es war an einem Sonntag im August, als er mit seiner Mutter die Stadt verlassen hatte und hierherzog, da war er in etwa in dem Alter des Jungen, der jetzt mit wedelnden Armen und schwankendem Oberköper auf dem Brett steht und die Straße hinunterrattert. Es ist ein warmer Tag, ein schöner.
Der alte Mann atmet tief durch, erhebt sich schwerfällig und betritt den Friedhof. Langsam geht er die Grabreihen entlang: Viele bekannte Namen, die er dort liest. Bauer Sonnbichler, Familie Schwaiger, das Fräulein Briefträger. Vor dem großen Grab der Feistls bleibt er kurz stehen und betrachtet die gerahmten Fotos der Verstorbenen. Die schöne Bäuerin mit den traurigen Augen, die alte, runzlige Schwiegermutter, der Mann mit dem forschen Blick. »Sie begann bei euch, diese Geschichte. Ja, ja, sie begann bei euch«, murmelt Simon Weber und zieht weiter, der Kies knarzt unter seinen Füßen. Eine junge Frau steht am Brunnen und füllt die Gießkanne, ansonsten ist es auch hier menschenleer.
Es ist ein gepflegter Friedhof. Kein Grab wirkt verwildert oder achtlos behandelt. Selbst die Welt der Verstorbenen ist im goldenen Dorf mit Schönheit und Achtsamkeit versehen. So war es schon immer. Doch das Gold war nur ein Schein, denkt der alte Mann. Damals zumindest. Und heute?
Endlich ist Simon an seinem Ziel angelangt. Er holt eine Kerze aus dem Rucksack, stellt sie behutsam an den Grabstein und zündet sie an. Die drei Rosen legt er daneben.
»Servus, ich bin’s, der Simmerl«, sagt er. »Mein Freund, ich hatte dir versprochen, dass wir zusammen deinen 90. Geburtstag begehen. Jetzt bist du oben im Himmel, ich unten im Dorf und blicke nur auf die schwarze Erde, die auf dir und den Deinen ruht.« Simon zögert einen Moment, bevor er weiterspricht. »Hab nachgedacht all die Jahre, wo begann das Schicksal, wo die Schuld, dass alles so gekommen ist, ich noch hier bin, ihr so weit weg seid? Ich sag’s euch, es begann, bevor wir geboren wurden. Und doch tragen wir die Schuld an dem, was passiert ist, alle miteinander, die noch Lebenden und ihr, die ihr hier ruht. Wisst ihr, es geschah vor ewiger Zeit. Es ist eine lange Geschichte, wie sie sich mir nach schmerzvollem Grübeln erschlossen hat. Wollt ihr sie hören?«
Die Toten geben keine Antwort. Nur ihre Namen glänzen in goldenen Lettern, der Mörder und zwei seiner Opfer tief unter der Erde vereint. »Es geschah im Sommer 1921«, beginnt Simon Weber zu erzählen.
Es geschah im Sommer 1921 droben, auf der Anhöhe im alten Schuppen. Währenddessen grasten nebenan die Kühe und schlugen mit den Schwänzen die Fliegen weg. Einige der Tiere dösten auf der Wiese, ihre Mäuler kauten gemächlich wieder. Während es geschah, leuchtete die Sonne hell am Himmel, Vögel zwitscherten auf den Ästen oder ließen sich durch die warmen Lüfte gleiten. In dieser Stunde, in der es geschah, hockte Alois Trachsler auf dem oberen Boden des Schuppens hinter einer Kiste und wagte keine Regung. Sonst wüssten die beiden Menschen, die es unter ihm trieben, dass ein Zeuge zugegen war.
Die meisten Familien des Ortes saßen zu dieser Zeit gemeinsam am Küchentisch; die Frauen sprachen über Alltägliches, über das, was sie beim Kirchgang oder im Landgraf’schen Laden erfahren hatten, die Männer tranken ihr Bier, nickten mit den Köpfen und ließen ihre Gedanken woandershin treiben.
Es war ein normaler Sonntag, während es geschah. Ein Sonntag in einem ruhigen Jahr, der Erste Weltkrieg war seit drei Jahren vorüber, die Armut noch quälend, die Trauer über die Gefallenen gegenwärtig. Einhundertvierzehn Männer des Ortes waren in den Kampf gezogen, nur jeder dritte zurückgekommen. Man hatte viel Leid zu überwinden.
Während oben auf der Anhöhe Heimliches geschah, deckte Mari Zinsmayer den Tisch und ärgerte sich, dass ihre Tochter Vroni um diese Zeit schon wieder aushäusig war. Deren Vater, Herbert Zinsmayer, hockte vor dem Haus auf der Bank und studierte seine Skizzen. Er war der Tüftler und geniale Erfinder im Ort.
Vierhundert Meter den Dorfbach aufwärts, dort, wo sich der Bauernhof mit der großen Kastanie befand, hängte Benedikt Feistl, ein ruppiger Bauer, seinen Sonntagsanzug in den Schrank, legte den Rosenkranz in die Schublade der Holzkommode und schnallte seinen Schmuckarm ab. Feistl massierte den Stumpf, der von seiner Schulter abging, ein nutzloses Teil, unbrauchbar für die Arbeit, hässlich, ein Stück Fleisch, das er hasste, das seinem Willen nicht mehr gehorchte, nichts anderes tat, als schlaff hinabzuhängen. Eine Granate hatte aus seinem rechten Arm einen blutenden Fetzen gemacht, Unterarm nebst Hand waren irgendwo auf dem Schlachtfeld zwischen den Leichen der Kameraden geblieben. Der Krieg war noch in Feistls Kopf, das Geschrei, der Tod, das Blut und diese verdammte Angst. Der Mann ging hinunter in die Küche, gab ein paar Holzscheite in den Ofen, stierte in die lodernden Flammen und grämte sich über sein Schicksal, einsam, ohne Weib, verkrüppelt, ständig Schmerzen verspürend und kein Geld in Aussicht, um diesen unerträglichen Zustand zu beenden.
Ein paar Häuser weiter bergauf, am oberen Rand des Ortes, stand das letzte Gebäude. Dort begann der Feldweg, der zu einem Pfad wurde, dann in einen Steig mündete, der Wanderer, Förster und Jäger hinauf auf den hohen Berg mit den zwei Zinnen führte. In diesem letzten Häuschen des Dorfes lebte das ledige Fräulein Briefträger mit fünf Katzen und der größten Briefmarkensammlung der ganzen Gegend. Frieda, so hieß die Postbotin mit richtigem Namen, war eine kleine pummelige Person mittleren Alters mit bereits ergrauten, gewellten Haaren. Außerdem war sie geschwätzig wie kaum jemand anderes und deswegen ohne Mann. Gleichwohl liebte man sie allerorts, denn sie hatte ein aufrichtiges, argloses Wesen.
»Dich stecke ich hierhin neben King George. Und dich, das Deutsche Reich? Vielleicht hierhin? Hmmm, mal sehen, was meinst du?«, murmelte sie in diesen Stunden am Sonntag vor sich hin, als wäre eine unsichtbare Person im Raum. Auf dem Tisch lagen Schere, diverse Briefumschläge, Schnipsel, einzelne Marken aus aller Welt. Und ein Briefmarkenalbum, dessen Seiten Frieda derart behutsam umblätterte, als bestünden sie aus purem feinstem Blattgold.
Den Dorfbach wieder hinabgehend, gelangte man schräg unterhalb der Kirche zu einem großen Platz, der von fünf Bauernhöfen umringt war. Der größte und stattlichste von ihnen war der Schwaigerhof, in dem der gleichnamige Bauer mit seinem Enkel Anderl lebte. Der Altbauer zählte zu den Betagteren im Ort und genoss den ruhigen Abschnitt seines Lebens, denn er hatte den Hof dem Enkel übergeben. Der alte Schwaiger arbeitete nur noch, wenn ihm danach war. Das Gehöft lag in einem üppigen Garten voller Obstbäume. Schien die Sonne, sah man den alten Bauern vor dem Haus sitzen und eine langstielige Pfeife rauchen. Während der Qualm in die Luft stieg, beobachtete der Mann seine Bienen, die links und rechts gegenüber der Bank vor ihren Stöcken summten und tänzelten. Schräg gegenüber dem Schwaigerbauern befand sich der marode Sonnbichlerhof, in dessen Stall gerade eine Kuh ihr Kälbchen gebar. Bauer Korbinian stand barfuß hinter ihr und zog am Seil, das er an die Hinterläufe des noch nicht Geborenen gebunden hatte. »Na, komm schon raus da«, knurrte er. Seine Laune war schlecht, denn ihn quälte der verdammte Hunger. Nachdem die Kuh das Junge aus dem Leib gedrückt und abgeleckt hatte und das Kälbchen auf zittrigen Beinen die Euterzitzen der Mutter suchte, ließ Korbinian Sonnbichler die beiden allein. Wieder ein Leben mehr auf dem Hof, obwohl das Futter knapp war. Fürs Vieh, für ihn selbst, für seine junge Frau Reserl und die kleine Tochter Annamirl. Der Bauer war verschuldet, sein Hof gehörte lang schon einer »Judenbank«, und Korbinian Sonnbichler sah keinen Ausweg aus der Misere. Die Speisekammer war restlos geplündert, das Apfel- und Zwetschgenmus verspeist, die Kartoffelkiste inhaltslos, der letzte Speck verzehrt, im Brotkorb lagen ein paar Krümel, und es rumorte im Bauch vor Hunger. Mit dem frühen Tod der Mutter war auch das Leben aus dem Gemüsegarten hinterm Hof gewichen, denn Reserl hatte keine Zeit für das Pflanzen und Jäten, sie war tagein, tagaus mit dem Spinnen von Flachs beschäftigt, um ein wenig Geld hinzuzuverdienen. Und so wuchs nichts mehr im Garten, außer Unkraut, Brennnesseln und Löwenzahn. Daraus kochte Reserl Suppe für die Familie oder bereitete Salat. Jetzt stand sie in der Küche, schmeckte die Gemüsesuppe ab und verzog den Mund. »Etwas Salz noch«, murmelte sie. »Aber besser wird’s dadurch auch nicht.« Dann deckte sie den Tisch, zog die Schürze aus und setzte sich. Die Hände im Schoß gefaltet, hockte sie regungslos da und sah zu, wie der Dampf dem Topf entwich. In der Stube roch es nach fader Brühe. Und in der Ecke in der Wiege schrie das Kind.
Während all dies geschah, liebkoste sich oben auf der Anhöhe, die über dem Dorf lag, das heimliche Liebespaar. Es lag ganz hinten in der Ecke des Schuppens in einem Heuhaufen. »Bist mein größter Schatz auf ewig«, flüsterte der Mann seiner Geliebten zu und streichelte ihr über die Brüste.
Zu dieser Zeit hatte die alte Kauffrau Lena ihren Laden selbstverständlich geschlossen, schließlich war Sonntag, der Tag des Herrn. Während Tochter Klara im Wohntrakt den Tisch für das Mittagessen eindeckte, stand die Ladeninhaberin hinter der Ladentheke und machte in den Regalen Ordnung. Das Butterschmalz stand falsch, Zucker, Dosen, Mehl, Schuhcreme, Wolle, alles war zu wenig geordnet. Lena schüttelte den Kopf. »Herrschaft, so a Durcheinander«, brummte sie. Zu Mittag, wenn sie alle am Tisch säßen, würde sie, die Chefin, ein paar ernste Worte an die Angestellten richten. Wie jeden Sonntag.
Die Glocken schlugen drei Mal, während oben auf der Anhöhe zwei Menschen voller Liebe füreinander waren, ihre Münder aufeinanderpressten, zuerst zärtlich, dann leidenschaftlich. Herzen vereinigten sich. Und Körper.
Und drunten bei den Zinsmayers warteten die Eltern am gedeckten Tisch vor ihren Suppentellern. »I hab’s langsam satt mit der Rumtreiberin«, schimpfte Mari Zinsmayer. Herbert nahm den Löffel in die Hand. »Wir fangen jetzt an zu essen«, bestimmte er. Seine Frau betrachtete ihn von der Seite, im Gesicht ihre unverkennbare Zornesfalte. »Du tust immer so, als wär nix mit unserer Tochter, Herbert«, sie hieb mit der Faust auf den Tisch. »Noch was muss ich dir sagen. Die Vroni küsst ihn.«
»Wer küsst wen?«, fragte ihr Mann.
»Die Moni den Hiasl.«
»I weiß net, wovon du sprichst«, murrte Herbert Zinsmayer und begann, die Suppe zu löffeln.
»Vom Theaterstückl red ich. Ich hab’s gelesen, und da küsst …«
»Ja und?«, fragte er.
»Mein Gott, Mann, unsere Vroni spielt die Moni. Und der Binder Lorenz den Hiasl, weißt des net?« Mari Zinsmayer verschränkte die Arme vor ihrer Brust. »Niemand werd küsst, schon gar net unsre Vroni von dem Hallodri Lorenz.« Der Vater zuckte mit den Achseln. »Wennst meinst, Frau. Jetzt iss! Und weil des Vronerl schon wieder net da is, kriegt’s halt nix zum Essen.«
1921 war das goldene Dorf noch ein normaler Ort. Und es war ein normaler Sonntag, während es droben im Holzschuppen auf der lauschigen Anhöhe geschah. Nichts Ungewöhnliches trat augenscheinlich auf, und doch geschah an diesem Tag etwas Besonderes: eine ungehörige Verschmelzung zweier Wesen, eine Schandtat fleischlicher, verbotener Gelüste zweier verliebter Menschen, die so jung waren, dass sie nicht ahnten, welche Folgen alles haben würde. Und wenn schon. Es wäre ihnen zu dieser Liebesstunde wohl einerlei gewesen.
Der König, denn für einen solchen hielt sich Alois Trachsler, lauerte immer noch oben in seinem Versteck, während es geschah. Er nahm sein Kreuz in die Hand und betete für die beiden Seelen, die es unter ihm trieben. Er hörte ihr Atmen, das Stöhnen, alles Ungehörige. Es war schrecklich für den alten Trachsler, der selbst nie erleben durfte, wie es war, einander nah zu sein.
Endlich gaben die Sündigen Ruhe, lagen im Halbdunkel, dicht nebeneinander und hielten sich an den Händen. Schweißperlen rannen über die verschwitzten Gesichter, das konnte Alois Trachsler durch die Ritzen der Holzbretter hindurch erkennen, denn ein schwacher Sonnenstrahl hatte sich durch den Fensterspalt quer über den Heuhaufen direkt auf die junge Frau gelegt. Jessas, die Zinsmayer Vroni und der Binder Lorenz, erschrak Alois Trachsler. Er überlegte, ob er einschreiten sollte, schließlich war das hier sein eigenes, geheimes Reich. Sein Reich! Dort hatte er zu grübeln. Allein und ungestört wollte er hier sein, und es gab für den König wahrhaft viel zu grübeln, denn bisweilen rasten die Gedanken in seinem Kopf derart durcheinander, von hier nach da, erbarmungslos und eigenwillig, dass es Alois Trachsler geradezu schwindlig wurde. Immer sonntags zwischen elf Uhr dreißig und dreizehn Uhr dreißig verzog sich der Mann hierher, denn nirgendwo ließ es sich so trefflich nachdenken, nirgendwo war er so ungestört wie hier auf dem oberen Boden des Schuppens, wo an den Wänden zwischen staubigen Spinnweben vergessene Heugabeln und ein paar stumpfe Sensen hingen und auf den Bodenbrettern drei hölzerne Melkschemel herumlagen. In einer Ecke befand sich Trachslers alte Kiste, in die er seine wertvollen Utensilien gepackt hatte: ein Kreuz, einen Kristallstein und eine weißlich schimmernde Meeresmuschel, die ihm seine Mutter vererbt hatte. Mutter Trachsler, die schon lange tot in der Grube lag, etwas außerhalb des Friedhofs, dort, wo man die Armen der Ärmsten begrub, hatte sie dem kleinen Alois geschenkt, als der noch ein Bub war. »Da, Loisl, wennst die Muschel ans Ohr hältst, hörst das Meer«, hatte sie ihm gesagt.
Die junge Frau im Raum unter Alois Trachsler richtete sich auf und zog den Unterrock über die Knie. Der Gefährte hatte die Augen geschlossen. »Lenzerl«, flüsterte sie, »bist eingeschlafen?« Er schüttelte den Kopf und strich sich mit der Hand durch die Haare. »Ich hör den Blättern zu, wie sie rauschen, und denk nach.« Vroni Zinsmayer zupfte sich kleine Heuhalme aus dem Zopf und steckte eine Locke zurück ins Geflecht. »Ganz dreckig bin i«, seufzte sie. Sie erhob sich, ging ein paar Schritte zur Tür und öffnete sie. Der Sonnenstrahl wanderte über den Boden bis zur hinteren Wand, durchflutete den Raum, ein sanfter Windzug strömte herein, und das große Spinnennetz am linken Balken direkt unter der Decke zitterte ein wenig. Auch das sah der König. Draußen begannen die Kirchturmglocken zu läuten, erst die eine, tief und sonor, kurz daraufhin die andere, hell und mahnend zur Essenszeit. »Wird Zeit, dass ich heimgeh«, sagte Vroni, »aber ich mag net, will bei dir bleiben.« Sie lächelte, drehte sich zu dem Geliebten um und legte sich wieder neben ihn ins Heu. »Die Zeit anhalten, des wär’s«, sagte Lorenz, »oder weit wegfahren, übers Meer, was meinst, Vronerl?« Sie nahm seine Hand und legte sie auf ihre Brust. »Weg, wohin?«, fragte sie.
»Amerika oder noch weiter«, schlug er vor. Sie atmete geräuschvoll ein. »Ach, Lenzi, du bist schon a Spinner, du, immer mit deinem Amerika. Schöner als bei uns im Dorf ist’s nirgendwo.«
»Ich nehm dich mit, Vronerl«, sagte Lorenz mit zärtlicher Stimme. Sie schüttelte den Kopf. »Naa, naa, jetzt kommt erst mal das Theater dran, ich freu mich so. Bis zur nächsten Probe kann ich den ganzen Text auswendig. Ich versprech’s dir.«
Die Glocken waren verstummt, eine Biene hatte sich verflogen, unruhig schwirrte sie im Schuppen umher, zog ein paar Kreise über den Köpfen der Liebenden, ließ sich kurz auf den Boden nieder, tänzelte nach rechts, nach links, surrte wieder in die Höhe und flog durch den Türspalt in die Freiheit. Der alte Trachsler lächelte zufrieden, schließlich gehörten auch die Bienen zu seinem Reich. »Lenz, wir sollten gehen, waren schon so lang weg«, warnte Vroni. Lorenz nickte, knöpfte die Lederhose zu und erhob sich. »Komm«, sagte er und reichte der Geliebten die Hand.
Als die beiden den Schuppen endlich verlassen hatten, legte Alois Trachsler das Kreuz sorgsam in die Schatztruhe zurück, kletterte die Leiter hinunter und sah durchs milchige Fenster dem Paar hinterher. Er schüttelte den Kopf, der einzige Zeuge der Liebe, die an diesem Sommersonntag 1921 geschah.
Droben auf der Anhöhe.
* * *
Im Garten Eden lebten die Seligen, dort waren Wonne und Glück zu Hause. Einen Strom, der sich in vier mächtige Flüsse geteilt hat, soll es im Garten Eden auch gegeben haben, durch diese gedieh und wuchs die Natur voller Üppigkeit und Vielfalt. Es duftete nach Rosen, Lavendel, nach Flieder und vielem mehr. Die Augen schweiften über sattes Grün, Blumenteppiche, über pralle Fruchtbarkeit. Tiere waren auch zugegen, alle Wesen, die erschaffen wurden. Es gab weder Missgunst noch Feindschaft, keinen Streit, schon gar kein Töten und Morden. Das Glück der beiden Menschen, der ersten und einzigen auf dieser noch unschuldigen, jungfräulichen Welt, war groß. Das Paradies, der schönste Ort, den die menschliche Vorstellung geschaffen hat, lag weit von der Erde entfernt, hoch oben hinter den Wolken im Himmel, dachten die Menschen. Erleben konnte man das Paradies nur, wenn man daran glaubte, es nach dem Tode betreten zu dürfen.
Und doch konnte es auch auf Erden sein. Während Vroni durch die kleinen Straßen nach Hause schlenderte, war ihr so. Die Gefühle in ihrem Herzen ließen die Verliebte denken, ein Stückchen des Garten Edens sei vom Himmel gefallen, direkt hierher ins Dorf und habe es in goldene Farbe getaucht. Im echten Paradies gab es keine Häuser, aber hier, im sonnendurchfluteten, irdischen, säumten sie den Weg, der sich durch den Ort schlängelte: die Balkone prachtvoll mit Geranien geschmückt, die Wände mit Malereien versehen, die Gärten mit Hyazinthen, Narzissen, Feuerkelchen, Rittersporn bewachsen. Im Herzen des Dorfes, auf der großen Angerwiese, kickten Buben einen Ball hin und her. In acht Wochen würden hier auf diesem Platz Bänke stehen. Ein Ausschank und eine Bühne gebaut und Stempen in den Boden geschlagen werden, zwischen die man als Kulisse bemalte Laken spannen wird. In wenigen Wochen würde auf dem Dorfanger eine große Aufführung stattfinden, und zwar das Theaterstück Der Bayerische Hiasl von Wilhelm und Ottilie Köhler. Vroni fieberte dem Tag entgegen, denn Lenz hatte ausgerechnet sie dazu auserkoren, die Rolle der schönen Moni zu übernehmen. Seit Anfang Mai lernte sie den Text auswendig, stand gestikulierend vor dem Spiegel, übte ihr Mienenspiel. Leidenschaft, Liebe, Verzweiflung, all das mache ihre Rolle aus, hatte Lenz Vroni erklärt. Er hatte die Vorführung auf die Beine gestellt, das Stück und die Schauspieler ausgesucht. Moni war die Geliebte des Hiasl. Und den Hiasl, den wilden Kämpfer für Gerechtigkeit, diese tragische Figur, die man später grausam hingerichtet hatte, spielte Lenz selbst. Im Dorf sagten die Leute, die Rolle des Rebellen würde zum Bäckerssohn Lorenz Binder bestens passen, denn der wäre immer schon besonders und aufmüpfig gewesen und hätte jetzt als wilder und rastloser Lebemann nichts als hochtrabende Ideen, Flausen und Weibersleut in seinem Kopf, anstatt sich der Arbeit und der Bäckerei zuzuwenden. Lenz selbst machte nie einen Hehl daraus, dass er den Bäckerberuf, der ihm aus Tradition heraus vorgegeben schien, verabscheute. Dem jungen Mann schwebte allerlei anderes vor: Mal wollte er Bierbrauer werden, mal Bildhauer, dann Musiker, Autor oder gegenwärtig ein großer Schauspieler auf den Brettern, die die Welt bedeuteten.
Ein Hahn krähte, und die Katzen sonnten sich auf der Hausbank. Auf ihrem Weg nach Hause grüßte Vroni fröhlich nach links, wo die Bäuerin strickend auf der Hausbank saß, grüßte nach rechts, rüber zum Lederer, der vor sich auf dem Gartentisch ein Bier stehen hatte. Hier im Dorf kannte man sich, fühlte sich miteinander verbunden, die Menschen lebten in einer Gemeinschaft, wie sie nicht enger und verbindlicher sein konnte.
Auf der schmalen Holzbrücke, die über den Dorfbach führte, blieb die Zinsmayertochter stehen und beugte sich übers Geländer. Sie sah die kleinen Strudel, die sich im Wasser bildeten, und in dem Moment wirkte selbst das Bächlein auf sie munter. Ihre Augen wanderten zwischen den Höfen hinüber zur Bäckerei. Dort hatte mit heftigem Herzklopfen und verstohlenen Blicken ihre heimliche Leidenschaft für Lenz begonnen. Und nichts fürchtete sie mehr, als dass irgendwer ihre Gefühle für den zwei Jahre älteren Bäckerssohn entdeckte. Der stattliche Mann mit seinem markanten Gesicht, den stahlblauen Augen, dem dunklen gewellten Haar schenkte Vroni das betörendste Lächeln der Welt, wenn er sie ansah und fragte, was sie zu kaufen gedenke. Stand die junge Zinsmayertochter im Laden direkt vor ihm, wagte sie kaum, ihn anzusehen, zu sehr fürchtete sie, ihre Wangen würden sich dann verräterisch röten. Gefühle, besonders die der Liebe, hatte man geheim zu halten, denn im Dorf tratschten die Leute gern, und in der Kirche predigte der gestrenge Pfarrer Keuschheit für Mann und Frau, solange diese den Bund der Ehe noch nicht eingegangen waren.
Vroni war es einerlei, was die Menschen über Lenz Binder tuschelten: Frauenheld, Tunichtgut, Hallodri. Aus der Theaterliebe Moni und Hiasl erwuchs alsbald die echte: Vroni und Lenz wurden zu einem heimlichen Paar, das sich versteckte, wenn es sich liebte, mal oben im Wald, mal unten am großen Fluss. Meistens aber trafen sie sich im Dunkel des Schuppens auf der Anhöhe, der früher mal ein Schafsstall gewesen war und jetzt als Lager für ausrangierte Dinge diente. Die Dachbalken hingen schräg, ein paar Bretter in der Wand fehlten, und es war nur eine Frage der Zeit, bis ein heftiger Windsturm das alte Teil zusammenbrechen lassen würde. Ein verlassenes Plätzchen, das niemand mehr betrat, dachten die Liebenden.
»Zu spät is, jetzt hilft kei Flucht mehr – Hiasl, wenn’s dich fangen, ist’s dein Tod und der meine auch.« Immer noch in Gedanken versunken stand Vroni auf der Brücke, murmelte jetzt Textfragmente vor sich hin. Sie hielt kurz inne und überlegte, wie es weiterging. Mit tiefer Stimme, denn im Text war es nun Hiasl, der redete, setzte sie die Szene fort: »Moni, du treue Seel! – I will leben – wegn deiner will i lebn.« An dieser Stelle sollte es passieren. Moni und Hiasl küssten sich, so zumindest schrieb es das Theaterstück vor. Vroni schloss die Augen, spitzte den Mund und beugte sich, den Kuss mimend, nach vorne. Plötzlich gewahrte sie jemanden hinter sich. Sie wandte sich um und blickte in die wässrigen Augen des alten Alois Trachsler. Sein zerfurchtes Gesicht war bleich, und die grauen Haare standen wirr nach allen Seiten. Wie so oft, sommers wie winters, trug er seinen langen dunklen Mantel. Im Dorf sagte man ihm nach, er sei ein Hexer, weil er Zaubertränke braute, und ein Spinner sei er zudem, wenn er mit hocherhobenem Haupt, auf dem er ein Kranzgeflecht aus Zweiglein und Blumen trug, durch den Ort stolzierte. Da er aber ansonsten friedlich in seinem Häuschen lebte und niemandem jemals etwas zuleide tat, mochten ihn die Menschen. Er war im Ort eine skurrile Selbstverständlichkeit, die keiner wirklich verstand. Trachsler lebte in einem kleinen baufälligen Häuschen, mittig am Leonhardiweg in einem verwilderten Garten gelegen. In der Behausung herrschte Schwärze, schwarz war die Küche, weil voller Ruß, dunkel die Stube, denn vor deren Fenster hatte sich ein dichter Hollerbusch breitgemacht. Und die Läden vor dem Schlafzimmer waren stets geschlossen und vom Efeu umrankt. »Jessas, Maria, der Trachsler, hast du mich erschreckt«, sagte Vroni, »was schaust mich so an?« Der Alte legte die Hand über seine schmalen, runzligen Lippen. »Verstehst?«, fragte er. Vroni schüttelte den Kopf. »Was meinst denn, Alois?« Er näherte sein Gesicht ihrem Ohr und raunte ihr zu: »Ich sag nix. Ich schweig. Ich versprech’s dir.« Dann zog er sein Kreuz aus der Tasche und hielt es der jungen Frau kurz an die Stirn. »Damit’s kein Unglück bringt«, sagte er mit gedämpfter Stimme. Dann wandte er sich zum Gehen. »Bis ins Grab«, flüsterte er noch und schlurfte von dannen, einen Fuß hinter sich herziehend und in viel zu großen Stiefeln. Die hatte er von Vronis Vater vor Urzeiten geschenkt bekommen, übrig gebliebene Schuhe eines Knechts, der beim Holzfällen von einem Baum erschlagen worden war. »Nix sag ich, aber«, er hob den Finger in die Höhe, »aber Vronerl, des machst in meinem Reich nicht mehr, so eine Untat. Des mag er net, der König.«
Zwei Haflinger trabten des Weges, auf der Kutsche, die sie zogen, hockten ein paar Burschen und Mädels aus dem Dorf, der Josef, Peter, die Tini, die feistfesche Brigitte und einige mehr, alle in Tracht gekleidet, die Männer in Lederhose und Hüten mit Gamsbärten, die Frauen im Sonntagsdirndl. Neben Vroni brachten sie die Rösser kurz zum Stehen. »Servus, Zinsmayerin, wie schaut’s aus? Drüben in Walding ist Dorffest, kommst mit auf a Maß?«, fragte einer der Burschen.
Vroni ließ ihren Blick über die ausgelassene Gruppe streifen, bis sie hinten links Lenz erkannte. Der thronte auf dem Wagen, keine sieben Meter von ihr entfernt, stolz und anziehend. Und in diesem Moment doch so fern mit seinem knappen Lächeln und kurzen Handgruß. »Servus, Vroni«, sagte er.
* * *
Heute ist der 18. August 1991.
Heute ist ein guter Tag, damit zu beginnen, so einiges mal aufzuschreiben. Es ist der Tag, an dem der liebste Mensch der Welt für immer fortgegangen und in der Erde verbuddelt wird.
Vater, Mutter und ihr anderen Menschen, die ihr mich kennt, ich erzähle euch meine Geschichte. Denn manchmal überkommt mich das Gefühl, dass irgendwann was passieren wird.
Ihr könnt euch dann später euren eigenen Reim daraus machen, ihr könnt die Zeilen, die ich schreibe, auch wegschmeißen, verbrennen, oder euch den Arsch damit abwischen. Wenn ihr sie nicht lest, dann ist es mir auch scheißegal.
Wie gerne wäre Vroni mitgegangen. Sie liebte das freudige Tanzen, das Poltern auf der Bühne, wenn die Burschen den Schuhplattler zeigten. Sie liebte die Ausgelassenheit, manchmal auch das unbeschwerte, leichte Gefühl, wenn sie ein paar Schlucke Bier aus dem Maßkrug getrunken hatte, heimlich natürlich, denn Mutter Zinsmayer meinte streng, Saufen sei nur was für Männer, eine ordentliche Frau habe dies tunlichst zu unterlassen.
Während Vroni am geöffneten Fenster ihres Zimmers stand und auf die Straße blickte, auf der entlang die Haflinger die jodelnde Truppe Richtung Dorffest gezogen und dabei ein paar Pferdeäpfel verteilt hatten, wurde sie wehmütig und zweifelnd zugleich. Es war ein schmerzendes Wanken in ihrer Seele, das eben noch höchste Glück schlug jäh in Zweifel und Wut um. Warum hatte Lenz eben nichts gesagt, als sie im Schuppen waren, warum nicht gefragt, ob sie auf das Fest mitkommen wolle. Groll richtete sich auch gegen die strenge Mutter, der neben dem Reichtum, den die Familie angehäuft hatte, nichts wichtiger war als der zweifellose Ruf ihrer Tochter, dem einzigen Kind der Zinsmayers. Niemals hätte sie erlaubt, dass Vroni ohne ihre Eltern auf ein Fest ging. Vom Vater war keine Hilfe zu erwarten, er sagte ohnehin meist nichts, hielt sich aus den Dingen, die im Haus stattfanden, heraus und arbeitete unermüdlich in seinem Säge- oder Elektrizitätswerk und grübelte in der Freizeit über seine diversen Erfindungen.
Vroni legte sich auf das Bett und hörte die Vögel singen. Der Nachmittag hatte begonnen, die Sonne stand hell am Himmel, der Vroni nun weiter weg erschien denn je. Sie war am falschen Ort, nicht bei der großen Liebe, die sie im Herzen klopfen spürte. Wenngleich sie ihm grollte, weil er sie übergangen hatte, vermisste sie Lenz, der jetzt fort war, drüben auf dem Fest wohl sicher eine andere Frau beim Tanz in seinen Armen hielt.
Während Vroni dalag und wehmütigen Gedanken nachhing, bemerkte sie plötzlich die seltsame Stille im Haus, keine Stimme, kein Klappern von Töpfen, keine Tritte im Hof. Als sie sich vorhin auf leisen Sohlen durch den Gang die Treppe hinauf ins Zimmer geschlichen hatte, um dem gewohnten Ärger zu entrinnen, der bei jedem Zuspätkommen drohte, sah sie durch den Türspalt, dass ihre Eltern in der Küche saßen: ihre Mutter, Mari, heftig gestikulierend und laut schimpfend, ihr Vater, Herbert, wie immer schweigend. Streit zwischen den beiden gab es öfter, es ging um die Knechte, die Mägde, die der Mutter zu faul waren, vor allem ging es um das leidige Geld, das der Mutter nie genug war, auch wenn die Zinsmayers die reichsten Einwohner des Ortes waren. Oder die Eltern zankten sich wegen Vroni, weil sie nicht tat, was man von ihr erwartete. Meistens aber suchte Mari Streit schlicht und einfach des Streites wegen, und Vroni fragte sich dann, ob es jemals Liebe zwischen ihrem Vater und der Mutter gegeben hatte? So wie zwischen ihr und Lenz?
Über die Liebe sprach man nicht offen, weder in der Familie noch unter Bekannten, man empfand und lebte sie heimlich, insbesondere wenn man so jung wie die erst achtzehnjährige Vroni war, und unverheiratet. Liebe und Begehren waren für die Ehe bestimmt, und falls sie nicht da war, die Liebe, heiratete man trotzdem, wenn es die Familie so bestimmt hatte. Nein, ihre Eltern liebten sich nicht, sahen sich nie zärtlich an, sie stritten oder schwiegen, sie funktionierten. Liebe, ahnte Vroni, war für ihre Eltern die Erfüllung von Pflichten. Niemals wollte Vroni so leben, sie wollte den Schatz hüten, der in der Liebe lag. Für immer und ewig. Mit Lenz. Sie würde auf den Tag warten, an dem er um ihre Hand anhielte, noch drei Jahre waren es bis zu ihrer Volljährigkeit, dann könnte sie sich vor der Kirche, vor den Eltern, vor allen Menschen im Dorf für den Mann entscheiden, den sie begehrte. Vroni erhob sich vom Bett, strich das Kleid glatt und lächelte. Sie schloss die Augen und stellte sich den Geliebten vor mit seinen schönen Augen, dem dichten Haar, dem Lachen, bei dem seine Zähne so weiß schimmerten. In Gedanken sah sie ihn, er stand direkt vor ihr, so nah, dass sie meinte, seinen Atem zu spüren. »Lenzerl«, sagte sie leise, »ich werd einmal dein Weib, wir könnten zusammen hier im Haus leben. Du könntest lernen, mit’m Holz und der Säg umzugehn. Dann musst nimmer in die Bäckerei. Ich mach den Garten, so wie im Paradies, Blumen kommen ans Fenster, und wir wer’n glücklich sein, für immer, Lenz, des weiß ich und des will ich.«
Festen Willens, stur, so schimpfte die Mutter stets, sei Vroni immer schon gewesen, trotzig, manchmal wild, meistens stolz. Ging die Zinsmayertochter durch den Ort, war ihr Haupt hoch erhoben, der Gang voller Anmut und Liebreiz. Schön, mit ebenmäßigem Gesicht und langen blonden Haaren, war sie überdies; eine gute Partie sei sie, sagte man im Dorf: reiche Eltern, einflussreicher Vater, ein ansehnlicher Besitz.
Die Schöne stand jetzt in ihrer Kammer, sprach in die Leere des Raums ihre Träume, voll jugendlicher Verblendung und dem Glauben, man könne die Zukunft selbst lenken, das Glück wählen und fest umklammert halten. Keine acht Wochen war es her, dass Lenz sie zum ersten Mal geküsst hatte.
»Vroooni, komm runter, muss mit dir reden«, hörte sie jetzt die Stimme der Mutter rufen.
Mari saß allein in der Küche, der Vater hatte sich verzogen. »Setz dich her«, befahl die Mutter der Tochter und klopfte mit der Hand auf einen Stuhl. Die Falte zwischen ihren Augen war furchig, die Lippen hatten sich zu einem schmalen Strich verzogen. Die Haare hatte sie wie immer zu einem festen Knoten gebunden, ein paar graue Strähnen schimmerten hervor. Die Finger waren knöchrig, wie alles an ihr. Langsam wird sie alt und verbittert, dachte Vroni, als sie Mari anblickte. Doch eine Mutter hatte man zu lieben und zu achten, egal wie sie war. Mehr liebte sie ihren Vater, den sanften, in sich gekehrten, den weisen, der nie sagte, was er dachte, dafür seine Augen sprechen ließ. Mutter Mari schob Vroni eine Teetasse zu und goss ein. Dann schraubte sie den Ehering über den Fingerknöchel nach oben und wieder zurück, eine Bewegung, die sie immer machte, wenn sie erregt war. Es roch nach Braten, der in einer Reine auf dem Herd vor sich hin simmerte, daneben ein Topf Soße. »Warst heut Mittag wieder net da«, begann die Mutter. »Wo hast dich rumgetrieben?« Vroni zuckte mit den Achseln. »Unterwegs mit ein paar Leut war ich, hab die Zeit vergessen.«
»Das ist jetzt der dritte Sonntag, Vroni, wo du net da warst. Ich hab’s dir gesagt, heut Abend gibt’s nix für dich zum Essen, wirst es schon noch lernen, dass du folgst, das sag ich dir. Ist eh net einfach mit dir, die ganzen Jahr net, seit du auf derer Welt bist. Machst dauernd, was du willst mit deinem Sturschädl, ich weiß net, woher der kommt.« Sie seufzte und schüttelte den Kopf. Sie nahm einen Schluck aus der Teetasse, stellte sie zurück, drehte wieder an ihrem Ring. »Da wär noch was«, fuhr Mari schließlich fort. Sie schob Vroni das Heftchen über den Tisch zu.
»I hab’s gelesen, des Stück da«, sagte sie. »Über den boairschen Hiasl, will ja schließlich wissen, was ihr da mit dem Theater macht’s. Du spielst die Moni, stimmt’s?«
»Das hab ich dir doch schon gesagt, Mutter«, gab Vroni zurück. An einer Stelle des Heftchens war ein Einmerker in Form eines Stücks Papier zu sehen. Mari schlug es dort auf und las mit erboster Stimme vor: »Moni küsst Hiasl.« Sie blickte ihre Tochter scharf an. »Und der Hiasl, haben’s alle gesagt, den spielt der Lorenz, der Lump. Des gefällt mir net. A schändliche Küsserei. Noch dazu vor alle Leut, auf der Bühne.«
»Ist doch nur a Theater, Mutter«, antwortete Vroni trotzig.
Mari Zinsmayer hieb mit der Faust auf den Tisch, dass Tee aus den Tassen schwappte. »Vroni, des is mir wurscht, i hab mit ’m Vater geredet, wir wollen des net, du machst da net mit, bei diesem Theater.«
Sie stritten sich, harsche Worte flogen hin und her, Vroni versuchte, sich zu erklären, es sei doch nichts dabei, man könne den Kuss auch wegfallen lassen, es wär doch alles nur auf der Bühne, Lenz würde sie als Schauspielerin dringend brauchen, denn es verblieben nur noch wenige Wochen bis zur Aufführung, sie habe sich so darauf gefreut, den Text gelernt, und Lenz meinte, sie sei eine gute Schauspielerin, außerdem könne sie ihn nicht einfach so sitzen lassen, bei seinem großen Traum, ein Stück zu inszenieren, zudem sei er doch ein ganz netter Bursche.
Nachdem Vroni all dies atemlos herausgesprudelt hatte, versetzte ihr Mari einen festen Schlag auf die Wange und schrie sie an: »Eine Ruh is!«. Draußen vor dem Fenster rauschte der Bach, zwitschernde Vögel waren auch zu hören und Stimmen von irgendwelchen Dorfbewohnern, die auf der Straße ein paar Worte wechselten. Der Nachbarsbub übte Trompete, spielte einen Walzer. Der Sonntag, der nicht schöner hätte sein können, wandelte sich, die Sonne glänzte nicht mehr, die Wärme verzog sich langsam, Mutter und Tochter saßen sich gegenüber und schwiegen. Das Paradies erschien auf einmal ferner denn je. Und Lenz, dachte die junge Frau in diesem Moment, tanzt gerade ausgelassen im Ort nebenan.
»Diesen Lorenz«, zischte die Mutter jetzt, »den mag ich net. Semmeln verkaufen und so a blödes Theater spielen. Außerdem ist er a Hallodri, a ganz a schlimmer, des weiß auch jeder im Ort.«
Vroni erhob sich von ihrem Stuhl. »Ich geh Zither spielen, Mutter«, sagte sie ruhig und verließ die Küche.
* * *
Die Tage zogen ins Land, auch ins goldene Dorf. Es waren Tage, die für die einen schnell vergingen, für die anderen unerbittlich langsam. Tage mit Routine, Gleichklang, Arbeit, aber auch Tage, in denen Pläne geschmiedet wurden, auf dass eine bessere Zukunft anstehen würde. Korbinian Sonnbichler hockte in seiner Werkstatt und drechselte Stäbe für Rechen. Mindestens dreißig von ihnen wollte er bis zum Herbstmarkt fertiggestellt haben, um sie dort zu verkaufen und von dem Geld Unterhosen und ein paar Schuhe zu erstehen.
Noch ließ es sich gut auf bloßen Füßen gehen. Die Sohlen waren schwielig und verhornt, sie schmerzten Korbinian nicht einmal, wenn er seine Kühe über steinigen Boden auf die Weide trieb. Erst mit der Kälte des Winters käme die Pein, weil der Bauer nichts anderes anzuziehen hatte als dicke Socken, mit denen er in löchrige, mit Filz und Schnüren halbwegs tragbar gemachte Stiefel schlüpfte. In denselben hatte er sich vor vier Jahren aus Belgien nahe Ypern aus dem Krieg zurückgeschleppt, gerade mal fünfundzwanzig Jahre alt, an der Ruhr erkrankt und bis auf die Knochen abgemagert.
Sein einziges noch intaktes, aber abgewetztes Paar Schuhe hat er für den Kirch- und Wirtshausgang vorgesehen. Es stammte aus der Zeit, in der seine Füße aufgehört hatten zu wachsen, und war ein Geschenk des Vaters, der jetzt zusammen mit der Mutter auf dem Friedhof ruhte. Nichts als Schulden und ein paar Kühe, die in einem maroden, renovierungsbedürftigen Hof mit undichtem Dach standen, hatten die Eltern ihrem Sohn vermacht. Die Wände des Hofes waren feucht und rissig, die Farbe blätterte ab. Zum Erbe gehörten überdies ein kleines Wäldchen, ein winziger Kartoffelacker und ein wenig Grund. Es reichte nicht, um den Hunger zu stillen, denn das Wenige, was die Sonnbichlers erwirtschafteten, unterlag auch noch der Zwangswirtschaft. Ständig kamen behördliche Kontrollen ins Dorf und nahmen den Bauern Milch, Fleisch, Eier, Kartoffeln. Es waren harte Zeiten, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, vor allem für die Stadtmenschen, die noch mehr hungerten als die Leute auf dem Land. Immer wieder tauchten sie bettelnd im Ort auf, versuchten Essbares gegen alles zu tauschen, was sie noch ihr Eigen nannten: Schmuck, Bücher, Kleidung. Dinge, die das Ehepaar Sonnbichler gerne besessen hätte, wäre der eigene Hunger nicht so groß gewesen. An manchen grauen Dämmerabenden geschah es auch, dass »Städterer« in den Äckern oder Gärten des Dorfes heimlich Kartoffeln ausstachen oder Salatköpfe rupften.
Immer noch war Sommer, die erste Mahd stand an. Es sollte keine gute Ernte werden, denn die Tage zuvor hatte der Himmel gegrollt, es donnerte, blitzte, und aus den Wolken brachen Wassermassen, die Flüsse traten über die Ufer, weite Teile der Felder lagen nach der Überschwemmung flach, es schien, als wären sie grüne Seen. Die Pferde auf den Weiden standen dicht beieinander, die Kruppen gen Wind- und Wetterseite gewandt, die Kühe stapften auf ihren Weiden knöcheltief im Matsch. Die Katzen verzogen sich in die Scheunen und rollten sich im Heu ein. Als dann endlich die Sonne kam und das Wetter wenigstens ein paar Tage zu halten schien, mähten die Bauern die geschundenen Felder, die Frauen rechten und wendeten das wenige Heu, das sie ernten konnten, Pferde zogen es zu den Scheunen.
Knapp acht Wochen waren vergangen seit jenem schönen Sonntagmittag. Alois Trachsler wollte von da an nicht mehr ins Versteck gehen, sein Ort der Stille war verdorben, voll des Lasters, der Lust, der Heimlichkeit und des Verbotenen. Der König verzog sich in sein dunkles Häuschen, nachdem er durch Wälder und über Wiesen gewandert war, um Kräuter, Tierreste, Knochen zu sammeln. Die mischte er, stampfte sie zu Brei oder Pulver und fertigte daraus im eisernen Kessel über dem Feuer Elixiere. Die füllte er danach in kleine Fläschchen, beschriftete sie und stellte sie alle sorgsam und wohlgeordnet ins Regal. Es waren unterschiedliche Gebräue des Vergessens. Sie bestanden aus allem, was der König als Vergänglichkeit deutete: wie Pflanzen, die verblüht, und Überreste von Tieren, die verendet waren, Rinden, die nicht mehr an den Bäumen hingen, sondern auf der Erde bald zu solcher werden würden. Frühmorgens, wenn der Tau die Wiesen glitzern ließ, stand Alois Trachsler mittendrin und sammelte auch noch Tropfen, die sich in den Kelchen der Blüten gesammelt hatten. Sie waren ebenso Zeugen der Vergänglichkeit, denn sie würden schnell verschwinden, sobald die Sonne sie verdunsten ließ. Vergängliches sammeln, es konservieren, um daraus eine Mixtur herzustellen, die, hat man sie zu sich genommen, das Vergessen in Körper und Geist zu bewirken vermochte. Es war eines seiner wirksamsten Mittel, fand der König. Ging es einem Menschen in Trachslers Reich schlecht, stellte sich der alte Mann vor sein Fläschchenregal und überlegte, welches Mittel am besten zu verordnen sei: Vergessen gegen Schmerz, gegen Trauer, gegen schlechtes Gewissen, gegen Sünden, gegen Missgunst, gegen Liebeskummer stand auf den Etiketten in Krakelschrift geschrieben. Sobald er wusste, was er zu verabreichen hatte, setzte Alois seine Krone auf, stapfte zu den trauernden Patienten. »Jeden Morgen auf nüchternen Magen einen kleinen Löffel«, verschrieb er ihnen. Bisweilen kamen die hilfesuchenden Menschen auch zu ihm ins Häuschen. Selbst wenn man allgemein im Ort sagte, der alte Mann sei nicht ganz dicht im Kopf, so hatte sich dennoch schnell herumgesprochen, dass trotz all seines Irrsinns auch Wahres mit dabei sei.
Während der vergangenen acht Wochen hatte sich Alois Trachsler um einen besonderen Sud bemüht, warf alles Mögliche, was er finden konnte, in den Kessel, doch nichts war ihm gut genug, es war zum Verzweifeln. Er blickte auf das Gläschen, das er bereits beschriftet, aber noch nicht gefüllt hatte: Elixier des Verzeihens hatte er darauf geschrieben.
Der Bäckerssohn Lenz Binder probte während dieser beiden Monate mit den Schauspielern des Ortes das Hiaslstück. Die Mitwirkenden waren emsig, lernten ihre Texte und bemühten sich rechtschaffen, in die ihnen zugedachten Rollen zu schlüpfen. Zuvor, als es um die Auswahl des Stücks gegangen war, moserte so manch einer, es sei zu traurig, die jetzigen Zeiten seien ohnehin schwer genug, man hätte besser ein lustiges Stück wählen sollen. Doch Lenz blieb unbeirrt. »Leut, hier geht’s um Gerechtigkeit, denkt dran«, erklärte er ihnen. »Hier geht’s um die Bauern, um die Unterdrückten und um die Armen. Schaut’s uns selbst an, ist grad mal zwei Jahr her, dass wir ein Freistaat Bayern geworden sind, wir haben keinen König mehr. Wir waren eine Räterepublik, weil wir uns erhoben haben gegen die da oben. Wir haben die gleiche Geschichte wie vor zweihundert Jahren, damals war der Hiasl der Rebell, in unsrer Zeit war’s der Eisner. Und wie der Hiasl, ist auch der Eisner tot.«
»Mei, oh mei, du immer mit deine Rebellengschichten, alter Zeitungsleser mit deiner Politik«, murrte Benedikt Feistl. Er spielte im Stück den bösen kurfürstlichen Jäger, der dem Hiasl und seiner Liebe zur Moni Schaden zufügen wollte. Zu den Proben hatte er stets seinen feinen Sonntagsarm angeschnallt, darüber eine Joppe gezogen, sodass man nur noch die Kunsthand sehen konnte, die er, so oft es die Gelegenheit zuließ, mit seiner gesunden bedeckte. Benedikt Feistl konnte Lenz, den Frauenheld, nicht leiden, zu beliebt und fesch war der junge Kerl mit seiner fröhlichen Art. An dem Theaterstück wirkte Benedikt nur mit, um auf unverfängliche und einfache Weise Frauen zu treffen. Es stand dringend an, dass er sich mit seinen nunmehr dreiundvierzig Jahren um ein Weib bemühte. Jeder Hof brauchte eine Frau, auch der seine. Endlich hatte der Feistlbauer mit viel Mü