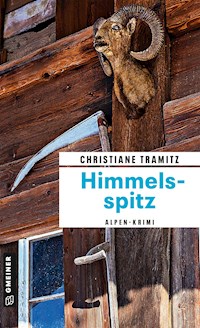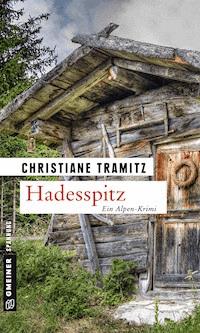9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
70 Jahre auf einer Alm in den bayerischen Bergen - die außergewöhnliche Lebensgeschichte einer bemerkenswerten Frau. Christiane Tramitz erzählt das Leben der Sennerin vom Geigelstein. Es ist eine Geschichte vom einfachen Leben im Gleichmaß der Jahreszeiten und in Achtsamkeit vor der Natur und von der Geborgenheit inmitten einer vertrauten Heimat. Weil sie Liebeskummer hatte, packte die damals siebzehnjährige Bauerntochter Maria Wiesbeck aus Samerberg 1941 ihren Rucksack, verließ den väterlichen Bauernhof und stieg auf zur Oberkaser-Alm in den Chiemgauer Alpen. Dort versorgte sie fortan als Sennerin das Vieh und kehrte seitdem nicht einmal in den harten Wintern ins Tal zurück. Die Alm-Wirtschaft wurde ihr Lebensinhalt. Sie lebte einfach und gesund im Einklang mit der Natur. Nun, am Ende dieses langen Lebens erkennt sie, dass das Vertraute mehr und mehr verschwunden ist. Auch auf der Alm hat das moderne Leben längst Einzug gehalten, und so manches davon bedroht die Natur. Die Biografie der Sennerin vom Geigelstein entführt die Leser auf eine anrührende Weise in die längst untergegangene Welt der traditionellen Alm-Wirtschaft inmitten einer Natur, die sich die meiste Zeit des Jahres lebensfeindlich zeigt. Dieses Leben ist alles andere als ein Idyll gewesen. Es war voller Entbehrungen und bot dennoch jene Geborgenheit, die wir heute Heimat nennen. * Das unvergleichliche Leben einer Sennerin in den bayerischen Bergen * Bedient die Sehnsucht nach einem ursprünglichen und unverfälschten Leben * Für die Leser von Anna Wimschneiders "Herbstmilch" und Dora Prinz´ "Ein Tagwerk Leben" Das perfekte Geschenk für alle Bergfreunde, Bergwanderer und Naturliebhaber
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Christiane Tramitz
Harte Tage, gute Jahre
Die Sennerin vom Geigelstein
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Weil sie Liebeskummer hatte, packte die damals neunzehnjährige Bauerntochter Maria Wiesböck aus Samerberg 1943 ihren Rucksack, verließ den väterlichen Bauernhof und stieg auf zur Oberkaseralm in den Chiemgauer Alpen. Dort versorgte sie fortan als Sennerin das Vieh und kehrte bis zu ihrem Tod im Juni 2017 nicht einmal in den langen Wintern ins Tal zurück. Sie führte ein einfaches und gesundes Leben im Einklang mit der Natur. Am Ende dieses langen Lebens erkannte sie, dass das Vertraute mehr und mehr verschwunden war. Die Erinnerungen an das Leben der Oberkasermare entführen die Leser auf eine anrührende Weise in eine längst untergegangene Welt, die alles andere als ein Idyll gewesen ist und dennoch jene Geborgenheit bot, die wir heute Heimat nennen.
Inhaltsübersicht
Widmung
Die alte Sennerin Mare [...]
Als das junge Mädchen [...]
Zur Winterszeit gibt es [...]
Bauer Adolf Finsterwalder sitzt [...]
Der Schadhubhof lag geborgen [...]
Der Tag ist gleißend [...]
Die Tage gingen ins [...]
Als die alte Sennerin [...]
Krieg, Bitterkeit und Nöte [...]
Es schimmert schwaches Licht [...]
An Mares erstem Tag [...]
Gleich am Morgen nach [...]
Die junge Sennerin wartete [...]
Gegen ihren Willen wurde [...]
Schnell ist der Trubel [...]
Es war Anfang September [...]
Es ist rabenschwarz auf [...]
Es war nicht Xaver, [...]
Kurz nachdem Conny vom [...]
Konrad trat in Mares [...]
Während das Leben auf [...]
Der Krieg war vorbei. [...]
Ausgerechnet der junge Finsterwalder [...]
Das Zusammenleben von Mare [...]
Der Tod mag Mares [...]
Was hat die Conny [...]
Frieden mit dem Leben [...]
Das Licht ist schwach, [...]
Auch wenn sie abgeschieden [...]
Adolf Finsterwalder hockt am [...]
Abschied von der Stille, [...]
Die Greisin steht barfuß [...]
Maria Wiesbeck ist nicht [...]
Die neue Oberkaserhütte sollte [...]
Die Zeit, so sagt [...]
Im Kopf ist Schwindel, [...]
Mare weiß, wie sie [...]
Unter Mutters Decke ist [...]
Anmerkung
Für Stephan – für gute Jahre
Die alte Sennerin Mare sitzt auf ihrem Stuhl und lauscht in die Stille. Im Herd zuckt die letzte Flamme, dann wird es finster im Raum. Ist schon die Nacht hereingebrochen? Mare weiß es nicht genau. Ihr ist auch egal, ob es Tag oder Nacht, Nacht oder Tag ist.
Der Berggeist huscht durch den Kamin herein und setzt sich ihr gegenüber. Mare fühlt es. »Jetza hock ma da«, sagt sie. »Ist Bettzeit oder net?« Der Geist bleibt stumm. »Ist dir kalt?«, fragt sie. »Musst dir was Warmes anziehn.« Sie zieht die Ärmel ihrer Jacke über die klammen Finger. »Feuer is aus, muss Holz sparn.« Eisiger Lufthauch strömt ihr ins Gesicht. »Weck mir die Hennen net auf«, flüstert Mare. Ihre Hand tastet quer über den Tisch, eine Schnapsflasche fällt um und kracht auf den Boden. »Pass doch auf!«, schreit Mare den Geist an. Dann sucht sie weiter. Ihre Hand tappt in ein Schälchen Katzenfutter. Sie leckt die Finger ab, sie schmecken nach Thunfisch. »Hast schon zu Abend gessen? Essen is wichtig, sonst verhungerst«, murmelt sie, zieht das Schälchen zu sich heran und fischt die Brocken heraus, bis es leer ist. Ihre Zunge schleckt den Rest Gelee aus. Dann stellt sie das Schälchen wieder auf den Tisch und wartet auf die Müdigkeit.
Draußen rieselt der Schnee. Die Adler haben sich in die Wipfel der Bäume verzogen, und der Wind peitscht die Wolken den dunklen Himmel entlang.
Für einen Moment erscheint der Mond über dem Berg, taucht ihn in milchiges Licht, die Kristalle der Schneedecke glitzern im Bergkessel. Dann wird es wieder finstere Nacht. Ein Fuchs umschleicht die Hütte, seine Spur verweht der Wind.
Mare löst ihre samtene Schleife aus dem Haar. »Bist noch da? Frierst net?« Schweigen in der Stube. Mare schüttelt den Kopf. »Herrje«, sagt sie, zieht ihre Jacke aus und schleudert sie auf die andere Seite des Tisches. »Zieh dir endlich was Warmes an, kriegst an Schnupfen.« Sie schält sich aus ihrer Lammfellweste und wirft sie in die Ecke. Eine Katze jault und springt von der Bank. »Miez, gib a Ruah«, schimpft Mare, »weckst mir die Hennen auf.«
Die Alte stöhnt leise, zieht die Schublade des Tisches auf und legt die Schleife hinein. Dann erhebt sie sich schwerfällig. »Muss die Taschenlampe suchn, nach dem Rechten schaun«, sagt sie. Mare tastet sich langsam durch die Stube rüber zum Bett. Sie sucht unter dem Kopfkissen und unter der Federdecke. Sie sucht auf dem Küchenboard zwischen all den Flaschen, sie wühlt im alten Butterkübel, in den Schubladen der Anrichte und in der Küchenschürze, die neben dem Herd hängt. »Gstohln habt ihr sie mir, ihr Gauner«, brummt sie. »Aber ihr werd’s schon sehn, ihr werd’s mi net unterkriegn, werd’s schon sehn.« Niemand antwortet, aber Mare weiß, dass sie in der Nähe sind. Alle, die ihr Böses wollen. Sie warten draußen vor der Hütte, dass Mare die Tür öffnet. Sie hocken vorne vor dem Gatter hinter einem Busch. Die Alte lächelt, setzt sich wieder auf die Bank und zieht die Schublade des Tisches auf. Die Schleife ist noch da. Mare nimmt ihre weißen Haare zwischen die Finger und bindet sie wieder mit dem samtenen Teil zusammen. Falls die Bösen doch noch in die Stube eindringen, will Mare fesch aussehen. Wenigstens das.
Die Sennerin schleppt sich zum Fenster, ihr Rücken schmerzt. Vor ein paar Tagen ist sie von der Leiter gestürzt und einen halben Tag auf dem Boden liegen geblieben, bis ihr die Zähigkeit wieder hochhalf. Ist es Tag oder Nacht? Die Bösen kommen nur nachts, die alten Feiglinge.
Mare entfernt all das Zeugs vom Fenster, das sie dort zur Sicherung angebracht hat. Aufeinandergestapelte Holzscheite, drei Pappendeckel, eine kleine Holzplatte. Sie legt alles sorgsam auf die Bank. »Is scho Nacht?«, fragt sie in die Stille und öffnet vorschichtig das Fenster ein paar Zentimeter. In der Stube bleibt es dunkel, eisige Luft weht herein. Die Sennerin zieht ihr Messer aus der Hosentasche. »Weißt, i stech sie alle ab, wenn sie kemman«, zischt sie dem Berggeist über die Schulter hinweg zu. Die Katze springt auf das Fensterbrett und reibt ihren Kopf an Mares Arm. »Lass mi«, sagt die Sennerin und versetzt ihr einen Schubs. Dann schiebt die Alte ihre Hand vorsichtig durch den Fensterspalt, bis sie im Schnee stecken bleibt.
Es ist ein harter Winter, droben am Geigelstein. Die Flocken fallen so heftig und dicht wie schon lange nicht mehr. Am Himmel leuchten keine Sterne, und der Mond ist hinter den schweren Wolken verschwunden. Die Tiere haben sich längst verkrochen, liegen irgendwo zusammengerollt unter den Tannen. Auch der Fuchs hat sich getrollt. Einsamkeit fällt über den Berg. Stillstand der Wildnis.
Nur der Wind weht. Er lässt die Flocken tanzen und zaubert Muster auf den Schneeteppich.
Mares Hände tasten sich durch den Fensterspalt, tauchen in die Tiefe des dichten Weißes. »Eingschneit samma wieder. Herrgott, wie soll man da wissen, ob Tag oder Nacht is?«, murrt sie, schließt das Fenster wieder, schiebt das Holzbrett davor, dann die Pappe und befestigt alles mit den Holzscheiten. Die Sennerin beginnt zu zittern. Auf der Suche nach ihrer Jacke tappt sie durch die Finsternis. Eine Henne flattert gackernd über den Boden, nachdem Mares Fuß sie gestreift hat. »Pass doch auf«, schimpft die Alte. Dann lässt sie sich wieder auf der Bank nieder und stützt die Ellbogen auf dem Tisch auf. »I glaub, es is Nacht«, sagt sie zum Geist. »I leg mi nieder, der Schlaf werd scho kemma. Pass auf, dass mi neamand erschießt, wach über mi.« Sie schleppt sich rüber zum Feldbett, kriecht unter ihre Decke und rückt das Kopfkissen zurecht. »Kimm Miez, is so kalt heut Nacht.« Mit der Katze im Arm schließt sie ihre Augen, hofft auf Wärme und einen schönen Traum. Der Wind pfeift durch den Schornstein und bläst kalte Luft über Mares Gesicht. »Bist heut aber recht frisch«, sagt sie zum Geist. Es sind ihre letzten Worte in dieser unheilvollen Nacht.
Die Sennerin ist in ihrer alten Hütte schon längst hinweggedämmert, als über ihr, oben am Kamm des Bergkessels, der Wind sein wildes Spiel beginnt. Er stößt den Schnee mal hier-, mal dorthin, formt kleine Bälle und lässt sie in die Tiefe rollen. Sie hüpfen und tanzen wie Derwische, werden immer mehr und mehr. Auf ihrem Weg nach unten zu Mares Hütte sammeln sie auf, was sie fassen können, werden größer und schneller. Bald haben sie sich zu einer rasenden Walze gen Tal vereint.
Als die Lawine mit lautem Getöse über die Oberkaseralm hinwegdonnert und alles unter sich verbirgt, was von der Hütte noch zu sehen ist, träumt die Sennerin, der Krieg sei über ihre Heimat gekommen. So wie damals, als sie noch ein junges Mädchen war. Sie hört die Bomben, das Krachen und all das Zerstören. Sie sieht die Hungernden, die Bettelnden, die vielen Toten unter Schutt und Mauerwerk. Die Männer aus ihrer Samerberger Heimat verschwinden nach und nach. Nur wenige von ihnen kehren zurück. Das Elend ist wieder da. Mare träumt, wie sie einst beschloss, dass dies nicht mehr ihre Heimat sei. Sie sieht, wie sie ihren Rucksack packt, mehrere Hennen in Holzkäfige steckt, in einen weiteren zwei kleine Kätzchen. Dann macht sie sich zusammen mit ihnen und zwölf Kühen, drei Kälbern, vier Schafen und zwei Mulis auf den Weg, hoch zur Alm am Geigelstein. Und kehrt nie wieder zurück.
Als das junge Mädchen aufwachte, war ihm kalt unter der dünnen Wolldecke. Die klammen Hände lagen zusammengefaltet auf dem Bauch, als hätten sie nachts zu Gott gebetet, er möge die Schwester aus dem gemeinsamen Bett zaubern. Gott könne zaubern, er sei der größte Zauberer der Welt, sagte Großvater immer. »Musst nur an ihn glaubn, dann werd scho ois wern.« Mare drehte ihren Kopf nach links. Diana hatte ihr den Rücken zugewandt und schlief noch, die einzige dicke Bettdecke, die sie beide gegen die Kälte hatten, fest um sich geschlungen. »Diana, i frier«, flüsterte Mare und zupfte am langen Zopf der Schwester. Draußen war es noch dunkel, dennoch hatte der Tag auf dem Schadhubhof schon begonnen. Der Hahn krähte, Mare hörte die Stalltür knarzen und Eimer scheppern. Knecht und Magd waren bereits unterwegs zu den Kühen, zum Melken. Vor dem Fenster rieselte der Schnee, wie schon am Abend davor, wie auch am Vortag und den letzten vergangenen Wochen. 1938 war der Winter auf dem Samerberg lang und hart wie immer. Die Menschen kannten es nicht anders in der kargen Hochtalregion. Dort setzten sich Nebel und Wolken zwischen den Bergen fest, der Samerberg war die Heimat des Regens und des Schnees, sobald die Kälte über ihn fiel.
Mare schlang die Hände um den Oberkörper und winkelte die Beine an, der kalte Morgen war erbarmungslos. Bald würde sie eine eigene dicke Decke bekommen, wie Diana eine besaß. Doch für die mussten die Federn und Daunen erst noch zusammenkommen. Nach so manch eisiger Nacht fasste sich Mare morgens an Nase und Ohren, um zu spüren, ob noch alles dran war. Ihrem Vater nämlich hatte die hartherzige Kälte Finger und Zehen geraubt, während er als junger Soldat in den Dolomiten das deutsche Vaterland verteidigte. Nach Kriegsende und seiner Rückkehr auf den Samerberg blieb er zehn Jahre auf dem Schadhubhof und bekam mit ihrer Mutter Edith drei Kinder: Franz, Diana, Mare. Er arbeitete hart, auch wenn ihn seine verstümmelten Füße nur mühsam trugen und ihn jede Bewegung Überwindung kostete. Eines Winters, als auf dem Samerberg der Schnee meterdick lag und fast bis zum ersten Stock des Hofes hinaufreichte, verließ der Vater das Haus. Ohne Stiefel, ohne Jacke, ohne Abschied. Am nächsten Morgen hatten sich seine Spuren im Schnee verloren, seine Leiche wurde erst im späten Frühjahr nach der Schmelze gefunden.
Es lag ein Jahrzehnt zurück, Mare war damals gerade einmal vier geworden, als man ihren Vater beerdigte. Sie war zu jung gewesen, um das Sterben zu begreifen, und so verblassten ihre Erinnerungen an ihn schnell.
Langsam kroch die Morgendämmerung durchs Fenster, an dem Eisblumen klebten. Mare hörte, wie nebenan der Dielenboden knarzte, ihr Bruder Franz war aufgestanden. Gestern hatte der Großvater mit ihm gestritten, weil er auf dem Hof einfach nicht zu gebrauchen war. Sie saßen alle zusammen in der Küche um den großen Tisch herum und sprachen über die Dinge, die auf der Welt gerade geschahen. Großvater Wiesbeck, ihm gegenüber Edith, die Wiesbecktochter, eine schmucke Frau, die stets eine gebügelte Bluse und blitzsaubere Schürze trug. Die dunklen Haare hatte sie zu einem schönen Kranz geflochten. Mare und Diana, Ediths junge Töchter, saßen an der linken Seite über Eck. Diana, die kräftige, wohlgeformte, mit blonden Locken und strahlenden Augen. Mare, schlank und hochgewachsen mit aufrechtem Oberkörper, das dichte, braune Haar zu Affenschaukeln gebunden.
Franz, der Bruder mit dem weichen Gesicht und den scheuen Augen hockte neben Edith und blickte auf seine Hände, die ein Buch hielten. »So was wia du will Bauer wern. Schau di an, nix als Lesen im Kopf«, schimpfte Großvater. »So weit werd’s eh net kemma, Großvater, weil bald ois aus und vorbei is bei uns in der Heimat, wenn’s so weitergeht«, antwortete Franz leise. Großvater schüttelte den Kopf. »Was redst? Es bleibt ois, wia’s is und wia’s war. Nix, gar nix, werd anders!« Und dann zeigte er auf die alte Anrichte. »War immer da, seit meinem Vater und meinem Großvater.« Der Finger des alten Wiesbecks wanderte weiter durch den Raum, hin zum eisernen Herd, auf dem ein Kessel Wasser stand. »Den Ofen, mei Bub, den kenn i, seit i klein bin, den hat mein Vater einbaut. Und der Kessel do, is so oid wia i. Der Tisch drüben in der Stube, die Kommode und der Webstuhl, ois von der Oma, oids Erbe, des woaßt doch selbst. Bub, es werd so bleibn hier am Schadhubhof«, sagte der alte Wiesbeck streng.
Franz legte das Buch beiseite. »Mei Großvater, deine Welt is net die jetzige Welt, es is a oide Welt, die vorbei is«, sagte Franz, wandte sich zum Radio und schaltete es ein. Eine schnarrend blecherne Stimme ertönte. Bevor sie den ersten Satz beenden konnte, donnerte Großvaters Faust so heftig auf den Tisch, dass alle zusammenzuckten. »Ausmachen, den Dreckskasten, diesen depperten Volksempfänger. Hier in meinem Haus sitzen koane Volksempfänger net!«, brüllte er. Franz stand auf, wortlos verließ er die Stube.
Herrschaft Franzerl, net den Großvater ärgern, dachte Mare. Sie liebte ihren Bruder, der zwei Jahre vor ihr auf die Samerberger Welt gekommen war, hier auf dem Schadhubhof, so wie alle Nachkommen der Familie Wiesbeck. Er war der beste Bruder, den sie sich vorstellen konnte, immer lieb und sorgsam war er. Nie brüllte er oder tat ihr oder Diana etwas Unrechtes. Franz war nicht so wie viele andere Burschen im Ort, nicht so ungestüm, eher still, fast schüchtern.
War schon Zeit zum Aufstehen? Die Schwester atmete ruhig, Mutter Edith klapperte in der Küche mit den Töpfen. Mare schlüpfte aus dem Bett. Als sie ans Fenster trat, sah sie Großvater und Franz die Milcheimer ins Haus schleppen. Die Schwärze der Nacht verzog sich langsam, matt lag der Schnee zwischen den Hügeln.
Mare zündete eine Kerze an und kramte in der hölzernen Truhe nach Kleidungsstücken. Sie suchte nach den dicken Socken, die sie selbst gestrickt hatte, nach ihrem blauen Wollpulli und dem langen Rock. Dann blies sie die Kerze wieder aus und versicherte sich mit einem langen Blick, dass Diana schlief. Mare, die langsam vom Mädchen zur Frau reifte und Scham verspürte, weil ihre Brüste wuchsen, wollte ihr Nachtgewand im Schutz der Dunkelheit abstreifen. Einen kurzen Moment stand sie, wie Gott sie erschaffen hatte, vor dem Spiegel und fragte sich, ob Xaver sie jemals so entblößt sehen würde.
Eine knappe Stunde später stapften die Schwestern auf einem kleinen Weg ins benachbarte Dorf, wo die Schule lag. Links und rechts neben ihnen türmten sich die Schneemassen zu kalten Wänden auf. Unter den Stiefeln der jungen Wiesbeckmädchen knarzte es bei jedem Schritt. Als Mare das Schulhaus im Dämmerlicht auftauchen sah, begann ihr Herz zu hüpfen, weil sie Xaver an der Eingangstür stehen sah. Sie wagte nicht zu hoffen, dass er auf sie wartete.
Als Mare an ihm vorbeiging, begegneten sich ihre Blicke einen Wimpernschlag lang. Xaver, der Bursche vom Mooshof, hatte die schönsten Augen, die Mare jemals gesehen hatte, dunkel und glänzend wie der Schwarzsee. Der Sohn des Moosbauern war ein paar Jahre älter als Mare, groß und stark gewachsen, mit schwarzen Locken und stets einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Er war der fescheste und begehrteste Kerl weit und breit, alle Mädchen bekamen leuchtende Augen, sobald sie ihm begegneten. Wenn Mare in der Gegend unterwegs war, im Dorf beim Einkaufen, in der Kirche oder bei einem der zahlreichen Vereinsfeste, die es auf dem Samerberg gab, traf sie Xaver stets in Begleitung irgendeines anderen Mädchens aus der Gegend, und im Gesicht eines jeden las Mare Stolz und Glück. Xaver, unstet und untreu, wie er schien, ließ die Mädchen nie lange an seiner Seite verweilen, und hatte er die eine für die andere verlassen, kam es unter den jungen Samberbergerinnen zum Gerede, wer wohl die Nächste sein dürfte.
Mare, die Bauerstochter vom Samerberg, hatte gerade ihren vierzehnten Geburtstag erlebt, als sie ihre erste Liebe spürte. Das war im Jahr 1938, in einer Zeit, in der sich alles im Wandel befand, draußen in der weiten Welt wie auch droben auf dem Samerberg und tief drinnen in Mares Herz.
Zur Winterszeit gibt es Tage auf dem Geigelstein, da verschwindet alles, was die Menschen dort geschaffen haben, unter einem großen weißen Teppich, und der Berg ruht still und mächtig wie ehedem. Kaum etwas erinnert daran, dass dort ein paar Almen stehen, einzig deren Schornsteine lugen wie steinerne Pilze aus der dichten Schneeschicht hervor.
Als die alte Frau aus ihrem Traum erwacht, umfängt sie Stille. In der Stube ist es immer noch so dunkel, als wäre finstere Nacht. Eine Weile liegt Mare in ihrem Bett und denkt nach, ob es der Herrgott heute gar nicht mehr Tag werden lässt. Es ist stickig, Mare klebt die Zunge am Gaumen vor Durst. Langsam erhebt sie sich und setzt sich aufrecht hin. Leichtes Schwindelgefühl überkommt sie, als sie ihre nackten Füße auf den Steinboden stellt und sich an der Wand nach oben schiebt. »Brauch a Luft.« Sie geht ein paar Schritte in die Richtung, in der sie die Eingangstüre vermutet. Sie hat die Orientierung verloren. Sie ertastet die Gefriertruhe, schlägt mit der Faust auf den Deckel. »Saublödes Stück, i brauch di net«, flucht sie. Als sie irgendwann die Spüle erreicht, dreht sie den Hahn auf und lässt sich kaltes Wasser in den Mund laufen. »Ahhh«, sagt sie und wischt sich die Lippen ab. Dann schleppt sie sich quer durch die kleine Stube, lässt sich auf der Bank nieder und wartet auf das, was geschehen könnte. Sie lauscht in die Stille. Es ist niemand da. »Ha«, sagt Mare und grinst stolz, »seid’s net einikemma in derer Nacht, ihr Terroristn.«
Der Tag soll endlich kommen und ihr Licht machen. Die Sonne soll scheinen und sie im kalten Winter wärmen. Mare zittert am ganzen Leib, und die Blase drückt. Die alte Sennerin umkreist den Tisch, zieht die Pyjamahose herunter, hockt sich in die Ecke unter dem Herrgottswinkel nieder und lässt es laufen. »Sauerei«, murrt sie, als Warmes die Füße entlangrinnt, und erhebt sich wieder. »Feuer machn, Tee kochn«, flüstert sie. »Muss die Kerzen findn, Herrschaft, haben’s die mir wieder klaut?« Sie öffnet alle Schubladen, die sie ertasten kann. Mehr als eine Kerze fällt ihr nicht in die Hände. Mare sucht weiter nach den Zündhölzern. Sie schlägt sich an jeder Ecke und Kante ihre Gliedmaßen an, es schmerzt. Endlich findet sie, was sie braucht, auf dem hinteren Eck des Herdes. Sie zündet ein Hölzchen an und sieht sich in der Stube um. Die Hennen hocken unter der Bank und schauen sie mit schief gelegten Köpfen an. Miez ist weg, der Deckel der Tiefkühltruhe zu, die Tür verrammelt, auch die Holzscheite, die sie vor das Fenster geschichtet hat, liegen unverändert an ihrem Platz. Dann wird es wieder dunkel. Mare zündet ein zweites Hölzchen an, schlurft zurück an den Tisch und hält das Feuer an den Docht der Kerze. Sie lächelt, als die Flamme aufflackert. Nachdem sie sich einen Fleecepulli übergezogen und gegen die Kälte eine alte Plastikfolie um Nieren und Bauch gebunden hat, packt sie den Weidenkorb, öffnet die hintere Stubentür und tastet sich durch den kurzen Gang nach hinten in den Stall. Dort setzt sie sich auf den Holzblock, der links am Eingang steht, und blickt in die schwarze Leere. Seit Jahren schon ist der Stall verwaist, riecht aber noch immer so gut nach all den Tieren, die er einst beherbergt hat. Die Sennerin schlingt die Jacke eng um sich und schließt die Augen. Sie kann ihre Viecher vor sich sehen, wie sie in Reih und Glied dastehen, an den Ketten ziehen und darauf warten, dass Mare sie endlich ins Freie lässt. Sie stampfen mit den Füßen und schnauben ungeduldig, links vorne Kathie und Berta, die alten Milchkühe, die Mare erst melken muss, bevor sie die Ketten löst, die Stalltür öffnet und alle Tiere nacheineinander auf die Almwiesen treibt. Immer wenn Mare mit geschlossenen Augen auf dem Holzblock sitzt, kehrt das alte Leben in den Stall zurück. Es duftet nach Heu, Milch und Mist, ist warm und vertraut, auch jetzt, da sie am ganzen Leib schlottert. Die Sennerin legt ein paar Scheite in den Korb. »Is Winterzeit, gibt koa Gras draußn, müsst drinnenbleibn, bei mir«, murmelt sie und kehrt zurück in die Stube, wo sie den Korb neben den Ofen stellt. »Heit is gar so kalt und gar so still.« Mare ist immer noch durstig und zu ungeduldig, um darauf zu warten, bis das Feuer brennt und das Teewasser kocht, und so zieht sie aus einem Kasten, der auf dem Boden steht, eine Flasche Bier. Es zischt, als Mare den Klappbügel öffnet. Da fällt ihr plötzlich das Geld ein. Ist es noch da? Sie nestelt an der Innenseite ihrer Jacke herum, findet die drei Sicherheitsnadeln, mit denen sie im Stoff eine Art kleine Tasche zusammengesteckt hat. Vorsichtig öffnet sie eine Nadel nach der anderen, bis sie die Geldscheine spürt. »Ois no da.« Mare ist beruhigt. Mit klammen Fingern breitet sie die Scheine vor sich auf dem Tisch aus und zählt: einhundert, zweihundert, dreihundert, vierhundert, fünfhundert. Des werd erst mal reichn, denkt sie. Damit kann sie jeden bezahlen, der sie noch besuchen kommt und ihr Kleidung, Getränke oder etwas zu essen mitbringt.
Eine Maus huscht über den Boden, Mare packt die Kerze und schleudert sie nach ihr. »Weg da«, flucht sie. Und wieder ist es dunkel in der Stube, die Sennerin horcht angestrengt. Sind die Terroristen da? Bestimmt! Hastig sammelt sie das Geld vom Tisch, stopft es zurück in die Jacke und sucht nach den Sicherheitsnadeln, um alles zu befestigen. »Mei, was für a Tag, so a stiller und finsterer.« Die Katze springt ihr auf den Schoß und rollt sich schnurrend ein. »Miez«, sagt Mare leise, »warum sagst mir net, ob’s die Terroristn da draußn hast umanander gehn sehn. Weißt, die wolln mi erschießn und di und die Hennen auch. An jeden von uns wolln’s erschießn, damit wir endlich weg san von da herobn.« Dann schweigt die Alte, nimmt noch einen Schluck Bier und wischt sich den Mund ab.
»Di wern’s auch erschießn«, sagt sie schließlich zum Berggeist. »Wer will scho so einen in der Hütte haben? Bist dann a toter Geist.« Mare schüttelt den Kopf. »A toter Geist, des is scho was Bsonders.«
Ein Klingeln fährt durch die Stille. »Psst!« Mare legt ihre Hand auf den Kopf der Katze und starrt in die Richtung, in der sie das Telefon vermutet, drüben, am Ende des Tisches. Vielleicht ist es Rosa, denkt sie. Rosa hat schon lange nicht mehr angerufen, Rosa, die Informantin, die alles weiß. Mares Hände wandern auf dem Tisch umher, bis sie an das Telefon stoßen. Die Sennerin hebt ab und hält sich den Hörer ans Ohr. Nix sagen, denkt sie, nur hören, wer’s sein könnt.
»Mare«, sagt die Stimme, »Mare, lebst no?«
Die Sennerin versucht, der Stimme am anderen Ende der Leitung ein Gesicht zuzuordnen. Wer ist dran? Rosa kann es nicht sein, denn es ist eine Männerstimme, die da spricht.
»Mare, bist da? Hör mir jetzt mal guad zu. Brennt dei Ofen?«
Die alte Frau schweigt.
»Du derfst koa Feuer im Ofen machn, verstehst, Mare, koa Feuer. Des überlebst net. Mare, jetzt sag halt was, i bin’s, der Sepp, kennst mi doch.«
»Ah, der Sepp«, antwortet Mare.
»Hör zu Mare, zünd a paar Kerzn an und schau, ob sie anbleibn oder ausgehn.«
»Wieso? Hab i eh scho gmacht, jetzt is sie aber wieder ausgangn.«
»Wieder aus? So a Mist, Mare, wia lang hat denn die Kerzn brennt?«
»Net lang, wegen dera Maus«, flüstert Mare.
»Wegen dera Maus?«
»Ja, aber i hab sie net troffn, des Scheißvieh, macht so an Dreck bei mir herin.«
»Mei, Mare. Is recht kalt bei dir?«
»Scho«, sagt sie. »Jetzt hab i aber koa Zeit mehr zum Ratschn, Sepp, muss putzn.«
»Nix putzn, Mare, jetzt zündest erst mal Kerzn an, hast überhaupt noch welche?«
»Woaß net, find sie net.«
»Such die Kerzn, zünd sie an und wart a Weil. Wenns net ausgehn, derfst einheizn.«
»Was hast denn Sepp? Was spinnst denn so mit dem Einheizn, will doch net erfriern. Und was hast mit dene Kerzen?«
»Sag amal, weißt net, was passiert is bei dir drobn auf dem Geigelstein?«, brüllt Sepp jetzt derart durch das Telefon, dass es sogar der schwerhörigen Mare zu laut wird.
»Was soll hier scho passiert sein, außer dass Terroristen vorm Haus san.«
»Hör auf mit dem Schmarrn, kannst eh nix sehn, mach amal die Tür oder das Fenster auf, da siehst nix. Nur Schnee. Überall is Schnee, auch auf deinem Dach und über deinem Kamin, überall. Mare, kapierst es endlich, a Lawine is über di drübergsaust. I woaß des von den Priener Hüttnleit, die haben mi angrufen wegen dir. Sie kemman net hoch zur Oberkaser. Und jetzt bist drunter, unter dem vielen Schnee. Und wennst jetzt einheizt, dann erstickst mir. Deswegen die Kerzen, damit siehst, ob noch von irgendwo a Luft herkimmt.«
Endlich ist Sepp fertig. Mare atmet geräuschvoll aus. Eine Lawine, mein Gott, bloß a Schnee? Sie streichelt der Katze über das Fell und lächelt. Nur a Lawine.
»Mare, bist noch dran? Sag doch was!«
Die Sennerin legt den Hörer auf die Gabel und schubst die Katze vom Schoß. Auf allen vieren kriecht sie den Boden entlang, bis sie die Kerze unter der Bank findet. Irgendwann bekommen ihre Finger auch die Streichhölzer zu fassen. Mare stellt die brennende Kerze auf die Bank, geht zum Herd, klappt das Türchen auf und schiebt Zeitungsseiten und Holzscheite hinein. Dann zündet sie alles an. Der Kamin faucht kurz auf, die Flammen lodern hell, bis der Ofen schwarzen Rauch ausspuckt. »Bist wieder da, Berggeist? Hab di net so wegen an Feuer«, brummt Mare. Sie beugt sich zur Ofenluke und bläst hinein, und obwohl Rauch in ihre Lungen dringt, pustet die Sennerin weiter und weiter. Beißender Gestank durchdringt die Stube. Mare nimmt den Schürhaken und stochert zwischen den angekokelten Hölzern herum, dann holt sie wieder tief Luft und bläst erneut. »Geh an«, zischt sie. Ein zweites Streichholz glimmt auf und wird in die schwache Glut geworfen, ein Papierstück hinterher. Für einen kurzen Moment wird es wieder hell im Herd, dann erlischt alles.
Mare flucht. »Wenigstens du brennst«, sagt sie zur Kerze auf dem Tisch. Die Sennerin öffnet das Fenster, um den Rauch hinauszulassen. Doch der prallt nur gegen die weiße Schneewand, die die Lawine dorthin geschoben hat, und kehrt zurück. Mare schließt das Fenster. Sie braucht eine Pause, muss überlegen. Keuchend sitzt sie am Tisch, kann durch den schwarzen Nebel den Herrgottswinkel kaum erkennen. »Willst, dass i erstick?«, fragt sie den Heiland. »Und die Hennen und die Katz auch?« Sie schüttelt den Kopf. »Bevor i ausm Lebn geh, mach i a Ordnung hier, so hinterlass i mei Hüttn net.« Sie räumt das verschmutzte Geschirr vom Tisch auf die Bank, wirft die leeren Katzenfutterdosen in die Ecke. Ein Hustenanfall lässt sie innehalten, bevor sie mit ihrem Handrücken die Brotkrümel von der Tischplatte auf den Boden fegt. »So«, sagt sie, als der Tisch von allem Müll befreit ist, »jetzt kimmt der Boden dran«, und krabbelt die Stube ab. Keuchend und schimpfend fegt sie Mäusekot, Hennendreck, Stroh, Katzenfutter zusammen. »Herrgott, was scheißt ihr da auch überall so umanander?« Die beiden Hühner verlassen ihre Nester und stieben gackernd durch den Raum. Zwei Eier landen in Mares klammer Hand. »So ist’s brav«, sagt sie und steckt sie in die Jackentasche. Der alten Frau wird schwarz vor Augen, ihre Arme knicken ein und sie sinkt mit dem Oberkörper auf den Boden. »Is jetzt soweit?«, fragt sie den Berggeist. Nun geben auch ihre Beine nach, ihr zerbrechlicher Körper kippt zur Seite. Der Boden ist kalt, die Luft bleibt wie ein stinkender Pfropfen in Mares Kehle stecken und die Kälte kriecht ihr durch den Leib wie der eisige Tod.
Bauer Adolf Finsterwalder sitzt mit seiner Frau Brigitte im Wohnzimmer und sieht fern. Vor ihm steht eine Flasche Bier, der Tag klingt geruhsam aus. Der Kachelofen ist eingeheizt, es ist wohlig warm in der Stube, Brigitte strickt für ihren Mann einen Pulli. Man zeigt Bayernnachrichten, Berichte aus der Region. »Verehrte Zuschauer, wir sind jetzt vor Ort auf dem Geigelstein in eintausendsechshundert Meter Höhe«, sagt der Reporter in einer wattierten Jacke. »Hier ist vergangene Nacht eine heftige Lawine abgegangen und hat die Sennerin Maria Wiesbeck unter sich begraben. Wie Sie selbst erkennen können …« , die Kamera schwenkt auf eine große, rußige Fläche, die sich wie ein Krater mitten im Bergkessel abzeichnet, »… ist hier nichts mehr zu sehen außer Schnee und Ruß.« Die Kamera folgt dem Finger des Reporters. »Dort befindet sich die Alm der in der Region bekannten Maria Wiesbeck, auch Oberkasermare genannt. Mit ihren vierundachtzig Jahren dürfte sie die älteste Sennerin Deutschlands sein. Seit achtundsechzig Jahren lebt sie hier auf dem Geigelstein.« Kameraschwenk nach unten. »Die weiter unten gelegenen Hütten hatten Glück, sie sind vom Lawinenabgang nicht betroffen.«
Adolf Finsterwalder nickt zufrieden. »Gut so«, sagt er. Seine Frau sieht ihn lange an. Alt ist er geworden, denkt sie, als sie sein scharfkantiges, faltiges Gesicht und den grauen Schnurrbart mustert. Aus seinen ehemals entschlossenen Gesichtszügen sind unerbittliche geworden, die Augen kalt. Brigitte weiß nicht, was ihn so hat werden lassen. Ging es ihnen doch noch immer vergleichweise gut. Noch standen Kühe im Stall, noch konnten sie und ihr Sohn Martin von dem Geld leben, das der Hof erwirtschaftete. Im Jahrzehnt des Bauernsterbens war die Existenz als Landwirt eher dem Glück, einem Wunder und dem eigenen Durchsetzungswillen zu verdanken als der Liebe zum Beruf. Die meisten Bauernhöfe der Region sind inzwischen verwaist. Die Landwirte haben aufgegeben, das Geschäft innerhalb der EU ist zu hart, zu kompromisslos, zu stark reglementiert. Überleben können nur noch die ganz Großen. Adolf Finsterwalder zählt zu ihnen.
»Is aus und vorbei, so a Lawine, die überlebt eh koana, auch die Mare net, Gott hab sie selig. Gitti, i glaub, jetzt is soweit«, sagt Adolf.
Die Frau legt das Strickzeug beiseite. »Meinst, Adi?«, fragt sie.
Der Finsterwalder zwirbelt mit den Fingern seinen Bart nach oben. »Der Herrgott hat die Mare sowieso alt wern lassn. Irgendwann mal is halt Schluss.«
»Woher willst wissn, dass die Mare tot ist?«
»Hast die Bilder doch selbst gsehn, alles schwarz. Die Hüttn ist abbrennt oder zammdruckt worn. Wer überlebt des scho?«
Die Bäuerin nimmt die Nadeln wieder in die Hand. »Bist herzlos, Adi«, sagt sie kopfschüttelnd. »Kanntest die Mare schließlich dein Lebn lang. Und jetzt redst so daher.«
»A jeder muss mal von der Erdn gehn, besser hätt’s die Mare net erwischn kenna als so, dahoam und im Schlaf sterbn.«
»Wir melden uns wieder, sobald die Rettungsaktion abgeschlossen ist«, beendet der Reporter seinen Bericht. Ein letzter Schwenk über die Berge hinüber zum Wilden Kaiser. Es folgt Werbung für ein Skigebiet, Waschpulver, blickdichte Jalousien und Kinderschokolade.
»Na«, murrt der Bauer, »besser für die Alte wär’s, sie tät nimmer lebn, kann man ja nimmer als ein Lebn bezeichnen, nur noch als a Hausn. Gitti, woaßt doch, wias da droben ausschaut in derer alten Hütten. I tat lieber sterbn, als so zu lebn, in dem Dreck und Müll. Na ja, Gott hat sicher an Erbarmen ghabt und die Oide zu sich gholt.«
Die Bäuerin schüttelt den Kopf. »Adi, vielleicht hat die Mare so lebn wolln, wia sie glebt hat, auch zum Schluss.«
»Gitti! Wolln? Sie hat nimmer anders kenna«, gibt Adolf zurück. »Net mal unser Vieh im Stall, net mal die Schweine lebn so. Da tät uns das Veterinäramt ganz schee aufs Dach steign.«
»Trotzdem«, entgegnet Brigitte, »wer sagt dir, dass die Mare net glücklich war, so wia sie glebt hat?«
Adolf zuckt mit den Schultern. »Is auch wurscht, jetzt is es sowieso vorbei. I werd mit der Erbin redn wegen dem Almkauf. Und dann ghört die Alm bald zum Finsterwalderhof. Zeit is worden, wir brauchn den Grund.«
Brigitte schüttelt den Kopf. »Adi, wieso willst jetzt auch noch die Oberkaser? Mir habn doch gnug. Macht nur noch mehr Arbeit.«
Adolf Finsterwalder lehnt sich im Stuhl zurück. »Wenn mia net größer wern und no mehr Viech kaufn, wern auch wir nimmer lang überlebn, Frau. Wir brauchen mehr Weidefläche, hier und oben auf der Alm. Außerdem kannt der Martin droben a Schankrecht kriagn. Was moanst, was des für a Pulver bringt, bei dene viele Wanderer, die jeden Tag auf den Geigelstein kemman. Der Martin soll a Wirtschaft aufmachn, da wern sie sich umschaun auf der Priener Hütte.«
Brigitte zieht eine Augenbraue hoch. »Der Martin? A Wirtschaft, moanst, die läuft da drobn?«
»Und wia, das letzte Haus vorm Gipfelaufstieg, da macht vorher und nachher jeder a Rast. Und dann gibt’s ois bio, Schinkn, Speck, verstehst, siehst ja, wia narrisch die Leute drauf san.
»Jetzt wart doch erst mal ab, ob die Mare überhaupt gstorbn is, mei Adi.«
»Die is gstorbn! Und wenn net, Gitti, dann ko es nimmer lang dauern, so wia die da drobn haust. Erfriern werds oder verhungern, oder so sterbn, wias so oide Leit halt tun. Oid gnua is sie.«
Brigitte Finsterwalder beschließt zu schweigen. Diskussionen mit ihrem Mann sind stets zwecklos.
Noch am selben Abend bestimmt Adolf Finsterwalder, dass sich sein Sohn Martin anderntags auf den Geigelstein zu begeben hat, um nach dem Zustand der Hütte zu sehen. Alles soll nun möglichst schnell gehen, der Bauer weiß, dass er nicht der Einzige ist, der sich für Grund und Hütte der alten Mare interessiert. Bald, sehr bald schon würde er Emmi Ecke aufsuchen, die Erbin der Oberkaseralm.
Der Schadhubhof lag geborgen in einer Mulde, seit Generationen unverändert. Alles sollte so bleiben wie immer, am Gewesenen festhalten wollte der alte Wiesbeck. Die Zukunft und sämtliche Veränderungen, die diese mit sich bringen wird, können nicht besser sein als die Gegenwart, sagte er immer. Seit des alten Wiesbecks Kindheit hatte sich an Haus und Hof fast nichts geändert. Der dunkle, kühle Eingang, in dem man früher das Getreide getrocknet hatte, war ausgestattet wie einst. Gerätschaften und Rucksäcke hingen an den Wänden, Schuhe standen in Reih und Glied, und über der alten Truhe hing ein Kruzifix. Die Stube, die links vom Gang abging, war spärlich eingerichtet, dennoch strahlte sie Gemütlichkeit aus. Vor den kleinen Fenstern baumelten geblümte Vorhänge, im Eck stand der alte Tisch, in dessen Schublade die Zahl 1834 geschnitzt war, der Tag, an dem er entstanden war. Um den großen grünen Kachelofen zog sich eine Bank, auf der buntbestickte Kissen lagen. Die Wände zierten Familienfotos, Hochzeitsbilder von den ganz alten Wiesbeckvorfahren, Kinder- und Kommunionsbilder von deren Nachkommen. Weiter hinten im Flur auf der linken Seite lag die Küche, der Mittelpunkt der Familie, Mares Lieblingsort in ihrer kleinen Heimat. Im Herd knisterte das Feuer, es roch so gut, wenn Mutter Edith kochte oder buk. Auf einer alten Anrichte standen weiße Keramikgefäße mit blauer Beschriftung für Mehl, Zucker und Salz. Im oberen Stockwerk befanden sich vier kleine Schlafstuben, eine für den Großvater, eine für Edith, in der dritten schlief Franz, in der vierten Diana und Mare. Mehr als ein Bett, Schrank und Kruzifix war dort nicht zu finden. Direkt hinter dem Wohngebäude schloss sich der Stall an, dort stampfte, grunzte und gackerte das Vieh.
Abends saßen die Wiesbecks in der Stube, der Großvater stopfte die Pfeife und versank in seinen Erinnerungen. Das Leben damals war einfach, dennoch fühlten sich die Menschen zufrieden. Es war ruhig im schönen Hochtal, sogar während anderorts der Erste Weltkrieg tobte. Mare kannte den Krieg nicht, und der Großvater wollte nicht über ihn reden.
Über nichts sprechen zu müssen und alles tief in sich vergraben, was die Seele schmerzen könnte, so wollte es der Großvater. Bewegten ihn Kummer, Sorgen oder Ängste, sah man dies nur an seinem Gesichtsausdruck, niemals kam ein Wort der Klage oder gar ein Jammern über seine Lippen. Streitigkeiten duldete das Familienoberhaupt am wenigsten. Der Schadhubhof bedeutete für ihn Heimat, in der das arbeitsame Leben schön sein sollte, weil sich am Schicksal ohnehin nichts ändern ließ. Gottes Wille geschehe.
Links vom Schadhubhof erstreckte sich die Hochries als nackte, unbewaldete Kuppe in die Höhe, kein schöner Berg mit seiner unspektakulären, zacken- und spitzenlosen Form. In den Wintermonaten wurde der Berg von den Stadtmenschen heimgesucht, die mit ihren Skiern hinauf zur Hochrieshütte stapften, dort mit viel Bier die Nacht verbrachten und am nächsten Tag auf ihren Brettern zurück ins Tal rutschten. War das Wetter schön und warm, fanden sich die Wanderer ein und zogen mit Rucksäcken und Stöcken die Pfade hinauf. In kurzer Entfernung rechts des Schadhubhofs lag Roßholzen, damals eine kleine Seelengemeinde mit Kirche, Schulhaus und einem Kramerladen. Jeder kannte jeden, vor allem die Wiesbecks, schließlich hatte man den alten Bauern wegen seiner Gutmütig- und Großherzigkeit zum Bürgermeister gewählt. Zudem gehörten die Wiesbecks seit Generationen zu den größten und mächtigsten Bauern des Samerbergs. Der alte Hof war stolz und gepflegt. Im Sommer wuchsen Geranien auf den beiden Balkonen, deren Holzgeländer kunstvoll mit geschnitzten Motiven aus dem Familienwappen verziert waren. Die Rösser und Kühe des Bauern standen stets gut im Futter, ihr Fell glänzte, und die Hufe waren gepflegt. Selten hörten die Nachbarn ein lautes Wort, die Wiesbecks wirkten wie eine glückliche Familie.
Es war das Jahr 1939. Weihnachten nahte, die Bratäpfel schmorten auf dem Herd. Franz lag in der Stube auf der Bank und las Die Leiden des jungen Werther. Diana und Mare zogen mit Großvater den Schlitten in den Wald hinter dem Schadhubhof, um dort einen Weihnachtsbaum zu fällen, so wie sie es getan hatten, seitdem sie laufen konnten.
Als abends die Kerzen leuchteten und die Wiesbecks Stille Nacht, heilige Nacht zu Zither und Hackbrett gesungen hatten, packten sie ihre Geschenke aus. Mare schnürte den Kartoffelsack auf, der mit einer roten Schleife zugebunden für sie unter dem Baum lag. »Is endlich mal Zeit worn«, sagte Mutter Edith, als Mare eine weiche Daunendecke daraus hervorzog. »So schee, Mama, die Deckn, dank dir so«, sagte sie leise. »Is was fürs Lebn, Mare«, lächelte die Mutter. Später trug Edith das Essen auf: Schweinernes mit Knödel. Die Wiesbecks falteten die Hände und sprachen das Gebet. Dann klapperte das Besteck in der Stille, die Wiesbecks schwiegen, ein jeder hing seinen Gedanken nach. Der Großvater blickte auf seine Familie, die so anders geworden war, als er es sich gewünscht hatte. Der Schwiegersohn ein Weichling, die Tochter eine Witwe, der der Mann auf schändliche Weise weggestorben war. Ein Feigling war er gewesen, der nicht auf Gottes Weisung gewartet, sondern im Eis Selbstmord begangen hatte. Und was nun aus den Enkelinnen Mare und Diana werden würde, blieb abzuwarten. Beide halfen im Stall, waren fleißig auf dem Feld, wenn es ans Rechen und Heueinholen ging. Sie fütterten die Hennen und gingen Edith im Haushalt zur Hand. Sie verhielten sich recht fromm und artig. Ja, sie waren auf dem richtigen Weg, adrett anzusehen mit ihren dichten Haaren und hübschen Gesichtern. Mare, die dunkle Dünne, Diana, die helle Wohlgenährte. Jetzt mussten nur noch zwei ordentliche Burschen her, damit die Mädchen später einmal gut versorgt wären.
»Lehrer Stein is nimmer da«, sagte Franz auf einmal in die Stille.
»Nachhert kimmt a anderer, vielleicht a besserer«, sagte Großvater. »Der Stein war eh net von hier, so einer von der Stadt hat eh net da herpasst.«
»Wo is er denn hin, der Herr Lehrer?«, fragte Edith.