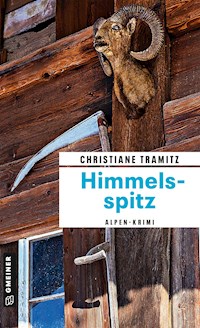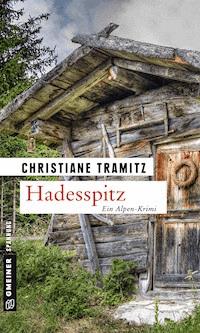15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein Mann, der nichts zu geben hat – zwei Mädchen, die alles brauchen – eine einzigartige Freundschaft
Fabian Krüger, arbeitslos, von seiner Frau verlassen und einsam, trifft auf der Treppe seines Plattenbaus auf zwei kleine magere Mädchen, die sich ausgesperrt haben. Obwohl er genug eigene Sorgen hat, kümmert er sich zunehmend um die Schwestern, er kauft von seinem wenigen Geld Essen für sie, macht Hausaufgaben mit ihnen. Er sorgt fast ein Jahr für die Kleinen, bis sie plötzlich verschwunden sind. Mithilfe der anderen Bewohner des Plattenbaus kommt Krüger zu einer schrecklichen Erkenntnis. Sein Leben erfährt eine jähe Wendung, auch weil es zwei Ordensschwestern gibt, die den Marzahnern seit 1992 in ihrer „Lebensberatungsstelle“ Hilfe anbieten. Ihre Mission lautet: Wunden heilen. Die Bestsellerautorin Christiane Tramitz erzählt eine ebenso berührende wie erschreckende Geschichte, die exemplarisch für das Leben vieler Menschen in Deutschland steht. Zugleich ist es eine hoffnungsvolle Geschichte voller Liebe und Zuversicht, die zeigt, wie sich Menschen in den schwierigsten Situationen umeinander kümmern – und dass dann tatsächlich Wunden geheilt werden können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Fabian Krüger, arbeitslos, von seiner Frau verlassen und einsam, trifft auf der Treppe seines Plattenbaus auf zwei kleine magere Mädchen, die sich ausgesperrt haben. Obwohl er genug eigene Sorgen hat, kümmert er sich zunehmend um die Schwestern, er kauft von seinem wenigen Geld Essen für sie, macht Hausaufgaben mit ihnen. Er sorgt fast ein Jahr für die Kleinen, bis sie plötzlich verschwunden sind. Mithilfe der anderen Bewohner des Plattenbaus kommt Krüger zu einer schrecklichen Erkenntnis. Sein Leben erfährt eine jähe Wendung, auch weil es die beiden Ordensschwestern gibt, die den Marzahnern seit 1992 in ihrer »Lebensberatungsstelle« Hilfe anbieten. Ihre Mission lautet: Wunden heilen. Die Bestsellerautorin Christiane Tramitz erzählt eine ebenso berührende wie erschreckende Geschichte, die exemplarisch für das Leben vieler Menschen in Deutschland steht. Zugleich ist es eine hoffnungsvolle Geschichte voller Liebe und Zuversicht, die zeigt, wie sich Menschen in den schwierigsten Situationen umeinander kümmern – und dass dann tatsächlich Wunden geheilt werden können.
Zur Autorin
Christiane Tramitz ist promovierte Verhaltensforscherin und war unter anderem am Max-Planck-Institut tätig, bevor sie ihre Leidenschaft für das Schreiben entdeckte. Sie hat mehr als zehn Bücher geschrieben, darunter die Erfolgstitel »Unter Glatzen« und »Harte Tage, gute Jahre«. Christiane Tramitz hat zwei Kinder und lebt in Berlin und Oberbayern.
Christiane Tramitz
DIE SCHWESTERN
VON MARZAHN
Vom Leben ganz unten
Dieses Buch beruht auf wahren Begebenheiten. Einige Schilderungen von Ereignissen und Personen wurden jedoch aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes verfremdet.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 03/2019
Copyright © 2019 by Ludwig Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Heike Fischer
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur,
Zürich, unter Verwendung eines Fotos von
© Getty Images/Jose Segarra/EyeEm
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-23771-4V001
www.ludwig-verlag.de
1
MARIE KRÜGER FÄHRT DURCH DIE NACHT. Die Frau hat ihren Kopf an die Fensterscheibe gelehnt, an der Regenperlen feine Fäden ziehen. Der junge Mann ihr gegenüber lümmelt müde auf dem Sitz herum, die Augen halb geschlossen. Auf den Ohren trägt er fette Kopfhörer, ab und an summt er vor sich hin. Neben Marie hockt eine Mutter mit ihrem Kind auf dem Schoß und tippt Nachrichten ins Handy. Die S-Bahn hält ruckelnd, Menschen gehen und kommen. Eine kaputte, klapprige Halbwüchsige mit dunklen Augenringen, unzähligen Piercings und einem halbseitig kahl rasierten Schädel hält Marie einen Pappbecher hin. An den Füßen trägt die junge Frau durchnässte Socken, keine Schuhe. Ihr ausgemergelter Körper steckt in einem überlangen, dreckig weißen Herren-T-Shirt, auf das mit Filzstift ein Totenkopf gemalt ist. Darunter steht ein Name gekritzelt: Chantal.
»Für eine Stulle, hab heute den ganzen Tag noch nichts gegessen«, sagt sie und tippt sich dabei auf die magere Brust.
»Habe selbst nichts«, antwortet Marie Krüger, wendet den Kopf ab und blickt nach draußen. Eine Tankstelle zieht an ihr vorbei, ein paar Autos, Häuser mit beleuchteten Fenstern, in der Ferne schimmert der Mond durch die Wolken. Nächster Halt, einige Passagiere steigen aus, keiner mehr ein. Die Waggons leeren sich. Zwei Sitze weiter stiert ein alter Mann regungslos ins Leere, in seiner Hand hält er eine Dose Bier so schräg, dass der Inhalt langsam auf den Boden tropft. Am Ende des Abteils amüsieren sich ein paar junge Kerle lautstark, alle haben sie Nike-Sneakers an.
»Dicker, hast die eine mit dem weißen Top gesehen, ist zwar nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber ich habe trotzdem ihre Nummer geschnappt«, grölt der eine.
»Boah, heut hab ich vielleicht gesoffen«, lallt der andere. Der Dritte lacht. Der Vierte flucht, hebt seinen Fuß in die Höhe und zeigt den anderen die Schuhsohle. »Und ich frag mich dauernd, warum es hier so stinkt, Dicka, bin in Hundescheiße getreten, verflucht.« Lautes Gelächter dringt durch das Abteil.
Es ist ein später Samstag, bald früher Sonntag in diesem Herbst.
Die S-Bahn rattert durch Marzahn bis zum Bahnhof Ahrensfelde. Dort ist Endstation. Marie Krüger ist eine der letzten Personen, die noch in dem Zug sitzen.
Als sie aussteigt, ist es kurz vor Mitternacht. Der Regen hat aufgehört. Der Asphalt glänzt, und die wenigen Autos, die zu dieser Zeit noch fahren, spritzen das Wasser auf den Bürgersteig, den Marie entlanggeht. Ihre Absätze klacken auf dem nassen Boden, ansonsten herrscht Stille an dem Ort. Die Frau biegt um die Ecke und überquert die Havemannstraße, ihre Schritte werden schneller. Marie mag Dunkelheit nicht, es ist die erste Nacht seit Langem, in der sie draußen auf der Straße ist. Sie war auf der Geburtstagsfeier einer Freundin in Berlin-Mitte, in der alten Bruchbude, in der sie vor vielen Jahren gehaust hatte.
Endlich erreicht sie den Hauseingang, noch drei Stockwerke nach oben, dann ist sie wieder daheim in ihrer bescheidenen Einzimmerwohnung. Marie überlegt, noch ein Bad zu nehmen, einen Tee möchte sie sich auch noch kochen, dann schlafen gehen. Als sie vor der Tür steht und in der Handtasche nach dem Schlüssel kramt, erblickt sie rechts zwischen dem Gebüsch stehend ein weißes Pappepferd mit schwarzen Tupfen. Neben ihm schläft ein Mann, den Hut weit ins Gesicht gezogen, seitlich an die Pferdebrust gelehnt. Frau Krüger erstarrt. Ein Irrer? Ein Drogenopfer? Ein Betrunkener? Ein Toter gar? Sie überlegt, die Polizei zu rufen. Oder besser gleich den Krankenwagen? Marie sucht nach ihrem Handy. Jetzt bewegt sich der Mann, brabbelt ein paar Worte. Dann hebt er den Kopf und öffnet seine Augen.
Der Kerl, der hier liegt, ist Fabian Krüger.
Seit fünf Jahren hat Marie ihren Mann nicht mehr gesehen.
2
KRÜGER SITZT AM KÜCHENTISCH und baut kleine Türmchen. Seine Finger zittern, als er die Geldmünzen ordnet. Alles soll seine Richtigkeit haben, wenigstens die Sache mit dem Geld. Ganz links stapelt er die Zweicent-, daneben die Fünfcentstücke, es folgt der kleine Zehnerturm, dann die Fünfzigergeldstücke, von denen er gerade mal vier Stück hatte finden können. Er zählt nach, mehr als vier Euro zwanzig geben die Türme nicht her. Reichlich wenig fürs Paradies. Krüger schüttelt den Kopf und murrt: »So ein Mist.«
Müde erhebt er sich, verlässt die Küche und geht ins Wohnzimmer, in dem eine alte Couch vor dem Fernseher steht. »Fürs Paradies ist es ohnehin zu früh, keiner da«, sagt er zu sich selbst und knipst den Fernseher an. Er zappt sich durch die Programme. Die Nachrichten bringen die Entscheidung von US-Präsident Trump, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen und die amerikanische Botschaft dorthin zu verlegen. In Berlin gab es einen Brandanschlag auf das Willy-Brandt-Haus. Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu, für Krüger mindestens genauso langweilig, wie es begonnen hatte, ohne wesentliche Ereignisse, wie all die Jahre zuvor. Doch die Langeweile quält Krüger schon lange nicht mehr, nicht einmal mehr das empfindet er: Langeweile.
Unten vor dem Gebäude lärmt die Sirene eines Krankenwagens.
Krüger überlegt kurz, ob sich das Aufstehen lohnt. Zum Balkon gehen und runtergucken. Viel sieht man ja ohnehin nicht, wenn man im elften Stock lebt und von dort in die Tiefe schaut. Die Menschen ganz unten sind nur kleine Punkte, was interessieren ihn schon die paar Punkte auf der Straße.
Er legt die Fernbedienung auf den Tisch und schließt für einen Moment die Augen. Er war heute zu früh wach geworden, der Tag hatte noch nicht einmal richtig begonnen, da haben so ein paar Idioten doch tatsächlich Flaschen im Container entsorgt, ein Klirren und Krachen um sechs Uhr dreißig. Illegal ist das, verboten und gehört bestraft. Die Menschen können sich nicht mehr an die Regeln halten. Und eine dieser Regeln, sie steht ja schließlich dick und fett auf dem Container geschrieben, lautet: Der Einwurf von Flaschen ist nur zwischen neun und einundzwanzig Uhr erlaubt, Feiertage ausgenommen. Können die Menschen nicht lesen? Krüger könnte kotzen. Der geraubte Schlaf bedeutet Wachsein, und das hasst er. Keine Träume, keine Ruhe, keine wohlige Decke um den Körper, und kein Frieden. Vor allem aber: langes Warten aufs Paradies.
Früher, als Krüger noch jung war, nicht so alt wie heute, und mit achtundfünfzig Jahren fühlt sich ein Mann wie er ja schließlich alt, also früher, als das Leben irgendwie noch anders war, nicht schön, aber vielleicht besser, da ging Krüger um siebzehn Uhr dreißig ins Paradies. Es lag ja schließlich auf dem Weg von der Arbeit zurück nach Hause.
Tür auf, rein in den Qualm des Paradieses, ein paar Bierchen zischen, ab und zu die Bedienung Nicola vögeln, das war ganz normal.
Krüger zieht eine Zigarette aus der Schachtel und geht auf den Balkon. Drinnen darf nicht geraucht werden, das stinkt und macht die Tapeten kaputt, die zwar alt sind, aber dennoch schön und voller Erinnerung an damals, als er sie zusammen mit seiner Frau Marie aussuchte. Es ist kalt auf dem Balkon und zugig, Winter in Marzahn, eklig, düster, trüb wie immer, nicht gut für die Stimmung. Krüger, der Altmarzahner, kennt ausnahmslos jeden einzelnen Winter, der über den grauen Berliner Stadtteil gefallen war. Jeden der achtundfünfzig frostigen Winter. Mit den Sommern sieht es etwas anders aus, da ist er gelegentlich fortgefahren, meistens an die Ostsee. Das waren die schönsten Zeiten für seine kleine Familie, gute Jahre, auch die gab es in seinem Leben.
Der Wind auf dem Balkon ist erbarmungslos, die Flamme des Feuerzeugs erlischt ständig, bevor sie die Zigarette zum Glimmen bringen kann. Krüger flucht und beobachtet, wie zwei Sanitäter jemanden mit der Trage aus dem Haus bringen und in den Wagen schieben. Immerhin kein Leichenwagen, denkt er, denn auch der fährt hier öfters vor. Vor seinen oder vor all die vielen anderen Eingänge der umstehenden Plattenbauten, die Krüger von seinem Balkon aus sehen kann. Im Winter sterben die meisten Menschen, denkt er. Sterben, meine Güte, dann ist halt mal wieder jemand weg von dieser Welt, sind ohnehin zu viele hier, wer braucht schon all diese Leute, die nichts tun, einfach nur rumsitzen, gammeln, die Zeit totschlagen. Ist ja kein Platz für sie, kein Sinn, keine Aufgabe. Die Zigarette ist endlich an, er bläst den Rauch gen Himmel, der bald keiner mehr ist, sondern grauer Schwaden, der sich von oben nach unten bis zur Straße zieht.
Es ist kurz vor acht Uhr morgens, seit eineinhalb Stunden ist er nun schon wach. Und? Was hat er in dieser Zeit getan? Geldtürmchen aufgehäuft, die Tapetenmuster angeschaut, den Fernseher mal kurz angemacht, durchgezappt, ausgemacht. Er hat gepinkelt und sich die Hände danach nicht gewaschen. Den Luxus gönnt er sich. Keine Hände waschen. Denn jetzt ist niemand mehr da, der ihm hysterisch durch die Badezimmertür zuruft: »Vergiss nicht, die Hände zu waschen, Schatz, sonst kleben die Bakterien an den Türgriffen!«
Der Rettungswagen wirft die nervende Sirene an und setzt sich langsam in Bewegung, drei Menschen stehen am Straßenrand. Klar, dass die gaffen, denkt Krüger, passiert hier ja sonst nichts. Ihn fröstelt es, vom Himmel fallen die ersten Flocken. Sie tanzen an seinen Augen vorbei, unverschämt fröhlich und leicht. Der Rettungswagen passiert gerade die Müllcontainer und nimmt an Fahrt auf, da sieht Krüger, wie zwei kleine Mädchen aus dem Haus stürzen und hinter dem Fahrzeug herrennen. Sie wedeln mit den Armen, das kleinere Kind stolpert und fällt hin. Dann steht es wieder auf und läuft weiter. Doch der Rettungswagen fährt und fährt, verschwindet hinter der nächsten Straßenecke, und irgendwann hört man in der Ferne nur noch ein schwaches Tatütata. Dort, wo der Lottoladen ist, bleiben die Kinder stehen. Pech gehabt, denkt der rauchende Beobachter auf seinem Balkon.
Im Plattenbau gegenüber brennen nur wenige Lichter. Das war früher anders. Morgens war fast überall Licht, weil die Menschen etwas zu tun hatten. Na ja, denkt Krüger, schnipst den Zigarettenstummel in die Tiefe und schließt die Balkontür hinter sich. Es ist acht Uhr zehn. Krüger setzt sich wieder in den Sessel und wartet darauf, dass der Zeiger der Uhr auf neun springt. Davor bleibt der Kühlschrank zu, ein wenig Disziplin will er noch aufbringen. Disziplin, das ist das Einzige, was er noch hat. Daran klammert er sich jeden Morgen, wenn er nicht weiß, wie der Tag enden wird. Disziplin, so wie er es von seinem Vater gelernt hat. Zur Disziplin gehört, ordentlich und sauber gekleidet zu sein, sich die Haare gekämmt zu haben und Socken zu tragen, die zusammenpassen. Krüger legt Wert darauf, dass jeder, der ihn sieht, weiß, dass sein nichtssagendes Leben zumindest in Ordnung ist.
Ein gestandener Mann mit kantigem Gesicht ist er, mit hellblauen Augen und schwarz gewelltem Haar. An den Schläfen hat sich etwas Grau eingeschlichen. Die Lippen sind farbloser und schmaler geworden, doch ansonsten stimmt alles mit seinem Äußeren, nichts Auffallendes, Störendes, Hässliches. Krüger ist ein Mann, von dem jeder ahnt, dass er mal recht attraktiv war und der sich trotz allem ganz gut gehalten hat. Er ist nicht so wie die anderen Menschen hier, mitnichten eine verlorene Kreatur, die sich aufgegeben hat.
Zur Disziplin gehört auch, den Müll rauszutragen. Krüger geht in die Küche, zieht den vollen Plastiksack aus dem Eimer. Es riecht nach Hering in Tomatensoße, Krügers Leibspeise, dieser Fisch in den länglichen Dosen. Er nimmt den Haustürschlüssel vom Haken und geht zum Aufzug. Die Tür mit den praktischen Müllschluckern, die früher den Abfall von ganz oben bis ganz nach unten sausen ließen, ist abgeschlossen. Nichts funktioniert hier mehr in Platte 13.
Der Aufzug scheppert in den elften Stock hoch, wenigstens das klappt, zumindest heute. Einsteigen, runterfahren, zu den Tonnen gehen, Deckel auf, Müll rein und zurück in den elften, geht ja alles ganz einfach.
Wieder oben angekommen, zieht Krüger seine zweite Zigarette aus der Schachtel und tritt erneut auf den Balkon. Inzwischen hat sich eine diesige, feuchte Nebelwand zwischen die hohen Plattenbauten geschoben. Es ist kurz nach halb neun, und der Tag will nicht hell werden, vierundzwanzig Stunden lang Winterdämmerung, das ist nun mal so in Berlin. Krüger schlingt die Jacke um den Körper, es ist kalt und zugig. Hastig zieht er an der Zigarette, um so schnell wie möglich in die Wärme zurückzukehren.
Die Gedanken im Kopf kreisen. Immer wenn er hier steht und raucht, taucht die Vergangenheit auf, ach, es ist so lange her, dass er hier über die Felder tobte, barfuß übers Gras lief und den Drachen steigen ließ.
Was in seinem Leben war schiefgegangen? Es hätte anders kommen können, denn eigentlich hatte es ganz nett begonnen. Vati, Mutti und Junior Fabian lebten nahe der jetzigen Großsiedlung in einem respektablen Haus mit Garten und Schwimmbecken. Bevor man die Plattenbauten aus dem Boden stampfte, erschienen die Felder hier endlos, wunderbar weit, und kein Drachen flog so fröhlich wie der von Klein Krüger.
Ein paar Mal in seinem Leben hätte er seine Heimat verlassen können, damals, als er unmittelbar nach der Wende einen Posten im Westen angeboten bekam, als leitender Konstrukteur. Gelsenkirchen hatte man ihm vorgeschlagen. Doch was in aller Welt sollte Krüger dort? In Gelsenkirchen? Hier in Marzahn war seine Heimat, hier ist sie noch immer, auch wenn er nicht mehr über Felder laufen kann, weil sich auf ihnen jetzt eine Häuserwüste ausbreitet.
Das Leben ist ihm ein wenig entronnen, zugegeben, aber immerhin hat er Wurzeln geschlagen, die fest verankert sind. In Platte 13, elfter Stock, rechter Eingang mit Küche, Bad, zwei Schlafzimmern, einem Wohnraum mit elektrischem Kamin und einem Balkon, auf dem der abgewetzte Teppich für Fußwärme sorgt.
War früher alles besser? Krüger weiß es nicht. Damals fühlte er sich ferngesteuert, er funktionierte wie eine perfekte Maschine, bei der Arbeit, im Sport, auch beim Sex.
Er schließt die Augen und stellt sich Nicola vor, die Bedienung im Paradies. Wenn sie gut gelaunt war, was meistens nach dreiundzwanzig Uhr der Fall war, wenn man ihr genügend Gläschen Goldkrone spendiert hatte, wurde sie für jeden, der ebenfalls einen gewissen Pegel intus hatte, zur begehrenswerten Frau. Dann sah man nicht mehr ihre gelben Zähne, roch nicht mehr den Schweiß unter den Achseln, wenn man sich zwischen ihre Brüste bettete.
Die Zigarette wirbelt in die Tiefe, der Wind hat einen Zahn zugelegt.
Krüger setzt sich wieder in den Sessel und bleibt hocken, bis die Zeiger endlich auf neun Uhr stehen. Er öffnet eine Bierdose, trinkt gierig und lässt sich in den Tag treiben. Die Flocken vor dem Fenster werden dichter, Krügers Augen verlieren sich im weißen Geflimmer.
Die Zeit vergeht irgendwie, ein guter Trost. Egal was passiert, die Zeit vergeht, selbst dann, wenn man meint, sie sei stehen geblieben. Es gibt Stunden, da verfolgen Krügers Augen jede quälend langsame Bewegung des Sekundenzeigers und zählen stumm mit. Eins, zwei, drei bis sechzig, die Minute ist um. Endlich. Alles geht vorbei, auch wenn Krügers Leben seit Langem nur aus dem Warten besteht, dass die Zeit verrinnt. Sekunden, Minuten, Tage, Wochen, Jahre in Marzahn. Und alles ohne Sinn.
Gegen Mittag steht Krüger in der Küche, der Magen knurrt, ihm ist nach einer Schrippe mit Mettwurst. Im Regal liegen eine Packung Kartoffelbrei, etwas Reis, eine Dose Bohnen und ein paar Tütensuppen sowie ein halb leeres Glas Essiggurken. Immerhin. Gegen Ende des Monats sieht es stets mager aus in der Küche, bis die nächsten vierhundertvier Euro, die er dem Staat noch wert ist, auf seinem Konto eintrudeln. Vierhundertvier Euro für den angesehenen Maschinenbauer, der er mal war. Vierhundertvier Euro, damit er nicht verhungert und nicht unter der Brücke schlafen muss, sondern bis zum Tode in Marzahn im Plattenbau leben kann.
Krüger fischt eine Gurke aus dem Glas und schiebt sie in den Mund, dann noch eine, bis nur noch Flüssigkeit mit ein paar Dillstängeln und Senfkörnern übrig ist. Langsam schraubt er das Glas wieder zu und stellt es zurück auf das Regal. Satt ist anders, aber sein Magen hat sich beruhigt.
Gegen dreizehn Uhr zieht Krüger seinen Mantel an, stülpt sich die Kappe über den Kopf und wickelt den Schal um den Hals. Ein paar Meter rausgehen, denkt er, das kann nicht schaden. Frische Luft, sich bewegen, nicht einrosten, sonst wirst du irre, hier im elften Stock.
Er schließt die Wohnungstüre zweimal ab, man weiß ja nie bei dem ausländischen Pack, das sich hier in Marzahn eingenistet hat. Das sagt auch der Nachbar, Herr Schulze. Der alte Mann wohnt im selben Stockwerk gegenüber und hat seine Bude in eine wahre Festung umgebaut, mit mindestens vier Schlössern. Kommt oder geht Schulze, hört Krüger das ewig dauernde Klappern, Klirren und Scheppern der Schlüssel und Klacken der Schlösser. Schulze ist ein Arsch. Krüger und er reden seit Jahren nur das Allernötigste miteinander, einer ist mürrischer als der andere, beide unzufrieden, beide alleine. Das war früher mal anders, da war Schulze der nette Nachbar, allzeit für ein Gespräch bereit und der beste Mann für Vitamin B. Er konnte damals alles besorgen, was man brauchte. Wie, hat er nie verraten, nur mit den Augen gezwinkert, wenn man ihn danach fragte. Der Mann war einmal Lebensmitteltechniker, heute nennt man das, stinknormal klingend, Bäcker. Mit der Wende wurden die Menschen hier degradiert, warum nicht auch die Bezeichnungen für ihre Tätigkeiten? Doch egal wie man diesen Beruf heute auch immer nennen mag, man braucht hier weder einen Lebensmitteltechniker wie Schulze noch einen Bäcker. Penny hat praktische Automaten, die spucken die einzigen Brötchen aus, die die Menschen sich in dieser Gegend noch leisten können.
Krüger wartet auf den Aufzug. Ein Wink des Schicksals, wird er sich später fragen. Denn wäre der Fahrstuhl an diesem Tag sofort gekommen und nicht mitten auf seinem Weg nach oben zwischen dem siebten und achten Stock stecken geblieben, hätte Krüger die Treppen nicht genommen.
Seine Hand rutscht das Geländer entlang nach unten. Krüger flucht, zweihundert Stufen sind schon was!
Im Gang des zehnten Stockwerks stehen ein Kinderwagen und ein Roller, dort wohnt eine Mutter mit drei Kindern, Krüger kennt sie vom Sehen, gesprochen hat er noch nie mit ihr. Sie ist eine abweisende, stets gehetzte Frau, die mit ihren Bälgern nicht gerade zimperlich umzugehen scheint. Dauernd Gezeter und Geschrei. In der Wohnung rechts von ihr lebt der Ewigstudent Torsten, ein angehender Informatiker, dessen Päckchen Krüger mehrmals im Monat entgegennimmt, weil außer ihm ja sonst niemand die Tür öffnet, wenn der Postbote klingelt.
Die Leute vom neunten Stock kennt Krüger nicht, hat sie noch nie gesehen oder die Übersicht verloren bei dem ständigen Ein- und Ausziehen der Menschen. Vor der Tür der links gelegenen Wohnung gammelt eine Yuccapalme vor sich hin, oder zumindest ein Gewächs, das einmal eine solche Palme gewesen sein dürfte. Jetzt hängen nur noch zwei braune Blätter am Stiel. Huahong steht am Klingelschild, wieder jemand von woandersher. Vor der Eingangstür der Wohnung daneben liegen ein paar ausgetretene, dreckige Schuhe und ein Plastiksack voller Müll. Es stinkt.
Krüger erreicht den achten Stock. Dort sitzen zwei kleine, dürre Mädchen mit angewinkelten Beinen mitten auf den Stufen und blicken ihn erstaunt an, als wäre er der erste Mensch, den sie in ihrem Leben sehen. Sie muten ausländisch an mit ihren langen, zerzausten, stark gekräuselten schwarzen Haaren und den großen, dunklen Augen. Oh Mann, denkt Krüger, nur noch Fremde in Platte 13. In den letzten Jahren sind sie von überall hierhergezogen, vorwiegend aus Russland, Rumänien, Südostasien, Türkei, Syrien und dem Libanon, mittlerweile auch aus dem tiefschwarzen Afrika. Krüger schätzt das kleinere der beiden Mädchen mit der roten Strumpfhose und dem grüngelben Rock auf sechs, sieben Jahre. Es hält einen verschlissenen Plüschaffen im Arm. Das größere trägt eine grellorangene Leggings nebst giftgrünem Pulli. Eine Zumutung für die Augen, denkt Krüger. Das Mädchen konnte nur unwesentlich älter sein als seine kleine Schwester, im Altereinschätzen von Kindern ist Krüger nicht gut, dafür hat er zu wenig Erfahrung und zu wenig Interesse. Vielleicht hat er in seinem Leben ja den einen oder anderen Balg gezeugt, das wäre bei der Menge seiner sexuellen Beziehungen kein Wunder. Aber meistens ist er kommentarlos, ohne Erwähnung seines vollen Namens, geschweige denn seines Wohnortes, nach einer heißen Stunde oder geilen Nacht einfach wieder abgehauen. Besser so.
»Was treibt ihr euch hier rum?«, fragt Krüger die Mädchen. »Blockiert die ganze Treppe.«
Die Kinder schweigen und rutschen ein paar Zentimeter zur Seite. Er geht weiter, erreicht den siebten Stock, wo Plattenhorst wohnt, ein alter Kerl im elektrischen Rollstuhl. Der Mann war mal Kunstlehrer, bis er unter einen fahrenden Trabi geriet, seine beiden Beine abgequetscht wurden und er in Frühpension geschickt wurde. Seitdem macht Horst nichts anderes mehr, als Plattenbauten zu zeichnen, vorzugsweise seine Platte, Platte 13. Plattenhorst eben, der Name sagte alles. Sechster Stock, ein Kinderfahrrad vor der Tür, Willkommen daheim steht auf dem Fußabstreifer. Fünfter Stock, es riecht nach Apfelkuchen, an den Türschildern fremde Namen. Früher kannte man sich im Gebäude, einige zumindest pflegten nette Kontakte zueinander, selten innige, häufig zweckgebundene, meistens oberflächliche. Man lud sich zum Kaffee ein, borgte einander Dinge aus, half sich gegenseitig, bewahrte den Ersatzschlüssel auf, nahm die Post entgegen und so weiter. Das war aber lange her. Die meisten von Krügers Freunden, Bekannten und Nachbarn (Schulze leider ausgenommen) sind fortgezogen oder gestorben. Was soll’s, denkt Krüger, es ist, wie es ist. Vierte Etage, da hängt ein großer Papagei am Haken direkt unter dem Spion, in dieser Wohnung lebt seit Jahren eine verrückte Alte mit Vogeltick. Man sieht sie immer mal wieder auf der Straße des Bezirks auf ihren Rollator gestützt, stets einen lebendigen bunten Papagei auf der Schulter tragend.
Sein linkes Knie schmerzt, als Krüger ins Freie tritt. Kalter Wind erfasst ihn, dieser Tag ist nicht nur eisig und dunkel, er ist unbarmherzig.
Gegen den Wind gebeugt schlendert Krüger die Straße in Richtung S-Bahn. Er bleibt kurz stehen und sieht den Zug einfahren, der ein paar Menschen verschluckt und sich dann gen Berlin-Mitte bewegt. Was wollen die dort? Einkaufen? Womit? Zur Arbeit fahren? Welche Arbeit? Oder Freunde und Bekannte besuchen? Ach, denkt Krüger und blinzelt in den grauen Himmel, aus dem nur noch wenige Flocken rieseln. Er setzt seinen Spaziergang fort, rüber zum Bäcker, einen Kaffee trinken für fünfzig Cent. Dort kann er auch anschreiben lassen, der Betreiber, ein Türke namens Göktan, ist ein ehemaliger Kollege von ihm. Im Betrieb für Maschinenbau Hasse & Wrede, wo Krüger einmal als Produktionsleiter tätig war, hatte der Türke die Böden geputzt.
»Alles gut?«, fragt Göktan, als Krüger den Laden betritt.
»Alles gut«, antwortet Krüger. »Kaffee zum Anschreiben, in ein paar Tagen kommt Geld.« Der Türke nickt und schenkt einen Pappbecher Kaffee aus der Thermoskanne ein. »Noch eine Schrippe mit Mett«, ordert Krüger.
»Du lässt es heute aber krachen«, grinst Göktan.
»Muss erlaubt sein«, erwidert Krüger und zeigt auf ein Brötchen, dessen Belag ihm am üppigsten erscheint. »Das da, bitte.« Er setzt sich an den kleinen Bartisch in der Ecke, gibt vier Löffel Zucker in den Kaffee. Immer vier sind es, seitdem Krüger Kaffee trinkt. Es dürfte neben Platte 13 die einzige Konstante in seinem Leben sein. Immer vier Löffel Zucker. Trotzdem schmeckt Göktans Kaffee wie gewohnt schlecht, dafür ist er aber warm.
Etwas später macht sich Krüger wieder auf den Weg, hinüber zum Einkaufszentrum, von dessen Läden inzwischen die meisten geschlossen sind. Viel ist im Zentrum daher ohnehin nicht mehr zu sehen: Ramsch, ein Nagelstudio, Schlüsseldienst, Tabakstore. Vor fast allen Schaufenstern der inzwischen aufgegebenen Läden kleben Fototapeten, auf denen glückliche Familien zu sehen sind, Eltern, die mit ihrem Kind »Engelein flieg« spielen und in der freien Hand prall gefüllte Einkaufstüten halten. Hinter diesen Fenstern befindet sich nichts anderes als ausgehöhlte, nackte Räume. C&A ist gegangen, H&M, Pimkie und wie diese günstigen Shops für die Massen sonst noch alle heißen. Die Käufer sind ausgeblieben, sie sind Menschen wie Krüger, die eine Woche vor Monatsende bei einem Türken anschreiben lassen und winzige Türmchen aus Geldstücken bauen, wenn sie ins Paradies wollen.
Massagestühle gibt es auch im Einkaufszentrum, mechanische Wellness für fünf Minuten, wenn man es sich leisten will oder kann. Ein Obdachloser hat auf einem dieser Sessel Platz genommen und kramt in seinen Plastiktüten nach etwas. Krüger steht in der Ecke und beobachtet den alten Mann, der vier Mäntel übereinander trägt. Die Stiefel sind durchgelatscht und der Schal löchrig von Motten zerfressen. Gescheitert, ohne Disziplin, denkt Krüger und fühlt in diesem Moment einen Hauch Stolz in sich aufkommen. Nein, er hat es geschafft, er ist nicht untergegangen. Er hat eine Wohnung mit Balkon, Fernseher und Elektrokamin. Er verhungert nicht. Er ist gut angezogen, auch wenn die Kleidungsstücke aus den Achtzigerjahren stammen. Da hatte er sich noch Teures, qualitativ Hochwertiges leisten können. Es hat sich ausgezahlt, Krüger ist nach wie vor ordentlich gekleidet.
Überhaupt hat er das Beste aus seinem Leben gemacht. An ihm lag es nicht, dass alles so gekommen ist, wie es kam. Er war ein erfolgreicher Maschinenbauer, zuverlässig, pünktlich. Nicht faul wie viele seiner Kollegen, die morgens zum Einstempeln gingen, zwischendrin aber zurück nach Hause zum Ausruhen, um sich dann abends wieder auszustempeln. Krüger war keiner dieser Schmarotzer, die es in der DDR zuhauf gab. Krüger war verantwortungsbewusst, auch seiner Frau gegenüber. Die Wende, diese verdammte Wende und seine Frau, beides hatte zu seinem jetzigen Zustand beigetragen. Es wäre anders gekommen, wenn man die Mauer hätte stehen lassen. Vor allem wäre alles besser verlaufen, wenn die Gattin, die er unüberlegt, von Liebe geblendet, geheiratet hatte, ihm eine hingebungsvollere und verständnisvollere Frau gewesen wäre. Stattdessen war sie eine, um es milde auszudrücken, beschissene Frau. Dafür aber hübsch, oh ja, das war sie. Sie war alle Sinne betörend schön, hatte schmale, gerade Beine, einen vollen Mund, eine süße Stupsnase, hilflose Rehaugen und dichtes Haar, das sie mit einer Klammer zur Seite steckte oder oben am Hinterkopf zu einem Pferdeschwanz zusammenband. Sie erinnerte ihn an die Bezaubernde Jeannie, die er im Westfernsehen gesehen hatte, nur dunkelhaarig.
Krüger will nicht mehr an seine Ex denken, nicht mehr an die Zeit mit ihr, an die Marter, die die Ehe für ihn bedeutete, bis seine Frau endlich ging. Von einem Tag auf den anderen war sie zusammen mit ihrem Geheimnis verschwunden. Sie hatte ein großes Geheimnis, und auch daran, dessen ist sich Krüger sicher, ist die Ehe zerbrochen. Vorbei, lange her, vergiss die Alte, weg mit ihr, denkt er und ärgert sich darüber, dass sich seine Ex wieder einmal in seinen Kopf drängen konnte. Aber der heutige Tag ist nun mal ein besonderer, denken die Menschen, denkt auch Krüger, denn dieser Tag zeigt den Einsamen, wie traurig ihr Leben sein kann. Krüger zündet sich eine Zigarette an. Lieber hier drinnen rauchen als draußen in der Kälte, auch wenn es verboten ist.
Der Obdachlose öffnet eine Bierdose und lehnt sich im Massagestuhl zurück. Zwei Jugendliche schlendern an ihm vorbei.
»Wat für ’n Oberchiller«, sagt der eine zum anderen und lacht. Sie steuern auf Krüger zu, beide mit einer Zigarette in der Hand.
»Alter, hast du Feuer?«, fragen sie. Krüger nickt.
»Geile Klamotten, trägt man so was jetzt?«, sagt einer der Typen und zupft an Krügers Mantel herum.
Krüger lächelt müde. Lass sie reden, denkt er. Ihm ist nicht nach Ärger zumute. Er zündet den Kerlen die Kippen an, steckt das Feuerzeug zurück in die Manteltasche und beschließt zu gehen. Doch wohin? Jetzt schon nach Hause? Und dann? Am Ende hätte man den Lift noch nicht repariert, was für ihn einen langen Fußmarsch nach oben bedeuten würde.
Draußen sind die Straßen weiß bepudert, es ist rutschig auf den Gehwegen. Krüger schlurft am sozialen Kaufhaus vorbei, bleibt kurz vor dem Schaufenster stehen. Alte, billige Klamotten hängen auf den Bügeln, eine hässliche Couchgarnitur aus lila Kunstleder steht in der Ecke, kitschige Vasen, Geschirr und sonstiges abgelegtes Zeugs liegt in den Regalen, ein lieblos angepinseltes Schaukelpferd gibt es auch noch, ein paar Stühle, Kommoden, lauter olle, abgehalfterte DDR-Mief-Kulturgegenstände, die einst begehrt und für schön befunden worden waren. Krüger überlegt kurz, was er hier in Kommission geben könnte, am liebsten alles, was sich in seiner Wohnung befindet. Dann würden sämtliche Dinge verschwinden, die er einst mit seiner Frau erstanden hat und die ihn immer wieder an diese vielen kalten und seelenlosen Jahre mit ihr erinnern. »Vergeudete Zeit«, murmelt er und setzt seinen Weg durch seine Heimat fort, die aus ein paar von Hochhäusern gesäumten Straßenzügen besteht.
Die Sonne, die den ganzen Tag kaum zu ihm durchgedrungen war, weil Wolken, Nebel und Schnee sie von diesem Stückchen Erde abgeschirmt haben, versinkt endgültig und überlässt Marzahn einem feuchtkalten Dunkel.
Die Menschen auf den Straßen sind fort, eine Ratte huscht hinter Aschentonnen hervor und verschwindet im Hinterhof von Penny. Die Fenster in den Gebäuden sind erleuchtet, an vielen funkeln Lichter.
Die Kälte dringt durch Krügers feuchten Mantel hindurch, er sieht seinen Atem, der stoßweise vor seinem Gesicht wabert.
Zeit fürs Paradies.
Krüger biegt in eine kleine Straße ein, schon von Weitem flackert der Schriftzug Paradies über der Tür der Kneipe, mal in Rot, mal in Blau, dann in Grün. Auf das Paradies kann man sich verlassen. Es bleibt, wie es immer war: Unverändert der alte Tresen, die Sitzpolster der Stühle speckig von den vielen Hintern, die jeden Abend auf ihnen kleben, die Zapfsäulen stets in Betrieb und das Werbeplakat für Spreegurken vergilbt.
Krüger tritt ein, hängt Kappe und Mantel an den Haken und nimmt seinen Stammplatz ein, rechte Ecke, direkt unter dem Regal mit den Bierkrügen. Bedienung Nicola hat an diesem Tag ein halbwegs ansehnliches Kleid angezogen.
»Ah, der Krüger, spät bist heute dran«, begrüßt sie ihn und stellt ihm ein Bier auf den Tisch. »Wenigstens du kommst, wenigstens einer, mit dem ich ein paar Worte wechseln kann. Der da …«, sie zeigt mit dem Kinn in die andere Ecke des Ladens, »ist schon ganz hinüber. Kam besoffen an und hat sich hier den Rest gegeben. Kennst du den?«
Krüger sieht den alten Mann, der rücklings an der Wand lehnt, kurz an. Die Augendeckel sind auf halbmast, die Hände umklammern einen Regenschirm, der als Stütze dient.
»Der kippt mir gleich um«, sagt Nicola und schüttelt den Kopf.
»Tja, ganz unten, der Typ«, meint Krüger und nimmt einen Schluck. »Scheißtag, Scheißkälte heute«, schimpft er. Die Bedienung kehrt zurück an ihren Platz hinter dem Tresen, setzt sich auf den Hocker und lässt ihre Augen durch den Raum schweifen. »Heut kommt wohl niemand mehr.« Krüger blickt auf die Uhr. Es ist siebzehn Uhr vierunddreißig.
»Ist ja noch früh, wirst sehen, die Bude wird krachend voll, was sollte man denn auch sonst tun, an einem Tag wie diesem?«
Die Bedienung zuckt mit den Achseln und schenkt zwei Klare ein. »Prost, Krüger, lass uns feiern«, sagt sie lächelnd und reicht ihm das Glas über den Tresen.
Krüger greift in die Hosentasche und türmt alle Centstücke auf, wie gewohnt links die Fünfcents, daneben die Zehner und so weiter. »So viel habe ich noch für heute, morgen und den Rest der Woche.«
»Du mit deinen Geldtürmchen, davon wird die Kohle auch nicht mehr«, seufzt Nicola.
Als Krüger Stunden später das Paradies wieder verlässt, ist ihm warm ums Gemüt, eine wohltuende Gleichgültigkeit hat sich im umnebelten Hirn ausgebreitet. Es ist ihm egal, dass auf der Straße niemand mehr anzutreffen ist, keine Einsamkeit macht sich in seinem Herzen breit, als er all die Fenster sieht, in denen Licht brennt. Keine beklemmende Vorstellung drängt sich ihm auf, was hinter den zugezogenen Vorhängen passiert. Die Sterne glitzern, die Wolken haben sich verzogen. Die klirrende Kälte dringt nicht mehr durch den Mantel. So stapft er in Tangenten heimwärts, mal ein wenig nach links schwankend, mal ein wenig nach rechts. Aber den Gehweg, den verlässt er nicht, er torkelt weder in die Büsche noch auf die Straße. Und wenn dem so wäre, wäre es auch egal. Es fahren keine Autos mehr durch Marzahn, die Menschen haben sich in ihre Wohnungen zurückgezogen, auch das ist Krüger gleichgültig.
Es war nicht anders zu erwarten, der Lift bleibt stumm und bewegungslos, als Krüger den Knopf drückt. Seine Hände ziehen ihn am Geländer langsam in die Höhe. Sei’s drum, irgendwann wird er oben ankommen. Er wird immer und überall ankommen, egal wohin er gelangen will. Das Schöne bei diesem Gedanken ist, dass er nirgendwo mehr hinwill. Nur noch nach Hause. Heute siegt die Gleichgültigkeit, was für ein Geschenk, sein persönliches Geschenk an diesem Abend.
Als er schnaufend den achten Stock erreicht, lümmeln die beiden Mädchen immer noch auf der Treppe herum. Als sie Krüger sehen, stehen sie sofort auf, drängen sich an die Wand, um ihn vorbeizulassen.
»Was gammelt ihr den ganzen Tag im Treppenhaus herum?«, mault Krüger. »Wo wohnt ihr denn?«
Die Kleinere der beiden deutet auf die rechte Eingangstür. »Da«, sagt sie leise.
Krüger fühlt seinen Körper schwanken. Disziplin, denkt er, Haltung zeigen. Er klammert sich mit beiden Händen am Geländer fest. »Und warum hockt ihr dann hier draußen?«, fragt er barsch. Die beiden Mädchen schauen sich kurz an und schweigen. »Ich habe euch was gefragt, also erwarte ich auch eine Antwort. Das Treppenhaus ist zum Treppensteigen und nicht zum Treppenhocken oder Spielen oder sonst was da.«
»Wir haben den Schlüssel drinnen vergessen«, antwortet die Größere kaum hörbar.
»Aha! Und eure Mutti? Wo ist die?«
»Die kommt gleich wieder, sie holt nur noch schnell was«, flüstert die Jüngere und nestelt an ihrem Rock herum.
»Kommt gleich, holt was. Das dauert aber lange bei eurer Mutti, dieses Holtwas«, murrt Krüger. »Wie heißt ihr beiden eigentlich?«
»Ich bin die Joana«, sagt die Größere der beiden, »und das ist meine Schwester Nela.«
»Aha, hab euch hier noch nie gesehen, aber egal«, murmelt Krüger.
»Und wer bist du?«, fragt Joana.
»Krüger vom elften Stock«, lautet seine knappe Antwort. Dann hangelt er sich die Treppe weiter nach oben.
Es dauert eine Weile, bis er den Schlüssel findet, noch längere Zeit benötigt er, bis das Teil im Schloss steckt. Krüger zieht die Schuhe aus und stellt sie an die Wand, dorthin, wo sie immer stehen. Ein paar Mal rückt er sie zurecht, bis sie seiner Meinung nach exakt parallel nebeneinanderstehen. Dann geht er in Socken auf den Balkon, um sich die letzte Zigarette für heute zu gönnen. Menschenferne Nacht.
Während er den Qualm durch die Nasenlöcher bläst und zusieht, wie sich der Rauch im Dunkeln auflöst, denkt er an früher. Da gab es in Marzahn noch viel Schnee, richtige Winter. Klein Krüger baute genau hier, wo jetzt die hohen Gebäude stehen, einen Schneemann, während Mutti alles vorbereitete, gutes Essen und das, was sonst noch so dazugehörte. Er rollte den Schnee zu einer großen Kugel, auf die er eine kleinere Kugel setzte. Die Kohlestücke für die Augen hatte er in der Jackentasche und eine Karotte für die Nase. Als der Schneemann schließlich vor ihm mitten auf dem großen, weißen, ruhigen Schneefeld aufgebaut war, dachte Krüger, er sei der glücklichste Junge weit und breit. Wenn Mutti dann auf dem Balkon mit der Glocke bimmelte, war es so weit. So schnell der Junge konnte, lief er zurück, riss das Gartentor auf, schellte an der Eingangstür und stellte seine Schuhe artig an ihren Platz. Er zog sich die feine Hose und den neuen Pulli an, den Mutti jeden Herbst für ihn strickte, und stand dann mit glühenden Wangen an der Wohnzimmertür. Und heute? Krüger befindet sich vor einem Häusermeer und starrt, wie seit Jahrzehnten schon, auf die ewig gleichen, blassen, hohen Wände, auf Fenster und Balkone.
Krüger schnippt die Kippe in die Tiefe und dreht sich um. Wieder Kind sein, unbeschwert, das wäre doch was, denkt er jetzt ein wenig melancholisch.
Er schaltet den elektrischen Kamin an, setzt sich in den Fernsehsessel und stiert in die künstlichen Flammen, die in die Höhe züngeln, während er gedankenverloren mit der Fernbedienung spielt. Ihm ist nicht nach der heilen Stimmung, die gerade in der Glotze gezeigt wird: wundervolle Welten in schönen Häusern, fröhliche Eltern, lachende Kinder – dieser ganze Unsinn. Krüger dämmert gerade langsam in den Halbschlaf, als er in der Ferne ein Martinshorn schrillen hört.
»Oh Mann, Krüger, du Penner, hätte dir auch eher einfallen können! Die Mädchen heute früh unten vor dem Haus, das waren die vom achten«, sagt er laut in den Raum und richtet sich kerzengerade auf. Er geht zum Werkzeugkasten, kramt nach den passenden Geräten und eilt zur Tür. So schnell es sein angetrunkener Zustand erlaubt, hastet er die Treppen hinunter in den achten Stock.
Dort liegen die Geschwister zusammengerollt und eng aneinandergekuschelt auf dem Fußabtreter vor der Tür, zwischen ihnen eingequetscht der Affe.
»Aufwachen, ihr beiden«, sagt Krüger, während er die schmalen Körper schüttelt. Dann macht er sich ans Werk. »Das heute früh im Krankenwagen war eure Mutti, stimmt’s?«, fragt er die Mädchen, nachdem sie aufgewacht waren. »Eure Mutti ist im Krankenhaus, hab doch recht, oder?« Die beiden nicken. »Und ihr hättet hier die ganze Nacht im kalten Treppenhaus gepennt? Mann, warum habt ihr denn nichts gesagt?«
»Wir haben gedacht, dass sie bald wieder zurückkommt«, antwortet die Größere.
Krüger schüttelt den Kopf und hantiert mit seinem Werkzeug am Schloss herum. »Was ist mit euren Nachbarn, warum habt ihr nicht bei denen geklingelt?«
Die Mädchen zucken mit den Achseln. »Die sind nicht nett, die schimpfen immer, wenn wir dreckige Schuhe haben.«
»Aha«, erwidert Krüger, »was hat denn eure Mutti?«
»Nichts Schlimmes, ihr war nur schlecht«, antworten die beiden wie aus einem Mund.
Krüger kratzt sich am Kinn. »Wenn jeder, dem mal schlecht ist, den Krankenwagen rufen und sich ins Krankenhaus bringen lassen würde, na, dann hätten die Sanitäter viel zu tun.«
Endlich steht die Tür offen. »Rein mit euch und ab ins Bett«, befiehlt er. »Zähneputzen und Gesicht waschen nicht vergessen, ihr zwei«, sagt er. Die beiden Kinder nicken artig und verschwinden in der Dunkelheit der Wohnung. Krüger sammelt sein Werkzeug zusammen und steigt gemächlich wieder die Treppen nach oben.
Genug für heute, denkt er. Er zieht seine Kleidung aus, legt sie sorgsam in den Schrank. Dann schlüpft er in den Pyjama und stellt sich einen Moment ans Fenster. Die meisten Lichter sind inzwischen erloschen. Marzahn ist in den Schlaf gefallen.
Krüger kriecht ins Bett, breitet die Decke über sich aus und löscht das Licht. Auf dem Nachttisch tickt der Wecker, es ist dreiundzwanzig Uhr sechsundfünfzig.
Noch vier Minuten, dann ist Heilig Abend vorbei.
3
WIR HÖREN AUF DEN SCHREI DER ERDE, auf den Schrei der Menschen. Wir suchen die Gerechtigkeit, den Sinn des Lebens. Wir verpflichten uns, das Wohlbefinden der Menschen in all ihren Lebensphasen zu fördern. Wir wollen Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung. Wir verstehen unser Engagement als globale Mission. Immer wieder suchen wir nach Antworten auf die sich ändernden, dringenden Nöte unserer Zeit.
Wir, das sind Angelika und ich, Michaela.
Wir sind Schwestern. Nicht im eigentlichen Sinn, nein, wir sind zwei Mitglieder der Missionsärztlichen Schwestern eines weltweit agierenden Ordens der katholischen Kirche.
Wir sind immer noch in Marzahn.
Obwohl man uns vor siebenundzwanzig Jahren vorhergesagt hatte, die Bewohner hier würden uns nicht lange dulden. Keine sechs Wochen hat man uns gegeben. »Spätestens dann sind Sie hier gescheitert«, sagte uns damals der Kardinal vorher.
Es war an einem tristen Novembertag im Herbst 1991, als wir uns ins Auto setzten und durch verschiedene Stadtbezirke der ehemaligen DDR-Hauptstadt fuhren: Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Weißensee und wie sie alle heißen. Die Häuser dort waren heruntergekommen, grau und schmuddelig, doch nah genug am Berliner Zentrum, um eines Tages zur begehrten Wohnlage zu werden. Wir ahnten damals schon, dass man die Menschen, die hier lebten, bald vertreiben würde, weil die zentrumsnahen Bezirke von Ostberlin nach der Wende an Attraktivität und Begehrlichkeit gewinnen würden. Die heruntergewirtschafteten, maroden Häuser würde man nach und nach renovieren, die Mieten würden für viele Menschen nicht mehr erschwinglich sein, all das war vorhersehbar. Also fuhren wir noch ein Stück weiter hinaus aus der Stadt, die Landsberger Allee entlang – die zweitlängste Straße Berlins, ohne Kurven – und zielstrebig in die kalte Peripherie. Knappe elf Kilometer. Immer geradeaus.
Wir verließen jene Teile der Stadt, in denen es Geschäfte und Lebendigkeit gab, und fuhren die breite Straße gen Osten, vorbei an Tankstellen, an brachliegenden, verwilderten Grundstücken, vorbei an beklemmenden großen Betongerippen mit eingeworfenen Fenstern und Graffiti an den Wänden. Die Straßen wurden immer leerer. Je weiter wir uns von der Innenstadt gen Osten entfernten, desto unwirtlicher erschien uns das, was wir sahen.
Dann tauchte das Konglomerat kühler, abweisender Riesenbauten, die im Grau des Himmels zu verschwinden schienen, vor uns auf, isomorphe Gebäude, Klone, hinter deren Betonplatten unzählig viele Menschen lebten oder nur noch existierten.
In der Allee der Kosmonauten machten wir halt und stiegen aus.
Da standen wir dann an diesem trüben Novembertag im Regen, in Marzahn, zwei Jahre nach der Wende.
Wir waren in ein bleiches Häusermeer eingetaucht und blickten schweigend die in die Höhe ragenden Wände an, die uns umzingelten, ohne Farbe, ohne Helligkeit, abweisend und düster. Mauern, hinter denen vom Leben enttäuschte, anschlusslose Menschen wohnten.
Wir haben in unserem Leben weiß Gott viel gesehen, schier Unvorstellbares erlebt.
Angelika war zuvor auf den Philippinen gewesen, hatte dort gesehen, wie unsere Mitschwestern den Ärmsten der Armen durch Mikrokredite und medizinische Hilfe durchs Leben halfen. Auf diese Weise leisteten sie seelischen Beistand und weckten Zuversicht.
Ich selbst arbeitete lange Zeit in einem Slum in Lima, sah Menschen in elendiger Armut in winzigen Hütten leben, Menschen, die im elendsten Dreck hausten, vom Leben abgehängt, von der Hoffnung auf eine bessere Zukunft ausgeschlossen.
Nun sind wir beiden Frauen in Marzahn angekommen.
Wir erahnten dort Seelen- und Sprachlosigkeit, verschüttgegangene Emotionen, während an diesem Novembertag graue Passanten an uns vorbeieilten.
»Mein Gott«, sagte Angelika, »schlimm hier.«
»Nicht so elend wie im Slum«, antwortete ich.
»Aber schlimmer als anderswo in Deutschland. Auf uns könnte eine besondere Art der Armut warten«, meinte Angelika, »eine andere, nicht greifbar dingliche. Auf den Philippinen wusste ich wenigstens, was die Menschen am Nötigsten brauchten: Nahrungsmittel und Medizin, Ausbildungsplätze, Schulen für die Kinder … verstehst du?«
Ich nickte.
»Aber hier? Womit fangen wir an? Und wie?«, fuhr Angelika fort.
Wir hatten viel Fachliteratur von Soziologen und Psychologen gelesen, bevor wir in Erwägung zogen, nach Marzahn zu gehen. Wir haben mit etlichen Leuten gesprochen, von denen wir meinten, sie verstünden die Situation der Menschen im Osten nach der Wende und könnten sie gut einschätzen. Vor allem aber verließen wir uns auf unsere eigenen unschätzbaren Erfahrungen, die wir im Lauf unseres Lebens hatten sammeln können. Das ist eine ganze Menge. Ich war damals gerade neunundvierzig Jahre alt geworden, Angelika war sechs Jahre jünger.
Als Missionsärztliche Schwestern ist es unsere Aufgabe, Menschen in Not zu helfen, sie zu heilen, ihre seelische Wunden zu versorgen, ihnen Selbstvertrauen und Hoffnung ins Leben zu geben.
An jenem Novembertag hatten wir Schwestern nur eine diffuse Vorstellung davon, was uns in dieser Trabantenstadt einmal erwarten würde.
Marzahn-Hellersdorf ist die größte Plattenbausiedlung Europas, ein seelenloses Wohngebiet, in das vom sozialistischen Regime einst so viel Hoffnung im Kampf gegen die allgemeine Wohnungsknappheit und Misere der DDR gesetzt worden war. Dort, so hatte es die Regierung damals ehrgeizig und verbissen angestrebt, sollten die Menschen ein schönes Zuhause finden, mit Licht, frischer Luft, viel Grün, Heizung, warmem Wasser und einer eigenen Toilette.
Es war eine kurze Hoffnung von nur zwölf Jahren gewesen. Kaum hatte man diesen Elitebezirk, das Vorzeige-Arbeiterquartier, auf einer Fläche von 820 Hektar mit über 38 000 Wohnungen errichtet, in die man mehr als 116 500 Menschen schachtelte, die dort dicht neben- und übereinander lebten, zerplatzte der sozialistische Traum eines lebenswürdigen Daseins und wurde nach der Wende zu einem Ort mit zweifelhaftem Ruf, an dem niemand mehr sein wollte.
Denn monotone Hochhaussiedlungen, sei es die in Marzahn, Gropiusstadt oder all den anderen Trabantenstädten, die mehr Aufbewahrungsorte als Wohngegenden sind, fordern den Menschen, die dort leben, viel ab. Sie versinken in einem anonymen Umfeld, ersticken in der Enge, verzweifeln am eintönigen Blick auf Wände mit Fenstern, auf verwaiste Spielplätze und hässliche Einkaufszentren. Die Menschen leben in diesen Wohnsilos wie in einem Getto. So fühlt es sich für all diejenigen an, die es woandershin nicht mehr geschafft haben. Trotzdem sind sie froh darüber, wenigstens ein Dach über dem Kopf zu haben. Das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr.
Als wir an jenem Tag zum ersten Mal nach Marzahn kamen, waren im Osten die Glücksgefühle über den Mauerfall schon längst der Ernüchterung gewichen.
Mitten in dieser Zeit des Wendeumbruchs zogen wir also nach Marzahn, es war verrückt und wagemutig zugleich. Wir waren Wessis, die in den Osten gingen, nachdem die große Euphorie bereits verpufft und der Groll auf jene gewachsen war, die die ehemalige DDR mit ihrem System überrollt und eingenommen hatten.
Wir wurden vom Westen über den Tisch gezogen, deswegen geht es uns jetzt bei Weitem nicht so gut, wie wir es verdient hätten! Ja, dieses Gefühl herrschte und herrscht bei den Menschen dort vor. Bis heute. In Fachkreisen nennt man es Projektion, wenn wir meinen, dass andere am eigenen Unglück Schuld tragen. Die Projektion ist ein Phänomen, das in jedem von uns als Mechanismus wirkt, damit wir mit unguten Situationen fertigwerden können. Projektionen durchziehen sämtliche zwischenmenschlichen Prozesse: die Partnerschaft, die Ehe, die Eltern-Kind-Beziehung sowie die gesellschaftliche Ebene, und damit auch die Ost-West-Beziehung Deutschlands. Wir können diesen Gedanken auch anders formulieren, dann besagt er, dass andere dafür zu sorgen haben, dass wir glücklich und zufrieden sind.
Angelika und ich, die beiden Wessis, verkörperten für die Menschen also so etwas wie Sündenböcke, waren eine willkommene Projektionsfläche.
Am meisten im Wege stand uns jedoch der Glaube. Wir sind Christinnen und dienen Gott. Aber wer, bitte, war Gott in der DDR? Ein Niemand.