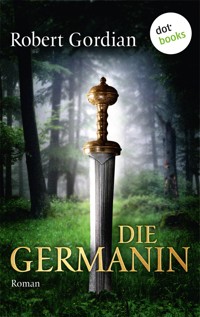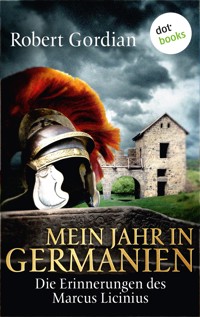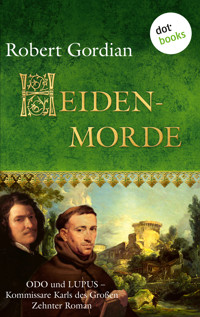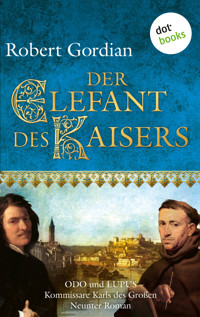9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das historische Epos auf über 2.100 Seiten: Die Merowinger-Saga »Das dunkle Lied von Macht und Blut« von Robert Gordian als eBook bei dotbooks. In dieser Familie gibt es nur Sieger und Besiegte … Als das fünfte Jahrhundert sich seinem Ende zuneigt, schließen in Nordeuropa zahlreiche Stämme ein mächtiges Bündnis: Sie nennen sich Franken – die Freien und Mutigen. Unter ihrem Anführer Chlodwig, dem jungen, ehrgeizigen König der Merowinger, setzen sie alles daran, sich vom Joch der römischen Besatzung zu befreien. Doch während Heere aufeinanderprallen und fern der Schlachtfelder gefährliche Intrigen gesponnen werden, müssen Chlodwig und seine Erben lernen, dass es selbst für unerschrockene Herrscher immer noch skrupellosere Feinde gibt: den eigenen Bruder, die eigene Schwester … Leidenschaftlich und fesselnd erzählt der erfolgreiche Autor Robert Gordian in diesem Sammelband, der seine 13-bändige historische Saga vereint, von einem Jahrhundert voller großer Schlachten, eiskalter Machtspiele und dem unstillbaren Hunger nach Ruhm – denn keine andere Familie hat der Welt des frühen Mittelalters so den Stempel aufgedrückt wie die Merowinger! Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Das dunkle Lied von Macht und Blut« von Robert Gordian, einem der vielseitigsten Autoren historischer Romane. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2604
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch:
In dieser Familie gibt es nur Sieger und Besiegte … Als das fünfte Jahrhundert sich seinem Ende zuneigt, schließen in Nordeuropa zahlreiche Stämme ein mächtiges Bündnis: Sie nennen sich Franken – die Freien und Mutigen. Unter ihrem Anführer Chlodwig, dem jungen, ehrgeizigen König der Merowinger, setzen sie alles daran, sich vom Joch der römischen Besatzung zu befreien. Doch während Heere aufeinanderprallen und fern der Schlachtfelder gefährliche Intrigen gesponnen werden, müssen Chlodwig und seine Erben lernen, dass es selbst für unerschrockene Herrscher immer noch skrupellosere Feinde gibt: den eigenen Bruder, die eigene Schwester …
Über den Autor:
Robert Gordian (1938–2017), geboren in Oebisfelde, studierte Journalistik und Geschichte und arbeitete als Fernsehredakteur, Theaterdramaturg, Hörspiel- und TV-Autor, vorwiegend mit historischen Themen. Seit den neunziger Jahren verfasste er historische Romane und Erzählungen.
Eine Übersicht über die eBooks, die Robert Gordian bei dotbooks veröffentlichte, finden Sie am Ende dieses eBooks bei den Lesetipps.
***
eBook-Sammelband-Originalausgabe Februar 2020
Die komplett überarbeiteten und erweiterten Neuausgaben der Merowinger-Romane von Robert Gordian, die in dieser Form erstmals 2014 bei dotbooks in 13 Bänden veröffentlicht wurden und nun in diesem Sammelband vorliegen, beruhen auf einer Tetralogie, die zwischen 1998 und 2005 in verschiedenen Verlagen veröffentlicht wurde: Der Wolfskönig und Die Heilige und der Teufel, veröffentlicht im Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin, Die schrecklichen Königinnen, veröffentlicht im Deutschen Taschenbuch Verlag GmbH, München, und Aufstand der Nonnen, veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg.
Copyright © der Originalausgabe »Der Wolfskönig« 2005 Aufbau Taschenbuch Verlag GmbH, Berlin
Copyright © der Originalausgabe »Die Heilige und der Teufel« 2006 Aufbau Taschenbuch Verlag GmbH, Berlin
Copyright © der Originalausgabe »Die schrecklichen Königinnen« 1998 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe »Aufstand der Nonnen« 1999 Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © der überarbeiteten Neuausgaben 2014 dotbooks GmbH, München
Copyright © der vorliegenden Sammelband-Originalausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Andrey_Kuzmin und shutterstock/detchana wangkheeree
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96148-409-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das dunkle Lied von Macht und Blut« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Robert Gordian
Das dunkle Lied von Macht und Blut
Die große Merowinger-Saga
dotbooks.
Erster Roman:LETZTE SÄULE DES IMPERIUMS
Dramatis personae
Chlodwig, König der salischen Franken (Tournai)Basina, Chlodwigs MutterSunna, Chlodwigs GemahlinAudofleda, Chlodwigs älteste SchwesterAlbofleda, Chlodwigs mittlere SchwesterLanthild, Chlodwigs jüngste SchwesterBaddo, Chlodwigs Vertrauter, früher MilitärtribunAnsoald, Chlodwigs GefolgsmannUrsio, Chlodwigs GefolgsmannBobolen, fränkischer PalastgrafBobo, Bobolens Sohn, Chlodwigs Gefolgsmann
Ragnachar, König der salischen Franken (Cambrai)Richar, Bruder des RagnacharRignomer, Bruder des RagnacharFarro, Liebhaber König Ragnachars
Chararich, König der salischen Franken (Tongeren)
Syagrius, letzter römischer Statthalter in GallienTitia, Frau des SyagriusScylla, Geliebte des SyagriusLeunardus, Comes palatii, Ratgeber des SyagriusStructus, Legat, Befehlshaber der Römer
Remigius, Bischof von ReimsChundo, Diakon
Droc, fränkischer KriegerDagulf, Kommandant einer WaldburgPotitius, GutsbesitzerCreatus, Verwalter des Poitius
Kapitel 1
»Achtung, da kommt Halleluja!«
Der kleine Ursio stieß diesen Ruf aus. Dreißig junge Männer stürzten gleichzeitig an die Mauer und blickten zwischen den Zinnen auf die Ebene vor der Festung hinab. Dort unten auf der alten Römerstraße näherte sich ein Reitertrupp mit einer Carruca in der Mitte, die von zwei Pferden gezogen wurde.
Alle kannten das mit einer Lederplane überdachte Gefährt. Unter dem Verdeck, das an diesem heißen Julitag vor der Sonne schützte, musste der kahlköpfige Oberpriester der Christianer sitzen.
In letzter Zeit besuchte er Tournai wieder häufiger. An einem Altar vor der einfachen Hütte, die sie ihre Kirche nannten, hatte er oftmals den Gottesdienst der Christianer zelebriert, und dabei hatten die Franken von ihm immer wieder das seltsame, unverständliche Wort »Halleluja« gehört. So war der würdige Mann zu diesem Spottnamen gekommen. Tatsächlich hieß er Remigius und war Bischof von Reims.
Einerseits war ja die Unterbrechung der Langeweile willkommen. Fast täglich in der besseren Jahreszeit versammelten sich die jungen Männer, die den Kern der Gefolgschaft bildeten, auf der Plattform des halbrunden Turms, an der Ecke der Wallanlage. Man sah von hier weit in das Land, und nichts, was dort unten geschah, blieb unbemerkt. Allerdings war der gleichbleibende Anblick des Flusses, der Hügel, Wälder, Wiesen und Hüttendächer auf die Dauer nicht sehr unterhaltsam, und nur von Zeit zu Zeit gab es etwas zu lachen, wenn etwa ein Fischerboot kenterte, ein Esel mit einem hochbeladenen Karren durchging oder ein Dieb auf dem Richtplatz vor dem Tor sich sträubte, aufgeknüpft zu werden.
Auch der Himmel bot wenig Abwechslung, besonders wenn er so gleichbleibend blau wie seit Tagen war. So vergnügten sich die jungen Männer mit Würfelspiel und Biertrinken, eine Beschäftigung, die sie gelegentlich durch eine Prügelei oder Messerstecherei unterbrachen. Aber sonst war nicht allzu viel los. Man wusste auch kaum, was in der Welt geschah, was hinter dem Horizont passierte. Die Ankunft von Besuchern löste daher gewöhnlich Freude und Neugier aus.
In diesem Fall aber war die Freude gedämpft, die Neugier nicht weniger. Alle kannten den Bischof, er war ja seit nahezu dreißig Jahren im Amt. Und fast jedes Mal, wenn er erschien, gab es Ärger.
»Halleluja kommt sich mal wieder beschweren.«
»Weil unser gottloses Treiben überhandnimmt.«
»Als ob unser Treiben ihn etwas anginge.«
Verschiedene Vermutungen wurden angestellt, worauf sich die zu erwartende Beschwerde beziehen könnte.
»Ich glaube, es geht ihm um den goldenen Leuchter«, meinte ein hübscher Schlingel mit blauen Augen und Adlernase namens Ansoald. »Und weil wir die beiden Christianer umgelegt haben.«
»Dabei waren die selber schuld«, fand der kleine krausköpfige Ursio. »Die sind uns ja direkt in die Lanzen gerannt.«
»Vielleicht will er auch Schadenersatz für das Dorf, das wir neulich eingeäschert haben.«
»Ich glaube, der will sich nur wieder mal bei uns durchfressen«, vermutete Bobo, ein wohlgenährter Bursche von beträchtlicher Körpergröße. »Immer kommen sie zu uns. Warum gehen sie nicht öfter zu denen von Cambrai?«
»Bei denen kriegen sie Prügel dazu«, witzelte Ursio. »Die Nachspeise schmeckt ihnen nicht.«
»Mir schmeckt nicht, dass Halleluja mich jedes Mal zu seinen Christengöttern bekehren will. Nun wird er mir wieder was vom Vater, vom Sohn und vom heiligen Geist vorquatschen.«
»Wenn er dich taufen will, mach es wie ich. Sag ihm, deine Flöhe vertragen kein Wasser.«
»Seht mal, da hat er noch jemanden bei sich!«, ließ sich neben Ansoald eine helle Stimme vernehmen.
Außer den dreißig jungen Männern befand sich auch ein Mädchen auf der Plattform. Die Schöne hieß Lanthild, war sechzehn Jahre alt, trug die Haare nach Männerart, Hosen mit Wadenbändern, einen groben Kittel, derbe Schuhe und am Gürtel eine Wurfaxt, die Franziska. Die meisten der jungen Burschen hatten ihre Kittel allerdings der Hitze wegen abgelegt. So viel Freiheit durfte sich Lanthild nicht nehmen.
Ihr Ausruf bezog sich auf einen kostbar gekleideten Reiter, der sich neben dem Wagen des Bischofs hielt.
»Vielleicht ist das wieder ein Freier für euch«, sagte Ansoald spöttisch. »So wie der aufgeputzt ist …«
»Dann soll er sich nur um meine Schwestern bemühen«, erwiderte sie. »Ich bin noch nicht dran, ich kann warten. Der da würde mir auch nicht gefallen«, fügte sie mit einem Lächeln für den hübschen Burschen hinzu.
»Alle mal herhören!«
Der scharfe Befehl kam von einem baumlangen jungen Kerl, der lässig an einer Zinne lehnte, den rechten Ellbogen oben aufgestützt, die linke Faust an der Hüfte. Es war einer, dem man sofort den Anführer ansah. Blitzende helle Augen, kräftige Nase, breite Kinnbacken, starkes Gebiss. Man erkannte ihn auch gleich als Merowinger: Dichtes, braunes Haar wallte fast bis zum Gürtel herab, so lang, wie es nur Angehörigen der göttlichen Sippe zu tragen erlaubt war. Und dass er auch König war, bezeugte der in der Sonne blinkende, goldene Siegelring, der die Aufschrift »CHLODOVICI REGIS« trug. In allem Übrigen unterschied sich der junge Mann kaum von den anderen: Stirnband, Ledergürtel mit Dolch und Franziska, Kittel und Hose aus Leinen.
Chlodwig, Sohn des Childerich, zwanzig Jahre alt, regierte bereits seit vier Jahren (nach heutiger Zeitrechnung seit dem Jahr 482) das fränkische Kleinreich von Tournai – oder regierte es auch nicht, je nach Betrachtungsweise. Im Augenblick war er jedenfalls nicht geneigt, sich den Nachmittag unter Freunden durch eine unerquickliche Begegnung mit dem stets anstrengenden, fordernden, langweiligen Oberhaupt der Reimser Christengemeinde zu verderben.
Deshalb sprach er die königlichen Worte: »Wir hauen ab, Männer! Heute empfangen wir nicht. Soll Halleluja sich bei meiner Mutter ausheulen. Wir haben noch etwas anderes vor. Nehmt eure Waffen und macht die Pferde bereit!«
Ein Jubelschrei aus dreißig Kehlen antwortete ihm. Das war etwas unvorsichtig, denn es wurde unten auf der Straße gehört, wo die bischöfliche Carruca schon unmittelbar vor dem Festungstor angelangt war. Alle ihre Begleiter sahen zur Höhe des Turms herauf.
Der Bischof selbst streckte den Kahlkopf unter der Plane hervor, blickte etwas verdutzt nach oben und winkte – in der Annahme, einen Freudenschrei zu seiner Begrüßung vernommen zu haben.
Indessen war König Chlodwig mit seiner Gefolgschaft schon in voller Absatzbewegung. Hastig zusammengerafft wurden die auf der Plattform verstreuten Kittel, Schuhe, Gürtel, Äxte, Messer und Würfelbecher. Zurück blieben leere oder zerbrochene Bierkrüge und abgenagte Knochen. Alles drängte und trampelte eine Wendeltreppe hinab, die bis an die niedrige Tür und ins Freie führte.
Gleich in der Nähe war eine Wiese, wo die Pferde weideten, kleine, stämmige Tiere aus eigener Zucht. In Windeseile wurden sie aufgezäumt und dann ein kurzes Stück an der Festungsmauer entlanggeführt. Hier tat sich, hinter Buschwerk verborgen und über breite, moosbedeckte Stufen erreichbar, die geheime, schon fast unterirdisch angelegte Pforte auf, die ein Entweichen vor ungebetenen Gästen ermöglichte, nicht nur so harmlosen wie dem Bischof.
Vor wenigen Monaten erst hatte sich Chlodwig mit den Seinen durch diese Pforte in Sicherheit bringen müssen, als seine drei Vettern aus Cambrai nach einem Familienzwist die Festung stürmten.
Hinter der Pforte begann der Wald. Die jungen Männer saßen nicht auf, sondern führten die Pferde am Zaum auf eine sehr schmale Schneise, die erst nach etwa einer Meile, wo der Wald sich etwas lichtete, breiter und ein bequemer Reitweg wurde. Einer nach dem anderen passierte mit seinem Pferd die Geheimtür und verschwand unter dem dichten Laubdach. Chlodwig stand seitlich an der Mauer und achtete darauf, dass keiner seine Waffen vergaß.
Zuletzt erschien Lanthild mit ihrer Stute.
»Was fällt dir ein?«, herrschte er sie an. »Du willst doch nicht etwa mit in die Waldburg?«
»Und was ist dabei?«, begehrte sie auf.
»Dort hast du nichts zu suchen, das weißt du doch. Das ist nichts für Mädchen. Du bleibst hier.«
»Ich langweile mich zum Sterben, wenn alle fort sind!«
»Besonders Ansoald. Habe ich recht?«
»Mit dem hab ich nichts im Sinn!«
»Ist mir schon aufgefallen«, sagte er lachend. »Wem fiele das nicht auf? Und jetzt gehst du zu unserer Mutter und sagst ihr, dass ich drei, vier Tage abwesend bin. Ich mache einen Umritt zwecks Sicherung und Überprüfung der Reichsgrenze.«
»Dazu brauchst du doch höchstens eine Stunde. Dann bist du doch rum um dein Reich!«
»Nun werd mal nicht frech, du Göre, sonst landest du noch in der Spinnkammer!«
»Bitte, Bruder …«
»Sage auch Bobos Vater Bescheid. Er soll Halleluja und seinen Leuten nichts Gebratenes vorsetzen, damit sie schnell wieder verschwinden. Hast du verstanden? Und schiebe den Riegel hinter mir vor!«
König Chlodwig zog den Kopf ein, zwängte sich und danach sein Pferd durch die Pforte und war im nächsten Augenblick unter den Bäumen verschwunden.
Kapitel 2
Als Lanthild den Riegel vorschob, rumpelte der Wagen des Bischofs bereits in den Hof des königlichen Palastes. Dieser ähnelte allerdings mehr einem heruntergekommenen Gutshof, was er im Grunde auch war, handelte es sich doch um ein ehemaliges Römergut, eine villa rustica. Nur das zweigeschossige Herrenhaus war in achtbarem Zustand, und es gab auch noch gut erhaltene Reste eines Säulengangs. Alles andere – die Wirtschaftsgebäude und die Wohnungen der Hofleute und Bediensteten – war arg vernachlässigt. Mauerwerk bröckelte, Balken waren verkohlt, Türen hingen in den Angeln.
Der Bischof kletterte von seinem Wagen herab, sah sich um, wiegte den Kahlkopf hin und her und murmelte seufzend: »Diese Barbaren! So hausen sie nun. Wie der Kuckuck im fremden Nest!«
Remigius war ein kleiner, quirliger Herr um die fünfzig, der niemals zu ruhen und zu rasten schien. Er war schon als Heiliger auf die Welt gekommen, und darin sah er eine Verpflichtung, der er sich keinen Augenblick seines Lebens entziehen durfte.
Ein blinder Eremit, dem zuvor ein Engel erschienen war, hatte seiner betagten Mutter verkündet, sie würde den Retter Galliens gebären, den Erneuerer der Kirche, den Erlöser vom heidnischen und arianischen Teufelsspuk.
Remigius wurde verheißungsgemäß geboren und tat unverzüglich sein erstes Wunder: Mit ein paar Tropfen Muttermilch, die er ihm auf die Augen strich, gab er dem Eremiten zum Dank für die Prophezeiung das Augenlicht wieder.
Weitere Wunder folgten im reiferen Alter: Ein Mädchen, das von Dämonen umgebracht wurde, machte er wieder lebendig und exorzierte sie anschließend erfolgreich.
Als man ihn einmal wegen Erbschleicherei verklagte, erweckte er rasch den Erblasser vom Tode, damit er dem Grabe entsteigen und vor Gericht die Unschuld des Remigius bezeugen konnte.
Sogar mit dem Gottessohn nahm er es auf. Ähnlich wie jener bei der Hochzeit zu Kanaa verhalf er einer durstigen Gesellschaft zu Wein, indem er über ein leeres Fass das Kreuz schlug.
Und nur durch sein inbrünstiges Gebet besiegte er in seiner Stadt Reims ein verheerendes Feuer.
All dies und die Gnadengabe, die Nachricht von solchen Mirakeln glaubhaft unter die Leute zu bringen, hatten ihm einen glänzenden Ruf verschafft.
Und so galt er auch bei den heidnischen Franken als Wundermann. Gewöhnlich empfingen sie ihn ohne Feindseligkeit und behandelten ihn achtungsvoll. Sie zum Bekenntnis des wahren Glaubens zu bringen, war ihm allerdings bisher nicht gelungen.
Doch er gab nicht auf und versuchte es immer wieder, hartnäckig und ideenreich. Drei- oder viermal im Jahr bereiste er ihre Gebiete im nordöstlichen Gallien. Diese gehörten zwar längst nicht mehr zum Imperium, und der römische Glaube war nicht mehr Staatsreligion, doch Remigius tat weiter so, als sei das alles noch wie zur Kaiserzeit seine Kirchenprovinz, für die er als Metropolit verantwortlich war.
Deshalb trug er auch diesmal wie stets zum Zeichen seiner Würde und Amtsgewalt die mit Perlen besetzte Mütze und die Seidenstola über dem Priestergewand. Und in der Hand hielt er den Hirtenstab, den er jetzt schüttelte, wobei er sich umsah und rief: »Warum empfängt uns denn hier niemand? Will uns keiner willkommen heißen? Heda, aufgemerkt, es sind Gäste da!«
Aus Scheunen und Ställen lugten neugierig ein paar strohköpfige Knechte. Hunde kläfften, Schweine trollten vorüber. Der vornehme Reiter, den man zuvor schon vom Turm aus bemerkt hatte, ein mondgesichtiger Jüngling, dessen gelockten Schopf ein breiter, silberner Stirnreif zierte, sagte mäklig: »Bist du sicher, Ehrwürdiger, dass wir hier auf einer Königsburg sind? Mir scheint, das ist nur ein gewöhnlicher Bauernhof.«
»Oder eine gewöhnliche Räuberhöhle«, bemerkte ein dünner Mann mit Hakennase und spitzem Kinn, der hinter dem Bischof vom Wagen gestiegen war. »Das ist die Hybris dieser Barbaren. Ein kleiner Häuptling – und nennt sich König!«
Hinter dem Dünnen sprang noch ein sehr junger Mensch vom Wagen, den eine tonsura Petri als Mönch auswies.
»Da soll man doch die Geduld verlieren!«, zürnte der Bischof und stieß den Stab heftig auf den Boden. »Wo ist der Hausherr? Kommt denn niemand?«
Endlich erschien unter den Säulen vor dem Herrenhaus ein schnurrbärtiger, behäbiger, dicker Franke. Es war Bobolen, der Vater des jungen Bobo, der das leitende Hofamt des comes palatii, des Palastgrafen, versah und somit als erster Mann nach dem König galt.
Er kam ohne Eile herbei und neigte respektvoll, doch nicht zu ehrerbietig den Kopf vor dem Bischof. »Salve! Es freut uns, dass du dich wieder mal zu uns begibst«, sagte er in bemühtem Latein. »Auch die anderen Herren … Wir fühlen uns durch euern Besuch geehrt. Man wird sich gleich um die Pferde kümmern.«
Er steckte zwei Finger in den Mund und stieß einen Pfiff aus. Ein paar Knechte kamen gemächlich herbei.
»Und wo ist dein König?«, fragte der Bischof missgestimmt. »Bisher war es üblich, dass mich der Hausherr selber willkommen hieß. Herr Childerich hat das niemals versäumt. Warum eifert der Sohn nicht dem Vater nach? Ist das bei euch Franken nicht Brauch? Und hat man uns denn nicht kommen sehen? Mir schien, dass man uns auf dem Turm bemerkt hatte.«
»Gewiss«, sagte der Palastgraf ohne Verlegenheit. »Es wird jeder bemerkt, der näher kommt. Leider hast du heute kein Glück. Da kommst du nun von weit her, machst bei der Hitze die beschwerliche Reise, und wie es der dumme Zufall will … der König ist fort.«
»Ist fort? Wie? Hat man ihn etwa vertrieben?«
»Das nicht. Er hat sich zu seinen Vettern nach Cambrai begeben. Ein Versöhnungsbesuch. Sie wollen im heiligen Hain den Göttern opfern und den Frieden beschwören.«
»Ach, lass mich mit deinen Göttern in Ruhe!«, sagte Remigius ärgerlich. »Chlodwig ist also nicht da. Wie schön! Da macht man sich nun Sorgen um ihn, will raten und helfen … kommt mit einem wichtigen Anliegen … bringt ihm auch einen vornehmen Freier für eine seiner Schwestern … und er? Ist wieder mal abwesend!«
»Du solltest erst einmal einen Trunk zu dir nehmen«, sagte Bobolen beschwichtigend. »Wir haben gut gekühlten Wein.«
Remigius nörgelte noch ein bisschen, ließ sich aber überreden. Der Franke führte ihn ins Herrenhaus, dessen Erdgeschoss in ganzer Länge und Breite als Empfangs- und Trinkhalle diente. Wuchtige Pfeiler stützten die Decke, Tische waren zu zwei längs und einer quer laufenden Reihe zusammengeschoben.
Der Raum war fast leer. Nur in einer Ecke saßen ein paar ältere Franken um einen Krug Bier.
In die Hände klatschend, verjagte Bobolen eine Hühnerschar, die auf den Tischen umherspazierte und Brotreste aufpickte. Unter den Tischen balgten sich Hunde, auch eine Ziege spazierte umher. Der Bischof und seine Begleiter ließen sich an der Querreihe auf den Bänken nieder, unter den Bälgen von Bären und Wölfen, die hinter ihnen als Trophäen an die Wand genagelt waren. Die Männer des Schutztrupps hielten sich abseits, die Knechte wurden woanders versorgt.
»Etwas Geduld!«, sagte Bobolen. »Gleich wird auch ein Imbiss aufgetragen, ihr müsst ja hungrig sein. Leider ahnten wir nichts von eurem Kommen, sonst wären wir besser vorbereitet.«
»Melde mich bei Frau Basina an«, sagte Remigius, nach wie vor missgestimmt. »Oder ist sie etwa auch unterwegs?«
»Die edle Frau Mutter des Königs ist anwesend. Ich bin sicher, sie wird erfreut sein, wenn sie hört, dass du da bist.«
»Dann solltest du ihr die Freude nicht länger vorenthalten.«
Der schnurrbärtige Palastgraf gab den Mägden, die noch rasch den Hühnerdreck von den Tischplatten wischten, ein paar Befehle, die Versorgung der Gäste betreffend, und verschwand dann über eine Treppe zum Obergeschoss.
»Ein Jammer, dass Childerich so früh dahinging«, sagte der Bischof, wobei er sich umdrehte und stirnrunzelnd zu den Trophäen hinter sich aufblickte. »Wenn er noch lebte, hinge dort jetzt das Kreuz statt dieser Scheußlichkeiten. Ich hatte ihn schon fast so weit. Noch zwei, drei Besuche, und er hätte sich taufen lassen.«
»Aber begraben ließ er sich wie ein übermütiger Heide!«, wandte der dünne Diakon Chundo ein. »Die Hälfte seines Schatzes soll er mit ins Grab genommen haben. Ganze Säcke voller Goldsolidi. Sogar sein Pferd hat man mit ihm bestattet.«
»Sein Pferd?«, fragte der junge Mönch mit runden Augen. »Hat man es extra umgebracht?«
»Was sonst? Sie haben es abgestochen und über seiner Grabkammer beigesetzt. Und zwar mit goldenem Zaumzeug! Aber damit wird er im Jenseits keinen Eindruck machen. Der Herr im Himmel wird wissen, wo sie das Geld gestohlen haben. In unseren Kirchen!«
»Still, Chundo, mäßige dich!«, sagte Remigius und blickte hinüber zu den Franken in der Ecke, die ihrerseits die Besucher neugierig musterten. »Halte dich an unsere Abmachung. Keine Schmähungen! Keine Beleidigungen! Das Beste wird sein, du hältst den Mund und lässt hier nur mich reden. Ich habe Erfahrung. Ich weiß, wie man mit ihnen umgehen muss.«
»Aber ist es denn wahr, was Chundo erzählt?«, fragte der vornehme junge Mann mit dem Silberreif. »Der König ließ sich die Hälfte seines Schatzes ins Grab legen? Da kann für die Mitgift seiner Töchter ja nicht mehr viel übrig sein.«
»Keine Sorge, Potitius, es ist genug da«, sagte Remigius. »Man muss nicht alles glauben, was Gerüchtemacher verbreiten. Mich selbst hat Childerich mal in seine Schatzkammer geführt. Ich war überwältigt! Goldbarren, Silberbestecke, edles Geschmeide, Perlen, Smaragde, Rubine!«
»Alles zusammengeraubt!«, murmelte Chundo.
»Als Föderal empfing er auch Hilfsgelder!«, wies ihn der Bischof zurecht. »Und vieles war wohl auch Kriegsbeute, nachdem er für römische Interessen – und damit auch für die unserer Kirche – gekämpft hatte. Mit solchem Gut eine christliche Ehe zu begründen, ist ja nicht verwerflich.«
»Wenn ich mich hier umsehe«, sagte Potitius, »kann ich kaum glauben, was du mir alles erzählt hast, Ehrwürdiger. Auf die Verwandtschaft mit diesem ›König‹ Chlodwig würde ich wohl nicht sehr stolz sein können. Und was die Bräute betrifft, die in Frage kommen … wahrscheinlich sind sie nur ungebildete Bauerntrampel. Aber ich sage dir eines: So eine nehme ich nicht!«
»Habe ich dir nicht versichert, dass sie die beste Erziehung genossen haben? Du wirst dich bald selbst davon überzeugen. Sie können ganze Gedichte auswendig hersagen … von Philodemon und Vergil und wem auch immer. Sie erhielten Unterricht bei dem Grammaticus Smerdis, den hatte ich selber empfohlen. Dein Vater weiß das alles, ich habe es ihm ausführlich berichtet. Hätte er dich sonst hergeschickt?«
»Mein Vater ist ein todkranker Greis, der seine Sinne nicht mehr beisammenhat«, sagte der Jüngling vorwurfsvoll. »Das hast du ausgenutzt!«
»Ich hätte ausgenutzt, dass dein Vater …«
»Du hast ihm gedroht, sonst werde es nichts mit der ewigen Seligkeit. ›Wenn du nicht vorher noch eine gute christliche Tat vollbringst‹, hast du gesagt, ›fährst du gleich nach dem Tode zur Hölle und bleibst dort in aller Ewigkeit.‹ Und als er fragte, was er noch tun könne, weil er ja nicht mehr viel Zeit hat, war deine Antwort: ›Verheirate deinen Sohn mit einer Merowingerin, damit kannst du noch alles wieder gutmachen. Wir müssen die heidnische Königssippe christlich unterwandern!‹ Waren das deine Worte? So stellst du dir das also vor. Mein Vater bekommt seine Seligkeit, und ich hab den Schaden.«
»Ein Christ muss jederzeit bereit sein, für seinen Glauben Opfer zu bringen«, bemerkte der Diakon Chundo, der sich bei seinem Vorgesetzten wieder beliebt machen wollte. »Der heilige Vater Remigius schont sich selbst nicht und hat manches Opfer gebracht.«
»Aber heiraten muss er nicht«, sagte der mondgesichtige Jüngling störrisch, wobei er den Silberreif, der verrutscht war, sorgfältig wieder auf seinen Lockenkopf drückte. »Das hat er nicht nötig. Da ist er fein raus.«
»Nun höre mir mal gut zu, Quintus Potitius!«, fuhr ihn der Bischof scharf an. »Du wirst mir noch einmal die Füße küssen, weil du in mir einen Fürsprech hattest. Von wegen Schaden! Andere würden sich darum reißen, eine Merowingerin zur Frau zu bekommen. Eine Verbindung mit der fränkischen Herrscherfamilie! Aber so ein Aristokratenspross wie du ist anscheinend blind und taub und glaubt wohl, er lebt noch immer im Römischen Reich, in der alten Herrlichkeit. Seit zehn Jahren gibt es in Rom keinen Kaiser mehr, den letzten hat ein Barbarenhäuptling davongejagt. Und hier in Gallien? Wo ist hier noch das Römische Reich? Es ist zusammengeschrumpft wie ein alter Arsch, und der könnte schon bald seinen letzten Furz lassen. Wenn unser glorreicher ›Reichsstatthalter‹, der Patricius Syagrius, nämlich nicht aufpasst, gehen die Reste seiner schönen Provinzen auch noch verloren. Goten, Burgunder, Alamannen … alle lauern schon auf die Gelegenheit – und die Beute. Und wer kann uns helfen, uns retten? Die Einzigen, auf die noch halbwegs Verlass ist, sind diese … die Franken. Wir brauchen sie, wenn sie uns auch eine Menge Ärger bereiten. Sie sind eine Macht, und wir haben Glück, dass sie sich dessen noch nicht bewusst sind. Noch sind ihre Töchter zu haben, du Dummkopf, aber bald könnte einer wie du ihnen nicht mehr fein genug sein!«
»Einer wie ich, der zwanzig Ahnen hat? Dessen Vorfahren Freunde von Caesar und Cicero waren? Das möchte ich sehen!« Potitius lachte abschätzig auf.
Der Bischof verzichtete auf eine Erwiderung, denn Bobolen war mit den Mägden zurückgekehrt und bot nun den Willkommenstrunk und den Imbiss dar.
»Der Wein ist selbstgezogen«, sagte er stolz. »Seid nochmals begrüßt und lasst es euch munden!«
Potitius nippte nur an seinem Becher und stellte ihn mit einer angewiderten Grimasse zurück auf den Tisch.
Der Bischof trank seinen Becher in einem Zug aus und bat, man möge nachschenken. »Ein köstlicher Wein«, befand er. »Und ohne Zweifel etwas für Kenner. Ich glaube, dass ihn nur kluge Leute zu würdigen wissen!«
Kapitel 3
Die Ankunft des Bischofs kam Frau Basina ungelegen.
Als Bobolen mit der Meldung kam, war sie gerade damit beschäftigt, ein Kleid von feinem Brokatgewebe anzuprobieren, das eine ihrer Mägde gefertigt hatte. Es stand ihr gut, wie auch ihre beiden älteren Töchter Audofleda und Albofleda fanden. Einige Nähte mussten freilich noch einmal aufgetrennt und versetzt werden, weil die füllige Witwe Luftmangel verspürte. Aber das war rasch ausgeführt, und die Mutter des Königs hätte jetzt eigentlich nichts lieber getan, als in dieser neuen, festlichen Robe einen Gast zu empfangen.
Zum Glück fiel Audofleda aber noch rechtzeitig auf, dass in den Brokat an mehreren Stellen Kreuze eingestickt waren. Eines zierte sogar den enormen Busen der hohen Dame und konnte somit nicht übersehen werden. Das war fatal, denn die Kreuze verrieten die Herkunft des teuren Gewebes. Noch vor einem Monat lag es als Altartuch in der Kirche von Bavai. Chlodwig und seine Gefolgschaft hatten es bei einem ihrer letzten Beutezüge mitgehen lassen. So musste sich Frau Basina wohl oder übel aus dieser prächtigen Hülle schälen und sie vorerst in einer Truhe verschwinden lassen. Das verdross sie, und absichtlich nahm sie sich viel Zeit beim Umziehen. Erst gegen Abend, als es bereits zu dämmern begann, empfing sie den Bischof.
Remigius betrat ihr Gemach in Begleitung des Diakons Chundo. Die beiden Geistlichen grüßten ehrerbietig, und der Bischof wollte mit einer wohlformulierten Anrede beginnen. Aber da wurde er schon angefahren.
»Was willst du hier wieder, Remigius? Du warst doch im Frühjahr erst hier! Dauernd kommst du mit irgendeinem Ansinnen! Was haben wir dir schon wieder getan? Wir leben hier mit unseren Sorgen und Mühen und tun niemandem etwas zuleide. Mein Sohn ist nicht da, er geht seinen Pflichten nach. Und was mich betrifft … ich komme kaum noch von meinem Stuhl hoch, weil meine Beine mich nicht mehr tragen. Was kann ich also verbrochen haben? Willst du mir etwa wieder Vorwürfe wegen der alten Geschichten machen? Ich sage dir, was ich dir immer sage: Das geht dich nichts an! Und deinen Gott geht es auch nichts an, mit dem hab ich nichts zu schaffen!«
Frau Basina, jetzt fränkisch gekleidet, im einfachen Kittel, als gute Hausfrau mit den Schlüsseln am Gürtel, saß massig in ihrem gepolsterten Armstuhl und redete unaufhörlich weiter. So blieb dem Bischof nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis ihr der Atem ausging. Er kannte solche Empfänge, war abgehärtet. Die Barbarendamen, besonders die vornehmen, waren schwierig, selbstgefällig und rechthaberisch, und es war ihnen nur schwer beizukommen. Mit dieser hatte es noch eine besondere Bewandtnis.
Basina war nicht Fränkin, sondern Thüringerin. Vor über zwanzig Jahren war sie mit König Bisin verheiratet gewesen, der noch immer irgendwo jenseits des Rheins seinen wilden Germanenstamm regierte. Als sie siebzehnjährig seine Frau wurde, lebte ein Flüchtling an seinem Hof – Childerich, der vertriebene Frankenkönig. Die fränkischen Großen hatten ihn abgesetzt und außer Landes gejagt, weil er sich immer wieder an ihren Frauen und Töchtern vergangen hatte. Bei König Bisin, einem entfernten Verwandten, hatte der Heimatlose Asyl gefunden, und jetzt fand er Gelegenheit, sich zu bedanken – auf seine Weise. Er verführte Bisins junge Gemahlin. Wenig später erfuhr er, dass ihn die Franken zurückhaben wollten, und verschwand so plötzlich, wie er gekommen war.
Basina blieb bei ihrem Gatten zurück und verzehrte sich nach ihrem Liebhaber. Sie schlief nicht mehr, aß nicht mehr und tat schließlich etwas Unerhörtes. Bei Nacht und Nebel verließ sie die Königsburg und machte sich, von nur wenigen Vertrauten begleitet, auf den Hunderte Meilen langen Weg zu den Franken. Sie bestand unzählige Abenteuer, entkam immer wieder ihren Verfolgern und erreichte nach einem halben Jahr Tournai. Hier fiel sie Childerich in die Arme. Sie erklärte dem Überraschten, er sei nun einmal »der Tüchtigste«, und einen anderen als ihn wolle sie nicht lieben. Wenn es irgendwo einen noch Tüchtigeren gäbe, sei es jenseits des Meeres, würde sie abermals nicht zögern und zu ihm eilen.
Childerich war gerührt und geschmeichelt. Dass die Königin eines großen Reiches unter Gefahr für Leib und Leben zu ihm, dem Kleinkönig, floh, hob sein Selbstgefühl beträchtlich. Er feierte Hochzeit mit ihr, obwohl sie ja nach wie vor mit Bisin verheiratet war, und seine Tüchtigkeit wurde hinfort so von ihr in Anspruch genommen, dass er das Wildern in fremden Revieren vollständig aufgab. Er wurde ein braver Ehemann und zeugte mit ihr vier Kinder: Chlodwig, Audofleda, Albofleda und Lanthild.
Das also waren die »alten Geschichten«. Wenn Remigius den Verblichenen auch gerade noch gegenüber dem Diakon Chundo verteidigt hatte, so war er ihm doch im Stillen gram. Er hatte einen endlosen Kampf um die Seelen der beiden Ehebrecher hinter sich. Das Bewusstsein des Unrechts für ihre Sünde zu wecken und daraus die Sehnsucht nach einem Erlöser, den er in der Gestalt des Herrn Jesus Christus bereithielt, hatte er sich viel Zeit und Mühe kosten lassen.
Doch das Ergebnis war leider unbefriedigend. Childerich, der am Ende seines Lebens rasch verfiel, hatte keine Kraft mehr zur Bekehrung. Er fürchtete zwar den schändlichen »Strohtod«, der ihm bevorstand und ihm den Zugang nach Walhall versperrte, wo sich nur die im Kampf gefallenen Helden ewig vergnügten. Ganz gern hätte er deshalb ersatzweise das Paradies gewählt. Frau Basina wollte das aber nicht dulden.
Nachdem Remigius das Paradies – vielleicht etwas zu leidenschaftlich – als einen von Engeln bevölkerten Ort ewiger Lust beschrieben hatte, hielt sie es für eine Art Freudentempel, wo sich ihr Gatte mit regenerierter Tüchtigkeit außerehelich vergnügen würde. Dies missgönnte sie ihm aus Eifersucht, und da sie ihn in seinen letzten Jahren völlig beherrschte, fügte er sich.
Er bekam also Schwert und Ross mit ins Grab, obwohl er sicher war, dass ihm das »drüben« nichts nützen würde. Frau Basina beweinte ihn angemessen. Als dralle Matrone im vollen Saft sündigte sie nach der Trauerzeit weiter (man munkelte: mit Bobolen) und ließ den Bischof auch weiterhin hartnäckig abblitzen. Doch ebenso hartnäckig setzte er seine Bekehrungsversuche fort.
Diesmal hatte er sich für sie eine neue Taktik zurechtgelegt. Als sie nun endlich, nach Atem ringend, den Mund hielt, sprach er sanft, mit bedeutsamer Miene: »Ich habe eine gute Botschaft für dich, edle Frau. Und trotz der Hitze bin ich hierhergeeilt, damit du sie gleich erfährst.«
»Eine Botschaft?«, fragte die ehemalige Königin hoch atmend, mit skeptischer Miene. »Was kannst du mir schon Gutes bringen?«
»Hör zu. Im Traum erschien mir der heilige Martin von Tours. Er nahm mich bei der Hand und führte mich in ein Haus und sprach: ›Siehe, Remigius, diesen Palast‹ – denn es war ein Palast mit Säulen, Türmen, Balkons und einem herrlichen Garten –‚ ›diesen Palast habe ich für König Childerich reserviert. Obwohl der Arme wie alle Heiden erst einmal zur Hölle gefahren ist. Ich gebe nämlich die Hoffnung nicht auf, dass er dort wieder herauskommen wird.‹
›Wenn die edle Frau Basina‹, fuhr der heilige Mann fort, ›den dreifaltigen Gott bekennt und der römischen Kirche beitritt, wird er unverzüglich in den Himmel entlassen und darf hier einziehen. Denn dieser Palast ist für sie beide bestimmt, und wenn Frau Basina eines Tages das Ziel ihres irdischen Wandelns erreicht hat, werden sie hier gemeinsam leben … in ewiger Jugend, glücklich vereint. Und er wird so tüchtig und sie wird so schön sein wie in ihren besten Zeiten auf Erden.‹ Ich wollte, dass du es gleich erfährst. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung?«
»So etwas träumst du also«, sagte die Königinmutter. »Das sind ja Sachen.«
Remigius merkte, dass er sie noch nicht überzeugt hatte, und fuhr rasch fort: »Ja, und gleich geschah noch etwas Wunderbares! In derselben Nacht, zur selben Stunde, erschien im Traum dem Diakon Chundo, den ich dir hier als Zeugen mitgebracht habe, derselbe Palast im Himmel und darin ein Bett mit einem Paar, das sich leidenschaftlich umschlang. Und das warst du mit deinem Gatten. Was sagst du zu so viel Übereinstimmung?«
»Es gehört sich nicht, so etwas zu träumen«, sagte Frau Basina und warf einen strengen Blick auf Chundo. »Ihr Kirchenmänner seid verdorben und schamlos. Das hat auch Childerich immer gesagt.«
»Aber ich habe ja gar nicht …«, protestierte der Dünne.
»Du hast es gebeichtet!«, zischte Remigius. »Zwischen Vigil und Frühmette träumst du immer von kopulierenden Paaren. Warum nicht von diesem?« Und laut, an Frau Basina gewandt, fuhr er fort: »Er hat nichts Unziemliches geträumt. Er konnte auch gar nichts erkennen, weil plötzlich das Paar in gleißendes Licht getaucht war. Es war die Aureole des heiligen Martin, die den Diakon blendete. Und auch zu ihm sprach der Heilige und sagte: ›Die beiden dort in dem Palast … das sind mein Sohn Childerich und meine Tochter Basina, das Königspaar, nachdem sich Basina zum dreifaltigen Gott bekannt hat.‹ Es versteht sich, dass der Heilige in die Zukunft blickt und sicher ist, dass du mit Childerich wieder vereint sein willst.«
»Aber das kann ja noch lange dauern«, sagte die Witwe, nachdem sie einen Augenblick nachgedacht hatte. »Zum Sterben ist es für mich zu früh. Warum kannst du mir Childerich nicht wieder lebendig machen? Dann würde ich glauben, was ihr Christianer erzählt. Du sollst ja schon mehrere Tote wieder lebendig gemacht haben.«
»Das ist nicht so einfach, edle Frau, und in diesem Fall ist es unmöglich. Erstens muss der Tote ein Christ sein, und zweitens darf er noch nicht so lange tot sein, wie es Herr Childerich ist. Ja, hätte er sich noch taufen lassen, und wäre ich gleich nach seinem Ende gerufen worden, dann hätte ich es mit Gottes Hilfe vielleicht noch geschafft. So muss ich dich leider auf die herrliche Zeit im Jenseits vertrösten, in dem himmlischen Palast. Freust du dich nicht darauf?«
»Sind auch Engel in dem Palast?«, fragte die hohe Dame misstrauisch.
»Es werden ab und zu einige nach dem Rechten sehen und als Boten Gottes nach euern Wünschen fragen«, erwiderte der Bischof vorsichtig. »Sonst verhalten sie sich aber sehr rücksichtsvoll und bleiben die meiste Zeit unsichtbar.«
»Ja, werden wir etwa ganz allein sein? Ohne Verwandte, ohne Gefolge, ohne Knechte und Mägde?«
»Der Palast wird voller seliger Geister sein … zu eurer Bedienung und Unterhaltung.«
»Es werden also auch Frauen da sein.«
»Auch Frauen, natürlich.«
»Und du sagst, Childerich wird sofort in den Himmel entlassen, wenn ich mich zu euch bekenne?«
»Unverzüglich! Das hat mir der heilige Martin zugesichert. Und der muss es wissen. Er sitzt ja direkt an Gottes Thron.«
»Wenn es so ist, werde ich noch warten«, sagte Frau Basina entschlossen.
»Noch warten? Warum? Warum denn?«
»Ich kenne Childerich gut genug. Er würde es nicht aushalten, bis ich sterbe. Er würde sich an alle diese Frauen heranmachen.«
»Aber bedenke, wo er sich im Augenblick aufhält. Er schmachtet in der Hölle!«
»Es ist besser, er bleibt dort so lange. Umso größer ist dann die Freude, wenn er mich wiedersieht. Ich habe mich auch noch nicht entschieden. Nein, nein, das habe ich nicht! Mein Sohn würde mir auch sehr übelnehmen, wenn ich plötzlich die alten Götter verließe.«
Der Bischof schwieg. Die Absage hatte ihre Logik, das musste er im Stillen einräumen.
Plötzlich zupfte ihn der Diakon Chundo am Ärmel und suchte ihn mit unauffälligen Kopfbewegungen auf etwas aufmerksam zu machen. Remigius wehrte ihn aber ärgerlich ab und bemühte sich, seinen Bekehrungsversuch wenigstens noch zu einem halben Erfolg zu führen.
»Aber rührt es denn nicht dein Herz«, wandte er sich wieder an Frau Basina, »dass dein Gemahl im Höllenfeuer schmort und von tausend Teufeln gepeinigt wird?«
»So schlimm wird es ja nicht sein«, fand die edle Witwe, »sonst könnte er ja im Himmel nicht wieder zu Kräften kommen, wie du behauptest. Und was kann ich dagegen tun?«
»Du könntest seine Leiden erleichtern und dafür sorgen, dass er in eine Abteilung der Hölle kommt, wo es weniger grausam zugeht.«
»Und wie?«
»Indem du den heiligen Martin als Fürsprech gewinnst. Der Heilige sieht betrübt, dass Franken unter dem Befehl deines Sohnes immer wieder in das Gebiet des römischen Patricius eindringen. Dass sie dort auch aus Kirchen und Heiligtümern alles, was Wert hat, entfernen. Dass sie auch sonst sehr viel Unheil anrichten. Du hast doch Einfluss auf deinen Sohn. Benutze ihn! Wenn du es schaffst, diesen Übergriffen ein Ende zu setzen, wird sich der Heilige erkenntlich zeigen. Ganz besonders wirst du ihn dir verpflichten, wenn alles, was neulich in der Kirche zu Bavai abhandengekommen ist, den Eigentümern zurückgegeben wird. Wir haben mit Hilfe des dortigen Priesters eine Liste angefertigt. Da wären zum Beispiel …« – Remigius nahm ein Pergament zur Hand, das Chundo schon bereitgehalten hatte – »ein hoher goldener Leuchter, sein silberner Messkelch, ein Altartuch aus feinem Brokat …«
»Davon weiß ich nichts!«, unterbrach ihn Basina schroff. »Behauptest du, dass wir Franken Diebe sind? Wer weiß, wer eure Kirche bestohlen hat! Vielleicht haben es eure eigenen Leute getan, diese Landstreicher. Sie werden alles unter ihren Kutten versteckt und sich davongemacht haben. So viele streunen umher …«
»Sie lügt!«, flüsterte neben dem Bischof der Diakon Chundo und machte wieder die unauffällige Kopfbewegung.
Remigius folgte der Richtung seines Blickes und bemerkte die Truhe in der Ecke. Von einem Kleidungsstück, das hineingestopft war, hing noch ein Zipfel heraus. Und dieser Zipfel war mit einem Kreuz bestickt.
»Wir wollen nicht kleinlich sein«, sagte der Bischof, wobei er Chundo gegen das Schienbein trat. »Ich habe aber hier auf der Liste noch verschiedene andere Gegenstände. Leider ist es schon dunkel …«
»Onofrio!«, schrie Basina. »Licht! Lies nur vor«, sagte sie zu Remigius, »lies deine lange Liste vor. Finden wird sich hier nichts davon!«
Kurz darauf trat ein Diener ein und trug mit sichtlicher Anstrengung einen halb mannshohen Kandelaber herein, von dem strahlende Helle ausging. Glanz verbreiteten nicht nur die zahlreichen Lämpchen, die an zierlichen Ketten hingen, sondern auch der Fuß, der Schaft und die Arme des prachtvollen Leuchters, deren edles Metall das Licht reflektierte.
Der Diakon Chundo fuhr heftig zurück. »Das ist er!«, schrie er. »Das ist er! Der Leuchter, der in Bavai gestohlen wurde!«
Im ersten Augenblick war auch Frau Basina erschrocken. »Dummkopf!«, fuhr sie den Diener an. »So viel Licht brauchten wir gar nicht!« Doch gleich fasste sie sich und gab sich entrüstet. »Was fällt dem denn ein? Was behauptet er da? Der Leuchter …«
Remigius hob abwehrend die Hände.
Doch Chundo war in seinem Drang nach Wahrheit nicht mehr aufzuhalten. »Er ist es! Der Fuß in Form einer Löwenpranke! Kleine Schiffchen als Ölbehälter! Vom Kaufmann Lupus Sotimus der Kirche gestiftet. Damit Messen gelesen wurden, für seine glückliche Heimkehr aus dem Orient. Gib her! Gib ihn her!«, schrie er den Diener an. Er packte den Kandelaber und brachte ihn nach kurzem Gezerre an sich.
Aber die Heftigkeit der Bewegungen und das Gewicht des Gegenstands rissen den dünnen Gottesmann fast von den Füßen. Er schwankte so sehr, dass das brennende Öl aus den Lämpchen herausspritzte. Der Polsterbezug eines Hockers fing Feuer und flammte auf. Auch aus dem Teppich schossen Flämmchen empor.
»Feuer!«, kreischte Basina. »Feuer! Zu Hilfe! Diebe! Brandstifter!«
Im nächsten Augenblick stürzten mehrere Männer herein, Bobolen an der Spitze.
Remigius wollte etwas erklären, wurde jedoch beiseitegestoßen.
Einer der Männer warf den brennenden Hocker aus dem Fenster. Andere versuchten, die Flammen auf dem Fußboden auszutreten. Man schrie nach Wasser.
Endlich schleppten Mägde einen Bottich herbei, der über dem Teppich ausgeleert wurde. Die Flammen erloschen. Stinkender Qualm verbreitete sich.
Bobolen half Frau Basina, die heftig hustete, aus dem Armstuhl und führte sie hinaus. Der Bischof rief ihr nach, es tue ihm leid und es handele sich um einen Irrtum aus Übereifer. Aber da wurde er schon von zwei Knechten gepackt und die Treppe hinuntergezerrt. Chundo folgte ihm, immer noch taumelnd, doch jetzt der Fußtritte und Faustschläge wegen, die von allen Seiten auf ihn einprasselten. Die beiden Geistlichen wurden über den Hof zu dem Turm an der Ecke der Wallanlage geschleppt und landeten im Festungsverlies.
Kapitel 4
König Chlodwig gähnte.
Die langen Beine angezogen, die Arme um die Knie gespannt, hockte er an einem der Feuer, die auf dem Platz vor dem ehemaligen Prätorium brannten. Obwohl es schon auf Mitternacht ging, war die Unterhaltung ringsum noch lebhaft, es wurde getrunken und gesungen. An den Bratspießen hing noch Fleisch, und alle Augenblicke erhob sich einer und zückte seinen Dolch oder ein Messer.
Die Stimmung war prächtig, wie stets vor einem Beutezug. Die Männer erzählten sich ihre Abenteuer bei früheren Unternehmungen und schwelgten im Vorgefühl des üppigen Gewinns, den sie diesmal erhofften. Eine der größten Domänen im Norden des gallorömischen Restreiches war ausgewählt worden, nachdem sie lange verschont worden war. Die Franken wollten in aller Frühe aufbrechen und die gut vierzig Meilen in zwei Tagemärschen zurücklegen. In der darauffolgenden Nacht sollte es dann zum Überfall kommen.
Chlodwig starrte schweigend in die herunterbrennenden Flammen. Er beteiligte sich nicht mehr an den Gesprächen. Es war ja alles gründlich beredet. Eigentlich hatte er diesmal die Waldburg ohne eine bestimmte Absicht aufgesucht. Er hatte sich in Tournai gelangweilt und »Halleluja« ausweichen wollen. Doch hier hatte er erfahren, dass die Gelegenheit günstig war. In einem solchen Fall war es nicht seine Art zu zögern.
Die Besatzung der Waldburg, eine Hundertschaft erfahrener Krieger, hatte wie immer den Zug gut vorbereitet. Die Spione hatten die schwachen Punkte der Mauern und Zäune ermittelt. Sie hatten auch festgestellt, dass der Besitzer der Domäne, ein Senator aus Reims, die Wachmannschaft aus irgendeinem Grunde ausgetauscht hatte. So bekam man es jetzt mit unerfahrenen Leuten zu tun, die sich in ihrer neuen Umgebung noch kaum richtig auskennen würden.
Ein Teil des Getreides war bereits ausgedroschen und in Vorratsfässern gelagert, und man hatte herausbekommen, in welche Speicher man einbrechen musste. Auch die versteckten Trampelpfade, die zu den nächtlichen Weideplätzen der Herden führten, waren erkundet.
Aus Dörfern in der Umgebung der Waldburg waren noch rasch über hundert Männer zur Verstärkung herbeigeholt worden. So würde man mit zweihundertfünfzig Bewaffneten angreifen. Ein größeres Aufgebot war nach Meinung der Waldburgleute nicht notwendig, und man konnte sich auf ihr Urteilsvermögen verlassen.
Alle Aufgaben waren verteilt, die Kommandos vergeben, die Trupps zusammengestellt.
Die Besten der jungen Gefolgschaft, die mit dem König aus Tournai gekommen waren, und eine zweite Abteilung der Jungmannschaft würden das Herrenhaus und die Gesindeunterkünfte stürmen. Sie würden die folgsamen, nützlichen Leute zusammentreiben, die unnützen und widersetzlichen niedermachen, die wertvollen Beutestücke sichern, schließlich die Brände legen.
Alles sollte so ablaufen wie immer.
Der dicke Bobo, der eines Tages seinen Vater als Palastgraf beerben wollte, würde mit der Peitsche in der Hand die Fuhrknechte antreiben. Der hübsche Ansoald würde die Gefangenentrecks zusammenstellen und aufpassen, dass keine der jungen Mägde entschlüpfte. Und der lustige Ursio würde zum Spaß einige schwächliche Alte ins Feuer stoßen und ein paar plärrende Kleinkinder hinterherwerfen.
Im Morgengrauen würde alles getan sein.
Siegreich, betrunken und grölend würden sie abmarschieren. So machten es germanische Haufen seit Hunderten von Jahren. Daran war nichts Besonderes.
Chlodwig gähnte abermals und erhob sich.
Es wurde Zeit, zur Ruhe zu gehen. Vorher wollte er aber noch einen Rundgang machen und die Torwachen kontrollieren. Diese Gewohnheit hatte er von seinem Vater übernommen. Besonders in seinen letzten Lebensjahren hatte Childerich immer und überall Feinde gewittert.
Ein Herrscher sammelte sein Leben lang Feinde, diese Erfahrung machte Chlodwig schon selbst. Zwei Anschläge auf sein Leben hatte er in den vier Jahren als König bereits überstanden.
Im ersten Fall hatte ihm einer der bei diesen Beutezügen geschädigten gallorömischen Aristokraten einen Mörder geschickt. Der hatte sich aber durch auffälliges Benehmen verraten, und sein abgeschlagener Kopf konnte dem Auftraggeber wohlverpackt zugeschickt werden.
Im zweiten Fall war es ein Komplott, und es waren sogar Verwandte beteiligt gewesen. Er hatte alle hinrichten lassen – mit der Folge, dass seine Vettern aus Cambrai, wahrscheinlich die Hintermänner des zweiten Anschlags, mit ihrer Streitmacht als Rächer heranzogen und ihn aus Tournai vertrieben. Hier in der Waldburg konnte er Kräfte sammeln, sich rüsten und schließlich den Gegenangriff riskieren.
Es kam zur Versöhnung, aber man traute einander nicht mehr. Und es war wohl auch nicht zu vermeiden, dass es irgendwann zur Entscheidung kam. Man lebte nebeneinander auf zu engem Raum. Man gebot über eine ständig wachsende Kriegerschar. Man war sich im Wege. Und es gab ja eine einfache Lösung.
Da die Franken nur von Merowingern beherrscht werden wollten, weil nach dem Rat der Götter nur Merowinger das zum Herrschen nötige Heil besaßen, genügte es, die Angelegenheit in der Familie zu regeln. Jeder tote Merowinger bedeutete mehr Macht und mehr Sicherheit für die lebenden.
Chlodwig winkte Dagulf, dem Kommandanten der Waldburg, und sie gingen den Hauptweg entlang auf das östliche Tor zu.
Wie alle Paläste und Burgen, in denen sich nach und nach seit zweihundert Jahren die Franken eingerichtet hatten, war auch die Anlage der Waldburg einst von Römern errichtet worden. Man erkannte noch die Grundform, das castrum, mit seinen streng rechtwinklig angelegten Straßen, Wällen und Gräben. Die römischen Holzbaracken waren natürlich längst verschwunden. Jetzt standen hier strohgedeckte fränkische Bauernhütten, zwischen denen Unterholz wucherte. Aus der sorgsam gepflasterten via principalis, auf der sich Chlodwig und sein Begleiter befanden, war ein von Gras, Moos und Schotter bedeckter holpriger Weg geworden. Nur der hohe Palisadenzaun, dem sie sich näherten, wurde ständig ausgebessert und erneuert. Gleich hinter ihm erhob sich ein schwarzer Wald vor dem hellen, vom Mondlicht überstrahlten Himmel.
Dagulf, ein kleiner, knorriger Graubart mit krummen Beinen, hatte Mühe, den raumgreifenden Schritten seines zwanzig Jahre jüngeren und zwei Köpfe größeren Königs zu folgen.
Er geriet außer Atem und blieb schließlich ganz zurück, ohne dass Chlodwig es gleich bemerkte. Der junge Mann, in Gedanken versunken, nahm auch nicht wahr, dass Dagulf plötzlich vom Wege abkam und mit einem seltsamen Rückwärtssprung im Gebüsch verschwand.
Gleich darauf war ja der leichte Schritt schon wieder vernehmbar. Er kam rasch näher, und als er jetzt fast neben ihm war, sagte Chlodwig: »Ich habe gehört, dass sich da draußen im Wald ein Mann herumtreibt. Er schleicht umher, taucht auf, verschwindet gleich wieder. Die Wachen beobachten ihn, versuchen, ihn einzufangen. Was ist das für ein Kerl? Ich will …«
Da blitzte etwas vor ihm auf. Mit der Raschheit des immer Wachsamen warf er den Kopf zurück und griff zu. Er bekam ein Handgelenk zu fassen und hörte es neben sich keuchen.
Die Augen mit rückwärts gebogenem Hals nach unten drehend, sah er die Faust, aus der eine Klinge ragte und unter sein Kinn zielte. Er presste das Handgelenk mit aller Kraft. Die Klinge, deren Spitze schon seine Haut berührte, senkte sich langsam, sehr langsam.
Und plötzlich vernahm er ein Lachen.
Die Hand erschlaffte und öffnete sich. Er drückte sie nieder. Das Messer fiel zu Boden. Und als er jetzt heftig den Kopf zur Seite wandte, starrte er in ein totes Auge, weiß und leer zwischen dunklem Haargewirr.
Und der Kerl neben ihm lachte noch immer. Und dann sagte er mit einer tiefen, kraftvollen Stimme: »Chlodwig! Sei ruhig. Keine Sorge, nichts wird dir geschehen. Aber so hätte man dich umbringen können.«
»Wer bist du, Mann?«, stieß der König hervor. Er packte den anderen, der kleiner und schmaler war, an der Schulter und schüttelte ihn.
»Baddo bin ich. Dein guter alter Freund Baddo. Der Kamerad deiner Kindheit. Dein Blutsbruder.«
»Du bist Baddo?«
»Sohn des Badegisel. Erinnerst du dich? Es ist ja noch gar nicht so lange her. Ich war mal der Einzige, der dir nahestand.«
»Du wolltest mich umbringen!«
»Nein, Chlodwig, nein! Ich wollte dir zeigen, wie man es tun könnte. Um dich zu warnen!«
»Was treibst du hier? Wie kommst du hierher?«
»Ich wollte zu dir. Ich musste zu dir. Es gibt außer dir niemanden mehr, dem ich vertrauen kann. Aber man hätte mich nicht zu dir gelassen, sondern mich auf der Stelle getötet. So musste ich einen Weg suchen, um mich dir bemerkbar zu machen.«
»Ein verdammt gefährlicher Weg!«
Chlodwig ließ den anderen los und bückte sich, um das Messer aufzuheben. »Aber warum? Warum war das notwendig?«
Der Mann, der sich Baddo nannte, strich eine Strähne des wirren Haars zurück, die sein gesundes Auge bedeckte.
»Es war notwendig, weil ich ein Flüchtling bin. Und ohne dich unrettbar verloren. Mir blieb keine Wahl, ich musste dir auflauern, um dich allein zu sprechen. Es war gar nicht so schwer, und wenn ich sonst nichts mehr erreiche, dann wenigstens dies: Du weißt nun, was deine Wachen wert sind. Alles Weitere liegt bei dir. Ich habe mich dir ausgeliefert. Und ich habe mich, wie es aussieht, schuldig gemacht. Wenn du mich hinrichten lässt, ist es mir vorbestimmt. Dann ist es Götterwille.«
Der König warf das Messer von sich, beugte sich etwas vor und starrte dem anderen lange und aufmerksam ins Gesicht.
»Ich erkenne dich nicht wieder«, sagte er. »Aber das Auge … es ist das linke. Du könntest es sein. Du verlorst es durch mich.«
»Das ist vergessen. Es war ein Unfall. Als Kinder gerieten wir in Streit und warfen mit Steinen. Einer traf mich ins Auge.«
»Wir wollten uns gegenseitig ans Leder. Aber dann wurden wir noch Freunde.«
»Blutsbrüder. Wir zapften Blut in unsere Becher, und jeder trank aus dem des anderen. Das ist ein Bund für alle Zeiten. Untrennbar.«
»Aber wie kommst du in diese Lage? Ich hörte, du warst Reiterhauptmann im Heer des Syagrius.«
»Das war ich noch vor einem Monat. Jetzt werde ich von ihm verfolgt. Als Opfer eines schändlichen Spiels. Ich werde dir alles berichten, wenn du dir Zeit nimmst, mir zuzuhören. Ich werde mich rechtfertigen und beweisen, dass ich dein Vertrauen verdiene. Vielleicht etwas mehr Vertrauen als der dort!«
In diesem Augenblick kroch hinter ihnen der kleine Dagulf aus dem Gebüsch. Er stellte sich mühsam auf seine krummen Beine und machte ein paar unsichere Schritte.
»Ich musste deinen obersten Wächter ein bisschen würgen«, sagte der Flüchtling. »Aber er kommt ja schon wieder zu sich.«
Der Anblick des torkelnden Kommandanten war so unwiderstehlich erheiternd, dass Chlodwig den Lachreiz nicht unterdrücken konnte.
»Ausgeschlafen?«, rief er. »Hast du ein Nickerchen im Gebüsch gemacht, während man deinen König umbringen wollte?«
Kurz darauf trat Chlodwig zwischen die niederbrennenden Feuer. Seine Hand lag auf der Schulter des Einäugigen.
»Alle mal herhören!«
Der Befehl war nicht nötig. Die Männer waren bereits verstummt und blickten erstaunt auf den Ankömmling.
»Das ist doch der Kerl aus dem Wald!«, rief einer.
»Ja«, sagte Chlodwig, »das ist der Kerl aus dem Wald. Das ist mein alter Freund Baddo, mein Blutsbruder! Mancher wird sich an ihn erinnern, wir haben als Kinder zusammen gespielt. Er ist der Sohn des Badegisel, der sich mit meinem Vater überwarf, nach Soissons ging und in die Dienste des Patricius trat. Was blieb Baddo übrig, als mit seiner Familie zu gehen. Aber jetzt ist er zu mir zurückgekehrt. Und, Männer, gleich hat er mir einen Beweis seiner alten Freundschaft und Treue gegeben! Als Feind hätte er mich umbringen können, weil diese Burg von Blinden, Tauben und Säufern bewacht wird. Er zeigte mir, dass ich zuverlässige Männer brauche. Deshalb wird er zur Probe bei uns aufgenommen. Er wird uns auf unserm Zug begleiten und uns beweisen, was er wert ist. Gebt ihm eine Strohmatte und eine Decke. Und morgen früh Kleidung und Schuhe. Waffen bekommt er von mir.«
Diesen Worten des Königs folgte ein unruhiges Gemurmel.
Ansoald rief: »Bist du sicher, Chlodwig, dass du den Mann nicht mit jemandem verwechselst? Wenn er so zuverlässig und treu ist … warum schleicht er im Wald umher und steigt nachts über Zäune?«
»Vielleicht ist er ein zuverlässiger, treuer Spion!«, schrie Ursio.
Einige der Betrunkenen lachten.
Bobo zog einen brennenden Ast aus dem Feuer, erhob sich und leuchtete in das abgezehrte, bleiche Gesicht des Einäugigen.
»Ein Spion ist er wohl nicht«, sagte er gedehnt. »Aber vielleicht …« Er streckte die Hand aus und griff in das wirre, schwarze Haar. Gleich darauf hatte er das rechte Ohr freigelegt, das von dünnen Strähnen nur halb bedeckt war. »Vielleicht … nein, sicher ist er ein Sklave!«, vollendete er den Satz und riss an dem Ohr den Kopf so heftig herum, dass Chlodwig nun im Schein des brennenden Astes die tiefe Kerbe bemerkte, die in die Muschel geschnitten war. Die Ränder waren noch verschorft, der Einschnitt schien frisch zu sein.
Die Zeichnung am Ohr war für einen Sklaven – abgesehen vom Tode – die schlimmste Form der Bestrafung.
Chlodwig starrte auf das verräterische Mal, schwieg aber.
Seine Hand blieb auf der Schulter des Mannes liegen, der fest zu ihm aufsah und mit seiner tiefen, ruhigen Stimme sagte: »Ja … das haben sie aus mir gemacht – einen Sklaven. Ich war schon mit einem Treck unterwegs, zu einem der Märkte in Spanien. Es gelang mir, zu fliehen und mich hierher durchzuschlagen. Urteile nicht aufgrund dieser Schändung, die sie mir zugefügt haben. Du wirst mich freisprechen, wenn du meine Geschichte gehört hast.«
»Es wird so gemacht, wie ich befohlen habe«, sagte Chlodwig zu Bobo. »Versorgt ihn! Und keiner soll wagen, ihn anzurühren. Gebt ihm morgen früh auch ein Pferd. Er gehört von jetzt an zur zweiten Abteilung.«
Es gab keinen weiteren Widerspruch, und der König fuhr fort: »Was sitzt ihr hier überhaupt noch herum und sauft und lärmt? Legt euch nieder, es wird früh hell, und ihr werdet das bisschen Schlaf brauchen. Denkt daran: Wir sind zwei Tage unterwegs, haben eine Nacht lang zu tun und brauchen mindestens drei Tage für den Rückweg. Wer müde und schlapp ist, den erwischt es zuerst. Und es ist dann nicht einmal schade um ihn!«
Kapitel 5
Es erwischte sechsundzwanzig Mann, aber das war nicht ungewöhnlich bei einer solchen Unternehmung. Es hatte schon größere Verluste gegeben.
Die meisten Toten hinterließ ein Kampf mit Viehdieben, die es zufällig in derselben Nacht auf dieselbe Herde abgesehen hatten. Die anderen hatten gesiegt, wenn auch ebenfalls mit hohen Verlusten, und hatten die Herde fortgetrieben. Zwei Mann waren davongekommen und hatten berichtet, dass die anderen – nach ihrer Sprache zu urteilen – Tongerer waren.
Chararichs Leute, dachte Chlodwig erbittert. Der Vetter, dieser Hund, kommt mir dauernd in die Quere. Eine Plage sind solche Verwandten!
Er war missgestimmt, denn unter den sechsundzwanzig Getöteten waren drei, um die es ihm leidtat und die ihm fehlen würden. Es gab nicht viele von der Art – Männer, die imstande waren, größere Haufen zu führen. Nur wenige besaßen den Verstand und das Geschick, nach einem vorgefassten Plan zu handeln und sich dabei nicht durch die vielen kleinen, unvorhersehbaren Zwischenfälle beirren zu lassen. Alle drei waren beim Sturm auf die Unterkünfte der Knechte erschlagen worden.
Es hatte dort überraschend starken Widerstand gegeben, weil in den Häusern außer den Sklaven auch viele Kolonen untergebracht waren. Diese Halbfreien waren während der Erntezeit dem Herrn der Domäne leistungspflichtig. Sie hatten sich wütend verteidigt, wussten sie doch, was ihnen blühte, wenn man sie einfing: Sie verloren dann auch ihre halbe Freiheit und würden die Heimat und ihre Familien nie wiedersehen. Während die Sklaven sich wie erwartet nur schwach gewehrt und viele sich sogar widerstandslos ergeben hatten (denn es änderte sich ja kaum etwas an ihrem Schicksal), waren die Kolonen auch auf dem Marsch noch aufsässig und unternahmen trotz strenger Bewachung Fluchtversuche.
Immerhin hatten die Franken über dreihundert Männer, Frauen und Kinder gesund und unversehrt aufgebracht. Bobo hatte Chlodwig schon vorgerechnet, sie würden im Herbst, wenn die Händler kamen, mindestens einhundertfünfzigtausend Solidi einbringen.
Dieser Gedanke heiterte den König ein wenig auf, während er schweigsam dem endlosen Treck voranritt.
Auch sonst entsprach die Ausbeute den Erwartungen. Hochbeladene Karren mit Getreide und anderem Beutegut wurden mitgeführt. Fast achthundert Tiere waren von den Weiden getrieben, viele wertvolle Zugochsen und Milchkühe darunter. Das Fleisch der Schweine würde den Winterbedarf der Festung sichern. So viele Pferde wurden eingefangen, dass die Tournaier ihre Fußtruppe endlich durch eine Reiterei verstärken konnten.
Diese Reiterei sollte unverzüglich aufgestellt werden, und Chlodwig wusste auch schon, wen er zu ihrem Befehlshaber machen würde: Baddo.
Dies war ein weiterer Gewinn bei dem Unternehmen – ein fähiger Anführer, der den Verlust der drei Erschlagenen sogar in gewisser Weise ausglich.
Der Überfall auf die besonders scharf bewachte Pferdekoppel war eine taktische Meisterleistung des Einäugigen und zerstreute den letzten Zweifel daran, dass es tatsächlich Baddo war, der einstige Reiterhauptmann des römischen Statthalters.
Chlodwig beschloss auch, ihn künftig in den inneren Kreis der Gefolgschaft aufzunehmen. Obwohl er noch immer nicht seine Geschichte kannte, war ihm Baddo in diesen Tagen schon fast wieder so vertraut geworden, als hätte es niemals die zehn Jahre der Trennung gegeben.
Im Grunde konnte der zwanzigjährige König mit sich zufrieden sein. Er hatte getan, was getan werden musste. Es war jetzt seine wichtigste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass er mit seinem salfränkischen Stammesvolk über den nächsten Winter kam. Dieses Volk wuchs beängstigend an, vor allem durch ständigen Zuzug von jenseits des Rheins, aus den alten germanischen Gauen. Stets drohten Hungersnöte und Seuchen. Es wurde eng in Chlodwigs winzigem Reich.
In der Festung Tournai und in den Weilern ringsum lebten doppelt und dreimal so viele Menschen, als man aus eigener Kraft ernähren konnte. Die meisten Männer hatten keine Beschäftigung. Die Flächen für den Getreideanbau, um den sich vor allem die Frauen kümmerten, waren schmal und ausgelaugt. Auch die eigenen Viehbestände waren eher bescheiden.
So blieb nichts anderes übrig, als sich in guter germanischer Tradition das Nötige zum Überleben von dorther zu holen, wo man es fand: bei reichen Nachbarn. Sechs bis acht Beutezüge im Jahr genügten Chlodwig, selbst wenn die meisten nicht halb so ertragreich wie dieser waren.
Auch sein Vater Childerich hatte sich schließlich nur noch auf diese Methode verlassen. Als Föderaten des Imperiums mit der Pflicht zu militärischem Beistand hatten die Franken von Tournai zwar nach wie vor Anspruch auf Hilfsgelder, aber die flossen schon zu Childerichs Zeiten nur spärlich und unregelmäßig.
Chlodwig wusste, dass man ihn und seine Vettern, die anderen kleinen Könige im Nordosten Galliens, am Hof des Patricius in Soissons nur verächtlich als Raubgesindel bezeichnete. Doch das durfte ihn nicht kümmern. Er hatte ja keine andere Wahl.
Trotzdem beherrschte ihn ein seltsames Unbehagen. Auch nachdem er den Ärger über die Verluste hinuntergekämpft und den Gewinn des Beutezugs dagegengehalten hatte, stellte sich keine Siegesstimmung ein.
Als die Bauwerke der Domäne in Brand gesetzt und die Gefangenen heraufgetrieben waren, hatten ihn einige seiner schon wieder betrunkenen Krieger in die Höhe stemmen und unter Gesang auf ihren Schultern umhertragen wollen. Er hatte sich heftig dagegen gesträubt, denn es war ihm zuwider gewesen, sich eines solchen Sieges wegen bejubeln zu lassen. Einen der Aufdringlichsten hatte er sogar mit der Faust niedergeschlagen.
Nach der Rückkehr in die Waldburg wollte er diesmal eine Siegesfeier vermeiden, sogar auf die Gefahr hin, viele aus der Gefolgschaft gegen sich aufzubringen.
Er nahm sich nicht einmal die besten Beutestücke. Manche nannten ihn schon den »traurigen Wolf« und witzelten über seine Anspruchslosigkeit. Doch er wusste, dass es eher das Gegenteil war, was ihm so sehr zu schaffen machte.
Der Rückmarsch des schwerfälligen Trecks dauerte länger als vorgesehen. Erst gegen Abend des vierten Tages wurde die Waldburg erreicht.
Die Stimmung des Königs hob sich nicht, als er sah, wer sich zu seinem Empfang bereithielt.
Kapitel 6
Bischof Remigius und der Diakon Chundo verbrachten nach dem fehlgeschlagenen Bekehrungsversuch bei der Mutter des Königs die Nacht unter denkbar unbequemen Umständen in einem stockfinsteren Kellergewölbe.