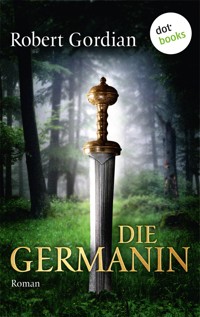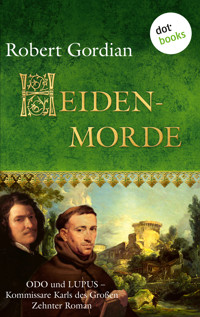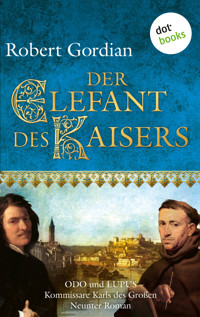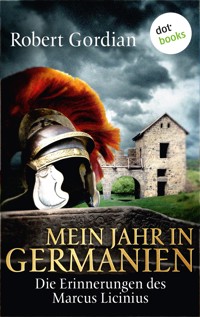
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Begleiten Sie den Römer Marcus Licinius beim Abenteuer seines Lebens: „Mein Jahr in Germanien“ von Robert Gordian jetzt als eBook bei dotbooks. Trinken, feiern, Frauen betören: Marcus Licinius genießt das Leben in vollen Zügen. Bis zu dem Tag, als der junge römische Jurist nach Germanien versetzt wird – jene feindselige Provinz, in der Barbarenstämme hausen und jeder kultivierte Mann in größter Gefahr schwebt. Es gelingt Marcus, das Vertrauen des Cheruskerfürsten Segestes zu erlangen. Nur zu gerne würde er auch das Herz seiner Tochter erobern, der schönen Thusnelda. Deren Zuneigung gilt einem anderen: Arminius, der sich freiwillig in römische Dienste begeben hat. Doch niemand ahnt, welche Pläne der Cherusker insgeheim schmiedet … Ein unbeschwerter Mann, der sich in einer feindlichen Welt wiederfindet – und das schicksalsträchtige Ereignis, das als Varusschlacht in die Geschichte eingehen soll! Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Mein Jahr in Germanien – Die Erinnerungen des Marcus Licinius“ von Robert Gordian. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch:
Trinken, feiern, Frauen betören: Marcus Licinius genießt das Leben in vollen Zügen. Bis zu dem Tag, als der junge römische Jurist nach Germanien versetzt wird – jene feindselige Provinz, in der Barbarenstämme hausen und jeder kultivierte Mann in größter Gefahr schwebt. Es gelingt Marcus, das Vertrauen des Cheruskerfürsten Segestes zu erlangen. Nur zu gerne würde er auch das Herz seiner Tochter erobern, der schönen Thusnelda. Deren Zuneigung gilt einem anderen: Arminius, der sich freiwillig in römische Dienste begeben hat. Doch niemand ahnt, welche Pläne der Cherusker insgeheim schmiedet …
Ein unbeschwerter Mann, der sich in einer feindlichen Welt wiederfindet – und das schicksalsträchtige Ereignis, das als Varusschlacht in die Geschichte eingehen soll!
Am Ende dieses eBooks finden Sie ein Glossar mit wichtigen in der Geschichte erwähnten Begriffen, Orten und Persönlichkeiten.
Über den Autor:
Robert Gordian, geboren 1938 in Oebisfelde, studierte Journalistik und Geschichte und arbeitete als Fernsehredakteur, Theaterdramaturg, Hörspiel- und TV-Autor, vorwiegend mit historischen Themen. Seit den neunziger Jahren verfasst er historische Romane und Erzählungen. Robert Gordian lebt in Eichwalde, einem Vorort Berlins.
Bei dotbooks veröffentlichte Robert Gordian den Roman XANTHIPPE – DIE FRAU DES SOKRATES sowie drei historische Romanserien:
ODO UND LUPUS, KOMMISSARE KARLS DES GROSSEN
Erster Roman: Demetrias Rache; Zweiter Roman: Saxnot stirbt nie; Dritter Roman: Pater Diabolus; Vierter Roman: Die Witwe; Fünfter Roman: Pilger und Mörder; Sechster Roman: Tödliche Brautnacht
DIE MEROWINGER
Erster Roman: Letzte Säule des Imperiums; Zweiter Roman: Schwerter der Barbaren; Dritter Roman: Familiengruft; Vierter Roman: Zorn der Götter; Fünfter Roman: Chlodwigs Vermächtnis; Sechster Roman: Tödliches Erbe; Siebter Roman: Dritte Flucht; Achter Roman: Mörderpaar; Neunter Roman: Zwei Todfeindinnen; Zehnter Roman: Die Liebenden von Rouen; Elfter Roman: Der Heimatlose; Zwölfter Roman: Rebellion der Nonnen; Dreizehnter Roman: Die Treulosen
ROSAMUNDE – KÖNIGIN DER LANGOBARDEN
Erster Roman: Der Waffensohn; Zweiter Roman: Der Pokal des Alboin; Dritter Roman: Die Verschwörung; Vierter Roman: Die Tragödie von Ravenna
***
Neuausgabe Februar 2015
Copyright © der Originalausgabe 2002 Pendo Verlag GmbH, Zürich
Copyright © der Neuausgabe 2015 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Bildmotivs von shutterstock/OPIS Zagreb
ISBN 978-3-95824-075-9
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Mein Jahr in Germanien an: lesetipp@dotbooks.de
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
http://instagram.com/dotbooks
Robert Gordian
Mein Jahr in Germanien
Die Erinnerungen des Marcus Licinius
Roman
dotbooks.
IDER ZORN DES AUGUSTUS
»Entweder du heiratest Sempronia Medullina oder du gehst nach Germanien!«
An jenem Morgen war ich mal wieder recht angeheitert in unser Haus auf dem Esquilin zurückgekehrt, nach einer Zechtour durch die Schenken der Subura. Es war schon taghell, und die Klienten meines Vaters waren längst in der Halle versammelt, um den Morgengruß zu entbieten. Ich versuchte, mich vorbeizustehlen, doch schwankte ich wohl zu sehr, um unauffällig die Treppe zum Obergeschoss, wo sich mein Zimmer befand, zu erreichen. Kaum war ich eingetreten, sah ich schon alle Blicke auf mich gerichtet. Je nach dem Grad der Abhängigkeit des Klienten waren es erschrockene, unsichere, peinlich berührte, aber auch spöttische und schadenfrohe Blicke. Letztere in Erwartung dessen, was man schon öfter erlebt hatte, wenn der einzige Sohn des Hausherrn in dieser Verfassung heimgekehrt war. Es kam diesmal schlimmer als je zuvor. Mein Vater ging auf mich los, packte mich, schüttelte mich und goss einen Wortschwall über mich, der eines Senators der Stadt Rom und Meisters der Beredsamkeit würdig war. Wäre Cicero noch am Leben gewesen, hätte er in diesem Augenblick von ihm lernen können.
Mit Augenrollen, dramatischen Gesten und donnernder Stimme ließ mein Vater mich wissen, dass ich eine untilgbare Schande sei, sowohl für ihn als auch für meine Ahnen, für alle die tugendhaften und verdienstvollen Licinier, deren Büsten an den Wänden der Halle herumstanden. Das meiste von dem, was er sagte, hatte ich natürlich schon oft gehört, und ich war überzeugt, dass er übertrieb, weil er vor Publikum sprach. Indem ich mich bemühte, gerade zu stehen und Zerknirschung zu zeigen, hoffte ich, auch diesmal davonzukommen. Doch er steigerte sich in einen Rausch der Empörung, dessen Höhepunkt das fatale »entweder – oder« war. Vor Zeugen gesprochen, war dies nicht nur eine rhetorische Drohung, sondern zweifellos bitterer Ernst. Ich musste eine Entscheidung treffen.
»Entweder du heiratest Sempronia Medullina oder du gehst nach Germanien!«
Zwei Übel – welches von beiden wählen? Für die Heirat sprach immerhin, dass ich in Rom bleiben könnte und meine Freunde nicht verlassen müsste. Die Braut stammte aus einem reichen Hause, ihre Mitgift musste beträchtlich sein. Das allerdings war ihr einziger Vorzug. Sie war hässlich wie die Gorgo Medusa. Außerdem galt sie als bösartig und tyrannisch. Mit diesen Eigenschaften hatte sie bisher nur ihren jüngeren Schwestern, armen Verwandten und Dienerinnen das Leben schwer machen können. Welch lohnende Beute wäre ein Ehemann, auf den sie so lange schon vergebens lauerte!
Andererseits ... Germanien! Allein das Wort ließ jeden Römer erschauern. Urwald, von Wölfen und Bären bevölkert. Wilde Jäger und Krieger, die sich in Felle hüllten und nur Fleisch, Milch und Käse zu sich nahmen. In der Schule hatten wir Caesars Gallischen Krieg gelesen. Wir hatten nackt, mit Gebrüll und Knüppel schwingend furor teutonicus gespielt, diesen Albtraum der Römer seit dem Besuch der Kimbern und Teutonen. Nun war Germanien unsere Provinz oder sollte es werden ... Wer wusste das schon? Unsere Legionen waren über den Rhenus gegangen und bis zu einem Fluss namens Albis gekommen. Nach ihnen sollte nun dort auch die römische Ordnung einziehen. Der Erhabene, unser unfehlbarer Imperator Caesar Augustus, wünschte es so. Es gab Männer, die allen Mut zusammennahmen und sich der großen Aufgabe stellten. Aber musste ausgerechnet ich ihnen nacheifern?
Nachdem ich mich ausgeschlafen und noch einmal gründlich nachgedacht hatte, erschien mir Sempronia Medullina alles in allem doch nicht gar so schrecklich, und so erklärte ich, als mein Vater mich zu sich rief, ich hätte mich für die Heirat entschieden. Da er mir diese Braut seit Jahren aufzudrängen versucht hatte, glaubte ich, er würde zufrieden sein. Zu meiner Enttäuschung war das aber nicht der Fall. Ja, es stellte sich nun heraus, dass er selber längst die Entscheidung getroffen hatte. Er hatte mir die Wahl nur zum Schein gelassen, um den ungünstigen Eindruck auf die Klienten zu mildern. Überrascht – ja, bestürzt erfuhr ich jetzt, zu einem Personenkreis zu gehören, der in der Hauptstadt nicht mehr erwünscht war.
»Der Erhabene ist nicht mehr bereit, sich euer Treiben länger gefallen zu lassen!«, wurde mir mit eisiger Miene verkündet. »Die Sittenverderbnis nimmt Ausmaße an, die den Bestand des Staates gefährden. Wer schert sich noch um Treue und Gattenliebe? Wer will noch in Ehren Kinder zeugen und aufziehen? Jeder sucht nur noch sein Vergnügen, niemand will Verantwortung tragen. Es ist Mode geworden, dass junge Männer Jagd auf Ehefrauen machen und – noch schlimmer – Ehefrauen auf junge Männer. Unter der Anleitung eines ruchlosen Schriftstellers wird lasterhaftes Betragen zur Kunst erhoben!«
»Falls du Ovidius Naso meinst, Vater ...«
»Wen sonst meine ich als diesen Lehrmeister aller Zuchtlosen und Verworfenen! Ich weiß sehr wohl, dass du zum Kreis seiner eifrigsten Schüler gehörst. Wenn du dich noch mit den Lustdirnen der Subura begnügen wollest! Aber man berichtete mir Dinge, die mich erröten ließen. Mit der Frau meines alten Freundes Fufetius ... Und mit der Schwester des Auguren Cominius! Mit Domitilla, einer Verwandten! Sogar die Mutter deines Studienfreundes Poetilius sollst du ...«
»Verleumdung, Vater! Das war nicht ich, sondern ...«
»Schweig! Als ob es auf eine mehr oder weniger noch ankäme. Ich habe dir zu viel Freiheit gelassen, wollte dich nicht am kurzen Zügel führen. Du hast meine Nachsicht schändlich missbraucht. Wann gehst du noch deinen Studien nach? Wann bereitest du dich auf den cursus honorum vor? Tagsüber schläfst du, die Nächte aber verbummelst du in zweifelhafter Gesellschaft. Zechen und Unzucht treiben ist alles, was du gelernt hast. Manchmal frage ich mich, ob du wirklich mein Sohn bist ... Ob es möglich war, dass die Lenden eines Licinius einen solchen Ausbund von Lasterhaftigkeit zeugten!«
»Ich verspreche dir, Vater, dass ich mich ändern werde!«, versicherte ich. »Wenn du befiehlst, ich solle heiraten, bin ich bereit. Auch Sempronia Medullina ...«
»Zu spät!«, fiel er mir mit düsterer Miene ins Wort. »Es steht so schlimm, dass meine schlimmsten Ahnungen weit übertroffen wurden. Der Erhabene rief mich zu sich. Und auch noch ein paar andere Väter missratener Söhne. Legte mir Listen mit Namen verführter Frauen vor. Berichte von tollen Streichen, empörenden Ausschweifungen. Seine Zuträger arbeiten gründlich und zuverlässig. Dabei fiel immer wieder der Name dieses verfluchten Ovidius Naso. Und mehrere Male – allzu häufig – der deinige!«
»Glaubst du denn wirklich alles, was Spitzel im Theater oder in den Thermen herausschnüffeln?«, rief ich verzweifelt und unvorsichtig.
»Ich stelle fest, du machst kein Hehl daraus, wo diese schändlichen Beziehungen angeknüpft werden«, gab er mit einem sarkastischen Lächeln zurück. »Im Übrigen zählt nicht mehr, was ich glaube. Der Erhabene hat sich längst sein Urteil gebildet. Seine Entschlossenheit, diesmal wirkungsvoll durchzugreifen, ist nicht zu erschüttern. In seiner eigenen Familie wird er beginnen – bei seiner sittenlosen Enkelin. Ihr droht das Schicksal ihrer Mutter.«
»Verbannung?«
»Ebenso wird euer Vorbild, der Verse schmiedende Lehrer der Liebeskunst, aus der Stadt verschwinden. Irgendwo weit im Osten wird er den Thrakern, Geten oder Skythen beibringen können, wie man Frauen zur Unzucht verleitet!«
»Das ist Willkür!«, wagte ich heftig zu entgegnen.
»Außerdem«, fuhr mein Vater unbeirrt fort, »wünscht der Erhabene, dass die Auffälligsten unter seinen Anhängern, die Schamlosesten und Dreistesten, gleich ihm aus der Stadt und möglichst aus Italien entfernt werden. Jedenfalls für einige Zeit. Und bis ein neues strenges Ehegesetz, das die lex Julia aus dem Jahre 736 ergänzen wird, in Kraft tritt. Er stellte uns, den Versammelten, frei, in diesem Sinne unsere väterliche Gewalt zu gebrauchen.«
»Ich heirate Sempronia Medullina und lebe zurückgezogen auf dem Lande!«
»Dies schlug ich selber dem Erhabenen vor, aber er hielt es nicht für ausreichend. Wie viele Möglichkeiten gäbe es, heimlich nach Rom zurückzukehren. Er ist auch der Ansicht, dass ein hartes Ehebett nicht genüge, um aus einem verweichlichten Schwelger einen Mann zu machen. Ich stimmte ihm zu, obwohl mir dabei sterbenselend war. Oh, wie litt ich in diesem Augenblick! Ich, der Abkomme eines Gaius Licinius, des ersten gewählten Volkstribunen im Jahre 263 – des ruhmreichen Spurius Licinius, der ebenfalls vor fast fünfhundert Jahren ...« Es folgte nun wieder eine Reihe von Ahnen nebst Aufzählung ihrer Verdienste. Die Klage gipfelte in dem Ausruf: »Ich, der von solchen Männern abstammt, musste mir vorwerfen lassen, mein Sohn sei ein verweichlichter Schwelger! Aber warte, das werden wir ändern!«
»Also Germanien«, sagte ich seufzend.
»Ja, Germanien! Für Müßiggänger und Ehebrecher der beste Ort der Abschreckung! Zu trinken gibt es dort ein abscheuliches Bier und wer eine Ehefrau verführt, wird totgeschlagen. Auch sonst gibt es, wie bekannt, kaum Annehmlichkeiten. Zwar soll sich nun einiges ändern, aber das braucht seine Zeit. Jedenfalls wird man dort kaum Theater und Bäder und andere Tummelplätze für verdorbene junge Männer errichten!«
»Darauf verzichte ich gern«, sagte ich trotzig. »Aber mir ist nicht klar, was ich dort tun soll. Bäume fällen? Bären jagen?«
»Übernimm dich nur nicht! Du wirst es erfahren. Ich habe an Publius Quinctilius Varus geschrieben. Er ist mein Freund und ich habe ihm manchen Dienst erwiesen, der einen Gegendienst wert ist. Den Posten des Statthalters von Germanien verdankt er nicht nur seiner Verwandtschaft mit dem Erhabenen, sondern auch meiner Fürsprache. Nun habe ich ihn gebeten, sich deiner mit besonderer Aufmerksamkeit, aber zugleich mit besonderer Strenge anzunehmen.«
»Dein Varus hat auch keinen guten Ruf«, sagte ich giftig. »Wenn du mir den zum Mentor gibst, wirst du dich wundern, was dabei herauskommt. Der hält auch nicht viel von altrömischer Tugend.«
»Ich verbiete dir solche respektlosen Äußerungen!«, schmetterte mein Vater zurück. »Wie kannst du dir ein Urteil über ihn anmaßen – einen unserer fähigsten Männer! Schon in Judäa hat er bewiesen, was in ihm steckt. Sogar einen Aufstand hat er niedergeschlagen. Als er im vorigen Jahr nach Germanien ging, setzte er sich ein klares Ziel: Er will vollenden, was Drusus vor zwanzig Jahren begonnen hat. Und ich bin überzeugt, er wird es schaffen! Er wird in diesen finstersten Teil der Welt unser Licht tragen! Dazu braucht er Helfer, die weder Tagediebe noch Duckmäuser sein dürfen. Wenn ich dich also zu ihm sende, so heißt das, ich setze noch immer Vertrauen in dich und bin zuversichtlich, dass du dich ändern wirst. Noch habe ich nicht alle Hoffnung verloren!«
Da war nichts zu machen. Alle Einwände, die ich vorbrachte, stießen auf eine Granitwand. Ich stand seitdem unter Hausarrest, und meine Abreise wurde zügig vorbereitet. Es wurde mir nicht einmal gestattet, mich von meinen Freunden zu verabschieden, geschweige denn von den liebenswerten und trostbedürftigen Frauen, die mich so reich mit ihrer Gunst beschenkt und eine so abrupte Trennung nicht verdient hatten. Ein paar zärtliche Worte, in Wachs geritzt, durch einen vertrauenswürdigen Diener überbracht, waren alles, was ich ihnen noch bieten konnte.
Den bewunderten Dichter, vertrauten Freund und amüsanten Konviven Publius Ovidius Naso sah ich nie wieder. Die Spitzel des Erhabenen hatten in seinem Fall ganze Arbeit geleistet. Sie hatten irgendetwas herausgefunden, das ihn schwerer belastete als jeden anderen aus unserem Kreis. Worum es sich handelte, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Hatte er etwas gesehen und ausgeplaudert, was er besser nicht gesehen oder zumindest verschwiegen hätte? Zum Beispiel, wie dem Erhabenen in einer geschlossenen Sänfte ein Mädchen zugeführt wurde? Oder hatte man etwa auch ihn zu Julia, der Enkelin des Allmächtigen, unter die seidene Bettdecke schlüpfen sehen? Als Vorwand für die Verbannung musste sein Buch von der Liebeskunst herhalten, angeblich eine Anleitung zur Unzucht. Es wurde verboten und wie alle anderen Werke des Dichters aus den öffentlichen Bibliotheken entfernt. Zum Glück besaß ich ein Exemplar, das ich nun allerdings sorgsam verstecken musste. Ich schmuggelte die Rolle in mein Gepäck. Ab und zu würde mich die Lektüre in meinem Unglück ein wenig aufheitern.
Meine Ausstattung bestand vor allem aus warmer Kleidung und Decken, von meiner Mutter und meinen Schwestern unter Seufzern und Tränen sorgsam in einer Reisetruhe verstaut. Auch mit Waffen war ich versehen, deren Gebrauch mir allerdings ungewohnt und zuwider war. Zu den Büchern, die mir erlaubt waren, gehörten Schriften von Cicero und Livius und ein ganzer Sack voller Prozessprotokolle. Diese wählte mein Vater selber aus, und er vergaß dabei keine seiner eigenen vor Gericht gehaltenen Reden, die er mir immer wieder zu studieren empfahl. Zum Abschied fand er fast milde Töne. Im Falle meiner Bewährung, sagte er, werde er spätestens nach zwei Jahren meine Rückkehr erwirken. Mit einer Empfehlung meines Legaten versehen, könne ich dann vielleicht sogar vorzeitig, mit achtundzwanzig statt mit dreißig Jahren, in die Ämterlaufbahn eintreten und die Quästur bekleiden. Und auf die Heirat mit Sempronia Medullina werde er nicht zurückkommen. Wenn ich ihn jetzt nicht enttäusche, erklärte er großmütig, werde er zu jeder Braut meiner Wahl seine Zustimmung geben.
Ich reiste in einer Rheda, vierspännig, zusammen mit fünf anderen Personen: zwei Präfekten, die zu ihren Standorten zurückkehrten, einem Beamten des Fiskus und zwei reichen gallischen Gutsbesitzern aus der Provinz Belgica. Letztere hatten sich auf ihre alten Tage das Vergnügen gegönnt, die urbs aeterna, den Mittelpunkt unserer Welt, zu besuchen. Die beiden waren lustige Vögel und kürzten uns ein wenig die Zeit. Der Ältere kam am Ende nicht an, kurz vor dem Ziel erlag er den Reisestrapazen.
Auch wir anderen, die wir sie überstanden, litten nicht wenig: unter den häufigen Regen- und Schneeschauern, dem Rumpeln auf den Gebirgspässen, bei einem Unfall infolge eines gebrochenen Rades, als wir uns alle neben dem umgestürzten Wagen in einer Erdmulde wiederfanden, und nicht zuletzt in schmutzigen und verwanzten Herbergen.
Doch wir gelangten über die Alpen und erreichten die Uferstraße des Rhenus. Am dritten Tag vor den Iden des Monats April im Jahre 761 ab urbe condita kamen wir in Mogontiacum an.
IIMÄNNER MIT FLÜGELN
Was für ein unwirtlicher Ort!
Das Legionslager, umgeben von einigen hundert Buden und Zelten. Überall das schreiende Rot der Waffenröcke und Helmbüsche. Getrommel, Getute, Gepfeife, Geschnauze. Jeden Augenblick muss man sich an eine Wand drücken, weil wieder ein Trupp vorbeimarschiert. Hoch spritzt der Straßenkot und besudelt die Kleidung. In den Gassen der Händler noch mehr Geschrei und Getöse. Ochsenpaare im Joch und beladene Esel, die nicht aneinander vorbeikönnen. Ehe man sich's versieht, hat man selbst einen Peitschenhieb abbekommen. Schweine und Ziegen fahren einem zwischen die Beine. Und erst der Hafen! Den Rhenus herab werden große Mengen von Bauholz geflößt und hier verladen. Ein gewaltiger Stamm rollt dir entgegen – rasch kehrtgemacht – da wirst du bereits vom Schwenk eines Balkens getroffen. Man brüllt dich an und stößt dich beiseite.
Um den Reisenden kümmert sich hier niemand. Nur das Militär zählt, sonst nichts. Als ich ankam, regnete es in Strömen. Der Kutscher spannte die Pferde aus und verschwand. Die Mitreisenden zerstreuten sich. Ein öder Platz am Rande des Gastrums, der Boden aufgeweicht, voller Pfützen. Kein Sklave für das Gepäck, keine Sänfte. Endlich gelang es mir, einen Bauern mit einem Karren heranzuwinken, der meine Truhe auflud und zu einer Herberge beförderte. Der Besitzer, ein Gallier, der bei mir Geld witterte, führte mich in ein immerhin fast sauberes Zimmer, wo nur noch zwei Händler nächtigten. Es gab sogar einen Haken, an dem ich die Truhe anketten konnte.
Es war weit nach Mittag. Ich wechselte meine durchnässte Kleidung und bestellte etwas zu essen. Ein Junge brachte eine Schüssel mit säuerlichem Brei, in dem sich ein paar Stücke Hammelfleisch verloren. Der Wein dazu war noch saurer. Ich streckte mich auf der Matratze aus, um ein bisschen zu ruhen und zu warten, dass der Regen aufhörte. Meine Schlafgenossen waren abwesend. Hinter dem Türvorhang keifte ein Weib in einer Sprache, die mir fremd war, wohl keltisch. Der halbdunkle Raum hatte nur ein winziges Fenster unter dem Schilfdach, von dem es herabtropfte.
Eine tiefe Niedergeschlagenheit befiel mich. Und auch wieder einmal Wut auf mich selbst. Was wollte ich hier? Warum musste es so weit kommen, dass ich in diesem traurigen Garnisonsnest landete? Was sollte hier aus mir werden?
Ein Vers des Horatius fiel mir ein:
Nie weiß der Mensch von Stund zu Stunde schon,
was ihn bedroht ...
Ich sprang auf. Ich musste der Ungewissheit ein Ende machen!
Obwohl es schon ziemlich spät war, würde ich es vielleicht noch schaffen, zum Statthalter vorzudringen. Mein Vater hatte mir einen zweiten Brief an ihn mitgegeben, der würde mir die Türen wohl öffnen.
Ich setzte meinen breitkrempigen griechischen Reisehut auf, hüllte mich in meinen Mantel und zog los.
Am Lagertor angekommen, wunderte ich mich über die nachlässige Einlasskontrolle. Schwieriger war es schon, in das praetorium zu gelangen. Trotz des Regens drängte sich auf dem Vorplatz allerlei Volk, und ich musste meine Ellbogen einsetzen. Dann erfuhr ich aber zu meiner Enttäuschung, dass der Legat gar nicht anwesend war. Allerdings werde er wohl noch vor dem Abend zurückkehren, hieß es. Der Wachhabende wollte mich erst abweisen, aber als ich ihm meinen Namen nannte und ihm das Siegel der Briefrolle zeigte, ließ er mich durch.
Das praetorium war der einzige Steinbau am Platze. Doch obwohl erst vor wenigen Jahren erbaut, wirkte er schon heruntergekommen. Der Mosaikfußboden in der Halle war von den Legionärsstiefeln zerkratzt. Die Säulen waren schwarz vom Rauch der Fackeln. Eine Büste des Erhabenen und eine Statue des Mars standen verloren in den Ecken, es gab wacklige Hocker und Holzbänke. Neu waren lediglich einige Wandgemälde. Die Farben strahlten noch, die Ausführung war jedoch stümperhaft. Aber was konnte man hier erwarten?
Ich sah mich um. Auch die Halle war voller Wartender. Vergebens suchte ich nach einem bekannten Gesicht. Ein paar höhere Militärpersonen standen herum, doch ich war keinem von ihnen je begegnet. Den beiden Präfekten, meinen Reisegefährten, die sich beim Statthalter melden mussten, war wohl die Zeit zu lang geworden. Die meisten hier schienen Provinzialen zu sein. Die Schnurrbärtigen in karierten oder gestreiften Mänteln und Hosen waren Gallier, die Übrigen Germanen. Da man sie eingelassen hatte, handelte es sich ohne Zweifel um Stammesoberhäupter oder andere Vornehme.
Germanen waren mir keine Unbekannten. In Rom begegnete man ihnen auf Schritt und Tritt, gewöhnlich als Sklaven, aber auch als Gardisten in den neu formierten Prätorianerkohorten. Eine Dame, die ich häufig besuchte, hatte eine germanische Zofe, ein unansehnliches, rundliches Wesen, das immer etwas verschreckt wirkte, weil es seiner Ungeschicklichkeit wegen manchen Nadelstich abbekam. Die Germanen hier in der Halle waren zumeist ältere Männer, ergraut oder kahlköpfig, mit wallenden Bärten die einen, sorgfältig glatt rasiert die anderen. Zum Empfang beim Statthalter hatten sie sich mit Spangen, Armreifen, silbernen Gürtelschnallen, Ketten aus aufgereihten Münzen oder Eberzähnen herausgeputzt. Waffen zu tragen war ihnen hier natürlich nicht gestattet.
Einer von ihnen fiel mir auf. Sie sind ja fast alle größer als wir, doch der war ein Riese, lang wie ein Pfahl. Er maß gut seine sechseinhalb Fuß. Sein Haar war grau, gelockt und kurz geschnitten, grau waren auch die buschigen Augenbrauen. Er mochte fünfundvierzig Jahre alt sein, vielleicht auch jünger. Das Alter dieser Barbaren ist nur schwer zu schätzen, und natürlich kennen die meisten es selbst nicht. Was mir an dem Mann ebenfalls auffiel, war sein sehr lebhafter, scharfer Blick, die ungenierte Aufmerksamkeit, mit der er seine Umgebung beobachtete – im Gegensatz zu der finsteren, stumpfen Gleichgültigkeit der meisten anderen. Als ich wieder mal zu ihm hinsah, stellte ich fest, dass auch er mich musterte und zu einem, der bei ihm stand, eine Bemerkung über mich machte. Ich wandte mich etwas verlegen ab und beachtete ihn eine Weile nicht. Zwischen den Wartenden hin und her gehend, hoffte ich wie alle anderen, dass sich endlich eine der vielen Türen öffnete und jemand die Ankunft des Legaten verkündete.
So schritt ich gerade in Gedanken, den Kopf gesenkt, an einer der Wände entlang, als ich beinahe mit dem langen Germanen zusammenstieß. Der stand etwas vorgebeugt vor einem der erwähnten Gemälde und starrte es an. Als er merkte, dass ich zurückfuhr, wandte er mir sein Gesicht zu, als freue er sich über diesen Zufall. In nicht ganz einwandfreiem, doch gut verständlichem Latein sprach er mich an.
»Du siehst aus wie einer, der was gelernt hat. Das da will mir nicht in den Kopf. Da fliegen zwei Männer in der Luft herum. Oder sind es Götter?«
Der Maler hatte mit seinen unzureichenden Mitteln versucht, die Geschichte des Daedalus und des Ikarus darzustellen. Oben links im Bild strahlte die Sonne, unten kräuselte sich das Meer, aus dem sich ein Hügel mit einer Burg erhob, der wohl die Insel Kreta sein sollte. Dazwischen sah man die beiden Geflügelten, himmelan strebend den einen, den anderen im Sturzflug. Ihre Namen standen dabei, vielleicht um zu vermeiden, dass sie jemand für Fledermäuse hielt. Immerhin erkannte sie der Germane als Männer.
»Das sind Flüchtlinge«, sagte ich. »Sie wollen sich vor einem König retten, der sie gefangen hielt.«
»Und da fliegen sie einfach los?«
»Die Griechen erzählen es so. Es ist eine Sage.«
»Bei uns können nur die Götter fliegen. Und die Toten, die vom Schlachtfeld auferstehen. Aber das wird auch nur erzählt. Ob es stimmt ...«
Er bleckte die gelblichen, lückenhaften Zähne und grinste. Dann trat er noch etwas näher zur Wand und vertiefte sich wieder in die Betrachtung des Bildes. Ich wollte vorbeigehen, aber er hielt mich am Arm fest.
»Wie sind sie nun aber zu den Flügeln gekommen? Weißt du das auch? Ich habe noch nie gehört, dass Männern Flügel wachsen.«
»Gewachsen sind sie ihnen auch nicht. Sie wurden künstlich hergestellt.«
»Künstlich?«
»Aus Vogelfedern, das sieht man dort ja. Die wurden mit Riemen und Wachs zusammengefügt, dann am Rücken befestigt.«
»Ist ja großartig. Und wer hat das erfunden?«
»Dieser hier ... Daedalus. Das war ein berühmter Künstler und Baumeister.«
»Ein Baumeister?« Er senkte den Kopf fast auf meine Höhe, blickte mir durchdringend in die Augen und fragte erstaunt: »So etwas können die auch?«
Ich wehrte lachend ab.
»Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Dieser Daedalus hat sicher nie gelebt und die Geschichte ist erfunden.«
»Vielleicht hat er es nur versucht mit dem Fliegen. Es ist ihm nicht gelungen. Der andere stürzt ab.«
»Das soll sein Sohn Ikarus sein. Weil er der Sonne zu nahe kam, schmolz das Wachs, das die Flügel zusammenhielt.«
»Das versteht sich«, sagte er nachdenklich. »Es war wohl nicht richtig, Wachs zu nehmen. Das hält nicht.«
»Es geht überhaupt nicht. Der Mensch kann nun einmal nicht fliegen.«
»Du meinst wirklich, sie haben sich die Geschichte nur ausgedacht?«
»Es ist eine Parabel.«
»Eine was?«
»Ein Gleichnis, das sich gegen den menschlichen Übermut richtet.«
Er brummte etwas. Vielleicht verstand er nicht oder war nicht zufrieden. Noch immer betrachtete er das Bild.
Wieder wollte ich mich abwenden, doch da fuhr er herum und packte mich am Handgelenk.
»Man müsste es noch einmal anders versuchen! Nicht mit Wachs, das war schlecht. Warum hat er nicht gleich richtige Flügel genommen?«
»Du meinst ...«
»Vom Adler ... Vom Geier ...«
»Die tragen doch keine Menschen.«
»Mag sein. Der Mensch ist zu schwer. Vielleicht müsste man ihm nicht zwei, sondern gleich vier Flügel anheften. Was sagst du dazu?«
Er hielt noch immer mit seinem eisernen Griff mein Handgelenk. Erwartungsvoll blickte er mir in die Augen.
»Auf solche Gedanken sind wohl schon andere gekommen«, sagte ich, wobei ich mich nicht ohne Mühe losmachte. »Und viele haben versucht zu fliegen. Das ist sinnlos, es gelingt nun mal nicht.«
»Nein?« Er strich sein kantiges, rasiertes, von zwei Narben gespaltenes Kinn. »Nun, wenn du es sagst ... Du weißt besser Bescheid. Ist aber seltsam ... Meinst du nicht auch? Was so ein dummer Vogel kann, müsste doch auch ein Mensch zuwege bringen. Alles macht er mit seinem Verstand: fahren, auf dem Wasser segeln, gewaltige Steine bewegen ...«
Er fuchtelte mit seinen großen, rissigen Händen, reckte den sehnigen Hals. Plötzlich sah er mich wieder an, diesmal prüfend.
»Es scheint, du verstehst etwas davon. Bist du vielleicht Baumeister?«
Ich verneinte.
Er seufzte enttäuscht.
»Nun, macht nichts. Ich suche nämlich einen. Bei uns ...«
Ich sollte an diesem Tag nicht erfahren, welcher Stamm mit »bei uns« gemeint war und wofür der germanische Riese einen Baumeister suchte. Ein durchnässter Bote trat in die Halle und teilte mit, dass der Legat an diesem Tag nicht mehr nach Mogontiacum zurückkehren werde. Wegen des schlechten Wetters und der schwer passierbaren Wege habe er sich zu einem Zwischenaufenthalt bei einem Gastfreund entschlossen. Günstige Umstände vorausgesetzt, werde er am nächsten Tag, spätestens mittags, nach Mogontiacum zurückgekehrt sein.
Diese Mitteilung führte unverzüglich zum allgemeinen Aufbruch. Alles drängte durch das schmale Vestibül zum Ausgangsportal. Ich wunderte mich, dass die Leute jetzt anscheinend dringende Angelegenheiten zu erledigen hatten, nachdem sie stundenlang müßig und ohne Zeichen von Ungeduld in der Empfangshalle des Legaten ausharren konnten. Es gibt wohl nirgendwo etwas Besseres zu tun als auf einen wichtigen Mann zu warten, um ihn zu grüßen und mit seinem Lächeln belohnt zu werden. Das hatten auch diese Gallier und Germanen schon begriffen.
Der Regen tröpfelte nur noch. Auf dem Vorplatz gingen die Wartenden ebenfalls rasch auseinander. Ich sah meinen neuen Bekannten, der als einer der Ersten hinausgeeilt war – übrigens ohne ein Abschiedswort, nicht mal ein Kopfnicken, was ich einem Barbaren natürlich nicht übel nahm –, von einem Haufen seiner Stammesbrüder umringt. Er schien ihnen irgendwelche Befehle zu geben und beim Abmarsch durch die via praetoria setzte er sich an ihre Spitze.
Vielleicht ein Häuptling, dachte ich und fand es auf einmal sehr komisch, dass ich mich mit einem Germanen über Helden griechischer Sagen und über fliegende Menschen unterhalten hatte.
Was sollte ich mit dem Rest des Tages in diesem verfluchten Garnisonsnest anfangen: Ich verließ das Lager und schlenderte noch eine Weile in der Siedlung umher. Es dämmerte schon, und die Luft war feucht und kalt. Die Bauern zogen mit ihren Ochsenkarren davon. Die Händler schlossen ihre Läden. Diebe, Huren und Strichjungen krochen aus ihren Schlupfwinkeln.
Ich hatte unangenehme Begegnungen. Bald konnte ich mich der gierigen Hände, die unter meinen Mantel langten, kaum noch erwehren. Die einen suchten nach meinem Geldbeutel, die andern griffen ungeniert tiefer. Als mich zwei Kerle schließlich gegen meinen Protest in eine der Lasterhöhlen zerren wollten, musste ich mich unter Einsatz von Fäusten und Zähnen in Sicherheit bringen.
Seltsam, vor kurzem noch hatte ich solche Streifzüge durch verrufene Spelunken genossen. Allerdings war ein Vergleich mit Rom nicht recht angebracht. In der Subura waren wir bekannt, wir wurden als gute Kunden geschätzt und geradezu ehrerbietig behandelt. Die römischen Huren nannten mich beinahe zärtlich den »dicken Apollo«. Ein weiterer Unterschied war der, dass man ihrer Dreistigkeit nie allein ausgeliefert war. Man erschien ja immer in großer Gesellschaft, in der man, wenn notwendig, Schutz fand.
Hier taten es übrigens die Legionäre nicht anders: Betrunken und grölend, Dolche im Gürtel, zogen ganze Hundertschaften durch die Bordelle und Schenken.
Ich machte mich lieber davon.
Später aber konnte ich meinem Vergnügen doch nicht entrinnen. Mein Wirt, der Gallier – sein Name war Antrax –, ein Bursche mit Herkulesschultern und eingedrückter Nase, der früher als Athlet gereist war, erzählte mir seine Lebensgeschichte, pries sich als treu sorgenden Familienvater und empfahl mir am Ende seine Tochter. Ich wagte keinen Widerstand, als er mich aufmunternd lächelnd am Arm nahm und in eine Kammer schob.
Die »Tochter« hieß Cassia, war etwas älter als er, doch gut im Fleisch. Sie stammte ebenfalls aus Gallien. Es war die, die mich am Nachmittag mit ihrem Gekeife gestört hatte. Obwohl nur eine winzige Ölfunzel brannte, sah ich, dass ihr linkes Auge schwarz umrandet und zugeschwollen war.
Jetzt war sie ganz sanft, fragte mich nach meinen Wünschen, und da ich unschlüssig war, empfahl sie mir, sie ruhig gewähren zu lassen. Ich streckte mich auf der Matratze aus und ließ es geschehen.
Sie zeigte mir dabei ihre bessere Seite, den prallen, weißen Hintern, den sie sehr wirkungsvoll zu bewegen wusste. Ohne Zweifel, sie hatte Erfahrung.
IIISEXTUS MANLIUS
Am nächsten Morgen ging ich wieder ins Lager. Das Gedränge auf dem Vorplatz und in der Halle war noch stärker als am Vortag, und ich erfuhr zu meiner Erleichterung, dass der Statthalter zurückgekommen sei und schon empfange.
Also gesellte ich mich zu den Wartenden.
Von Zeit zu Zeit trat aus der Tür des Empfangsraums ein schmales, weißhaariges Männchen. Dann verstummten alle Gespräche, denn niemand wollte seinen Namen überhören, falls der Legat ihn als Nächsten zu sehen wünschte. Ich erkannte das Männchen, es war Honorius, ein Freigelassener, der Varus bereits seit Jahrzehnten diente. In Rom, wo ich einige Male mit meinem Vater im Haus seines Freundes zu Gast gewesen war, hatte ich ihn schon seines Amtes walten sehen. Als Sekretär und Nomenklator hatte er eine Vertrauensstellung und schien dem Statthalter unentbehrlich zu sein, sogar hier im Militärlager. Mit vornehmer Herablassung musterte er die Anwesenden, und nachdem er einen aufgerufen hatte, der an ihm vorüber in den Empfangsraum eilte, zog er ein Wachstäfelchen und einen Griffel hervor, um die Namen der Neuankömmlinge und ihre Anliegen zu notieren.
Auch ich trat zu ihm, doch bevor ich den Mund öffnen konnte, gab er mir mit einem Blick zu verstehen, dass er mich kenne und Bescheid wisse.
»Wir haben den Brief deines Vaters erhalten und uns schon über dich Gedanken gemacht«, sagte er, ein Lächeln andeutend. »Wie du siehst, sind wir heute sehr beschäftigt. Hab etwas Geduld.«
Tatsächlich musste ich mehrere Stunden warten.
Immer wieder stürmten Tribunen und Centurionen herein, deren dringende Angelegenheiten keinen Aufschub duldeten. Die Zahl der Gallier und Germanen hatte sich gegenüber dem Vortag verdoppelt. Ich sah auch den hoch gewachsenen Häuptling wieder, der breit und zufrieden lächelnd aus dem Empfangsraum kam und – rechts einem auf die Schulter klopfend, links jemandem etwas zurufend – zum Ausgang strebte.
Nach ihm trat einer heraus, in dem man sofort den vornehmen Römer erkannte. Mich durchzuckte ein freudiger Schreck.
Das war doch ... Bei Jupiter, das war Manlius! Sextus Manlius, der Sohn des früheren Prokurators für die Getreideversorgung. Ein Freund aus meiner Studienzeit an der Akademie in Athen.
Ich konnte ihn gerade noch am Ellbogen packen, bevor er die Halle verließ. Er drehte sich etwas unwirsch um, blieb aber gleich stehen und starrte mich überrascht an.
»Marcus Licinius?«
»Ich bin es!«
»Was hast denn du in dieser verdammten Gegend verloren?«
»Keine Ahnung. Und du?«
»Nichts als kostbare Zeit.«
Wir umarmten uns.
Er hatte sich in den sechs, sieben Jahren wenig verändert. Wie früher war er so mager, als hätte er kein Gramm Fett am Leibe. Wie gegerbt spannte sich die Haut über den starken Backenknochen. Sein krauses schwarzes Haar hing ihm wirr in die Stirn. Und noch immer hatte er diesen bohrenden, etwas düsteren Blick, der kaum heiter wurde, wenn er lachte.
»Wo war das zuletzt?«, fragte er. »In Athen?«
»Wo sonst? Du und ich ... Die zwei Unzertrennlichen!«
»Jedenfalls ein paar Monate lang.«
»Du bliebst wohl noch eine Weile dort. In Rom sind wir uns nicht wieder begegnet.«
»Von Athen ging ich noch nach Ephesus.«
»Als Baumeister?«
»Nein. Da gibt es nichts mehr zu bauen. Zu lernen sehr viel. Tempel, Wasserleitungen, Hafenanlagen ... Und du? Hast du schon fleißig Prozesse gewonnen?«
»Leider nicht«, musste ich gestehen. »Aber das hat ja noch Zeit. Jetzt will der Erhabene, dass ich erst einmal Erfahrungen in der Provinz sammle. Dann wird es leichter mit der Quästur.«
»Darauf hättest du dich nicht einlassen sollen.«
»Was sollte ich machen? Mein Vater ...«
Er unterbrach mich mit einer schroffen Geste.
»Was wissen die Alten? Auch meiner hat mich dazu überredet. Geh nach Gallien, bewähre dich dort! Danach wird man sich in Rom um dich reißen. Schwindel! Jetzt bin ich fünf Jahre hier ... Mal in Argentorate, mal in Vesontio ... Hier ein Wassertürmchen, dort ein Kanalschacht ... Hier eine Heizung, dort eine Latrine ... Und wie geht es weiter?«
»Ja, was hast du nun vor?«
»Du fragst, was ich vorhabe?« Manlius verzog den Mund zu einem bitteren Lächeln. »Frag mich lieber, wozu man mich zwingt! Vor drei Jahren hat mir Tiberius selber noch zugesagt, er werde mich nach Italien zurückholen. Ich habe nichts mehr von ihm gehört! In Ostia soll ein Theater gebaut werden, in Rom entstehen neue Paläste. Zu tun gibt es dort mehr als genug. Aber nicht für mich! Ich sitze nun mal hier und versinke im Sumpf. Mich schickt der Statthalter nach Germanien!«
»Du meinst – auf die andere Seite des Rhenus?«
»Wohin sonst? Irgendein übergeschnappter alter Häuptling wünscht sich in seinem Urwald römischen Prunk – und ich soll ihn schaffen. Verlorene Mühe! Vertane Zeit! Selbst wenn ich dort die schönste Basilika baue ... Wer wird sie sehen? Wer wird meine Arbeit würdigen? Bald wird man sich kaum noch an mich erinnern. Lebendig begraben werde ich sein!«
»Du kannst dich ja weigern, dorthin zu gehen.«
Manlius warf einen zornigen Blick nach der Tür des Empfangsraums, die gerade wieder geöffnet wurde.
»Und bei dem da in Ungnade fallen, dem Freund und Verwandten des Erhabenen? Das liefe auf das Gleiche hinaus. Der hat sich nun einmal in den Kopf gesetzt, die Wildnis in eine Musterprovinz zu verwandeln. Wie er das machen will, ist mir schleierhaft. Aber er glaubt wohl, dass ihm alles gelingt. Er sagt sich, ich bin mit den Juden fertig geworden – warum soll ich mich vor den Germanen fürchten? Nun, er sitzt ja hier auf der linken Seite des Rhenus im Trocknen. In den Regen hinaus schickt er Leute wie mich. Pass auf! Auch auf dich wird er einen Anschlag machen ...«
Kaum hatte er das gesagt, als Honorius mich zum Legaten rief.
Rasch verabschiedete ich mich von Manlius. Er sagte mir noch, wo ich ihn finden könne. In der Eile und Aufregung vergaß ich es gleich.
Doch ich sollte ihn noch am selben Tag wiedertreffen.
IVDER STATTHALTER
Ich sah mich getäuscht in meiner eitlen Erwartung, der Legat werde sich für mich allein etwas Zeit nehmen.
In dem großen, kahlen Raum, wo er arbeitete und empfing, war ich in zahlreicher Gesellschaft. Zunächst bemerkte ich ihn gar nicht.
Gleich hinter der Tür stand eine Gruppe von Militärs um einen kahlköpfigen, in eine Toga gehüllten Greis, der gestenreich etwas darlegte. In einer Ecke hockten um einen Tisch Legionäre, die einem bettelnden Hund, wohl dem des Hausherrn, Brotbrocken zuwarfen. Auch ein paar Gallier in bunt karierten Mänteln waren anwesend. Vor der hinteren Wand, auf die ein Plan von Gallien und Germanien mit dem Rhenus in der Mitte gezeichnet war, standen drei Männer im lebhaften Gespräch: ein mit Auszeichnungen behangener Veteran, ein Centurio, der den Arm in einer Wundbinde trug, und schließlich ein beleibter älterer Mann in bequemer, lässig unter dem Bauch gegürteter Tunika.
Auf ihn ging ich zu. Es war Publius Quinctilius Varus.
Seit langem kannte ich ihn. Vor seiner Abreise nach Germanien war er ja als Senator eine der wichtigsten Persönlichkeiten im Leben der Hauptstadt gewesen. Das Konsulat hatte er schon als Vierunddreißigjähriger bekleidet. Als Prokonsul in Afrika und vor allem als Statthalter Syriens hatte er großen Ruhm erworben. Der Erhabene hielt ihn sogar der Aufnahme verwandtschaftlicher Beziehungen für würdig und trug ihm die Heirat mit seiner Großnichte an, der Enkelin seiner Schwester Octavia. Natürlich sagte Varus nicht Nein. Ich erinnere mich an die mit großem Prunk gefeierte Hochzeit, bei der ich als Zehnjähriger meinen ersten Weinrausch hatte. Die Braut wirkte etwas kümmerlich neben dem stattlichen Bräutigam und sie schien ihn als Ehefrau auch nicht lange zu fesseln. Er hielt sich bei Konkubinen und Sklavinnen schadlos und sorgte vor kurzem noch mit manchem Histörchen dafür, dass wir Müßiggänger in unseren langen, verbummelten Nächten Gesprächsstoff hatten. Im Grunde war das nichts Ungewöhnliches, weil es alle so trieben, aber ein Varus verdiente nun einmal besonderes Interesse. Sein Scharfsinn und seine Beredsamkeit waren berühmt, die meisten seiner Senatsreden wurden schriftlich verbreitet. Wenn man ihm auf dem Forum begegnete, zog er stets einen Schwarm von Klienten hinter sich her. In seinem Gefolge ließ es sich offenbar gut leben, denn er galt auch als einer der reichsten Männer des Staates. Wer hatte das böse Wort nicht gehört, das über seine Statthalterschaft in Syrien umging? Arm betrat er ein reiches Land, hieß es, reich verließ er ein armes.
»Wie freue ich mich, dich zu sehen, mein Junge!«, rief er, als er mich bemerkte, und legte mir beide Hände auf die Schultern.
»Ein glänzender Gedanke deines Vaters, dich zu uns zu schicken. Wir brauchen junge Männer wie dich! Hast du die lange Reise gut überstanden und dich schon etwas umgesehen?«
Wie früher strahlte sein breites, immer stark gerötetes Gesicht vor Wohlwollen. Doch das Jahr in Germanien hatte ihn verändert. Er wirkte auf mich gealtert, auch überanstrengt. Die lange Nase stach spitz hervor, die Tränensäcke unter den Augen waren geschwollen. Die zurückweichende Stirn war noch höher geworden, nur ein schütterer grauer Haarkranz war ihm geblieben. Bei aller zur Schau getragenen Gewogenheit wusste er wie immer Abstand zu halten, und die Eigenart, sein Gegenüber stets leicht belustigt und sogar etwas abschätzig anzusehen, hatte er auch hier nicht abgelegt. Während ich seine Fragen beantwortete, hatte ich wieder das Gefühl, ihn zu langweilen, so wie fast immer, wenn er bei früheren Gelegenheiten das Wort an mich gerichtet hatte. Ich endete mit einem Gestammel und glücklicherweise fiel mir noch der Brief meines Vaters ein, den ich hervorzog und ihm reichte.
»Ich werde ihn später lesen«, sagte er und gab die Rolle dem Honorius. »Wie sollte ich mich daran erfreuen – bei diesem Lärm und Durcheinander? Ich hoffe, wir werden hier für dich etwas finden, Marcus, zu tun gibt es wahrhaftig genug. Nein, mein Bester!«, wandte er sich an den Veteranen, der das Gespräch mit dem verwundeten Centurio fortgesetzt hatte und jetzt auf verschiedene Punkte der an die Wand gezeichneten Landkarte deutete. »Doch nicht so nahe am Rhenus! Was hätten wir damit erreicht? Tiefer drinnen ... Viel tiefer!«
Er wies mit dem Zeigefinger auf andere Stellen, weit im Innern Germaniens.
»Das wäre viel zu gefährlich, Legat«, gab der Veteran respektvoll zu bedenken. »Diese Gebiete sind ja noch nicht richtig erobert. Wer wollte mitten im Feindesland siedeln?«
»Ich brauche Bürgerkolonien«, sagte Varus. »Ich brauche Zentren, in denen sich städtisches Leben entwickelt. Die Sogwirkung ausüben auf die Umgebung. Die so anziehend sind, dass sie das misstrauische Volk aus den Wäldern hervorlocken. Handwerk und Handel, Märkte, Vergnügungen! Sie müssen aus ihren Schlupfwinkeln kriechen, damit wir sie erst einmal erfassen. Wie soll man etwas verwalten, das sich verborgen hält ... Justiz üben über Unsichtbare? Kann mir jemand erklären, wie man das macht?«
»Du hast Recht«, sagte ein gewichtiger, schnurrbärtiger Gallier, indem er näher trat. »Aber warum macht ihr es nicht wie bei uns? Erfasst sie in Gauen, gebt ihnen römisches Recht und lasst sie sich selbst verwalten.«
»Darauf wäre ich längst gekommen, du Schlaukopf«, erwiderte Varus, »wenn es nur irgendwie durchführbar wäre. Aber dafür sind sie zu weit zurück. Bei euch war das anders. Die Gaue waren ja vorgebildet und überall gab es größere Ortschaften, von wo aus die Oberhäupter ihre Stämme beherrschten. Heute sind das schon blühende Städte. Hier ...« Er zeigte auf rot markierte Punkte auf der gallischen Seite der Wandzeichnung. »Durocortorum, Vesontio, Vienna, Nemausus ... Vor allem aber Lugdunum! Die gallische Hauptstadt! Aus einer Bürgerkolonie entstanden, im Grunde heute noch eine. Mit eigener Landesvertretung, Münzprägungsstätte, zentraler Erfassung des Grenzzolls. Knotenpunkt des gallischen Straßennetzes. Mit einem Wort: das Rom des Westens! Und auf der anderen Seite des Rhenus, der germanischen? Was finden wir dort? An der Lupia und am Moenus ein paar Militärlager – und sonst nichts! Was ist das – die Provinz Germania? Eine Schimäre! Erzähle, Rutilus, was euch passiert ist – bei diesen Marsern, als ihr Abgaben einfordern wolltet. Was ist Volesius passiert, dem Steuereinnehmer?«
»Er ritt allein hin, mit zwei Gehilfen, um sie nicht einzuschüchtern«, sagte der Centurio mit der Wundbinde. »Sie wurden gleich totgeschlagen. Dann versuchte ich es mit meiner Hundertschaft. Als wir hinkamen, waren sie weg. Verschwunden! Sogar ihre Häuser hatten sie mitgenommen, vermutlich wieder auf Wagen geladen. Aber einige lauerten noch im Gebüsch und schleuderten ihre Lanzen nach uns.«
»Wilde!«, sagte der Statthalter seufzend. »Doch wir haben nun mal einen Auftrag. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen!«
»Das sähe dir auch nicht ähnlich, Varus«, sagte der Togaträger in schmeichelndem Ton. »Aber warum greifst du nicht schärfer durch und machst es wie in Judäa? Warum schlägst du nicht ein paar Tausend von ihnen ans Kreuz oder hängst sie an ihre verdammten Eichen? Rücksichtslose Gewalt ... Das ist die einzige Sprache, die sie verstehen!«
»In Judäa, das war etwas anderes«, sagte Varus, ärgerlich abwehrend. »Das war offener Aufstand, höchste Gefahr. Harte Bestrafung war unerlässlich. Das Volk dort ist leidenschaftlich und immer erregt ... Dieses ist schwerfällig, stur und bösartig. Aufstände sind nicht zu befürchten, aber der Widerstand ist noch immer hartnäckig. Man muss ihn mit anderen Mitteln brechen.«
»Das ist wahr«, sagte einer der Militärs. »Hier ein Dorf niederbrennen, dort ein paar Köpfe rollen lassen – das nützt nicht viel. Solche Maßnahmen machen wenig Eindruck. Dreißig Meilen hinter dem Wald bekommt das schon niemand mehr mit.«
»Sie begreifen ja unsere Überlegenheit!«, erklärte der Statthalter überzeugt. »Man muss sie ihnen nur ständig vor Augen führen und damit den Wunsch in ihnen wecken, auch ständig an dieser höheren Daseinsform Anteil zu haben. Dann wird ihnen nämlich auch nach und nach dämmern, dass sie das Bessere nicht umsonst erhalten – als Göttergeschenk. Dass sie den Anschluss zur Welt nur dann bekommen, wenn sie Straßen und Brücken bauen ... Nach Gesetzen leben und für Sicherheit sorgen ... Mit einem Wort, sich nicht wie Tiere, sondern wie Menschen verhalten. Das muss in ihre blöden Barbarenschädel hinein!« Er wandte sich wieder dem Veteranen zu: »Übrigens gibt es auch freundliche Zeichen. Einige ihrer Häuptlinge sind ja schon lange bemüht, unserer Sache zu dienen. Besonders einer – ihr kennt ihn: Segestes. Er baut eine villa rustica und hat auch noch größere Pläne. Seine Burg ist sehr günstig gelegen, ich habe sie im vorigen Jahr besucht. Vielleicht werden sie selbst dort die erste Stadt gründen. Diesem Segestes wäre es zuzutrauen. Ein Germane mit Verstand ... Eine seltene Erscheinung! Kommt nicht her, um sich zu beschweren, sondern macht Vorschläge, wie es schneller vorangehen könnte. Ich gebe ihm den jungen Manlius mit. Der ist geschickt und hat als Baumeister schon so gut wie alles gemacht. Es gefällt ihm zwar nicht, er will lieber nach Rom zurück – aber wer von uns wollte das nicht? Was meinst du, Marcus?«
Er lachte. Ich stimmte mit der Mehrheit seiner Zuhörer ein.
»Aber verzeih«, sagte der Togaträger. »Was ist denn aus Longinus geworden? War der nicht als Baumeister bei Segestes ... Oder irgendwo bei den Cheruskern?«
»Auch so eine dumme Geschichte«, erwiderte Varus, gleich wieder missgestimmt. »Longinus ist tot, in einem Steinbruch verunglückt. Er hatte ihn gerade erst in Betrieb genommen. Segestes schwört, dass es ein Unglücksfall war, aber wer weiß ... Er selber war nicht dabei, und was ihm seine Leute berichten ... Wer wird die Wahrheit jemals erfahren! Dem Segestes traue ich, und ich brauche nun einmal solche Männer. Deshalb will ich auf eine Untersuchung verzichten. Wer ist noch draußen, Honorius? Ach, ich bin müde – die lange Fahrt. Ich muss ruhen. Lade alle zum Mahl! Meine Herren, ihr seid heute meine Gäste! Es gibt Wachteln, Huhn auf parthische Art, Schweineeuter und vieles mehr! Wir sehen uns dann ...«
VEIN WENIG VERLOCKENDES ANGEBOT
Ich hatte natürlich gleich erraten, wer der »Germane mit Verstand« war, von dem der Legat gesprochen hatte. Sextus Manlius bestätigte es.
»Würde er sich doch totfressen!«, zischte mein Freund und deutete mit dem Kopf zu dem langen Häuptling hin, der sich an einem Spanferkel gütlich tat. »Warum musste er gerade hierher kommen, als auch ich hier zu tun hatte! Warum musste der Kerl einen Baumeister suchen?«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: