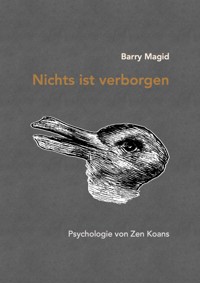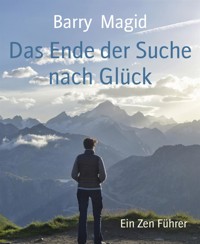
11,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Dieses Zen-Buch überrascht. Barry`s Sicht auf Zen ist konsequent alltagsbezogen und psychologisch ausgerichtet. Es gelingt ihm, die Essenz des Zen zu vermitteln und uns dabei in unserer ganz „stinknormalen“ Menschlichkeit abzuholen. Unsere Vorstellungen, irgendwann, wenn unsere Zen-Praxis erfolgreich ist, jeden Moment gelassen, voller Mitgefühl und befreit von all dem lästigen Kleinkram über den Dingen stehen zu können, werden herausgefordert.
Ein grosser Teil des Buches macht deutlich, wie uns unsere Heil-Fantasien im Grunde immer wieder die selbe Melodie vorsingen: ich bin noch nicht da, wo ich sein kann, es gibt da noch mehr, ich sollte mich mehr anstrengen! Diese Vorstellungen einer spirituellen Selbst-Optimierung sind hartnäckig ... welche Entspannung „ ...wenn wir jegliches Streben, Buddha zu werden, vergessen und als ganz normale menschliche Wesen das Leben geniessen.“
Barry gelingt es, der Übung des Zen, ein menschliches Antlitz zu geben. Themen wie Liebe, Beziehungen, Abhängigkeit, Sex, Verletzlichkeit ... menschliche Erfahrungen und Bedürfnisse, die auch durch besondere Erleuchtungs-Momente nicht verschwinden, bekommen durch die Übungs-Praxis ihren Platz.
Mehr und mehr erkennen wir, wie wir mit aller Anstrengung versuchen, ein Anderer zu sein als der, der wir sind. Wir fühlen, was es mit uns macht, gegen den Strom des Lebens zu rudern und das Unkontrollierbare kontrollieren zu wollen. Geben wir den verschiedensten Teilen in uns freundlich Raum, lockert, ja, vielleicht löst sich der selbstzentrierte Traum. Durchaus mit einem Schmunzeln.
Was man von der Übung erwarten kann? „Unser Schmerz ist nicht ein Zeichen dafür, dass etwas in uns beschädigt oder kaputt ist. Er ist ganz einfach ein Zeichen, dass wir lebendig sind.“
„Also: Sitz einfach. Lasse alles in Ruhe. Mache nichts. Doch das tue wirklich.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Ende der Suche nach Glück
Ein Zen Führer
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenEin Zen Führer
Barry Magid
Das Ende der Suche
nach Glück
Deutsche Übersetzung von:
Barry Magid
Ending the Pursuit of Happiness
A Zen Guide
Wisdom Publications, Boston, 2008
Chris Bünck, 2019
mit freundlicher Erlaubnis des Verlags
Hinweise zur übersetzten Ausgabe
1. Einführung
2. Unsere geheime Praxis
3. Der Weg des Zen, der Weg der Psychoanalyse
4. Das gewöhnliche Leben
5. Die Suche nach Erleuchtung
6. Körper und Geist
7. Liebe, Sex und Mitgefühl
8. Beziehungen
9. Wer, Was und Warum?
10. Es ist mir ein Rätsel
11. Schlussfolgerung
Anmerkungen
Über Barry Magid
Literaturverzeichnis
Hinweise zur übersetzten Ausgabe
Hinweise zur übersetzten Ausgabe
Diese Übersetzung begann durch die Übersetzung einzelner Passagen für eine Sitzgruppe in der Schweiz (www.zen-am-berg.ch).
Dadurch kam die Idee auf, das ganze Buch in Deutsch zugänglich zu machen. Ein langer, intensiver und ausserordentlich lehrreicher Prozess begann. Der Austausch mit anderen Sangha-Mitgliedern war enorm hilfreich. Übersetzen ermöglicht ein Vertiefen und Eintauchen in Bedeutungsebenen, die einem beim einmaligen Lesen gar nicht auffallen. So entstanden interessante Diskussionen, um einzelne Begriffe beim Übertragen in die deutsche Version so nah wie möglich am Original zu halten.
Der/die interessierte Leser/in wird öfters dem Wort Mind (vielfach in Klammern gesetzt) begegnen. Wir haben uns intensiver mit einer passenden Übersetzung auseinandergesetzt, auf der Suche ein deutsches Wort zu finden, das Mind am besten immer gleich repräsentieren kann. Dem englischen Mind, wird man wohl am besten durch eine kontext-bezogene Übersetzung gerecht. So heisst es an manchen Stellen ganz einfach Geist, an anderen Bewusstsein, Selbst, Gedankeninhalte u. ä., in Klammern jeweils Mind.
Ich hoffe auf diesem Weg der Vielschichtigkeit gerecht zu werden und gleichzeitig die Lesbarkeit zu bewahren.
Dies ist keine professionelle Übersetzungsarbeit. Diese Ausgabe enthält sicherlich den ein oder anderen Fehler. Doch bin ich überzeugt, dass Barry’s inspirierendes, tiefgehendes Verstehen klar und verständlich rüberkommt.
Als Barry mich fragte, ob ich Interesse hätte, dieses Buch zu übersetzen (nur weil ich mich irgendwann mal an einzelnen Passagen versucht hatte) sagte ich einfach Ja ... und hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommen wird. Es war viel. - Jetzt freue ich mich und bin dankbar, dieses Geschenk erhalten zu haben. Beim unzähligen Überarbeiten und Editieren, bin ich doch immer wieder überrascht, wie sehr die Passage, an der ich gerade arbeite, mit dem zu tun hat, was mich gerade beschäftigt und mir neue Blickwinkel öffnet. Und das obwohl ich diese Zeilen doch schon einige Male gelesen hatte ... immer wieder von Neuem: inneres Nicken, mich gesehen fühlen, in meiner ganz normalen Menschlichkeit angesprochen und erreicht. Etwas, dass dieses Buch vermittelt.
Danke.
Chris Bünck (Amden, Schweiz)
1. Einführung
1. Einführung
Warum reparieren, wenn es doch gar nicht kaputt ist?
Dieser Titel steht für eines der Hauptthemen dieses Buches. Er wurde nicht aus einem tausend Jahre alten Zen-Text genommen, auch wenn es möglich ist, Anklänge davon in der chinesischen Klassik zu finden, wie z. B. dem Tao Te Ching oder Hsin Hsin Ming.
Und genauso wie die alten Meister in der Umgangssprache ihrer Zeit sprachen, müssen wir unseren eigenen zeitgenössischen und amerikanischen Weg finden über die Dinge zu sprechen, die sie uns vermittelt haben. Der Spruch „Warum denn reparieren, wenn es doch gar nicht kaputt ist?“ gehört zu den Teilen der Volksweisheit, von denen jeder glaubt, ihn schon mal gehört zu haben, aber niemand zurückverfolgen kann, wo er eigentlich herkommt. In meiner Erinnerung wurde er 1977 durch Bert Lance bekannt gemacht, einem engen Freund und Berater von Präsident Jimmy Carter. Vielleicht liesse er sich bis nach China zurückverfolgen. Auf jeden Fall vermittelt er wohl – in seiner volkstümlichen amerikanischen Art – eine Wahrheit, die tiefer geht als das, was Lance damit beabsichtigt hatte. Einerseits warnt dieser Spruch uns, an Dingen herumzudoktern, die perfekt und reibungslos ohne unsere Zutun laufen. Andererseits fordert er uns heraus, genauer hinzusehen, was wir in unseren Leben für nicht in Ordnung halten und als reparaturbedürftig ansehen. Vielleicht ist die überraschende Antwort, dass überhaupt nichts zerbrochen ist und dass wir auch keine Reparatur brauchen.
Als Psychiater, Psychoanalytiker genauso wie als Zen-Lehrer geht es in meinem beruflichen Leben immer um die Arbeit mit Menschen, die berichten, dass sie Probleme haben und auch tatsächlich leiden, oftmals sichtbar und schrecklich. Wie kann ich ihnen vermitteln, dass nichts wirklich falsch an ihnen ist? Und wenn ich das sagen würde, inwieweit würde ich meine buddhistischen Gelübde erfüllen, alle Wesen zu retten?
Jeder, der zur Therapie oder zur Meditations-Praxis kommt, hat das Gefühl, dass etwas mit ihm/ihr falsch ist und dieses nun in Ordnung gebracht werden soll. Das kann man schon erwarten. Wir kommen, um nach Linderung unseres Leidens zu suchen, welche Vorstellung auch immer wir über „Leiden“ und „Linderung“ haben. Zen jedoch (und vielleicht auch Bert Lance) sagt uns, dass unsere Suche selbst die Schieflage verkörpert, die wir zu korrigieren versuchen. Und Zen fährt fort, dass wir ausschliesslich, indem wir die Dinge genauso lassen, wie sie schon sind, die falsche Dichotomie von Problem und Lösung verlassen können (die ja das, was sie vorgibt in Ordnung zu bringen, damit gerade am Leben erhält).
Doch bevor wir zu schlagfertig bei dieser Schlussfolgerung ankommen, werden wir gründlich alle Aspekte zu untersuchen haben, wie wir uns zerbrochen fühlen und ehrlich damit sein, welche Art von Behandlung, Heilung oder Reparatur wir glauben zu benötigen.
Wir alle versuchen, uns in der ein oder anderen Weise zu kurieren, aber häufig gehen unsere Hoffnungen dabei unter Tage und wir sind uns meist nicht wirklich klar darüber, was wir suchen oder wie wir uns vorstellen, dorthin zu gelangen. Vielleicht können wir eine ganze Liste verschiedenster Dinge darüber sagen, was wir uns von Meditation erhoffen, doch irgendwo im Hinterstübchen unseres Selbst versteckt sich üblicherweise eine Fantasie, dass es da etwas gibt, das uns ein für alle Mal in Ordnung bringt. Diese Fantasie hat viele Namen, einer davon ist „Erleuchtung“. Dieser Begriff löst eine bestimmte Vorstellung aus: die eines problemfreien Lebens, und das dann ein für alle Mal. Erleuchtung ist wirklich, viel wirklicher als wir uns das vorstellen können, doch wir werden niemals die Bedeutung kennen können, solange wir uns in unsere Ideen darüber verwickeln.
Im ersten Kapitel dieses Buches, werde ich all die Wege erkunden, die uns helfen, bewusster und ehrlicher mit unserer „heimlichen Praxis“ umzugehen. Sie läuft im Hintergrund und nährt die Hoffnung, dass uns unsere Übungspraxis in Ordnung bringt, wenn nicht sogar heilt.
An dieser Stelle ist meine psychoanalytische Ausbildung von Vorteil: zu wissen, wo wir nach all den subtilen und unbewussten Schleichwegen schauen müssen, die wir nutzen, um unsere Meditationspraxis in den Dienst unserer persönlichen, psychologischen Absichten zu stellen. Psychoanalyse ist eine ergebnisoffene Erforschung, die von uns verlangt genauer zu schauen, was unser Bewusstsein Moment für Moment gerade tut. Das ist gar nicht so besonders anders als das Beobachten unserer Gedanken in der Meditation und dabei zu erkennen, wie sie kommen und gehen. Der Hauptunterschied ist der, dass die Psychoanalyse auch fragt: „Wo haben Sie diese Idee her?“ Im fortlaufenden Dialog mit dem Analytiker schauen wir unsere persönliche Geschichte näher an. Die Hoffnung und der Schrecken und wie es geschah, dass uns – als wir noch klein waren – beigebracht wurde, was wir im Guten sowie im Bösen erwarten konnten. Und wie das Leben oder die Menschen, die uns besonders nah waren, uns das näher brachten. Wir erinnern uns gemeinsam, wie es war, bei unseren Eltern nach Liebe zu suchen und was wir glaubten tun zu müssen oder besser sein zu lassen, um diese Liebe auch zu verdienen oder zu erhalten. Mit zunehmender Vertiefung der analytischen Beziehung, beginnen wir auch diese Beziehung selbst zu betrachten, um zu erkennen, wie auch sie andauernd beeinflusst ist von den alten Sehnsüchten und Erwartungen, etwas das in all unseren Beziehungen geschieht. Bekommen wir schlussendlich die Aufmerksamkeit, die wir immer wollten und von unseren Eltern nicht bekommen konnten? Oder ist der Analytiker einfach nur der letzte in der langen Reihe derer, die es einfach nicht kapieren und uns mit dem chronisch wiederkehrenden Gefühl hinterlassen, nicht verstanden zu werden?
Die Vertauschung von Hoffnungen und Befürchtungen ist buchstäblich endlos und zeigt sich im Laufe der Jahre in einer Vielfalt verschiedenster Szenarien. Nach und nach wird das Bild der Person, die wir zu sein glauben, immer klarer. Klarer wird auch, wie wir uns als diese Person fühlen, wie angenehm wir uns in dieser unserer Haut fühlen – mit all den Emotionen, unserem Körper, unserer Sexualität und mit anderen Menschen.
Zwangsläufig gibt es dann auch eine Menge, was wir nicht mögen an uns und wir am liebsten ändern möchten. Zudem gibt es in unserem mentalen und emotionalen Leben ein grosses Gebiet, das wir überhaupt nicht näher betrachten wollen, ja dessen Existenz wir am liebsten vollkommen leugnen würden. In diesen Gebieten fühlen wir uns oft am verletzlichsten, am schwächsten und vielleicht auch am meisten beschädigt. Oder es handelt sich um die Dinge, für die wir uns am meisten schämen. Doch um so länger wir Aufmerksamkeit und Ehrlichkeit mit uns selbst und dem Analytiker praktizieren, umso schwieriger wird es, diese verleugneten Teile unseres Selbst zu ignorieren. Dann drängt sich die Frage auf: Was soll mit all den Teilen unseres Selbst geschehen, die wir nicht mögen, diejenigen Teile, die wohl die Ursache unseres Leidens sind? Wird es der Therapie gelingen, sie ein für alle Mal verschwinden zu lassen? Wie sieht es mit spirituellen Übungen aus? Wird es der Meditation möglich sein, uns in andere Personen zu verwandeln, freundlicher, mitfühlender, spiritueller?
Sowohl Psychoanalyse wie auch Meditation können tief gehende Veränderungen in unserem Leben auslösen. Sie tun das allerdings nur auf eine Art, die unerwartet geschieht. Die Veränderungen, die wir nach vielen Jahren der Analyse oder der Übung wahrnehmen, können durchaus ganz andere sein als die, die wir uns zu Beginn vorstellten. Genaugenommen verändern beide uns dadurch, dass sie uns beibringen, die Dinge so sein zu lassen, wie wir sie vorfinden. Das ist nun nicht gerade das, was wir uns wünschten oder erwartet hatten. Es gibt genügend viele Therapien und spirituelle Übungen auf dem Markt, die uns die Erfüllung unserer Selbst-Optimierungs-Fantasien, vielleicht sogar so etwas wie Perfektion, versprechen. Mit Freude erlaube ich mir zu sagen, dass der Hauptunterschied zwischen Psychoanalyse und dieser Art der Psychotherapie darin besteht, dass Psychoanalyse niemandem hilft. All diese Helfer und diejenigen, die vorgeben das zu tun, sind sich einfach zu sicher, was defekt ist und wie man es wieder reparieren kann. Psychoanalyse und Zen - beide auf ihre Art - stellen diese Sicherheit in Frage.
Wenn es doch auf ganz grundlegender Ebene so ist, dass wir keine Wiederherstellung, keine Reparatur benötigen, dann ist doch unser ganz normales Alltagsleben, das wir ja schon haben, nicht das Problem, sondern genaugenommen die Lösung nach der wir suchten. In diesem Fall werden unsere Alltags-Definitionen von „Problemen“ und „Lösungen“ eine drastische Überprüfung brauchen. In einem Zen-Vers, dem Sandokai (Die Gleichheit vom Relativen und vom Absoluten), heisst es: „Das Relative passt zum Absoluten wie ein Deckel zu seinem Behälter“. Mit dem Absoluten ist das Gegenteil unseres normalen Alltagslebens gemeint. Üblicherweise bedeutet es für uns etwas, das ewig, perfekt und untrennbar ist, etwas, das wir nicht in gut und schlecht, perfekt oder unvollkommen zweiteilen können. Nun sind wir allerdings tief konditioniert, das Alltägliche und das Absolute als polare Gegensätze zu betrachten. Das ist die Schwierigkeit. Und uns wird nicht gesagt, dass sich das Alltägliche und das Absolute gegenseitig annullieren, sondern dass sie auch noch perfekt zueinander passen.
Dieses Buch beschäftigt sich genau damit: wie unser Normal- und Gewöhnlich-Sein mit dem, was wir spirituell nennen, zusammen passen kann.
Wir werden im Folgenden genauer erkunden, wie dieses Zusammenpassen in unserem alltäglichen Leben, bei der Arbeit, in unseren Beziehungen, mit unseren Bedürfnissen und Schwierigkeiten aussehen kann ... auch, wenn wir das wir das eigentlich nicht wirklich mögen. Glauben wir nicht, dass wir schon alles über das Alltägliche wissen? Der Psychoanalytiker Harry Stack Sullivan meinte mal, dass wir schlussendlich „menschlicher sind als aussergewöhnlich“. Das scheint ja eigentlich offensichtlich. Doch irgendwie sind wir überwiegend mit unserem „aussergewöhnlich“- sein beschäftigt. Wenn Menschen zur Therapie kommen, befürchten sie oftmals, weniger zu sein als ganz einfach menschlich; dass sie Schaden erlitten haben in ihrem Leben oder dass sie auf andere Art und Weise, doch grundsätzlich unangemessen sind. Sie werden von Ängsten geplagt und oftmals befinden sie sich in unglücklichen Beziehungen, die verhindern, ihr Leben, das sie sich eigentlich wünschen, zu leben. Und so fühlen sie sich oft in einem dichten Netz aus Konflikt und Unterdrückung verwickelt.
Historisch gesehen entwickelte sich die Psychotherapie nach dem Vorbild und in Analogie zur Medizin. In dieser Sichtweise waren emotionale Probleme so etwas wie Krankheiten, die dann die Psychotherapeuten, auch wenn sie selten Ärzte waren, heilen würden. Wir haben uns daran gewöhnt, seelische „Erkrankungen“ und die Behandlung von Unglücklichsein als Krankheiten anzusehen, unter denen wir leiden und von denen wir geheilt werden müssen. Unbestreitbar gibt es bestimmte ernsthafte Zustände wie Schizophrenie oder die bipolare Störung, bei denen sich biologische oder neurochemische Ursachen gezeigt haben und bei denen wir mit Medikamenten behandeln – so wie bei Krankheiten. Dass wir aber eine direkte Linie von Schizophrenie zu jeder Art von Verwirrung, Unglücklichsein oder interpersonellen Schwierigkeiten ziehen können ist alles andere als offensichtlich.
Handelt es sich wirklich um Krankheiten? Ist die gesamte menschliche Rasse grundsätzlich krank und behandlungsbedürftig? Oder haben wir alle in der ein oder anderen Form mit Leiden klarzukommen, auch wenn wir irgendwoher eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für unsere seelische Gesundheit bekommen haben? Buddha legte dar, dass Leben, Geburt, Tod und alles dazwischen Leiden bedeutet. Wir werden genauer untersuchen, wie dieses Leiden seine Wurzeln in der Tatsache der Veränderung hat, speziell der Veränderung die uns in unseren Körpern widerfährt.
Welchen Bezug zu unserem verkörperten Dasein hat unsere spirituelle Übung (bzw. das, was wir dafür halten)? Was hat sie mit unserem Leben im Körper zu tun? Kann die spirituelle Übung uns dabei helfen, unsere Körper zu transzendieren und uns an einen höheren Ort zu führen, an dem es kein Leiden gibt? Oder bringt uns die Übung immer wieder zurück auf den Boden? Wenn all diese Weisen von „Erleuchtung“ sprechen … was ist damit genau gemeint? Was wird die Übung in unserem Leben bewirken?
In meinem vorherigen Buch Ordinary Mind: Exploring the common Ground of Zen and Psychoanalysis habe ich näher untersucht, wie man das psychoanalytische Verständnis des Selbst in das Konzept des Nicht-Selbst des Zen-Buddhismus integrieren könnte. Mit anderen Worten: wie man die gesunde Entwicklung einer Person genauso wie deren pathologischen Abweichungen mit dem Konzept des Nicht-Selbst, also die essenzielle Leere des Selbst und die wechselseitige Verbundenheit mit der gesamten Existenz, vereinbaren kann. In diesem Buch werde ich keinen weiteren Versuch starten, eine integrierte Herangehensweise an Zen und Psychoanalyse zu definieren oder zu rechtfertigen. Wenn es sich ergibt, werde ich es im Verlauf kurz illustrieren. Dieses Buch wird, was seinen Stil angeht, weniger psychoanalytisch sein. Ich hoffe sehr, dass meine Erfahrung und Fachkenntnis als Psychoanalytiker – auch wenn es sicherlich alles, das ich schreibe, inspiriert – meistens unaufdringlich im Hintergrund bleibt. Nichtsdestotrotz werde ich mich meiner klinischen Erfahrung bedienen, wenn wir uns der Zen Übung zuwenden und was diese mit unseren Beziehungen zu tun hat. Und vor allem: was Zen über unsere sexuelle Leidenschaften und unser spirituelles Mitempfinden sagt oder eben auch nicht sagt.
Im Buch Ordinary Mind befanden sich auch Kommentare zu dem ein oder anderen Koan. Koans zu kommentieren, ist eine sehr traditionelle Form der Zen-Lehre. Mir war es wichtig aufzuzeigen, wie es möglich wird, solche Kommentare für ein modernes psychologisch orientiertes Publikum vermittelbar zu machen. In diesem Buch werde ich eher informell über Koans reden und sie einfach als Fallbeispiele nutzen, um einen bestimmten Punkt zu verdeutlichen. Auch wenn diese alten Fälle zur Verdeutlichung eines ganzen Spektrums von Themen gebraucht werden können, stellen sie doch grundsätzlich eine Frage und benutzen dabei eine Form, die diese Frage beispielhaft verdeutlicht oder das Problem stärker in den Vordergrund hebt. Typischerweise in einem der ersten Fälle, auf den Studenten treffen, fragt ein junger Mönch seinen Lehrer: „Haben Hunde eine Buddha-Natur oder nicht?“ Diese Frage spiegelt unsere Beschäftigung mit dem, was wir haben oder nicht haben, mit dem was unsere Basis ist und dem, was wir für spirituell halten. Es macht die grundlegende Kluft deutlich, die die meisten von uns spüren, die Kluft zwischen dem, der wir glauben zu sein und dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir haben hier mit dem Grundmuster unserer Konflikte zu tun: die Welt als entweder/oder und uns selbst in den Begrifflichkeiten von Haben oder Nicht- Haben zu erfahren. Anstatt die Frage zu beantworten, fordert uns das Koan heraus, radikal aus seinem (und unserem) Zwiespalt auszusteigen.
Als Analytiker ist mir klar, dass durch Therapie Probleme gelöst werden können, allerdings nicht ohne unerwünschte Nebenwirkung: Etwas mit uns ist grundsätzlich nicht in Ordnung, es gibt da ganz schwerwiegende psychologische Beschädigung ... diese Idee bleibt unangetastet. Und sie benötigt lebenslange Korrekturarbeiten. Dabei spielt es für die Konzeptualisierung keine Rolle, ob diese Beschädigungen als biologisch bedingt interpretiert werden oder die Gründe in frühkindlichen Traumata gesehen werden, die unveränderbar für immer in der Person, die wir „tief drinnen“ sind, eingraviert sind. Sogenannte Einblicke in die Natur unserer Krankheit oder die Rekonstruktion von Kindheits-Traumata sind zu häufig einfach nur Krücken, die den tief sitzenden Glauben an unsere Gebrechlichkeit bestätigen. Dabei könnten sie auch Stärke und Vertrauen in unsere eigene Widerstandsfähigkeit aufkommen lassen, mit der wir unserem Leben, so wie es ist, begegnen. Zen bietet uns da eine ausgleichende Einsicht an: nämlich unsere essenzielle Vollständigkeit, eine Ganzheit, zu der nichts hinzugefügt oder von der nichts weggenommen werden muss (was in Wirklichkeit auch gar nicht möglich ist). Wir sind wie Wasser, das nicht mehr nasser werden kann – nun, das braucht es ja auch nicht.
Was wird dann aus den „helfenden“ Berufen oder dem Anspruch, alle „Wesen vom Leid zu befreien“? Wir sind nur so umzingelt von Therapien, Diäten und Selbst-Optimierungsprogrammen, die alle versprechen, uns in Ordnung zu bringen. Stillschweigend – ohne dass wir das mitbekommen – verstärken sie unsere Annahme, dass wir beschädigt sind und Reparatur brauchen.
Wie wäre es, wenn wir diese Annahme ein für alle Mal infrage stellen? Und uns nicht weiterhin auf die Suche nach der neuesten Reparatur-Methode begeben?
Bei unserer Erkundung werden wir überprüfen, wie in den verschiedenen Traditionen diese Themen unterschiedlich behandelt werden, sei es psychologisch, philosophisch oder religiös, ob monastisch oder laizistisch, westlich oder östlich.
Ich hoffe, dass Sie gegen Ende des Buchs ein Verständnis davon haben werden, wie eine psychologisch-orientierte Zen-Praxis zu unserem alltäglichen Leben im Amerika des 21. Jahrhunderts beitragen kann.
2. Unsere geheime Praxis
2. Unsere geheime Praxis
Was ist Meditation?
Mit dem Wort Meditation werden verschiedenste Techniken, die aus ganz unterschiedlichen Kulturen und Traditionen stammen, beschrieben. So fordern manche Techniken uns auf, uns zu konzentrieren, unsere gesamte Aufmerksamkeit auf ein Objekt zu lenken – auf ein Wort, ein Mantra wie zum Beispiel Mu. Andere weisen uns an, unseren Atem zu zählen – von eins bis zehn, immer wieder von Neuem. Andere empfehlen uns, die Aufmerksamkeit weit offenzuhalten und ganz einfach zu beobachten, was Moment für Moment vor sich geht. Meine Lehrerin Joko Beck, die wiederum bei einem japanischen Zen-Meister in Amerika lernte, empfahl neuen Studenten zunächst mit der Praxis des Etikettierens ihrer Gedanken zu beginnen.
Wenn wir sitzen, kommen wir nicht drumherum, dass Gedanken auftauchen. Taucht einer auf, wiederholen wir diesen still für uns selbst. Wenn wir zum Beispiel mitbekommen, dass wir an etwas aus unserem Beruf denken, können wir innerlich sagen: „…Gedanke, dass der Bericht um 12.00 fertig sein muss.“ Wenn immer also ein Gedanke auftaucht, wiederholen wir diesen. Und dadurch, dass wir diesen Prozess immer wieder von Neuem anwenden, beginnen wir das Denken selbst als andauernden Prozess mit eigener Geschwindigkeit und eigenem Rhythmus zu erfahren. Sollten wir bestimmte, immer wieder kehrende Muster erkennen, benutzen wir vielleicht nur ein „Ein-Wort-Etikett“ wie Arbeit oder Planen, um damit alle Variationen unseres Grundmusters abzudecken. Nach und nach werden wir mit dieser Art zu praktizieren vertraut und wir versuchen nicht mehr, bestimmte Gedanken wegzubekommen oder vielleicht bestimmte wünschenswerte Zustände zu kultivieren. Wir nehmen einfach nur wahr, benennen (etikettieren) innerlich unsere Gedanken und erlauben ihnen, sich ganz von allein zu setzen – oder auch nicht.
Auch, wenn das Wort Meditation viele spirituelle Bedeutungen trägt, ist sitzen das was wir tun ist tun. Während wir sitzen, spüren wir unseren Atem. Und wir müssen uns nicht um unsere Gedanken kümmern – wir sitzen einfach da und spüren wie unser Körper atmet. Heutzutage wird der eigentliche Akt des Sitzens oft als selbstverständlich angesehen und die gesamte Betonung liegt auf dem, was in unserem Verstand, unserem Geist vor sich geht. Aber: Meditation ist eine körperliche Aktivität, nicht einfach eine geistige. Wir sitzen in einer bestimmten Position, traditionellerweise mit gekreuzten Beinen, so dass unsere Knie fest im Kontakt mit dem Boden sind und unser Rücken dabei gerade. Vielleicht können wir uns Meditation als eine Form von Yoga vorstellen, mit nur einer Position, in der wir ein Leben lang verbleiben. Das Aufrechterhalten der Position steht in einem engen und wichtigen Zusammenhang mit der Fähigkeit, mental fokussiert und konzentriert zu bleiben. Dieses Eingestimmt Sein auf unseren Körper ist unsere grundlegende Bewusstseins-Disziplin.
Jedoch brachte das Sitzen mit gekreuzten Beinen für westliche Zen-Studenten Probleme mit sich: Durchhalten und bewusst zu bleiben stellten sich als schwierig heraus. Tatsächlich schien es mir, dass ich im Zendo vor allem lernte, auch bei intensivem Schmerz absolut still zu sitzen. Das einzige Wort, an das ich mich noch von meinem japanischen Lehrer im ersten Sesshin erinnere, waren das hingeknurrte Wort „Durchhalten!“ während einer langen, schmerzvollen Sitzperiode.
Er hatte sicher viele interessante Dinge über alle möglichen Themen zu sagen, doch ich konnte nur noch auf eines achten: wie es mir gelingt von einem schmerzvollen Atemzug zum nächsten zu kommen, während meine Fussknöchel und Knie sich anfühlten, als ob darin brennend-heisse Nadeln stecken. Körperlich waren diese frühen Zazen Jahre sehr schmerzhaft. Ich habe mich entschieden, dieses Vermächtnis nicht an meine Studenten weiter zu geben.
Still – in der Mitte eines bestimmten Ausmasses an Schmerz oder Ruhelosigkeit – sitzen zu bleiben, kann durchaus eine wertvolle Disziplin sein. Doch unter quälenden Schmerzen etwas auszuhalten kann nicht wirklich Zen-Training sein. Studenten können auch aufrecht und still auf Stühlen sitzen, wenn das Sitzen mit gekreuzten Beinen unerträglich ist. Und sie müssen lernen, welches Ausmass an Schwierigkeiten sinnvoll für sie ist, was sie aushalten wollen und warum. Traditionelles Zen hat eine ziemliche Macho-Seite, die über die Jahre weicher geworden ist. Etwas, was wir einer neuen Generation von Zen-Lehrern verdanken, ganz speziell Lehrerinnen, denen es gelungen ist, eine neue Balance zwischen Disziplin und Sanftheit zu finden.
Wenn wir zum ersten Mal ein Zendo betreten und die Stille der dort Meditierenden betrachten, stellen wir uns wahrscheinlich vor, dass sie alle einen Zustand kompletter innerer Versenkung erreicht haben. Doch spätestens wenn wir uns selbst hinsetzen, realisieren wir äusserst schnell, dass dies nicht automatisch zusammengehört. Im Gegenteil, dadurch, dass unsere Körper still werden, entsteht Schritt für Schritt ein Gefäss, in dem unsere aufgeregten Gedanken und Gefühle zutage treten. Möglicherweise beruhigen sie sich oder sie brodeln weiter und drehen sich heftig – durchaus für eine ziemlich lange Zeit. Was auch immer innen drin los ist, wir sitzen ganz einfach und atmen.
Eigentlich ist es wirklich einfach – aber es ist für uns gar nicht so einfach, es einfach zu halten oder es einfach sein zu lassen. Es sind wir, die es kompliziert machen indem wir uns mit dem Inhalt unserer Gedanken beschäftigen, anstatt den Gedanken einfach zu erlauben, so wie Wolken am Himmel durch unser Bewusstsein zu ziehen.
Wir versuchen die Anleitungen für Meditation einfach zu halten. Jeder kann atmen: Jeder kann fühlen, wie sich die Brust durch den Atem füllt und durch die Nase ein – und ausfliesst. Das ist wie Treppensteigen. Wie wir diesen ersten Schritt tun müssen, das wissen wir alle. Einen Schritt nach dem anderen zu tun, ist deutlich schwieriger – speziell dann, wenn – wie in unserer Praxis – das Treppenhaus niemals aufhört und wir niemals sicher sein können, wohin es führt. Jedoch alles, was wir bei jeder Stufe tun müssen, ist genau diese zu nehmen – dieser Schritt, der nächste Atemzug.
In der Regel erkläre ich Anfängern, dass sie während der Meditation zur Wand gerichtet sitzen sollen, so als ob sie in einen Spiegel schauen. Und dass, während sie so sitzen, ihr Ich (mind) ganz von selbst auftauchen und sich zeigen wird. Wenn wir vor einem Spiegel sind, zeigt sich unser Gesicht auch von selbst. Das können wir nicht richtig oder falsch machen, der Spiegel macht den ganzen Job. Wenn wir also in Meditation sitzen, dann ist unser Ich (mind) direkt vor uns. Und alles, was wir tun müssen ist, bereitwillig hinzuschauen und zu erfahren, was da auftaucht.
Was könnte einfacher sein? Das ist die gute Nachricht: Man kann es nicht verpassen, es ist immer da, immer vor uns; Unser Gesicht wird von selbst sichtbar, wenn wir in den Spiegel schauen. Doch dafür sind wir damals eigentlich nicht zur Praxis gekommen: Das ist die schlechte Nachricht. Wir sind meistens überhaupt nicht glücklich mit den Versionen unseres Selbst, zu denen wir Moment für Moment aufwachen. Denn oft war es genau das, weswegen wir überhaupt zur Praxis gekommen sind.
Gerade durch etwas, was ich „Meta-Gedanken“ nenne, zeigt sich unser ganzes Unbehagen mit unseren Gedanken, so wie sie sind. Dieses sind unsere Gedanken über unsere Gedanken. Sie erscheinen in der Form von Urteilen oder Kommentaren über den ganzen Prozess. Dieses sind genau die „..wie mache ich mich?“ oder „..mache ich es richtig?“ - Gedanken. Beim Etikettieren unserer gewöhnlichen Gedanken wegen Mittagessen, Planung oder Tagträumen läuft es so, dass wir diese mitbekommen und sie dann loslassen. Die Meta-Gedanken benötigen eine leicht andersartige Aufmerksamkeit: sie verkörpern verschiedenste Varianten von Sehnsucht und Erwartungen, von unseren Meinungen darüber, wer wir sind, und warum wir praktizieren. Die Meta-Gedanken zeigen uns auf, in welcher Weise wir glauben, beschädigt zu sein und welches unsere Fantasien sind, wie wir wieder in Ordnung kommen und heil werden.
Diese Heil-Fantasien (curative fantasies) sind das Kernstück von dem, was ich „heimliche Praxis“ nenne. Uns dieser heimlichen Praxis bewusst zu werden, ist der einzige Weg, zu einer echten Praxis zu gelangen.
Warum meditieren wir (wirklich) ?