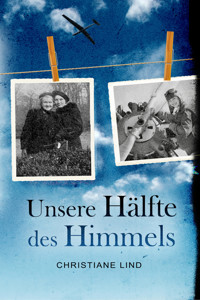5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Gärtnerin Laura flieht vor ihren Erinnerungen nach Madeira in das Haus am Leuchtturm, das ihrer Familie gehört. Wie ihre Vorfahrin, die Blumenmalerin, verfällt auch sie dem Zauber der Insel. Auf der Suche nach weiteren Bildern entdeckt Laura Briefe einer Mutter an ihre Tochter, die ihr Herz berühren. Ihre Nachforschungen führen Laura in die Zeit zwischen den Weltkriegen und auf die Spur eines Familiengeheimnisses. Cornwall 1928: Die schüchterne Amelia steht im Schatten ihrer schönen Schwester Bethany. Als sich beide in denselben Mann verlieben, trifft Amelia eine folgenschwere Entscheidung. Doch Bethany schreckt vor nichts zurück, um das zu bekommen, was sie will … Eine mehrere Generationen umfassende Familiengeschichte voller Intrigen, Geheimnisse, Leid, Hoffnungen, Sehnsüchte und Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Die Autorin
Die wichtigsten Figuren
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Fakten und Fiktion
Literaturhinweise
Danksagung
Impressum
Überarbeitete Neuveröffentlichung
Oktober 2024
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024
AIKA Consulting GmbHBerliner Straße 52
34292 Ahnatal
All rights reserved.
Erstveröffentlichung unter dem Titel „Das Haus auf der Blumeninsel“
© Droemer Knaur 2013
ISBN:
Umschlaggestaltung/eBook: Grit Bomhauer
Unter Verwendung von
© Depositphotos – 1xpert | lifeonwhite | Preto_perola
© Adobe Stock – Caitlin | JK_kyoto | Mubeen |
Tran | Infinite_PNG
Lektorat: Bettina Traub
Korrektorat: Regina Merkel
DIE AUTORIN
Christiane Lind hat sich immer schon Geschichten ausgedacht, die sie ihren Freundinnen erzählte. Erst zur Jahrtausendwende brachte sie ihre Ideen zu Papier und ist seitdem dem Schreibvirus verfallen. In ihren Romanen begibt sich Christiane am liebsten auf die Spur von Familien und deren Geheimnissen. Sie lebt in Ahnatal bei Kassel mit unzähligen und ungezählten Büchern, einem Ehemann, vier Katern und einer schüchternen Katze.
DIE WICHTIGSTEN FIGUREN
Vergangenheit
Lord Percy, Earl of Porthpyran, Herr von Tristyans Manor
Lady Norah, Countess of Porthpyran
Amelia Lanston, Tochter von Lord Percy und seiner ersten Ehefrau
Bethany Lanston, Tochter von Lord Percy und Lady Norah
Clifford Lanston, Bruder von Amelia und Bethany
Diane Lanston, Schwester von Amelia und Bethany, Nesthäkchen
Zachary Gavelston, Marquess of Henlys
Emma Gavelston, Erbin von Tristyans Manor
Charles Watson, Evakuierter aus London
Hawkins, Butler
Olive, Zimmermädchen
Gegenwart
Laura Marc, Gartengestalterin
Matthew Nelson, Fotograf
Grace Mainer, Eigentümerin von Tristyans Manor
Joshua Austen, Architekt und Experte für die Restaurierung maroder Herrenhäuser
Hannah, Lauras jüngere Schwester und Weltenbummlerin
Joana Mendes, Ladenbesitzerin auf Madeira
Middleford, Butler
Oliver Twist, ein graugestreiftes, struppiges Kätzchen
Ponta do Pargo, Madeira, Frühling 1929
Die blauen Stunden. Das sanfte Licht der Dämmerung, bevor der Tag begann. Amelia erhob sich mühsam aus dem Bett und tapste auf bloßen Füßen zum Fenster. Mit einem Lächeln begrüßte sie den Morgen. Nur wenig Grün breitete sich vor ihren Augen aus; überwiegend Gras und ein paar Kakteen, die typisch für die Insel waren, wuchsen auf dem Hochplateau. Sie betrachtete das tiefe Blau des Meeres und das sanftere Blau des Himmels, das vom Weiß einzelner zarter Wolken durchzogen war. Ihr Blick fiel auf den rot-weißen Leuchtturm, der über den steil abfallenden Klippen aufragte und sie an ihr Zuhause erinnerte. Amelia schauderte, was nicht der Morgenkühle geschuldet war, sondern dem Gedanken an ihre Familie. Ihre Mutter und ihre Schwester sollten gestern auf der Insel angekommen sein, wo sie sich standesgemäß eine Suite im Reid’s Palace genommen hatten. Einen Tag Aufschub hatte sie gehabt. Heute würde Amelia es nicht mehr vermeiden können, ihnen gegenüberzutreten.
Mit einem Seufzen wandte sie sich vom Fenster ab. Mit vorsichtigen Schritten schlurfte sie in die Küche, um sich einen Tee zuzubereiten. Ihre Schwester würde sicher spotten, dass Amelia nicht einmal eine Köchin oder eine Zofe in ihrem Exil auf Madeira Gesellschaft leisteten. Die Begegnung würde auf einen Streit hinauslaufen. Einen Wortwechsel, wie sie ihn seit den Tagen ihrer Kindheit führten. Immer hatte die Jüngere haben wollen, was der Älteren lieb und teuer war. Jedes Mal hatte sie gewonnen. Nur dieses Mal würde Amelia nicht nachgeben, würde sich nicht dem Diktat von Familie und Konventionen beugen.
Mehr als die Bosheit ihrer Schwester fürchtete sie die Kühle ihrer Mutter. Niemals würde diese so weit die Contenance verlieren, dass sie im Streit laut würde. Niemals von den Regeln des Anstands abweichen, die so stark in ihr verankert waren. Auf dem Gesicht von Lady Norah würde Amelia jedoch ablesen können, welche Enttäuschung sie, die älteste Tochter, für sie war. Niemals hatte Amelia ihr etwas recht machen können, und schon als Kind hatte sie sich gefragt, warum ihre Mutter sie ablehnte. Möglicherweise, weil Lady Norah nicht ihre richtige Mutter war.
Amelia schüttelte den Kopf, um die dunklen Gedanken zu vertreiben. Es täte ihrem Kind nicht gut, wenn ihre Stimmung bereits in der blauen Stunde so düster war. Mit einer dampfenden Tasse Tee in der Hand setzte sie sich an den Sekretär und öffnete die Schublade. Voller Bewunderung strich sie über die Intarsien, mit denen ein wahrer Meister der Tischlerkunst das Schreibmöbel verziert hatte. Neben den Stunden, die sie mit Malen und Zeichnen verbrachte, war ihr die morgendliche Zeit am Sekretär die liebste. Die Zeit, in der sie Briefe an ihr Kind schrieb. Jeden Tag einen. Dreißig waren es inzwischen, die in der Schublade darauf warteten, dass ihr Kind geboren wurde und dass sie ihm die Briefe eines Tages vorlesen konnte.
Jeden Morgen folgte Amelia diesem Ritual. Sie nahm einen Bogen blassblaues Papier aus der Kassette und strich ihn glatt. Vorsichtig schraubte sie die Kappe vom Füllfederhalter, säuberte die Feder mit einem spitzenumsäumten Taschentuch und nahm einen tiefen Atemzug, bevor sie die silberne Spitze aufs Papier setzte.
Mein liebes Kind,
begann sie und hielt inne. Heute Nacht hatte sie von ihm geträumt und war sich nun sicher. Ein Lächeln glitt über ihr Gesicht und ihre rechte Hand, die, die den Füllfederhalter nicht hielt, legte sich auf ihren gerundeten Bauch. Sie strich die drei Worte aus und schrieb weiter.
Meine liebe Tochter,
Erneut hielt sie inne. Nein, sie würde einen Brief an ihr Kind nicht damit beginnen, dass sie die Anrede ausstrich. Schließlich sollte ihre Tochter die Briefe später auch einmal selbst lesen. Mit einem Seufzer nahm Amelia das Blatt und zerriss es. Sie hievte sich vom Stuhl und ging zum Fenster, lehnte sich hinaus, öffnete die Hand und beobachtete, wie der Morgenwind das Papier davontrug. Vielleicht bis zum Meer, das die Klippen umtoste. An windigen Tagen meinte Amelia, die Brandung zu hören. Ihr Blick folgte den Schnipseln, die wie zarte Blüten über das karge Gras des Hochlands flatterten. Dann ermahnte sie sich zur Eile. Ihr blieb nicht viel Zeit, den Brief zu beenden.
Meine liebe Tochter,
ich weiß, dass Du ein Mädchen wirst, weil ich mir so sehr ein Mädchen wünsche. Ich habe bereits einen Namen für Dich. Seit dem Tag, an dem ich erfuhr, dass ich schwanger bin, habe ich den Namen gehegt und gepflegt und mit mir getragen. Tante Mabel und meine wenigen Freunde auf der Insel haben auf mich eingeredet, dass ich auch einen Namen für einen Jungen aussuchen sollte.
Nein, nein, ich will Dir die Wahrheit sagen, auch wenn sie schmerzt. Selbst meine Freunde haben auf mich eingeredet, dass ich Dich unbenannt lassen, dass ich Dich vergessen soll.
»Wenn Du dem Kind einen Namen gibst, wirst Du es nicht weggeben wollen«, haben sie gesagt.
Selbst wenn Du namenlos bliebest, würde ich um Dich kämpfen. Das wusste ich vom ersten Augenblick an. Dich und mich kann nichts trennen. Meine Familie wird versuchen, Dich mir wegzunehmen. In ihren Augen bist Du ein Missgeschick, schlimmer noch: ein Ärgernis, das sie vergessen möchten, wenn sie es schon nicht ungeschehen machen können.
Doch glaub ihnen nicht, meine geliebte Kleine. Für mich bist Du der Sonnenschein, der meine tägliche Düsternis erhellt. Mir ist es egal, was sie sagen; egal, ob es sich nicht gehört; egal, dass ich nie einen angemessenen Ehemann finden werde. Für Dich nehme ich alles in Kauf. Eine Zukunft mit Dir kann nur golden werden, auch wenn ich hier allein mit Dir leben werde.
Es bedrückt mich nicht, dass ich nie mehr zur guten Gesellschaft gehören kann. Zu jenen, die nur dem Schein nachjagen und alle Gefühle hinter Konventionen versperren. Auf sie kann ich verzichten, wenn ich Dich nur bei mir habe. Gemeinsam mit Dir werde ich nie einsam sein. Ich zähle die Tage, bis ich Dich endlich in die Arme schließen kann.
Ich freue mich schon darauf, gemeinsam mit Dir die Sonnenuntergänge am Leuchtturm zu erleben. Zu beobachten, wie sich die Felsen in unglaublichen Rottönen färben, die mein Pinsel niemals einfangen kann, obwohl ich es jeden Tag aufs Neue versuche. Den verschiedenen Jahreszeiten beizuwohnen, die auf diesem Juwel im Meer überirdisch schön erscheinen.
Fast über Nacht hat eine Blütenpracht eingesetzt, die der gepflegte Garten meiner Familie niemals erreichen wird. Ich liebe das Blau der Jacarandabäume, das beinahe lilafarben leuchtet. Seit Tagen male ich und male und male alle Pflanzen, die mir João, ein Junge aus dem Dorf, jeden Morgen vorbeibringt. Ich bedauere jede Minute, die ich für Essen und Schlafen vergeuden muss.
Ich könnte stundenlang von den Blumen schwärmen, die ich auf meinen langen Spaziergängen entdeckt habe. Obwohl ich mich wuchtig fühle und mir das Laufen von Tag zu Tag schwerer fällt, zieht mich die Schönheit der Inselwelt hinaus. Die Dorfbewohner haben sich an meinen Anblick gewöhnt und schütteln längst nicht mehr den Kopf, wenn ich an ihnen vorbeistapfe. Den Bauch vorgestreckt, die Staffelei auf dem Rücken. Inzwischen nennen sie mich die Blumenmalerin. Erst gestern hat mich João, der wohl ein wenig verliebt in mich ist, zu einer versteckten Stelle in den Felsen geführt. Vor Dankbarkeit habe ich ihn umarmt. Diese Farbenpracht, die mir entgegenfunkelte, ließ mich alles vergessen. Ich werde Dir das Bild zeigen, in Erinnerung an einen der glücklichsten Tage hier auf der Insel. Graue Felswände, vor denen Ginster in einem leuchtenden Gelb erstrahlte – fast zu früh für die Jahreszeit. Und als ob ein begnadeter Künstler seinen Farbtopf ausgeschüttet hätte, erblühte mittendrin der Natternkopf, der erste Vorbote des Frühlings. Was für ein bedrohlicher Name für die fragilen violetten Blüten. Ich nenne ihn lieber den Stolz Madeiras, so tauften ihn die Menschen hier.
Meine geliebte Tochter, ich hoffe, dass Du meine Liebe zu den Blumen und der Malerei erben wirst. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit Dir die Insel zu erkunden. Hier will ich bleiben und leben. Tristyans Manor soll für mich nur eine Erinnerung an eine dunkle Zeit sein. Eine Zeit, die wir beide hinter uns lassen. Obwohl ich meinen Vater vermissen werde.
Vor meinem Fenster wächst eine Strelitzie, die Blume, die unserem Gärtner auf Tristyans Manor so viel Unbehagen bereitete, weil das Klima in Cornwall nicht das richtige für sie war. Ihren Beinamen Paradiesvogelblume hat sie wahrlich verdient. Denn genauso sieht sie aus: Als hätte ein ungewöhnlicher Vogel mit schimmerndem blauem und orangefarbenem Gefieder sich für eine kurze Rast auf dem schlichten Grün niedergelassen.
Meine Tochter, Du merkst, ich schweife ab. Lieber schreibe ich Dir von Blumen und Bäumen als von meiner Familie, die ich heute erwarte. Wie freundlich von ihnen, wirst Du denken, dass sie mir in der schweren Stunde der Geburt beistehen wollen. Aber Du irrst. Sie wollen mir nicht helfen. Sie wollen, dass ich mich ihren Wünschen beuge, und hoffen, dass ich zu erschöpft sein werde, mich gegen sie zu wehren.
Ein Klopfen an der Tür schreckte Amelia auf. War es bereits so spät? Hastig legte sie den Füllfederhalter zur Seite und rief: »Ich bin gleich da.« Sie pustete auf das Papier, bevor sie es eilig in einer verborgenen Schublade des Sekretärs versteckte. Das Lächeln wich einer besorgten Miene, und sie knetete die Unterlippe mit den Zähnen. Ein letzter Blick suchte nach verräterischen Spuren im Zimmer, bevor sie sich zur Tür wandte.
Sie war sich ihrer Entscheidung sicher. Ihre Mutter und ihre Schwester konnten sagen, was sie wollten. Amelia würde ihre Tochter niemals aufgeben. Sie würde für ihr Kind kämpfen, kostete es, was es wollte.
Tristyans Manor, Cornwall 1956
»Du musst artig sein. Bitte, Schatz, versprich es mir.« Ihre Mutter kniete sich vor Grace auf den dunklen Boden, so dass sie einander in die Augen sehen konnten. Grün-grau wie das Meer leuchteten sie normalerweise, aber heute wirkten die Augen ihrer Mutter verhangen wie der Himmel an einem Herbsttag. »Es ist wirklich wichtig für mich, Schatz.«
Grace trommelte mit den Füßen gegen den Sitz und streckte die Hand aus. Sanft berührte sie die dunklen Locken ihrer Mutter, die Emma hochgesteckt trug. Doch die Fülle der Haare widersetzte sich allen Bestrebungen nach Ordnung und hatte sich bereits wieder gelöst. Grace liebte ihre Mutter und beugte sich nach vorn, um sie auf die Wange zu küssen.
»Ja, Mama. Ich werde brav sein. Versprochen.« Ein wenig wunderte es Grace, dass ihre Mutter seit kurzem so viel Wert auf Etikette legte und ihr ein elegantes neues Kleid gekauft hatte. Eines, das kratzte und sie einschnürte. Eines, in dem sie sich kaum bewegen konnte. Auch die schwarzen Lackschuhe mit den silbernen Schnallen fühlten sich zu eng an, und Grace hätte sie am liebsten von den Füßen geschleudert. Aber ihre Mutter hatte ihr erklärt, dass sich das für eine Lady nicht gehörte und dass sie nun mal eine Lady sei. Lady Grace. Wie schön und vornehm das klang. Dafür ertrug Grace gern das ungewohnte Kleid und die drückenden Schuhe. »Sind wir bald da?«
»Schau, Liebes, das Meer. Wie zu Hause.« Grace horchte auf, weil die Stimme ihrer Mutter seltsam klang, beinahe ängstlich. »Es ist nicht mehr weit. Tristyans Manor, es … es wird dir gefallen.«
Grace rutschte auf dem unbequemen Sitz hin und her. Sie mochte nicht mehr aus dem Fenster schauen. Inzwischen fand sie die Zugfahrt langweilig. Gemeinsam mit ihrer Mutter hatte sie Sandwiches gegessen und Tee getrunken. Sie hatten gesungen, und Emma hatte ihr vorgelesen, aber die Reise schien einfach kein Ende finden zu wollen. Grace wollte endlich ankommen. Sie war schrecklich neugierig auf das sagenumwobene Tristyans Manor, von dem sie so viel gehört hatte.
Andere Mütter lasen ihren Kindern vor dem Einschlafen Märchen vor. Emma schwärmte mit leuchtenden Augen von Gewächshäusern mit exotischen Pflanzen und farbenprächtigen Orchideen. Sie malte Aquarelle für Grace, auf denen ein wunderschönes Herrenhaus inmitten einer riesigen Parkanlage thronte, und im Hintergrund waren das Meer und Klippen angedeutet.
Doch jedes Mal, wenn Grace gefragt hatte, warum sie in dem kleinen Haus auf der Blumeninsel wohnten und nicht in Tristyans Manor, war Emma verstummt, hatte Grace einen Kuss gegeben und von etwas anderem erzählt.
Für eine längere Zeit hatte Emma dann Tristyans Manor in ihren Gute-Nacht-Geschichten nicht mehr erwähnt, bis Grace mit ihren Wachskreiden ein Bild des Gartens gemalt und ihre Mutter gefragt hatte, ob dort auch die blaublühenden Jacarandasträucher wuchsen, wie hier auf Madeira.
»Jacaranda und Orchideen und Orangen. Alles, was du dir vorstellen kannst, findest du in den Gewächshäusern von Tristyans Manor.« Der Blick ihrer Mutter war weit in die Ferne geschweift, als ob sie in der Zeit zurückreiste. »Leider gibt es in jedem Paradies einen Drachen, vor dem man sich in Acht nehmen muss.«
Ganz leise hatte Emma von dem Drachen gesprochen, damit er sie nicht hören könnte. Gemeinsam hatten sie an jenem Abend eine Höhle aus Decken gebaut, in der sie sich verstecken konnten. Grace hatte sich vorsichtig in die Küche geschlichen, um Proviant zu besorgen. Emma war im Zimmer zurückgeblieben, um den Drachen zu bekämpfen. So wie jede Mutter, die ihr Kind verteidigen würde, hatte sie Grace erklärt.
»Dich und mich, mein Schatz, kann nichts trennen.« Emma hatte Grace auf die Stirn geküsst, als sie mit Sandwiches beladen zurückkam. »Wir sind wie zwei Schwäne, die ein Leben lang zusammenbleiben.«
»Können wir den Drachen nicht besiegen?«, hatte Grace gefragt. »Wir beide zusammen?«
»Ach, meine Kleine.« Emmas Gesicht hatte sich für einen Augenblick verdüstert, so dass Grace wünschte, sie hätte die Frage nicht gestellt. »Manchmal ist es klüger, einen Kampf zu meiden. Wenn du größer bist, vielleicht.«
So blieb Tristyans Manor für Grace ein verwunschener Ort, den sie eines Tages unbedingt kennenlernen wollte. Sie stellte sich von diesem Abend an jeden Tag in den Türrahmen, damit Emma anzeichnen konnte, wie viel sie gewachsen war.
»Bin ich schon groß genug, um gegen den Drachen zu kämpfen?«
»Nein.« Ihre Mutter hatte lächelnd den Kopf geschüttelt, einen Pinsel in die rote Farbe getaucht und mit sicherer Hand einen Strich gezogen. »Wenn du die Markierung erreichst, überlegen wir, ob wir uns dem Ungeheuer stellen wollen.«
»Aber dann bin ich ja fast so groß wie du«, meinte Grace enttäuscht. Selbst wenn sie jeden Tag Spinat essen würde, würde es noch eine Ewigkeit dauern, bis sie den roten Strich erreichte.
So lange konnte und wollte Grace nicht warten. So gefährlich konnte der Drache nicht sein. Schließlich war ihre Mutter ihm auch entkommen, und zu zweit konnten sie jedes Ungeheuer besiegen. Daher bettelte Grace immer wieder darum, endlich einmal das Zuhause ihrer Mutter kennenlernen zu dürfen. Doch Emma hatte stets fadenscheinige Ausreden gefunden, warum sie bei all ihren Reisen niemals den Weg nach Cornwall einschlugen.
»Liebes, dafür bist du noch zu klein.« Emma deutete auf den roten Strich am Türrahmen, lächelte und sagte nichts weiter. Doch je mehr ihre Mutter schwieg, desto größer wurde Graces Neugier, und in ihrer Phantasie malte sie sich Tristyans Manor als das Paradies auf Erden aus. Ein Paradies, das sie wohl erst zu sehen bekommen würde, wenn sie erwachsen wäre. In unendlicher Ferne also.
Weil sie ein glückliches Kind war, das sich für vieles begeistern konnte, drängelte Grace nicht weiter, sondern stellte sich jeden Tag schweigend in den Türrahmen, um ihre Fortschritte zu messen. Langsam begann sie Tristyans Manor als etwas zu betrachten, das sie aus einem Märchen kannte. Ein verzaubertes Schloss, um das sich Mythen und Legenden rankten. Eine Einladung auf weißem Büttenpapier mit goldenen Lettern – so kannte sie es aus ihren Märchenbüchern - würde sie jedoch niemals erhalten, weil der Drache ihre Mutter für immer vertrieben hatte.
Daher hatte es sie vollkommen überrascht, als ihre Mutter vor zehn Tagen einen Brief aus Tristyans Manor erhielt. Schließlich war Grace erst neun Jahre alt und noch weit von dem roten Strich am Türrahmen entfernt. Während Grace ihre Mutter beobachtete, öffnete Emma den Brief, der auf feinem weißem Papier geschrieben war, und wurde blass. Sie zog Grace auf ihren Schoss, verbarg das Gesicht in ihren Haaren und murmelte: »Oh Herr, lass mich das Richtige tun.«
Die Tage seit dem Eintreffen des Schreibens vergingen wie im Flug. Emma zerrte Grace zu einer Schneiderin, die ihr in stundenlangen Sitzungen vier Kleider anpasste. Drei helle mit Spitze und ein blaues mit einem weißen Matrosenkragen. Doch damit nicht genug. Grace musste einen Friseurbesuch erdulden, dem ihre blonden Locken zum Opfer fielen und in eine brave Welle gezwungen wurden. Um ihre Mutter nicht zu kränken, hielt Grace ihre Tränen zurück, als sie die Haare auf den Boden des Friseursalons fallen sah.
»Eine Schande«, flüsterte die Friseurin, eine stämmige Frau mit strohblonden Haaren ihrer Kollegin zu, bevor sie die Schere ansetzte. »So eine Pracht zu stutzen.«
Die freundlich gemeinten Worte hatten Grace bis ins Mark getroffen, und sie hatte sich das erste Mal gefragt, was für ein Mensch ihre Großmutter wohl war, dass man ihr die Locken opfern musste. Bangen Herzens hatte sie sich gewundert, ob ihre Mutter und sie noch mehr Opfer bringen mussten, bis der Drache von Tristyans Manor zufrieden gestellt wäre.
»Wir sind da.« Emma sprang von ihrem Sitz auf und zerrte die beiden Koffer aus der Ablage. Sie drückte Grace ihre Handtasche in den Arm und versuchte, ermutigend zu lächeln. »Komm, beeil dich.«
Vor lauter Aufregung ließ Grace die Handtasche fallen und blieb mit ihrem Lackschuh am Türrahmen hängen. Ein tiefer Kratzer zog sich über das glänzende Schwarz. Grace schaute an sich herunter, und Tränen traten ihr in die Augen. Das Kleid war zerknittert, der Schuh zerstört. Was würde sie für einen Eindruck auf ihre Großmutter machen, die anscheinend sehr viel Wert auf Anstand und Sitte legte? Grace stellte sie sich immer ein wenig wie Frau Holle vor. Eine würdevolle, aber strenge alte Dame mit weißen Haaren und vielen Falten. Würde ihre Großmutter den Drachen loslassen, damit er die unordentliche Grace und ihre Mutter aus dem Paradies verjagte?
»Komm, Schatz. Trödel nicht.« Ihre Mutter, in jeder Hand einen Koffer, blickte über die Schulter. Emma, die in dem eleganten grauen Kostüm und den farblich passenden Handschuhen fremd und unnahbar wirkte, bemühte sich um ein Lächeln. »Mit dem Schuh, das ist nicht so schlimm.«
Grace drängte die Tränen zurück und folgte ihrer Mutter hinaus auf den kleinen Bahnhof. Wie anders er wirkte als die Victoria Station, wo sie umgestiegen waren. Die vielen Menschen auf dem großen Londoner Bahnhof hatten ihr eine solche Angst eingejagt, dass sie das Handgelenk ihrer Mutter mit beiden Händen festgehalten hatte, um nur ja nicht von der Menschenmenge fortgetragen zu werden und verloren zu gehen.
Der Bahnhof von Perranporth hingegen sah freundlich aus mit seinem weißen Zaun und den kleinen Blumenrabatten, die mit flachen weißen Steinen umsäumt waren.
»Schau, da ist Michaels.« Ihre Mutter winkte einem älteren Herrn zu, der neben einem großen schwarzen Auto stand. Grace verspürte eine leichte Enttäuschung. Sie hatte auf eine Kutsche wie im Märchen gehofft. Gezogen von sechs edlen Schimmeln, die ihre Mutter und sie zu dem verwunschenen Schloss brächten. Ob Tristyans Manor auch von Dornengestrüpp verborgen wurde wie Dornröschens Schloss? Sie musterte den Mann, den ihre Mutter Michaels genannt hatte. Er trug eine Uniform und erschien Grace sehr aufrecht und förmlich.
»Lady Emma, schön, Sie wieder zu Hause zu haben.« Michaels nickte ihrer Mutter zu, ehe er die beiden Koffer nahm. In seinen großen Händen wirkten sie wie Puppenspielzeug. Grace schluckte, als er sich zu ihr hinabbeugte. »Und du bist bestimmt die kleine Lady Grace, nicht wahr?«
»Guten Tag. Ich freue mich, Sie kennenzulernen.« Grace versuchte einen Knicks, der ihr allerdings vor Aufregung misslang, was Michaels ein Lächeln entlockte. »Aber ich bin keine Lady, ich bin Gracie.«
»Lady Galveston erwartet Sie bereits.« Obwohl Michaels freundlich klang, bemerkte Grace wie ihre Mutter erbleichte. »Ihre Ladyschaft hat Ihr altes Zimmer für Sie herrichten lassen, Lady Emma.«
»Danke«, flüsterte Emma und kletterte in den schwarzen Wagen.
»Danke«, wisperte auch Grace und folgte ihrer Mutter. »Wie weit ist es noch?«
»Oh, in knapp zehn Minuten dürften wir da sein, kleine Lady.« Michaels zwinkerte ihr zu und schloss die Wagentür.
Grace rutschte aufgeregt auf dem Sitz hin und her, bis ihre Mutter ihr sanft die Hand auf den Unterarm legte. Von da an saß Grace still da und drehte nur noch den Kopf von einer Seite zur anderen, damit ihr auch ja nichts entging. Sie fuhren eine schmale Straße entlang, die von Hecken gesäumt und von Bäumen so weit überdacht war, dass nur wenig Licht in den Wagen fiel. Grace konnte es kaum erwarten, endlich Tristyans Manor zu sehen. Als sie am Ende des Hohlwegs angelangt waren, hielt Michaels an.
»Tristyans Manor, Lady Grace.« Er deutete mit der linken Hand nach vorn. »Es hat sich nicht sehr verändert, seitdem Sie weg sind, Lady Emma.«
Grace traute ihren Augen kaum. Sicher, ihre Mutter hatte von Tristyans Manor wunderschöne Bilder gemalt und spannende Geschichten erzählt, aber niemals hatte es sich Grace so überwältigend vorgestellt. Vor ihnen erstreckte sich eine weitläufige, äußerst gepflegte Rasenfläche. Dahinter erhob sich ein riesengroßes graues Haus, ein zinnenbewehrtes Gebäude mit Türmen und Mauern, die von Efeu überwachsen schienen. Tristyans Manor sah noch mehr nach verwunschenem Schloss aus, als es sich Grace erträumt hatte.
»Wo … wo sind der Garten und die Gewächshäuser?«, fragte sie mit piepsender Stimme. Sie hatte sich so sehr auf die Orchideen und Orangenbäume gefreut.
»Hinter dem Haus.« Michaels lachte dröhnend. »Die junge Lady hat bisher noch kein Herrenhaus gesehen, nicht wahr?«
Emma schwieg und starrte geradeaus. Ihre Fingerspitzen hatte sie aneinandergelegt und hob sie jetzt an die Stirn wie zum Gebet. Grace beugte sich zu ihrer Mutter und strich ihr über den Arm. Emma lächelte sie an. Ein Lächeln, das die Augen nicht erreichte.
»Ich hatte gehofft, ich würde sie nie wiedersehen«, raunte Emma so leise, dass Grace sie kaum verstehen konnte, und küsste sie auf den Haaransatz. »Und jetzt muss ich sie um Hilfe bitten.«
Emma sagte kein Wort mehr, bis Michaels den Wagen vor dem Herrenhaus zum Stehen brachte. Grace griff nach der Hand ihrer Mutter und drückte sie. Auf den Stufen einer breiten Steintreppe standen Menschen in einer Reihe nebeneinander. An der Spitze wartete ein älterer Herr mit schwarzem Anzug, weißem Hemd und ernstem Blick neben einer Dame mit einem dunklen Kleid; an dritter Stelle stand ein jüngerer Mann, der Grace zuzwinkerte, als sie aus dem Auto stieg; dann waren da noch drei Mädchen, die grau-grüne Kleider mit weißen Schürzen und weiße Hauben trugen und zu Boden blickten.
»Sind das Großvater und Großmutter?«, flüsterte Grace, die sich hinter ihrer Mutter versteckte und sie am Ärmel zupfte. Die streng aussehenden Herrschaften schauten stur geradeaus und würdigten Grace keines Blickes.
»Nein, Schatz, das sind Hawkins, der Butler, und Dickens, die Hausdame. Daneben stehen der Diener und die Dienstmädchen. Wo wohl die Köchin ist?« Ihre Mutter beugte sich zu ihr herab und seufzte. »Lass uns deine Großmutter begrüßen.«
Während Grace sich fragte, wo sich ihre Großmutter wohl versteckt hielt und warum sie nicht mit den anderen auf sie wartete, zog ihre Mutter sie hinter sich her die Treppenstufen hinauf, vorbei an der gesamten Dienerschaft, die Emma mit einem Nicken begrüßte. Grace tat es ihr nach und lächelte alle an.
Vor der hohen Tür, die zur Hälfte aus Glasfenstern bestand, blieb ihre Mutter stehen und holte tief Luft. Sie reckte den Kopf vor.
»Grace, Schatz, bitte benimm dich.« Emma strich ihr über den Kopf und wartete. Hawkins ging an ihnen vorbei und öffnete die Tür. »Lass dir von deiner Großmutter keine Angst machen.«
Bevor Grace fragen konnte, warum sie sich vor ihrer Großmutter fürchten sollte, blieb ihr vor Staunen der Mund offen stehen. Was für eine Pracht! Allein die Eingangshalle des Herrenhauses erschien ihr so groß wie ihr gesamtes Häuschen auf Madeira. Ehrfürchtig blickte sich Grace um. Die schwarz-weißen Muster des Fußbodens glänzten wie blankpoliert. Vor ihnen erhob sich eine weiße Steintreppe, breiter als der Wagen, in dem sie gekommen waren. Doch was sie am meisten beeindruckte, war der Ausblick, der sich ihr bot. Lebensgroße Statuen, wie sie sie bisher nur in Museen gesehen hatte, hielten Wache neben der geöffneten Tür, die einen Blick in das nächste Zimmer und darüber hinaus ermöglichte. Dort war er, der Park, von dem ihre Mutter ihr so viel erzählt hatte. Hinter einem schimmernden Kiesweg sah Grace eine Rasenfläche, an die sich der Garten anschloss. Allerdings konnte sie nur die Hecken erkennen, die den Park umschlossen und vor neugierigen Blicken verbargen. Ein gewaltiger Brunnen mit einer hochaufragenden Frauenfigur versperrte ihr die Sicht. Sie zog an der Hand ihrer Mutter, um sich loszureißen und hinauszulaufen, doch Emma hielt Graces Finger festumklammert.
»Grace. Schatz. Das ist deine Großmutter. Lady Bethany Galveston, Marchioness of Henlys.«
Tristyans Manor, Cornwall 1956
Grace blinzelte in einer Mischung aus Erstaunen und Bewunderung. Vor ihr stand die schönste Frau, die sie je gesehen hatte. Schöner selbst als ihre Mutter. Die goldfarbenen Haare trug sie zu einer perfekten Welle aufgesteckt. Die Augenfarbe erinnerte Grace an Jacarandabäume, wenn sie in voller Blüte standen. Das Kleid hatte annähernd die gleiche Farbe und umschmeichelte den schlanken Körper.
Grace fiel es schwer, von der schönen Frau als ihrer Großmutter zu denken. Lady Bethany sah überhaupt nicht aus wie irgendjemandes Großmutter. Sie hatte so gar nichts an sich, was an eine Oma erinnerte, an die man sich ankuscheln konnte, die einem vorlas, nachdem sie eine Tasse heiße Schokolade gekocht hatte. Lady Bethany wirkte wie eine Königin. Grace schlug die Augen nieder. Nicht wie eine der guten Königinnen, sondern wie die Stiefmutter, die Schneewittchen den vergifteten Apfel gereicht hatte.
»Gracie. Bitte. Begrüße deine Großmutter.« Etwas in der Stimme ihrer Mutter verunsicherte Grace, und sie sah hoch und musterte Emmas Gesicht. Ihre Mutter war kreidebleich und starrte Lady Bethany an. So wie eine Maus die Katze beobachten würde. »Mutter, das … das ist … «
»Ich weiß, wer das ist«, unterbrach sie Lady Bethany. Ihr Gesicht wirkte wie eine Maske. Starr und unnahbar. Sie erinnerte Grace an Marmorstatuen, die ihre Mutter ihr so gern in Museen gezeigt hatte. Ausnehmend schön, aber ohne Leben und Wärme. Die kalte Frau beugte sich zu Grace hinab. »Hat die Katze deine Zunge gefressen?«
Grace musste einen Augenblick überlegen, bevor sie die Frage beantworten konnte. Schließlich wollte sie ihre Großmutter nicht verärgern.
»Guten Tag, Ihre Ladyschaft. Wir haben keine Katze«, sagte sie schließlich und knickste. Nicht elegant, aber gelungener als bei den ersten Versuchen. »Obwohl ich mir immer eine gewünscht habe.«
»Ist das Kind etwas zurückgeblieben?« Lady Bethany richtete sich auf und sprach über Grace hinweg mit Emma. So, als ob Graces Antwort nicht von Bedeutung gewesen wäre. Warum aber hatte sie überhaupt die Frage gestellt? »Hast du es mir deshalb noch nicht präsentiert? Wo ist dein wunderbarer Ehemann?«
»Mutter, bitte.« Emma klang gleichzeitig zornig und traurig. Sie drückte Graces Hand so fest, dass diese einen kleinen Schrei ausstieß. »Wenn du die Sache nicht ruhen lassen kannst, gehen wir wieder.«
»Wohin denn?« Lady Bethany lachte. So, wie die dreizehnte Fee im Märchen lachen würde. Siegessicher und voller Niedertracht. Grace hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten, aber sie hatte ihrer Mutter versprochen, sich anständig zu benehmen. »Bettler können nicht wählerisch sein, mein Kind.«
Emma seufzte und sagte kein weiteres Wort mehr. Das Schweigen legte sich über sie wie eine schwere Wolke an einem Regentag. Irgendetwas sagte Grace, dass sie in Tristyans Manor keinen Sonnenstrahl finden würde, der die Wolke zerriss und den Regen vertrieb.
»Hawkins, bringen Sie meine Tochter und meine Enkelin zu ihren Zimmern.« Lady Bethany wandte sich ab. Bevor sie die Tür erreichte, blieb ihre Großmutter stehen und drehte sich zu ihnen um. »Dinner im roten Speisezimmer. Um sechs Uhr. Ich erwarte Pünktlichkeit, wie du weißt.«
Wieder drückte Emma Graces Hand so fest, dass es schmerzte. Grace sah zu ihrer Mutter auf. Emma hatte die Augen geschlossen und knirschte mit den Zähnen. So hatte Grace ihre Mutter noch nie erlebt und sie drückte sich voller Furcht an ihren Körper. Mit einer schnellen Bewegung strich Emma ihr durch die Haare und flüsterte: »Alles wird gut, Schatz.«
»Lady Emma?« Hawkins sprach gelassen, als ob er nicht bemerkte, in welchem Aufruhr sich ihre Mutter befand. Grace beobachtete den Mann voller Verwunderung. Später, wenn sie endlich allein waren, musste sie ihre Mutter fragen, was eigentlich ein Butler war. »Wenn Sie mir bitte folgen wollen.«
»Danke, Hawkins.« Ihre Mutter öffnete die Augen und versuchte ein Lächeln. Sie ließ Graces Hand los und strich sich mit beiden Händen durch die Haare. »Komm, Liebes. Schauen wir uns unser neues Zuhause an.«
Der Butler führte sie schweigend durch die Halle bis in einen engen Gang aus kalten grauen Steinen mit einer Rundbogendecke. Dunkelbraune Regale voller Bücher raubten dem schmalen Flur viel Platz und erinnerten Grace an unerwünschte Gäste, die jemand hierhin geschoben hatte. Nur wenig Licht fiel durch die schmalen Fenster und ließ den Teppich, der mit Phantasieblumen in braun und rosa übersät war, blutrot aussehen. Jagdszenen hingen verteilt an den Wänden, ab und zu unterbrochen von ausgestopften Tieren. Grace erkannte einen Fasan, einen Marder und einen Fuchs, die sie aus Glasaugen beinahe anklagend anstarrten. Ihr lief ein kalter Schauder über den Rücken, und sie beeilte sich, damit sie Hawkins und ihre Mutter nicht aus den Augen verlor. Der Gedanke, allein durch diese gruseligen Gänge zu irren, versetzte Grace in helle Aufregung.
Endlich hielt der Butler vor einer dunkeln Eichentür, höher als zwei Männer, und öffnete sie mit beiden Händen. Grace schwankte zwischen Furcht und Neugier und presste sich eng an ihre Mutter. Die Tür führte in ein dunkles Zimmer. Grace spähte in die Finsternis.
»Einen Augenblick bitte, Lady Emma. Lady Grace.« Mit sicheren Schritten ging der Butler hinein und zog die Vorhänge zurück, so dass Sonnenlicht ins Zimmer hereinfallen konnte. »Wenn Sie mir bitte folgen.«
Grace bemühte sich, einen Überraschungsschrei zu unterdrücken. Sie musste den Kopf in den Nacken legen, um die schwindelerregend hohen Decken sehen zu können. Die Holzdielen des Fußbodens knarzten unter Hawkins‘ festen Schritten. Die hochhackigen Schuhe ihrer Mutter gaben klackernde Geräusche von sich, bis Emma auf einen der Orientteppiche trat, die im Zimmer ausgebreitet lagen. Doch etwas anderes zog Graces Aufmerksamkeit auf sich. Verteilt im Raum standen Sessel, nur erkennbar an ihren Konturen, da sie unter weißen Tüchern verborgen waren. Auf Grace wirkten sie wie Gespenster, die sich jederzeit unter ihren Laken erheben und einen Tanz beginnen könnten.
Aber Hawkins ließ ihr nicht viel Zeit zum Staunen, sondern ging schnurstracks weiter. Durch eine ebenso hohe Tür, in ein zweites, ebenso eindrucksvolles Zimmer mit ebenso verhüllten Möbeln.
Grace war froh, als sie die Räume hinter sich ließen und Hawkins sie über eine Wendeltreppe nach oben führte. Am Ende der Treppe erwartete sie ein weiterer Flur, von dem viele Türen abgingen. Wie viele Zimmer hatte das Herrenhaus? Wer brauchte so viele Räume?
»Bitte schön, Lady Grace.« Endlich hielt Hawkins an und öffnete eine Tür. »Lady Emmas Zimmer ist nebenan. Es gibt eine Verbindungstür.«
»Vielen Dank.« Grace knickste mit wackeligen Knien.
»Gern geschehen.« Ein leichtes Lächeln glitt über Hawkins ernste Miene, und er schloss die Tür hinter sich.
Grace drehte sich einmal um sich selbst und schaute sich in ihrem Zimmer um. Es enttäuschte sie ein wenig. Nach der riesigen Halle und den gewaltigen Räumen im Erdgeschoss hatte sie erwartet, dass ihr Zimmer groß und elegant, vielleicht auch ein wenig unheimlich wäre. Ein Gemach, wie es einer Lady entsprach. Stattdessen hatte Hawkins sie in einen Schlafraum geführt, der nur unwesentlich größer war als ihre Kammer auf Madeira. Ein Bett aus dunklem Holz stand an der einen Wand, eine Kommode und ein Schrank aus dem gleichen Holz an der anderen. Ihr Koffer stand neben einem Stuhl.
Ein buntgemusterter Teppich lag auf dem Fußboden und an den Wänden hingen zwei Drucke, die galoppierende Pferde zeigten. Grace setzte sich auf das Bett und ließ die Beine baumeln. Sie stand auf, ging zum Fenster und schaute hinaus. Von ihrem Zimmer aus konnte sie den Küchengarten sehen, von dem ihre Mutter ihr erzählt hatte, und den weitläufigen Park.
Grace schaute eine Weile hinaus, bis ihr langweilig wurde. Ein Geräusch aus dem Nebenzimmer weckte ihre Aufmerksamkeit. Grace klopfte an die Verbindungstür und öffnete sie. Emmas Schlafraum war viel, viel größer und deutlich eleganter als Graces Zimmer. Die untere Hälfte der Wände war mit dunklem Holz vertäfelt; auf der oberen Hälfte spannten sich taubenblaue Tapeten mit silbernen Mustern. Emma lag auf einem Himmelbett aus dunklem Holz, dessen hellblaue Vorhänge das gleiche Blumenmuster wie die Tapeten zeigten. Ihre Mutter hatte Grace den Rücken zugedreht und ihre Schultern bebten.
»Mama. Mama, was ist mit dir?« Vorsichtig berührte Grace den Arm ihrer Mutter, nachdem sie eine Weile schweigend überlegt hatte, was sie sagen konnte. »Mama, habe ich etwas falsch gemacht?«
Wie ertappt drehte sich Emma um und setzte sich auf. Sie wischte sich mit dem Handrücken die Tränen ab, zog Grace zu sich auf das Bett und küsste ihren Scheitel.
»Nein, Liebes, du hast nichts falsch gemacht.« Ihre Mutter zog ein schlichtes rotkariertes Taschentuch hervor und schnaubte sich die Nase. »Es ist alles meine Schuld. Ich … ich hätte nicht erwartet, dass …«
Emma schwieg, und Grace schaute ihre Mutter fragend an. Aber deren Gesicht blieb starr wie eine Maske. Schweigend saßen sie beide eine Zeitlang auf dem breiten Bett, bis Emma einen Seufzer tat.
»Schatz, wasch dich und zieh dir ein frisches Kleid an.« Emma bemühte sich um ein zuversichtliches Lächeln. »Es gibt bald Essen.«
»Ich packe nur meinen Koffer aus.« Grace wollte sich ihre Sorgen nicht anmerken zu lassen und lächelte zurück. Ihre Kleider aufzuhängen, würde sie sicher ablenken. »Soll ich das gelbe Kleid anziehen?«
»Unsere Kleider sind bereits verstaut, mein Schatz. Auf Tristyans Manor packt man seine Koffer nicht selbst aus.« Emmas Lachen klang hohl und bitter. Noch nie hatte Grace ihre Mutter so erlebt. »Es tut mir leid. Ich hätte dir viel früher erklären müssen, wie man hier lebt.«
Obwohl es in dem Zimmer warm war, schauderte Grace. Sie hätte es nicht erklären können, aber die Worte ihrer Mutter trugen einen bedrohlichen Klang mit sich. Grace warf sich in Emmas Arme und hielt ihre Mutter fest. Gemeinsam würden sie alle Hindernisse überwinden können. Bisher hatten sie das auch geschafft.
»Liebes, komm. Wir dürfen deine Großmutter nicht warten lassen.« Emma schob Grace ein Stückchen von sich, küsste sie sanft auf die Wange und erhob sich. »Zieh lieber das lindgrüne Kleid an. Lady Bethany mag die Farbe.«
Ob ihre Mutter alle Kleider danach ausgewählt hatte, dass sie der Großmutter gefallen würden, fragte sich Grace, aber folgte Emmas Worten und ging zurück in ihr Zimmer. Sie öffnete den Kleiderschrank. Ihre Kleider hingen ordentlich auf Bügeln, nach Farbe sortiert. Ordentlicher als Grace oder Emma sie aufgehängt hätten. Trotzig griff Grace nach dem butterblumengelben Kleid. Sie zog es heraus, schaute es eine Weile an, ehe sie es wieder in den Schrank hängte.
Mit gewaschenem Gesicht und gekämmten Haaren klopfte sie im lindgrünen Kleid an die Verbindungstür. Ihre Mutter öffnete und lächelte.
»Du siehst aus wie eine Prinzessin, mein Schatz.«
»Und du wie eine Königin«, sagte Grace voller Bewunderung. Das dunkelblaue Kleid mit dem weißen Spitzenkragen ließ die helle Haut ihrer Mutter leuchten. »Kommen viele Gäste zum Dinner?«
»Wie kommst du darauf?«
»Weil Großmutter sagte, dass wir im Speisezimmer essen und da dachte ich …« Grace kam sich ein wenig dumm vor, als ihre Mutter lachte. Kein freundliches Lachen, sondern ein spöttisches, eins, das wehtat. Eins, nach dem Grace sich klein fühlte. So, als ob sie eine Frage gestellt hätte, für die sie schon viel zu groß wäre.
»Oh nein, mein Schatz. Die Familie isst immer in einem der Speisezimmer.« Emma nahm Graces Hand und drückte sie, wohl auch, um sich für ihr Lachen zu entschuldigen. »Morgen erzähle ich dir, worauf man in Tristyans Manor Wert legt. Sei heute Abend einfach brav und sprich nur, wenn deine Großmutter dich etwas fragt.«
»Was ist mit Großvater?« Die Frage lag Grace schon lange auf der Zunge. Immer, wenn Emma von Tristyans Manor erzählt hatte, hatte sie nur von dem Drachen und von Graces Großmutter gesprochen. »Werde ich ihn heute Abend treffen?«
Über Emmas Gesicht glitt ein dunkler Schatten. Sie blinzelte, als ob sie gegen Tränen ankämpfte.
»Dein Großvater war ein tapferer Mann und hat gegen die Deutschen gekämpft. Er ist im Großen Krieg gefallen.«
»Das tut mir leid.« Inzwischen war Grace alt genug, um zu verstehen, was es bedeutete, wenn Menschen im Krieg fielen. Sie spürte ein leichtes Bedauern, dass sie ihren Großvater nie kennenlernen würde. »Kann ich ein Bild von ihm sehen?«
»Bestimmt, aber nun komm.« Emma hatte auf ihre Armbanduhr gesehen und eilte zur Tür. »Wir wollen deine Großmutter nicht gleich am ersten Abend verärgern.«
Mit sicheren Schritten führte Emma Grace durch die verwinkelten Gänge und Wege, in denen sie sich allein niemals zurechtgefunden hätte, bis sie an einer hohen weißen Tür ankamen.
»Noch einmal, Schatz: Bitte, sprich nur, wenn Lady Bethany dich dazu auffordert.« Ihre Mutter ging in die Knie und schaute Grace in die Augen. Ihr Gesicht war sehr ernst. »Schwöre es mir.«
Grace nickte und wunderte sich. Egal, wen sie bisher besucht hatten, niemals hatte ihre Mutter derartige Versprechen von ihr verlangt. Zum ersten Mal in ihrem Leben freute sich Grace nicht auf etwas Neues, sondern fürchtete sich vor dem Abendessen.
Emma öffnete die Tür und stupste Grace an. Sie trat ein und bemühte sich, sich ihr Erstaunen nicht anmerken zu lassen. Das war also das rote Speisezimmer. Dunkles Holz nahm die Wände ein, etwa so hoch, wie Grace groß war. Darüber leuchteten rote Stofftapeten mit Blumenmustern in einem dunkleren Rotton. Auf dem Tisch, den ein weißes Tuch bedeckte, standen rote Kerzen in goldenen Haltern und tauchten den Raum in ein sanftes Licht. Die Blumen, die in Vasen verteilt im Zimmer standen, waren ebenfalls rot. Grace erkannte Rosen und Tulpen. Im Kamin knisterte ein Feuer.
»Wie schön«, flüsterte Grace und konnte sich nicht daran sattsehen, wie die Blumen auf den Tapeten im Flackern der Kerzen hervortraten oder in den Schatten verschwanden. »Was für ein wunderschönes Zimmer.«
»Immerhin seid ihr pünktlich.« Ihre Großmutter saß bereits am Tisch, in einem dunklen Stuhl mit hoher Lehne, so dass sie Grace an eine Königin erinnerte, die von ihrem Thron herab ihre Untertanen betrachtete. Mit äußerst missbilligender Miene. »Wenn das Kind genug geglotzt hat, setzt euch.«
Die spöttische Schärfe in Lady Bethanys Tonfall brachte Grace dazu, einen Platz an der gedeckten Tafel zu suchen und den Blick auf ihren Teller zu senken. Sie war froh, dass sie nur dann antworten sollte, wenn ihre Großmutter sie direkt ansprach. Jemand tippte ihr sanft auf die Schulter, und sie schaute auf.
Ein Diener in schwarzem Anzug und weißem Hemd hielt ihr ein Tablett hin, beladen mit Fleisch und Kartoffeln und Spinat. Erst auf den zweiten Blick erkannte Grace den jungen Mann, der ihr zugezwinkert hatte. Sie sah ihn hilfesuchend an. Was sollte sie tun? Bisher hatte sie stets mit ihrer Mutter zusammen gegessen, die ihr die Teller gefüllt hatte.
»Nimm dir etwas, Liebes«, sagte Emma mit leiser Stimme. »Aber nur so viel, wie du essen möchtest. Für mich kein Fleisch, bitte.«
»Was soll das?«, fragte Lady Bethany mit scharfer Stimme, aber erhielt keine Antwort von Emma.
Vorsichtig griff Grace nach dem Löffel, der ihren Fingern entglitt und auf das weiße Tischlaken fiel. Ein dunkler Fleck breitete sich darauf aus. Grace erstarrte und spürte Tränen aufsteigen. Oh nein, sie hatte sich so sehr bemüht, alles richtig zu machen und jetzt dieses Malheur.
»Jones, bitten legen Sie dem Kind vor. Es scheint weder intellektuell noch physisch dazu in der Lage zu sein.« Die harschen Worte ihrer Großmutter schmerzten Grace mehr als eine Ohrfeige. Auch wenn sie nicht genau verstanden hatte, was Lady Bethany meinte, spürte sie die Herablassung.
Ihre Tränen tropften auf das Fleisch und die Kartoffeln. Sie begann das Fleisch zu schneiden. Mechanisch führte sie die Gabel zum Mund, kaute und schluckte, ohne etwas zu schmecken. Sie wollte nur das Essen überstehen, ohne eine weitere Katastrophe hervorzurufen. Grace war so sehr auf sich konzentriert, dass sie den Streit zwischen ihrer Mutter und ihrer Großmutter erst bemerkte, als Emma so heftig aufsprang, dass ihr Stuhl umfiel.
»Mutter. Ich bin bereit, vieles zu ertragen. Aber ich werde nicht dulden, dass du schlecht über meinen Mann redest.« Emmas Augen glühten, und sie hielt die Hände zu Fäusten geballt. »Noch ein Wort, und wir reisen ab.«
Emma drehte sich um und verließ das Speisezimmer. Graces Herz schlug laut, so laut, dass Lady Bethany es bestimmt hören konnte. Emma und Grace vermieden es, von Graces Vater zu sprechen, weil jede Erinnerung an ihn so sehr schmerzte. Wie konnte ihre Großmutter es nur wagen, schlecht über ihn zu reden? Grace lächelte, als sie an ihren Vater dachte.
»Was grinst du so?«, fuhr Lady Bethany sie an. »Deine Mutter hat dir wahrlich kein Benehmen beigebracht.«
Grace senkte den Blick. Noch nie in ihrem Leben hatte sie sich so einsam gefühlt wie in diesem Augenblick, allein mit ihrer Großmutter in dem roten Zimmer.
Deutschland 2012
Ein klirrend kalter Märzmorgen. Die Frühlingssonne schaffte es nicht, den Frost zu vertreiben, der sich durch das geöffnete Fenster in die Wohnung schlich. Aber nicht der eisige Wind trug die Schuld daran, dass Laura fröstelte. Sie beugte sich weit aus dem Fenster und warf die Papierschnipsel in die Luft. Der Wind griff danach und wirbelte einzelne von ihnen hoch hinauf, ehe er sie weitertrug. Der Großteil jedoch verteilte sich über den Bürgersteig vor dem Haus. Das würde ihr einen Rüffel von der Mieterin im Erdgeschoss einbringen, dachte Laura. Als gäbe es nichts Wichtigeres als die anstehende Hauswoche. Dieses deutsche Ritual hatte Laura nie begreifen können. Daran hatte sie stets gemerkt, dass sie eine Fremde in Fabians Land bleiben würde, so sehr sie sich auch bemühte, sich anzupassen. Alles aus Liebe zu ihrem Mann. Der Liebe ihres Lebens. Das hatte sie jedenfalls geglaubt. Mit der Zeit waren ihre Gefühle zwar ruhiger, vielleicht sogar ein bisschen langweilig geworden, aber dass sie ewig halten würden, stand für Laura außer Frage. Fabian war der Richtige. Auch wenn seine Eigenheiten sie manchmal zur Weißglut trieben und sie beide im Laufe der Jahre ihre eigenen Leben und ihre Berufe stärker in den Mittelpunkt gestellt hatten - es blieb das Gefühl der Verbundenheit. Sie hatte ihn für seine kleinen Gesten geliebt, für die nahezu unleserlichen Zettel, die er ihr schrieb, bevor er auf eine Dienstreise fuhr. Für seine Verlässlichkeit und die Stabilität. Sie war sich sicher gewesen, dass sie alle Höhen und Tiefen gemeinsam durchstehen würden, dass es nichts gab, was ihre Liebe zerstören könnte. Auch jetzt noch glaubte sie daran. Sie hätten es schaffen können, wenn sie nur eine Chance gehabt hätten.
Für immer und ewig. Sie schaute den letzten Papierschnipseln nach, die der Wind in eine kahle Baumkrone entführte. Wenn sich wenigstens der Frühling zeigen würde. Das aufblitzende Grün trüge die Illusion von Leben und Zukunft in sich. Das Hellgrau des Februars schien sich in diesem Jahr unendlich auszudehnen. Vielleicht lag es ja auch an ihr. Haarsträhnen wehten Laura ins Gesicht, die sie mit einer ungeduldigen Handbewegung zurückstrich. Heute Morgen hatte sie beim Blick in den Spiegel gesehen, dass sich der Schnitt ihres Pagenkopfs endgültig ausgewachsen hatte. Aber allein der Gedanke daran, zur Friseurin zu gehen, sich über den Urlaub oder das Wetter unterhalten zu müssen, ermüdete sie. Dann lasse ich meine Haare eben wachsen, hatte sie mit einem Anfall von Trotz gedacht. Jetzt wo Fabian nicht mehr darauf beharren konnte, dass ihr die halblangen Haare am besten stünden. Freedom is just another word for nothing left to lose, spukte der Songtext von Janis Joplin durch ihren Kopf.
Mit einem Schaudern schloss sie das Fenster und drehte sich um. Alles im Wohnzimmer erinnerte sie an Fabian. Der blaue Eisbären-Radiergummi, sein Weihnachtsgeschenk vom letzten Jahr, auf das er so stolz gewesen war. Weil er sich sicher sein konnte, dass der Eisbär Laura gefiel und dass sie ihn sich niemals selbst gekauft hätte.
Seine DVD-Sammlung der Sopranos lag noch unter dem Fernseher, als ob er gleich zur Tür hereinkäme, um seine Lieblingsfolge das fünfte Mal anzuschauen. Auf dem Großbildfernseher, den er unbedingt haben wollte, damit er alle StarTrek-Folgen sehen konnte. Raumschiffe wirkten nur auf einem großen Bildschirm, hatte er den Spontankauf gegenüber Laura begründet.
»Lass es uns gemeinsam anschauen«, hatte Fabian ihr immer wieder vorgeschlagen. An den wenigen freien Tagen, die sein Beruf ihm ließ. »Wir nehmen uns zehn Tage Zeit und gucken alles von Captain Kirk bis Voyager. So lange, bis wir viereckige Auge haben.«
»Heute nicht. Ich muss erst noch einen Plan zu Ende zeichnen«, hatte Laura lachend geantwortet. Immer stand ein Auftrag an oder der Besuch in einer Gärtnerei oder eine Mail, die noch dringend geschrieben werden musste. »Wir sehen uns alles an, wenn wir in Rente sind.«
Bis fünfundfünfzig wollten sie beide arbeiten. Sich dann ein Haus kaufen. Am Meer, vielleicht in Frankreich oder Holland oder in England, Lauras Heimat. Hauptsache, dem Wasser nah. Das Meer hatte sie immer vermisst. Laura hatte nicht lange nachdenken müssen, ob sie Fabian nach Deutschland folgte, und hatte ihren Entschluss nie bereut. Nur nach dem Meer, das zu Hause in Cornwall einfach dazugehörte, hatte sie sich beinahe täglich gesehnt. So sehr wie sie sich jetzt nach Fabian sehnte.
Sie biss sich auf die Unterlippe. Nur nicht daran denken. Mit Tränen in den Augen ging sie zum Bücherregal und nahm sein letztes Geschenk in die Hand. Das Pop-up-Buch vom kleinen Prinzen, so kostbar, dass sie kaum wagte, es aufzuschlagen, aus Angst, die fragilen Pappbilder zu zerstören. Sein Lächeln, als sie das Geschenkpapier geöffnet und vor Freude über das unerwartete Präsent Tränen in den Augen gehabt hatte. Sie legte das Buch wieder ins Regal und trat einen Schritt zurück.
Mit der Kniekehle prallte sie gegen den schwarzen Couchtisch, den sie gemeinsam ausgesucht hatten. Zu gut erinnerte sich Laura daran, wie Fabian das Tischchen fluchend aufgebaut hatte, bis sie ihm den Schraubendreher aus der Hand genommen hatte. Heimwerken war nicht seine Stärke gewesen.
Die Erinnerung drohte sie zu überwältigen, und sie floh aus dem Wohnzimmer in ihr Arbeitszimmer. Der einzige Ort ihrer gemeinsamen Wohnung, aus dem sie alles verbannt hatte, was sie an Fabian erinnerte. Ihr Refugium. Der Ort, an dem die Erinnerungen und die Schuld ihr nicht ins Auge sprangen.
Nur führte der Weg an seinem Arbeitszimmer vorbei. Die Tür ließ sich nicht schließen, weil eine zerbrechliche Konstruktion aus diversen Kabeln die Telefondose auf dem Flur mit dem Internetanschluss verband. Wie magisch angezogen, blieb sie einen Moment an der Tür stehen, ehe sie schließlich eintrat. So wie jeden Morgen seit einem halben Jahr. Jeden Morgen wollte sie dieses Ritual durchbrechen, wollte an seinem Arbeitszimmer vorbeigehen und scheiterte jedes Mal.
Sie ließ sich auf das mintgrüne Sofa sinken, ein Designerstück, viel zu tief und unbequem. Aber es hatte Fabian sowieso nur als Ablage gedient. Daneben standen die gerahmten Bilder, Kunstdrucke von Monet und Marc und Hopper. Seit ihrem Einzug vor zwei Jahren lagerten sie auf dem Fußboden, weil Fabian immer wieder vergaß, sich eine Bohrmaschine zu leihen. Absichtlich vergaß, so vermutete Laura, um sich nicht zu blamieren.
In der Mitte, direkt vor dem Fenster, stand der schwere dunkelbraune Tisch. Eigentlich ein Esstisch, aber Fabian hatte einen extrabreiten Schreibtisch gebraucht, für die Papierstapel. Er war Anwalt von Beruf und hatte beinahe jeden Abend Akten mit nach Hause gebracht, die sich auf dem Schreibtisch anhäuften. Gegen Lauras Rat hatte Fabian sich für das Monstrum entschieden, neben dem alles andere winzig wirkte. Seit sechs Monaten war der Schreibtisch leer, was Laura dazu brachte, auf ihre Lippe zu beißen, um die Tränen zurückzuhalten. Jeden Morgen nahm sie sich vor, ein Buch oder die Tageszeitung oder ein paar Stifte auf den Tisch zu legen, um die Leere zu durchbrechen. Aber sie vergaß es immer wieder. Warum die Illusion erzeugen, dass Fabian zurückkäme? Sie wusste es besser.
Rechts reihten sich Regale auf, vollgestopft mit Büchern, Zeitschriften, Aktenordnern und Stempeln. Wie konnte ein Mensch nur so viel von den Dingern benötigen, hatte Laura gespottet, nachdem der Paketbote eine Woche lang jeden Tag einen neuen Stempel gebracht hatte. Auch heute noch kam Post für Fabian. Rechnungen, Werbung, Schreiben von Versicherungen. Laura brachte nicht die Kraft auf, Fremde anzuschreiben und sie zu benachrichtigen. Ihr Herz schlug schneller, und sie wünschte sich die Stärke, einfach alles zu nehmen und in Kisten und Kartons zu verpacken. So wie sie es mit den Sachen auf seinen Schreibtisch getan hatte – an dem Tag, an dem …
Nur zu gut erinnerte sie sich daran. An das durchdringende Klingeln. An die mitleidigen Blicke der Männer, die sie vorher nie gesehen hatte. Bevor nur ein Wort gefallen war, hatte sie gewusst, was geschehen war.
Nachdem die Männer gegangen waren, hatte Laura schweigend vor sich hin gestarrt und dann in einer Art Betäubung Fabians Schreibtisch leergeräumt und gründlich abgeschrubbt. Erst dann hatte sie ihre Familie angerufen und schließlich Fabians Eltern. Heute wünschte sie sich, sie hätte damals alles verpackt. Verpackt und vergessen. Aus den Augen, aus dem Sinn.
»Warum verkaufst du seine Sachen nicht?«, hatte eine Freundin vor ein paar Wochen gefragt. In diesem wohlmeinenden Ich-meine-es-doch-nur-gut-Ton, den Laura hassen gelernt hatte. »Oder spendest sie, wenn du kein Geld dafür willst?«
Laura hatte sie schweigend angeschaut, so lange, bis ihre Freundin rot angelaufen war und sich bald danach verabschiedet hatte. Laura konnte Fabians Sachen nicht weggeben. Sie musste sie behalten. Als Mahnmal und als Erinnerung an ihre Schuld. Sie schloss die Augen und atmete tief ein und aus.
»Das ist normal. Sie müssen diese Phase durchlaufen«, hatte der Leiter der Gruppe gesagt, zu der eine andere, ebenfalls wohlmeinende Freundin sie mitgeschleift hatte. »Aber Sie müssen an sich arbeiten, damit Sie die nächste Stufe erreichen.«
»Wer sagt Ihnen, dass ich die nächste Stufe erreichen will?« Mit diesen Worten war Laura aufgestanden und hatte den Raum verlassen, und die Gruppe und auch die Freundin.
Sie öffnete die Augen und starrte die Buchrücken an. Die Sammlung aller Maigret-Krimis, Kunstbände, Reiseführer zu den Reisen, die sie gemeinsam unternommen hatten. Toskana, Tunesien, London, Teneriffa, Portugal, Spanien, Niederlande …
Auf dem Tischchen neben dem Sofa lagen die Reiseführer mit dem Ziel Australien. Ihre große Reise. In sechs Wochen hätten sie fliegen wollen. Heute waren die Tickets gekommen. Laura hatte sie genommen und in winzige Fetzen zerrissen und dem Wind geschenkt. Als ob sie damit der Erinnerung entrinnen könnte.
Das Telefon klingelte. Laura schaute auf das Display. Keine Rufnummer. Ihre Schwester. Hannah wollte sicher wissen, wie es ihr ging. Was sollte Laura antworten?
»Ich weiß es nicht. So wie jeden Tag seit einem halben Jahr. Nein, es ändert sich nicht.«
Sobald sie so etwas sagte, würde Hannah vorbeikommen wollen. Sich in den nächsten Flieger setzen und zur Rettung ihrer älteren Schwester herbeieilen. Mit Essen von daheim und tröstlichen Worten, die Laura in ein Gefühlswirrwarr stürzen würden. Zorn, weil sie keinen Trost wollte und auch keinen Trost empfinden konnte. Scham, weil Hannah versuchte, zu helfen, so wie ihre Freundinnen, die in den ersten Tagen und Wochen täglich angerufen oder sie mit Besuchen überrascht hatten. Lauras harsche Worte oder ihr dumpfes Schweigen hatten schließlich selbst die treuesten vergrault. Hinterher hatte es ihr oft leid getan, aber wie hätte sie reagieren sollen auf Plattitüden wie »Die Zeit heilt alle Wunden«? Was hätten die Freundinnen anderes sagen können? Laura wusste es nicht.
Nur Hannah war geblieben. Vier Wochen lang. Ihre Schwester hatte sich um Einkäufe gekümmert, die Blumen gegossen und Mails an Lauras Auftraggeber geschrieben, solange Laura im Bett lag und nichts und niemanden sehen wollte. Dafür schuldete Laura es ihr, ans Telefon zu gehen.
»Wie geht es dir? Kannst du schlafen?« Hannah hielt sich nicht mit Eröffnungsgeplänkel auf. »Nimmst du immer noch Tabletten?«
»Nein, schon länger nicht mehr«, log Laura und hoffte, dass ihre Schwester es ihr nicht anhörte. Zu gut kannten sie einander. »Ich schlafe ganz gut. Den Umständen entsprechend.«
Sie wünschte, sie hätte Hannah nicht in einem Moment der Schwäche von den Träumen erzählt, die sie jede Nacht plagten. Nur nicht, wenn sie Tabletten nahm. Träume, in denen Laura auf einem Hochhaus stand, an der äußersten Kante des Daches, wie magisch angezogen von der Tiefe. Nächte, in denen sie endlose Leitern hochkletterte, einem Schemen hinterher, der sie an Fabian erinnerte. Bis zu dem Moment, wo er sich auflöste und Laura nach unten sah. Paralysiert vom Abgrund, der sich unter ihr auftat. Sie fiel niemals in diesen Träumen, aber sie fürchtete jedes Mal, dass sie eines Nachts den letzten Schritt gehen würde. Fürchtete sie es oder wünschte sie es sich?
»Kommst du nach Hause?« Hannahs Stimme zerrte sie aus ihren Gedanken. »Wie lange willst du noch in der Wohnung bleiben?«
»Heute sind die Flugtickets für Australien gekommen.« Laura wollte nicht schon wieder darüber diskutieren, dass es für sie gleich war, wo sie lebte. Als ob die Erinnerung an Fabian ortsgebunden wäre. »Ich … ich hatte sie ganz vergessen.«
»Was willst du damit machen?«
»Ich habe sie zerrissen.« Das klang theatralisch und melodramatisch, musste Laura zugeben. Eben war es ihr noch als das einzig Richtige erschienen. »Blöd, ich weiß.«
Mit dem Telefon in der Hand verließ sie Fabians Zimmer und ging in ihr Arbeitszimmer. Auf ihrem Schreibtisch lagen die Gartenbaukataloge noch immer ungeöffnet neben ersten Entwürfen für ihre aktuellen Projekte. Jeden Tag nahm Laura sich vor, heute mit der Arbeit zu beginnen, und jeden Tag starrte sie nur auf die Bücher oder auf den Bildschirm ihres Notebooks. Noch hatten ihre Kunden Geduld mit ihr. Aber langsam rückte die Pflanzzeit näher. Mit dem Frühling einher kamen erste Anfragen, wie lange Lauras Entwürfe noch auf sich warten ließen.
»Vielleicht solltest du einfach mal wegfahren. Für länger.« Hannah klang energisch. Laura wäre gern wie ihre Schwester, die sich jedem Problem stellte, es bekämpfte und besiegte. »Australien. Entschuldige, nein. Neuseeland vielleicht.«
»Ich weiß nicht.« Fabian war der, der Fernreisen liebte. Laura zog es nicht in exotische Länder. In den Australienurlaub hatte sie nur seinetwegen eingewilligt. »Das ist zu weit weg.«
»Dann fahr nach Madeira. Da gibt’s doch das Haus dieser alten Tante von uns.« Hannah begeisterte sich über ihren Vorschlag. »Das käme nicht so teuer. Ich könnte dich besuchen, damit du nicht allein bist.«
»Ich weiß nicht.« Laura kam sich vor wie ein Papagei, der nur eine Antwort kannte.
»Ich finde heraus, ob das Haus frei ist, und rufe dich wieder an.« Hannahs Energie fühlte sich Laura nicht gewachsen. Sie wollte sich nicht mit ihrer Schwester streiten. Falls es ernst würde, könnte sie immer noch eine Krankheit vortäuschen. »Du gibst auf jeden Fall die Tickets für Australien zurück und versuchst, das Geld zurückzubekommen.«
»Mach ich.« Laura schwieg einen Moment. Sie fühlte sich von ihrer Schwester überrollt, konnte sich aber Hannahs Argumenten nicht entziehen. »Du hast recht. Ich sollte eine Weile raus.«
»Was hältst du davon, wenn ich während deines Urlaubs Fabians Sachen sortiere?« Hannah war mit ihren Gedanken schon weiter. »Ich wollte sowieso für eine Woche nach Deutschland kommen und könnte bei dir wohnen und mich um alles kümmern.«
Erst wollte Laura abwehren, erkannte dann aber ihre Chance.
»Danke, aber …« Laura zögerte. Sollte sie ihren Verdacht äußern, nur um sich hinterher für eine neurotische Ehefrau zu halten? Sollte sie schweigen und ihre Schwester möglicherweise mit etwas konfrontieren, was diese nicht wissen wollte? »Wenn dir etwas seltsam vorkommt, ruf mich an, okay.«
Hannah schwieg. So wie ihre Mutter geschwiegen hatte und jedes Geheimnis, und war es noch so klein, aus Laura herausgelockt hatte. Sie meinte zu spüren, dass ihre Schwester nachhaken wollte, was Laura meinte. Eine Frage, die sie nicht beantworten wollte. Daher sagte sie schnell: »Danke für alles. Ich muss los.«
Hastig legte sie das Telefon zur Seite und holte Die Blumen Madeiras aus dem Regal. Das Buch liebte sie, seitdem sie es das erste Mal gesehen hatte. Dreizehn Jahre alt war sie damals gewesen. Vor einer langweiligen Familienfeier war sie in die große Bibliothek von Tristyans Manor geflüchtet, wo sie es entdeckt hatte. Eine entfernte Verwandte hatte angeblich diese phantastischen Blumenbilder gemalt. Laura hatte sich der Unbekannten merkwürdigerweise gleich nahe gefühlt, nachdem sie das Buch durchgeblättert hatte. Die Abbildung einer Strelitzie hatte sie vollkommen fasziniert. In der Zeichnung zeigte sich tausendmal mehr, als es ein Foto je vermocht hätte. Angeregt durch das Buch hatte Laura begonnen, sich für Blumen und Pflanzen zu interessieren, so dass auch ihr Berufswunsch bald feststand.
Mehr noch. Die Blumenbilder gaben ihr erstaunlicherweise Kraft und Halt, weil sie in ihnen versinken konnte. Wer war diese Großtante, deren Zeichnungen sie auf eine solche Weise berührten? Warum hatte Laura eigentlich nie versucht, mehr über Amelia herauszufinden? Vielleicht sollte sie das tun und sich damit von allem ablenken. Laura setzte sich in den breiten Sessel, den Fabians Großmutter ihr vererbt hatte, blätterte wieder und wieder durch die Seiten und ließ sich von den Blumen Madeiras einfangen.
Madeira. Vielleicht eine gute Idee.
Madeira 2012
Als das Flugzeug zum Landeanflug ansetzte, schloss Laura die Augen und umklammerte das Buch, das sie während des Fluges lesen wollte. Ihr Nachbar interpretierte ihr Verhalten fälschlicherweise als Flugangst und sprach Laura Mut zu.
»Glauben Sie mir, Fliegen ist viel sicherer als Autofahren.« Seine Worte bohrten sich in Lauras Ohren. Warum konnte er sie nicht in Ruhe lassen und sie ihren Gedanken überlassen. »Und wir sitzen günstig.«
»Bitte?« Laura öffnete die Augen, um ihn anzusehen. Sie hatte bereits fünf oder sechs Versuche des Mannes abgewehrt, der offensichtlich mit ihr ins Gespräch kommen wollte, und nun fehlte es ihr an Energie, noch ein weiteres Mal unhöflich zu sein. »Was meinen Sie damit?«
»Nah am Notausgang und im Bereich der Tragflächen. Da ist das Flugzeug am stabilsten.« Ihr Sitznachbar drehte sich zu Laura um und legte seine linke Hand so über die rechte, dass der Ringfinger mit dem auffallenden weißen Streifen nicht zu sehen war. Wirkte sie so naiv, dass er meinte, sie damit darüber hinwegtäuschen zu können, dass er verheiratet war?