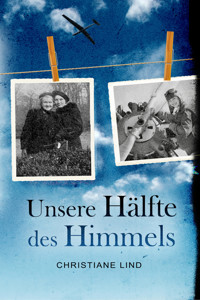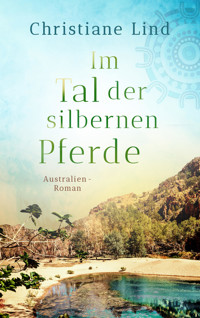7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erinnerungen werden lebendig – Familiensagas, die bewegen! Die Frankfurt-Romane im Sammelband. Die Frankfurt-Romane tauchen ab in die dunkle Zeit der 1930er Jahre und begleiten mutige Frauen, die für das kämpfen, was ihnen am Herzen liegt. Sie müssen sich mit ihren eigenen Ängsten und Zweifeln auseinandersetzen und lernen dabei, dass die Vergangenheit immer noch in uns lebt. In »Unsere Hälfte des Himmels« träumen Amelie und Johanna 1935 davon, als Fliegerinnen ihr Leben zu führen. Doch in einer Zeit, in der Frauen an Heim und Herd gedrängt werden, ist ihr Wunsch verwegener als je zuvor. 1971 fällt Amelie nach einem Autounfall ins Koma und ihre Tochter Lieselotte reist sofort zu ihr nach Frankfurt am Main. Aus der Sorge um ihre Mutter entwickelt sich eine Reise in deren Vergangenheit und die Suche nach einer selbstbestimmten Zukunft. »Ich warte auf dich, jeden Tag« erzählt die Geschichte von Erin, die vor den Trümmern ihres Lebens steht. Dann findet sie auf dem Speicher ihres Elternhauses ein Flugticket und einen Liebesbrief aus dem Jahr 1993, der von einer Lily unterschrieben ist. Auf der Suche nach Antworten reist Erin nach Deutschland und stößt auf die Geschichte von Lily, einer mutigen Frau, die in den dreißiger Jahren gegen die Nazis kämpfte. Dabei entdeckt Erin nicht nur die Wahrheit über ihre Familie, sondern auch die Bedeutung von großer Liebe und kleinen Lieben, von Freundschaft und Zusammenhalt. Dieser Sammelband ist eine Hommage an die mutigen Frauen, die in schweren Zeiten ihren Weg gegangen sind. Und er zeigt, dass die Vergangenheit nie ruht und immer wieder neue Fragen aufwirft. Ein absolutes Highlight für alle Fans von Familiensagas!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Sammelband von »Ich warte auf dich, jeden Tag« und »Unsere Hälfte des Himmels«Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023AIKA Consulting GmbH, Berliner Straße 52, 34292 Ahnatal
Erstveröffentlichung unter dem Titel »Ich warte auf dich, jeden Tag« und dem Pseudonym Clarissa Linden© Droemer Knaur 2015Lektorat 2015: Julia von NatzmerLektorat 2022: Maike KleihauerKorrektorat: Regina Merkel und Heike Freistühler
Erstveröffentlichung unter dem Titel »Unsere Hälfte des Himmels« und dem Pseudonym Clarissa Linden© Droemer Knaur 2017Lektorat: Silvia Kuttny-Walser
Buchcoverdesign: www.BookCoverStore.comBuchsatz: LoreDana Arts, http://www.loredanaarts.de/Home/
Christiane Lind
Ich warte auf dich, jeden Tag
Roman
Das Buch
Berkeley 1999. Erin steht vor den Scherben ihres Lebens: Ihr Mann hat sie nach zwanzig Jahren Ehe verlassen, und ihr Job als Buchhändlerin ist gefährdet. Da findet sie auf dem Speicher ihres Elternhauses unter den Hinterlassenschaften ihres Großvaters ein Flugticket nach Deutschland und einen Liebesbrief aus dem Jahr 1993, unterschrieben von einer Lily. Erin kann es nicht glauben, denn sie hat ihren Großvater als kalten und unnahbaren Menschen kennengelernt. Und ausgerechnet er soll eine heimliche Liebe gehabt haben?
Auf der Spur des Geheimnisses reist Erin nach Deutschland und begibt sich auf die Suche nach der mutigen Lily, die in den dreißiger Jahren eine leidenschaftliche Gegnerin der Nazis war …
Eine emotionale Geschichte über die große Liebe und das Schicksal, das sich ihr in den Weg stellt.
Die Autorin
Christiane Lind hat sich immer schon Geschichten ausgedacht, die sie ihren Freundinnen erzählte. Erst zur Jahrtausendwende brachte sie ihre Ideen zu Papier und ist seitdem dem Schreibvirus verfallen. In ihren Romanen begibt sich Christiane am liebsten auf die Spur von Familien und deren Geheimnissen. Sie lebt in Ahnatal bei Kassel mit unzähligen und ungezählten Büchern, einem Ehemann sowie einem mutigen Kater und einer schüchternen Katze.
Für meine Großmütter Ida und Berta und Großtante Erna,die ihre Erinnerungen mit mir teilten
Kapitel 1
Frankfurt am Main, 30. Januar 1933
Die Straßenbahn war überfüllt, so dass Lily zwei Stationen vor ihrer Haltestelle ausstieg, um dem Stimmenwirrwarr und den unsäglichen Gerüchen zu entkommen. Von der Mischung aus Mottenkugeln, gekochtem Kohl und feuchter Wolle war ihr übel geworden. Außerdem konnte sie das belanglose Gerede nicht mehr ertragen. Die Frankfurter beschwerten sich über das Wetter, klagten über die Verspätung der Straßenbahn oder jammerten über die ansteigenden Preise. Noch weniger auszuhalten waren die hoffnungsvollen Worte, mit denen die Menschen Hitlers Ernennung zum Reichskanzler kommentierten. Waren ihre Mitbürger denn blind? Konnten oder wollten die Frankfurter nicht sehen, was es für Deutschland bedeutete, dass die Nationalsozialisten an Macht gewannen?
Lily stolperte aus der Bahn, rang nach Luft, die winterkalt ihre Lungen traf. Noch immer konnte sie nicht glauben, was geschehen war. Nicht einmal ihre Partei, die SPD, hatte Hitler aufhalten können. Vor Verzweiflung kamen Lily die Tränen. Sie senkte den Kopf und stapfte nach Hause. Was für ein furchtbarer Tag! Dabei hatte er so wunderbar angefangen. Doktor Elias, ihr Dozent, der hochgeschätzte Assistent von Professor Mannheim, hatte Lily zum ersten Mal in seine Diskussionsrunde eingeladen. Zwar hatte sie kaum ein Wort herausgebracht, aber aufmerksam zugehört.
Auch an anderen Tischen saßen Studenten und diskutierten. Der Duft der frischgebackenen Torten und Kuchen ließ Lily das Wasser im Mund zusammenlaufen, aber sie konnte sich gerade mal ein Glas Wasser leisten, an dem sie sich festhielt und nur ab und zu einen Schluck trank. Sie spürte die Wärme der Menschen um sich herum, fühlte sich erstmals als Teil der Studenten zugehörig. Und dann platzte die Nachricht von Hitlers Ernennung in die Runde. Wie alle anderen in dem Café sprang Lily auf und rannte nach draußen.
Sie wurde von der Menge mitgerissen und folgte dem Strom der Studenten in die Innenstadt. Hier versammelten sich die Menschen auf Straßen und Plätzen, um ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Oder – wie Lily mit eigenen Augen sehen musste – um gegeneinander zu kämpfen. Vor ihr schlug sich ein Braunhemd mit einem Mann, dessen Worte ihn als Kommunisten ausgewiesen hatten. Man konnte die Aggression, die in der Luft lag, förmlich mit den Händen greifen. Daher hatte Lily beschlossen, nach Hause zu gehen, anstatt sich in eine Auseinandersetzung zu begeben, bei der sie nur verlieren würde. Allein könnte sie nichts gegen die Nationalsozialisten ausrichten, so gerne sie das auch würde.
Mit gesenktem Kopf kämpfte sie gegen den Wind an, der sich an ihr Gesicht schmiegte, als wollte er sie liebkosen. Missmutig zog Lily den Schal etwas höher, aber das Gefühl von Kälte blieb. Kälte, die sie von der Verwirrung ablenkte, die sie schon seit Stunden beschäftigte. Seitdem Alexander Kirchner, ihr Kommilitone, sie im Café Laumer nach ihrer Meinung zu Hitlers Ernennung gefragt hatte, als gehörte sie zu denjenigen, mit denen er sich umgab. Wie kam er dazu, ausgerechnet sie zu fragen? Lily war so überrascht gewesen, dass ihr keine Antwort eingefallen war. Und bevor sie ihre Gedanken geordnet hatte, hatte Alexanders blonder Freund ihn am Arm gegriffen und von Lily weggezogen, an einen anderen Tisch. Sie hatte den beiden Männern nachgestarrt und sich gefragt, warum ihr ausgerechnet heute nichts einfallen wollte.
Er musste sie für dumm halten. Für dumm und einfältig, für eine der Studentinnen, die ihr Studium der Großzügigkeit der Akademie der Arbeit verdankten. Oder, schlimmer noch, für eine der Frauen, die nur deshalb an der Goethe-Universität eingeschrieben waren, um einen passenden Ehemann zu finden. Sonst war sie nie um eine Antwort verlegen, diskutierte gerne mit den Kommilitonen über wissenschaftliche Fragestellungen oder die aktuelle politische Situation. Warum also war sie stumm wie ein Fisch geblieben, als Alexander Kirchner sie gefragt hatte? Sollte sie ihn morgen ansprechen und ihm sagen, was sie dachte, oder wäre das nur noch peinlicher?
Sicher saßen er und die anderen Studenten immer noch im Café Laumer, redeten sich die Köpfe bis spät in die Nacht heiß, um am nächsten Morgen gähnend und mit dunklen Ringen unter den Augen in der Vorlesung zu sitzen. Lily beneidete ihn und seine Freunde um diese Freiheit, die sie sich nicht leisten konnte. Wenn sie nicht lernte, arbeitete sie, um Geld zu verdienen, oder stürzte sich mit Elan in die Parteiarbeit.
»Lily! Lily!«
Erst meinte sie, sich verhört zu haben, und ging zielstrebig weiter. Doch als die Lily-Rufe nicht endeten, blieb sie stehen und wandte sich um. Ein Lächeln glitt über ihr Gesicht, als sie ihre Mutter Ida erkannte, dick eingehüllt in den schweren braunen Mantel und den selbst gestickten tiefroten Schal.
»Ich war im Konsum und hatte Glück.« Ida stellte zwei gefüllte Einkaufstaschen zu Boden und strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn, die ihr der Januarwind immer wieder ins Gesicht wehte. »Sie hatten noch Schwarzbrot von gestern. Für den halben Preis. Nur neunzehn Pfennig. Da konnte ich gleich noch zwei Kilo Kartoffeln kaufen. Und Öl.«
»Wie schön. Dann haben wir in den nächsten Tagen gut zu essen«, antwortete Lily und ging ihrer Mutter entgegen. Sie fühlte einen Stich des schlechten Gewissens, weil sie studierte und nur wenig zum Einkommen ihrer Familie beitragen konnte. Daher war ihre Mutter gezwungen, altes Brot zu kaufen und jeden Pfennig umzudrehen. Wie so viele Menschen in Frankfurt. Bei einem Stundenlohn von zweiundfünfzig Reichspfennig, den sie als Näherin erhielt, konnte man eben keine großen Sprünge machen.
»Es tut mir leid, ich sehe, wie schwer es für dich ist. Vielleicht kann ich noch eine Stelle als Kellnerin finden.«
»Nein, Lily.« Ihre Mutter schüttelte vehement den Kopf. »Das kommt gar nicht in Frage. Du sollst studieren und ein gutes Examen machen. Das wünschen dein Vater und ich uns für dich.«
»Das weiß ich und ich bin euch dankbar, aber¨…« Lily wollte die Diskussion nicht wieder führen. »Soll ich dir etwas abnehmen?«
»Ja, trag das Brot.« Flüchtig strich Lilys Mutter ihr mit der Hand über die Wange. »Du siehst erschöpft aus, Kind. Mir scheint, du arbeitest zu viel. Geht es dir gut?«
»Ja, alles in Ordnung, Mutter. Ich bin nur ein bisschen müde. Aber was ist mit dir? Du wirkst aufgewühlt, als hättest du eine unerfreuliche Begegnung gehabt.«
»Ach, das Übliche. Sie werden immer mehr. Immer mehr und immer dreister.« Ida machte eine wegwerfende Bewegung, als wollte sie die düsteren Gedanken verdrängen. »Bertha und Willy kommen gleich vorbei. Wir wollen darüber reden, was …«
Lilys Kehle fühlte sich an wie zugeschnürt. Zu stark war das Gefühl von Bedrohung. »Ist etwas passiert?«
»Lass uns gleich darüber reden.«
Lily war es nur recht, dass ihre Mutter gerade nicht über Politik reden wollte. Zu sehr hatte die heutige Nachricht sie getroffen. All ihre Zukunftspläne standen nun zur Disposition und waren auf einmal keinen Pfennig mehr wert.
»Ich bin froh, dass ich Glück beim Einkauf hatte«, sagte ihre Mutter. »Obwohl die Lebensmittelpreise stabil sein sollen, kommt es mir vor, als würde von Woche zu Woche alles teurer. Wo soll das noch hinführen?«
Lily antwortete nicht, weil ihre Mutter es wohl nicht mehr erwartete. Schon oft hatten sie einander diese Frage gestellt und keine Hoffnung gesehen. In vertrautem Schweigen legten sie den Weg nach Hause zurück, gaben vor, die Gruppe von Männern vor ihnen nicht zu sehen, die sich aufspielten, als gehörte die Straße ihnen. Kerle in braunen Hemden und mit roter Armbinde, auf der das schwarze Hakenkreuz in weißem Rund hervorstach. Mit zu Fäusten geballten Händen drängte Lily sich an ihnen vorbei. Zu zweit konnten ihre Mutter und sie nichts gegen die Braunhemden ausrichten. Wahrscheinlich wollten sie sich dem Mob anschließen, der zum Römerberg zog und »Sieg Heil! Sieg Heil!« brüllte, als gehörte ihm die Stadt.
Ohnmächtig vor Zorn folgte Lily ihrer Mutter, die mit großen Schritten auf das Haus zuging und die Treppe in den zweiten Stock hinaufeilte. Als sie das Mehrfamilienhaus betraten, schlug Lily der vertraute Geruch von Bohnerwachs und Kohl entgegen. Mit der linken Hand hielt sie sich am Handlauf fest, dessen Holz sich glatt und kühl anfühlte. Als Ida die Tür öffnete, ächzte das Holz und die Angel quietschte. Lilys Vater Gottfried wollte die Scharniere ölen, aber Ida mochte das Geräusch.
Während Ida in die Küche ging, blieb Lily noch einen Augenblick im Flur stehen, bis ihre Augen sich an das Halbdunkel gewöhnt hatten. Sorgsam zog sie den dicken Mantel aus, den sie von Oma Bertha geerbt hatte, und hängte ihn auf. Die schweren Stiefel stellte sie auf einen Wischlappen, damit Eis und Schnee nicht auf den Linoleumboden tropften. Nachdem sie einmal tief Luft geholt hatte, stieß Lily die Tür zur großen Wohnküche auf. Wie Lily erwartet hatte, war die ganze Familie zusammengekommen. Kaffeeduft zog durch den Raum und schaffte eine heimelige Atmosphäre. Auch wenn es nur Muckefuck war, nicht der teure Bohnenkaffee, den sich die Familie nur zu Geburtstagen und großen Feiertagen wie dem 1. Mai gönnte.
Links an der Wand stand die Eckbank, die ihr Opa Willy gedrechselt hatte, ebenso wie den alten Holztisch, der bereits für den Familienkaffee gedeckt war. Durch die schmalen Fenster fiel das graue Licht des Tages, erreichte die Spüle aus Stein und die Holzschränke, in denen sich ihr Geschirr befand. Die Küche bot Platz für die ganze Familie – und sogar noch ein paar Genossen, denn die Familie erhielt oft Besuch. Auch wenn man wenig hatte, teilte man gern.
Vor drei Jahren hatte ein Parteigenosse von Lilys Vater ihnen eine bessere Wohnung angeboten, eine der May-Wohnungen, die im Rahmen des Frankfurter Wohnungsbauprogramms erbaut worden waren. Doch Lilys Mutter Ida und deren Mutter Alwine hatten nur einen prüfenden Blick in die Küche geworfen, um schließlich dankend abzulehnen. Selbst die Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky, der ihre funktionale Küche eine Herzensangelegenheit war und die mit den Mietern gesprochen hatte, konnte Ida und Alwine nicht überzeugen. Obwohl sich beide Frauen übereinstimmend sehr beeindruckt von der jungen Architektin gezeigt hatten. »Eine Küche ist dazu da, dass die Familie sich dort trifft. Punkt!«, hatte Alwine verkündet. »Aber das Wiener Mädchen ist ein kluger Kopf. Schade, dass sie Kommunistin ist.«
Damit war die Entscheidung getroffen und die Familie blieb weiter in der Kölnischen Straße im Gallusviertel, in »Kamerun«, wie der Stadtteil in Frankfurt genannt wurde, wohnen. Eigentlich war die Wohnung mit den drei Zimmern viel zu klein für Lily, ihre Eltern, Lilys Bruder Karl und Oma Alwine, die vor zwei Jahren bei ihnen eingezogen war. Aber die Wohnung war noch bezahlbar, selbst jetzt, wo Lilys Vater Gottfried, wie so viele andere auch, seine Arbeit verloren hatte, und nur ab und zu Aushilfstätigkeiten auf dem Bau fand, für die er eigentlich zu alt war. Gottfried war Buchbinder gewesen und vermisste den Geruch von Leim und das Gefühl von Papier. Dank Oma Alwine, die eine kleine Rente bekam, musste Lily nur einen geringen Teil zum Familieneinkommen beitragen und konnte sich im Großen und Ganzen ihrem Studium widmen, obwohl sie sich inzwischen fragte, wie lange sie noch an der Universität bleiben könnte.
»Lily.« Ihr Vater erhob sich von der Eckbank, um sie zu begrüßen. In den letzten Monaten war er abgemagert, so dass seine kräftige Nase scharf hervorsprang und die Falten um seine braunen Augen sich tief in die Haut eingegraben hatten. »Wie war es an der Universität?«
»Heute hat mich Doktor Elias, der Assistent von Professor Mannheim, eingeladen. Ins Café Laumer.« Ob ihre Familie begreifen würde, was für eine Ehre das für Lily gewesen war? Nur wenigen Studenten gewährte der Dozent dieses Privileg.
»In Cafés verbringen die vornehmen Herrschaften an der Universität also ihre Zeit, während unsereins sich an Brot und Muckefuck halten muss. Als gäbe es nichts Wichtigeres.« Obwohl ihr Bruder vorgab, einen Scherz gemacht zu haben, wusste Lily nur zu gut, dass er jedes Wort ernst meinte. Karl hielt Lily für eine Klassenverräterin, weil sie unbedingt studieren wollte. Ihr hatte er das einmal vorgeworfen, den Eltern und Oma Alwine gegenüber hielt er klugerweise den Mund.
Karl begleitete seine Worte mit einem bissigen Grinsen, und nicht zum ersten Mal fragte sich Lily, wie zwei so unterschiedliche Menschen Geschwister sein konnten. Ihr Bruder war groß und kräftig mit vollem schwarzem Haar, das ihm in die Stirn fiel, und den dunklen Augen ihres Vaters. Lily reichte ihrem Bruder nicht einmal bis zur Schulter. Ihr Haar war von einem hellen Braun, das Karl als »Straßenköterblond« bezeichnete, ihre Augen waren hellgrau wie sonst bei niemandem aus der Familie. Oma Alwine allerdings behauptete steif und fest, dass ihr verstorbener Mann Friedrich ebensolche Augen gehabt hatte. »Meerschaumaugen«, wie Alwine zu Lilys Verwunderung gesagt hatte. So ein romantisches Wort passte gar nicht zu ihrer bodenständigen Großmutter.
Aber nicht nur im Äußeren unterschieden sich die Geschwister. Wo Karl aufbrausend und laut war, blieb Lily ruhig und sprach leise. Nur in einem waren sich beide einig – ihr politisches Herz schlug links. Das jedoch hinderte Karl nicht daran, seiner Schwester ihr Studium vorzuhalten und zu behaupten, sie würde sich für etwas Besseres halten.
Bevor Lily sich eine Antwort auf Karls Angriff überlegen konnte, mischte sich Oma Alwine ein. »Der Karl hat nicht Unrecht. Wir müssen überlegen, wie es weitergehen soll.« Alwine, eine vom Alter gebeugte Frau, fuhr sich mit der Hand durch die kurzgeschnittenen weißen Haare, die wild vom Kopf abstanden. »Ich will nicht in einem Land leben, in dem Hitler regiert. Du etwa, Clara?«
Alwine deutete mit dem Zeigefinger auf Lily. Eine Geste, die Lily als Kind schreckliche Angst eingejagt hatte, weil sie gnadenlos wirkte. Überhaupt hatte sie sich vor ihrer polternden, ruhelosen Großmutter gefürchtet, bis sie alt genug war, hinter die ruppige Fassade zu blicken.
»Mutter, du sollst sie nicht Clara nennen«, sagte Ida und seufzte. Sie führte den Kampf um Lilys Namen seit mehr als achtzehn Jahren mit ihrer Mutter. Oma Alwine wollte sich einfach nicht damit abfinden, dass ihr Namensvorschlag nach Lilys Geburt überstimmt worden war, und nannte Lily daher bei jeder Gelegenheit Clara, nach Clara Zetkin.
Denn von Lily Braun, der Namenspatin für Lily, hielt Oma Alwine überhaupt nichts. »Kriegstreiberin, die«, pflegte Alwine zu sagen, sobald die Sprache auf sie kam. »Muss man sich schämen, dass das Kind danach heißt.«
Obwohl Lily ihrer Großmutter zustimmte, was die politischen Verfehlungen ihrer Namenspatin anging, war sie dennoch froh, dass sich weder ihr Vater durchgesetzt hatte, der sie nach Rosa Luxemburg hatte nennen wollen, noch Oma Bertha, die für Ottilie plädiert hatte. Mit Emma hingegen, dem Vorschlag von Opa Willy, hätte Lily leben können – diesen Namen mochte sie. Manchmal fragte sie sich, ob ihr Leben ein anderes wäre, wenn sie eine Emma oder Clara geworden wäre.
»Aber Oma, wo sollten wir denn leben?«, erwiderte Lily schließlich auf Alwines Frage. Sie konnte sich nicht vorstellen, Frankfurt zu verlassen. Sie wollte sich nicht vorstellen, das Studium aufzugeben. »Alle unsere Freunde und Genossen leben hier. Gemeinsam werden wir siegen.«
Bevor jemand etwas erwidern konnte, klopfte es an der Wohnungstür. Lily ging in den Flur und öffnete. Vor ihr standen Willy und Bertha, die Eltern ihres Vaters, beide mit sorgenvollen Mienen.
»Blass bist du«, sagte Oma Bertha, die oft das Reden für sich und ihren Ehemann übernahm. »Du studierst zu viel.«
»Kommt rein.« Lily deutete Richtung Küche. »Mutter schmiert gerade Brote für uns alle.«
Sie hängte die Mäntel ihrer Großeltern auf und folgte ihnen in die Küche, wo Karl, Gottfried und Alwine zusammenrückten, damit alle Platz am Esstisch fanden. Lily stellte sich neben ihre Mutter, die dicke Scheiben von dem dunklen Brot abschnitt und diese auf einen großen Teller legte.
»Stell bitte Margarine und Rübensirup auf den Tisch«, bat Ida, während sie Teller und Tassen aus dem Hängeschrank nahm. Lily drückte sie deren Lieblingstasse in die Hand – die weiße mit dem Rosenmuster. Nachdem sie sich auf die Eckbank und Stühle verteilt hatten, goss Ida Kaffee ein und stellte das Brot auf den Tisch. Oma Bertha und Opa Willy rückten ein Stück zur Seite, so dass Lily sich setzen konnte. Lily goss etwas Milch in den Kaffee, verzichtete aus Sparsamkeit auf Zucker und trank einen Schluck. Die Wärme des Getränks tat ihr gut und der bittere Geschmack belebte sie.
»Wie konnten sie den Hitler nur zum Reichskanzler ernennen?« Oma Berthas Stimme zitterte etwas, als könnte sie selbst nicht glauben, was sie da sagte. Für Lily war Oma Bertha immer die »echte Oma« gewesen – eine große, kräftige Frau, die stets ein freundliches Wort für ihre Enkelin hatte und eine breite Schulter zum Ausweinen. Mit den Jahren war Bertha etwas kleiner und schmaler geworden, aber sie überragte ihren Ehemann Willy immer noch um einen halben Kopf.
»Es war nur eine Frage der Zeit, bis Hindenburg einknickt.« Lilys Mutter schüttelte den Kopf, und die braunen Locken fielen ihr ins Gesicht. Seitdem ihr Mann seine Arbeit verloren hatte, hatten sich mehr und mehr graue Strähnen in Idas Haar eingeschlichen. Kurzsichtig blinzelte sie in die Runde. Ihre Augen verschlechterten sich zunehmend durch die Näharbeiten bei schlechtem Licht.
»Und wir haben uns alle lustig gemacht über den Giftzwerg Goebbels«, sagte Opa Willy mit tonloser Stimme. »Als der letztes Jahr verkündete, dass Hitler Reichstagspräsident werden will.«
»Na, das konnte man doch damals nicht ernst nehmen«, antwortete Bertha. Sie und ihr Mann waren sich häufig uneinig, welche Richtung die Sozialdemokratie einschlagen sollte, aber sobald es um die Nationalsozialisten ging, waren sie einer Meinung. »Wir konnten die Hoffnung nicht aufgeben, dass das Parlament zur Vernunft kommt.«
»Da kommt einiges auf uns zu.« Lilys Opa wog bedächtig den Kopf von einer Seite zur anderen. Der zähe kleine Mann, der im Krieg 1917 einen Unterschenkel eingebüßt hatte, sagte selten etwas in den familiären Debatten. Wenn er einmal sprach, hörten ihm alle zu. Willy hatte in seinem Leben mehr erlebt, als die meisten von ihnen sich vorstellen konnten, dachte Lily oft. Sie mochte ihren Opa mit dem ovalen Gesicht, das tiefe Falten aufwies. Als Kind hatte sie sich vor ihm gefürchtet, weil er eine tiefbraune Haut hatte und riesige Ohren, die mit jedem Jahr größer zu werden schienen. Das markanteste Merkmal von Willy jedoch war die filterlose Zigarette, die er stets in der Hand hielt und mit der er auch jetzt die Luft verpestete.
»Kind, wenn du je rauchst, dann ohne Filter«, hatte der Opa zu Lily gesagt, als sie vierzehn Jahre alt geworden war. »Im Filter sammelt sich der ganze Dreck. Filterlos ist viel gesünder, allerdings auch ein Problem.« Lächelnd hatte er Lily seine Fingerkuppen gezeigt, die eine intensiv gelbbraune Färbung angenommen hatten.
»Was meinst du, Vater?«, fragte Gottfried. »Können wir das Steuer noch herumreißen?«
Bevor Willy antworten konnte, schellte es. Karl sprang auf und ging zur Tür. Die Familienmitglieder wechselten einen schnellen Blick – in letzter Zeit hatten Besuche nicht viel Gutes zu bedeuten gehabt. Kurz stand ein junger Mann, der verlegen seine Mütze zwischen den Händen drehte, in der Küchentür und wünschte ihnen einen guten Abend.
Ehe er ein weiteres Wort sagen konnte, tauchte der hochgewachsene Karl hinter ihm auf. »Es ist nur Georg.«
Nur Georg. Nicht sehr freundlich, aber zutreffend. Lily kannte Georg, solange sie denken konnte. Er hatte mit seinen Eltern und sieben Geschwistern zwei Häuser weiter gewohnt, bevor die Familie ihre Chance genutzt hatte und in eine der modernen Wohnungen gezogen war. Als Kinder hatten Lily und Karl häufig mit Georg und dessen Geschwistern gespielt. Georgs großer Bruder Richard hatte Lily das Fahrradfahren beigebracht und ihr gegen Kinder beigestanden, die sie als Streberin beschimpft hatten. Ihn vermisste sie von der Familie am meisten, da er inzwischen nicht mehr in Frankfurt wohnte, sondern sein Glück im Ruhrgebiet suchte.
Zu Lilys Überraschung war sie Georg vor drei Jahren auf einer Parteiveranstaltung wieder begegnet, und seitdem war er ein gerngesehener Gast bei ihnen. Oma Alwine pflegte ab und zu mit einem schelmischen Lächeln zu fragen, warum der Junge wohl ständig bei ihnen vorbeischaute, aber Lily wehrte diese Anspielungen stets ab. Georg und sie verband der gemeinsame Kampf um bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle Menschen sowie die Organisation des Widerstands gegen die immer mächtiger werdende NSDAP und deren Anhänger.
»Im Ostend gab’s wieder Schmierereien. ›Juden raus‹ und noch mehr übles Zeug«, sagte Georg. Als sein Blick dem von Lily begegnete, färbte Röte seinen Hals und er schaute schnell weg. »Wir wollen von der Eisernen Front eine Kundgebung abhalten. Seid ihr dabei?«
»Auf jeden Fall müssen wir auf die Straßen gehen.« Alwine schlug mit der Faust auf den Tisch. Georg zuckte zusammen, obwohl er das Temperament von Lilys Großmutter inzwischen kennen sollte, so oft, wie er zu Besuch kam. »In einem Land, wo der Hitler regiert, will ich nicht leben.«
»Wo willst du denn hin?« Willy schüttelte den Kopf. »Uns alte Bäume sollte man besser nicht mehr verpflanzen.«
»Nach Prag oder ins Saarland.« Alwine gab nicht nach. »Oder nach Schweden, so wie Katharina.«
»Wir müssen uns besser organisieren. Straffer. Bereit sein, in den Untergrund zu gehen.« Karl sprang auf. Lilys Bruder liebäugelte schon länger mit den Kommunisten, deren Organisation viel strikter war als die der Sozialdemokratie. »Jetzt können wir nicht weiter den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass alles gut wird.«
»Die Kommunisten werden auch nichts allein retten können«, wandte Gottfried ein. »Nur gemeinsam sind wir stark.«
»Gemeinsam! Gemeinsam!« Karl sprang auf. »Wer verweigert den Kommunisten denn die Unterstützung und Hilfe? Das sind eure feinen Freunde von der Sozialdemokratie.«
Mit großen Schritten stürmte er aus der Küche und in den Flur. Kurz danach hörten sie, wie er die Wohnungstür zuknallte. Wenn nicht einmal ihre Familie zusammenhalten konnte, wie sollte das im Parlament funktionieren, fragte sich Lily mit einem Schaudern.
Eine Gruppe von Männern jagt ein großes Säugetier, das den Spieß umdreht. Nur der Erzähler überlebt.
Kapitel 2
Berkeley, September 1999
»Es tut mir leid, Erin. Du weißt, ich wünsche dir alles Gute …«
Bevor er sagen kann »Lass uns Freunde bleiben«, lege ich auf. Unter Tränen. Tränen der Wut. Tränen der Trauer.
Wie oft habe ich mir geschworen, Jeffrey nie wieder anzurufen, ihn endgültig aus meinem Leben zu streichen? Aber vor drei Tagen wäre unser Hochzeitstag gewesen. Drei Tage habe ich durchgehalten, bis mich die Einsamkeit überfallen hat wie ein wildes Tier. Es hat mich gepackt und an mir gezerrt, bis ich es nicht mehr aushalten konnte. In dunklen Stunden wie diesen muss ich Jeffrey anrufen. Niemand sonst kennt mich so gut wie er. Niemand sonst kann verstehen, was ich empfinde. Niemand sonst ist mir je so nah gewesen und nun so unerreichbar.
Ruf ihn nicht an, ruf ihn nicht an, habe ich wie ein Mantra wiederholt, während ich ein zweites Glas Rotwein trank, aber dann habe ich doch die Nummer gewählt, habe atemlos gelauscht, bis ich endlich seine Stimme hörte. Seine angenehme, so vertraute Stimme, die so oft »Ich liebe dich« gesagt hat.
Die nie wieder »Ich liebe dich« zu mir sagen wird.
Mit zitternden Händen gieße ich mir ein drittes Glas Rotwein ein. Nicht, weil er mir besonders schmeckt, sondern weil ich hoffe, dass er mir hilft zu vergessen. Aber wie soll ich Jeffrey vergessen können, hier im gemeinsamen Haus, das ich in zwanzig Ehejahren zu einem Heim gemacht habe, wie ich es mir vorstelle. Ein Zuhause, warm und behaglich, ein Ort, an dem wir zusammen alt werden wollten. »In guten wie in schlechten Tagen, in Krankheit und Gesundheit«, das haben wir uns geschworen. Nun sitze ich hier und sehe nur Einsamkeit vor mir. An manchen Tagen gewöhne ich mich daran, an anderen Tagen, so wie heute Abend, fühlt sich die Einsamkeit besonders drückend an. Deshalb habe ich Jeffrey angerufen, obwohl ich es besser wissen sollte. Nach jedem Telefonat mit ihm beginnt meine Trauer erneut – ich– gehe nicht über Los, ziehe keine zweitausend Dollar ein. Seine neutrale Freundlichkeit schmerzt mehr, als wenn er mich anschreien würde.
Es kommt mir nicht vor, als ob bereits zehn Monate vergangen sind, seitdem er mich verlassen hat. Heißt es nicht, man trauert halb so lange um eine Ehe, wie sie gedauert hat?
Meine Hand greift erneut nach dem Telefon.
Nein.
Einmal ist genug.
Mehr als eine Demütigung am Tag kann ich nicht ertragen.
Ich muss mich ablenken.
Ich könnte fernsehen. Besser nicht. Womöglich bleibe ich an einem dieser Liebesfilme hängen, die, natürlich, mit dem großen Glück für alle Ewigkeit enden. Alles Lügen. Seitdem ich das vor drei Tagen zu meiner Freundin Charlotte gesagt habe, bin ich ihr neues Projekt. Wo sie nur die Energie hernimmt, sich um all die Streuner und Verlorenen zu kümmern? Dreibeinige Katzen, halbblinde Hunde und jetzt ich.
Charlotte habe ich vor zehn Jahren kennengelernt, als ich einen neuen Job suchte. Ich wollte meine langweilige Verwaltungsstelle an der Uni aufgeben und stellte mich in einer Buchhandlung vor. Charlotte war die Inhaberin und mir sofort sympathisch, auch meine Kolleginnen mochte ich auf Anhieb.
Charlotte ging es mit mir wohl ebenso, denn sie hat mir die Stelle gegeben.
Und ich habe noch mehr bekommen – eine beste Freundin, die sich um mich kümmert. Auch wenn wir uns wunderbar über Literatur streiten können. »Wenn du bei mir arbeitest, musst du dich auskennen. Nicht nur mit deinen heißgeliebten Europäern, sondern mit unseren amerikanischen Autoren ...« So beginnen unsere Geplänkel, seit wir uns kennen. Ich liebe vor allem die russischen und französischen Autoren. Charlotte behauptet, ich lasse die Propheten im eigenen Land nicht gelten. »Ich habe brav ein paar deiner geliebten Amerikaner gelesen«, erwidere ich dann. »Das reicht nicht«, entgegnet sie beharrlich. »Du musst den Kunden helfen können, die nicht wissen, wie das Buch heißt, das sie lesen wollen, wer der Autor ist oder worum es überhaupt geht.«
Bei jedem anderen wäre ich zornig geworden, aber Charlotte lasse ich alles durchgehen. Ohne sie wäre ich vollkommen zusammengebrochen, als Jeffrey mich im letzten November verließ. Neun Monate lebe ich nun schon allein – und es kommt mir vor, als wäre er erst vor neun Tagen gegangen.
Als ich vor drei Tagen zusammengebrochen bin, weil ich an unserem Hochzeitstag allein war, zog mich Charlotte in ihre Arme. »Ich habe eine Aufgabe für dich. Versprich mir, dass du jede Woche einen amerikanischen Roman liest.«
Glaubt Charlotte wirklich daran, dass amerikanische Literatur mir helfen könnte, über meinen Schmerz hinwegzukommen? Aber sie kennt mich zu gut. »Du wirst keinen der alten Schinken lesen«, sagte sie und grinste mich an. »Sondern Romane, die ich dir aussuche. Jede Woche bekommst du einen Hinweis und musst das Buch erraten und lesen. Innerhalb einer Woche. Wenn du früher fertig bist, umso besser.«
Mit Charlotte streitet man nicht, wenn sie so entschieden wirkt. Also habe ich mich seufzend dazu bereit erklärt, ein Buch pro Woche zu lesen. Vor drei Tagen gab sie mir den ersten Hinweis. Die Notiz kam in einem Briefumschlag. Eine Gruppe von Männern jagt ein großes Säugetier, das den Spieß umdreht. Nur der Erzähler überlebt. Glaubte sie wirklich, sie könnte mich damit hereinlegen? Natürlich wusste ich sofort, dass die Männer einen Wal jagen, der Hinweis war einfach zu deuten. »Lies es. Es hat viel mit dir zu tun«, sagte Charlotte, nachdem ich ihr die Lösung präsentiert hatte. »Und lies es bis zum Schluss.«
Moby Dick zu lesen ist gar nicht so einfach. Ich kenne den Film mit Gregory Peck, den ich gruselig und spannend finde, aber diese Spannung entdecke ich im Roman nicht wieder. Seitenweise lässt sich der Autor Herman Melville über Walfang aus. In viel zu vielen Details. In den letzten Tagen war ich schon ein paar Mal versucht, das Buch zur Seite zu legen und Charlotte gegenüber zu behaupten, dass ich es gelesen habe. Schließlich weiß ich dank Hollywood bereits, wie die Geschichte ausgeht.
Dennoch nehme ich das Buch widerstrebend in die Hand. Ich kuschele mich auf dem Sessel ein, den Jeffrey mir zu unserem fünfzehnten Hochzeitstag geschenkt hat, und lese an der Stelle weiter, an der ich gestern mit müden Augen aufgehört habe. Schon nach wenigen Seiten beginne ich zu gähnen.
Das Telefon klingelt.
Jeffrey! Ich springe sofort auf, um in den Flur zu laufen.
Vor Aufregung lasse ich das Buch fallen, verheddere mich in der Decke und stoße mir das Knie am Esstisch, als ich mich endlich von allem befreit habe. Bitte, bitte, lass ihn nicht auflegen, flehe ich. Bitte.
»Hier sind Erin und Jeffrey. Wir sind nicht zu Hause. Ihr wisst ja, wie das geht.«
Zu spät. Ein letzter Schritt, ich zerre den Telefonhörer von der Ladestation.
»Jeffrey?«, frage ich atemlos.
»Erin?«, antwortet die Stimme meiner Mutter.
Oh nein, sie hat mir gerade noch gefehlt.
»Hallo Mom«, sage ich und sende ein stummes Stoßgebet, dass sie nicht nachfragt, warum ich sie Jeffrey genannt habe. »Ist etwas passiert?«
Konsterniertes Schweigen am anderen Ende der Telefonleitung.
»Kann ich nicht bei dir anrufen, ohne dass etwas Schlimmes geschehen sein muss?«
»Es tut mir leid.« Wirklich. Mit der linken Hand reibe ich das schmerzende Knie, während ich nach einer passenden Entschuldigung suche. »Es war ein harter Tag.«
»Geht es dir besser?«
»Ja. So langsam. Es war … ziemlich überraschend.«
Die Untertreibung des Jahrhunderts. Aber ich möchte nicht mit meiner Mutter über meinen Exmann reden. Sie war von Anfang an der Auffassung, dass etwas mit Jeffrey nicht stimmte. Statt meine zwanzig guten Ehejahre mit ihm in die Waagschale zu werfen, denkt sie wahrscheinlich nur daran, dass ihre Prognose sich als richtig erwiesen hat.
»Wie geht es Kyle?« Gleich wird sie mit der üblichen Tirade beginnen, die auf die zunächst harmlose Frage folgt. »Ich finde es nicht richtig, dass dein Sohn allein durch Europa reist.«
»Ach, Mom.« Ich verkneife mir ein Seufzen. Zu oft haben wir diese Diskussion geführt. Meine Mutter ist der Überzeugung, dass es ein großer Fehler war, Kyle zu erlauben, in Spanien zu studieren. Beinahe so groß wie mein Fehler, Jeffrey geheiratet zu haben. »Kyle ist glücklich mit seinem Architekturstudium und seine Noten sind traumhaft.«
Und in Barcelona bekommt er nur am Rande mit, was sich hier in Berkeley abspielt. Wie sehr ich unter der Trennung leide. Wie einsam ich trotz Charlottes Bemühungen bin. Wie sehr ich mich aufgegeben habe. Wenn ich mit meinem Sohn telefoniere, bemühe ich mich darum, gelassen und zufrieden zu wirken. Kyle hat Jeffreys und meine Trennung besser aufgenommen, als ich erwartet habe.
Wahrscheinlich, weil er sein eigenes Leben lebt. Ein Leben, das sich um Architektur, neue Freunde und bestimmt auch Mädchen dreht, auch wenn er mir davon nie etwas erzählt. Ein Leben, in dem ich nur eine Nebenrolle spiele. Ich muss meinem Sohn zugutehalten, dass er nach Berkeley zurückkehren wollte, als er erfuhr, dass sein Vater mich verlassen hat. Aber ich habe abgelehnt. Ich wollte keine dieser Frauen werden, die ihr Kind als Waffe in dem Trennungskrieg benutzt.
»Erin?« Meine Mutter klingt irritiert. Wahrscheinlich hat sie mir etwas Wichtiges sagen wollen und meine Gedanken waren ganz woanders. »Erin. Hörst du mir zu?«
»Entschuldige, Mom.« Wenn ich nicht aufpasse, kommt sie noch auf die Idee, mich zu besuchen, um mir zur Seite zu stehen. Nicht, weil es ihr ein wirkliches Bedürfnis ist, sondern weil es sich so gehört. Mütter haben für ihre Kinder da zu sein, vor allem in Krisensituationen. »Ich habe an Kyle gedacht. Was hast du gesagt?«
»Dein Vater und ich wollen das Haus verkaufen.«
»Nein!«, platze ich heraus. Nicht das auch noch. Mein Sohn studiert in Spanien, mein Mann lebt mit seiner großen Liebe zusammen, und nun wird das Haus meiner Kindheit verkauft. »Das könnt ihr nicht machen!«
»Es ist viel zu groß für uns beide.« Bestimmt war es ihre Idee, das Haus aufzugeben, um sich in einer Seniorenresidenz einzuquartieren. Dad würde niemals unser Heim verkaufen. »Seit dem Herzinfarkt kann dein Vater kaum noch im Garten arbeiten.«
»Ihr könntet einen Gärtner einstellen«, schlage ich vor. Die Vorstellung, nie wieder in mein altes Zimmer zurückkehren zu können, bringt die Tränen zurück, die ich mühsam niedergerungen habe. »Ich zahle etwas dazu.«
»Ach, Erin.« Diesen Tonfall kenne ich nur zu gut. »Woher willst du das Geld nehmen?«
In dem Moment erkenne ich, was meine Mutter vor mir verbergen will.
»Ihr habt das Haus schon verkauft.«
Schweigen am anderen Ende. Schweigen, das mir ein Schuldgefühl vermitteln soll, obwohl meine Mutter sich schuldig fühlen müsste.
»Warum rufst du überhaupt an, wenn schon alles entschieden ist? Wann zieht ihr aus?« Wie gepresst kommen die Worte aus meinem Mund. Ich kann es nicht fassen, was sie getan haben.
»In zwei Wochen kommt eine Firma, die uns beim Entrümpeln hilft. Dein Vater und ich dachten, dass du vorher gern deine Sachen aussortieren würdest.«
»In zwei Wochen?« Meine Kehle fühlt sich trocken an. Meine Augen brennen. »Ich … ich habe einen Job. Ich kann da nicht einfach weg.«
Meine Eltern wohnen immerhin in Oregon, ich kann nicht einfach mir nichts, dir nichts dorthin fahren. Charlotte setzt darauf, dass ich ihr im Buchladen helfe.
»Dann packen dein Vater und ich die wichtigsten Dinge für dich zusammen und schicken sie dir.«
Die Vorstellung, dass meine Eltern in meinen alten Sachen wühlen und entscheiden, was für mich wichtig ist, lässt mir die Haare zu Berge stehen. Auf gar keinen Fall will ich, dass Mom meine Tagebücher oder Liebesbriefe entdeckt.
»Nicht so eilig. Ich spreche morgen mit Charlotte und rufe dich dann an.«
»Grüß sie von uns.«
»Danke, Mom. Grüß Dad.«
»Bis morgen.«
Noch lange nachdem ich den Hörer wieder auf die Ladestation gelegt habe, verfolgt mich nur ein Gedanke: Kann es noch schlimmer kommen?
Ein armer Mann verliebt sich in ein reiches Mädchen und erfindet sich selbst als Millionär neu. Aber sie ist verheiratet. Kein Happy End für beide.
Kapitel 3
Berkeley, September 1999
Ich erwache mit schmerzendem Rücken und blinzele in die Sonne, die mir ins Gesicht scheint. Nachdem ich die Flasche Rotwein geleert hatte, bin ich über den letzten Seiten von Moby Dick im Sessel eingeschlafen. Mein Mund fühlt sich trocken und gleichzeitig pelzig an. Zum Glück habe ich den Wecker gestellt, sonst hätte ich die Mittagsschicht in der Buchhandling mit Sicherheit verschlafen. Charlotte wäre mir wahrscheinlich nicht böse, aber der sorgenvolle Blick, den ich von ihr bekäme, wäre mehr, als ich ertragen könnte.
Unter der Dusche schlägt mir der moralische Kater seine Krallen in die Seite. Einer der Gründe, warum ich mich selten betrinke. Nach ein paar Gläsern Wein geht es mir am nächsten Morgen körperlich schlecht, was noch zu verkraften wäre. Schlimmer noch fühlt sich das schlechte Gewissen an, das ich »moralischer Kater« getauft habe. Das Gefühl, etwas Dummes angestellt zu haben, so wie ein Anruf beim Exmann. Schnell drehe ich das warme Wasser auf, aber meine Gedanken bleiben bitter.
Ich werde nie wieder glücklich sein.
Mein Leben wird eine Aneinanderreihung trister Tage werden.
Ich bin selbst schuld daran, dass mein Mann mich verlassen hat.
Man sagt, die Trauer über das Ende einer Ehe dauert etwa halb so lange wie die Beziehung – da kommen noch schlimme Jahre auf mich zu.
Mit geschlossenen Augen lehne ich den Kopf an die Wand der Dusche, überlege, einfach hier stehen zu bleiben. Tagelang. Aber nein, dafür bin ich zu diszipliniert. Ich weiß, dass Charlotte auf mich wartet. Also stelle ich das Wasser ab, putze mir die Zähne und ziehe mich an. Wahllos greife ich in den Schrank, nehme das erstbeste Kleidungsstück, das mir in die Hände fällt.
Seitdem Jeffrey mich verlassen hat, habe ich etliche Kilogramm abgenommen. Etwas, das ich früher mit Freudentänzen gefeiert hätte. Heute ist es mir egal. Ich müsste mir neue Kleidung kaufen, mindestens eine Größe kleiner, aber allein die Vorstellung, etwas auswählen und mich entscheiden zu müssen, erschöpft mich. Lieber ziehe ich den Gürtel enger und akzeptiere, dass die Hose um meine Beine schlackert und tief unter meinem Hintern hängt. Es interessiert ohnehin niemanden, wie ich aussehe.
In düsterer Stimmung schmiere ich mir ein Frühstücksbrot – Erdnussbutter mit Johannisbeermarmelade, aber nicht einmal die würzige Süße kann meine Stimmung aufheitern. Einen Kaffee kaufe ich mir auf dem Weg zu Charlottes Buchladen. Meine Kaffeemaschine hat vor drei Wochen ihren Geist aufgegeben und bisher habe ich nicht die Kraft gefunden, eine neue anzuschaffen. Die Vorstellung, in einem Geschäft zwischen Dutzenden von Modellen wählen zu müssen, Entscheidungen darüber zu treffen, ob die Maschine auch Espresso und Cappuccino herstellen soll, ob sie selbstreinigend ist oder gewartet werden muss – all das ist mir zu viel. Da kaufe ich mir lieber jeden Morgen einen Coffee to go und unterstütze die lokale Wirtschaft.
An manchen Tagen genieße ich es, die Telegraph Avenue entlangzuschlendern, die grellen Farben an den Straßenständen in mich aufzunehmen, die Fröhlichkeit der Straßenhändler, das Gewimmel von Touristen und Studenten zu beobachten. An Tagen wie heute kann ich den Anblick der jungen Menschen, die ihr Leben noch vor sich haben, kaum ertragen, den von engumschlungenen Paaren schon gar nicht. »Noch glaubst du, dass er es ehrlich meint und für immer bei dir bleiben wird«, möchte ich dem hübschen Mädchen im Batikkleid am liebsten entgegenschleudern, das sich an ihren Freund schmiegt. »Aber er wird dich für jemand anderen verlassen. Und du wirst allein bleiben. Alt und einsam.«
Es ist kühl für Ende September. Ich ziehe meine viel zu dünne Jacke enger um mich, aber das Frösteln will nicht vergehen. Wer wird sich um mich kümmern, wenn ich einmal krank bin? In meinem Hinterkopf antwortet eine Stimme: »Charlotte oder Helen oder Amy«, aber ich will nicht auf sie hören, will mein Selbstmitleid zur Neige auskosten. Sosehr ich meine Freundinnen liebe, sosehr trauere ich meinem alten Leben nach. Meinem perfekten Leben.
Seitdem ich ein kleines Mädchen war, habe ich mir meine Zukunft in einer Zweiheit ausgemalt. Als meine Mutter mir Eisenbahnen und Autos schenkte, quengelte ich so lange, bis ich eine Barbie bekam. Doch bald war ich es satt, Barbie mit unterschiedlichen Kostümen auszustatten und sie zum Shopping zu schicken. Oder ins Büro – darauf bestand meine Mutter. Wieder quengelte ich, bis ich endlich das bekam, was Barbie in meinen Augen erst komplettierte – Ken. Stundenlang konnte ich mich damit beschäftigen, mir ein glückliches Leben für Barbie und Ken auszumalen. Von ihrem ersten Date über die Zeit der Verlobung bis hin zur rauschenden Hochzeitsfeier. Viele Kinder bekamen Barbie und Ken in meiner Phantasiewelt und lebten glücklich und zufrieden im Kreis ihrer wachsenden Familie.
Dieser Kindheitstraum hat mich nie losgelassen. Alles, was geschah – Schulabschluss, Studium, Job –, waren für mich nur Stationen auf dem Weg zum Glück, zu meiner Bestimmung, zu meinem Ken. Und das Leben meinte es gut mit mir. In meinem zweiten Semester an der Uni traf ich Jeffrey, dessen Idaho-geprägte Blondheit so gar nichts mit dem dunkelhaarigen Ken gemeinsam hatte. Bereits nach dem zweiten Date wusste ich, dass Jeffrey der Richtige, der Eine für mich war. Wir mochten dieselben Bücher, dieselben Filme, lachten über dieselben Komiker und engagierten uns politisch für dieselben Zwecke. Jeffrey wünschte sich viele Kinder, ich mir auch. Jeffrey wollte nicht zurück nach Idaho, ich nicht zurück nach Oregon. Wir beide liebten die Sonne Kaliforniens, die bunten Farben Berkeleys und das Meer direkt vor der Haustür.
Nachdem Jeffrey mir einen Heiratsantrag gemacht hatte, glaubte ich mich am Ziel meiner Wünsche. Der erste Rückschlag kam, als die Ärzte mir nach Kyles Geburt mitteilten, dass ich keine weiteren Kinder bekommen könnte. Daher widmete ich unserem Sohn meine ganze Aufmerksamkeit, sorgte mich ständig, dass ihm etwas passierte. War das der Moment, in dem wir begannen, uns auseinanderzuleben? Waren wir da nicht mehr Erin und Jeffrey, sondern Erin und Kyle, Jeffrey und Kyle?
Nach außen hin lief alles glatt. Jeffrey bekam eine Festanstellung an der Universität, ich arbeitete halbtags dort, allerdings nicht im wissenschaftlichen Dienst, sondern in der Verwaltung. Doch sobald Charlotte mir die Chance bot, Bücher zu verkaufen, ließ ich die sichere Universitätsstelle sausen und arbeitete das, was mir Spaß machte, auch wenn es weniger Geld einbrachte. Aber das machte ja nichts. Mein Leben, mein Lebensstandard hing davon ab, was Jeffrey verdiente.
Ich muss aufhören, über diese Dinge nachzudenken. Ich muss aufhören, mich in meiner Einsamkeit zu suhlen. Wenn ich Katzen mögen würde, könnte ich mir eine anschaffen, aber Katzen erinnern mich an meinen Großvater, dem die Stubentiger wichtiger waren als wir Enkel.
Weil ich so tief in meinen Gedanken versunken bin, habe ich nicht aufgepasst und bin falsch abgebogen, bin den kurzen Weg gegangen und nicht den längeren, den ich bevorzuge. Ich versuche, dem kürzeren Weg durch die Telegraph Avenue auszuweichen, weil er mich an der Stelle vorbeiführt, wo früher das Café Intermezzo eine bunte Gesellschaft von Studenten, Professoren, Universitätsbeschäftigten und Touristen angezogen hat. Im November 1998 zerstörte ein Feuer das Gebäude und nahm Berkeley damit eines seiner traditionsreichsten Cafés. Mit vielen anderen zog ich einen Tag später zur Brandstätte, um mich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, dass es das Restaurant nicht mehr gab. Dass das Café, in dem Jeffrey und ich so viel Zeit verbracht hatten, abgebrannt war, erschien mir als Ironie des Schicksals, hatte Jeffrey doch drei Tage zuvor verkündet, dass er mich verlassen wollte. Im November, mitten in den selbst in Kalifornien grauen Tagen. In der Vorweihnachtszeit. Dass er nicht bis zum neuen Jahr warten konnte, werfe ich ihm immer noch vor. »Ich konnte nicht mehr warten, Erin«, hatte er gesagt und mich dabei gequält angesehen. Mein Mitleid hielt sich in Grenzen. Schließlich hat er mich verlassen und nicht ich ihn.
Noch immer schmerzt es, wenn ich hier entlanggehe. Jedes Mal, wenn ich am Brandort vorbeikomme, werde ich an den verhängnisvollen Nachmittag erinnert. In meinen Augen verbindet sich das Ende des Cafés mit dem Ende unserer Ehe, so dass ich alle Bemühungen der Stadt Berkeley, das Intermezzo an anderer Stelle wiederaufzubauen, mit Argusaugen beobachte. Für mich ist das Café zu einem Omen geworden: Wenn es der Stadt oder den Eigentümern gelingt, das Intermezzo aufleben zu lassen, dann wird mein Leben wieder gut werden.
Endlich habe ich Books Charlotte loves erreicht. Schmal und unauffällig liegt die kleine Buchhandlung zwischen einem indischen Restaurant und einem Geschäft, das Tees und Kräuter verkauft, was in Charlottes Laden spürbar ist. Mal überwiegt der Duft indischer Gewürze, mal der von ökologisch angebauten Kräutern – das gibt Books Charlotte loves etwas Besonderes. Obwohl es dort an sich schon speziell ist. Klein, chaotisch, mit Büchern, die alle nur denkbaren Flächen belegen: Regale, Fensterbänke, selbst die linke Hälfte der Treppenstufen ist mit Büchern bedeckt. Nicht mit den gängigen Romanen und Bestsellern, wie man sie überall findet, sondern einer lebendigen Mischung aus unterschiedlichsten Genres und Zeiten, eben all den Büchern, die meine Freundin Charlotte liebt. Sie will niemanden missionieren, aber sie sagt, dass sie nur etwas verkaufen kann, das ihr am Herzen liegt. Das ist auch die wichtigste Voraussetzung, um bei ihr einen Job zu bekommen: Man muss Bücher lieben. Kein Wunder, dass ich dafür die Unistelle aufgab. Damals ahnte ich allerdings noch nicht, dass ich einmal von meinem Einkommen leben müsste.
Bevor mich düstere Gedanken nach unten ziehen, stoße ich die Tür weit auf und atme tief ein. Mittags gewinnt jeden Tag das indische Restaurant. Obwohl ich gefrühstückt habe, meldet sich mein Magen. Die Gerüche nach Curry, Masala und Vindalho sind einfach zu verführerisch.
Charlotte steht mit dem Rücken zum Eingang, den Kopf gesenkt, als würde sie lesen. Ihre Silhouette und ihre Farben sind unverkennbar. Selbst wenn es mir schlecht geht, sobald ich meine Freundin sehe, fühle ich mich besser. Sie hat diese Wirkung auf Menschen im Allgemeinen, nicht nur auf mich im Besonderen. Vielleicht, weil sie hochgewachsen und rundlich ist, weil sie an freundliche Kindergärtnerinnen erinnert, an die man sich ankuscheln konnte, wenn man sich das Knie angeschlagen hatte. Vielleicht, weil sie sich in leuchtende Farben kleidet, die an einen Sommertag voller Liebe erinnern. Vielleicht, weil sie für jeden ein Lächeln und ein freundliches Wort hat, selbst wenn die Kunden mit den seltsamsten Fragen kommen.
»Guten Morgen«, begrüße ich sie. »Moby Dick ordnungsgemäß beendet. Was das allerdings mit mir zu tun hat, ist mir schleierhaft.«
»Ahab war besessen von etwas, das ihn ins Unglück stürzen würde. Er hat dem weißen Wal alles geopfert. Seine Ehe, seine Lebensfreude, sein Boot, seine Mannschaft und schließlich sein Leben.«
»So also siehst du mich.« Ich beiße mir auf die Unterlippe, weil ich nicht weinen will. »In deinen Augen bin ich neurotisch und folge einem sinnlosen Ziel. «
Charlotte mustert mich schweigend. Ich starre zurück, wobei ich noch immer gegen Tränen ankämpfe.
»Ich halte dich nicht für neurotisch«, sagt Charlotte schließlich. Sanft und gelassen, als spräche sie zu einem ihrer Findeltiere, das beruhigt werden muss. »Du bist nur in der ersten Trauerphase steckengeblieben…«
»Komm mir jetzt bitte nicht damit«, unterbreche ich sie harsch. Du kannst nicht in Berkeley leben, ohne an jeder dritten Ecke über Flyer oder Werbezettel zu stolpern, die Seminare und Workshops zur Trauerbewältigung oder zum Umgang mit Trennungen anbieten. Aber so verzweifelt bin ich nicht, dass ich mich in eine dieser Gruppen begeben würde.
»Erin!« Ich schrecke auf. So schroff hat Charlotte noch nie mit mir gesprochen. »Erin. Seit Wochen und Monaten höre ich mir an, wie sehr du darauf hoffst, dass Jeffrey sich besinnt. Du verdrängst nur.«
»Und Moby Dick soll mir helfen«, entgegne ich, schärfer als geplant. Aber ich mag mir einfach keine guten Ratschläge mehr anhören. Vor allem nicht von meiner Freundin, deren Männerbeziehungen in der Regel eine Nacht nicht überlebten. »Was kommt als Nächstes? Jack London? Nathaniel Hawthorne? Oder Pearl S. Buck? Frauen, die zu sehr lieben?«
»Das hier.« Wieder drückt mir Charlotte einen Umschlag in die Hand. Dieses Mal ist er rosafarben, mit einem bunten Regenbogen, der sich quer über das Papier zieht. Hell und fröhlich – genau das Gegenteil von meiner Stimmung. »Finde heraus, was es ist, und lies es.«
»Charlotte!« Meine Stimme klingt so laut, dass die beiden Frauen, die in Büchern blättern und bestimmt keines davon kaufen werden, erschrocken aufschauen. Sofort mäßige ich mich. »Es ist ja nett, dass ich dein neues Projekt bin, aber ich habe verstanden, was du mir sagen wolltest. Moby Dick hat mir die Augen geöffnet.«
»Nimm es und lies es.« Immer noch hält sie den Umschlag in der Hand. Immer noch weigere ich mich, meine Hand auszustrecken. »Du bist kein Projekt für mich. Du bist meine beste Freundin und ich kann es nicht ertragen, dich leiden zu sehen.«
Schlagartig bricht mein Widerstand zusammen. Ich nehme den Briefumschlag und öffne ihn. Auch diesen Roman erkenne ich auf Anhieb.
»Der große Gatsby. Sag mal, willst du mich endgültig in eine Depression treiben?«, frage ich halb im Scherz.«
»Wer sagt, dass dich ein Buch glücklich machen soll?«, widerspricht Charlotte. »Im besten Fall hilft es dir, mehr über dich selbst zu erfahren oder dich an etwas zu erinnern, was du schon viel zu lange vergessen hast.«
»Warum Gatsby?«, frage ich. »Weil er unglücklich liebt?«
»Weil er die Vergangenheit zurückholen will, obwohl er es besser weiß. Niemand kann das so gut beschreiben wie F. Scott Fitzgerald.«
Das also denkt meine beste Freundin von mir. Warum nur fürchte ich, dass sie recht behalten könnte?
Nach außen hin wirkt sie erfolgreich und beneidenswert, doch in ihrem Innern plagen sie Zweifel. Die Protagonistin scheitert an ihrer Unfähigkeit, eine Entscheidung zu treffen.
Kapitel 4
Berkeley und Salem, September 1999
Als ich eine Woche später zu Books Charlotte loves komme, um Tschüs zu sagen, bevor ich zu meinen Eltern fahre, herrscht gedrückte Stimmung. So niedergeschlagen habe ich meine Freundin noch nie gesehen: Charlotte wirkt düster, selbst das kräftige Grün ihres Pullovers, das sich mit dem leuchtenden Orange ihrer Hose beißt, wirkt blasser als sonst, beinahe ausgewaschen. Sarah, meine Lieblingskollegin, steht hinter der Kasse und hat rote Augen, als hätte sie geweint. Sie nickt mir zu und kämpft sichtlich mit den Tränen. Ist jemand gestorben, den wir alle kennen und der uns viel bedeutet?
Im Kopf gehe ich unsere Freunde durch – von einigen habe ich lange nichts mehr gehört, was nicht ihre Schuld ist, sondern meine, da ich mich nach Jeffreys Weggang in meinem Schneckenhaus versteckt habe. Schlagartig überfällt mich das schlechte Gewissen, verbunden mit dem festen Vorsatz, mich demnächst durch mein Adressbuch zu mailen oder zu telefonieren.
»Was ist passiert?«, frage ich, noch bevor ich die Jacke ausgezogen habe.
»Nicht hier«, antwortet Charlotte und zieht mich nach hinten in die winzige Kaffeeküche. Auch hier stapeln sich Bücher, die vorn im Laden keinen Platz mehr gefunden haben. Da wir Bücher lieben, kann Charlotte sich darauf verlassen, dass niemand von uns es wagen würde, Kaffee auf die Bücher zu gießen und sei es nur aus Versehen.
»Ist … ist jemand gestorben?« Aus Angst vor ihrer Antwort halte ich den Atem an. Lass es nicht Ben sein oder Karen, bete ich stumm. »Sag schon.«
»Nein. Noch nicht.« Charlotte sarkastisch zu erleben, ist eine Neuerung für mich – keine positive. »Ich war heute bei der Bank.«
Ja, ich weiß, Books Charlotte loves läuft nicht mehr so gut wie noch vor fünf Jahren. Die große Kette, die zwei Straßen weiter eine Filiale eröffnet hat, und das Internet haben uns viele Kunden geraubt. Aber wie schlimm es steht, war mir bis heute nicht klar.
»Kannst du den Buchladen nicht mehr halten …?«, frage ich, kurz vor der Panik. Mein Job hier und meine Freundschaft zu Charlotte sind die einzigen Konstanten in meinem Leben. Nicht auszudenken, wenn ich mir eine neue Stelle suchen muss. Wer stellt eine über Vierzigjährige ein, die einen Abschluss in Literaturwissenschaft und einige Jahre Erfahrung im Buchhandel aufweist? »Kann ich dir irgendwie helfen?«
»Hast du zufällig zweihunderttausend Dollar zur Hand?« Charlotte wartet nicht auf meine Antwort, sondern wendet mir den Rücken zu, um Kaffee zu kochen. Aber den Klang ihres Weinens kann sie nicht verstecken.
Vorsichtig trete ich neben sie und nehme sie in den Arm, halte sie fest. Meine starke Charlotte, die sonst immer mich getröstet hat. Wie schlimm muss es um den Buchladen stehen, dass sie derart verzweifelt ist?
»Ich habe ein bisschen Geld von meinem Großvater geerbt«, sage ich. »Ungefähr dreißigtausend Dollar. Die gebe ich dir gern.«
Charlotte löst sich aus meinen Armen. »Danke. Aber das reicht nicht einmal, um die gröbsten Löcher zu stopfen.« Sie füllt den fertigen Cappuccino in zwei Tassen, reicht mir eine und trinkt selbst einen Schluck. »Ich hätte doch besser ein Café eröffnen sollen. So was läuft immer. Essen müssen alle, lesen viel zu wenige.«
»Ich bin eben am Intermezzo vorbeigekommen«, sage ich, um das Thema zu wechseln, weil ich mich hilflos fühle. »Es sieht nicht so aus, als ob sie in den nächsten Monaten aufmachen werden. Deine Chance.«
»Du weißt doch, wie gut ich koche.« Nun lächelt Charlotte wieder. Etwas schief und nicht hundertprozentig überzeugend, aber besser als eben ist es auf jeden Fall. »Außerdem bin ich nicht kreditwürdig, wie mir die Bank vorhin mitgeteilt hat.«
»Das kann nicht sein. Wie lange bist du schon Kundin dort?«
»Mein ganzes Leben. Aber das zählt heutzutage nichts mehr. Heute geht es nur um Zahlen und Ratings.«
»Was hältst du von einer Sammelaktion oder so was wie Aktien oder Rabatte oder …?« Es muss doch irgendetwas geben, um Books Charlotte loves zu retten. Schnell gehe ich im Kopf Freunde und Familie durch, aber niemand, den ich kenne, hat so viel Geld, wie Charlotte benötigt. »Ich sage den Besuch bei meinen Eltern ab und bleibe hier.«
»Nein.« Charlotte schüttelt ihren Kopf so heftig, dass Cappuccino auf eins der Bücher tropft. Wir sehen uns erschrocken an, um dann gemeinsam in Lachen auszubrechen. »Nein. Fahr ruhig. So schnell gebe ich nicht auf.«
»Kann ich dich wirklich allein lassen?« Es würde mir nicht schwerfallen, den Besuch bei meinen Eltern zugunsten meiner Freundin aufzuschieben. »Bist du sicher?«
»Ja, natürlich. Ich bin nur tief enttäuscht von der Bank. Selber verschleudern sie Millionen, aber wenn ich Hilfe brauche …«
»Also gut. Aber wenn etwas ist, ruf mich auf jeden Fall an. Du warst immer für mich da.« Ich umarme sie zum Abschied, sage schnell Tschüs zu Sarah und will mich auf den Weg zum Bahnhof machen, als Charlotte mich zurückruft. Dieses Mal ist der Briefumschlag schlichtweiß.
»Ich hab’s nicht vergessen«, sagt sie.
»Ich hab’s befürchtet«, antworte ich. Meine Kehle fühlt sich zugeschnürt an, als ich sehe, dass Charlotte mit den Tränen kämpft. »Ich bleibe.«
»Nein, verschwinde. Morgen Abend will ich die Lösung wissen.«
***
Nach langem Überlegen habe ich mich dazu entschlossen, die knapp sechshundert Meilen bis zu meiner Familie in Salem mit dem Zug zu fahren. Fliegen erscheint mir zu aufwändig und die Autofahrt ist mir zu lang. Ich fahre nicht gern Auto, und eine Fahrtzeit von fast neun Stunden bedeutet, dass ich für Tage erschöpft bin. Also lieber Amtrak nutzen, auch wenn die Zugfahrt sechzehn Stunden dauert und ich in Martinez umsteigen muss. Obwohl ich auf mein Geld achte, seitdem Jeffrey mich verlassen hat, habe ich mich für einen Schlafwagen entschieden. Ich fühle mich inzwischen zu alt, um auf dem Sitz zu schlafen, bei jeder Kurve in Gefahr, meinem Sitznachbarn näher zu kommen, als mir – und wohl auch ihm oder ihr – lieb ist.
Den Titel des neuen Buches, das Charlotte mir für die Reise zu meinen Eltern aufgegeben hat, habe ich sofort erkannt, worauf ich stolz bin. Schließlich gehörten Frauenstudien zu meinem Curriculum und da kam man nicht an Sylvia Plath vorbei. Will meine Freundin mir sagen, dass ich mich unter einer Glasglocke verkrochen habe? Oder soll der Roman eine Anspielung auf Fremdheit in der Familie sein? Wahrscheinlich will Charlotte nur, dass ich mir diese Fragen stelle und mich von Jeffrey ablenke. Damit hat sie Erfolg. Woher bekomme ich ein Exemplar des Romans? Ob noch eins in meinem alten Zimmer liegt, das bald nicht mehr meins sein wird?
Damit meine Gedanken schweigen, nehme ich eine Schlaftablette, die mich kurz darauf gähnen lässt. Ich stelle den Wecker, putze mir die Zähne und lege mich hin. Bald spüre ich die dumpfe Müdigkeit, die mit den Tabletten einhergeht, und umarme sie.
Der Zug ist pünktlich; ich fühle mich ausgeschlafen und bin bereit, dieses Wochenende bei und mit meinen Eltern durchzustehen. Sie erwarten mich am Bahnhof. Mein hochgewachsener Vater zieht mich in eine bärige Umarmung und drückt mich, meine Mutter steht daneben und nestelt verlegen an ihrer Handtasche. Wir beide umarmen uns so flüchtig, dass ich ihre Berührung kaum spüre. Auf der Fahrt erzähle ich ihnen von Charlottes Dilemma und sie mir von der Seniorenresidenz, in die sie sich eingekauft haben.
Nachdem wir angekommen sind, spüre ich Beklommenheit, wenn ich das Haus ansehe, das ich heute das letzte Mal betreten werde. Meine Kindheit und Jugend habe ich hier verbracht. Obwohl ich meine Eltern selten besuche, habe ich diesen Ort immer als mein Zuhause betrachtet.
»Kommst du?«, fragt Dad, der meine Stimmung spürt.
Ich kann nur nicken.
Als ich zur Haustür hereintrete, schießt ein graues Schemen hinter der Tür hervor, springt gegen mein Bein, schlägt Krallen in meinen Unterschenkel, stößt sich ab und galoppiert mit hochgerecktem Schwanz davon.
»Sie lebt also immer noch«, sage ich und versuche nicht einmal, Ärger und Abscheu in meiner Stimme zu verbergen. »Wie alt ist Beauty? Hundert? Hättet ihr sie nicht einsperren können, solange ich hier bin?«
»Es ist doch nur ein Tier«, antwortet meine Mutter, mit dem üblichen leichten Vorwurf in der Stimme. »Zwei Tage wirst du es mit ihr aushalten können, oder?«
Ich mag Tiere, alle, selbst Spinnen setze ich vorsichtig in die Freiheit, aber diese Katze und ich kommen einfach nicht miteinander aus. Von Anfang an nicht. Schon als sie noch bei meinem Großvater lebte, war es dem graugetigerten Biest ein Vergnügen, mich zu jagen und zu verletzen. Ihre Tochter Snow ist nicht viel besser.
»Snow hat gerade Junge bekommen. Wirklich niedliche Babys«, erzählt mein Vater. Warum meine Mom eine graugetigerte Katze Snow White nannte, habe ich nie verstanden. Genauso wenig wie ich begreifen konnte, dass Großvater Snows Mutter, das hässliche Katzenviech, Beauty taufte. Leicht drückt Dad meinen Arm, als wollte er mich beruhigen. »Wir können sie uns später ansehen. Jetzt komm erst einmal in Ruhe an.«
»In einer Stunde gibt es Essen«, ergänzt meine Mutter. »Vegetarisch. Oder isst du jetzt wieder normal?«
»Vegetarisch ist wunderbar, danke.«
Warum nur fühlt sich ihre Frage an wie ein Vorwurf, als müsste ich mich dafür entschuldigen, dass ich kein Fleisch esse? Bevor ich einen Streit anfange, flüchte ich in mein Zimmer, begleitet von dem Gefühl, beobachtet zu werden. Zu Recht. Auf dem Schrank im Flur sitzt Snow, die mich anfaucht, als ich an ihr vorbeigehe. Was für eine wundervolle Begrüßung.
Gerade habe ich die Tür meines Kinderzimmers hinter mir geschlossen, als sie sich wieder öffnet.
Meine Mutter. Es erstaunt mich immer wieder, wie ähnlich wir uns sehen und wie wenig wir ansonsten gemeinsam haben. Wir teilen das hellbraune, feine Haar, das viel zu dünn ist, um mehr als schulterlang getragen zu werden. Genau wie sie habe ich grünbraune Augen unter dunklen Brauen. Sie allerdings lässt ihre zu einer dünnen Linie zupfen, ich lasse meine wachsen. Seitdem ich abgenommen habe, ist meine Figur beinahe wie ihre. Vorher wirkte ich mehr wie mein Vater – stabil und durch nichts umzuwerfen. Meine Mutter hingegen gleicht in ihrer zierlichen Zartheit einer Elfe, die ein lautes Wort allein umpusten könnte. Nichts täuscht mehr als dieser Eindruck. Denn meine Mutter ist zäher und stärker als mein Vater und ich zusammen.
»Hier.« Sie reicht mir einen Stapel Kisten und einige Müllsäcke. »Bis zum Essen kannst du ja schon anfangen, etwas auszusortieren.«
»Danke«, stoße ich zwischen den Zähnen hervor. Warum nur muss sie immer so organisiert sein? Warum kann sie mir nicht einmal eine Stunde Pause gönnen, damit ich mich von meinem Zimmer und meinem Leben verabschieden kann? »Hat das nicht noch etwas …«
Als hätte er unseren aufkommenden Streit gespürt, tritt mein Vater neben meine Mutter.
»Erin«, unterbricht er mich. »Komm in die Garage, ich muss dir etwas zeigen, das ich dort gefunden habe.«
Obwohl ich weiß, dass er mich nur von dem Streit abhalten will, der sowieso kommen wird, weil meine Mutter und ich uns jedes Mal streiten, freue ich mich, dass ich entkommen kann.
»Hier, dein erstes Fahrrad.« Stolz lächelnd zeigt mein Vater auf das rote Teil, dessen Räder verbogen sind. »Weißt du noch, wie ich dir Radfahren beigebracht habe?«
»Ja, nur zu gut.« Nun muss ich lächeln. Wie man mit einem Fahrrad vorankommt, hatte ich schnell gelernt. Nur das Bremsen konnte ich lange Zeit nicht. Wie oft bin ich am Wochenende die Straße vor unserem Haus auf und ab gefahren, habe »Daddy, Daddy« gerufen, bis er mich endlich hörte und stoppte.
»Warum verkauft ihr das Haus?«
»Erin.« Seine hellblauen Augen weichen meinem Blick aus. »Es ist einfach zu groß für uns.«
»Was ist wirklich passiert?« Auf einmal bekomme ich es mit der Angst zu tun. Mein Vater ist immer noch kräftig, aber er hat deutlich abgenommen, was ich bereits bei der Begrüßungsumarmung gespürt habe. »Was verschweigst du mir?«
Er kramt geschäftig in seinem Werkzeugkasten, als ob dort jemals Unordnung herrschen könnte. Meine Angst wächst sich zu einer Panik aus.
»Dad?«
»Ich hatte einen zweiten Herzinfarkt«, flüstert er, holt einen Schraubendreher heraus, mustert ihn prüfend und legt ihn zurück in den Kasten. »Nichts Schlimmes, aber die Ärzte meinen, ich sollte kürzertreten.«
»Wann war das?«, bringe ich mit tränenerstickter Stimme hervor. Mein Vater ist erst achtundsechzig Jahre alt. Ich will ihn nicht verlieren. Nicht auch noch ihn.