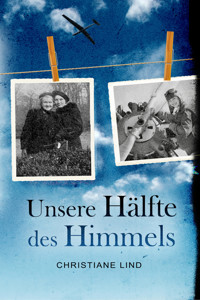7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die große Pilgerinnen Saga
- Sprache: Deutsch
Eine gefährliche Liebe. Braunschweig zur Zeit der Kreuzzüge: Die junge Leonore von Calven begibt sich auf Wallfahrt nach Jerusalem. Was niemand weiß: Leonore trägt ihr Pilgergewand nur zum Schein, denn der wahre Grund ihrer Reise muss verborgen bleiben. Viele Gefahren lauern auf dem Weg in die Heilige Stadt. Doch die junge Frau findet hilfsbereite Gefährten – und sie ist nicht die Einzige, die ein Geheimnis hütet. Als Leonores Leben bedroht wird, rettet sie der Karawanenführer Nadim. Durch ihn taucht sie in eine faszinierende fremde Welt ein und muss sich der Frage stellen, ob eine Christin einen Sarazenen lieben darf ... Der Roman erschien vormals unter dem Titel "Die Geliebte des Sarazenen".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Braunschweig zur Zeit der Kreuzzüge: Die junge Leonore von Calven begibt sich auf Wallfahrt nach Jerusalem. Was niemand weiß: Leonore trägt ihr Pilgergewand nur zum Schein, denn der wahre Grund ihrer Reise muss verborgen bleiben. Viele Gefahren lauern auf dem Weg in die Heilige Stadt. Doch die junge Frau findet hilfsbereite Gefährten – und sie ist nicht die Einzige, die ein Geheimnis hütet.
Als Leonores Leben bedroht wird, rettet sie der Karawanenführer Nadim. Durch ihn taucht sie in eine faszinierende fremde Welt ein und muss sich der Frage stellen, ob eine Christin einen Sarazenen lieben darf …
Über Christiane Lind
Christiane Lind, geboren 1964, ist Sozialwissenschaftlerin und wuchs in Niedersachsen auf. Nach Zwischenstationen in Gelsenkirchen und Bremen lebt sie heute mit ihrem Ehemann und fünf Katern in Kassel. Bei atb ist ihr Roman »Die Heilerin und der Feuertod« lieferbar; 2015 erschien »Die Medica und das Teufelsmoor«.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Christiane Lind
Die Reise der Pilgerin
Historischer Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Dramatis Personae
Teil 1 Die Entführung Braunschweig
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Teil 2 Die Reise Venedig und Akkon
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Teil 3 Die Entscheidung Jerusalem
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Glossar
Danksagung
Nachwort
Literaturempfehlungen:
Anmerkungen
Impressum
In Erinnerung an meine Mutter und meinen Vater
Für Matthias
Dramatis Personae
Kloster St. Marien bei Bad Gandersheim
Leonore von Calven Novizin bei den Benediktinerinnen
Schwester Methildis Büchermeisterin
Schwester Flordelis Gärtnerin
Schwester Walpurga Nonne
Schwester Margaret Nonne
Schwester Chunegundis Pförtnerin
Mutter Hildegard Äbtissin
Braunschweig und Reise nach Venedig
Humbert Wagenlenker
Konstanze Leonores Stiefmutter
Bernardus Leonores Vater
Fulk von Calven Fernhändler und Leonores Gatte
Herburgis von Calven Fulks Mutter
Blanche Leonores und Fulks Tochter
Aleidis Magd
Guda Magd
Detmud Köchin
Konradin Fulks Bruder
Wenzel Krämer Gildenvorsteher
Magister Jordanes Pfarrer von Sankt Jacobus
Bruder Anselmus Pfarrer von Sankt Michaelis
Gottfried Kahle Ritter, ehemals Templer
Adelheid Jerusalempilgerin
Ida Moller Jerusalempilgerin
Orlando Bandinelli1 Papst Alexander III
Barbarossa2 Stauferkaiser
Heiliges Land / Jerusalem3
Nadim Karawanenführer
Wadjid Sarazene
Najmah Nadims verstorbene Frau
Gérard de Ridefort4 Ritter
Renaud de Châtillon5 Ritter
Balduin6 König von Jerusalem
Salomon Goldschmied und Händler
Ruth Salomons Nichte
Djabal Diener Salomons
Khalid Diener Salomons
Sibylla7 Prinzessin von Jerusalem
Mabruka Sarazenin
Haidar Mabrukas Sohn
Ghazi Mabrukas Bruder
Tiere
Adler Hengst des Fulk von Calven
Fahkir Hengst des Nadim
Razouna Leonores Kamelstute
Bint al Hawa Leonores Schimmelstute
Martin Blanches Pferdchen
Teil 1 Die Entführung Braunschweig
1
St. Marien bei Bad Gandersheim, 1170
Die schwarze Gestalt beugte sich über sie wie ein riesiger Rabe. Leonore schreckte hoch und hob abwehrend die Arme. »Leonore, Kind, wach auf!«, sagte der Unglücksvogel mit harscher Stimme. Endlich erwachte sie aus dem Dämmerschlaf – und atmete auf. Das dunkle Wesen, das ihr solche Angst eingejagt hatte, war nur Schwester Methildis. Leonore versuchte, sich im Licht des frühen Morgens zurechtzufinden. Hatte sie etwa die Laudes verschlafen?
»Du musst aufstehen. Und zieh dir etwas Ordentliches an!« Ungewöhnlich drängend klang die Stimme der Benediktinerin, die sonst so ruhig und unerschütterlich wirkte. »Der Wagen deines Vaters wartet.«
Leonore fuhr sich schläfrig durch die kurzen dunklen Locken und versuchte, den Nachhall des Traumes abzuschütteln. Was hatte Schwester Methildis eben gesagt? »Mein Vater – ist er etwa hier? Was wünscht er?«
»Frag’ nicht, Kind.« Methildis’ Stimme klang etwas sanfter. »Trage heute dein bestes Kleid. Ein neues Leben wartet auf dich. Dein Vater holt dich zu sich nach Braunschweig.«
»Aber ….« Leonore setzte sich auf und fröstelte in der Kälte der Klosterzelle. Nun erst wurde sie sich der Bedeutung der Worte bewusst, mit denen die Nonne sie aus dem Schlaf gerissen hatte. Leonore spürte, wie die Angst in ihr hochkroch. »Ich dachte … ich habe gehofft, dass ich mein Leben hier mit Euch verbringen werde.«
Die Benediktinerin beugte sich zu ihr herab und strich ihr übers Haar. »Das haben wir alle erwartet. Doch dein Vater hat etwas anderes mit dir vor.«
Leonore biss sich heftig auf die Unterlippe, eine alte Gewohnheit, die stets hervorbrach, wenn sie sich ängstigte. »Ich kenne ihn doch gar nicht.«
»Hadere nicht, Kind. Eine Tochter muss dem Familienoberhaupt gehorchen. Pack nun deine Sachen und komm.« Mit diesen Worten ging Methildis und schloss die Tür des kargen Raums hinter sich.
Leonore setzte sich auf und schüttelte benommen den Kopf. Ihr Vater. Warum ängstigten sie diese Worte? Müsste sie sich als gute Tochter nicht freuen, dass sie in den Schoß ihrer Familie zurückkehren durfte? Aber es war eine Familie, die sie nicht kannte. An die sie sich nicht erinnerte. Ihre Mutter war im Kindbett gestorben, und der Vater hatte seine Tochter in die Obhut der Benediktinerinnen gegeben, sobald sie das fünfte Jahr erreicht hatte, und sich dann nicht weiter um sie gekümmert. Zwölf Jahre lebte sie nun schon bei den Nonnen und betrachtete die Schwestern als ihre Familie. In Sankt Marien fühlte sie sich heimisch. Leonore fröstelte und rieb sich die Arme. Vorsichtig setzte sie ihre bloßen Füße auf den kalten Steinboden und eilte auf Zehenspitzen zu der Holztruhe, in der sie ihre wenigen Habseligkeiten aufbewahrte. Hastig zerrte sie die Kleidungsstücke heraus. Ein Lächeln zog über ihr Gesicht, als sie die weiche Seide fühlte. Doch bald setzte sich wieder eine Kummerfalte auf ihre Stirn. Schwester Methildis hatte gut reden. Das beste Kleid anziehen. Die Wahl fiel leicht, wenn man nur zwei Kleider besaß. Beide hatte Leonore im letzten Jahr von ihrem Vater gesandt bekommen und selbst umgearbeitet, damit sie ihrer zierlichen Gestalt passten. Eine noch größere Überraschung als das wertvolle Geschenk war die Nachricht gewesen, dass ihr Vater noch lebte. Gar nicht weit entfernt in Braunschweig lebte – und offenbar nicht schlecht, wenn er ihr so prachtvolle Kleider schicken konnte. Sechzehn Jahre lang hatte sie geglaubt, ein Waisenkind zu sein, und plötzlich tauchte ihr Vater auf und mischte sich in ihr Leben ein. Sein Brief an die Äbtissin und die Anweisung, dass Leonore den Schleier nicht nehmen sollte, hatten das Mädchen tief erschüttert. Ihr Lebensweg, der so klar vorgezeichnet schien, hatte sich von einem Tag auf den anderen geändert.
Schwester Methildis hatte versucht, sie zu beruhigen. »Dein Vater wollte sich alle Möglichkeiten offen halten«, meinte die Büchermeisterin und gab Leonore Handschriften zum Kopieren, um sie von ihren Sorgen abzulenken. »Vielleicht entscheidet er im nächsten Jahr, dass du für immer hier im Kloster bleiben kannst.«
Doch Leonore hatte damals schon geahnt, dass es anders kommen würde. Niemand schickte einer Benediktinerin grundlos farbenfrohe Kleider. Viele Tage wartete sie, gekleidet in blaue oder türkisfarbene Seide. Wartete auf den Vater, der nicht kam. Viele Tage fürchtete sie, dass der fremde Vater sie zu sich nach Braunschweig rufen lassen würde und ihr ein Leben drohte, dem sie sich nicht gewachsen fühlte. Eine Welt, die sie schon vor langer Zeit gegen den Frieden des Klosters eingetauscht hatte. Doch die Wochen vergingen, und nichts geschah. Es schien, als hätte der Vater sie einfach wieder vergessen. Da legte Leonore die Kleider sorgfältig zusammen, verstaute sie in der Truhe und kleidete sich wieder in die Farben der Benediktinerinnen. Alle Gedanken an ihren Vater hatte sie mit den Kleidern verborgen.
Heute nun kehrten die Ängste zurück. Draußen wartete ein Wagen, der sie aus Sankt Marien entführen würde. Zu einem Fremden, den sie Vater nennen sollte. Der türkisfarbene Stoff raschelte, als sie sich das Kleid überzog. Leonore schluckte, Tränen traten ihr in die Augen, und sie fühlte sich mit einem Mal, als ob sie an einem tiefen Abgrund stünde, kurz davor, hinuntergestoßen zu werden. Dabei wollte sie sich nur noch verkriechen. Sie warf sich aufs Bett, vergrub das Gesicht im Kissen und weinte über das Geschick, das ihr Leben getroffen hatte.
In ihrer Verzweiflung hatte sie nicht bemerkt, dass Schwester Methildis zurückgekehrt war. »Komm, Kind, es wird Zeit.« Die Nonne reichte ihr die Hand und zog sie hoch. Leonore wischte sich die Augen und suchte Fassung zu gewinnen. Ihr kamen leicht die Tränen, aber Weinen würde jetzt nicht helfen. Nein, sie wollte stark und tapfer sein und ihrem Vater gefasst gegenüber treten. Eilig kleidete sie sich an, faltete das blaue Kleid und legte es sorgfältig in einen Beutel. Die wenigen anderen Kleidungsstücke, die ihr gehörten, folgten. Obenauf legte sie ihren größten Schatz, ein Pergament mit Bibelworten, das ihr die Büchermeisterin geschenkt hatte. Sie nickte Schwester Methildis zu und warf einen letzten Blick in die Kammer, in der sie einen Großteil ihres Lebens verbracht hatte.
Stumm schlich Leonore hinter der alten Nonne her, versuchte, die Gänge, durch die sie so häufig gelaufen war, mit den Augen in sich aufzunehmen, um sich später an sie erinnern zu können. Im Hintergrund hörte sie die vertrauten Geräusche des Tagesbeginns im Kloster. Die Schwestern strebten in die kleine Kapelle zu den Laudes. Nie hätte Leonore geglaubt, dass sie mit Sehnsucht an das Morgengebet denken würde. Heute würde sie das Kloster verlassen, ohne noch einmal dem Offizium nachkommen zu können. Wehmütig erinnerte sich Leonore an die vielen, vielen Morgen, an denen sie knapp an Zeit die Gänge entlang geeilt war, um noch rechtzeitig zu den Morgengebeten in der Kapelle zu sein. Wie oft hatte sie sich gewünscht, noch etwas schlafen zu können, sich in die Decke zu schmiegen, und hatte die eiserne Disziplin der Benediktinerinnen gefürchtet.
Als Kind hatte sie ihre Mühe mit den Ritualen und Regeln der Schwestern gehabt, hatte oft mit sich und dem Leben gehadert, weil es sie an diesen Ort geführt hatte. Im Laufe der Jahre aber lernte Leonore die Sicherheit und Beständigkeit zu schätzen, die das Klosterleben ihr bot. Bald konnte sie sich ein Leben außerhalb des Klosters kaum mehr vorstellen. Sie genoss es, jeden Tag ihren Aufgaben im Kräutergarten oder in der Bibliothek nachzugehen. Sie lächelte, als sie an die geliebten Arbeiten dachte. Wie gerne hegte und pflegte sie die Kräuter und Pflanzen im Klostergarten. Stunde um Stunde hatte sie unter der Anleitung von Schwester Flordelis vor den Beeten gekniet, die warme Erde gerochen und sich den Setzlingen gewidmet. Jede einzelne Pflanze liebten die Nonnen, Schnecken und andere Schädlinge verfolgten sie dagegen mit aller Härte. Für Leonore blieb der Garten ein freundlicher Ort, wo sie ihren Gedanken nachhängen und einer Tätigkeit nachgehen konnte, die sie beherrschte. Jedes Jahr wieder bewunderte sie die Schöpfung, wenn aus den Samen und Setzlingen Kräuter und Blumen erwuchsen.
Neben dem Kräutergarten galt ihre Liebe der Arbeit in der Klosterbibliothek. Die Stunden, in denen sie Bücher abschrieb und mit größter Sorgfalt Buchstaben auf Pergamente malte, zählten für Leonore zu den schönsten Augenblicken ihres Lebens. Zwischen den Schriftrollen, unter der Anleitung von Schwester Methildis, hatte das unglückliche Kind eine Welt entdeckt, in der es nicht ungeschickt und fehl am Platze wirkte, sondern für die es alle Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbrachte. Nach kurzer Zeit beherrschte sie die Kunst des Schreibens und der Büchermalerei so gut wie ihre Lehrmeisterin. Wer nur würde jetzt ihren Platz einnehmen und die Pergamente kopieren? Etwa Walpurga mit den dicken Händen und ungeschickten Fingern, die stets Tinte über die Schriftrollen verschüttete? Oder, schlimmer noch, Margaret, die Quirlige, die nie stillsitzen konnte und sich ständig verschrieb? Leonore seufzte. Warum musste sie alles aufgeben, um nach Braunschweig zu reisen? In eine fremde Stadt, zu einem Unbekannten, der sich ihr Vater nannte. Warum hatte er sie in all den Jahren nicht ein einziges Mal besucht, sondern schickte jetzt nach ihr wie nach Gesinde? Schwester Methildis drehte sich zu ihr um, als hätte sie ihre Gedanken gelesen.
»Komm, Kind.« Die Nonne lächelte ihr zu. »Wir Frauen müssen uns in unser Schicksal fügen. So will es unsere Bestimmung.«
»Aber nein!«, brach es aus Leonore heraus. »Das ist nicht wahr. Es ist doch nicht das Schicksal, das über mein Leben entscheidet. Sondern ein Fremder, der nach so vielen Jahren kommt und sich mein Vater nennt.« Eine Welle von Angst überkam sie plötzlich, und sie fiel vor der alten Nonne auf die Knie. »Bitte, Mutter Methildis, bitte. Liefert mich nicht der Welt und ihren Schrecken aus. Alles will ich tun, jeden Dienst, den ihr mir auftragt. Ich werde auch jede Handarbeit und Stickerei ohne Murren verrichten, die Ihr mir gebt. Aber bitte schickt mich nicht fort.«
Die Schwester schüttelte nur stumm den Kopf. Mit sanfter, aber kräftiger Hand zog sie das Mädchen empor. »Es ist nicht an uns, über dein Leben zu bestimmen, mein Kind. Füge dich in dein Schicksal und vertraue dem Herrn. Vergiss nie, der Mensch denkt, doch Gott lenkt.«
Leonore sank in sich zusammen, als sie erkannte, dass von Methildis keine Hilfe zu erwarten war. Wenn nicht einmal die Büchermeisterin ihr zur Seite stand, von wem konnte sie dann noch Unterstützung erhoffen? Sollte sie vielleicht fliehen? Sich verstecken, sich dem Willen des Mannes entziehen, der über sie bestimmen wollte wie über eine Handelsware. Einfach loslaufen, bis zum Tor, hinausstürmen und ihr Glück alleine versuchen, schoss es ihr durch den Kopf. Doch sofort wurde ihr bewusst, wie töricht dieser Plan war. Wohin konnte ein Mädchen schon fliehen, wenn es ein ehrbares Leben behalten wollte? Wovon sollte sie leben? Manchmal flüsterten die Novizinnen einander Geschichten über gefallene Jungfrauen zu und schüttelten dann mit einem Schauder der Entrüstung die Köpfe. Nein, das Leben einer geflohenen Nonne war nichts, was sie vernünftigerweise in Erwägung ziehen konnte. Ihr blieb nichts anderes übrig, als ihr Schicksal wie alle Frauen anzunehmen und sich dem Willen ihres Vaters zu beugen. Leonore schickte ein Stoßgebet zur Muttergottes und bat um Beistand und Hilfe für die kommende Zeit. Mit hängenden Schultern folgte sie Methildis auf den Hof und schlich zum Tor. Das neue Kleid kratzte. Der edle Stoff und die leuchtenden Farben wirkten für Leonore schal, schien es ihr doch, als hätte sie dafür ihr Leben verkauft.
Chunegundis, die Pförtnerin, blickte ihnen neugierig entgegen. Neben ihr wartete Mutter Hildegard, die Äbtissin. Wie stets strahlte sie Ruhe und Zufriedenheit aus. Leonore hatte sich oft gewünscht, so gelassen und furchtlos durchs Leben gehen zu können wie die Klostervorsteherin.
Mutter Hildegard umarmte Leonore und flüsterte einen Segen. Dann zog sie ein silbernes Kreuz aus dem Ärmel ihres Habits hervor und überreichte es Leonore. »Bitte, meine Tochter. An dem Tag, an dem der Herr dich in unsere Obhut befahl, gab dir deine Amme dieses Schmuckstück als Erinnerung an deine Mutter mit.« Die Äbtissin zuckte die Achseln. »Da du dich dem Herrn Jesu Christi anvermählen wolltest, hielt ich es nicht für klug, dich an dein altes Leben zu erinnern. Doch nun …« Die Äbtissin umarmte Leonore, hängte ihr schnell das Kreuz um, das an einer zarten Kette hing, und eilte davon, ohne sich noch einmal umzudrehen. Mit ihr schwand Leonores letzte Hoffnung. Nur Mutter Hildegard hätte sie vor dem Ansinnen ihres Vaters retten können.
»Sei vorsichtig in der Welt.« Chunegundis blickte Leonore mit tiefem Ernst in die Augen. »Und halte dich an die Gebote. Möge der Herr dich schützen.«
Leonore schluckte. Zum ersten Mal, seitdem sich vor Jahren die Pforte des Klosters hinter ihr geschlossen hatte, öffnete sich das Tor nun wieder für sie. Sie holte tief Luft und spähte hinaus. Methildis folgte ihr und zeigte auf einen Wagen. Zwei Pferde waren davorgespannt und stampften mit den Hufen, als ob sie es nicht erwarten konnten, sich auf den Weg nach Braunschweig zu machen. Neben ihnen stand ein Mann und schaute Leonore entgegen. Sie musterte ihn verstohlen und erschrak.
Verwegen sah er aus, mit dunklen Augen und erdfarbenen Haaren. Sollte sie etwa alleine mit ihm reisen? Alleine mit einem Mann? Leonores Kehle zog sich zusammen, und sie spürte, wie ihre Hände zu zittern begannen.
»Bitte, ich weiß doch nichts von der Welt.« Mit letzter Verzweiflung schaute sie sich zu Schwester Methildis um. »Ich will auch gar nichts von ihr wissen. Bitte, kann ich nicht doch einfach bei Euch bleiben?«
Doch die Nonne schüttelte den Kopf und hob die Hände in einer hilflosen Geste. Hastig umarmte sie Leonore und segnete sie mit einem Kreuzzeichen. Mit einem letzten Nicken drehte Methildis sich um und ging zur Pforte. Die Tür schloss sich mit einem dumpfen Schlag hinter ihr.
2
Leonore stand alleine im Halbdunkel und musterte den Wagen und die Pferde, weil sie sich nicht traute, den Mann offen anzusehen. Sie spürte den Blick des Kerls auf sich ruhen, der immer noch schweigend neben dem Fuchs und dem Rappen stand. Leonore trat von einem Fuß auf den anderen und kratzte sich verlegen am Arm. Sollte sie auf den Mann zugehen, oder musste eine Frau warten, bis er sie zum Kommen aufforderte? Wie sollte sie einen Knecht ansprechen? Oder gehörte er nicht zum Gesinde? Nicht einmal die einfachsten Regeln des Lebens außerhalb der Klostermauern kannte sie, das wurde ihr jetzt bewusst. Sie spürte, wie die Röte ihr den Hals und die Wangen hinaufkroch. Einen flüchtigen Gedanken lang ärgerte sie sich über ihre Schwäche, dann nahm sie sich schließlich zusammen und näherte sich zögernd dem Gefährt. Helle Leinenplanen bedeckten die Seiten des Leiterwagens, der Leonore an die Wagen erinnerte, mit denen Bauern Waren ins Kloster brachten oder Gemüse und Obst für den Markt abholten. Sollte es möglich sein, in einem derartig einfachen Gefährt die Strecke bis nach Braunschweig zu überwinden? Sie schluckte. Der Weg würde sicher zwei Tagesreisen in Anspruch nehmen. Zwei Tage und zwei Nächte allein mit diesem Mann! Was mutete ihr Vater ihr nur zu?
Der Wagenlenker grinste ihr unverhohlen entgegen, als hätte er ihre Gedanken gelesen. Leonore sandte einen stummen Hilferuf an den heiligen Eustachius und bat um Beistand in dieser schlimmen Stunde.
Da schob sich eine Hand aus dem Wageninnern und schlug die Plane zur Seite. Eine Frau, nur wenige Jahre älter als Leonore, schaute heraus und rief ihr zu: »Nun komm schon, Mädchen. Der Weg nach Braunschweig dauert seine Zeit. Und dein Vater wartet nicht gerne.« Ihre helle Stimme klang ungeduldig.
Wer immer diese Frau auch war, Leonore erschien sie wie ein Geschenk des Himmels. Wenigstens musste sie die Fahrt nach Braunschweig nicht alleine mit dem Mann verbringen. Sie holte tief Luft und drängte die Tränen zurück. Vorsichtig kletterte sie in das Wageninnere und nahm auf einer Holzbank Platz. Die Frau, die sie zur Eile gedrängt hatte, stand mit dem Rücken zu ihr und beugte sich über eine Truhe. Leonore räusperte sich. Die Andere schaute kurz auf, nickte ihr zu und beugte sich noch etwas tiefer. Endlich tauchte sie auf und setzte sich Leonore gegenüber.
»Hier, nimm die Cappe.« Sie reichte Leonore einen dunkelgrauen Stoff.
Als sie Leonores fragenden Blick sah, schüttelte die Frau den Kopf. »Das ist ein Reisemantel. Los, zieh ihn über. Oder willst du dein Gewand mit dem Schmutz der Straße ruinieren? Außerdem hält er warm, die Nächte können noch frisch sein.«
Leonore nickte zum Dank. »Wer seid Ihr?«, flüsterte sie und räusperte sich erneut, um Gewalt über ihre Stimme zu bekommen. »Warum begleitet Ihr mich?«
Ein leises Lachen war die Antwort, gefolgt von einem spöttischen Blick, unter dem Leonore sich plump und dumm fühlte. »Ich bin Konstanze, die Frau deines Vaters.«
Leonore schwieg. Diese Neuigkeit musste sie erst einmal verdauen. Vor einem Jahr hatte sie erfahren, dass sie einen Vater hatte. Heute nun reiste sie mit einer Stiefmutter, von der sie noch nie gehört hatte, nach Braunschweig.
»Habe ich …?«, begann sie, dann setzte ihre Stimme aus. Nach einer Pause, die ihr wie eine Ewigkeit erschien, wagte sie nach ihrer neuen Familie zu fragen. »Habe ich Geschwister?«
Ein trauriges Lächeln huschte über Konstanzes Gesicht. »Nein, ich habe beide Kinder vor der Zeit verloren.«
»Das tut mir leid.« Leonore biss sich auf die Unterlippe und wünschte, sie hätte ihre Neugier gezügelt.
Konstanze nickte und eine unangenehme Stille breitete sich zwischen ihnen aus. Der Wagen rumpelte dahin und schüttelte die Frauen durch. Endlich fasste Leonore den Mut, ihrer Stiefmutter noch eine Frage zu stellen.
»Hätte meine Rückkehr nicht bis nach dem Morgengebet warten können? Wieso mussten wir so früh aufbrechen?«
»Wir wollten den Tag nutzen. Die Reise dauerte länger, als wir erwartet hatten.« Konstanze stieß ein Schnauben aus, das Leonore an das Fauchen des Klosterkaters erinnerte. »Die Straßen sind in einem erbärmlichen Zustand und ich musste zweimal in schmutzigen Herbergen übernachten.« Konstanze schüttelte sich und kratzte sich im Gesicht und an der Schulter. »Bestimmt habe ich mir Flöhe eingefangen.«
»Warum habt Ihr die Mühen auf Euch genommen?«
»Ich musste mich auf die Reise begeben, weil dein Vater sein unschuldiges Töchterlein nicht mit dem Knecht alleine reisen lassen wollte.« Konstanzes Stimme klang anklagend. »Mich mit Humbert, diesem einfältigen Kerl alleine zu lassen, das störte ihn wohl nicht.« Ihre Stiefmutter zog die Mundwinkel nach unten.
Leonore knabberte an ihrer Unterlippe und suchte nach einer unverfänglichen Frage. »Ist Braunschweig eine große Stadt?«
»Braunschweig wächst und gedeiht. Besonders uns Kaufleuten geht es gut durch den Löwen.« Konstanze lächelte Leonore vielsagend an.
»Den Löwen?« Was war Braunschweig nur für eine Stadt, in der ein Raubtier für Wohlstand sorgte?
»Unser Herzog Heinrich, du Dummerchen.« Über so viel Unwissenheit schüttelte Konstanze den Kopf. »Haben sie dich im Kloster denn gar nichts gelehrt? Weißt du überhaupt nichts von der Welt?«
»Nur wenig.« Leonore senkte den Kopf. »Ich habe die Tage mit Beten und Schreiben -«
»Schon gut.« Leonores Stiefmutter lehnte sich zurück. »Der Herzog baut Braunschweig zu seiner Residenz aus und fördert uns Kaufleute. Sogar Handwerker aus dem Ausland holt er in die Stadt. Ständig lässt er Bauten errichten, die der Nachwelt seinen Ruhm zeigen sollen.«
»Ist er ein frommer Mann?«
Konstanze lachte. »Er lässt einen gewaltigen Dom bauen und pilgerte ins Heilige Land. Reicht dir das?« Dann gähnte Konstanze und streckte sich. »Geschlafen habe ich wenig. Bist du nicht auch müde?«
»Ich bin es gewöhnt, mit dem ersten Licht aufzustehen.« Leonore betrachtete ihr Gegenüber. Warum hatte ihr Vater eine so junge Frau geheiratet? Ähnelte Konstanze vielleicht Leonores Mutter, die bei ihrer Geburt gestorben war? War ihre Mutter auch so ein zartes Geschöpf gewesen? Konstanze wirkte wie eine Prinzessin in ihrer schimmernden Cotte, deren Farbe Leonore an Glockenblumen erinnerte. Das Blau des Stoffes betonte die Blässe von Konstanzes Haut und die Farbe ihrer Augen.
Das weiße Leinenband, das Konstanze als verheiratete Frau auswies, umrahmte ein herzförmiges Gesicht mit einer Stupsnase. So eine hatte Leonore sich immer gewünscht. Unwillkürlich fasste sie sich ins Gesicht und fuhr mit dem Finger die eigene Nase entlang, die ihr stets zu breit und undamenhaft lang erschienen war. Wenn Konstanzes Äußeres zeigte, welche Art Frauen ihr Vater schätzte, so wäre er von ihr sicher enttäuscht. Zu mager, zu hager und zu eckig.
»Was glotzt du mich so an?« Konstanze runzelte die Stirn.
»Entschuldigt.« Leonore senkte den Blick. »Ich habe nur die Feinheit Eures Kleides bewundert. Es kleidet Euch ausnehmend gut.«
»Ich musste deinen Vater lange bitten, bis er mir diese schönen Stoffe schenkte.« Leonores Kompliment schien ihre Stiefmutter versöhnt zu haben. Konstanze rückte etwas näher und schlug den Surkot um. »Hier, fühl einmal. Seide aus dem Orient.«
Liebevoll strich Konstanze über den safrangelben Stoff, der sich leuchtend vor dem Braun der Wolle abhob. Leonore folgte der Aufforderung und streichelte über das feine Tuch. Bisher hatte sie ihre neuen Gewänder, die der Vater ihr ins Kloster geschickt hatte, für edel gehalten, doch gegen Konstanzes Surkot wirkten sie wie die Kleider einer Bäuerin.
»Wunderschön«, flüsterte Leonore. »Mein Vater muss ein reicher Mann sein.«
Konstanzes Lachen überraschte Leonore, die sich nicht bewusst war, etwas Lustiges oder Dummes gesagt zu haben. »In der Tat, dein Vater ist einer der bedeutendsten Fernhändler Braunschweigs.« Konstanze nickte eifrig. »Sein Wort hat großes Gewicht in der Stadt. Du weißt gar nicht, was für ein Glück du hast.«
Aber etwas in den Augen ihrer Stiefmutter ließ Leonore zweifeln, ob sie wirklich einem besseren Leben entgegenfuhr. Bevor sie weitere Fragen nach ihrem Vater stellen konnte, begann Konstanze, über Stoffe und Waren, die Händler aus fernen Ländern nach Braunschweig brachten, zu schwatzen. Ihr Geplauder hatte eine beruhigende, beinahe schon einschläfernde Wirkung.
Zu Mittag hielt der Knecht am Straßenrand und tränkte die Pferde. Die Fahrt hatte Leonore durchgeschüttelt, und sie war froh über die Unterbrechung. Gemeinsam mit Konstanze kletterte sie vom Wagen und streckte die müden Knochen. Die Frauen nutzten die Gelegenheit, um sich ein wenig die Beine zu vertreten. Zurück im Wagen öffnete Konstanze die Truhe und holte Brot und Käse heraus, dazu einen Schlauch Apfelmost.
»Wie lange werden wir reisen?«, fragte Leonore.
Konstanze zuckte die Schultern und schnitt sich eine weitere Scheibe vom Käse ab. »Wenn der Knecht sich beeilt, sollten wir mit einer Rast auskommen.«
»Werden wir in einem Kloster übernachten?« Bei den Benediktinerinnen baten Reisende oft um eine Schlafgelegenheit und ein Mahl und erhielten beides.
»Fehlt dir das Kloster etwa schon?« Konstanze schaute sie belustigt an. »Nein, wir sind nicht auf Mildtätigkeit und wässrigen Haferbrei angewiesen. Ich will lieber in einem Gasthaus nächtigen. Möglichst in einem ordentlichen.«
Leonore nickte. Wieder etwas, was sie nicht gewusst hatte. Gerne hätte sie ihre Stiefmutter gefragt, wie es in Gasthäusern zuging und woran man ein ordentliches erkannte, aber Konstanze drehte ihr den Rücken zu und begann bald, leise zu schnarchen. Leonore war ebenfalls müde, doch ihre Gedanken ließen sie nicht zur Ruhe kommen.
Auch später in der Herberge – einem recht dreckigen Haus, über das Konstanze enttäuscht die Nase gerümpft hatte –, vermochte Leonore lange nicht in den Schlaf zu finden. Zu laut dröhnten das Grölen der betrunkenen Männer, das Poltern ankommender Wagen und das Rollen von Fässern, die abgeladen wurden. Nun erst erkannte sie, was für ein ruhiger Ort Sankt Marien war. Wieder und wieder wälzte sie sich von einer Seite zur anderen, bemüht, Konstanze nicht zu wecken, die neben ihr lag. Erst lange nach Mitternacht schlief sie ein.
Am Morgen wurde sie vom Krähen eines übereifrigen Hahns geweckt und sprang aus dem Bett, in Sorge, verschlafen zu haben. Nicht dass sie erneut zu spät zu den Laudes käme, schoss es ihr durch den Kopf. Doch als sie die schlummernde Konstanze erblickte, wurde ihr mit einem Schlag klar, wo sie sich befand. Leonore sackte zurück auf das Bett.
»Bernardus, was soll das?«, murmelte Konstanze schläfrig und drehte sich um.
»Eilt Euch!« Ein lautes Hämmern an der Tür riss Leonores Stiefmutter aus dem Schlaf. »Wir haben einen langen Weg vor uns«, dröhnte die Stimme des Wagenführers.
Konstanze setzte sich auf, reckte sich ausgiebig, gähnte und blickte Leonore mit müden Augen an. »Nun los, du hast gehört, was er gesagt hat.«
Leonore nickte und kleidete sich stumm an. Aus einem Krug schöpfte sie brackig riechendes Wasser in eine Schüssel und wusch sich notdürftig Gesicht und Hände.
»Frühstücken will ich in dieser Drecksbude nicht. Du etwa?« Konstanze, auf deren Gesicht sich Falten der Decke abzeichneten, stand bereits angekleidet an der Tür.
Stumm schüttelte Leonore den Kopf und folgte ihrer Stiefmutter auf die schmale Stiege, die in den Gastraum führte. Der Geruch nach altem Rauch, Wein und Männerschweiß quoll ihnen entgegen und raubte Leonore Atem und Appetit. Konstanze rümpfte erneut die Nase und eilte aus der Herberge. Vor der Tür warteten mehrere Wagen, meist Ochsengespanne, mit denen Bauern und Händler ihre Waren beförderten. Leonore blickte voller Staunen auf das Gewimmel. Die kräftigen Rinder muhten und schüttelten die Köpfe. Ein brauner Ochse schaute sie geradewegs an und zuckte mit den Ohren. Leonore lächelte über diesen unerwarteten Morgengruß.
»Weg da!«, brüllte einer der Knechte und rollte ein Weinfass über den Hof ins Wirtshaus.
Weitere Fuhrleute verstauten ihre Waren auf Karren oder Ochsenwagen und kamen einander dabei in die Quere. Flüche und Schimpfwörter flogen durch die Luft, ab und zu untermalt von einem muhenden Ochsen. Leonore war erleichtert, als sie in der Sicherheit des Reisewagens saß und dem Getümmel entgehen konnte.
»Dein Vater hätte klüger sein und dich in einem Kloster unterbringen sollen, das näher an Braunschweig liegt.« Konstanze verzog das Gesicht. »Ich habe so schlecht geschlafen, dass ich sicher alt auf dich junges Ding wirke.«
»Nein, nein«, beeilte sich Leonore zu sagen und versicherte ihrer Stiefmutter, dass sie überaus frisch aussähe. Verwunderlich, wie viel Gedanken Konstanze an ihr Äußeres verschwendete. Im Kloster hätte man sie der Sünde der Eitelkeit bezichtigt.
Zufrieden reckte Konstanze sich, lehnte sich an die Wand des Wagens und schlief prompt ein. Ihre schmalen Hände lagen dabei damenhaft übereinander in ihrem Schoß. Leonore blickte auf ihre eigenen Hände. Tintenflecke zierten den Mittelfinger, und unter den kurzen Fingernägeln hatte sich trotz kräftigen Schrubbens Erde aus dem Garten abgesetzt. Noch nie zuvor hatte sie das Gefühl gehabt, die Hände einer Magd zu haben. Während sie die zarten weißen Finger ihrer Stiefmutter anschaute, entdeckte Leonore mehr und mehr Fehler an sich. Was würde ihr Vater nur von ihr halten? Sie sank in sich zusammen und wünschte sich einmal mehr ins Kloster zurück. Neben ihr schnarchte Konstanze, von draußen drang das Rattern der Wagenräder und der Hufschlag der Pferde an ihr Ohr. Hin und wieder hörte sie Humbert fluchen. Der Wagenlenker hatte noch kein Wort mit Leonore gewechselt, sondern sie nur angestarrt. Fragen richtete er stets an ihre Stiefmutter, mit einem unterwürfigen Grinsen. Leonore lief ein Schauder über den Nacken und sie dankte den heiligen Nothelfern, dass der unheimliche Kerl vorne saß und keine Gelegenheit mehr hatte, sie mit seinen Blicken zu durchdringen. Das Schaukeln des Gefährts wirkte einschläfernd, und immer wieder fielen ihr die Augen zu. Aber in ihrem Inneren war sie zu unruhig, um schlafen zu können. Ständig kreisten ihre Gedanken um die Frage, was sie in Braunschweig erwarten würde. Sie hätte gern mit Konstanze gesprochen, doch die schlief noch immer, und Leonore wollte sie nicht wecken.
Endlich schlug ihre Stiefmutter die Augen auf, reckte sich, gähnte und suchte nach etwas unter dem Sitz. Sie holte einen Weinschlauch hervor, öffnete ihn und trank einen Schluck.
»Möchtest du?« Konstanze reichte Leonore den Schlauch. »Ein wohlschmeckender Gewürzwein. Aus dem gut gefüllten Keller deines Vaters. Mit Weinen kennt er sich aus.« Etwas in Konstanzes Stimme ließ Leonore aufhorchen. Mehr wollte ihre Stiefmutter anscheinend nicht sagen.
Leonore schüttelte den Kopf und räusperte sich. »Sagt, warum musste ich so plötzlich abreisen?« Sie nahm allen Mut zusammen und stellte die Frage, die ihr auf der Seele brannte. »Warum konnte mein Vater mich nicht einfach im Kloster leben lassen?« Leonore fürchtete sich ein wenig vor Konstanzes Antwort. War sie zu frech und die Stiefmutter würde sie strafen?
»Man fragt besser nicht nach den Beweggründen deines Vaters, sondern bemüht sich, seine Wünsche zu erfüllen.« Konstanze lachte, doch Leonore spürte einen bitteren Unterton in ihren Worten. »Das wirst du bald lernen.«
Lag da ein mitleidiger Ausdruck in den Augen ihrer Stiefmutter? Leonore schauderte. Ihr Vater schien ein Mensch zu sein, der es gewohnt war, seinen Willen durchzusetzen. Hatte er sie nicht auch aus dem Kloster gezerrt, ohne sich darum zu scheren, wie sie selbst ihr Leben verbringen wollte? Wieder spürte sie die Angst, die ihr die Kehle zuschnürte. Wohin würde ihr Schicksal sie führen? »Unser Herr gibt uns nie mehr Lasten auf, als wir tragen können«, hatte Methildis stets gepredigt, wenn Leonore sich über die Widrigkeiten des Klosterlebens beklagt hatte. Sie schluckte und versuchte, auf die Weisheit der Nonnen zu vertrauen.
Immerhin musste sie diesen Weg nicht ganz allein gehen. Ihre Stiefmutter war vielleicht kein Ausbund an Freundlichkeit, aber sie schien bereit, Leonore den Weg in das Braunschweiger Leben zu weisen. Vielleicht würden sie sogar noch Freundinnen werden. Sie lächelte Konstanze an. Ihre Stiefmutter nahm das als Aufforderung, Leonore mehr über Braunschweig und die weit verzweigte Gesellschaft der Fernhändler zu erzählen. Aber so sehr sie sich bemühte, vermochte Leonore den Geschichten nicht zu folgen, die sich um fremde Familien und deren Stellung in der Braunschweiger Kaufmannschaft drehte. Höflich unterdrückte sie ein Gähnen und nickte ab und zu an den hoffentlich passenden Stellen von Konstanzes verwickelter Erzählung. Das Rütteln des Wagens und Konstanzes Stimme, die wieder und wieder die gleiche Geschichte, nur mit wechselnden Namen, zu erzählen schien, beruhigten Leonore ein wenig, und sie sah dem Treffen mit ihrem Vater gefasster entgegen.
In der Abenddämmerung erreichten sie ihr Ziel. Als sie sich den Stadttoren näherten, hörte Leonore den Wagenlenker schimpfen und mit lauter Stimme gegen den Lärm anschreien, der sich um sie herum erhob. Hunde bellten, Schweine grunzten, Säuglinge schrieen. Aber nicht nur den Ohren, auch der Nase wurde einiges zugemutet, nun, da sie sich der Stadt näherten. Über allem lagerte ein beißender Gestank von Tiermist und Menschenschweiß. Leonore schlug die Plane zur Seite und spähte hinaus. In der Ferne entdeckte sie eine Stadtmauer, über die Kirchtürme ragten. Braunschweig. Ihr Herz pochte vor Aufregung und Erwartung. Um sie herum strömten Menschen aus Richtung der Stadt. Bauern mit Ochsenwagen oder kleinen Karren, die sie schoben, Mägde, die Gänse und Enten vor sich hertrieben, ganze Familien von Kleinbauern, die Kiepen auf dem Rücken trugen, machten dem Pferdewagen die Straße streitig.
»Glotz nicht wie eine Dienstmagd!«, wies Konstanze sie mit scharfer Stimme zurecht. »Du bist die Tochter eines der größten Fernhändler der Stadt. Also benimm dich auch deinem Stande entsprechend.«
Sofort ließ Leonore die Plane fallen und sank zurück auf die Bank. Sie senkte den Kopf und blickte auf ihre Hände. Wie von selbst hatten Daumen und Zeigefinger der rechten Hand begonnen, die zarte Haut des linken Daumens abzureißen. Der Schmerz lenkte Leonore von der Angst ab, die sich auf sie legte wie eine dunkle Wolke. Woher sollte sie wissen, wie sich die Tochter eines Kaufmanns zu verhalten hatte? Ihr Leben hatte sich um Kräuter und Gemüse, um Bücher und Gebete gedreht, nicht um gesellschaftliche Umgangsformen und Standesunterschiede. »Bitte entschuldigt.« Sie zupfte weiter an der Nagelhaut. »Könnt Ihr mir helfen, eine gute Tochter zu werden?«
Ein grimmiges Schnauben begleitete Konstanzes Antwort. »Für deine Erziehung werde ich wohl kaum Zeit finden. Wir werden nicht lange zusammen leben.«
Was meinte sie damit nun wieder? Doch bevor Leonore sie fragen konnte, rief der Knecht ihnen zu: »Frau Konstanze, wir sind gleich zu Hause.«
Leonores Stiefmutter begann, unruhig an Kleid und Mantel herumzuzupfen. Mit zwei Fingern strich sie sich über die Stirn. »Wie sehe ich aus? Wirke ich sehr erschöpft?«
Leonore suchte nach einer Schmeichelei. »Nein, Ihr seht frisch aus wie der Morgen.« Warum sorgte sich ihre Stiefmutter nur so sehr um ihr Äußeres?
Ein erneuter Ruf des Knechts lenkte Leonore von dem Gedanken ab, und sie atmete tief durch. Dann prüfte sie noch schnell die Sauberkeit ihrer Fingernägel, doch da war nichts zu retten, die Gartenarbeit sah man ihren Händen weiterhin an.
Der Wagen kam mit einem Ruck zum Halten. Schritte polterten, und der Knecht schlug die Plane zurück. Hinter ihm erspähte Leonore einen Hof, sicher so groß wie das Kloster. Ihr Vater musste ein vermögender Mann sein. Mit schmerzenden Gliedern kletterte Leonore aus dem Wagen. Humbert bot ihr eine Hand an, doch die übersah sie geflissentlich, weil sie den Mann nicht anfassen mochte. Sie streckte ihren von der Reise müden Körper und blickte sich neugierig um. Rund um den Hof, in dem etliche Ochsenkarren und andere Wagen standen und wohl auf Fuhren warteten, lagen verschiedene Gebäude. Ein Speicher, in dem ihr Vater seine Waren unterbrachte, wie Leonore vermutete, ging in die Wohnkemenate über.
»Man nennt die Bauweise Fachwerk. Hier in Braunschweig gibt es einiges davon.«, sagte Konstanze, die Leonores erstaunten Blick richtig deutete. Stolz erklärte sie Leonore die Häuser. »Im Speicher und im Torhaus lagern die Waren. Bei gutem Wetter läuft der Verkauf hier im Hof. Bei schlechtem, was wir hier des Öfteren zu beklagen haben, nutzt dein Vater die Diele des Hallenhauses.« Konstanze deutete auf ein zweistöckiges Gebäude, dessen Balkenzeichnung Leonore so verwundert hatte. »Doch nun komm. Wir wollen Bernardus nicht warten lassen.«
Hinter ihrer Stiefmutter betrat Leonore das Haupthaus und spähte ins Innere. Eine Mischung aus Neugierde auf den Fremden, den sie Vater nennen würde, und Angst vor seinen Erwartungen an sie brachte ihre Hände zum Flattern. Sei stark, versuchte sie sich Mut zuzuflüstern, doch die Sorge wuchs in ihr und wollte sich nicht wegreden lassen. Nur nicht anfangen zu weinen und mich dem Vater als Schwächling zeigen! Dieser Gedanke kreiste in ihrem Kopf und verdrängte alles andere.
In der Diele waren zwei Männer in ein Gespräch vertieft, beides stattliche Herren, die sich ihrer Stellung gewiss zu sein schienen und bestimmt nicht so einfach zu verunsichern waren wie sie. Der Jüngere, hochgewachsen und sehr gerade in seiner Haltung, redete auf den Älteren ein. Sein kräftiger Körper schien unter Spannung zu stehen, und Leonore ahnte das Drängen in seiner Stimme, als er sich nach vorne beugte, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. Der Ältere, wohl Bernardus, ihr Vater, ließ sich durch die Gesten nicht beeindrucken. Er stand aufrecht wie ein Baum, und Leonore bemerkte, wie er eine Augenbraue spöttisch nach oben zog. Sie musterte sein Gesicht, suchte nach Anzeichen von Gemeinsamkeiten zwischen sich und diesem Mann, vielleicht ein Grübchen, das sie teilten, oder der Schwung der Nase. Aber sie konnte nichts in dem starken Gesicht erkennen, das ihr ähnelte. Der Mann wandte den Kopf in ihre Richtung, als ob er ihren Blick auf sich gespürt hätte. Nicht einmal die graublauen Augen hatte sie mit ihm gemeinsam. Die ihres Vaters waren braun und wirkten kühl.
»Ah, da seid ihr ja endlich!«, rief er aus und eilte mit großen Schritten auf sie zu. »Meine geliebte Frau und meine sehnsüchtig erwartete Tochter.«
Ihr Vater streckte die Hände aus, und Leonore, verwirrt durch seinen Überschwang, stolperte und fiel ihm buchstäblich an die Brust. Bernardus verzog unwillig das Gesicht, worauf Leonore erschreckt zurücksprang.
»Mein Kind.« Ihr Vater lächelte nun wieder freundlich und hielt ihr die Hände entgegen. »Ich möchte dir Fulk von Calven vorstellen, einen guten Geschäftspartner. Schon sein Vater und ich haben gemeinsam Waren aus dem Heiligen Land nach Braunschweig geholt.«
Der Jüngere wandte sich ihr zu und nickte knapp zur Begrüßung. Sein Blick wanderte über ihr Gesicht und ihren Körper, und Leonore fühlte sich unwillkürlich wie eine Ware, die ein Kaufmann vor Geschäftsabschluss schätzte und deren Wert er erst nach gründlicher Prüfung festsetzen wollte. Doch sie verdrängte diesen dunklen Gedanken und lächelte dem Mann freundlich zu. Damit hoffte sie den Wünschen ihres Vaters Genüge zu tun.
»Ihr müsst erschöpft sein nach der langen Reise.« Bernardus wandte sich Konstanze zu. »Zeige meiner Tochter ihre Kammer. Wir reden später.«
Konstanze nickte stumm und winkte Leonore, ihr zu folgen. Die knickste und eilte Konstanze nach, die kein Wort mit ihrem Gemahl gewechselt hatte. Hinter sich hörte sie die Stimme des Kaufmanns, der ihr als Fulk von Calven vorgestellt worden war: »Ein wenig mager ist sie ja. Glaubst du, dass sie Söhne gebären kann?«
3
Braunschweig, Frühling 1177
Warum wollte ihr nie etwas gelingen? Selbst das weiche Licht der Kerze konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie wieder einmal gescheitert war. Leonore blickte auf das Stückchen Brokat, aus dem sie eine Kappe für Fulk hatte nähen wollen. Krumm und schief war sie, die Ecken fransten aus, und das ganze Tuch schien ihr vorwurfsvoll entgegenzurufen: »Stümperin!«
Gut, dass Herburgis schon schlief und Leonore nicht mit einer weiteren Predigt über die haushaltlichen Tugenden und Pflichten einer Ehefrau drangsalieren konnte. Leonore musste den Stoff verstecken, bevor Fulk nach Hause käme und ihn entdeckte. Sonst würde er ihr wieder wochenlang vorwerfen, dass sie den teuren Brokat für ihre kläglichen Nähversuche verschwendet hatte. Leonore seufzte und vergrub die verpfuschte Kappe in einer alten Truhe, in der sie viele ihrer Missgeschicke verbarg.
Mit schlechtem Gewissen begab sie sich in Blanches Zimmer. Wenn ihr etwas missglückt war und sie an sich zweifelte, suchte sie gerne Trost bei ihrer Tochter. Wenigstens eines war ihr in ihrem Leben gelungen. Vorsichtig öffnete sie die Tür, um die Kleine nicht zu wecken. Sie schlich auf Zehenspitzen an das Bett und schaute hinein. Ein Lächeln legte sich auf ihr Gesicht und verbannte alle dunklen Gedanken.
Blanche lag auf der Seite, die Hand zur Faust geballt und vor den Mund gehoben, als ob sie gleich hineinbeißen wollte. Sanft strich Leonore dem schlafenden Kind über den Kopf, hauchte ihm einen Kuss auf die Stirn und setzte sich auf die Truhe neben dem Bett. Im Licht des Mondes konnte sie die feinen Gesichtszüge ihrer Tochter deutlich erkennen. Wie hatte sie nur etwas so Wundervolles zuwege bringen können? Alles an Blanche war vollkommen. Von den zarten Fingern bis hin zu den honigfarbenen Locken. Die Kleine war ihr Ein und Alles, ein wunderbares Kind, das mit einem wachen Kopf und einem freundlichen Herzen durch die Welt ging. Leonore seufzte. Wenn nur Fulk bereit wäre, seine Tochter so zu lieben wie sie. Aber ihr Gemahl sah in Blanche lediglich einen Fehlschlag, einen weiteren Beweis dafür, dass er die falsche Frau geheiratet hatte. Nur ein Mädchen, hatte er nach der Geburt gesagt und seine Tochter seitdem kaum eines Blickes gewürdigt.
Leonore hatte ihm den ersehnten Stammhalter bisher nicht schenken könne. Nach Blanches Geburt vor sechs Jahren, die Leonore fast das Leben gekostet hätte, war sie nicht wieder schwanger geworden. Fulk machte ihr deshalb Vorwürfe. Ein Mann brauchte schließlich einen Sohn, dem er das Geschäft, das Haus und seinen Namen vererben konnte. Wie zur Bestrafung hatte sich ihr Gatte mehr und mehr von ihr zurückgezogen. Leonore vermutete, dass er sich der Gesellschaft anderer Frauen hingab, zog es jedoch vor, nicht darüber nachzugrübeln, wo Fulk seine Abende verbrachte. Herburgis hatte Andeutungen gemacht, die Leonore verletzen sollten, doch sie hatte sich dumm gestellt, und ihre Schwiegermutter hatte bald den Spaß an dem grausamen Spiel verloren. Leonore schauderte beim Gedanken daran, wie garstig Herburgis manchmal sein konnte.
Sie streichelte Blanches Hand und grübelte über den Weg nach, den ihr Leben seit der Ankunft in Braunschweig genommen hatte. Vom Regen in die Traufe war sie geraten. Nach wenigen Wochen im großen, aber lieblosen Haus ihres Vaters hatte sie gehofft, dass ein Prinz sie aus ihrem traurigen Schicksal als ungeliebtes Stiefkind befreien würde. Als Fulk von Calven um ihre Hand anhielt, sah Leonore in ihm die Möglichkeit, der Obhut ihres hartherzigen Vaters zu entkommen. Zwar war Fulk kein Königssohn, nur ein Kaufmann, doch in seinen nussbraunen Augen lag ein Hauch von Düsternis, der Leonore auf geheimnisvolle Weise anzog. In ihrer Naivität hatte sie geglaubt, dass Fulk nur der Liebe einer ergebenen Frau bedurfte, die seine Sorgenfalten mit Freundlichkeit vertrieb. Aber bereits in ihrer Hochzeitsnacht lernte sie, dass Fulks Dunkelheit aus seinem Innern entsprang. Sie bekam noch immer eine Gänsehaut beim Gedanken daran. Mit rohen Händen hatte er sie entkleidet, ohne Liebkosungen hatte er sich auf sie gestürzt und sie nach der vollzogenen Ehe alleine gelassen. Die halbe Nacht hatte sie zitternd wach gelegen und gefürchtet, dass er erneut über sie herfiele.
Doch Fulk hatte ihr keine sonderliche Aufmerksamkeit mehr geschenkt. Die Ehe vollzog er eilig und lieblos, schien nur danach zu trachten, einen Sohn zu zeugen. Bald hatte Leonore erkennen müssen, dass ihr Gemahl ein bitterer Mann war, der voller Zorn auf die Welt blickte. In der Verbindung mit Leonore sah er nur einen Handel, eine Vereinbarung, die sie beide erfüllen mussten. Immerhin brachte sie eine gute Mitgift mit in die Ehe. Ihr Vater hatte sich nicht lumpen lassen und war Fulks Erwartungen an die Heirat gerecht geworden. Leonore hingegen hatte ihren Teil des Geschäfts nicht einhalten können. Der Stammhalter ließ auf sich warten.
»Hast du geglaubt, dass dir so ein Kind einen Sohn gebären kann?«, hatte Leonore kurz nach Blanches Geburt die giftige Stimme ihrer Schwiegermutter vernommen. Vor der Tür ihrer Kammer hatten Fulk und seine Mutter sich lautstark gestritten.
»Mager ist sie vom Klosteressen und viel zu klein. Da kann nichts Vernünftiges draus kommen.«
Herburgis’ böse Worte hatten Leonore tief getroffen, doch Fulks Antwort verletzte sie noch mehr.
»Du wolltest ja, dass ich den Bund mit Bernardus schließe.« Seine Stimme senkte sich etwas. »Wer weiß, vielleicht stirbt sie ja bei der nächsten Geburt.«
Bei der Erinnerung an diese grausamen Worte lief Leonore ein kalter Schauer über den Rücken. Sie versuchte, die düsteren Gedanken abzuschütteln, denn Schwäche konnte sie sich nun nicht leisten. Ein letztes Mal beugte sie sich zu Blanche hinab und sog tief den Geruch ihres Kindes ein, der sie stets beruhigte. Dann ging sie in ihre Schlafkammer.
Wie alles in Fulks Haus zeugte auch das Ehegemach von Reichtum und gutem Geschmack. Das Himmelbett aus dunklem Holz war mit feinsten Schnitzarbeiten verziert und mit teuren Pelzen bedeckt. In den Eichentruhen warteten Gewänder aus Seide und Brokat auf Leonore, damit sie sich kleiden konnte, wie es sich für eine Kaufmannsgattin geziemte. An den Wänden zeigten bunte Teppiche aus Seide, dass Leonores Gemahl im fernen Orient gelebt hatte. Wie gerne wüsste sie mehr von seinen Abenteuern in der Fremde, doch Fulk hieß sie schweigen, sobald sie ihn danach fragte. Was war nur im Morgenland geschehen, das ihn so verbittert hatte? Leonore sah sich um, als ob die Wände ihr eine Antwort geben könnten. Sie fröstelte und kleidete sich für die Nacht um.
Selbst der heiße Stein, den eine Magd Leonore vorsorglich zwischen die Laken gelegt hatte, half nicht, die Kälte und das klamme Gefühl zu vertreiben. Leonore wickelte die Decken fest um sich und versuchte, in den Schlaf zu finden, bevor Fulk nach Hause zurückkehrte.
4
»Draußen warten zwei Fremde auf Euch«, flüsterte Aleidis und knetete ihre Hände. Die junge Dienstmagd hielt den Blick auf den Boden gesenkt. »Sie verlangen, Euch zu sprechen.«
»Wie heißen sie denn, du dumme Trine?« Fulks dunkle Stimme klang zornig. »Hast du nicht nach ihren Namen gefragt?«
»Ich … ich weiß nicht.« Die Kleine hob die Schultern und schluchzte auf. »Sie sind so absonderlich, dass mir gruselte.«
»Verschwinde!« Fulk holte tief Luft. »Sag ihnen, dass ich gleich bei ihnen sein werde.«
»Sei nicht so streng zu ihr.« Leonore legte Fulk eine Hand auf den Unterarm. »Sie ist doch noch ein Kind und erst seit ein paar Wochen in unserem Dienst.«
Mit einer unwilligen Geste schüttelte er sie ab. »Ich kann keinen Bauerntrampel brauchen, der meine Gäste empfängt.« Sein Zorn entlud sich auf sie. »Ich habe dir gleich gesagt, dass ein Mädchen vom Dorf nicht für ein Stadthaus taugt.«
Leonore zog die Hand zurück und biss sich auf die Unterlippe. An ihrem Gemahl vorbei starrte sie auf das Bild, das protzig die Wand zierte. Fulks Vater, der Mann, der den Fernhandel eröffnet hatte, schien sie spöttisch anzugrinsen. Sie strich sich mit einer fahrigen Geste eine Haarsträhne unter die Haube. »Sie wird sich noch machen …«
»Bauerntrampel aus Mackenthorpe«, unterbrach Fulk sie und gebot ihr Schweigen. »Nur, weil Deine Amme von dort kam.« Ein bösartiges Lächeln zog über sein Gesicht. »Aber gleich und gleich gesellt sich ja bekanntlich gerne.«
Leonore starrte ihn an, wieder einmal fassungslos ob der Grausamkeit, die er ihr entgegenbrachte. Aber sie würde nicht weinen. Heute nicht. Heute würde sie ihm den Triumph nicht gönnen. Trotzig streckte sie das Kinn vor und hielt seinem Blick stand. Fulk wollte gerade zu einer weiteren Gemeinheit ansetzen, als ein Klopfen ihren Streit unterbrach.
»Herr, die beiden Fremden warten auf Euch.« Guda, die ältere Magd, stand in der Tür. Ihre gedrungene Gestalt und ihr hocherhobenes Haupt zeigten deutlich, dass sie sich von niemandem herunterputzen lassen würde.
»Wie sind ihre Namen?«, herrschte Fulk sie an. »Oder hast du auch nicht gefragt?«
So schnell ließ sich die Magd nicht einschüchtern. »Heidnische Namen, die ich nicht auszusprechen vermag«, antwortete Guda, und ihre ganze Haltung drückte die Verachtung aus, die sie für Fremde im Allgemeinen und Heiden im Besonderen hegte.
»Heiden?« Fulk zog erstaunt eine Braue hoch. »Sarazenen?«
»Seht selbst. Sie tragen seltsame Gewänder und ihre Haut ist braun wie eine Haselnuss.«
Fulk war plötzlich ganz blass geworden. Ohne ein weiteres Wort eilte er in die Diele. Leonore blickte ihm erstaunt nach. Kannte er denn die Fremden? Fürchtete er sie?
Leonore wollte ihm nachgehen, doch ihre Schwiegermutter hielt sie auf.
»Glotz nicht wie eine Kuh. Der Haushalt erledigt sich nicht von alleine.« Herburgis ließ Leonore keine Zeit, sich mit den Besuchern zu befassen. »Folge mir, die Handarbeit wartet.«
Als Leonore mit ihrer Schwiegermutter in der Stube saß und Leinentücher bestickte, wanderten ihre Gedanken wieder zu den Fremden. Sie vermochte ihre Neugierde kaum zu zügeln. Von dunklen Männern in seltsamen Gewändern hatte die Magd gesprochen. Zu gerne hätte sie die Sarazenen einmal gesehen. Juden reisten öfter durch Braunschweig, um Gewürze und Stoffe zu verkaufen, doch Sarazenen war Leonore noch nie begegnet. Sollte sie unter einem Vorwand zu ihnen gehen, um ihre Neugierde zu stillen? Nein, lieber nicht. Fulk wünschte nicht, dass sie sich in seine Geschäfte einmischte, und sie hatte gelernt, dem Willen ihres Mannes zu gehorchen. Sie verbannte die Gedanken und versuchte, ihre Aufmerksamkeit wieder der Stickerei zu widmen.
Doch wie lästige Fliegen tauchten die Fragen wieder auf. Sarazenen in Braunschweig, in ihrem Heim! Was wusste sie über Morgenländer? Heiden waren das, die dunklen Göttern dienten und denen ein Menschenleben nichts bedeutete. Solche Menschen verlangten nun ihren Gemahl zu sprechen, und Fulk hatte sie empfangen. Was hatte es zu bedeuten, dass zwei dieser Götzenanbeter in ihrem Heim auftauchten? Vielleicht waren es Kaufleute, die Fulk in Jerusalem getroffen hatte, als er dort lebte. Vielleicht könnte sie von den Männern endlich etwas über die Zeit erfahren, über die ihr Gemahl nicht sprechen wollte. Leonore nagte an ihrer Unterlippe und grübelte. Sicher wollten die Sarazenen nur Waren bringen, versuchte sie sich zu beruhigen. Doch das nagende Gefühl einer Bedrohung wollte nicht weichen. Obwohl das Licht der Sonne ins Zimmer fiel und Leonore wärmte, ließ der Gedanke an die Fremden sie frösteln. Sie rieb sich die Arme. Der weiße Stoff, den sie mit roten und blauen Blüten besticken wollte, glitt von ihrem Schoß und fiel zu Boden.
»Träumst du etwa schon wieder? Heb das gute Leinen auf, bevor es dreckig wird!«, fuhr ihre Schwiegermutter sie an. Herburgis hatte bereits das zweite Tuch fertiggestellt und ordentlich gefaltet zur Seite gelegt, während Leonore nicht einmal die Hälfte des ersten Stoffes bestickt hatte. Sie brauchte nicht aufzusehen, um sich des missbilligenden Blicks ihrer Schwiegermutter gewiss zu sein. Wenn Leonore es Fulk schon kaum recht machen konnte, so war sie in Herburgis’ Augen eine vollkommene Versagerin. Ihre Stickerei zu grob, ihre Kochkünste zu schmal, ihr Benehmen zu derb und ihre Mitgift zu zart, wie oft hatte sie sich diese Litanei anhören müssen. Sie seufzte leise, bückte sich nach dem Tuch und legte es zur Seite.
Bevor Herburgis ihr erneut Vorwürfe machen konnte, erhob sich Leonore, nickte ihrer Schwiegermutter zu und verließ den Raum. Nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, atmete sie auf. Sofort meldete sich ihr schlechtes Gewissen, weil es ihr nicht gelang, ihrer Schwiegermutter Wärme und Freundlichkeit entgegenzubringen. Erneut eine lässliche Sünde, die sie beichten musste. Leonore seufzte. Vielleicht hatte es nur an Herburgis’ bedrückender Gesellschaft gelegen, dass sie sich vor den Fremden fürchtete. Sie musste die Heiden einfach sehen und sich vergewissern, dass ihre Ängste nur Hirngespinste waren. Leonore ging in die Küche und bat Detmud, die Köchin, um einen Krug Wein und Wasser. In dem Blick, mit dem die Frau ihre Bitte bedachte, lag nahezu ebenso viel Verachtung, wie Leonore sie von Herburgis zu spüren bekam. Man bittet Gesinde nicht, man befiehlt ihm, lautete das Credo ihrer Schwiegermutter. Leonore gelang es beim besten Willen nicht, der Köchin und den Mägden mit barscher Stimme Befehle zu erteilen, so wie Herburgis. Sie bat mit freundlichen Worten und erhob nie ihre Stimme. Das Gesinde jedoch war so sehr an den Ton ihrer Schwiegermutter gewöhnt, dass es Leonores Freundlichkeit nicht erwiderte und ihren Wünschen nur unwillig folgte.
Endlich ließ sich Detmud dazu herab, Leonore ein Tablett mit einem Krug Gewürzwein und einem Krug Wasser zu geben. Die stämmige Frau musterte Leonore von oben bis unten und murmelte etwas.
»Bitte?« Leonore mühte sich um Freundlichkeit, obwohl sie am liebsten aus der Küche geflohen wäre. Warum konnte die Köchin ihr nicht mit ein wenig Höflichkeit begegnen?
»Die Muselmanen trinken keinen Wein. Wisst Ihr das nicht?« Auf dem breiten Gesicht der Köchin lag ein unverschämtes Grinsen, und Leonore merkte, wie Röte sich auf ihrem Hals ausbreitete und ihre Wangen färbte. Sie ärgerte sich über diese Schwäche, die ihre Unsicherheit verriet.
»Natürlich weiß ich das«, antwortete sie und hoffte, dass ihre Stimme nicht zitterte. »Mein Gemahl jedoch wird sich über einen guten Gewürzten freuen.« Im Bewusstsein ihres kleinen Sieges drehte Leonore sich um und ging gemessenen Schrittes aus der Küche. Die Worte, die die Köchin ihr hinterherzischelte, konnte sie nicht verstehen. Sie bemühte sich, den Rücken gerade durchzustrecken und der Frau Stärke zu zeigen.
»Mein Gemahl, ich dachte, Ihr wünscht eine Erfrischung … nein, so etwas kann ich nicht sagen«, probte sie auf dem Weg zur Diele. »Guten Tag, ein kleiner Trunk für Euch und Eure Gäste.« Sie schüttelte den Kopf. Welche Worte konnte sie wählen, die natürlich und passend klangen? Herburgis und auch Konstanze hätten gewusst, wie sich eine gute Ehefrau zu verhalten hatte. Nur sie scheiterte an ihrer Unwissenheit. Leonores Courage sank. Mutlos wollte sie sich schon umdrehen und Wasser und Wein unverrichteter Dinge zurück in die Küche bringen, da zog ein Tumult ihre Aufmerksamkeit auf sich.
Aus der Kammer drangen laute Stimmen, die einen heftigen Streit vermuten ließen. Zaghaft klopfte sie an die Tür. Keine Antwort. Leonore stockte. Konnte sie es wagen, jetzt hineinzugehen und womöglich den Zorn der Männer auf sich zu ziehen? Und wenn die Sarazenen Fulk angriffen, ihn berauben wollten? War es nicht ihre Pflicht als Ehefrau, ihrem Gemahl beizustehen? Leonore biss sich auf die Unterlippe und ging kurzentschlossen in das Zimmer.
Sie erstarrte vor Schreck und hätte beinahe das Tablett aus den Händen verloren, als sie die drei Männer sah. Einer der Sarazenen, dessen weites weißes Gewand seine dunkle Haut betonte und Leonores Blick auf sich zog, sprach auf ihren Gemahl ein und fuchtelte dabei wild mit den Händen. Fulks Gesicht hatte alle Farbe verloren, Schweißtropfen standen ihm auf Stirn. Er schien vor seinem Gegenüber mehr und mehr zurückgewichen zu sein und stand nun mit dem Rücken an der Wand. Der Sarazene redete in seiner melodiös klingenden Sprache auf Fulk ein. Leonore meinte drei Worte zu erkennen, die der Fremde wieder und wieder in drängendem Ton nannte: »Mabruka«, »Haidar« und »Allkutz.
Was mochte sich hinter diesen Ausdrücken verbergen? Und wer waren diese Männer, die in ihr Haus eingedrungen waren, ihren Gemahl in Angst versetzten und ihn mit ihrem unverständlichen Kauderwelsch belästigten? Die feine Wolle ihrer Kleidung und ihr Gebaren, ihre stolze Haltung wies sie als Edelleute aus, doch was hatten Morgenländer hier zu schaffen? Selbst die Händler, mit denen Leonores Vater Geschäfte führte, ritten nie so weit ins Christenland. Es musste etwas Wichtiges sein, das die Sarazenen aus ihrer Heimat hierher getrieben hatte.
Leonore runzelte die Stirn und schluckte. Wäre es klüger, wenn sie unauffällig wieder verschwände, bevor sie in den Streit hineingezogen würde? Vorsichtig machte sie einen Schritt zurück, als der zweite Fremde sich ihr zuwandte. Er zischte mehrere Worte in seiner Sprache, und Fulk und der andere Sarazene ließen von ihrem Streit ab und starrten sie an. Unter den prüfenden Blicken der drei Männer fühlte Leonore, wie ihr die Röte den Hals hinaufkroch.
Ihre Wangen brannten, und sie wünschte, sich einen kühlenden Becher Wein an ihr Gesicht halten zu können. Stattdessen senkte sie den Blick und räusperte sich. »Eine Erfrischung an diesem warmen Tag, wenn es Euch genehm ist.«
Vorsichtig stellte sie das Tablett auf ein Tischchen, möglichst entfernt von den Männern und ihrem Zorn. Mit gesenktem Kopf ging sie rückwärts zur Tür und blieb kurz stehen, wie die Höflichkeit es gebot, als sie spürte, wie sich eine kleine Hand in ihre schob. Blanche! Auch ihre Tochter hatte wohl die Neugierde dazu getrieben, nach den Gästen des Vaters zu schauen, die auf schmalen, edlen Pferden angeritten waren und deren Kleidung sich so sehr von der ihren unterschied. Leonore schaute nach rechts. Neben ihr stand das Kind und blickte voller Staunen auf die Männer.
Leonore lächelte ihrer Tochter zu und flüsterte: »Sei höflich und begrüße unsere Gäste.« Sie wagte nicht, zu Fulk hinüberzusehen, dessen kaltes Schweigen sie ängstigte.
»Guten Tag. Herzlich willkommen in Braunschweig.« Blanches helle Stimme, voller Freundlichkeit und Vertrauen, brach die eisige Stille, und Leonore hätte ihr Kind gerne dafür umarmt.
Zwischen den Sarazenen und Fulk flogen nun wieder Worte hin und her, deren harter Tonfall Leonores erneut in Schrecken versetzte. Sie holte tief Luft und drückte Blanches Hand. Für ihre Tochter musste sie stark sein und sich Fulks Groll stellen. Ihr schien es am klügsten, schnell aus der Kammer zu eilen. Leonore knickste und wollte sich zurückziehen. Aber Fulks Stimme, dunkel und heiser vor Ärger, hielt sie auf. »Bleib. Sie wollen dich und das Kind ansehen. Schenk uns Wasser ein.«