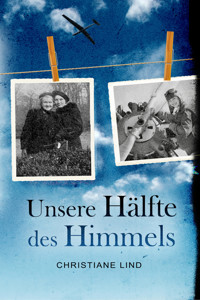7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der zweite Teil der großen Pilgerinnen Saga von Christiane Lind!
Jerusalem 1182. Durch Zufall kommt die Christin Leonore von Calden in den Besitz eines geheimnisvollen Pergaments, das die Macht im Heiligen Land ändern kann. Gemeinsam mit ihrem Geliebten, dem Muslimen Nadim, und ihren Kindern begibt sich Leonore auf eine abenteuerliche Flucht nach Damaskus.
Doch ihre Gegner schrecken vor nichts zurück und beauftragen die gefürchteten Assassinen, Leonore zu entführen. Wenn er seine große Liebe retten will, muss Nadim seinen Onkel um Hilfe bitten, doch der fordert einen hohen Preis …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Der zweite Teil der großen Pilgerinnen Saga von Christiane Lind!
Jerusalem 1182. Die Christin Leonore von Calven, Mündel des jüdischen Goldschmieds Salomon, wird in eine Verschwörung um die Heilige Lanze hineingezogen, an der ihr verstorbener Vater beteiligt war. Die Templer, Sybilla von Jerusalem und die geheimnisumwitterten Assassinen verfolgen die junge Frau, die im Besitz eines Pergaments ist, das die Macht im Heiligen Land ändern kann. Nadim, der Mann ihres Herzens bringt sie nach Damaskus in Sicherheit, doch alle Mühe ist umsonst: Leonore wird von den Assassinen auf die Burg Masyaf entführt. Nadim und sein Onkel Salah ad-Din verfolgen die Entführer und können Leonore befreien. Allerdings ohne das Pergament. Wird Nadim trotzdem weiterhin zu ihr halten?
Über Christiane Lind
Christiane Lind, geboren 1964, ist Sozialwissenschaftlerin und wuchs in Niedersachsen auf. Nach Zwischenstationen in Gelsenkirchen und Bremen lebt sie heute mit ihrem Ehemann und fünf Katern in Kassel. Bei atb ist ihr Roman »Die Heilerin und der Feuertod« lieferbar; 2015 erschien »Die Medica und das Teufelsmoor«.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Christiane Lind
Die Flucht der Pilgerin
Historischer Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Dramatis Personae
Prolog
Jerusalem
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Damaskus
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Burg Masyaf
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Glossar
Hintergrund: Die Bedeutung der Heiligen Lanze
Hintergrund: Zur historischen Einordnung von Leonores Geschichte
Weiterführende Literatur
Trivia und Danksagung
Impressum
Dramatis Personae
Leonore und ihre Familie
Leonore von Calven, Christin, die 1177 als Pilgerin nach Jerusalem reiste und mit Nadim ihr Glück fand
Nadim al-Malik, Karawanenführer und Großneffe Saladins
Blanchefleur, Leonores Tochter aus erster Ehe mit Fulk von Calven
Haidar,(arabisch: Löwe) Adoptivsohn Leonores und Nadims; sarazenischer Christ, der an seinem Glauben zweifelt
Gottfried Kahle, Leonores Vater, den Assassinen in Jerusalem ermordeten
Sadik, Diener Nadims und Leonores
Yasina,(arabisch: Gutes Herz) Dienerin in Salomons Haus
Ida Moller, Jerusalempilgerin aus Braunschweig
Die Franken
Balduin IV.*, König von Jerusalem; Sohn des Amalrich I., König von Jerusalem, und der Agnes von Edessa, leidet an Lepra
Sibylla von Jerusalem*, Prinzessin von Jerusalem, Tochter des Amalrich I., König von Jerusalem, und der Agnes von Edessa; in erster Ehe verheiratet mit Wilhelm VII., Markgraf von Montferrat; in zweiter und dritter Ehe verheiratet mit Guy de Lusignan
Balduin V.*, Sohn von Sibylla und ihrem ersten Ehemann Wilhelm von Montferrat
Guy de Lusignan*, Ehemann von Sibylla
Agnes von Courtenay/ Edessa*, Mutter von Sibylla
Renaud de Châtillon*, räuberischer christlicher Ritter, Herr zu Kerak, von Montreal und Graf von Moab
Gérard de Ridefort*, Marschall von Balduin IV. von Jerusalem und Seneschall der Templer
Raimund von Tripolis*, Regent des Königreichs Jerusalem bis 1176
Patriarch Heraclius von Caesarea* (auch: Heraclius von Jerusalem), bekannt für seinen ausschweifenden Lebenswandel
Pasque de Riviera*, stadtbekannte Mätresse des Jerusalemer Patriarchen
Die Muslime
Saladin / Salah ad-Din*, al-Malik al-Nasir Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, Sultan von Ägypten und Syrien: Christen sprechen von Saladin; Muslime von Salah ad-Din
Al-Qadi al-Fadil*, Ratgeber Salah ad-Dins
Ghazi,(arabisch: Eroberer, Krieger) Mabrukas Bruder und Haidars Onkel
Batal al-Salis, (arabisch: Sieger, Held) Freund Nadims in Damaskus
Nadiyah,(arabisch: schön wie der Morgen) Schwester von Nadims erster Frau und Konkurrenz für Leonore
Mabruka,(arabisch: Gesegnete) Haidars verstorbene Mutter
Sabin,(arabisch: Kühle Morgenbrise) vierte Ehefrau Batals und Freundin Leonores
Faiza,(arabisch: die Siegreiche) Mutter von Batal al-Salis
Chusama,(arabisch: Lavendel) erste Ehefrau von Batal al-Salis
Warda,(arabisch: Rose) zweite Ehefrau von Batal al-Salis
Sawsan,(arabisch: Lilie) dritte Ehefrau von Batal al-Salis
Amal,(arabisch: Hoffnung, Sehnsucht) stumme Dienerin in der Burg der Assassinen
Husam,(arabisch: Klinge, Schwert)Assassine
Raschid al-Din, (auch Sinan ibn Salman ibn Muhummad, Abu al-Hasan Sinan ibn Sulayman ibn Muhammad oder Raschid al-Din Sinan), genannt: Der Alte vom Berge, Sektenführer der Assassinen in Syrien
Khalid,(arabisch: beständig) Diener des Goldschmieds Salomon
Die Juden
Salomon, Goldschmied und Händler
Ruth,(jüdisch: Freundschaft) Salomons Nichte und Leonores Freundin
Aharon,(jüdisch: singend) Ruths Ehemann
Chajm,(jüdisch: Leben) Ruths Sohn
Die Tiere
Fahkir,(arabisch: prächtig, herrlich) Hengst des Nadim
Bint al Hawa,(arabisch: Tochter des Windes) Leonores Schimmelstute
Dau al Gamar,(arabisch: Mondlicht) Schwester Bint al Hawas
Husu at Tali,(arabisch: Glücksstern) Fohlen Dau al Gamars
Razouna,(arabisch: sanftmütig) Leonores Kamel
Schunra,(aramäisch: Katze) Salomons Katze
Tarub,(arabisch:fröhlich, vergnügt) Katze, die Nadim Leonore und den Kindern schenkt
Dau Ash Shams,(arabisch: Sonnenschein) Hengst des Salah ad-Din
Prolog
Heiliges Land 1176
»Ihr seid Euch gewiss, Gottfried?« Die schwarzen Augen des Sarazenen blickten in die Runde, seine Gesichtszüge waren im Halbdunkel nur zu erahnen. Er wirkte fehl am Platz in der ärmlichen Hütte, ebenso wie die anderen, gut gekleideten Männer, die sich hier vor den Toren Jerusalems versammelt hatten. Auf einem schiefen Tischchen in der Mitte des kleinen Raums stand ein silbernes Tablett mit zwei Karaffen und fünf Kelchen. Der Duft einer angeschnittenen Orange überlagerte den Geruch von Armut, der in der Hütte schwebte. »Uns bleibt keine andere Möglichkeit?«
»Ich bin mir sicherer, als mir lieb ist«, entgegnete der Ritter im Habit eines Templers und wirkte besorgt. Dunkle Ringe zeichneten sich unter seinen Augen ab und er sah aus, als ob er mehrere Nächte schlecht geschlafen hätte. Er griff nach der Karaffe und goss roten Wein in einen Kelch, aus dem er trank wie ein Verdurstender. »Wir müssen handeln oder …« Seine Stimme brach, und er holte tief Luft.
»Der zerbrechliche Frieden im Heiligen Land zwischen Muslimen und Christen liegt in Eurer Hand.« Ganz ruhig klang die Stimme des Sarazenen, als er die bedeutsamen Worte aussprach. Ihnen folgte Schweigen, so als wären sich alle Anwesenden ihrer Tragweite bewusst.
»Denkt Ihr, das weiß ich nicht?«, antwortete der erschöpfte Ritter endlich und strich sich mit der Hand das Haar aus der Stirn. »Nun, da der Kriegstreiber Renaud de Châtillon durch Heirat zum Herrn von Oultrejourdain geworden ist, wird Saladin das Königreich Jerusalem angreifen, um einem Angriff Renauds zuvorzukommen.«
Er trank einen Schluck Wein. Dann stieß er einen tiefen Seufzer aus.
»Ich wünschte, wir hätten das Pergament nie entdeckt.«
»Darf ich es sehen?« Der Sarazene beugte sich vor. Er griff nach der zweiten Karaffe und goss sich Wasser ein, das nach Rose und Zitrone duftete. Dabei umklammerte er den Kelch, als müsste er seine Hände beschäftigen.
»Bitte.« Gottfried Kahle schlug seinen Umhang zurück und holte ein Pergament aus dessen Tiefen. Mit einem schiefen Lächeln reichte er es seinem Gegenüber.
Ehrfurchtsvoll nahm der Sarazene das Schriftstück entgegen. »Wie viel Macht in diesem Pergament steckt. Ihr hattet recht, die Feder ist weitaus mächtiger als das Schwert.«
»Nun denn, noch ist es niemandem gelungen, das Schriftstück zu entschlüsseln.« Gottfried trank einen weiteren Schluck Wein. »Wir müssen glauben, dass es den Standort der Heiligen Lanze verrät.«
»Was wollt Ihr mit diesem Wissen anfangen?«, mischte sich der dritte Mann in das Zwiegespräch ein. Seine Kleidung wies ihn als Juden aus. »Wollt Ihr es offenbaren oder für immer verbergen?«
»Wenn ich das nur wüsste.« Der Ritter rieb sich mit der Hand die Stirn, als hätte er Kopfschmerzen. »So eine Entscheidung sollten Könige treffen, nicht einfache Menschen wie wir.«
»Ihr könntet das Pergament König Balduin überreichen. Er kann es nutzen, um seine Macht zu stärken.« Der Jude griff nach einem Stück Obst. »Der Besitz der Heiligen Lanze gäbe ihm die Oberhand gegenüber den kriegstreiberischen Falken an seinem Hof.«
»Denkt Ihr wirklich, dass der König von Jerusalem der Richtige wäre? Noch ist er stark genug, sich ohne dieses Hilfsmittel auf dem Thron zu halten.« Der Sarazene seufzte. »Oder wollt Ihr es dem Sultan von Ägypten geben, damit er die Frandsch vertreibt?«
»Besser nicht, obwohl ich oft denke, dass das Heilige Land unter der Herrschaft von Salah ad-Din ein freundlicherer Ort wäre.« Gottfried Kahle seufzte. Die Falten in seinem Gesicht schienen noch tiefer geworden zu sein; er sah aus wie ein Mann, der zu vieles gesehen und erlebt hatte. »Ich dachte an den Grafen von Tripolis. Er versteht euch Muslime besser als jeder andere Christ …«, Gottfried nickte dem Sarazenen zu, »… und wünscht sich einen dauerhaften Frieden.«
»Eine gute Wahl. Ein ehrenhafter Mann.« Der Sarazene neigte zustimmend den Kopf. »Wollt Ihr dem Herrn von Tripolis heute bereits die Macht übergeben?«
»Nein. Noch ist König Balduin stark genug.« Gottfried Kahle zuckte mit den Schultern. »Ich werde zurück nach Braunschweig reisen und das Pergament dort jemandem geben, dem ich vertraue und der es hoffentlich entschlüsseln kann.«
»Das ist eine kluge Entscheidung.« Der Jude nickte. »Sorgt nur dafür, dass wir es zur rechten Zeit wiedererhalten werden.«
»Woran wollt Ihr die richtige Zeit erkennen?« Der Sarazene neigte fragend den Kopf zur Seite. »Wer soll diese Entscheidung treffen?«
»Kismet.« Der Jude lächelte. »Nennt Ihr das Schicksal nicht so?«
»Ja, doch wir glauben auch daran, dass wir manchmal dem Schicksal nachhelfen müssen. Vertraue Allah – aber binde dein Kamel an, sagt man bei uns.« Ein leichtes Lächeln huschte über das dunkle Gesicht des Sarazenen und ließ ihn jünger aussehen.
»Vielleicht.« Der Jude hob die Schultern. »Vielleicht werdet Ihr die Bürde dann nicht mehr tragen müssen.«
»Seid vorsichtig auf Eurer Reise, Gottfried.« Der Sarazene blickte voller Ernst und Zweifel. »Meine Spione warnten mich vor den Tempelrittern. Eure Brüder haben von dem Pergament erfahren und würden sicher alles tun, um es in ihre Hände zu bekommen. Mit dem Wissen um die Heilige Lanze könnten sie ihre Position im Königreich stärken.«
»Ich weiß.« Gottfried nickte. »Ich werde heute aufbrechen.«
»Ist die Gefahr, die wir eingehen werden, nicht dennoch zu groß?« Der Jude holte tief Luft und musterte die anderen Männer. Auf allen Gesichtern zeichneten sich Erschöpfung und Sorge ab, aber auch eiserne Entschlossenheit.
Der Sarazene strich sich mit der Hand durch den Bart. Sein Gesicht war von tiefen Falten geprägt. »Auf unserer Seite gewinnt Salah ad-Din an Macht. Er ist der erste Herrscher, dem ich zutraue, alle Muslime zu einen.«
»Auf unserer Seite …«, der Ritter namens Gottfried lächelte schief, als ob ihm die Zugehörigkeit zu einer Seite schwerfiele, »… gewinnen die Falken an Macht. Mit der Freilassung de Châtillons ist einer der wildesten Kriegstreiber wieder auf dem Spielfeld.«
»Mein Volk wird keinen Krieg führen, aber wir haben bisher unter jedem leiden müssen.« Der Jude schwieg einen Augenblick. »Ich bin bereit, mein Leben für einen dauerhaften Frieden einzusetzen.«
»Das erscheint mir nicht nötig.« Gottfrieds Begleiter, ein Mann, dessen asketische Gesichtszüge und tintenbefleckte Finger ihn als Schreiber oder Philosophen auswiesen, mischte sich erstmals in das Gespräch. »König Balduin mag geschwächt sein von der Lepra, aber mein Zögling bleibt ein kluger König, der Frieden auf seiner Agenda führt. Falls es jedoch zu einem Krieg kommt, wird er sich zu verteidigen wissen.«
Er beugte sich nach vorn. Das Licht der Kerzen ließ seine Augen nahezu schwarz wirken. Der Franke, gekleidet in edles Tuch und bewaffnet mit einem Schwert, strahlte Ruhe und Selbstsicherheit aus. Obwohl er mit leiser Stimme gesprochen hatte, lauschten ihm alle konzentriert.
Die Männer tranken etwas und stärkten sich mit den Fladen, die auf einem irdenen Teller lagen.
»Aber …« Gottfried runzelte die Stirn. Es fiel dem Ritter sichtlich schwer, die Worte auszusprechen, die ihn drängten. »Es tut mir leid, mein Freund.« Er legte dem Schreiber eine Hand auf die Schulter. »Aber wie lange wird Balduin noch leben? Wer wird sein Nachfolger werden?«
Das Schweigen, das Gottfrieds Frage folgte, lastete auf den Männern wie eine düstere Wolke, die einen Sommertag verdunkelte. Endlich antwortete der Ritter. »Fünf, vielleicht zehn Jahre wird mein Zögling gegen den Aussatz kämpfen können. Dann wird die furchtbare Krankheit ihm das Leben nehmen.«
»Lasst uns in fünf Jahren wieder hier treffen. Dann kennen wir das Schicksal des Königs.«
»In fünf Jahren.« Gottfried nickte. Er seufzte. »Vielleicht wird es unseren Völkern bis dahin gelingen, friedlich miteinander zu leben.«
»Fünf Jahre also.« Der Sarazene sprang auf. Er wirkte wie ein Mann, der sich auf dem Rücken eines Pferdes oder eines Kamels wohlfühlte. Nicht wie einer, der in dunklen Höhlen politische Intrigen spann. »Lasst uns unser Geheimnis bewahren und uns in fünf Jahren erneut beraten.«
Die anderen nickten. Auch sie gingen zu ihren Pferden und sprengten eilig davon. Nur Gottfried Kahle blieb zurück. Er wandte sich um und sagte leise ins Innere der Hütte hinein: »Habt Ihr genug gehört, mein Herr?«
Ein Vorhang raschelte leise und ein weiterer Mann trat ins Licht der Kerzen. Seine Kleidung wirkte edel, aber bescheiden, so als ob er sie bewusst angelegt hätte, um nicht aufzufallen. Trotz der Hitze hüllte er seine Hände in Handschuhe und trug einen Turban und einen Schleier, der das Gesicht verdeckte. Nur seine hellen Augen waren zu sehen.
»Ich danke Euch, Herr Gottfried.« Die Stimme des Königs klang gepresst, als ob er unter Schmerzen litt. »Dank Eurer Bemühungen ist der Frieden im Heiligen Land in guten Händen. Für eine Zeit gewiss.«
»Ja, Herr.« Gottfried verneigte sich. Er musterte den Mann mit sichtlicher Hochachtung. »Seid Ihr wahrhaft sicher, dass ich das Pergament außer Landes schaffen soll?«
Der Tempelritter war nicht überzeugt davon, dass das Schriftstück den Standort einer der wichtigsten Reliquien des christlichen Glaubens verriet. Allzu oft waren er und andere Tempelritter auf Fälschungen hereingefallen. Ganz zu schweigen davon, dass der Kaiser von Konstantinopel darauf beharrte, die Lanze, gespickt mit Nägeln des Kreuzes, an dem Jesus Christus starb, in seinem Besitz zu haben.
»Ich will gewiss sein, dass es nie in die gierigen Hände meiner Schwester gerät.« Ein bitteres Lachen, tief und dunkel, begleitete die Worte. »Sibylla ist nicht zu trauen. Ich fürchte, dass sie mich und die Krone verraten wird.«
Gottfried Kahle nickte, denn er teilte die Meinung des Königs von Jerusalem. Prinzessin Sibylla war eine Gefahr für den Frieden, da sie sich von den Falken beschwatzen ließ.
»Ich wünsche Euch eine gute Reise.« Balduin von Jerusalem reichte dem Ritter die behandschuhte Hand. »Auf dass Ihr das finden mögt, was Euch in die Heimat zurückzieht.«
»Ich danke Euch, Herr.« Gottfried verneigte sich. In einer fließenden Bewegung drehte er sich um und ging zu seinem Pferd. Der Rappe schnaubte, als ob er die weite Reise nach Braunschweig nicht erwarten könnte. Gottfried klopfte den Hals des Tieres. »Ich werde dich vermissen, mein Guter. Aber unsere Wege trennen sich bald.«
Jerusalem
Kapitel 1
Das Heilige Land 1181
Die Sonne stand am Zenit und strahlte unbarmherzig auf die Kämpfenden herab. In der Mittagshitze erklangen die Schreie der Verwundeten und Sterbenden und übertönten das Krächzen der Aasvögel, die am Himmel ihre Kreise zogen und auf reiche Beute warteten. Über dem Schlachtfeld lagerte der Gestank des Schweißes von Männern und Pferden und vermischte sich mit dem Geruch von Blut, das aus zahllosen Wunden strömte.
Gelb wirbelten die Hufe der Schlachtrösser und die eisenbewehrten Füße der Ritter den Sand der Wüste auf. Wie ein goldener Schleier wogte der Wüstenstaub um die Gestalten. Franken und Sarazenen droschen mit gewaltigen Hieben und unter heftigem Klirren der Schwerter und Krummsäbel aufeinander ein. Auf den Gesichtern der Kämpfenden hielten sich Erschöpfung und Kampfeslust die Waage. So bald würde diese Schlacht nicht enden.
Ein Ritter im Umhang eines Templers galoppierte mit erhobenem Schwert auf den waffenlosen Nadim al-Malik zu. Die Augen des schwarzen Schlachtrosses rollten. Schaum flog vom Maul des Pferdes und Schweiß hinterließ dunkle Streifen auf seinen Flanken und dem Hals. Der Tempelritter hatte den Mund aufgerissen und schrie ihm eine Beleidigung entgegen, die Nadim jedoch nicht verstehen konnte. Zu laut dröhnten die Hufe des heranrasenden Rappens und die Schreie der Männer um ihn herum in seinen Ohren. Blut hatte den ehemals strahlend weißen Umhang des Angreifers besudelt und verdeckte beinahe das Zeichen der Templer – das achtspitzige rote Tatzenkreuz, das Symbol ihres ewig währenden Kampfes gegen die Feinde Christi.
»Stirb, du Hund!« Der Ritter beugte sich vor und holte mit aller Kraft aus. »Gott will es!«
Im letzten Augenblick warf sich der Sarazene zur Seite und konnte dem tödlichen Schlag knapp ausweichen. Nadim strauchelte und hielt sich die schmerzende Seite. Ein gut gezielter Hieb einer Kriegsaxt hatte ihn vor kurzem getroffen und beinahe getötet. Der lange Kampf, der seit dem Morgengrauen wogte, hatte Nadim al-Malik gezeichnet. Erschöpfung malte sich auf seinem dunklen Gesicht und er stolperte erneut, als er sich zu dem Templer umdrehen wollte. Blut rann aus einer Stirnwunde über die rechte Wange und fing sich in seinem schwarzen Bart. Wüstenstaub hatte sich auf die Wunde gelegt und verlieh Nadim einen verwegenen Ausdruck. Verzweifelt blickte er um sich und suchte nach einer Waffe, mit der er dem Ritter entgegentreten konnte. Den Gefallenen in seinem Blickfeld hatten Kämpfer bereits Schwerter und Äxte abgenommen, um ihr eigenes Leben zu verteidigen. Nadim hob eine Hand und wischte sich Blut und Schweiß aus dem Gesicht und beschattete die Augen.
Im Licht der Sonne blendete ihn das Weiß des Templergewands, und das Tatzenkreuz auf der Brust des Ritters leuchtete blutrot. Der Ritter kam aus der Sonne geritten wie ein Dschinn und galoppierte erneut auf Nadim zu. Der Sarazene sprang einen Schritt zur Seite und versuchte, ihn mit einem gewaltigen Satz von dem schwarzen Hengst zu zerren, doch der Angreifer widerstand und schlug ihm die kettenbewehrte Faust ins Gesicht. Blut schoss aus Nadims Nase, und er fiel rückwärts in den hellen Sand, den die Sonne erwärmt hatte und der glühte wie ein Feuer in der nächtlichen Wüste.
Nadim al-Malik rollte sich zur Seite und erhob sich auf die Knie. Sein Blick fiel auf eine rettende Waffe. Mit zwei Schritten gelangte er an die Seite eines gefallenen Franken und zerrte mit letzter Kraft ein Schwert unter der Leiche hervor. Breitbeinig stellte er sich auf, das Metall zur Abwehr erhoben.
Der Templer hatte sein Schlachtross gewendet und griff erneut an. Wuchtig prallten die Schwerter aufeinander. Mit so viel Wucht, dass Nadim al-Malik auf die Knie fiel und der Templer vom Pferd geschleudert wurde. Beide Männer rappelten sich auf und standen sich gegenüber. Sie maßen sich mit ihren Blicken, die Waffen zum Kampf bereit.
»Gérard de Ridefort«, knurrte Nadim al-Malik, als er seinen Gegner erkannte. »Ich habe Euch erwartet.«
»Erwarte stattdessen den Tod, Heide«, zischte der Templer und drang mit wuchtigen Hieben auf Nadim ein. Dieser wich zurück und parierte den Hieb. Um die beiden Männer herum wogte die Schlacht, deren Härte und Gewalt Gesichter und Körper von Franken und Sarazenen gleichermaßen zeichnete. Die glühende Sonne der Wüste legte ein Flirren über die Kämpfe, was diese noch unwirklicher erscheinen ließ.
Ein sterbender Franke, dem ein Pfeil aus dem Hals ragte, torkelte auf Nadim al-Malik zu und riss ihn im Todeskampf zu Boden. Der Sarazene verlor sein Schwert und versuchte verzweifelt, den Sterbenden von sich zu stoßen. Endlich rollte der Franke zur Seite und Nadim war wieder frei. Benommen versuchte er sich aufzurappeln, doch der Tempelritter war schneller.
»Nie wieder wirst du eine Christin schänden«, schrie Gérard de Ridefort. In seinen Augen blitzte Mordlust, als er in der sicheren Gewissheit seines Sieges das Schwert hob und zustieß.
******
Schreiend erwachte Leonore, schlug um sich und rang nach Luft. Nur langsam kehrte sie zurück aus dem Alptraum, der sie in seinen Klauen gehalten hatte. Sie starrte in die Dunkelheit, noch immer gefangen in dem Schrecken der Schlacht, die sie im Traum so lebendig vor sich gesehen hatte. Endlich erkannte sie, dass sie in ihrem sicheren Haus war, in ihrem Bett lag. Allerdings war sie allein, weil Nadim eine Karawane von Jerusalem nach Tyrus begleitete.
Das hatte er jedenfalls gesagt, bevor er vor zehn Tagen aufgebrochen war, jedoch ohne ihr dabei in die Augen zu sehen. Vielleicht erklärte das ihre dunklen Träume. Leonore fürchtete, dass Saladin, der Sultan von Ägypten und Syrien, ihren Geliebten für einen seiner geheimen Aufträge eingebunden hatte. Eine Mission, die höchstwahrscheinlich gefährlich und möglicherweise sogar tödlich war. Wie oft hatte Leonore Nadim angefleht, sich nicht in Gefahr zu begeben.
»Denk an Flordelis. Wenn du schon nicht für mich zu Hause bleiben kannst.« Leonore hatte verzweifelt die Hände gerungen. »Soll deine Tochter ohne dich aufwachsen?«
»Ich verspreche dir, vorsichtig zu sein.« Auf Nadims Gesicht hatte sich tiefer Schmerz abgezeichnet, doch er hatte nur den Kopf geschüttelt. »Ich muss es tun. Für die Ehre …«
Von deiner Ehre können wir nicht leben, wenn du stirbst, hätte Leonore am liebsten geschrien, doch sie wusste, dass der Streit sinnlos war. Nadim, der sonst so liebevoll und freundlich war, verwandelte sich in einen stoischen Krieger, sobald sein Großonkel Saladin ihn dorthin rief, wohin ihn seine Suche nach Verbündeten trieb. Auf dem Markt hatte Leonore Gerüchte gehört, dass Saladin auf dem Weg nach Damaskus wäre, um dort ein Heer aufzubauen.
Vor einiger Zeit, kurz vor Flordelis’ Geburt, hatte Nadim Leonore gebeichtet, warum er Saladin so treu ergeben war. Der Sultan von Ägypten hatte Nadim wie seinen eigenen Sohn aufgezogen, nachdem dessen Eltern einer Seuche erlegen waren. Die Heirat mit Saladins Nichte Najmah hatte Nadim noch stärker an die Familie seines Ziehvaters gebunden. Seit dem tragischen Tod seiner Frau, über den Nadim nie sprechen wollte, fühlte er sich Saladin mehr denn je zu ewigem Dank verpflichtet.
All das vermochte Leonore zu verstehen, dennoch wünschte sie sich oft, sie und ihre Kinder würden ihm mehr bedeuten als seine Ehre. Wenn Nadim auf einer der Reise verletzt oder gar getötet würde … Leonore wagte es nicht, den Gedanken zu Ende zu spinnen. Was würde aus ihr und ihren Töchtern werden, ohne den Schutz eines Mannes?
Sie schüttelte den Kopf, strich sich über das Haar und atmete tief ein. Ein Schluck Gewürzwein würde sie sicher beruhigen und ihr den Schlaf wiederbringen. Wenn sie aufstünde, könnte sie gleich nach ihren Töchtern sehen. Der Anblick der Mädchen würde den furchtbaren Traum sicher verdrängen.
Als sie sich aufsetzte, spürte sie Übelkeit in sich aufwallen. Eine Nachwirkung des Traums? Anzeichen einer Krankheit? Oder etwa? Leonore holte tief Luft. Konnte es sein? Sie legte eine Hand auf den Bauch, strich sich sanft darüber und rechnete im Kopf nach. Ja, es konnte sein, dass … Ihr Lächeln wurde breiter und ging dann in einen Seufzer über. Warum war Nadim heute Nacht nicht bei ihr?
Kapitel 2
Nadim konnte es nicht erwarten, endlich seine Mission zu beenden, um zu Leonore und den Kindern zurückzukehren. Er konnte nur hoffen, dass sein Onkel nicht noch einen Auftrag für ihn hatte, der ihn erneut auf Reisen führen würde. Schließlich erwartete Leonore ihn spätestens in vier Tagen zurück. Er bereute es, dass er ihr nicht die Wahrheit über seine Reisen gesagt hatte, aber er fürchtete, sich zwischen seiner Liebe und seinem Onkel entscheiden zu müssen.
Fahkir stolperte, was Nadim aus seinen Gedanken zog. Aufmunternd klopfte er seinem Hengst auf den Hals. Das Pferd war ebenso erschöpft wie er. Endlich sah Nadim die Silhouette der Stadt Irbid am Horizont. Glücklicherweise hatte Salah ad-Din diesen Treffpunkt vorgeschlagen und erwartete nicht, dass Nadim sich auf den weiten Weg nach Damaskus machte.
Nachdem Nadim das Stadttor durchquert hatte, wandte er sich nach links, wie es sein Onkel ihm geschrieben hatte. Vor einem unauffälligen Wohnhaus hielt er seinen Hengst an und übergab ihn einem herbeigeeilten Diener.
Nachdem er seinem Pferd noch einmal über den Hals gestrichen hatte, öffnete Nadim die Haustür und trat ein. Es roch nach brennendem Holz und würzigen Kräutern, die jemand im Herd verbrannte. Nadim betrat die Küche, wo sein Onkel bereits auf ihn wartete.
»Mein lieber Neffe, teuer mir wie ein Sohn.« Salah ad-Din trat auf Nadim zu und umarmte ihn. »Gut, dich zu sehen. Was hast du in Erfahrung gebracht?«
»Wenig Gutes, fürchte ich.« Nadim trat an das Tischchen heran, auf dem ein Teller mit Datteln, Feigen und Orangenspalten neben einer Karaffe voll Wasser stand. Der Sarazene war erschöpft. Dunkle Ringe lagerten unter seinen Augen und der Staub der Wüste fand sich in Bart und Haaren. Auch seine Kleidung hatte gelitten. Der lange Ritt durch die Wüste hatte deutliche Spuren hinterlassen. Er goss sich Wasser ein und trank gierig. Wohl wissend, dass er die schlechten Neuigkeiten, die seine Ankunft begleiteten, nur kurz zurückhalten könnte. »Die Beduinen zeigten wenig Bereitschaft, sich mit dir zu verbünden, um gegen die Frandsch in den Krieg zu ziehen.«
»Diese Dummköpfe!« Salah ad-Din ließ sich auf den leuchtend roten Diwan fallen. Nadim sah sich im Gemach um: Es war ein prachtvoller Raum. Auf dunklen Tischen mit hellen Intarsien standen silberne Vasen mit Lilien, deren Duft betäubend war. Teppiche in Rot und Gold oder Blau und Silber schmückten die Wände. Niemand konnte Salah ad-Din vorwerfen, dass er nicht zu leben verstand. Doch im Augenblick hatte der Sultan keinen Sinn für die Schönheit, die ihn umgab. »Was für ein Dummkopf«!«, empörte er sich.
»Ich fürchte, er traut dir nicht.« Nadim nahm sich eine Feige, zerteilte sie mit einem silbernen Messerchen und genoss die milde Süße der Frucht.
»Hat er das gesagt?« Salah ad-Din sprang auf. Seine Augen blitzten, und er wirkte wie ein gereizter Kater. »Hat er es gewagt, mir etwas zu unterstellen?«
»Nein.« Nadim lächelte und schüttelte den Kopf. »Dafür ist er zu klug. Er hat viel über Macht philosophiert und dass es nie gut ist, wenn ein Mensch zu viel davon besitzt. Du kennst ihn.«
»Ich habe nichts anderes erwartet«, entgegnete Salah ad-Din etwas ruhiger.
»Gib ihm Zeit«, erklang eine dunkle Stimme von der Tür. Nadim sah auf und erkannte Salah ad-Dins Freund und Berater.
»Al-Qadi al-Fadil, wie schön, Euch zu sehen.« Nadim nickte dem buckligen Mann zu. »Wisst Ihr mehr als ich?«
»Man hört so einiges.« Al-Qadi al-Fadil neigte lächelnd den Kopf. »Wir werden am langen Ende siegen und die Frandsch aus unserer heiligen Stadt al-Quds vertreiben. Kul uqda wa laha halla. Jeder Knoten wird von jemandem gelöst.«
»Hoffen wir, dass Ihr recht habt.« Nadim setzte sich Salah ad-Din gegenüber auf einen Stuhl.
Auch Al-Qadi al-Fadil zog sich einen Stuhl heran und nahm etwas abseits Platz. Wie typisch für den Ratgeber, dachte Nadim. Stets dabei, aber nie mitten im Geschehen.
Die drei Männer beratschlagten das weitere Vorgehen. Nach einer Weile schloss Nadim die Augen und überließ Al-Qadi al-Fadil und Salah ad-Din das Reden. Seine Gedanken wanderten. Zu Leonore und seinen Töchtern. Er hoffte, dass Salah ad-Dins Pläne, Verbündete für seinen Feldzug gegen die Christen zu finden, bald zu einem Abschluss kamen, damit Nadim mehr Zeit bei seiner Familie verbringen könnte. Und gleichzeitig fürchtete er, dass Salah ad-Dins Bestrebungen bald Erfolg trügen und sich ein Heer gegen die Frandsch zusammenfände. Die Folgen für Leonore, ihre Töchter und sich wollte Nadim sich nicht ausmalen.
»Mein Neffe droht einzuschlafen.« Salah ad-Din lachte leise. Nadim öffnete die Augen und erwiderte das Lächeln seines Onkels. »Al-Qadi al-Fadil, ich danke Euch. Lasst uns morgen weiterreden.«
Der Ratgeber verabschiedete sich mit einem Nicken und verschwand so unauffällig, wie er gekommen war.
»Du willst heute noch zurück nach Jerusalem reiten, nehme ich an?« Kam es Nadim nur so vor oder musterte Salah ad-Din ihn kritisch. »Zurück zu …«
»Leonore.« Nadim unterdrückte ein Seufzen. Er fühlte sich zu erschöpft für einen weiteren Disput mit seinem Onkel. »Zu meiner Frau und unseren Töchtern.«
»Wie kann sie deine Frau sein?« Salah ad-Din war aufgestanden und spießte eine Dattel mit dem Messer auf, als ob die Frucht ihn verärgert hätte. »Sie gehört nicht dem wahren Glauben an.«
»Bitte, Onkel, nicht wieder …«
»Ich liebe dich wie einen Sohn«, unterbrach ihn Salah ad-Din. »Daher schmerzt es mich tief, dass du dir nicht eine Frau des wahren Glaubens nimmst. Eine wie Najmah.«
»Lass Najmah aus dem Spiel.« Nadim sprang trotz seiner Erschöpfung auf. Sein Gesicht verdunkelte sich vor Zorn. »Akzeptiere meine Liebe zu Leonore oder sprich nie wieder von ihr.«
»Entschuldige.« Salah ad-Din neigte den Kopf. »Du musst verstehen. Es schmerzt mich, dich ohne Ehefrau und Sohn zu sehen.«
»Bitte.« Nadim hob abwehrend die Hände. »Es war eine lange Reise und ein noch längerer Tag.«
»Wenn du schon mit einer Christin leben willst, kommt wenigstens zu uns nach Damaskus.« Salah ad-Din lächelte entschuldigend, aber Nadim war sicher, dass der Sultan dieses Thema erneut zur Sprache bringen würde. »Du weißt, dass der Krieg gegen die Frandsch, die in unser Land eingefallen sind und unsere Pilger angreifen, nur eine Frage der Zeit ist.«
»Wer wüsste das besser als ich.« Nadim schloss einen Augenblick die Augen. »Leonore wird nicht in Damaskus leben wollen.«
»Seit wann entscheidet die Frau?« Salah ad-Dins Lächeln verschwand und wich einer sorgenvollen Miene. Nadim war es müde, dem Sultan sein Leben erklären zu wollen. Er winkte nur ab, jedoch mit einem Lächeln, um seinen Onkel nicht zu verärgern. »In Al-Quds droht dir Gefangenschaft, wenn nicht der Tod.«
»Sorge dich nicht.« Nadim bemühte sich zu verbergen, dass auch er Jerusalem lieber heute als morgen verlassen hätte. Als Muslim fühlte er sich wie ein Gefangener in der Stadt, die von den Christen besetzt war. »Leonore steht unter dem Schutz der Prinzessin.«
»Sibylla.« Salah ad-Din schnaubte verächtlich. »Die Prinzessin wird dich verraten. Wenn es ihr nutzt.«
»Noch nutze ich ihr genug, dass sie mich schützt.« Nadims Gesicht blieb ausdruckslos. Er wollte nicht mit Salah ad-Din über seine Sorgen sprechen. Sosehr er den Sultan verehrte und schätzte, niemals würde Salah ad-Din Nadims Liebe zu Leonore verstehen können.
»Illi byil 'ab ma'il qot bado yilqa chramischo.« Salah ad-Din nickte Nadim zu. Sein Gesicht wirkte wie eine Maske, undurchdringlich und undurchschaubar. Nicht umsonst war der Sultan ein guter Schachspieler. »Wer mit der Katze spielt, muss ihre Kratzer vertragen.«
»Wahr gesprochen.« Nadim verneigte sich und ging zur Tür. Er spürte Salah ad-Dins Blick auf sich ruhen, aber drehte sich nicht um.
Vor dem Haus wartete bereits ein Diener mit Fahkir. Nadim dankte dem Mann und schwang sich in den Sattel seines schwarzen Hengsts. Er klopfte dem Pferd auf den Hals und fühlte, wie die Anspannung von ihm abfiel. Fahkir tänzelte und scheute, als zwei verschleierte Frauen sich an ihm vorbeidrängten. Sie trugen Körbe mit Orangen in den Händen und würdigten Pferd und Reiter keines Blicks. Nadim wartete, bis sie an ihnen vorbeigegangen waren, bevor er sein Pferd antrieb.
Vor vier Jahren, in dem Jahr, als Nadim Leonore begegnet war, hatte Salah ad-Din sich den Frandsch entgegengestellt, die Jerusalem regierten, und war bei Montgisard vernichtend geschlagen worden.
Der kranke König und sein Falke, der verhasste Brins Arnat, hatten das Überraschungsmoment genutzt und Salah ad-Dins zahlenmäßig weit überlegenes Heer besiegt.
Mit Schaudern erinnerte sich Nadim an die Schlacht. Neben ihm hatte Bassam, sein jüngerer Bruder, den Tod gefunden. Erschlagen von einem »Lebenden Toten«. Nur die Frandsch konnten so eine Truppe erdenken. Männer, die an Aussatz erkrankt waren und sich mit Todesverachtung in jede Schlacht warfen, weil sie lieber im Kampf sterben wollten, als der Krankheit zu erliegen. Der Gestank der Lebenden Toten eilte ihnen voraus und bot häufig Anlass zur Panik bei den Angegriffenen. Je näher diese Ritter kamen, für desto mehr Grauen sorgten sie. Um ihre Feinde zu entsetzen, zogen die Lebenden Toten ohne Gesichtsschutz in die Schlacht und präsentierten ihre zerstörten Fratzen. Nadim schauderte erneut. Obwohl die Schlacht fünf Jahre zurücklag, schmerzte die Erinnerung an Bassams Tod immer noch. Nadim fühlte sich verantwortlich. Er hätte den jüngeren Bruder schützen müssen.
Fahkir wieherte und riss seinen Reiter aus den düsteren Gedanken. Nadim gab dem Rappen die Zügel und ließ den Hengst angaloppieren. Sie hatten einen weiten Weg nach Hause vor sich. Vier Tage und Nächte trennten ihn noch von Leonore und den Kindern, eine Zeit, die ihm wie eine Ewigkeit erschien.
Kapitel 3
Um die Mittagsstunde trat Nadim endlich durch die Tür, staubig nach einer langen Reise durch die Wüste, das Gesicht gezeichnet von Erschöpfung. Voller Glück eilte Leonore in seine Arme und vergoss Tränen der Erleichterung. Sofort kamen ihre Töchter angerannt und begrüßten den Vater freudig, so dass Leonore nicht mit ihm reden konnte. Haidar, Nadims und Leonores Ziehsohn, schloss sich ihnen für kurze Zeit an, bevor er seiner Wege ging.
Als hätten sich alle verschworen, Leonore von Nadim fernzuhalten, stand Salomon auf einmal vor der Tür und verlangte, dringend mit Nadim zu sprechen. Nachdem ihr jüdischer Freund gegangen war, warteten bereits Händler, die mit Nadim Wichtiges zu bereden hatten, das keinerlei Aufschub verlangte. Leonore musste mit zornigem Herzen bis weit nach dem Abendessen warten, um etwas Zweisamkeit mit ihrem Geliebten zu erringen. Sie konnte es kaum erwarten, ihm endlich die freudige Nachricht mitzuteilen. Vorher jedoch wollte sie erfahren, wo er in den vergangenen zwei Wochen gewesen war.
Nachdem die Kinder ins Bett gegangen waren, saßen Leonore und Nadim vor dem wärmenden Feuer. Er hielt ihre Hand zwischen seinen und wirkte so müde, dass sie überlegte, ob sie ihn wirklich mit ihren Fragen bedrängen sollte. Aber es musste sein, für die Sicherheit ihrer Kinder. Sollte Nadim wahrhaftig für Saladin Verbündete suchen, käme der Krieg immer näher. Ein Krieg, der sie zermahlen würde.
»Wohin hat Saladin dich geschickt?«, fragte sie scheinbar beiläufig und entzog ihm ihre Hand. Obwohl das Feuer im Herd behaglich knisterte, fühlte Leonore sich kalt.
»Bitte, Durrija, frag mich nicht.« Nadim strich Leonore über das Haar und wandte den Kopf zur Seite, um ihrem Blick auszuweichen. »Ich … ich kann es dir nicht verraten. Falls die Ritter des Königs dich fragen, ist es besser, wenn du nichts weißt.«
»Die Sorge um dich bringt mich um den Verstand und du willst mir nicht den Grund nennen, warum Saladin dich wieder und wieder auf Reisen schickt.« Leonore hasste sich dafür, dass ihre Stimme keifend klang wie die eines Marktweibs, das einen Bettler verscheuchte. Sie ärgerte sich, dass sie ihren Geliebten mit Vorwürfen überschüttete, doch der dunkle Traum über einen Krieg zwischen Muslimen und Christen hielt sie noch in seinem Bann, auch wenn sie ihn vor vier Nächten geträumt hatte. Seitdem hatte sie wieder und wieder versucht, sich damit zu beruhigen, dass es nur ein Traum gewesen war, doch die Angst um Nadim ließ Leonores Herz nicht aus ihren Krallen.
»Du warst lange weg, dieses Mal. Länger als üblich«, sagte sie und bemühte sich, ihre Stimme leichthin klingen zu lassen. »Noch einmal: Wo bist du gewesen?«
Wieder wehrte Nadim ihre Frage ab, antwortete ausweichend oder versuchte, über etwas anderes zu reden. So lange, bis sie in einen Streit gerieten, wie so oft, seitdem Nadim immer häufiger ohne ein Wort der Erklärung davonging und erst nach Tagen zurückkehrte.
»Wie soll ich dir vertrauen, wenn du mir nicht vertraust?« Leonore hasste es, ihm Vorwürfe zu machen. Aber vermochte Nadim nicht einzusehen, was er ihr und den Mädchen an Angst bereitete, wenn er sie einfach verließ? Flordelis war in den vergangenen Wochen mehrfach weinend aufgewacht und hatte nach ihrem Vater gejammert. Blanche, die Ältere, hatte alles mit aufmerksamen Augen beobachtet, doch ohne ein Wort zu sagen.
»Bitte, mein Herz, du kannst mir alles sagen …« Leonore versuchte ein letztes Mal, eine Antwort zu erhalten. Eine Antwort, die sie suchte und gleichzeitig fürchtete. Wenn sie wüsste, wohin Saladins Aufträge Nadim führten, würde ihre Sorge um den geliebten Mann sicher ins Unermessliche wachsen. Und dennoch zerrte die Ungewissheit an ihr, schlimmer als Aasvögel an ihrer Beute.
»Leonore, bitte.« Nadim hob die Hände, als wollte er weitere Fragen abwehren. Sein Gesicht erschien ihr wie eine undurchdringliche Maske. Er hatte einen Schleier des Schweigens über sein Tun gelegt, den ihre Liebe nicht durchdringen konnte. »Es ist zu deinem Schutz.«
Leonore hob die Hand zur Kehle, die sich plötzlich trocken anfühlte wie die Wüste, die Jerusalem umgab. Was meinte Nadim damit? Wie groß war die Gefahr, in die er sich begab?
»Schutz? Vor wem?«, flüsterte sie und bemühte sich, das Zittern in ihrer Stimme zu verbergen. Sie hatte so viele Gefahren überstanden, um ins Heilige Land zu gelangen und um mit ihrem Geliebten zu leben. Warum nur fürchtete sie jetzt die Wahrheit? Lag es an ihrem Zustand? »Bitte, Nadim, in was bist du hineingeraten?«
Gedanken hetzten durch ihren Kopf, jagten einander und führten alle zurück zu dem Traum, in dem der Tempelritter Nadim tötete. Sollte sie ihm davon erzählen, sollte sie ihn vor der drohenden Gefahr warnen? Würde Nadim ihr glauben oder alles mit einem Lachen als Hirngespinste abtun? Leonore ließ sich schwer auf die hölzerne Bank fallen und griff nach einem Becher und dem Krug mit frischem Wasser. Vor lauter Streiten hatte sie Nadim noch nicht einmal von ihrem gemeinsamen Kind erzählt. Sie trank einen Schluck, befeuchtete die trockene Kehle und sah ihn herausfordernd an. »Was immer du auch tust, bring es bald zu einem Ende. Wir bekommen ein Kind.«
Nadim schaute sie an, als ob sie ihn geschlagen hätte. Doch dann breitete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. Ein Lächeln so voller Glück und Freude, dass Leonore ihren Zorn vergaß.
Er zog sie hoch in seine Arme und küsste sie voller Liebe und Zärtlichkeit. Ihre Ängste schmolzen wie Schnee in der Sonne und wichen der Gewissheit, dass sich alles zum Guten wenden würde.
»Seit wann weißt du es?«, fragte Nadim schließlich und sah ihr geradewegs in die Augen.
»Seit einigen Tagen habe ich Gewissheit.« Doch da tauchten die entsetzlichen Bilder erneut vor ihr auf und traten wie dunkle Schatten vor die Freude. Leonore schüttelte den Kopf, um sie zu verdrängen, doch zu lebendig standen sie ihr vor Augen. »Ich erwachte aus einem furchtbaren Traum, sah dich tot, ermordet …«
»Nein. Sorge dich nicht.« Wieder zog er sie an sich heran, hielt sie fest, und sie fühlte sich sicher und geborgen. »Mir wird nichts geschehen. Ich achte auf mich, weil ich weiß, dass du auf mich wartest.«
Leonore hielt einen Augenblick inne und genoss das Gefühl der Zusammengehörigkeit, das sie teilten. Mit einem kleinen Seufzer löste sie sich aus Nadims Armen. Sie fühlte Verantwortung für sich und ihr ungeborenes Kind. Verantwortung, die ihr keine Ruhe ließ.
»Nadim, wir brauchen dich. Blanche, Flordelis und ich und unser ungeborenes Kind. Bitte bleib bei uns.« Das schlechte Gewissen regte sich, weil sie ihre Schwangerschaft nutzen wollte, um ihn zu Hause zu halten, aber sie würde es nicht ertragen, wenn er stürbe. Sie konnte nicht einmal daran denken, ohne dass ihr Herz schneller schlug. Und ihre Worte sprachen die Wahrheit. Sie brauchten ihn, brauchten ihn zu Hause in Jerusalem, als Schutz gegen die Unbill eines drohenden Krieges zwischen den Christen und Muslimen, der von der Welt außerhalb ihres Hauses auf sie eindringen wollte.
»Einmal noch, Durrija, einmal noch muss ich meine Pflicht erfüllen.« Nadim beugte sich zu ihr und hielt sie so fest, dass es beinahe schmerzte, aber sie wehrte sich nicht, sondern schloss die Augen und verdrängte alle Sorgen und Ängste auf den kommenden Tag.
******
Zwei Wochen waren vergangen, in denen Leonore den Alltag mit ihrer kleinen Familie genossen hatte. Doch gestern war eine Brieftaube eingetroffen, die eine Nachricht für Nadim getragen hatte. Nachdem er ihr nicht erzählen wollte, was die Taube mitgebracht hatte, war es wieder zu einem Streit gekommen. Daher war Leonore bereits am frühen Morgen aufgestanden, um mit ihren Töchtern den Markt in Jerusalem zu besuchen. Der Tag war wunderschön, die Morgensonne tauchte ihren Weg durch die schmalen Gassen in ein sanftes Licht.
»Ich werde dich begleiten.« Lautlos wie ein Schatten war Haidar neben ihr aufgetaucht. »Es schickt sich nicht für eine Frau, allein auf den Markt zu gehen.«
Leonore zuckte zusammen. Der Sohn ihres ersten Ehemanns und dessen arabischer Frau schien sie in letzter Zeit überwachen zu wollen. Vermutlich litt Haidar ebenfalls darunter, dass Nadim die Familie so oft verließ. Er wurde von Tag zu Tag unleidlicher und weigerte sich immer häufiger, Leonores Rat oder Bitten zu folgen.
Leonore überlegte, ob sie ihn zurechtweisen und darauf hinweisen sollte, dass es für Christinnen gefahrlos wäre, den Markt aufzusuchen, aber der Streit mit Nadim hatte sie erschöpft und sie suchte keine neuen Händel. Also nickte sie nur.
»Ich auch. Ich auch.« Flordelis sprang auf und ab. Leonore seufzte leise. Wenn sie ihre Jüngste mitnahm, würde der Einkauf sehr viel länger dauern, als sie vorgesehen hatte. Das Mädchen würde an allen Ständen stehen bleiben und die bunte Warenvielfalt bewundern und betteln, dass Leonore ihr etwas kaufte. Aber die Freude im Gesicht der Kleinen ließ Leonore die Verspätung in Kauf nehmen.
»Und du?«, fragte sie Blanche. Wie groß ihre Älteste geworden war. Beinahe erwachsen. »Willst du uns auch begleiten?«
»Nein.« Blanches Lächeln milderte ihr Nein ab. »Salomon hat mir eine Rechenaufgabe gestellt, die ich gerne lösen möchte.«
Das Mädchen wechselte einen Blick mit Haidar, den Leonore nicht deuten konnte. Sobald etwas Ruhe in ihr Leben eingekehrt wäre, würde sie mehr Zeit mit Blanche verbringen. Bevor ihre Tochter zu erwachsen war. Schon jetzt lebte Blanche ein eigenes Leben. Wissensdurstig hatte sie in Salomon, dem Onkel von Leonores Freundin Ruth, einen Mentor gefunden, der sie in Mathematik unterrichtete. Lesen und Schreiben hatte Leonore ihrer Tochter beibringen können, aber die hohe Kunst des arabischen Rechnens war Leonore verschlossen geblieben.
»Also gut.« Leonore griff nach ihrem Mantel und einem Korb für die Waren, die sie auf dem Markt erwerben wollte. »Dann lasst uns gehen, bevor die besten Früchte weg sind.«
Kapitel 4
Noch bevor sie die Marktstände sahen, erkannte Leonore am Duft der Gewürze, dass sie ihr Ziel bald erreicht hatten. Pfeffer kitzelte in ihrer Nase und sie meinte, Kardamom zu riechen. Auch Flordelis schnupperte mit weit geöffneten Nasenflügeln.
»Hmm, Honig«, sagte das Kind mit leuchtenden Augen.
Wie stets wimmelte der Markt von Menschen. Hier trafen sich alle, die im Königreich Jerusalem lebten oder die Heilige Stadt während einer Pilgerfahrt besuchten.
Christliche Ritter, hoch zu Ross, teilten sich die schmalen Gassen mit verschleierten Frauen, die zu Fuß von Stand zu Stand schlenderten. Beduinen zerrten ihre Kamele hinter sich her und Fellachen trieben ihre Esel, schwer beladen mit den Früchten der Felder, vor sich her.
Leonore zog es in den Bereich der überdachten Marktstände. Im Schatten der Baldachine suchte sie gemeinsam mit Flordelis nach Früchten und Gemüse für ihre Mahlzeiten.
»Frau Leonore. Wie schön, Euch zu sehen.« Leonore sah erschreckt von den Granatäpfeln auf, deren Reife sie geprüft hatte. Die Stimme kannte sie. Besser, als ihr lieb war. Vor ihr stand Gérard de Ridefort. Hochgewachsen und schlank, gekleidet in den Ornat der Templer. So wie sie ihn in ihrem Alptraum gesehen hatte.
Auch wenn es nur ein Traum gewesen war, Gérard de Ridefort hatte etwas Unheimliches an sich, das sie misstrauisch machte. Wie schaffte der Ritter es nur, sich stets so anzuschleichen, dass sie ihn erst im letzten Augenblick entdeckte und ihm nicht entkommen konnte? Manchmal schien es ihr, dass Gérard de Ridefort sie heimlich verfolgte und es nur darauf anlegte, immer wieder ihren Weg zu kreuzen. Dann jedoch lachte sie über eine derart verrückte Idee. Warum sollte ein Ritter, ein geachteter Templer, die Gesellschaft einer Christin suchen, die ihrem Glauben untreu geworden war, weil sie mit einem Muslimen zusammenlebte?
Leonore war dankbar, dass sie noch nicht, wie befürchtet, exkommuniziert worden war. Der Patriarch von Jerusalem wagte es bis heute nicht, sich Sibyllas Wünschen entgegenzusetzen. Leonore dachte voller Dankbarkeit an die Prinzessin von Jerusalem, ohne deren Schutz ihr Leben deutlich schwieriger wäre. Heraclius von Caesarea hatte Leonore eine Predigt über ihre Sünden gehalten, aber sie sonst nicht weiter bestraft. Allerdings war es Leonore schwergefallen, seine Worte anzunehmen, da der Patriarch selbst nicht allen Geboten des Herrn und der Kirche folgte. Ganz Jerusalem kannte seine Geliebte, Pasque de Riviera, die Gemahlin eines Kaufmanns aus Nablos, scherzhaft auch »Frau Patriarch« genannt. Pasque de Riviera hatte ein Kind mit dem Kirchenoberhaupt. Neben dieser langandauernden Liebschaft wurde Heraclius auch eine Liaison mit Agnes de Courtenay, der Mutter des Königs, nachgesagt.
»Herr Gérard.« Leonore zwang sich zu einem höflichen Lächeln. Der Ritter konnte nichts dafür, dass sie ihn nicht schätzte. Aus unerfindlichen Gründen stellten sich ihr die Nackenhaare auf, wenn sie mit ihm zusammentraf. Dabei verhielt er sich in allen Belangen stets wie ein Edelmann. »Wie geht es Euch? Ich habe Euch lange nicht gesehen.«
Er lächelte. Siegessicher und sehr von sich eingenommen, wie Leonore fand. Sie senkte den Kopf und tat so, als ob sie die Güte der Datteln prüfte, die vor ihr auf dem Marktstand lagen.
»Nun, seitdem ich Marschall des Königs bin, führen mich wichtige Missionen in alle Winkel des Königreichs.« De Ridefort lächelte wieder.
Leonore nickte. Sie wusste nicht, was sie ihm hätte antworten können, doch er schien auch keine Antwort zu erwarten.
»Ich …«, flüsterte er und beugte sich nahe zu Leonore. Viel zu nahe für ihren Geschmack, doch sie war zu höflich, um den Templer abzuwehren. »… ich verrate Euch ein gut gehütetes Geheimnis. Die Templer planen, mir den Rang eines Seneschalls zu gewähren.«
»Wie schön für Euch. Ihr seid ein erfolgreicher Mann und könnt Euch glücklich schätzen.«
»Ich danke Euch.« Gérard de Ridefort verneigte sich. »Ich führe ein gottgefälliges Leben, obwohl ich sagen muss, dass ich ein glückliches Familienleben dem Dasein eines christlichen Ritters vorziehen würde. So wichtig die Aufgabe auch ist …« Er blickte Leonore vielsagend an, etwas zu vielsagend für ihren Geschmack.
Sie stellte sich dumm. »Ja, das kann ich gut verstehen. Meine Familie ist mein ganzes Glück.«
Als hätte sie auf dieses Stichwort gewartet, tauchte Flordelis’ dunkler Schopf neben Leonore auf. Ihre Tochter trippelte aufgeregt von einem Fuß auf den anderen.
»Dahinten gibt es Halva. Ganz frisch, hat der Mann gesagt. Bitte, bitte.«
Leonore lächelte ihre Tochter an. »Sag Haidar, er soll dir ein Stückchen kaufen. Und eins für Blanche.« Schnell fügte sie hinzu: »Und eins für sich, natürlich«, damit der Junge sich nicht wieder zurückgesetzt fühlte.
»Ihr lebt noch immer mit dem … dem Sarazenen?« Gérard de Ridefort gelang es perfekt, in dieses eine Wort eine derart tiefe Verachtung zu legen, dass Leonore ihn am liebsten ohne ein Wort stehen gelassen hätte. Was maßte der Templer sich nur an? Nadim war zehnmal, nein, hundertmal mehr wert als de Ridefort.
Stattdessen lächelte sie honigsüß. »Nadim al-Malik. Soweit ich mich erinnere, seid Ihr ihm bereits begegnet?« Damit spielte sie auf einen Kampf zwischen den beiden Männern an, den Nadim gewonnen hatte. Einen Kampf, den de Ridefort angezettelt hatte, aus gekränkter Eitelkeit, weil Leonore sich für Nadim entschieden hatte. Für Leonore und ihre Familie war der Kampf bedrohlich gewesen, da die Templer Genugtuung verlangt hatten. Dank Sibyllas Einfluss war es ihnen gelungen, mit heiler Haut aus der Affäre zu gelangen, denn selbst die Templer fürchteten die Prinzessin von Jerusalem.
»Ich erinnere mich.« Der Ritter lächelte säuerlich. Sein gut geschnittenes Gesicht verzog sich, als ob er in eine Zitrone gebissen hätte. »Doch diese seltsamen sarazenischen Namen kann ich mir nicht merken. Ich hörte, Ihr wart in letzter Zeit viel bei Hofe«, wechselte er geschwind das Thema.
Leonore war sich sicher, dass er sie mit diesen plötzlichen Wechseln verwirren und aus der Reserve locken wollte. Doch die Jahre in Jerusalem hatten sie gelehrt, sehr vorsichtig zu antworten und nur wenig zu verraten. Jedes Wort musste man in dieser Stadt auf die Goldwaage legen, weil man nie wissen konnte, wem es hinterbracht werden würde. Der Schutz, den Sibylla gewährte, war zweischneidig, zog er Leonore doch stärker in die Intrigen des Jerusalemer Hofs, als ihr lieb war. Aber sie hatte keine Wahl. Wenn sie weiter mit Nadim und ihren Töchtern in Jerusalem leben wollte, brauchte sie einen Fürsprecher.
»König Balduin geht es gesundheitlich schlechter, und Prinzessin Sibylla sucht meine Gesellschaft.« Wie so oft wunderte sich Leonore, wie schnell die Gerüchte in Jerusalem eilten. Schneller als jeder Läufer, schneller selbst als die besten Araberpferde. Alles, was mit dem Königshof und den dortigen Intrigen zusammenhing, gelangte sofort zu den Templern und natürlich zum Patriarchen von Jerusalem.
Sie schüttelte die Gedanken ab und widmete dem Templer wieder ihre Aufmerksamkeit. »Was spricht man bei den Templern über die Nachfolge des Königs?«
Auch Leonore beherrschte die hohe Kunst des Themenwechsels. Und sie hätte zu gerne erfahren, auf wessen Seite der Ritterorden in dieser wichtigen Frage stand, die über das Schicksal der Christen im Heiligen Land entscheiden würde. Würden sie Raimund von Tripolis unterstützen, der Frieden mit den Muslimen wünschte, oder schlugen sich die Templer auf Seiten der Falken um Renaud de Châtillon, die möglichst viel Blut der Ungläubigen vergießen wollten?
»Ach, lasst uns an diesem schönen Tag nicht über Politik sprechen«, wich Gérard de Ridefort aus. Sofort wurde Leonore hellhörig. Wenn der Templer Stillschweigen wahren wollte, musste das Thema bedeutender sein, als sie bisher geahnt hatte. Sie würde Salomon fragen, der stets gut über das politische Geschehen in Jerusalem Bescheid wusste. Als Jude in einer von Christen beherrschten Stadt sei das überlebensnotwendig, pflegte Salomon mit einem Augenzwinkern zu sagen.
»Ja, das Wetter ist herrlich.« Leonore erklärte sich bereit, über etwas gänzlich Unverfängliches zu plaudern, und ärgerte sich sogleich über ihre Freundlichkeit, als der Templer seine nächste Frage stellte.
»Sagt, stimmt es, dass Ihr in der Unterstadt lebt?« Mit einem höhnischen Lächeln brachte de Ridefort die Worte hervor, wohl wissend, dass sie Leonore schmerzen würden. Leonore spürte Zorn in sich aufsteigen. Auch wenn die Prinzessin von Jerusalem ihre schützende Hand über Leonore und ihre Familie hielt, hatte Sibylla es nicht erlauben wollen, dass Leonore in der Jerusalemer Oberstadt wohnte, die den Christen vorbehalten war. Nadim und Leonore und ihre Kinder lebten in der Unterstadt, dem ärmeren Bezirk Jerusalems, in dem Moslems, Juden und einige wenige Christen wohnten.
»Ihr seid wieder einmal hervorragend informiert.« Leonore zwang sich zu einem falschen Lächeln. »Ich ziehe es vor, abseits von Politik und Pilgermassen ein bescheidenes Heim zu führen.«
Bevor de Ridefort ihr antworten konnte, winkte ihn ein Templer, der auf einem gewaltigen Schimmel saß, zu sich heran.
»Bitte entschuldigt. Meine Geschäfte verlangen nach mir.« De Ridefort verbeugte sich knapp. So knapp, dass es beinahe einer Unhöflichkeit gleichkam. »Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.«
Leonore neigte den Kopf zur Antwort. Sie wollte keine Lüge zur Liste ihrer Sünden hinzufügen, aber auch nicht unhöflich erscheinen.
»Wer war der Mann?« Haidar war neben ihr aufgetaucht, ebenso leise und unvermutet wie vorher der Ritter. »Er gehört zu den Templern, nicht?«
Auf seinem dunklen Gesicht malte sich Ekel ab. Leonore wusste nicht zu sagen, ob Haidars Abscheu nur dem Ritter oder auch ihr galt.
»Er heißt Gérard de Ridefort«, antwortete Leonore und sah, wie sich die Lippen des Jungen verächtlich kräuselten. »Ich bin ihm gegenüber zu Dank verpflichtet. Er hat mich in der Wüste gerettet.«
Warum nur verfolgte er die Christen mit so viel Hass? Mabruka, seine Mutter, hatte dem christlichen Glauben angehört und ihren Sohn darin erzogen.
»Hat er nicht vielmehr eine Karawane überfallen?«, antwortete Haidar in gehässigem Ton. »Aber es waren ja nur Heiden, die er ermorden wollte. Wie so viele von ihnen.«
Seine Augen musterten sie durchdringend. Leonore schien es, als ob der Junge nur darauf wartete, dass sie Schwäche zeigte oder ihm einen Anlass bot, sie bei Nadim anzuschwärzen. In letzter Zeit hatte Haidar vermehrt gegen Christen gewettert, obwohl seine Mutter ihn im wahren Glauben hatte taufen lassen.
Flordelis stand zwischen Leonore und Haidar und verfolgte den Wortwechsel mit großen Augen. Ihrer Tochter zuliebe wollte Leonore keinen Streit führen, doch derartige Worte durfte sie dem Jungen nicht durchgehen lassen.
»Haidar! Ganz so einfach ist die Welt nicht.« Leonore konnte die Wut nicht fassen, mit der der Junge ihr entgegentrat. Hatten Nadim und sie ihm nach dem Tod seiner Mutter und der feigen Flucht seines Vaters nicht ein Heim geboten? War es zu viel verlangt, dass Haidar ihr gegenüber etwas Respekt zeigte? Dann jedoch verdrängte eine Frage ihre Empörung: Woher wusste Haidar von dem Überfall? Wer hatte es ihm erzählt, und vor allem, wer hatte ihm den Floh ins Ohr gesetzt, dass Christen Muslime mordeten?
»Warum soll ich dir glauben? Du bist auch eine von ihnen.« Mit den Worten drehte Haidar sich um und kehrte ihr den Rücken zu. Bevor sich Leonore von der Überraschung erholt hatte, war der Junge in der Menge der Menschen verschwunden, die an diesem schönen Frühlingstag den Markt besuchten.
»Haidar! Komm sofort zurück!«, rief Leonore ihm nach, wusste aber, dass er nicht auf sie hören würde. Von Tag zu Tag schien es ihr schwieriger, mit dem Jungen umzugehen. Fast so, als würde Haidar sie für alles Schlechte in seinem Leben verantwortlich machen. Leonore seufzte. Sie hatte geahnt, dass es nicht einfach werden würde, einen sarazenischen Waisenjungen, der zudem noch christlichen Glaubens war, in ihre Familie aufzunehmen. Wie sehr Haidar sich von ihr entfernen würde, hatte sie nicht ahnen können. Der Junge hing mit treuer Liebe an Nadim und folgte jedem Wort, das der Sarazene an ihn richtete. Leonore hingegen konnte im besten Fall darauf hoffen, dass Haidar seinen Widerwillen geschickt verbarg. Böse wie heute hatte sie den Jungen allerdings noch nicht erlebt. Heute Abend würde sie mit Blanche sprechen. Ihre Tochter schien die Einzige zu sein, der der Junge etwas anvertraute. Selbst Nadim gegenüber zeigte sich Haidar immer verschlossener.
»Mama?«, fragte Flordelis und sah Leonore mit ihren großen dunklen Augen an. Augen, die so sehr denen ihres Vaters glichen, dass Leonore trotz allen Zorns lächelte. »Warum ist Haidar böse mit dir?«
»Nein, nein, mein Schatz«, versuchte Leonore, ihre Tochter und auch sich selbst zu beruhigen. »Haidar mochte nur den Mann nicht, der mich angesprochen hat. Aber nun komm, wir müssen noch etwas für heute Abend kaufen.«
Flordelis streckte ihr ihre kleine Hand entgegen. Leonore ergriff sie und Hand in Hand gingen Mutter und Tochter zum nächsten Stand, um dort Früchte und Gemüse für den Abend zu kaufen. Um Flordelis abzulenken, ließ Leonore sie die Orangen wählen, die sie essen wollte. Nach erfolgreichem Einkauf bahnten sich die beiden ihren Weg durch die Menschenmenge, die über den Markt strömte wie ein gewaltiger Fluss.
Wie immer schlug die Vielfalt der Eindrücke über Leonore zusammen. An Tagen wie diesen schien es, dass Jerusalem wirklich das Zentrum der Welt war. Pilger, die in den unterschiedlichsten Sprachen miteinander redeten, drängten sich an Rittern vorbei, die mit gewichtiger Miene ihren Geschäften nachgingen. Hochgestellte Sarazenen in reich geschmückten Gewändern verhandelten mit Fellachen in abgerissener Kleidung, die die Früchte ihrer Felder feilboten, um den Lebensunterhalt ihrer Familien zu sichern.
Ende der Leseprobe