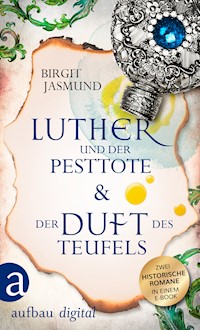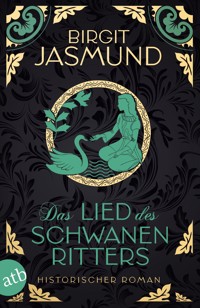9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das große Meißen-Epos
- Sprache: Deutsch
Die schöne Malerin von Meißen.
Meißen, 1750: Geraldine hat das Rittergut ihres Vaters geerbt. Dann jedoch taucht eine geheime Zusatzklausel des Testaments auf, nach der sie ihr Erbe verliert, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres einen standesgemäßen Mann heiratet. Dabei ist eine Ehe das Letzte, was Geraldine will, jetzt, wo es ihr endlich gelungen ist, sich als Porzellanmalerin einen Namen zu machen. Doch ihr offensichtliches Talent ruft Neider auf den Plan – und schon bald scheint nicht nur Geraldines Erbe in Gefahr, sondern auch ihr Leben ...
Authentisch und kenntnisreich - eine packende Geschichte vor der Kulisse der Meißner Porzellanmanufaktur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Birgit Jasmund
Birgit Jasmund, geboren 1967, stammt aus der Nähe von Hamburg. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Kiel hat das Leben sie nach Dresden verschlagen. Wenn einem dort der Wind so richtig um die Nase weht, hält sie nichts im Haus. Im Aufbau Taschenbuch Verlag sind von ihr bereits die historischen Romane »Die Tochter von Rungholt«, »Luther und der Pesttote«, »Der Duft des Teufels«, »Das Geheimnis der Porzellanmalerin«, »Das Erbe der Porzellanmalerin«, »Das Geheimnis der Zuckerbäckerin« sowie bei Rütten & Loening die Liebesgeschichte »Krabbenfang« erschienen.
Informationen zum Buch
Die schöne Malerin von Meißen.
Meißen, 1750: Geraldine hat das Rittergut ihres Vaters geerbt. Dann jedoch taucht eine geheime Zusatzklausel des Testaments auf, nach der sie ihr Erbe verliert, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres einen standesgemäßen Mann heiratet. Dabei ist eine Ehe das Letzte, was Geraldine will, jetzt, wo es ihr endlich gelungen ist, sich als Porzellanmalerin einen Namen zu machen. Doch ihr offensichtliches Talent ruft Neider auf den Plan – und schon bald scheint nicht nur Geraldines Erbe in Gefahr, sondern auch ihr Leben.
Authentisch und kenntnisreich: eine packende Geschichte vor der Kulisse der Meißner Porzellanmanufaktur
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Birgit Jasmund
Das Erbe der Porzellanmalerin
Historischer Roman
Inhaltsübersicht
Über Birgit Jasmund
Informationen zum Buch
Newsletter
Dramatis Personae
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Danksagung
Impressum
Dramatis Personae
Ein Überblick über die wichtigsten Personen des Romans. Historische Persönlichkeiten sind kursiv dargestellt.
Frau Sieglinde Aha, Herr Thomas Aha – Geschwister, Hausdame und Verwalter auf dem Rittergut im Käbschütztal
Claudio Castagno – aus Italien stammender Maler, hält sich mühsam über Wasser
Graf Heinrich von Brühl – kurfürstlich-sächsischer und königlich-polnischer Premierminister 1746 bis 1751, liebt die Pracht und das Geld, hat aber kein Händchen für Letzteres
Johann Friedrich Fleuter – Kreisamtmann in Meißen, Mitglied der Manufakturkommission und vielbeschäftigt, gesegnet mit einer charmanten Frau
Friedrich August II. – Sächsischer Kurfürst und als August III. König von Polen, mit mehr Interesse als Begabung für die Malerei
Christian Gottlob Gerber – Pfarrer in Lockwitz, von milder Gesinnung
Johann Gregorius Höroldt – der erste Maler der Porzellanmanufaktur und kein einfacher Mensch
Johann Joachim Kändler – der Formenmeister der Porzellanmanufaktur und schon freundlicher
Maurice – Mulatte, dient Geraldine so aufopferungsvoll wie ihrem Vater
Frederik Nehmitz – Jurist, seine Liebe zu Geraldine übersteht alle Höhen und Tiefen
Wilma Eberhardine Nehmitz – Frederiks Mutter, darf sich über eine Schwiegertochter freuen
Otto – ein Mops
Leonhard Johann Pfeiffer – Lehrer im Käbschütztal, gesegnet mit einer Frau und einer reichen Kinderschar
Anton Piwatzsch – Österreicher und Naturforscher
Familie Siebert – Bäckerfamilie aus Lockwitz, bestehend aus Adrian, Christiana und ihren vier Kindern
Hann Schneider – zerrinnt alles zwischen den Fingern
Janne Schneider – seine Frau und Geraldines Zofe
Rikarda und Simon Andreas – ihrer beider Kinder
Geraldine von Scholl – Mulattin und Malerin, will das Erbe ihres Vaters retten
Peter von Scholl – Geraldines Halbbruder, Pfarrer mit menschlichen Abgründen
Familie Schumann – Arztfamilie aus Dresden, bestehend aus Laurenz, Therese und der Tochter Laura
Dr. Eduard Wilhelm Wezel – Leipziger Notar der Familie von Scholl, sitzt zwischen allen Stühlen
Theodorus Gottlieb Windisch – Pfarrer im Käbschütztal, sittenstreng
Johann Heinrich Zedler – Leipziger Verleger und Buchhändler
Sowie eine Vielzahl von Volk in Meißen, Dresden, Leipzig und dazwischen.
Kapitel 1
Geraldines Herz schlug einen aufgeregten Takt. Die Kutschfahrt vom Käbschütztal nach Meißen zur Albrechtsburg war viel zu schnell zu Ende gewesen. Ihr Blick glitt an der Fassade des mächtigen Gebäudes entlang. Die Fenster glichen dunklen Augen, hinter jedem von ihnen ahnte sie Beobachter. Der Anblick kam ihr nicht mehr so prächtig vor, wie das noch vor einem Jahr der Fall gewesen war, als sie das erste Mal davorgestanden hatte. Mehr als ein Gesims war angeschlagen, stellenweise fehlte Putz, Regenwasser hatte Schmutzspuren hinterlassen. Sie riss sich von dem Anblick los und betrat die Burg durch das Hauptportal.
Dämmerung umfing sie, um sie herum herrschte Geschäftigkeit. Aus den oberen Stockwerken hörte sie Stimmen und Schritte. Nie hätte Geraldine gedacht, die Porzellanmanufaktur noch einmal zu betreten. Nicht, nachdem sie sich als junger Buntmaler verkleidet den Zugang erschlichen hatte, um die Ehre ihres Vaters zu retten. Malen auf Porzellan war ein Kapitel ihres Lebens, mit dem sie abgeschlossen hatte. Aber dann war vor zwei Tagen ein höflich formuliertes Schreiben aus Dresden gekommen, in dem sie für den heutigen Nachmittag in die Kreisamtmannschaft Meißen geladen wurde.
Die Kreisamtmannschaft war nicht identisch mit der Porzellanmanufaktur, aber beide in der Albrechtsburg untergebracht, und für Geraldine bestand zwischen ihnen kein großer Unterschied. Der Kreisamtmann führte die Bücher der Manufaktur, über ihn lief der Schriftverkehr, er war Mitglied in der Manufakturkommission. Wenn sie zu ihm geladen wurde, musste es mit der Manufaktur zusammenhängen.
Sie solle nicht hingehen, hatte der Rat ihrer Hausdame, Frau Aha, gelautet. Die rüstige Frau hatte sich dabei richtig in Rage geredet. Ihre gnädige Herrin hätte nichts mehr mit der Manufaktur zu schaffen, die Herren sollten hinter dem Horizont verschwinden oder zu den Molukken gehen, wo der Pfeffer wachse. Angesichts dieser Wut konnte man den Eindruck gewinnen, die Einladung stamme von einem Dämon und führe geradewegs in die Hölle. Ihr Bruder, Herr Aha, der zugleich der Verwalter von Geraldines Gütern war, hatte sich ihr angeschlossen. Der schwarze erste Hausdiener Maurice hielt jedoch dagegen, dass die gnädige Frau nichts mehr mit der Manufaktur zu tun haben müsse, dass sie jedoch hingehen und sich anhören solle, weswegen man sie eingeladen habe. Sie könne einen kräftigen Begleiter mitnehmen; er böte sich an.
Geraldine hatte zuerst dem Rat der Geschwister Aha folgen wollen, um ihr Gemüt nicht zu belasten. Wo bliebe ihr Mut, hatte sie sich dann gefragt. Mit dieser Verzagtheit hätte sie nie die Flucht von der Insel Santo Domingo geschafft, wo sie geboren wurde und ihre ersten vierzehn Jahre verbracht hatte. Sie gestand sich auch Neugierde ein und entschied, die Einladung anzunehmen. Auf Maurice als Begleiter hatte sie verzichtet, da sie kein zartes Ding war, das sich nicht allein aus dem Haus traute.
»Es wird nicht lange dauern«, hatte sie ihren Kutscher beschieden und ihre Röcke geordnet. Ihr Herz hatte dabei womöglich noch schneller geschlagen als jetzt, während sie auf einen der Schreiber der Manufaktur zuging. Das letzte Mal, als sie gedacht hatte, es würde nicht lange dauern, hatte sie mehrere Wochen in der Dresdner Festung verbracht. Als Gefangene!
Im Kabinett erwarteten sie neben Kreisamtmann Fleuter auch Johann Gregorius Höroldt, der erste Maler der Manufaktur, und der Formenmeister, Johann Joachim Kändler.
Bei ihrem Eintritt erhoben sich alle. Das im Raum lastende Schweigen vermittelte Geraldine das Gefühl, in ein Gespräch geplatzt zu sein, dessen Anlass sie gewesen war. Ihre eigene Unsicherheit verbarg sie hinter einem Hüsteln, als hätte sie sich verschluckt, und indem sie sich die behandschuhte Rechte vor den Mund hielt.
Über ihre Finger hinweg beobachtete sie die Mienen der drei Männer. In Fleuters ließ sich nicht lesen. Kändler musterte sie so neugierig wie sie ihn. Wenn ihr in diesem Raum einer freundlich gesinnt war, war es der Formenmeister. Über Höroldt brauchte sie gar nicht erst nachzudenken, an seiner Meinung über sie hatte sich nichts geändert, entnahm sie seiner verkniffenen Miene. Kändler und Fleuter hauchten einen Kuss auf ihren Handrücken, der Maler beugte sich nur darüber, spitzte nicht einmal die Lippen.
Eine Erfrischung in Form eines Koppchens Kaffee, natürlich serviert in Meißner Porzellan, lehnte Geraldine ab. »Ich ziehe es vor, wenn Sie mir unverblümt mitteilen, weshalb Sie mich eingeladen haben. Meine Zeit ist knapp bemessen.«
»Setzen wir uns. So viel Zeit werden Sie doch mitgebracht haben, gnädige Frau.« Der Kreisamtmann deutete auf einige zierliche Sessel, die in einer Ecke des Arbeitskabinetts um einen Tisch gruppiert standen.
Höroldt kommentierte das mit einem Schnauben. Als Einziger blieb er an die Wand gelehnt stehen, mit vor der Brust verschränkten Armen. »Meine Idee war das nicht. Ich bin sogar ausdrücklich dagegen«, setzte er noch hinzu.
Alles andere hätte Geraldine auch sehr gewundert. Sie schenkte ihm ein strahlendes Lächeln, das so falsch war wie sein ausdrucksloses Gesicht. Fleuter und Kändler schauten sich unbehaglich an.
»Ich bin beinahe neugierig«, konnte sie sich nicht verkneifen zu sagen, nachdem sie auf der Kante eines Sessels Platz genommen hatte.
»Aus Dresden ist etwas eingetroffen, das ich Ihnen geben möchte.« Fleuter nahm aus einer Schublade des Tisches eine lederne Mappe. Statt sie Geraldine zu reichen, gab er sie Kändler. »Die Ehre gebührt Ihnen.«
Der Formenmeister stand wieder auf, verneigte sich. »Es ist mir eine besondere Freude, gnädige Frau. Niemand hat dies so sehr verdient wie Sie.« Er klappte die Mappe auf und übergab sie Geraldine feierlich, als beinhaltete sie ihre Ernennung in den Fürstenstand.
Eine Urkunde befand sich tatsächlich darin mit einem Wachssiegel an einer mehrfarbigen Schnur.
»Lesen Sie.« Kändler klang ungeduldig, wie jemand, der unbedingt wissen wollte, ob sich sein Gegenüber über ein Geschenk freute.
»Das ist eine Schande für die Manufaktur«, grummelte Höroldt im Hintergrund, als Geraldine zu lesen begann.
Zuerst verstand sie nur einzelne Worte, aber die ergaben keinen Sinn. Sie zwang sich dazu, noch einmal von vorn und langsamer zu lesen. Die ersten drei bis acht Zeilen bestanden aus einer umständlichen Vorrede und einer nicht enden wollenden Nennung von Titeln, angefangen beim König von Polen, gefolgt vom Sächsischen Kurfürst. Ihr Name wurde im Text genannt. Nur Geraldine von der Insel Santo Domingo, wie sie sich früher genannt hatte, bevor sie ihren Vater fand. Bevor er ihr seinen Namen von Scholl verlieh. Worum es tatsächlich ging, wurde am Ende des Textes in zwei Zeilen abgehandelt: Ihr wurde erlaubt, außerhalb der Manufaktur auf Porzellan zu malen, nach eigenem Belieben und so viel sie wollte. Sie durfte das Porzellan aus der Manufaktur anfordern und es dort für den letzten Brand, wieder hinbringen.
»Damit beginnt es, und ich möchte nicht wissen, wo es enden wird«, schnaubte Höroldt wieder. »Diese Frau schleicht sich unter falschem Namen ein, schädigt die Manufaktur und wird dafür belohnt.«
»Mademoiselle von Scholl hat geholfen, großen Schaden von der Manufaktur abzuwenden. Das wissen Sie so gut wie wir alle, werter Herr Kollege.« Kändler war laut geworden, beinahe an der Grenze zum Schreien.
Eine Handbewegung des Kreisamtmannes brachte ihn dazu, sich zu mäßigen.
»Ich wurde überstimmt. Aber lassen Sie sich eines gesagt sein, Fräulein von Scholl, die Manufaktur werde ich gegen Ihr Tun schützen.« Meister Höroldt zog die Augenbrauen zusammen und sah aus, als wollte er zu Schwert und Schild greifen. »Sie werden keine Muster der Manufaktur malen und jedes Stück als Ihres kenntlich machen. Sonst wird mich auch diese Urkunde nicht zurückhalten, das Recht der Manufaktur geltend zu machen.«
»Sie wollen einer Dame …«, setzte Fleuter an.
»Als Dame bezeichne ich niemanden, der mir als Glücksritterin begegnet ist.«
»Nun ist es aber gut!«, polterte der Kreisamtmann. »Sie vergessen sich, Höroldt. Entschuldigen Sie sich bei Mademoiselle von Scholl.«
»Bevor ich das tue …«
»Auf eine Entschuldigung, die nicht von Herzen kommt, lege ich keinen Wert«, warf Geraldine scharf ein.
»Das Beste wird sein, Sie entfernen sich«, empfahl Kändler dem ersten Maler.
»Nichts lieber als das. Auf mich wartet Arbeit.« Höroldt besaß immerhin so viel Anstand, sich vor Geraldine zu verneigen und den beiden Männern grüßend zuzunicken, ehe er mit stampfenden Schritten aus dem Kabinett rauschte.
Der Kreisamtmann blickte unglücklich drein. »Ich muss mich entschuldigen. Das tut mir wirklich leid. Ich hätte ihn gar nicht erst dazu bitten sollen.«
»Und ihn um das Vergnügen bringen, sich aufzuregen«, sagte Geraldine mit einem verschmitzten Lächeln. »Ich kenne Monsieur Höroldt und habe von ihm nichts anderes erwartet. Entschuldigen Sie sich nicht für ihn, sagen Sie mir lieber, wie es hierzu gekommen ist.« Sie deutete auf die Urkunde auf dem Tisch.
Das übernahm der Formenmeister, der ihr erklärte, wie die Kommission über die Erlaubnis zur Porzellanmalerei für sie entschieden und dies schließlich dem König und Kurfürst zur Bestätigung vorgelegt hatte. Er sprach mit Feuer und Leidenschaft, und Geraldine verstand, dass er einer der treibenden Köpfe gewesen war, wenn es sich nicht sogar um seine Idee handelte.
»Ich bin Ihnen dankbar. Wirklich sehr dankbar. Bis vor einer halben Stunde ging ich davon aus, nie wieder auf Porzellan zu malen. Nun machen Sie mir dieses wirklich wunderbare Geschenk. Den Forderungen Meister Höroldts werde ich mich beugen, schließlich weiß niemand besser als ich, was es bedeutet, wenn die Herkunft des Porzellans nicht zweifelsfrei bestimmbar ist.« Sie klappte die Ledermappe zu und drückte die kostbare Urkunde an ihre Brust. Um ihre wirklichen Gefühle auszudrücken, fehlten ihr die wohlgesetzten Worte, wie sie für eine vornehme Dame angemessen waren. Sie würde am liebsten aufspringen, im Raum umhertanzen, die Herren umarmen und vor lauter Glück und Erleichterung singen. Sie wollte aber weder Fleuter noch Kändler in Verlegenheit bringen und blieb sitzen, fühlte sich dabei aber wie unter einer Glocke.
Kändler ließ es sich nicht nehmen, sie zu ihrer Kutsche zu begleiten und seiner Unterstützung zu versichern.
Auf der Fahrt zurück ins Käbschütztal streichelte Geraldine die Ledermappe, betrachtete noch einmal die Urkunde, mit den Fingerspitzen fuhr sie die Konturen des Siegels nach. Ihr Herz klopfte noch genauso heftig in ihrer Brust wie vor dem ersten Besuch. Diesmal jedoch vor Freude. Sie durfte wieder auf Porzellan malen. Auf dem Werkstoff, den sie ganz allein gemeistert hatte. Leinwand, Karton, Holz, darauf zu malen hatte sie unter der kundigen Anleitung von Meister Schmitz in Köln gelernt. Die Beherrschung der Porzellanmalerei hatte sie ihrer eigenen Findigkeit zu verdanken. Mochten andere – Johann Gregorius Höroldt etwa – ruhig denken, dass eine Frau dazu nicht in der Lage war, sie wusste es besser. Mit einem Mal merkte sie, dass ihr das Malen auf Porzellan mehr bedeutete, als sie sich in der Vergangenheit eingestanden hatte.
Sie dachte an Meister Höroldts blasierte Miene, als er ihr verbot, die Muster der Manufaktur zu malen. Als ob sie daran ein Interesse hatte. Bereits auf Teucherts Dachboden hätte sie lieber eigene Motive gemalt, als die der Manufaktur abzukupfern. Bilder auf Porzellan wollte sie schaffen – so schön, so fein, dass sich selbst Meister Höroldt vor ihrer Kunst verneigen musste.
Sie las die Urkunde noch einmal sorgfältig durch und betrachtete das Siegel, das dem auf ihrem Medaillon glich. Das Siegel des Königs von Polen und des sächsischen Kurfürsten. Der König und Kurfürst hatte von ihrer Person erfahren. Vielleicht gefiel ihm ihre Kunst? Es hieß ja, dass der sächsische Herrscher ein sehr an der Malerei interessierter Herr sei. Dieser Gedanke jagte einen Schauder über Geraldines Leib, und gleich darauf lachte sie über sich selbst. Sie war viel zu unbedeutend, als dass Friedrich August II. von Sachsen und August III. von Polen sich mit ihr beschäftigen würde. Kreisamtmann Fleuter hatte es ja gesagt: Die Manufakturkommission hatte darauf entschieden.
Kapitel 2
Während Geraldine sich höchst angenehmen Gedanken hingab, standen auf dem Rittergut ihre Hausdame Frau Aha und der erste Diener Maurice in der Eingangshalle und flüsterten aufgeregt miteinander. Es kam selten vor, dass die beiden die Köpfe zusammensteckten und das noch in der Eingangshalle, in die Frau Aha kaum je kam. Ihr Bereich waren die Vorrats- und Wäschekammern, die Geschirrschränke und die Gesindestuben der Mägde unter dem Dach. Aber nachdem sich im Speisezimmer der Dienerschaft herumgesprochen hatte, wer in Abwesenheit der Herrin zu Besuch gekommen war, hielt es sie nicht länger im Untergeschoss. Mit beiden Händen ihre Röcke raffend war sie hinaufgeeilt.
In Maurice schwarzem Gesicht war seine Gemütslage kaum je zu ahnen, aber an diesem Nachmittag war seine Aufregung unschwer zu erkennen.
»Was treibt diesen Menschen her?«, hatte Frau Aha eben flüsternd gefragt.
»Etwas Gutes wird es nicht sein«, lautete die Antwort. »Er hätte wieder gehen sollen, nachdem ich ihm gesagt habe, dass Mademoiselle Geraldine nicht daheim ist. Jeder höfliche Mann hätte sich verabschiedet und wäre am nächsten Tag wiedergekommen.«
»Höflich! Sie sagen es. Wenn ich daran denke, dass ich ihn als Kind auf meinen Knien geschaukelt habe.«
»Das wird nicht der Grund für seine charakterlichen Mängel sein.«
Diese ungewohnt pointierte Antwort brachte Maurice einen langen Blick der Hausdame ein. »Es gibt keinen Grund. Der Junge hat nie etwas entbehrt. Ich war ihm Mutter und Vater zugleich, nur die besten Hauslehrer wurden für ihn engagiert. Das sieht man ja auch daran, dass er sein Theologiestudium mit Auszeichnung abgeschlossen hat.«
»An den Universitäten in Leipzig und Wittenberg haben sie nur vergessen, ihn auch christliche Demut zu lehren.«
»Warum haben Sie ihm gesagt, dass wir die gnädige Frau noch heute zurückerwarten? Sie hätten ihm ins Gesicht lügen sollen, sie sei wochenlang abwesend, dann hätte er wieder gehen müssen. Als Katholik können Sie das doch, zünden hinterher eine Kerze an und sprechen ein Ave Maria, damit alles vergeben ist.« Frau Aha schnaubte. Sie hatte vergessen zu flüstern und fuhr sich nun erschrocken mit der Hand über den Mund.
»Das hätte ich am liebsten getan, nur ist er der einzige Sohn des verstorbenen gnädigen Herrn. Wir schulden ihm Respekt und Höflichkeit«, erwiderte Maurice bekümmert.
»In welchen Salon haben Sie ihn geleitet?«
»In den Nachmittagssalon.«
»Zu schade, dass Sie nicht erfahren konnten, was ihn herführt. Ich hoffe, wir werden nicht gezwungen sein, ihn über Nacht zu beherbergen.«
Das war es jedoch, was Maurice befürchtete, denn je später die gnädige Frau zurückkam, desto geringer wurde die Chance, den ungebetenen Gast bei Tageslicht wieder loszuwerden. Ihn in die Nacht hinauszujagen, wäre jedenfalls ein Ding der Unmöglichkeit.
»Wirklich zu schade, dass Thomas gerade jetzt nicht da ist. Er hätte diesen Menschen an gutes Benehmen erinnert«, murmelte Frau Aha. Thomas war ihr um ein Jahr jüngerer Bruder, der beinahe ebenso lange auf dem Rittergut diente wie sie. Also sein ganzes Leben lang. Nur war er der Verwalter und regelmäßig mehrere Tage abwesend, um mit den Einwohnern der zum Rittergut gehörenden Dörfer anstehende Arbeiten zu besprechen.
»Trauen Sie mir das nicht zu?«, wollte Maurice drohend wissen.
»Sie haben ihm eine Erfrischung und einen Imbiss gebracht!«
»Wenn er es an Höflichkeit fehlen lässt, werden wir nicht Gleiches tun.«
»Da haben Sie auch wieder Recht«, seufzte Frau Aha. »Seine Anwesenheit macht mich ganz unglücklich. Was wird die gnädige Frau dazu sagen?«
»Was werde ich wozu sagen? Und was macht Sie unglücklich, liebe Frau Aha?«, wollte Geraldine wissen. Sie hatte das Herrenhaus durch einen Seiteneingang betreten. Hut, Handschuhe und Umhang hatte sie bereits abgelegt, trug jedoch die Ledermappe bei sich, als sie zu ihren Bediensteten trat.
Maurice fing sich als Erster und verneigte sich. »Mademoiselle Geraldine, im Nachmittagssalon wartet Besuch auf Sie.«
»Heiliger Jesus, die gnädige Frau.« Frau Aha deutete einen Knicks an, wandte sich dann an den ersten Diener und sprach leiser weiter: »Da haben wir es. Sie müssen etwas tun.«
»Das wird ja immer mysteriöser«, erheiterte sich Geraldine. »Wer ist denn gekommen, um Himmels willen?«
»Mademoiselle, es ist Peter von Scholl.«
»Mein Halbbruder!« Geraldines Gefühle wechselten von Sorge zu Freude und wieder zurück. Schließlich überwog Letzteres.
»Lassen Sie sie nicht hineingehen, ohne sie entsprechend vorzuwarnen«, sagte Frau Aha hastig.
Es war zu spät, denn Geraldine eilte auf den Nachmittagssalon zu, überhörte, was Maurice ihr hinterherrief und öffnete die Tür.
Peter von Scholl sprang bei ihrem Eintritt auf und stieß dabei sein Weinglas auf dem Tisch um. Eine rote Lache breitete sich auf dem Lack aus, tropfte von dort auf den Boden, wo sie im Teppich versickerte. Seinem geistigen Stand entsprechend war er in Schwarz gekleidet. Das blonde Haar trug er im Nacken zusammengebunden, der Zopf war bis auf die untersten Locken mit einem schwarzen Band umwickelt. Geraldines freudige Miene stieß bei ihm auf keinen Widerhall, er verneigte sich nur steif und entschuldigte sich für den Weinfleck im Teppich. Die Stimme war dabei so sauer wie Essig.
»Gewährt, gewährt, mein lieber Bruder. Was schert mich ein Fleck auf dem Teppich, wenn ich die Freude Ihres Besuches habe. Wir setzen uns einfach woanders hin.« Sie wies mit der Hand auf zwei Sessel, die vor einer Vitrine mit Büchern standen.
»Dies ist ein Besuch, zu dem ich mich verpflichtet sehe«, sagte Peter von Scholl knapp. »Ich betrachte Sie nicht als Schwester, nicht einmal als eine entfernte Verwandte. Für mich sind Sie nichts als eine Usurpatorin, eine Glücksritterin, die sich einen Besitz angeeignet hat, der ihr nicht zusteht.«
Geraldine starrte ihren Bruder an. Sie musste zu ihm aufsehen, und die steile Falte auf seiner Stirn ließ keinen Zweifel am Zweck seines Besuches zu. Ihr Geist war wie leergefegt, deshalb schwieg sie zu den ausgesprochenen Beleidigungen.
»Einmal will ich es noch im Guten mit Ihnen versuchen, danach werde ich andere Seiten aufziehen!«
»Was …«, Geraldine schluckte, »was für Seiten?«
»Verlassen Sie dieses Rittergut und kehren Sie nie zurück, dann will ich den Schaden vergessen, den Sie meinem Vater zugefügt haben. Wie Sie seine Krankheit ausgenutzt haben, um ihn in Ihr Lügengespinst einzuwickeln.«
»Ich habe dieses Rittergut geerbt. Es gibt ein Testament, vor Zeugen aufgesetzt und für gültig erklärt.«
»Dieses Testament …« Sein Gesichtsausdruck wurde wild.
Unwillkürlich trat Geraldine einen Schritt zurück, verschränkte die Arme vor der Brust und wappnete sich gegen alles, was der Halbbruder ihr noch an den Kopf werfen mochte. »Unser Vater hat mir seinen Besitz vererbt. Er wollte, dass ich ein Auskommen habe. Sie haben Ihr Amt als Pfarrer.«
»Sagen Sie nicht ›unser Vater‹!«, schrie Peter von Scholl. Speicheltröpfchen sprühten von seinen Lippen. »Verschwinden Sie! Geben Sie mir mein Erbe zurück. Mein Leben lang habe ich darauf gewartet, und ich lasse es mir nicht wegnehmen! Nicht von einer dahergelaufenen Zigeunerin!«
So war sie lange nicht mehr genannt worden. Wut sprang Geraldine an, aber statt sie in eine Furie zu verwandeln, wurde sie ganz ruhig. »Wenn ich verschwinde, werde immer noch ich die Erbin sein, das Gut wird immer noch mir gehören. Keines Ihrer Worte ändert daran etwas.«
»Unverschämte Person! Sie werden auf das ergaunerte Erbe verzichten und mich wieder in meine Rechte einsetzen.«
»Ich werde nichts dergleichen tun!«
Peter von Scholl wurde rot im Gesicht wie ein gekochter Flusskrebs. Alle Ähnlichkeit mit den edlen Zügen seines Vaters war verschwunden. Seine Kleingeistigkeit widerte Geraldine an, und sie wollte ihn loswerden. Dennoch blieb er ihr Halbbruder. Deshalb bezähmte sie ihren Groll und sagte: »Aber ich habe einen Vorschlag zu machen.«
»Sie sind nicht …!«
»Hören Sie sich erst an, was ich zu sagen habe!« Schnell sprach sie weiter. »Ich wurde vom Testament unseres Vaters genauso überrascht wie Sie. Und ich will Ihnen zugestehen, dass die Überraschung für Sie unangenehmer war als für mich. Deshalb bin ich bereit, Ihnen eine gewisse Summe zu überlassen, um Sie zu entschädigen. Wir sind Geschwister, das muss Ihnen doch auch etwas bedeuten. Für die Entscheidung unseres Vaters kann ich nichts, dennoch bin ich der Meinung, er hat an Ihnen nicht Recht gehandelt. Das möchte ich wiedergutmachen.«
Tatsächlich hatte Geraldine bereits nach Verkündung des Testaments versucht, mit ihrem Verwalter, Thomas Aha, darüber zu sprechen, aber der hatte nichts von einer Teilung des Erbes wissen wollen. Auch über eine vierteljährliche Apanage für Peter von Scholl und seine Familie hatte er nur den Kopf geschüttelt, und Geraldine das Thema einstweilen fallen lassen. Nun schien die Gelegenheit günstig, ihr Anliegen mit dem zu besprechen, den es anging. Wurden sie sich einig, konnte ihr Verwalter nur noch den Anweisungen folgen. »Ich kann mich auch der Ausbildung Ihrer Kinder annehmen und ihr Schulgeld bezahlen, zusätzlich meine ich. Oder Ihre Frau besucht mich auf einige Wochen. Ich würde mich freuen, schließlich sind wir Schwägerinnen.«
»Einen Teufel werden Sie! Mein treues Weib wird lieber im Elend leben, als einen Fuß in dieses Haus zu setzen, solange Sie es sich widerrechtlich angeeignet haben. Geben Sie mein Erbe heraus! Danach überlasse ich Ihnen ein paar Taler, damit Sie von hier verschwinden können.« Peter von Scholl stürzte auf sie zu. »Geben Sie mir mein Erbe heraus!«
Im letzten Augenblick gelang es Geraldine, ihm auszuweichen und einen Sessel zwischen sie beide zu bringen. An dessen Sitzkante schlug Peter von Scholl sich das Schienbein an. Schmerzverzerrt verzog er das Gesicht, schrie aber nur noch lauter, dass sie eine Betrügerin und Glücksritterin sei, die ihn um sein Erbe betrogen habe. Und dass er erst gehen würde, wenn sie es herausgegeben habe.
Geraldine rettete sich hinter den nächsten Sessel und stieß ihm das Möbelstück entgegen. »Hören Sie auf! Sie sind ja nicht bei Sinnen, Mann!«, rief sie. Aber sie hätte auch Russisch oder Chinesisch sprechen können, die Wirkung auf Peter von Scholl wäre die Gleiche gewesen.
Sein Gesicht hatte eine gefährlich rote Farbe angenommen. Die Hände hielt er zu Klauen geformt, als wollte er sie um ihren Hals legen und zudrücken. Geraldine bekam es mit der Angst zu tun. Gehetzt sah sie sich nach einer Waffe um. Ein Schürhaken geriet in ihren Blick. Der Kamin, an dem er lehnte, befand sich hinter ihrem Bruder und war für sie unerreichbar. Erneut musste sie dem Rasenden ausweichen, und weil ein Tisch ihr den Weg zur Tür versperrte, blieb ihr nur die andere Richtung. Es war abzusehen, wann er sie in die Enge getrieben hätte. Diesmal war Geraldine nicht schnell genug, er bekam eine der Schleifen zu fassen, mit denen ihre Ärmel eng um den Unterarm geschnürt waren.
Die Schleife riss ab, und Peter von Scholl warf sie mit einem verächtlichen Gesichtsausdruck beiseite.
»Sie sind ein Mann Gottes, bedenken Sie das!«, versuchte Geraldine, an seine Vernunft zu appellieren.
»Weib des Teufels! Elende Verführerin!«
»Zu Hilfe!«, schrie Geraldine. »Zu Hilfe! Hören Sie auf!«
Kapitel 3
Die Tür des Salons wurde aufgerissen und krachte gegen den Rahmen. Maurice erfasste die Situation mit einem Blick, sprang hinzu und umklammerte von hinten Peter von Scholls Oberkörper. Er besaß Bärenkräfte, und obwohl er ungefähr doppelt so alt war wie der Geistliche, gelang es diesem nicht, sich zu befreien. Einer der jüngeren Diener kam herbeigelaufen, und gemeinsam drängten sie Peter von Scholl zur Tür hinaus.
Inzwischen hatte Frau Aha einen Arm um Geraldines Schultern gelegt und stützte sie, derweil sie sie zu einem Sessel führte. Geraldines Knie fühlten sich wie Teig an, sodass sie die Hilfe dankbar annahm.
»Auf den Schreck hin lasse ich Ihnen ein Glas warmes Bier mit einem Stärkungspulver bereiten«, schlug die Hausdame vor. »Und eine kräftige Brühe. Das wird Sie im Nu wieder auf die Beine bringen.«
Warmes Bier und verschiedene Pülverchen waren Frau Ahas Allheilmittel. Sie bewahrte mehr als ein Dutzend für jede Gelegenheit in dem verschlossenen Schrank auf, der auch die Haushaltsbücher beherbergte. Mehr als die Aussicht auf eines davon brachte jedoch diejenige auf warmes Bier die Kräfte in Geraldines Leib zurück.
»Es geht mir wieder besser«, erklärte sie und befreite sich aus dem Arm der Hausdame. Tatsächlich fühlte Geraldine sich noch wacklig auf den Beinen, aber sie atmete tief ein und aus und schimpfte sich in Gedanken eine Trine, weil sie sich ins Bockshorn hatte jagen lassen. Das half. Sie eilte aus dem Salon in die Eingangshalle.
Maurice und der Lakai hatten Peter von Scholl inzwischen dorthin gedrängt. Der Mann schnaufte wie ein Stier, sein Gesicht war rot und schweißüberströmt.
»Können wir Sie loslassen, Monsieur von Scholl? Oder sollen wir Sie auf diese Weise zur Tür hinausbefördern? Ihre Entscheidung!« Die Stimme des treuen ersten Dieners klang gepresst. Es zehrte an seinen Kräften, den Sohn seines verehrten früheren Herrn wie einen ertappten Strauchdieb halten zu müssen.
»Lasst mich los!«, forderte Peter von Scholl. »Dieses Weib hat mich mit ihrem Blick verhext!«
»Unsinn«, kommentierte Maurice, aber er und der Lakai ließen los.
»Du wagst es, mein Wort anzuzweifeln? Das Wort eines Geistlichen!«, donnerte Peter von Scholl.
»Ich wünsche nicht, dass in meiner Eingangshalle geschrien wird«, sagte Geraldine schneidend kalt. »Dieser Mann hat mich mit unmöglichen Forderungen überzogen und bedroht. Er ist in diesem Haus nicht mehr willkommen und muss auf der Stelle gehen.«
»Sie haben Mademoiselle von Scholl gehört!« Maurice öffnete die zweiflügelige Haustür. Peter von Scholl ließ er dabei keinen Moment aus den Augen.
Draußen waren die Schatten länger geworden, der Abend senkte sich herab.
Der Besucher warf einen Blick zur Tür hinaus. »Sie wollen, dass ich jetzt gehe? Um diese Uhrzeit? Die Höflichkeit gebietet, mir ein Nachtquartier anzubieten. Sie jedoch jagen mich in die Nacht hinaus.«
Das war … Diese Frechheit machte Geraldine für einen Augenblick sprachlos. Ihrer Dienerschaft – selbst Maurice – erging es nicht anders.
»Für Sie gibt es in diesem Haus kein Nachtquartier«, entschied sie schließlich, ihre Stimme war noch um einige Grade kälter geworden.
»Sie haben die gnädige Frau gehört.« Maurice packte den Mann am Arm, und mit Hilfe des Lakaien schob er ihn zur Tür hinaus.
Peter von Scholl stolperte auf der Freitreppe und konnte nur mit Mühe einen Sturz verhindern. Dass er sich umdrehte und die Hände zu Fäusten ballte, sah niemand mehr. Die Tür war bereits geschlossen und verriegelt.
Der Kelch des warmen Biers mit einem Stärkungspulver war an Geraldine vorbeigegangen, aber um die kräftige Brühe kam sie nicht herum. Die wurde ihr serviert, kaum dass ihr Halbbruder das Haus verlassen hatte. Wider Erwarten tat ihr die heiße Mahlzeit gut. Anschließend bat sie Maurice und Frau Aha in das Arbeitskabinett ihres Vaters, wo sie zunächst erzählte, was ihr Halbbruder von ihr verlangt hatte.
»Das kann nicht wahr sein«, ereiferte sich Frau Aha. »Nun ist es doppelt schade, dass mein Bruder nicht da ist, um diesem Menschen zu antworten, was er von ihm hält; rechtlich zu antworten.«
Die Anwesenheit Thomas Ahas hätte Geraldine ebenfalls begrüßt. Nicht wegen seiner rechtlichen Ausführungen. Diese machte er oft und gerne, aber nach Geraldines Überzeugungen nicht sehr gekonnt. Aber er hätte mäßigend auf Peter von Scholl einwirken, ihn vielleicht zur Räson bringen können.
»Dieser Unhold …! Wie sich ein Mensch nur so verändern kann. Als kleiner Junger war er so niedlich und brav«, sprach Frau Aha weiter.
»Er hat mir gesagt, dass er sein Erbe zurückbekommen wird. Kann er das?«, wollte Geraldine wissen.
Beide Bedienstete schüttelten entschieden den Kopf.
»Das Testament Ihres Vaters hat Ihnen das Rittergut zugesprochen. Ich verstehe nichts vom Recht und noch weniger vom kursächsischen, aber was man aufgrund eines Testaments erhält, darf man behalten. Das ist überall auf der Welt so«, sagte Maurice im Brustton der Überzeugung.
Frau Aha stimmte zu. Bei Geraldine blieb trotzdem ein Gefühl von Unsicherheit und Ohnmacht zurück. Sie hatte schon mehr als einmal wütenden Männern gegenübergestanden, nicht zuletzt Meister Höroldt, aber noch nie hatte sie sich so verloren gefühlt, wie gerade eben bei ihrem Halbbruder. Sonst hatte sie die Wut eines Mannes immer einschätzen können. Wusste, wenn es sein Ziel war, sich ihr überlegen zu fühlen oder sie zu demütigen, weil er ihren Körper nicht bekommen konnte. Bei Peter von Scholl hätte sie nie damit gerechnet, dass er gewalttätig wurde. Männer seines Typs schrien herum, bekamen einen roten Kopf und fielen dann auf einmal in sich zusammen, als hätte man mit einer Nadel in eine Schweinsblase gestochen. So hatte sie jedenfalls gedacht.
»Er wird nicht wiederkommen, Kindchen«, erklärte Frau Aha mütterlich. »Ich meine, gnädige Frau. Sie haben Maurice, mich, meinen Bruder und noch ein halbes Dutzend mehr Diener, die alle die Hand für Sie ins Feuer legen. Sie müssen sich keine Sorgen machen.«
»Ich weiß das, aber …«, versuchte Geraldine, ihre Gefühle in Worte zu fassen.
»Das ist der Schreck, das ist doch verständlich. Schlafen Sie sich richtig aus, und danach sieht die Welt wieder besser aus.«
»Dürfen wir nach Ihrem Termin in der Manufaktur fragen, Mademoiselle Geraldine?«, warf Maurice ein.
Geraldine schenkte ihm einen dankbaren Blick. Die Mütterlichkeit Frau Ahas war ihr zu viel geworden, und der vertraute Diener und Weggefährte ihres Vaters hatte das erkannt und lenkte die Hausdame ab.
»Das war etwas Schönes. Wo ist die Mappe, die ich mitgebracht habe?«
»Sie liegt noch in der Eingangshalle.« Maurice eilte, um sie zu holen. Nach wenigen Augenblicken kehrte er zurück, hatte die Ledermappe auf seinen Händen liegen, als trage er die Krone des Königreichs Polen. Er legte sie vor Geraldine auf den Tisch.
»Ich darf außerhalb der Manufaktur auf Porzellan malen. Das ist die Erlaubnis dazu mit dem Siegel unseres Fürsten.« Sie schlug die Mappe auf.
»Ich habe immer gesagt, dass die Manufaktur Ihnen etwas schuldet. Ihren Vater hätte das sehr gefreut.« Maurice strahlte über das ganze Gesicht, dieses anziehende Lächeln ließ sie den Schrecken mit Peter von Scholl vergessen.
Kapitel 4
Hann Schneider trieb sich draußen in der Nähe des Gutshauses herum, achtete aber sorgfältig darauf, von niemandem gesehen zu werden.
Die Arbeit bei dem Töpfer, zu der Geraldine ihn verpflichtet und die sie ihm als einer Arbeit in der Manufaktur gleichwertig angepriesen hatte, befriedigte ihn nicht. Der Töpfer war ein alter Mann, der beim Sprechen in einen zahnlosen Mund nuschelte und kaum zu verstehen war. Hann begriff die wenigsten seiner Anweisungen, und dann wurde der Alte gleich ausfallend. Das Geschirr, das er für die Untertanen des Rittergutes fertigte, gefiel Hann auch nicht. Kein Vergleich mit den zarten Kostbarkeiten, die die Manufaktur verließen. Er wollte nicht lernen, so etwas Grobes herzustellen.
Es häuften sich deshalb die Tage, an denen er gar nicht erst zur Arbeit bei dem Töpfer erschien. An anderen hatte dieser nicht genug zu tun, um noch Aufgaben für einen Gehilfen zu haben. Hann hatte es sich deshalb angewöhnt, den halben Vormittag zu verschlafen, durch die Gegend zu strolchen, am Nachmittag eine Schenke aufzusuchen und wütend auf das Leben zu sein, das er führte.
Seine Ehefrau Janne verließ mit den beiden Kindern das Haus im Morgengrauen, um ihren Dienst zu beginnen. Sie gehörte im Herrenhaus zu denen, die die Vielzahl der Zimmer in Ordnung hielten, aber mehr und mehr verlangte die gnädige Frau nach ihrer Hilfe bei der Wahl ihrer Garderobe und ihrer Frisur. Nach Jannes Meinung tat sie es in der Erinnerung an ihre Meißner Freundschaft, als sie beide noch von einfachem Stand und arm wie die Kirchenmäuse gewesen waren. Seine Frau war dankbar für ihre Aufgaben als Zofe, für Hann dagegen war das nichts als ein Almosen, mit dem die gnädige Dame Geraldine von Scholl ihr Gewissen beruhigte.
In die gleiche Kategorie gehörte für ihn auch die Erlaubnis, dass Janne die beiden Kinder mit ins Herrenhaus bringen dürfte, damit sie dort angemessen beschäftigt wurden. In seinen Augen wurden sie dort nur von jedermann verwöhnt. Das ging so weit, dass sie ihrem Vater kaum noch den schuldigen Respekt entgegenbrachten, ihn stattdessen um Süßigkeiten anbettelten. Hätte Geraldine tatsächlich etwas für seine Familie tun wollen, hätte sie ihnen ein anständiges Auskommen verschafft, statt nur Brosamen von ihrem Tisch fallen zu lassen.
Hann beobachtete das Kommen und Gehen im Herrenhaus. Da kaum einmal Besuch eintraf, waren seine Erkundungen überschaubar. Umso mehr war ihm deshalb der Herr im Gewand eines Geistlichen aufgefallen, der an diesem Nachmittag das Haus betreten hatte. Er hatte eigentlich erwartet, ihn gleich wieder herauskommen zu sehen, weil die gnädige Dame Geraldine ausgefahren war, aber die Tür blieb geschlossen. Hann verlor die Lust daran, einen Eingang zu beobachten, bei dem sich nichts tat. Er ging seiner Wege.
In der hereinbrechenden Dämmerung kam ihm auf einem Pfad eben jener Herr zu Fuß entgegen. Er trug von Weitem erkennbar Wut im Gesicht. Trotz seiner geringen Kenntnisse über die Sitten der vornehmen Welt wusste Hann, dass man seinen Gästen um diese Zeit normalerweise ein Quartier anbot, damit sie sich nicht bei der Suche nach einer Herberge den Gefahren der Nacht aussetzen mussten. Dass man es diesem Besucher trotzdem zumutete, ihm nicht einmal eine Kutsche zur Verfügung stellte, war so ungewöhnlich, dass es Hanns Interesse weckte. Er sprach den Mann deshalb an, als der an ihm vorbeistürmte.
»Verzeihung der Herr, wenn Sie auf der Suche nach einem angemessenen Nachtquartier sind, kann ich eine Herberge empfehlen.«
Ihn traf ein verächtlicher Blick. »Ich kenne alle Herbergen in der Umgebung mit Sicherheit besser als er.«
Das war nicht sehr ermutigend, trotzdem gab Hann nicht auf. »Leider ist es so, dass die neue Herrin des Rittergutes keine sehr vornehmen Sitten pflegt und die Menschen in ihrer Umgebung schindet.«
»Was weiß er schon!« Der Geistliche war jedoch stehen geblieben und schien gewillt, sich auf ein Gespräch einzulassen.
»Jedermann weiß doch, dass man einem Besucher um diese Zeit nicht mehr die Tür weist. Mein Weib arbeitet im Herrenhaus von früh bis spät mit ihren schwachen Kräften. Deshalb sehen Sie mich auf diesem Pfad, weil sie noch nicht zu Hause ist, um sich um ihren Ehemann zu kümmern.« Hann schlug sich mit der Hand auf die Brust.
»Das ist seine Sache.« Der Mann machte Anstalten weiterzugehen.
Hann musste sich etwas überlegen, denn er war fest entschlossen, herauszufinden, warum der Geistliche mit einem strengen Gesichtsausdruck das Haus betreten hatte und mit einer derartigen Wut wieder herausgekommen war. Ihm fiel jedoch nichts anderes ein, als sich zu verneigen. »Johann Schneider, stets zu Ihren Diensten, Herr …«
»Pfarrer Peter von Scholl«, lautete die prompte Antwort.
»Von Scholl! Dann sind Sie ein Verwandter der gnädigen Dame Geraldine?« Sieh mal einer an, dachte er. Dabei hatte Janne stets behauptet, es gäbe keine Verwandtschaft.
»Gnädige Frau! Und nein, ich leugne jegliche Verwandtschaft mit ihr.« Die immer noch in seiner Brust gärende Wut brachte Peter von Scholl dazu, die Geschichte des Rauswurfs preiszugeben. In Hann fand er den dankbarsten Zuhörer, der sich vorstellen ließ.
»Also ist sie nichts als eine Hochstaplerin. Ich habe es immer geahnt«, kommentierte der, nachdem Peter von Scholl geendet hatte.
»Was geahnt?«
»Dass etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, als es auf einmal hieß, sie habe dieses Rittergut geerbt. Ich kenne sie als eine Frau, die sich erst als Magd versucht und später das Porzellan der Meißner Manufaktur gefälscht hat. Ich will Ihnen etwas sagen, guter Herr Pfarrer, ich stehe auf Ihrer Seite. Dieses Unrecht muss aus der Welt geschafft werden, und dabei können Sie auf mich zählen, so wahr mir Gott helfe.«
»Das soll sein Schaden nicht sein, guter Mann. Berichte er mir von den Vorgängen in diesem Hause. Ach, er wird ja nicht schreiben können.«
»Ich kann lesen und schreiben«, erklärte Hann stolz. »Schließlich habe ich in der Manufaktur gearbeitet und hatte gute Aussichten, zum Brenner aufzusteigen, bevor die Umstände um diese Dame mich zwangen, mein Tractament aufzukündigen. Nun muss ich mein Dasein in einer Töpferei fristen und mein Weib in ihrem Hause schuften, damit wir überhaupt ein Auskommen haben.«
Für die armseligen Umstände seines Verbündeten interessierte Peter von Scholl sich nicht, deshalb sagte er nur kühl: »Bestens. Berichte er mir in das Pfarrhaus nach Muskau. Das ist für seine Auslagen.« Aus einer ledernen Börse fischte er einige Groschen und schnippte sie Hann hin.
Dieser fing sie geschickt auf und ließ sie in einer Tasche seiner verschossenen Jacke verschwinden.
»Lass er sich nicht erwischen!«, brummte Peter von Scholl noch.
»Wo denken Sie hin, ehrwürdiger Herr Pfarrer. Einem Hann Schneider kommt niemand auf die Schliche. Auf mich können Sie zählen bei allem, was zu tun ist, um diese anmaßende Person zu vertreiben und mein armes Weib aus ihrer Fron zu befreien.«
»So soll es sein, so wahr Gott gnädig und gerecht ist«, stimmte Peter von Scholl zu, und zu der Wut in seiner Miene gesellte sich Genugtuung.
Zur Bekräftigung ihrer Vereinbarung gaben sie sich die Hand. Danach strebte Peter von Scholl mit langen Schritten davon.
Die Großspurigkeit seines neuen Verbündeten war ihm nicht verborgen geblieben, und er entschied, sich nicht allein auf dessen Findigkeit, sondern auch auf seine eigenen Geisteskräfte zu verlassen. Ihm fiel im Moment jedoch nichts ein, was gegen diese Hochstaplerin unternommen werden könnte, aber er war sicher, Gott hieße es nicht gut, wenn sich diese Katholische auf seinem Erbe breitmachte. Deshalb würde er ihm beizeiten eine Idee eingeben.
Dieses Gottvertrauen beruhigte sein aufgeregtes Gemüt beträchtlich, und in heiteren Gedanken an seinen Triumph schritt er dahin.
Janne saß im Schein einer Laterne vor dem Haus und nähte an Rikardas Sonntagskleid einen handbreiten Streifen Stoff an. Das Mädchen war schon wieder gewachsen und ihr alles zu klein geworden. Zum Glück hatte sie von Frau Aha Stoffreste zum Nähen bekommen und keine kaufen müssen. In letzter Zeit verdiente Hann kaum noch etwas, und sie bekam im Herrenhaus den größten Teil ihres Lohnes in Naturalien ausbezahlt. Mit Essen, das sie jeden Abend von dort mitbrachte. Im Haus war kaum Geld vorhanden, auch wenn es ihnen an nichts fehlte.
Eifrig stach sie die Nadel durch den Stoff und beugte sich in der zunehmenden Dunkelheit immer dichter an die Laterne heran, um noch etwas zu sehen. Hinter ihr stand die Haustür offen, damit sie hörte, wenn eines der Kinder aufwachte und nach der Mama rief.
So fand sie Hann, der sich schnaufend neben ihr auf der Bank niederließ. Zwischen ihnen stand die Laterne.
»Warum sitzt du draußen?«, wollte er wissen.
»Es ist ein schöner Abend, und im Haus war es so stickig.«
»Du verdirbst dir die Augen, wenn du bei dem Funzellicht nähst.«
»Rikarda ist schon wieder aus ihren Kleidern herausgewachsen. Was soll ich machen?«
»Wir kaufen ihr neue Kleider. Es wird doch in den zum Rittergut gehörenden Dörfern eine Frau geben, die für uns nähen kann.«
Janne ließ die Nadel sinken und schaute ihren Mann über die Laterne hinweg an. Sie versuchte zu ergründen, ob Hann einen Scherz gemacht hatte. Er sah allerdings aus, als hätte er es vollkommen ernst gemeint. »Eine Näherin wird Geld verlangen. Woher sollen wir das nehmen? Im Haus haben wir nur ein paar Groschen, die wir für einen Notfall aufbewahren müssen.«
»Dann bezahlen wir die Frau später«, antwortete Hann leichthin. »Sobald wir mehr Geld haben. Diese Frau wird doch ein paar Wochen warten können, dann ändert sich hier alles.«
»Hann, wovon redest du?«
»Von einer besseren Zukunft für uns. Du musst mir dabei helfen, sie zu erreichen.«
Dazu war Janne mehr als bereit. Wenn es bedeutete, dass ihr Mann wieder eine richtige Arbeit fand, wollte sie ihm sehr gerne helfen. Sie nickte. »Was muss ich tun?«
»Mir nur ein paar Dinge sagen.«
»Was für Dinge?«
»Was im Herrenhaus so vor sich geht. Du musst mir sagen, wenn dir etwas auffällt.«
»Im Herrenhaus? Was hat das mit einer Arbeit für dich zu tun? Was soll mir dort auffallen?« Sie forschte in Hanns Gesicht nach einer Antwort auf ihre vielen Fragen, aber seine Miene blieb unbeweglich. »Wenn Herr Aha dich beschäftigen will, wird er dir sagen, was du zu tun hast.«
»Um ihn geht es nicht. Der hochnäsige Herr Aha wird hier bald gar nichts mehr zu sagen haben. Sobald erst einmal der wahre Erbe das Gut übernommen hat, werden sich die Dinge ändern. Grundlegend ändern. Wir beide werden auf der Seite der Sieger stehen, dafür habe ich gesorgt.«
»Wer soll der wahre Erbe sein?«
»Peter von Scholl. Er war heute hier, um sein Recht einzufordern.«
Janne hatte den Namen noch nie gehört, aber ihr war ein Vorfall mit einem ungebetenen Gast zu Ohren gekommen, der des Hauses verwiesen worden war. Sie brauchte nicht lange, um zusammenzuzählen, dass es sich bei ihm um Peter von Scholl gehandelt haben musste. »Hann, weißt du auch genau, was du da tust?«
»Natürlich weiß ich das. Die gnädige Frau«, bei diesen Worten verdrehte er die Augen, »hat nicht zu Recht geerbt. Aber sie ist wohl nicht bereit, sich den Tatsachen zu stellen und den Besitz herauszugeben. Deshalb muss ich wissen, was im Herrenhaus vor sich geht und es weitergeben, damit ihre finsteren Pläne nicht gelingen können.«
Nun wurde Janne erst heiß, dann kalt und zuletzt fauchte Wut durch ihre Gedanken. Sie hatte Mühe, sitzen zu bleiben, statt ins Haus zu laufen und die Tür hinter sich zu verriegeln. »Du meinst, ich soll die gnädige Frau bespitzeln, damit du weißt, was bei ihr auf den Tisch kommt, wo ihr Schmuck aufbewahrt wird oder wie viele Unterröcke sie trägt?«, stieß sie endlich hervor.
»Die Unterröcke interessieren mich nicht. Das mit dem Schmuck ist eine Überlegung wert. Eigentlich will ich wissen, was sie redet. Alles, was du hörst, könnte wichtig sein. Ihre finsteren Pläne dürfen keinen Erfolg haben, das Rittergut muss in die Hände gelangen, in die es gehört. In die Hände eines Mannes.«
»Hörst du dir selbst zu?«, begehrte Janne auf. »Die gnädige Frau war immer gut zu uns. Sie hat uns geholfen, als wir ganz unten waren. Sie hat uns ein Heim gegeben. Das willst du ihr danken, indem du hilfst, sie von hier zu vertreiben?« Sie rückte fort von Hann bis zum Ende der Bank. Seine Nähe war für sie gerade nicht leicht zu ertragen.
»Wie sprichst du mit mir? Ich bin dein Mann …«
»Deswegen mache ich mir trotzdem eigene Gedanken und erkenne ein Unrecht, wenn ich eines vor mir sehe. Die gnädige Frau nimmt mich als ihre Zofe an, obwohl ich wenig von dem verstehe, was eine Zofe alles zu tun hat. Ich darf beide Kinder ins Herrenhaus mitbringen, und sie werden von allen so behandelt, als wohnten sie dort. Jeden Tag beweist sie mir so ihre Güte.«
»Du willst dich mir widersetzen? Deinem Mann?«
»Du bist mein Mann, und ich liebe dich. Auf allen Wegen folge ich dir und tue alles, was du mir zumuten willst. Es darf nur kein Unrecht sein und meine Seele nicht mit Sünde beflecken. Aber gerade das verlangst du von mir.«
»Das tue ich nicht«, sagte Hann sofort. »Du verhilfst der Wahrheit zu ihrem Recht. Nichts anderes verlange ich von dir. Du wirst es tun!« Hann wollte an der Laterne vorbei nach dem Arm seiner Frau greifen.
Janne sprang auf, und in diesem Moment ertönte ein Weinen aus dem Haus. »Simon Andreas braucht mich.« Sie lief nach drinnen, um ihren kleinen Sohn hochzunehmen und zu beruhigen, ihre Nase in seinen Nacken zu drücken und seinen süßen Kleinkinderduft einzuatmen. Die Laterne nahm sie mit.
»Ich bin dein Mann, und du wirst mir gehorchen«, rief Hann ihr hinterher.
Ihr Sohn lag in seinem Korb auf dem Bauch, strampelte mit Armen und Beinen, wollte sich drehen, und weil es ihm nicht gelang, weinte er verzweifelt. Janne nahm ihn hoch, drückte sein verschwitztes, tränennasses Gesicht an ihre Wange. Er roch süß nach Milch. Sie wiegte ihn sanft und murmelte beruhigende Worte. Es dauerte auch nicht lange, bis das Weinen aufhörte.
Dafür standen nun Janne Tränen in den Augen. Während sie ihren Sohn in den Armen wiegte, dachte sie daran, wie sie und Hann vor fünf Jahren geheiratet hatten. Wie glücklich sie gewesen war, einen guten Mann zu bekommen, in den sie obendrein seit Jahren heimlich verliebt war. Sie hätten ein gutes Leben haben können. Solange Hann in der Manufaktur arbeitete sowieso. Jetzt auch noch. Er hätte weiter bei dem Töpfer arbeiten sollen, und weil dieser Mann keine Kinder hatte, sogar eines Tages dessen Werkstatt übernehmen können. Stattdessen verknotete ein Dämon seine Gedanken, dass er immer alles kaputt machte.
Eine Träne tropfte auf Simon Andreas' feinen Haarflaum.
Kapitel 5
Die ersten Scherben, die Geraldine nach der Entscheidung der Manufakturkommission bemalte, waren etwa handtellergroße Untersetzer. Davon jedoch mehr als ein Dutzend. Mit sehr feinen Strichen entstand auf einer Hälfte ein Porträt Martin Luthers. Auf die anderen malte sie das Konterfei Philipp Melanchthons.
Die beiden Reformatoren hatte sie von Bildern abgemalt, die im privaten Salon ihres Vaters hingen. Der Raum, in dem sie sich zum ersten Mal gegenübergestanden hatten. Lukas Cranach der Jüngere hatte beide Bilder gemalt. Einem gottesfürchtigen Menschen stand es immer gut an, Bilder dieser beiden im Haus zu haben.
Für ihr Vorhaben wäre es besser gewesen, diejenigen auf den Untersetzern zu porträtieren, denen sie als Geschenk zugedacht waren, aber dafür hätten die Herren ihr Modell sitzen, und sie hätte Skizzen anfertigen müssen. Die Überraschung wäre dahin gewesen.
Den ersten Luther, an dem sie sich versuchte, musste sie nach dem Gutbrand aussortieren. Sein Porträt war verrutscht, die Farben nicht gleichmäßig in die Glasur eingebrannt und die Pinselstriche nicht so fein und sicher, wie sie sich das vorgestellt hatte. Beim Malen hatte sie das schon befürchtet und den Untersetzer nur zum Brennen gegeben, um hinterher zu sehen, was es zu verbessern galt. Das aus Meißen angelieferte Porzellan war bestenfalls zweite Wahl, obwohl ihr der Dispens die beste Qualität zusicherte. Meister Höroldts Handschrift vermutete sie dahinter, eine derartig kleingeistige Haltung passte zu seinem Charakter. Vorläufig war Geraldine bereit, es hinzunehmen, so lange es nicht dazu führte, dass ihre Kunstwerke unansehnlich wurden.
Die anderen Porträts auf den Untersetzern waren … Ihr kritischer Blick durch eine Lupe zeigte ihr Stellen, an denen die Farben nicht gut ineinander verlaufen waren, aber sie waren noch hinnehmbar. Bei jedem Kunstwerk gab es Stellen, mit denen der Erschaffer weniger zufrieden war als mit anderen. Es ärgerte sie jedoch, dass sie nach ein paar Wochen, in denen sie nicht auf Porzellan gemalt hatte, gleich blutige Anfängerfehler machte. Der Untersetzer, den sie gerade betrachtete, sah nur von Weitem gut aus. Geraldine sortierte ein weiteres Porträt Martin Luthers aus.
Am Ende hatte sie aber doch genügend Bildnisse, um jedem eins zu schicken, bei dem sie sich bedanken wollte. Alles in allem elf Personen. Jedem schrieb Geraldine einen Brief, in dem sie sich für die Erlaubnis, auf Porzellan malen zu dürfen, bedankte. Als kleines Zeichen ihrer Ergebenheit lege sie dem Schreiben ein Porträt bei und hoffe, es gefalle dem Empfänger und diene seiner Erbauung. Es war nicht leicht, elf Briefe gleichen Inhalts, aber mit immer anderen Worten zu schreiben. Danach fühlte Geraldine sich erschöpft und gleichzeitig zufrieden.
Es waren tatsächlich die ersten Bilder auf Porzellan, die sie in all der Zeit nach ihrem eigenen Gutdünken gemalt hatte. Bei Teucherts hatte sie malen müssen, was diese von ihr verlangten. Nachdem sie sich als falscher Buntmaler in die Manufaktur eingeschlichen hatte, um den Namen ihres Vaters von einem furchtbaren Verdacht reinzuwaschen, war es unter Höroldts Ägide nicht anders gewesen. Und dann hatte sie monatelang gar nicht auf Porzellan malen dürfen. Aber nun … Sie fühlte die Schaffenskraft wie feurige Lohe durch ihre Adern fließen.
Die Schreiben mit dem Porträt Martin Luthers verschickte sie an die Arkanisten Gottlob Leberecht von Heynitz, Johann Joachim Kändler, an den Arzt Dr. Christoph Heinrich Petzsch und seinen Kollegen Johann Christlieb Schatter sowie an Daniel Gottlieb Schertel. Der Direktor Graf Heinrich von Brühl und die Mitglieder der Manufakturkommission Johann George von Wichmannshausen, Carl von Nimpsch und Johann Friedrich Fleuter und Justus Lorentz erhielten mit ihrem Schreiben ein Bild Philipp Melanchthons.
Eigentlich hätte sie bei den Schreiben an die Arkanisten auch Johann Gregorius Höroldt bedenken müssen, aber darauf verzichtete sie. Der Mann verstand das sicher nur als einen Angriff auf seine Ehre. Ihr kleines Porträt war ihr zu schade, um auf der Erde zerschmettert zu werden. Wie von ihm verlangt hatte sie jedoch jedes Bild mit ihren Initialen GvS und einem Weidengras signiert, um deutlich zu machen, dass es nicht aus der Manufaktur stammte.
Dann gab es noch jemanden, dem sie danken müsste, und der sie zögern ließ. War er doch der polnische König und sächsische Kurfürst. Sollte sie so dreist sein und ihm ein Geschenk schicken? Welches? Er und seine Familie waren katholisch, da kam es nicht infrage, sie mit dem Bildnis eines Reformators zu bedenken. Ein Heiliger wäre vermutlich angemessener. Im Hause ihres Vaters fand sie jedoch keine Vorlagen. Er war überzeugter Lutheraner gewesen und hatte sich keine Heiligen an die Wände gehängt. Sie fand nur eine Maria mit dem Jesuskind, aber beide waren von derart schlechter Qualität in Perspektive und Pinselstrich, dass sie als Vorlage nicht infrage kamen. Geraldine fragte sich sogar, wie dieses Gemälde im Haus überlebt hatte. Nach dem Signum eines Malers suchte sie vergeblich. Nach zwei Tagen der Überlegung gab sie diesen Plan schließlich auf.
Das Verschicken der Dankschreiben vertraute sie Herrn Aha an, der dafür in Meißen einen Boten engagierte, statt die Sendungen dem Postschiff zu übergeben.
***
Kreisamtmann Fleuter sah das Schreiben und das beigelegte Porträt des Reformators Melanchthon am Abend, nachdem er von der Arbeit zurückgekehrt war. Er interessierte sich mehr für juristische Vorgänge als für Kunst und schloss Porträt und Schreiben achtlos in seinem Sekretär ein.
Kändler erhielt sein Schreiben und ein Lutherbildnis in seiner Werkstatt in der Porzellanmanufaktur. Er nahm sich die Zeit, den Brief sorgfältig zu lesen und das Bild zu betrachten. Es war ein kleines Kunstwerk, ein wenig düster für seinen Geschmack, aber das war wohl der Vorlage geschuldet. Er erkannte sehr wohl, dass es einem Cranach-Gemälde nachempfunden war, und die waren ihm immer düster erschienen. Trotzdem hing er das kleine Bild auf, und fortan hatte ihn der Reformator bei seiner Arbeit im Blick.
Im Haushalt des Kabinettsministers Graf Heinrich von Brühl nahm dessen Sekretär das Schreiben entgegen. Und weil nur Minuten später ein ganzer Stoß zu bearbeitender Akten auf seinem Tisch abgelegt wurde, wanderte die schmale, aber unerwartet schwere Sendung einer dem Sekretär unbekannten Dame aus dem Käbschütztal auf den Stapel mit wenig wichtiger Post, um dort vergessen zu werden.
Der Arkanist Dr. Johann Christlieb Schatter saß in seinem Behandlungszimmer und war gerade mit dem Lesen des Dankesbriefes beschäftigt, als ihm sein Freund und Berufskollege Laurenz Schumann als Besucher gemeldet wurde. Der war gekommen, um ein medizinisches Werk zurückzubringen, das er sich vor wenigen Wochen von Dr. Schatter geliehen hatte. Den Brief ließ dieser liegen, aber das kleine Lutherbild nahm er mit, als er in die Bibliothek ging, um den Freund zu empfangen. Beide Männer tranken einen Portwein miteinander und saßen etwa eine halbe Stunde beisammen. Dabei fiel Laurenz Schumann das Porzellanbild auf, das der Freund achtlos auf einem Fensterbrett abgelegt hatte. Er fragte danach.
»Das ist nur ein kleines Gemälde Martin Luthers, das mich eben erreichte, als mir Ihr Besuch gemeldet wurde. Ich weiß gar nicht, warum ich es hergebracht habe.« Dr. Schatter war jedoch ein gutmütiger Mensch und stand auf, um den kleinen Porzellanteller für seinen Freund zu holen.
Laurenz Schumann betrachtete es einige Zeit, nahm dabei mitunter ein Lorgnon zu Hilfe. Endlich schaute er auf. »Ich verstehe vom Porzellan bei Weitem nicht so viel wie Sie, aber mir scheint es ein hübsches kleines Porträt zu sein. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Menschen so lebensecht auf Porzellan gemalt werden können.«
Das brachte Dr. Schatter nun dazu, sich das Porträt genauer anzusehen. Dafür hielt er es sich dicht vor die Augen und brauchte nur wenige Augenblicke. »In der Tat. Es ist bemerkenswert echt dargestellt. Selbst aus der Nähe sieht es aus, als wollte der Herr Luther gleich zu predigen beginnen. Nur ob wir das hören wollen?«
Beide Männer lachten kurz auf. Laurenz Schumann griff wieder nach dem Untersetzer, streichelte mit einem Finger Martin Luther über die Wange. »Es besteht auch keine Ähnlichkeit mit dem, was man sonst als Meißner Porzellan kennt. Was ich in Ihrer Sammlung bewundern durfte. Wer hat es gemalt?«
»Ein Fräulein Geraldine von Scholl, die Tochter meines Ende letzten Jahres verstorbenen Freundes und Arkanisten Ritter von Scholl.«
Ritter von Scholl – der Name berührte eine Seite in Laurenz Schumann. Bald zwanzig Jahre war es her, dass er den Mann getroffen und als einen eifrigen, aber auch in sich verschlossenen Forscher kennengelernt hatten. Nach vier Wochen hatten sich ihre Wege wieder getrennt. Der Mann hatte also bei seiner Begeisterung für die Wissenschaft und ausgedehnte Forschungsreisen noch die Zeit gefunden, Vater einer Tochter zu werden.
»Werden wir also bald ein Reformationsservice in der Dresdner Niederlage bestaunen können. Ob das unserem katholischen Fürsten und seiner gottesfürchtigen Gattin zusagt?«
»So weit wird es nicht kommen.« Dr. Schatter fuhr sich mit einem Finger unter sein Halstuch, das ihm auf einmal zu eng gebunden schien. Selbst bei einem so guten Freund wie Laurenz Schumann fühlte er sich bei jedem Gespräch über die Manufaktur wie kurz vor dem Fegefeuer stehend. Er fürchtete, unbeabsichtigt einen Teil des Arkanums zu verraten und in die gleiche Lage zu kommen wie weiland Nathan Leberecht von Scholl.
Auf den fragenden Blick seines Besuchers hin führte er schnell weiter aus, was er in Fräulein Geraldines Dankschreiben gelesen hatte.
»Das scheint mir eine großzügige Geste zu sein. Ich will Ihre Zeit aber nicht länger in Anspruch nehmen.« Laurenz Schumann erhob sich, dabei warf er noch einen Blick auf das Porzellanporträt, das inzwischen neben dem zurückgebrachten Buch auf einem schwarz lackierten, chinesischen Tischchen lag.
Schnell nahm Dr. Schatter es an sich. »Lieber Freund, nehmen Sie es mit.« Er hielt es Laurenz Schumann hin.
»Das geht nicht. Es ist ein Geschenk an Sie.«
»Und jetzt schenke ich es Ihnen. Ich sehe doch, dass es Ihnen viel bedeutet. Mehr als mir, der ich schon so viel Porzellan im Haus habe, dass ich mich manchmal selbst nicht mehr auskenne.«
Das war stark übertrieben, aber Laurenz Schumann ließ sich am Ende überreden und trug das Porzellanbild nach Hause.
Kapitel 6
Seine siebzehnjährige Tochter Laura Schumann verstand nichts von Martin Luther und nicht viel von Malerei. Ihre Talente lagen auf einem anderen Gebiet, nämlich, dass ihr Mundwerk niemals still stand, und ein Händchen für Pferde hatte sie von ihrer Mutter geerbt. Sie sah sich aber gerade vor die Aufgabe gestellt, selbst porträtiert zu werden. Ein Geschenk für ihren Verlobten, um ihm die Wartezeit bis zur Hochzeit in einem Jahr nicht zu lang werden zu lassen.
Obwohl von einem Porträt die Rede gewesen war, schwebte ihr als Erstes ein lebensgroßes Bild von sich selbst auf ihrer Schimmelstute Desdemona vor. Ihre Eltern mussten einige Kunst aufwenden, um ihr das wieder auszureden. Ihre zweite Idee bestand darin, nicht mehr lebensgroß und mit Pferd, dafür aber unter einem Rosenbogen abgebildet zu werden, wie sie an einer der Blüten roch. Schließlich war das die Situation gewesen, in der sie ihren Verlobten Conrad Amadeus Döbner zum ersten Mal gesehen hatte. Sie wollte auch in genau dem gleichen Kleid gemalt werden, das sie damals trug. Nach Lauras Ansicht handelte es sich um ein sehr bescheidenes Bild, wie es Verlobte einander schenken sollten, um sich ihrer Zuneigung zu versichern. Therese und Laurenz Schumann fiel es nicht leicht, ihr das auch wieder auszureden. Den Ausschlag dagegen gab schließlich, dass das bewusste Kleid zwar noch vorhanden, aber völlig aus der Mode gekommen war. In diesem Ding – so bezeichnete Laura es nun – wolle sie sich keinesfalls malen lassen.
Deshalb hatte sie in ein Porträt eingewilligt, bei dem sie im Halbprofil und bis zu den Schultern zu sehen war. Besonders ihr schlanker Hals sollte gut zur Geltung kommen, denn dorthin hatte Conrad einen ersten scheuen Kuss gesetzt. Aber das wussten die Eltern nicht.
So weit waren die Dinge gediehen, als Laurenz Schumann das Porträt Martin Luthers gemalt auf Porzellan mitbrachte. Seine Ehefrau Therese betrachtete es wohlgefällig, ehe sie es an ihre Tochter weiterreichte. Kaum spürte die das kühle Porzellan in ihren Händen, ging ein Ruck durch das Mädchen, als habe sie ein Blitz getroffen. An Herrn Luther konnte es nicht liegen – so viel war einmal sicher.
»Das ist es!«, rief Laura aus. »Mama, schauen Sie! Das ist für Conrad genau das Richtige.«