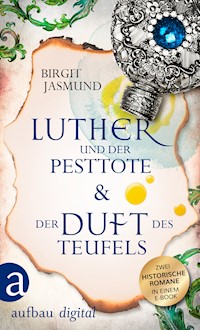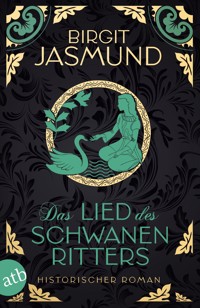9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn das Eis bricht.
Dresden, 1784: Seit ihre Mutter verschwunden ist, hilft Luise ihrem Vater, einem Fischer, bei der Arbeit. Beunruhigt beobachten sie, wie sich auf der Elbe die Eismassen aufstauen. Den Geographen Conrad treiben ähnliche Sorgen um. Als ein paar Kinder zwischen die Eisschollen geraten, muss Luise mit ansehen, wie Conrad sein Leben riskiert, um die Jungen zu retten. Die beiden spüren sofort eine besondere Verbindung. Dann bricht das Eis auf, Wassermassen schießen stromabwärts – und in all dem Unglück werden Luise und Conrad auseinandergerissen ...
Eine berührende Liebesgeschichte inmitten einer verheerenden historischen Naturkatastrophe – hervorragend recherchiert und packend erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Die junge Luise hilft ihrem Vater, einem Elbfischer, bei der Arbeit, seit ihre Mutter vor vielen Jahren spurlos verschwunden ist. Sie beobachten beunruhigt, wie sich das Eis auf der Elbe immer weiter aufstaut. Eine Katastrophe scheint unausweichlich, wenn die Behörden nicht sofort reagieren und den Fluss vom Eis befreien. Auch der junge Geograph Conrad schätzt die Lage als gefährlich ein, aber man nimmt ihre Sorgen nicht ernst, und so geschieht das Unglück: Das Eis bricht, und Wassermassen überfluten die Orte entlang der Elbe. Bei einer dramatischen Rettungsaktion kommen Luise und Conrad einander näher. Doch als sie den falschen Freunden vertraut, steht auf einmal nicht nur ihr Glück auf dem Spiel …
Über Birgit Jasmund
Birgit Jasmund, geboren 1967, stammt aus der Nähe von Hamburg. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Kiel hat das Leben sie nach Dresden verschlagen. Wenn einem dort der Wind so richtig um die Nase weht, hält sie nichts im Haus.
Im Aufbau Taschenbuch Verlag sind von ihr bereits die historischen Romane „Die Tochter von Rungholt“, „Luther und der Pesttote“, „Der Duft des Teufels“, „Das Geheimnis der Porzellanmalerin“, „Das Geheimnis der Zuckerbäckerin“, „Das Erbe der Porzellanmalerin“, „Die Maitresse. Aufstieg und Fall der Gräfin Cosel“ und „Das Geheimnis der Baumeisterin“ sowie bei Rütten & Loening die Liebesgeschichte „Krabbenfang“ erschienen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Birgit Jasmund
Die Elbflut
1784: Eine mutige Frau und eine verheerende Naturkatastrophe
Historischer Roman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Kapitel XXXIV
Kapitel XXXV
Kapitel XXXVI
Kapitel XXXVII
Kapitel XXXVIII
Kapitel XXXIX
Kapitel XL
Kapitel XLI
Kapitel XLII
Kapitel XLIII
Kapitel XLIV
Kapitel XLV
Kapitel XLVI
Kapitel XLVII
Kapitel XLVIII
Kapitel IL
Kapitel L
Kapitel LI
Kapitel LII
Kapitel LIII
Kapitel LIV
Kapitel LV
Kapitel LVI
Kapitel LVII
Kapitel LVIII
Kapitel LIX
Kapitel LX
Kapitel LXI
Kapitel LXII
Kapitel LXIII
Ein paar Anmerkungen …
Impressum
Wer von diesem historischen Roman begeistert ist, liest auch ...
Kapitel I
Das ist alles!« Jacob Ehrmann warf eine Handvoll Münzen auf den Tisch. Sie rollten in alle Richtungen.
Seine Kinder Luise und Georg beeilten sich, sie abzufangen, ehe sie den Rand erreichten. Sie legten die Münzen in der Tischmitte wieder zusammen. Es waren einige Groschen, mehr Pfennige, kein einziger Taler. Wenn man es zusammenrechnete … viel war es nicht. Eine eiserne Faust schloss sich um Luises Herz. Auch der fünfzehnjährige Georg sah betreten drein. Jacob setzte sich auf einen Stuhl am Kopfende des Tisches.
»Die Fische im Kasten?«, fragte Luise.
»Verkauft«, antwortete der Bruder.
»Davon leben wir seit Wochen. Seit wir wegen des Eises nicht mehr zum Fischen rausfahren können«, erklärte Jacob, als wüsste das nicht jeder in der Familie.
»Die geräucherten?«, fragte wieder Luise. Der Vater war zwischen Meißen und Pillnitz bekannt für seine geräucherten Fische. Sogar bis zu den Kaufherren nach Leipzig hatte es sich herumgesprochen, dass der Elbfischer Jacob Ehrmann seinen Fang mit einer ganz besonderen Note räucherte.
»Das ist der Erlös der letzten drei Fische.« Die schweren Lider sanken hinab, und Jacob Ehrmann sah aus wie ein Hund, der neben seinem toten Herrn trauerte.
Luise sprang auf, nahm eine Tasse vom Wandbord und schenkte ihrem Vater ein. Die Kanne hielt sie den ganzen Tag auf dem Herd warm. Entsprechend schwarz und stark war der Kaffee. Sie verdünnte ihn mit etwas Wasser, ehe sie die Tasse vor ihren Vater stellte. Georg schaute sie an, als hätte er auch gerne eine Tasse Kaffee gehabt, aber sie schüttelte den Kopf. Man sollte sich nichts gönnen, was man sich nicht selbst erarbeitet hatte. Nach diesem Grundsatz hatte der Vater sein Leben ausgerichtet, und so hielt er es auch bei seinen Kindern. Von klein auf hatten sie und Georg gelernt, dass Belohnungen verdient werden mussten. Jacob trank den Kaffee in langsamen Schlucken. Weder wurde seine Miene weicher noch entspannte sich seine Haltung. Er knallte die leere Tasse auf den Tisch und stiefelte aus dem Haus.
Alles, was Luise noch hätte sagen können, um ihren Vater aufzumuntern, schmeckte ihr selbst schal. Niemand wusste besser als sie, wie wenig sie mit Waschen und Flicken für reiche Dresdner Haushalte dazuverdiente.
Tags darauf stand für Jacob an, den Fischerschuppen der Familie Ehrmann und den daran angebauten Räucherofen zu säubern. Vor allem Letzteres war eine schwere und schmutzige Arbeit. Jacob verlangte dabei die Hilfe seines Sohnes. Der hatte den Tag in der Werkstatt des Wagenbauers Leopolds in der Radeberger Vorstadt verbringen wollen. Georg träumte davon, bei diesem Wagenbauer in die Lehre zu gehen, statt Fischer zu werden. Ein ständiger Streitpunkt zwischen ihm und seinem Vater. Bereits vor dem Frühstück war die Stimmung im Hause Ehrmann auf einem Tiefpunkt, und Luise erhielt auf ihre gut gemeinten Bemerkungen entweder keine oder einsilbige Antworten. Sie atmete auf, als die beiden Männer aus dem Haus waren.
Sie räumte noch die Küche auf und hatte dann auch außerhalb zu tun. Obwohl die Kälte unter die Röcke kroch, in ihre Waden biss und dort richtig zupackte, wo der nackte Oberschenkel begann, und der Atem an ihren Wimpern gefror, war sie froh darüber, fortzukommen. Auf den Rücken geschnallt trug sie den Packen Wäsche, den sie in Dresden ausliefern wollte. Den Handwagen, den Georg ihr dafür gebaut und als Eintrittsbillett in seine Wagenbauerkarriere betrachtete, ließ sie zu Hause. Im Schnee war er nur hinderlich.
Luise ging oberhalb des Treidelpfades am Ufer der Elbe entlang, durchquerte Wachwitz und die Radeberger Vorstadt. Andere hatten vor ihr eine Spur getreten. Den Strom überspannte eine geschlossene Eisdecke, unter der er hoffentlich ruhig dahinfloss. Sie konnte keine Anzeichen der gefürchteten Eisversetzung entdecken: dass Eisschollen sich an Biegungen oder Hindernissen sammelten und sich immer höher auftürmten, das fließende Wasser immer mehr behinderten, bis es aufgestaut wurde.
Sie entdeckte auf dem Eis zwei Männer, die ein Loch hineinhackten, um zu kontrollieren, ob das Wasser wirklich so ruhig floss, wie es den Anschein hatte. Die Loschwitzer Fischer hackten ebensolche Löcher ins Eis, um den Fluss zu beobachten. Manche versuchten auch, in diesen Löchern zu angeln, aber die froren zu schnell wieder zu.
In Dresden besuchte Luise zunächst den Haushalt eines Majors auf der Neustädter Seite. Nahe des Schwarzen Tores bewohnte die Familie zwei Etagen eines großzügigen Hauses. Im Erdgeschoss befand sich die Tabakspfeifenniederlassung Hornig. Herrn Christoph Hornig gehörten auch das Haus und das Nachbargebäude, in dem er wohnte. Die Fassaden strahlten hell im Winterwetter, nur bei genauem Hinsehen waren feine Risse zu entdecken und abgeplatzte Putzstellen unter den Fenstern oder an den Türsimsen.
Luise ging in den Hof und zog die Glocke an der Hintertür. Es dauerte eine Weile, bis das Dienstmädchen der Majorsfamilie öffnete. Sie besaß ein längliches Gesicht wie ein Pferd und hatte die erste Jugendzeit hinter sich. Ihr unvorteilhaftes Aussehen wurde durch die weit auseinanderstehenden Schneidezähne noch verstärkt. Sie hieß Annifried und schaute mürrisch, als sie Luise vor der Tür erkannte.
Die deutete einen Knicks an und setzte gleichzeitig ihre Last ab. »Ich bringe die Wäsche.«
»Das wird auch Zeit. Wir haben bereits gestern mit dir gerechnet. Die gnädige Frau … Komm hoch.«
»Bei dieser Kälte dauert es länger, bis die Sachen trocknen.«
Annifried machte keine Anstalten, ihr mit der Wäsche zu helfen. Luise musste das Paket allein die Treppe hinaufschleppen. Im Vorraum zur Küche wuchtete sie es auf einen Tisch und wickelte die Verschnürung ab. Annifried zählte nach, was Luise ihr hinschob, und kontrollierte die Stücke auf ihrer Wäscheliste.
»Es fehlt ein Laken. Ich habe vier aufgeschrieben, und du hast nur drei zurückgebracht. Das dulden wir nicht. Die Kosten für das eine werde ich von deinem Lohn abziehen.«
Im Kopf rechnete Luise flink aus, dass sie dann die nächsten Wochen aus diesem Haushalt keinen Lohn bekommen würde. Das durfte nicht geschehen. Nicht gerade jetzt.
»Es waren nur drei Laken. Ganz bestimmt. Du weißt, dass ich noch nie etwas verloren habe. Du kannst mir kein Laken abziehen, das du mir nie gegeben hast.«
»Es fehlt eines. Wenn ich hier vier aufgeschrieben habe, habe ich dir auch so viele mitgegeben.«
»Es waren nur drei. Zähle alle Laken in diesem Haushalt, und dann wirst du feststellen, dass keines fehlt.«
»Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich zu tun habe.« Annifried schob den Kopf vor und ähnelte mehr denn je einem Pferd. »Die gnädige Frau muss hiervon erfahren. Du bewegst dich nicht von der Stelle.«
Annifried lief aus dem Raum. Ihre Pantinen klapperten einen empörten Rhythmus auf den Dielen. Luise zog das Haushaltsbuch zu sich heran und schaute auf die Einträge. Sie war froh, dass ihr Vater darauf bestanden hatte, sie solle auch Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Es bereitete ihr keine Mühe, die Einträge zu entziffern. Es stand dort tatsächlich die Übergabe von vier Laken. Ihr schoss Hitze ins Gesicht. Sie war sich ganz sicher, nur drei bekommen zu haben.
Die gnädige Frau Majorin rauschte, in eine Wolke Wohlgeruch gehüllt, herein. »Es fehlt ein Laken?«, flötete sie in einer Stimmlage, die eher an eine junge Frau als an eine Dame ihres Alters erinnerte. Luise hatte sie noch nie anders als mit dieser Kleinmädchenstimme sprechen hören.
»Sie hat ein Laken verschlampt, oder wahrscheinlich hat sie es heimlich verkauft und lügt uns nun dreist ins Gesicht«, trumpfte Annifried auf.
»Ich lüge nicht.«
»Dann erkläre, warum du nicht die Anzahl an Laken wieder mitbringst, die wir dir zum Waschen gegeben haben.« Die Majorsgattin sah aus und sprach, als stände ihre halbwüchsige Tochter mit einem zerrissenen Kleid vor ihr.
»Ich … weil …« Luise geriet ins Stottern. Den Blick hielt sie wieder auf das Haushaltsbuch gerichtet. Vier Laken – die Worte sprangen ihr ins Auge. Dann las sie noch etwas anderes. Die Woche. Es war die Woche des ersten Sonntags nach Epiphanias. Der letzte Sonntag war aber bereits der dritte nach Epiphanias gewesen. Annifried hatte die falsche Woche aufgeschlagen.
Ihr Zeigefinger stieß auf das Papier herab. »Das ist nicht die richtige Woche. Wir sind zwei Sonntage weiter.«
»Zeig her!« Die Majorin beugte sich von der anderen Seite heran, drehte das Haushaltsbuch um und vertiefte sich in die Einträge.
Sie kniff die Augen zusammen, blätterte eine Seite um. Als sie sich nach einer Weile aufrichtete, schoss sie einen strengen Blick auf ihr Hausmädchen ab.
»Du hast dich in der Woche geirrt. Für die letzte Woche sind drei Laken eingetragen. Deswegen hast du mich gestört? Für nichts und wieder nichts.«
Annifried wurde rot und knickste tief. »Verzeihung Madame. Das tut mir wirklich sehr leid.«
»Du musst dir mehr Mühe geben. Es ist immer dasselbe mit dir.«
»Gnädige Frau.«
Die Majorin drehte sich um. »Gib dem Mädchen den Lohn und belästige mich nicht weiter«, sagte sie über die Schulter.
Es war nicht der beste Zeitpunkt, das war Luise klar, aber wenn nicht jetzt … Sie leckte sich über die Lippen. »Gnädige Frau, darf ich etwas mit Euch besprechen? Es ist wichtig für mich. Bitte.«
»Was gibt es denn noch? Annifried gibt dir dein Geld.«
»Das weiß ich, gnädige Frau. Ich möchte Euch gerne etwas zeigen.« Luise fummelte an ihrem Bündel herum. Schließlich zog sie ein Stoffstück hervor, das mit Blumen, Ranken und graphischen Mustern bestickt war. Umgeben von Vergissmeinnicht prangten in der Mitte die Worte »Vater unser im Himmel«. Luise breitete das Tuch auf dem Tisch aus und glättete die Falten. »Dies wollte ich Euch zeigen, gnädige Frau.«
Die Majorin warf einen Blick darauf. »Recht hübsch. Hast du das gefertigt?«
»Mit meinen eigenen Händen. Ich habe auch die Muster selbst entworfen. Alle Stiche sind ebenmäßig und klein, wie es sein soll«, erklärte Luise. Es fiel ihr nicht leicht, ihre eigene Arbeit zu loben.
»Du hast geschickte Hände«, gab die Majorin zu. »Warum zeigst du mir das?«
»Weil Ihr eine vornehme Dame seid und diese Dinge zu würdigen wisst. Ich wollte Euch fragen, ob Ihr Bedarf an Stickereien habt, gnädige Frau?«
Aus dem Hintergrund kam ein Schnauben von Annifried. Luise überhörte es. Nicht nur Georg hatte Träume, sie auch.
»Ich will dir das nicht abkaufen«, kam es von der Majorin.
»Dies ist mein Mustertuch und steht nicht zum Verkauf. Wenn Ihr eine Kissenhülle oder Stickereien für ein Kleid benötigt, ich kann auch Borten und Bänder verzieren. Ich würde gerne für Euch arbeiten, gnädige Frau. Sticken!«
»Was denkst du, wer du bist? Wenn ich etwas gestickt haben will, gebe ich es einer Meisterin und lege den teuren Stoff nicht in unkundige Hände. Du machst die grobe Wäsche, das Sticken überlasse anderen.«
Tränen stiegen Luise in die Augen. Sie blinzelte. »Ihr habt die feinen Stiche gesehen, die ich zustande bringe. Gebt mir eine Gelegenheit, mich zu bewähren, ich bitte Euch.«
Die Majorin hatte den Vorraum verlassen. Annifried stand an die Wand gelehnt und gab sich keine Mühe mehr, ihr Lachen zu unterdrücken.
»Du willst eine Stickerin sein«, prustete sie.
Das machte Luise wütend. »Ich will mein Leben nicht auf den Knien verbringen, Asche aus dem Ofen kehren oder Teppiche ausklopfen und dankbar sein müssen für die abgelegten Kleider der Herrschaft. Ich habe eben Träume.«
»Träume sind Schäume. Du wirst nie für vornehme Haushalte sticken oder nähen. Flickwäsche, das ist für solche wie dich.«
»Ich werde eine Stickerin werden. Du wirst sehen. Es wird eine Zeit kommen, da werden sich die vornehmen Damen um meine Arbeit reißen. Das verspreche ich dir.«
»Beeile dich mit deinen Träumen, damit ich nicht vorher ins Grab sinke«, spottete Annifried und legte einige Münzen auf den Tisch. »Hier ist dein Geld, und nun verschwinde. Die schmutzige Wäsche liegt in der Kammer.«
Zuerst zählte Luise die Münzen in aller Ruhe nach. Es fehlte nichts.
Danach brachte sie Wäsche in den mutterlosen Haushalt eines Lehrers an der Kreuzschule. Dort saßen sieben Kinder aufgereiht wie die Orgelpfeifen am Tisch und waren in ihre Aufgaben vertieft. Gerade einmal das Jüngste wagte es, hochzuschauen, als sie eintrat. Der Lohn für ihre Arbeit lag abgezählt in einer Zinnschale, und der Berg an schmutziger Wäsche, den Luise mitnahm, überstieg den zurückgebrachten. Bei dieser Familie zeigte sie ihr Mustertuch nicht vor.
Mit der schmutzigen Wäsche schwer bepackt stapfte Luise über den Altmarkt. Unzählige Paar Stiefel hatten den Schnee zu braunem Matsch zertreten. Die vornehmen Gewölbe mit den besten Waren befanden sich in den Galerien der den Altmarkt umgebenden Häuser. Luise riskierte manchen Blick auf modische Hüte, Handschuhe aus hauchdünnem Leder, seidene Strümpfe und bestickte Bänder. Besonders den Letzteren galt ihre Aufmerksamkeit. Die Stiche waren nicht so fein und gleichmäßig, wie sie selbst sie fertigbrachte.
Sie drückte sich so lange die Nase an dem kleinen Fenster des Gewölbes platt, dass der Inhaber herauskam und sie davonjagte, weil eine Frau wie sie die vornehme Kundschaft vergraulte.
Kapitel II
Aus einer Garküche duftete es verführerisch nach heißen Pasteten, und Luise befingerte das Geld in ihrer Börse. Sie hatte an diesem Tag nur eine dünn mit Schmalz bestrichene Scheibe Brot gegessen, und der Weg nach Hause war noch weit. Sie dachte aber auch daran, dass die Familie nur noch ihren Verdienst hatte. Sie versagte sich den Genuss einer Pastete und machte sich auf den Heimweg.
Dabei durchquerte sie die Schlossgasse und sah am Ende des Schlossplatzes die Brücke über die Elbe bereits vor sich. Auf der rechten Seite des Platzes befanden sich das Brühlsche Palais und gegenüber die Hofkirche. Luise kam sich klein vor neben diesen herrschaftlichen Bauten und zusätzlich mit dem herzoglichen Schloss im Nacken. Ohne nach rechts und links zu schauen, hastete sie auf die Brücke zu.
»Luise? Du bist doch Luise Ehrmann«, hörte sie hinter sich jemand ihren Namen rufen. Die Stimme kam ihr bekannt vor, aber sie verband keinen Namen damit.
Sie schaute über die Schulter. Ein Kindermädchen hielt ihre beiden Pfleglinge fest an der Hand. Sie hatte nur Augen für diese. Eine Reihe von Herren spazierte, angetan mit Dreispitz oder Pelzmützen, allein oder zu zweit über den Platz. Betuchte Damen achteten darauf, ihre Röcke nicht im Schneematsch zu beschmutzen, und Frauen einfachen Standes gingen ihren Geschäften nach. Niemand achtete auf sie. Trotzdem war sie sich sicher, ihren Namen gehört zu haben.
»Luise, hier!« Ein hellbrauner Handschuh winkte. Die Trägerin verschwand beinahe unter einem großen Hut und hatte sich gegen die Kälte in einen pelzverbrämten Mantel gehüllt.
»Erkennst du mich nicht?« Die Frau stand jetzt vor Luise und lachte.
Sie konnte der anderen endlich ins Gesicht blicken und erkannte sie: Rosina Weller. Sie waren beide gleich alt, hatten sich in der Schule ein Pult geteilt, waren zusammen konfirmiert worden, hatten sich danach noch einige Male gesehen und sich dann aus den Augen verloren. Rosina war schon immer von zarter Statur gewesen. Unter dem großen Hut und mit dem Pelz am Mantel sah sie noch zerbrechlicher aus. Die Haut ihres Gesichts wirkte rein und klar wie Marmor und wurde durch die zart geröteten Wangen unterstrichen. Die dunklen Augenbrauen hoben sich gefällig davon ab.
Rosina ließ ihr keine Zeit für weitere Betrachtungen, sondern umarmte sie stürmisch wie eine lang vermisste Freundin. Sie stieß dabei an den Packen, den Luise auf dem Rücken trug. »Womit schleppst du dich ab?«
»Das ist Wäsche, die ich waschen muss und flicken.«
»Macht ihr das immer noch?«
»Es ist ein Zubrot zum Fischen und hilft uns«, antwortete Luise. Sie löste sich aus den Armen der anderen und ließ ihre Last zu Boden gleiten, achtete sorgfältig darauf, sie so hinzustellen, dass sie niemand unbemerkt wegnehmen konnte. »Wieso bist du so schick?«, wollte sie wissen und überlegte gleichzeitig, was im Dorf über Rosina geredet wurde. Sie konnte sich an nichts erinnern.
»Ich habe es gut getroffen.« Rosina drehte sich geziert um die eigene Achse.
»Hast du einen vermögenden Mann geheiratet?«
»Geheiratet! Ich doch nicht!« Die Freundin lachte perlend. »Es ist kalt, lass uns irgendwo hingehen. In ein Kaffeehaus zum Beispiel.«
Davon hatte Luise gehört, aber noch nie eines besucht. Sie bezweifelte auch, dass jemand wie sie dort Einlass fand. Rosina schienen die gleichen Gedanken durch den Kopf zu gehen, denn sie schaute zweifelnd auf den voluminösen Packen.
»Keine so gute Idee mit diesem Ding, aber ich friere hier langsam fest.« Rosina trat von einem Fuß auf den anderen.
»Dahinten habe ich eine Garstube gesehen. Da können wir uns aufwärmen«, sagte Luise schnell. Sie schulterte die Wäsche wieder, und gemeinsam gingen sie zurück zum Altmarkt.
Aus der Garstube roch es immer noch köstlich nach Pasteten. Und Luise hatte sich nicht getäuscht, es gab zwei Tische in einem düsteren Raum ein paar Treppenstufen unterhalb des Straßenniveaus. Rosina zog eine Schnute und achtete sehr darauf, nirgendwo anzustoßen. Bei den Ausmaßen ihres Hutes verlangte das Geschick. Sie legte ein Taschentuch auf die Bank ohne Lehne, ehe sie sich setzte.
Die Betreiberin der Garküche kam sofort heran, um etwas anzubieten.
»Ganz bestimmt nicht«, erwiderte Rosina.
»Die Herrschaften können hier nicht sitzen, ohne etwas zu essen oder zu trinken.«
»Ich werde hier nichts zu mir nehmen und mir am Ende was wegholen.«
»Ich muss darauf bestehen, wenn die Damen bei mir im Warmen sitzen wollen. Ich kann den Damen warmes Würzbier bringen.«
Rosina verzog erneut das Gesicht, seufzte dann laut und kramte in einer Geldbörse. Sie warf einige Münzen auf den Tisch. »Reicht das, damit wir hier eine Weile sitzen und uns unterhalten können? Bringen Sie etwas Licht dafür.«
Die Frau strich die Münzen wortlos ein und zog sich zurück.
»Ich will alles wissen. Wie bist du so vornehm geworden, Rosina?« Luise beugte sich vor.
»Ottilia«, sagte diese.
»Was?«
»Ich nenne mich Ottilia. Das ist ein Name wie Milch und Honig und klingt vornehm.«
»Wieso brauchst du einen vornehmen Namen?«
»Kannst du dir nicht vorstellen, dass es Situationen gibt, in denen man alles hinter sich lassen will und dabei auch den Namen abstreift? Ich nenne mich jedenfalls jetzt Ottilia.«
»Wie du willst. Bist du Witwe?«
»Da ich nie verheiratet war, kann ich auch keine Witwe sein. Ich habe einen Gönner. Er bezahlt mir eine Wohnung, schenkt mir Schmuck und schöne Kleider. Sieh mich an und dann dich. Kannst du dir vorstellen, dass ich auch einmal die Wäsche fremder Leute gemacht habe?«
Luise schüttelte den Kopf.
»Siehst du, ich auch nicht mehr. Das war in einem anderen Leben. Jetzt bette ich mich auf weiche Daunen und stehe erst zum Mittag auf.«
»Und dein Gönner?«
»Er besucht mich. Wir reden, und na ja … es ist ganz zauberhaft mit ihm. Er ist ein feinsinniger Geist. Wir besuchen Konzerte und Kartenabende. Ich habe ihn schon in die Oper begleitet.«
»Heiraten will er dich nicht?«
»Was du immer mit dem Heiraten hat. Das ist kein Thema zwischen uns.«
»Es bezahlt dir doch keiner eine Wohnung für ein bisschen reden und ins Konzert gehen. Daran ist was faul.«
»Sehe ich aus, als wäre etwas faul?« Wieder ließ Rosina – Ottilia – ihr perlendes Lachen hören. »Ich sage dir, es ist ein prima Leben. Du könntest es auch haben. Du müsstest nur ein wenig nett zu einem Herrn sein. Und dann – Wäsche adé. Schau dir deine Hände an.« Sie griff über den Tisch hinweg nach Luises Rechter. »Und meine dagegen.«
Der Unterschied war augenscheinlich: brüchige Nägel und rote Haut die eine, makellos mit gefeilten und polierten Nägeln die andere.
»Ich habe auch Träume.«
»Von einem Ehemann, der Fischer ist und den dein Vater dir ausgesucht hat.« Ottilias Augen blitzten spöttisch.
»Ich will das Leben in Loschwitz genauso hinter mir lassen wie du. Auf meine Weise.«
»Welche soll das sein?«
Luise wühlte in der Wäsche nach ihrem Mustertuch und legte es auf den Tisch. »Diese.«
Wortlos schaute Rosina auf die Stickerei. Sie berührte sie mit den Fingerspitzen. »Das hast alles du gemacht? Das ist schön.«
»Ich habe auch die Muster selbst entworfen. Nun suche ich jemanden, der mich als Stickerin beschäftigen will. Du hast doch Zugang zur vornehmen Welt, kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen?«
»Ich weiß nicht …«
»Es gefällt dir doch?«
»Das schon, aber die vornehme Welt ist komplizierter, als du es dir vorstellst. Es gibt viele, die mit mir nichts zu tun haben wollen, weil ich nicht vornehm geboren bin. Vor allem Frauen denken so. Ich kann dir nicht helfen.«
Luises Hoffnung, die eben hochgeschlagen war wie eine Flamme im Stroh, sackte auch genauso schnell wieder zusammen. »Nur ein paar Worte hier und da. Mehr verlange ich nicht. Ich gehe dann selbst hin und zeige meine Muster vor.«
Ottilia faltete das Tuch wieder zusammen und schob es über den Tisch. »Ich will es versuchen, aber versprich dir nicht zu viel davon. Einfacher ist es auf jeden Fall, dir einen Gönner zu suchen. Komm zu mir, wenn du … Na ja, ich muss jetzt gehen.« Sie sprang auf und huschte zur Tür hinaus.
»Gib dich mit der nicht ab«, sagte die Garküchenbetreiberin und setzte einen Holzteller vor Luise ab. »Das ist die Letzte für heute.«
Die Pastete duftete köstlich.
Kapitel III
Wo die Elbe eine Biegung machte, türmte sich das Eis hoch auf. Der Fluss hatte die Schollen an dieser Stelle zusammengeschoben, und er brachte jeden Tag neues Eis. Oberflächlich gesehen bedeckte eine geschlossene Eisdecke die Elbe, und darunter floss das Wasser. Tatsächlich brach das Eis an jedem Tag irgendwo auf, es schob die Schollen voran, bis sie an einer Biegung hängen blieben. Unentwegt knackte und krachte der gefrorene Fluss, und es hörte sich an, als wollte er die Welt verschlingen.
Jacob Ehrmann stand am Ufer, hatte die Stirn gerunzelt und blickte auf das aufgetürmte Eis. Neben ihm trat der Loschwitzer Dorfälteste Valentin Kyritz von einem Fuß auf den anderen. Zwei andere Fischer warteten neben ihm, einer war Gabriel Neuber und der zweite der zahnlose Moritz Hammel, der älteste Fischer in Loschwitz, der sich wegen seines Rheumas schwer auf einen Stock stützte.
»Das sieht nicht gut aus«, nuschelte Moritz Hammel und stieß seinen Stock fester in den Schnee.
»Wir müssen etwas tun, sonst endet alles in einer Katastrophe«, stimmte Jacob ihm zu.
»Was soll das sein?«, wollte der Dorfälteste wissen. »Wir sind keine zweihundert Männer in Loschwitz, was sollen wir gegen einen Fluss ausrichten?«
»Deshalb müssen wir uns an die Obrigkeit wenden. Die feinen Herren müssen verstehen, was uns bevorsteht, wenn sie tatenlos bleiben. Wir leben mit dem Fluss und von ihm, wir kennen ihn genau.« Jacob schaute die anderen herausfordernd an.
»Willst du ihnen sagen, dass du in deinen steifen Gelenken etwas spürst? Die werden nicht auf dich hören.« Gabriel Neuber spuckte aus.
»Wir dürfen nicht tatenlos zusehen.«
»Es ist nicht unsere Verantwortung. Du kannst machen, was du willst, aber ohne mich. Ich lasse mich in nichts reinziehen.« Diesmal drehte Neuber sich um und stapfte davon.
»Der Junge hat recht, der versteht sein Handwerk. Ich weiß nicht, warum du uns hergeschleppt hast. Eis hat die Elbe in jedem Winter, ich erlebe es seit mehr als sechzig Jahren.« Moritz Hammel ging langsam davon, gestikulierte mit dem Stock und schrie Neuber hinterher, dass der auf ihn warten solle.
»Ich sollte auch gehen. Auf mich wartet Arbeit. Jacob, wirklich … das Leben ist so, du kannst nichts machen.« Valentin Kyritz wandte sich ab.
Jacob hielt ihn am Ärmel fest. »Du stiehlst dich nicht fort, du bist der Dorfälteste.«
»Genau deswegen lasse ich mich nicht von dir vereinnahmen. Ich stehe für das ganze Dorf. Wir können gegen das Wetter nichts ausrichten.«
»Wir können aber dafür sorgen, dass das Wasser frei fließen kann. Wenn das Eis bei steigenden Temperaturen aufbricht, muss es abfließen können. Diese Eisverwerfungen müssen weg. Überall entlang der Elbe müssen die weg. Du berichtest nach Dresden oder gehst am besten selbst hin und erklärst es genau.«
»Du spinnst.«
»Du bist der Dorfälteste, auf dich werden sie hören.«
»Ich mache mich nicht vor den Amtmännern lächerlich.«
»Diese Eisschollen müssen jedenfalls weg.«
»Die sind aneinander festgefroren, die bekommst du nicht einmal mit Hammer und Meißel auseinander. Es muss nur wärmer werden, dann schmilzt alles von ganz alleine weg. Das ist genau das, was sie mir in Dresden sagen werden. Schönen Tag noch.« Valentin schüttelte den Kopf, zog sich die Mütze tief über die Ohren und folgte den beiden Fischern.
Wie konnten sie nicht sehen, was so offensichtlich war? Jacob trat gegen das Eis.
Diese ungläubigen Thomasse. Die Menschen entlang der Elbe schwebten alle in Gefahr. Das Eis türmte sich immer höher auf. Wenn es aufbrach … das Wasser anstieg … Wie es vor den Brücken aussah, in Dresden und in Meißen, wollte er sich nicht vorstellen.
Jacob packte zu und zerrte an einer Eisscholle, die vor ihm aus der Elbe ragte. Er setzte das Gewicht seines Körpers ein, kümmerte sich nicht darum, dass die Kälte in seine Hände biss. Im Eis entstanden Risse. Die Scholle löste sich. Er kippte nach hinten, landete auf dem Hintern. Sofort rappelte er sich wieder auf. Der Eisbrocken lag am Ufer. Ein erster Erfolg. Ein kleiner. Jacob zog ihn weiter vom Fluss weg und suchte sich den nächsten.
Ein Eisstück nach dem anderen löste er aus der Barriere am Ufer, zerrte es an Land und ließ es liegen. Seine Hände waren längst blutig, wo er sich die Haut fetzenweise abgerissen oder sich an scharfen Kanten geschnitten hatte. Er hinterließ rote Abdrücke auf dem Eis. Seine Kraft ließ nach, und wenn er sich umschaute, hatte er erst so wenige Eisschollen entfernt. Dennoch glaubte er, zu hören, dass der Fluss leichter um diese Biegung floss.
Er tat das Richtige. Überall müsste es so gemacht werden. Alle Anwohner an der Elbe … Jacob hockte sich einen Augenblick hin, um sich auszuruhen.
»Vater! Was machen Sie da?«, rief jemand. Im ersten Augenblick klang die Stimme wie die seiner Frau Barbara, die vor fünfzehn Jahren spurlos verschwunden war, als hätte es sie nie gegeben. Hatte sie damals beschlossen, ihn zu verlassen, oder war ihr ein Unglück zugestoßen? Er wusste es nicht, und diese Ungewissheit war auch nach der langen Zeit schlimmer auszuhalten, als wenn er sie hätte zu Grabe tragen müssen.
»Vater!«
»Barbara«, sagte er. Er blinzelte, und das Bild klärte sich.
Es war seine Tochter Luise. Sie lief auf ihn zu.
»Vater! Was machen Sie?«, wiederholte sie und blieb vor ihm stehen. Ihre Wangen waren vom Laufen und der Kälte gerötet, die Haare standen wirr unter ihrer Kappe hervor.
»Das Eis muss weg. Es behindert den Fluss. Wir brauchen Pferde und Seile. Am besten kommt die Armee und sprengt es weg.«
»Sie sind keine Armee, Papa, und Sie können das Eis nicht mit den Händen wegräumen. Schauen Sie sich an.« Luise berührte sanft seine linke Hand. Blut war schon in den Schnee getropft und dort zu Rosa verwässert. »Das muss verbunden werden. Kommen Sie nach Hause.«
»Wieso bist du hier?«, fragte Jacob.
»Sie waren nicht da, als ich vom Markt kam, aber Gabriel Neuber berichtete von einer Auseinandersetzung.«
»Der ist ein selbstsüchtiger Mensch. Auf den musst du nicht hören.«
»Auch nicht, wenn er mir sagt, wo Sie ganz alleine am Fluss sind?« Luise lächelte und erinnerte ihn mehr denn je an ihre Mutter. Jacob ballte die verletzten Hände. Der Schmerz vertrieb Barbaras Bild.
Luise hatte ein Tuch entfaltet und wickelte seine Rechte darin ein. »Geben Sie mir Ihr Taschentuch.«
Sie zog es aus seiner Tasche und umwickelte seine andere Hand.
Zu Hause badete Luise seine Hände in warmem Wasser, behandelte sie mit einer streng riechenden Salbe aus Schweineschmalz und verschiedenen Kräutern. Schon beim Auftragen spürte er, wie gut sie ihm tat. Nachdem die Hände dick verbunden waren, kamen sie ihm vor wie Klumpen. Er setzte sich in der Stube aufs Sofa und war mit seinen Gedanken allein. Luise hatte den Ofen angeheizt, die Verschwenderin, weshalb er es jetzt angenehm warm hatte.
Kapitel IV
In Wehlen stand der Geograph Conrad Meinel am Ufer der zugefrorenen Elbe und musterte den Fluss. Das wechselhafte Wetter der vergangenen Wochen mit sehr kalten Tagen von Temperaturen unter minus zehn Grad Réaumur wechselte sich ab mit kurzen Tauwetterperioden, in denen das Thermometer auf mehr als fünf Grad Réaumur kletterte. Dieser Februarmorgen gehörte zu einer kalten Periode, die Sonne brachte die von Schnee und Eis bedeckte Landschaft zum Glitzern. Conrad hatte dafür keinen Blick übrig.
Seine Aufmerksamkeit galt den zu bizarren Formationen zusammengeschobenen Eisschollen, die sich zu Miniaturgebirgen an Ufern und Untiefen aufgetürmt hatten. Bei Tauwetter war die Eisdecke aufgebrochen und bei Frostgraden wieder zusammengefroren. Stellenweise war das Eis mehrere Ellen dick. Das Elbtal war zwischen Rathen und Pirna besonders eng, zu beiden Seiten erhob sich das Elbsandsteingebirge. Conrad dachte mit Schrecken daran, was passieren mochte, wenn dauerhaftes Tauwetter einsetzte, das Eis aufbrach und sich flussabwärts wälzte und dann noch das Schmelzwasser aus den Nebenflüssen, von den Hängen und aus Böhmen hinzukam. Die Flut wäre verheerend, im kalten Wasser hätte niemand eine Überlebenschance. Ihn schauderte.
Die Dicke des Eises hatte er bereits vor Tagen mithilfe mehrerer Eisenstäbe gemessen, mit denen er sonst Markierungen im Gelände anbrachte, wenn es Straßen und Pfade zu vermessen galt. Das Eis war in Ufernähe überall wenigstens eine Elle dick, an vielen Stellen mehr als zwei Ellen. In die Flussmitte zum Nachmessen traute er sich nicht, obwohl die Eisdecke überall geschlossen aussah.
Conrad ging am Ufer auf und ab. Er suchte am wolkenlosen Himmel nach Anzeichen einer Wetterveränderung, schnupperte in der Luft nach dem Geruch von Frühling.
»So früh schon außerhalb der warmen Stube, der junge Herr Meinel.«
Bei diesen Worten fuhr Conrad herum und stand dem Wehlener Holzhändler Joachim Liebethal, einem entfernten Verwandten von ihm, gegenüber. Der tippte sich grüßend an seine Pelzmütze und grinste spöttisch.
Hatte dieser Mensch ihn etwa dabei beobachtet, wie er nach oben gestarrt und an der Luft gerochen hatte? Joachim Liebethal galt in Wehlen als ein Mann, der die Schwächen anderer skrupellos zu seinem Vorteil nutzte. Ihm hätte Conrad sich nicht gerne in lächerlicher Pose präsentiert. Er grüßte den Holzhändler unverbindlich und überlegte, wie er einem Gespräch entgehen konnte.
Der andere stapfte breitbeinig zum Ufer und schaute aufs Eis. Gegen die Sonne kniff er die Augen zusammen und beschirmte sie sogar mit einer Hand. »Schaut nicht gut aus mit dem Eis. Wenn’s nicht bald wegtaut, kostet das Existenzen.«
»Weil Hochwasser kommt?«, forschte Conrad vorsichtig nach.
»Bah, Hochwasser haben wir jedes Jahr. Oder was die Leute dafür halten. Wenn’s zwei Ellen höher geht, schreien sie gleich. Ich mein die Fischer und die Schiffer. Verdienen ja nichts, wenn der Fluss gefroren ist.«
»Für den Transport Ihres Holzes macht sich der gefrorene Fluss auch nicht gut.«
»Ich komm zurecht. Holz brauchen die Leute immer zum Bauen, zum Heizen. Die Öfen in Meißen ständen lange still ohne mich. Muss es eben in Karren dorthin transportiert werden. Dauert länger, macht es teurer.« Liebethal sprach von der Porzellanmanufaktur in Meißen, deren Öfen mit Holz befeuert wurden, das zu einem guten Teil aus seinem Handel stammte. »Für den Herrn Kartenzeichner ist der Winter auch nicht die beste Zeit.«
»Ich bin Geograph«, berichtigte Conrad. »Mit der Kartographie beschäftige ich mich nur gelegentlich. Das Hauptfeld meiner Arbeit besteht in der Vermessung des Landes, der Aufteilung des Raumes und der Untersuchung der Erde.«
Für Liebethal zählte nur, was er in sein Säckel stecken konnte, ihm war anzusehen, dass er mit Landvermessung nicht viel und mit Raumaufteilung noch weniger anfangen konnte.
»Hört sich alles nicht nach einer Beschäftigung für den Winter an.«
»Ein Großteil meiner Tätigkeit findet am Schreibtisch statt. Ich schreibe Abhandlungen über Naturphänomene. Aktuell bin ich mit der Zusammenstellung von Material für ein Lehrbuch für die Bergakademie in Freiberg befasst.« Conrad hatte selbst dort studiert und war stolz darauf, mit dem Lehrbuch quasi in die Riege der Dozenten aufzusteigen. Er hauchte in seine Hände, die in fingerlosen Handschuhen steckten und in der Kälte rot gefroren waren.
»Ist kalt, was?« Liebethal sah jedoch aus, als fühlte er sich wohl, weil die Kälte seiner vierschrötigen Figur nichts anhaben konnte. Er hatte die Hände in den Taschen seines Lammfellmantels vergraben. »Sie werden noch ein mächtig vornehmer Herr werden, vor dem wir einfachen Menschen uns verneigen müssen.«
»Ich strebe danach, ein gelehrter Herr zu werden. Die Wissenschaften der Geographie sind auch für die mit dem Handel befassten Herren nicht ohne Bedeutung.«
»Wenn’s gilt, Bodenschätze auszubeuten. Da stimme ich Ihm zu. Stößt Er auf Erze, soll Er sich nur bei mir melden, ich bin für ein neues Geschäft immer zu haben.«
»Ich merke es mir«, antwortete Conrad frostig. Joachim Liebethal blieb sich in jeder Lage treu und hatte nicht verstanden, worin seine Tätigkeit bestand. Conrad verabschiedete sich und stapfte zurück in die Stadt.
In einem zweigeschossigen Haus gegenüber der Kirche wohnte Conrad mit seiner Mutter zusammen. Sie teilten sich die Wohnung im Obergeschoss des Wehlener Lehrerhauses. Im Erdgeschoss wohnte der jetzige Lehrer mit seiner Familie in zwei Stuben und zwei Kammern, während die andere Hälfte des Hauses das Klassenzimmer einnahm. Conrads Vater war bis zu seinem Tod der Wehlener Lehrer und Kantor gewesen. Seitdem nahm seine Mutter die große Lehrerwohnung als Wittum für sich in Anspruch, obwohl es das für einen Lehrer im Kurfürstentum Sachsen nicht gab. Von einer Lehrerswitwe wurde erwartet, dass sie Unterschlupf im Hause ihrer Kinder fand. Der junge Kollege im Erdgeschoss war vom Hilfslehrer zum Lehrer aufgestiegen und wartete nun darauf, dass die große Wohnung im Obergeschoss für ihn, seine schwangere Frau und die beiden drei und vier Jahre alten Töchter frei wurde.
Conrad wusste, dass auf seiner Mutter der Druck lastete, die Wohnung zu räumen, aber solange er keine Aussicht auf eine feste Stellung hatte, konnte er sich eine eigene Unterkunft mit einer Stube für seine Mutter nicht leisten. Deshalb setzte er große Hoffnungen darein, sich mit dem Lehrbuch der Bergakademie als Dozent zu empfehlen. Dann könnte er nicht nur seiner Mutter einen angenehmen Lebensabend bieten, sondern auch an Heirat und die Gründung einer eigenen Familie denken.
Auf Zehenspitzen ging er am Klassenzimmer vorbei. Hinter der Tür hörte er die Kinder ein Gedicht aufsagen. Er ignorierte den ewigen Geruch nach Kohl und Haferschleim aus der unteren Wohnung und mied die knarrenden Stufen auf der Treppe. Hinter der eigenen Tür wartete seine Mutter, als hätte sie dort auf seine Ankunft gelauert. Sie war einen guten Kopf kleiner als er und stand vorgebeugt. Bevor er den Schal abgelegt hatte, umfasste sie mit rheumaverdickten Fingern sein Gesicht.
»Du bist ganz kalt, mein Lieber«, sagte sie vorwurfsvoll, als zählte er gerade einmal ein Drittel so viele Jahre wie die dreißig, die er alt war. »Warum gehst du bei dieser Kälte raus, statt in der warmen Stube zu bleiben?«
»Es ist nichts, Mama. Lassen Sie mich.« Er streifte ihre Hände ab, hielt sie einen Augenblick liebevoll in seinen.
In der Wohnung war es tatsächlich sehr warm, ihm brach der Schweiß aus unter seinen vielen Schichten Kleidung. »Warten Sie bis ich Hut und Mantel abgelegt habe.«
Sie hielt ihm einen Morgenmantel hin, verlangte danach von ihm, dass er mit ihr ein zweites Frühstück einnahm. Sie hatte in der Stube, in der Nähe des glühend heißen Ofens, bereits alles vorbereitet.
»Du solltest zu Hause bleiben, wenn es so kalt ist. Die Temperatur ist weit unter dem Gefrierpunkt. Du wirst noch krank werden«, sagte sie und legte ihm eine Scheibe geröstetes Brot auf den Teller.
In seiner Tasse dampfte Tee, obwohl ihm der Sinn eher nach einem Glas kalter Milch stand. »Ich bin schon groß. Sie müssen sich nicht mehr um mich sorgen.«
»Ich werde erst damit aufhören, wenn ich ins Grab gesunken bin. Was bei der Kälte draußen nicht mehr lange dauern wird.«
Er nahm das nicht ernst. Seit Jahren klagte sie, jeder Winter sei ihr letzter. »Um die Elbe steht es schlecht. Wenn das Eis aufbricht …«
»Dein Onkel Joachim sieht das nicht als schlimm an. Die Elbe führt jedes Jahr Eis, und jedes Jahr fürchten sich einige Leute vor einer schlimmen Eisversetzung, die nie eintrifft«, unterbrach ihn seine Mutter. Sie legte eine gewollte Munterkeit in ihre Stimme.
Joachim Liebethal war mitnichten sein Onkel. Die Verwandtschaft war sehr viel weitläufiger. Conrad war nicht in der Lage, diese genau zu erklären, er zweifelte auch daran, dass es seine Mutter konnte. Dennoch betonte sie gerne die Verbindung zum erfolgreichsten Wehlener Holzhändler.
»Herr Liebethal tut vieles als belanglos ab und redet über Probleme einfach hinweg.« Conrad biss in sein gebuttertes Röstbrot und klang streng wie ein Lehrer gegenüber einem faulen Schüler.
»Er versteht den Lauf der Welt. Du musst dich gut mit ihm stellen, dann kann er bestimmt etwas für dich tun.« Es war nicht zu überhören, dass seine Mutter mit den Plänen ihres Sohnes für dessen Zukunft nicht einverstanden war. Sie hätte es lieber gesehen, wenn er in die Fußstapfen des Vaters getreten und ebenfalls Lehrer an der Wehlener Schule und Kantor in der Kirchgemeinde geworden wäre. Das hätte zumindest ihr Problem mit der Wohnung gelöst. Dass er vollkommen unmusikalisch war und seine Neigungen auf anderen Gebieten lagen, vergaß sie dabei.
Conrad traf eine Entscheidung. »Ich werde nach Dresden reisen, Mutter.«
»Vor Ostern? Wegen einer Stellung?« Sie schaute ihn verwirrt an.
»Morgen.«
»Nicht bei diesem Wetter.«
»Wenn die Fuhrwerker unterwegs sein können, kann ich es auch.«
»Du wirst dir den Tod holen.«
Conrads Entschluss stand fest, und alle von seiner Mutter vorgebrachten Einwände prallten an ihm ab.
Kapitel V
Vor der Dresdner Augustusbrücke staute sich das Eis und hatte sich an den Brückenpfeilern zu einem beinahe mannshohen Gebirge aufgetürmt. Es rieb und kratzte an den hölzernen Pfeilern. Das ergab ein Geräusch, wie sich Luise das Scharren von Dämonenkrallen an den Pforten der Hölle vorstellte. Es fuhr ihr durch Mark und Bein, und sie fragte sich, ob die Brücke den Eismassen noch lange standhalten konnte. Neben ihr stand das Paket mit schmutziger Wäsche, das sie gegen saubere eingetauscht hatte.
Sie hatte sich extra beeilt, die saubere Wäsche abzugeben, um sich auf der Brücke mit ihrem Vater zu treffen. Jetzt suchte sie ihn vergeblich unter den vielen Menschen, die alle das Schauspiel des Eises betrachteten. Arm und Reich stand einträchtig nebeneinander, und in vielen Gesichtern entdeckte sie einen Ausdruck wohligen Schauers. Luise schulterte ihr Bündel und strebte der Neustädter Seite zu. Sie drängte sich durch die Menge und wurde mehrfach angerempelt und böse angeschaut.
Der Vater hatte sie an diesem Tag nach Dresden begleitet, weil er bei den Behörden vorstellig werden wollte. Seine Sorgen wegen des befürchteten Eisaufschlusses waren größer, nicht kleiner geworden. Die Behörden mussten tätig werden. Mit seinen verbundenen Händen hatte Jacob sogar einen Bericht geschrieben, in dem er alles genau aufzählte. Weder von Luise noch von Georg hatte er sich dabei helfen lassen.
Sie stellte sich auf Zehenspitzen und spähte umher. Mit einer Hand hielt sie sich dabei am Brückengeländer fest. Den rechten Fuß hatte sie in einer der Trageschlaufen des Wäschepakets verankert.
Jemand packte sie an der Schulter. Auf den mit Eis überzogenen Bohlen der Brücke wäre Luise beinahe gestürzt. Sie musste sich an der Person abstützen, die sie aus dem Gleichgewicht gebracht hatte. Die stellte sich als junger Mann heraus, etwa in Georgs Alter. Im Gegensatz zu dessen vom Wetter geprägten Gesicht blickte sie eine bartlose, weiche Miene an.
»Sehen Sie doch!«, keuchte der unbekannte junge Mann.
Luise suchte einen festen Stand und befreite sich aus seinem Griff. Erst dann folgte ihr Blick seinem ausgestreckten Arm. Auf dem Eis vor der Brücke kletterten magere, zerlumpte Kinder herum. Immer höher wagten sie sich hinauf und sprangen dann wieder hinunter. Irgendjemand klatschte Beifall, andere fielen ein. Auch der junge Mann neben Luise.
»Mutige Burschen!«, rief er ihnen zu und pfiff auf zwei Fingern.
Das Geräusch gellte Luise in den Ohren. Jemand warf eine Handvoll Münzen auf das Eis. Das löste unter den Gassenjungen eine wilde Balgerei aus. Weitere Würfe folgten. Das Gerangel auf dem Eis nahm zu.
»Da, da hinten ist noch etwas«, rief eine helle Knabenstimme, die mühelos die Geräuschkulisse auf der Brücke übertönte.
»Mein gnädiger Herr!«, rief dem Jungen eine Frauenstimme zu. »Es gehört sich nicht, vor den einfachen Menschen so laut zu sprechen.«
Luise hielt nach der Frau und dem Kind Ausschau. Auch andere wurden nun aufmerksam. »Der kleine Prinz Karl August Friedrich aus dem Haus Wittelsbach«, wurde geflüstert. Jedermann in Dresden wusste, dass der achtjährige Junge zur Erziehung in der Stadt weilte. Seine Mutter war eine Schwester des sächsischen Kurfürsten und mit dem Herzog von Pfalz-Zweibrücken verheiratet.
Einige verneigten sich. Luise tat es ihnen nach und versuchte, einen Blick auf das fürstliche Kind zu erhaschen. Sie erblickte einen Knaben, der sich von anderen durch weiches, lockiges Haar unterschied, das ihm unter einer Pelzmütze hervorquoll. Sein Wintermantel bestand aus dunkelblauem Loden und hielt den kleinen Körper sicherlich gut warm. Die Füße steckten in fellbesetzten Stiefeln. Neben ihm standen seine Erzieherin und zwei uniformierte Herren als Gefolge.
»Das ist lustig. Ich will auch werfen«, verlangte der Prinz. »Ich will Münzen.« Er streckte fordernd die Hand aus.
Einer der Uniformierten ließ Geld hineinfallen.
Etliche der Münzen fielen schon vor der Brüstung zu Boden, aber einige schafften es aufs Eis. Auf der Brücke bückte sich der Uniformierte nach dem Geld und sammelte es ein, auf dem Eis sprangen die Gassenjungen danach. Der Prinz warf die Münzen, die die Uniformierten aufgesammelt hatten, erneut. Luise schob ihr Bündel vor sich her und strebte weiter der Neustädter Seite zu. An der Auffahrt der Brücke entdeckte sie ihren Vater.
Jacob schaute angestrengt drein. Er winkte mit seinen verbundenen Händen, dass die Buben vom Eis kommen sollten. Wenn sie ihn überhaupt bemerkten, kümmerten sie sich nicht um ihn. Sie jagten weiter den Münzen hinterher, die in immer größerer Zahl von der Brücke regneten.
Einer der Jungen geriet mit einem Bein in eine Spalte zwischen den Eisschollen. Er wollte sich festhalten, rutschte aber ab und verschwand. Jacob rannte los. Im Laufen warf er seinen Umhang beiseite und kletterte über eine Scholle. Ein junger Mann folgte ihm. Etliche Leute waren auf das Drama aufmerksam geworden. Sie zeigten von oben dorthin, wo der Junge verschwunden war. Jacob und der andere rannten, kletterten und rutschten über das Eis und hatten endlich die Stelle erreicht. Luise war zu keinem klaren Gedanken fähig, konnte aber auch die Augen nicht abwenden von dem, was sich auf dem Fluss abspielte.
Der Junge hielt sich noch mit den Fingern an der Eiskante fest, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis er den Halt verlor. Das Eis bewegte sich. Er rutschte mit einer Hand ab. Es würde ihn zermalmen. Jacob erreichte die Scholle. Er wollte nach oben klettern, aber der junge Mann war schneller und sprang hoch. Er bekam die Kinderhand zu fassen, fand selbst irgendwie Halt und zog den Buben mit Schwung heraus. Wie ein leerer Sack schlenkerte der durch die Luft. Jacob streckte die Arme und fing das Kind auf. Der junge Mann verlor nun seinerseits den Halt, stürzte glücklicherweise zurück aufs Eis und nicht zwischen die Schollen vor der Brücke.
Einen Augenblick lag er starr auf dem Rücken. Dann bewegte er Arme und Beine, richtete sich halb auf. Durch die Menge ging ein Raunen der Erleichterung.
Jacob hatte den geretteten Jungen auf die Füße gestellt und verpasste ihm eine Ohrfeige, dass dessen Kopf herumflog. »Das ist für deine Dummheit«, schimpfte er dabei. Eine zweite Ohrfeige folgte. »Das für deinen Übermut.«
Luise strebte von der Brücke herunter und zum Ufer, um ihren Vater aufzuhalten. Der Wäschepacken behinderte sie, aber natürlich kam es nicht infrage, ihn unbewacht stehen zu lassen. Sie schleppte sich also damit ab.
Für einen Augenblick breitete sich Schrecken im Gesicht des Jungen aus, dann übernahmen die Instinkte die Führung, die ihn auf der Straße überleben ließen, und sein Gesichtsausdruck wurde wütend. In seinen Backen sammelte er Spucke, um sie Jacob ins Gesicht zu schleudern und anschließend zu flüchten. Der alte Fischer verpasste dem Bengel aber eine dritte Ohrfeige, weswegen dieser sich verschluckte.
»Denk nicht einmal dran«, knurrte Jacob und hielt den Jungen am Arm fest. »Solche wie dich kenne ich genau.«
»Papa, bitte!«, rief Luise und bemühte sich, auf dem Eis nicht ins Rutschen zu kommen. Es gelang ihr nicht, aber der junge Herr war inzwischen aufgestanden und griff beherzt zu. Er bewahrte sie vor einem Sturz.
»Sie können keine fremden Kinder schlagen«, sagte Luise und löste den Arm des jungen Herrn von ihrem Ellenbogen. Seine Kleidung war deutlich vornehmer als ihre und die ihres Vaters. Er trug auch seinen Hut wieder und wirkte wie ein studierter Mann.
»Ich kann«, widersprach Jacob und schüttelte den geretteten Jungen wie eine Puppe. »Wenn die Lümmel leichtsinnig sind. Du hast doch gesehen, was passiert ist. Klettert auf dem schiebenden Eis rum, als wäre das ein Misthaufen.«
»Is wegen dem Geld«, murrte der Knabe.
»Du gehörst von deinem Vater gehörig übers Knie gelegt.«
»Den gibt’s nicht.«
»Dann von einem Onkel oder deiner Mutter. Viel hätte nicht gefehlt, und das Eis hätte dich zerquetscht.«
»Ich wär schon rausgekommen.«
»Einen Teufel wärst du.«
Luise atmete erschrocken ein. Es sah ihrem Vater nicht ähnlich, den Leibhaftigen im Mund zu führen.
»Das geht den Herrn nichts an. Ich habe nicht darum gebeten, von Ihm gerettet zu werden.«
»Auch noch frech werden! Schleich dich!« Jacob verpasste dem Burschen eine vierte Backpfeife, die ihn aufs Eis schleuderte, weil er ihn gleichzeitig freigab.
Das ließ der Junge sich nicht zweimal sagen, kroch erst auf allen vieren weg und nahm dann die Beine in die Hand. Die anderen Schlingel waren längst verschwunden, nachdem kein Geld mehr geworfen wurde.
»Ich muss Ihnen zu Ihrer mutigen Tat gratulieren«, sagte der junge Herr und lüftete kurz seinen Hut. »Wenn ich mich vorstellen darf, Conrad Meinel mein Name. Geograph aus Wehlen und Freiberg.«
»Sie waren nicht weniger mutig. Jacob Ehrmann, Fischer aus Loschwitz. Das ist meine Tochter Luise.«
Conrad Meinel nahm ihre Rechte und schüttelte sie. Sein Händedruck war nicht zu fest, aber auch nicht so schlaff, dass es sich anfühlte, als stecke die Hand im Bauch eines toten Fisches. »Auf meinem Weg von Wehlen nach Dresden bin ich durch Ihr schönes Dorf gekommen.«
»Schön …? Es ist unsere Heimat. Wir waren noch nie woanders.« Luise befreite ihre Hand und wusste nicht, ob sie einen Knicks machen sollte. Sie entschied sich dagegen.
»Außer in Dresden.« Conrad Meinel lächelte herzlich.
»Ich hatte auf der Amtmannschaft zu tun. Aber die feinen Herrn … Das Eis … da müssen sie doch … Sie haben nur gesagt, dass es längst Befehle gibt, vor den Brücken Artillerie in Stellung zu bringen. In Meißen und Torgau und auch hier in Dresden. Um die Eisschützen wegzusprengen. Ich sehe nichts von Artillerie.«
»Mir haben sie das Gleiche gesagt. Ich war gestern beim Amtmann, um ihn vor dem Eis zu warnen. Wenn es aufbricht … und noch das Eis und das Schmelzwasser aus Böhmen dazukommt. Es gibt eine Katastrophe, wenn keine Vorsorge getroffen wird.«
»Meine Rede.« Jacob sprach ungewohnt munter. Mit Fremden unterhielt er sich selten so eifrig.
»Können wir nicht vom Eis heruntergehen?«, warf Luise ein.
Obwohl das Spektakel vorüber war, standen immer noch etliche Personen auf der Brücke und sahen auf sie hinunter. Sie wollte nach ihrem Packen greifen, aber Conrad Meinel war schneller. Er ächzte, als er ihn anhob.
»Was ist denn da drin?«
»Wäsche«, informierte Luise ihn. »Schmutzige Wäsche, die ich waschen und plätten muss, ehe ich sie zurückbringe. Die Frauen und Töchter der Fischer verdienen auf diese Weise etwas dazu.«
Er schwang sich den Packen auf den Rücken, und sie gingen ans Ufer, blieben unterhalb der Brücke stehen. Dort konnten sie von oben nicht mehr gesehen werden, aber es pfiff ein unangenehmer Wind unter dem Bogen. Luise verkroch sich tiefer in ihre Jacke und zog ihr gestricktes Dreieckstuch höher, bis es auch ihr Kinn bedeckte.
»Sie sind ein gelehrter Herr. Welche Maßnahmen haben Sie den Behörden vorgeschlagen?«
»Das Eis muss sehr genau beobachtet werden. Seine Bewegungen müssen gemessen und die Dicke ständig kontrolliert werden. Artillerie muss bereit stehen, um das Eis an besonders gefährdeten Stellen mit Kanonenschüssen aufzubrechen.«
Jacob nickte. »An verschiedenen Kontrollstellen entlang des Flusses von Schandau bis Torgau. Meldereiter müssen an der böhmischen Grenze stationiert werden, um die Menschen flussabwärts zu warnen, wenn das Schmelzwasser kommt. Das muss alles vorbereitet werden. Es reicht nicht, Artillerie an die Brücken zu beordern, die dann nicht zu sehen ist.«
Luise fragte sich, was mit ihm los war. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie ihn das letzte Mal so viele Worte hintereinander hatte sprechen hören. Zwischen den beiden Männern entspann sich ein Gespräch über Eis, Wasser und das Wetter. Luise war vergessen. Sie konnte nur zuhören und staunen. Ihr Vater unterhielt sich mit diesem Fremden, als würde er ihn seit Jahren kennen. Seine Augen leuchteten richtig.
Kapitel VI
Luises Füße wurden kalt, bald spürte sie ihre Zehen nicht mehr. Der Wind wurde auch immer unangenehmer. Die Männer schienen nicht zu frieren, obwohl auch ihre Nasen rot aussahen. Sie trat von einem Fuß auf den anderen und bewegte die Zehen in den Stiefeln. Es half nichts.
»Fräulein Ehrmann, Ihnen wird kalt, während wir hier stehen. Das ist unverzeihlich.« Conrad Meinel verneigte sich leicht vor ihr.
Daran war Luise nicht gewöhnt, und sie wusste nicht, wo sie hinschauen sollte.
»Es wird auch bald dunkel«, fiel ihr Vater ein. »Wenn wir nicht in finsterer Nacht nach Hause gehen wollen, müssen wir uns auf den Weg machen.«
»Dann werde ich mich verabschieden. Ich bleibe noch bis morgen in Dresden und kehre dann nach Wehlen zurück.«
»Haben Sie eine Unterkunft in Dresden?«
»Ich werde schon irgendeine Herberge finden.«
Jacob legte den Kopf schräg und schaute den ihn überragenden Conrad Meinel an. »Warum kommen Sie nicht mit zu uns? Wir wohnen nicht vornehm, aber im Haus ist es warm, es gibt ein Abendbrot, und einen Platz zum Schlafen finden wir auch für Sie. Wir könnten uns noch weiter austauschen.«
»Da haben Sie recht, guter Herr Ehrmann«, erwiderte Conrad. »Nur kann ich Ihr großzügiges Angebot nicht annehmen, und Ihrer Frau und Ihrer Tochter zusätzliche Arbeit machen.«
»Ich bin ohne Frau«, sagte Jacob gepresst.
»Umso schlimmer. Dann kann ich Ihnen erst recht nicht zur Last fallen.«
»Sie fallen uns nicht zur Last«, mischte sich Luise ein. »Überhaupt nicht. Es ist alles so, wie mein Vater es gesagt hat.«
»Dann ist es abgemacht, und Sie müssen nicht mit einem zugigen Herbergszimmer vorliebnehmen.«
Die Männer gaben sich die Hand, und dann schulterte Conrad Meinel den Packen mit der Schmutzwäsche.
Auf dem Sofa in der Stube, auf dem sonst Georg schlief, hatte Conrad Meinel die Nacht verbracht, während der Bruder mit dem Vater zusammen in dessem Bett geschlafen hatte.
»Nie wieder«, schimpfte Georg am frühen Morgen. »Ich verbringe nicht noch eine Nacht mit Papa zusammen in einem Bett. Wenn dieser Mensch bleibt, schlafe ich bei den Neubers.«
»Das könnte dir so passen. Denkst du, ich weiß nicht, dass du beide Augen auf die älteste Neubertochter geworfen hast?«
»Es ist mir egal.«
Die Geschwister saßen zusammen in der Küche, wo der Tisch für ein Frühstück gedeckt war. Der Brei simmerte in einem Topf auf dem Herd, auf dem Fensterbrett blieb die Milch im Krug kühl. Luise hatte einen Sellerie kleingeschnitten und blanchiert, mit Zwiebeln angereichert bildete er die frische Zutat zu ihrem Frühstück. Als Letztes standen Brot und Schmalz auf dem Tisch. Georg hatte danach schon begehrlich die Hand ausgestreckt, die Schwester gab ihm einen Klaps auf die Finger.
»Wir warten auf Vater und unseren Gast.«
»Wo bleiben die eigentlich?«
»Vater ist draußen und hackt Holz.« Das Geräusch hinter dem Haus war bis in die Küche zu hören. »Herrn Meinel habe ich noch nicht gesehen.«
»Der feine Herr schläft offenbar gerne lange. Wer keinem ordentlichen Beruf nachgeht, kann es sich auch erlauben, lange im Bett zu liegen. Ich will nicht mehr ewig auf mein Frühstück warten, Herr Leopolds braucht mich nachher.« Georg griff wieder nach dem Brot.
Erneut schlug Luise ihm auf die Finger. »Untersteh dich. Wir werden nicht unhöflich sein.«
Georg seufzte. Sie saßen weiter am Tisch und warteten. Aus der Stube war nichts zu hören. Draußen fuhr die Axt in Holzscheite.
»Hast du schon an seine Tür geklopft?«
Luise schüttelte den Kopf.
»Oder nach ihm gesehen?«
»Natürlich nicht.«
»Ich warte nicht länger.« Georg sprang auf und verschwand aus der Küche. Die Schwester hörte ihn an die Stubentür pochen, dann wurde sie geöffnet. Sie knarrte in ihren Lederangeln.
Gleich darauf stand Georg wieder in der Küchentür. »Du solltest besser kommen und dir das ansehen.«
»Das kommt nicht infrage. Ich kann doch nicht die Schlafstube eines fremden Mannes betreten.«
»Es ist eine besondere Lage«, flüsterte Georg. Er zog sie von ihrem Schemel hoch. Widerwillig folgte ihm Luise.
Sie stieß die nur angelehnte Tür einen Spalt auf und spähte hinein. Unter dem hoch aufgetürmten Federbett hörte sie ein Stöhnen. Gleich darauf richtete sich ein zerzauster Conrad Meinel auf. Er schniefte, und trotz des schlechten Lichts im Zimmer erkannte Luise eine gerötete Nase und triefende Augen. Oje, auch das noch, lautete ihr erster Gedanke, für den sie sich gleich darauf schämte. Sie befahl Georg, ein Licht zu holen, und zog selbst die Vorhänge zurück.
Einen Fremden im Bett zu erblicken, war eine ungewohnte Erfahrung. Zögernd trat sie näher.
»Bleiben Sie liegen, Herr Meinel. Ich sehe doch, dass es Ihnen schlecht geht«, sagte sie, als er Anstalten machte, sich zu erheben. »Soll ich nach einem Arzt schicken? Oder einem Bader?«
»Auf keinen Fall«, keuchte Conrad Meinel und musste husten. »Ich will Ihnen keine Umstände machen.«
»Das machen Sie nicht. Ich werde Ihnen einen Tee bereiten und eine Hühnerbrühe.«
Hühnerbrühe hatte Luise nicht im Haus, aber sie schickte Georg zu den Nachbarn, welche zu holen. Sie selbst bereitete in der Küche einen Lindenblütentee. Jacob Ehrmann kam herein und war völlig bestürzt über die Krankheit seines Gastes, wusste aber weder, was er tun, noch, was er sagen sollte. Luise musste ihn ebenso betreuen wie den Kranken. Dem flößte sie den heißen Tee ein. Ihrem Vater legte sie eine Scheibe Schmalzbrot hin. Georg kam mit einem Topf Hühnerbrühe zurück. Er saß mit dem Vater in der Küche, während Luise dem Kranken Wadenwickel machte, ihm den Schweiß von der Stirn wischte und dabei immer wieder versicherte, er müsse sich keine Vorwürfe wegen seiner Krankheit machen.
Kapitel VII
In den folgenden Tagen war Conrad Meinel zu schwach, um auch nur den Abtritt aufzusuchen. Georg kam die Aufgabe zu, ihm einen Nachttopf hinzustellen und diesen auszuleeren. Luise fütterte den Patienten mit allem, was er herunterbrachte, und war froh, wenn er es bei sich behielt. Vor allem die Hühnerbrühe schien ihm zu bekommen. Gegen das Fieber setzte sie auf Wadenwickel. Oft genug wurde der Patient jedoch von Schüttelfrost heimgesucht, und dann häufte sie alle Decken auf ihn, die im Hause verfügbar waren. Bis er sie wieder von sich stieß, weil er darunter zu ersticken glaubte.
»Es tut mir so leid, dass ich Ihnen diese Mühe verursache«, krächzte Conrad. »Sie müssen mich für einen lästigen Gast halten.«
»Sie können nichts dafür, krank geworden zu sein. Denken Sie nicht darüber nach, sondern werden Sie gesund«, widersprach Luise streng. »Jede Aufregung ist Gift für Sie. Sie sollen liegen bleiben, schlafen und viel trinken.«
»Zu etwas anderem bin ich auch nicht nütze.«
Nachdem drei Tage lang das Fieber nicht sinken wollte und Luise wirklich Angst um ihren Patienten bekam, stimmte Jacob dem Besuch eines Arztes zu, obwohl das ein Loch in ihre schmale Barschaft riss. Aus Dresden Neustadt kam dieser am Tag danach zu ihnen und fand einen fiebernden, sich kaum noch bei Bewusstsein befindenden Patienten vor. Conrad Meinel sprach im Delirium, wusste weder, wo er sich befand, noch wo er wohnte, und konnte kaum seinen Namen buchstabieren. Der Arzt ließ eine Flasche Laudanum da, aus der dem Patienten morgens und abends einige Tropfen im Tee verabreicht werden sollten, damit er die Krankheit ausschlafen könne. Hühnerbrühe und heißen Tee befand der Arzt ebenfalls für gut.
Für seinen Besuch, der kaum eine halbe Stunde gedauert hatte, verlangte der Mann vier Taler und für den Weg von Dresden heraus noch einen extra. Zähneknirschend zählte der Vater das Geld ab.
»Mit den Händen hat der nie gearbeitet«, moserte er, nachdem der Arzt auf einem nervösen Braunen davongeritten war. »Sonst wüsste er, wie viel unsereins schuften muss, um fünf Taler zu verdienen.«
»Wir mussten den Arzt holen, Papa«, mischte sich Georg ein und klopfte sich Schnee von den Stiefeln. Er hatte vor dem Haus dessen Pferd gehalten.
»Das mussten wir«, stimmte der Vater zu. »Wir können keinen Gast bei uns beherbergen und nicht alles für ihn tun, was nötig ist. Es hätte aber vielleicht auch gereicht, die Wehfrau aus dem Dorf zu holen, wie wir es für uns tun.«
Die Wehfrau holte die Kinder auf die Welt und kümmerte sich um die anderen Leiden der Loschwitzer, von denen sich keiner einen Arzt leisten konnte.
»Das ist ein vornehmer Herr, dem können wir nicht mit der Hebamme kommen. Was soll er von uns denken?«, widersprach Luise.
Die fünf Taler für den Arzt wurden ihnen zwei Tage später ersetzt. Luise hatte auf Conrad Meinels Bitte hin einen Brief an seine Mutter nach Wehlen geschrieben. Sie solle sich wegen seines Ausbleibens nicht sorgen, er komme zurück, sobald er wieder reisen könne. Mit dem Antwortbrief aus Wehlen wurde eine Rolle Taler abgegeben, die die Mutter ihrem Sohn schickte, damit er seine Ausgaben bestreiten konnte. Conrad bestand in einem wachen Moment darauf, dass Jacob alles nahm und für seine Unterbringung und Pflege verwandte.
»In einer Herberge müsste ich auch für meine Unterkunft bezahlen. Es ist nur recht und billig, wenn Sie das Geld erhalten.« Es waren weit mehr als fünf Taler, aber Conrad schloss mit seiner verbliebenen Kraft Jacobs Hand um das Geld.
Später in der Küche zählten die Ehrmanns über zwanzig Taler in Groschen und Pfennigen.