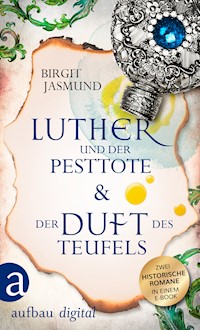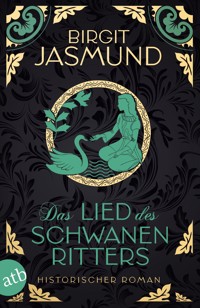8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Luther-Verschwörung.
Wittenberg im Jahre 1517. Die Residenzstadt an der Elbe wird von der Pest heimgesucht. Alle nehmen an, dass auch der Student Tamme zu den Opfern gehört, obwohl seine Leiche nie auftaucht. Almuth, seine Verlobte, glaubt als Einzige an ein Komplott und schafft es, bei Martin Luther Gehör zu finden. Wenig später jedoch braucht der Geistliche selbst Almuths Hilfe. Denn nachdem seine 95 Thesen öffentlich wurden, fürchtet er um sein Leben ...
Spannend und emotional: Eine Geschichte um Martin Luther zur Zeit der Reformation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Die Luther-Verschwörung
Wittenberg im Jahre 1517. Die Residenzstadt an der Elbe wird von der Pest heimgesucht. Alle nehmen an, dass auch der Student Tamme zu den Opfern gehört, obwohl seine Leiche nie auftaucht. Almuth, seine Verlobte, glaubt als Einzige an ein Komplott und schafft es, bei Martin Luther Gehör zu finden. Wenig später jedoch braucht der Geistliche selbst Almuths Hilfe. Denn nachdem seine 95 Thesen öffentlich wurden, fürchtet er um sein Leben. Spannend und emotional: Eine Geschichte um Martin Luther zur Zeit der Reformation.
Birgit Jasmund
Luther und der Pesttote
Historischer Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Dramatis Personae
Prolog: Wittenberg nach Ostern 1517
1. Teil: Von Mitte Juli 1517 bis Mitte September 1517
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
2. Teil: Von Mitte September 1517 bis Januar 1518
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Nachwort
Über Birgit Jasmund
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Dramatis Personae
Eine Aufstellung der wichtigsten Personen der Geschichte in alphabetischer Reihenfolge. Historische Personen sind kursiv dargestellt.
Benedictus – Augustinereremit, Bruder im Schwarzen Kloster in Wittenberg
Boethius, Friedrich – Kommissar der Fugger, reist mit Johann Tetzel
Brandenburg, Albrecht von – Erzbischof von Mainz und Magdeburg, verkauft den Ablass zur Tilgung seiner Schulden bei den Fuggern
Cranappel, Urban – Ratsherr in Wittenberg
Els – Magd im Haus Gronenberg
Eschaus, Thomas – Arzt in Wittenberg
Friedrich III. – genannt der Weise, Kurfürst von Sachsen
Globigk, Matthias – Stadtrichter in Wittenberg
Gronenberg, Almuth – Schwester des Buchdruckers Johann Gronenberg, verlobt mit Tamme Redecker
Gronenberg, Eufemia – Tochter des Buchdruckers Johann Gronenberg
Gronenberg, Johann – Buchdrucker in Wittenberg, auch Grunenberg oder Rhau Grunenberg
Gronenberg, Sibilla – Johann Gronenbergs Ehefrau
Henning – Augustinereremit, Bruder im Schwarzen Kloster, Luthers Freund
Herkner, Dietlind – Ehefrau des Apothekers Georg Herkner, Tammes Mutter
Herkner, Georg – Apotheker in Wittenberg, Dietlind Herkners zweiter Ehemann, Tammes Stiefvater
Hinke Cuno – Waisenjunge in Wittenberg
Hohndorff, Johann – Bürgermeister von Wittenberg
Link, Wenzeslaus – Augustinereremit, Prior im Schwarzen Kloster
Lufft, Hans – Buchdruckergeselle
Luther, Martin Dr. – Augustinereremit im Schwarzen Kloster, Professor für Bibelkunde an der Wittenberger Universität, Ablassgegner
Marie – Magd im Hause Herkner
Mergelin, Frau – Kupplerin in Wittenberg
Naber, Ferdinand – Kommissar der Fugger, reist mit Johann Tetzel
Redecker, Tamme – Student der Rechte, verlobt mit Almuth Gronenberg
Reichenbach, Philipp – Stadtschreiber in Wittenberg
Reinhart, Symphorion – Buchdrucker in Wittenberg
Spalatin – Verwalter der Wittenberger Universitätsbibliothek, Hofkaplan, Geheimschreiber Friedrichs des Weisen, Freund Luthers
Staupitz, Johann von – Generalvikar des deutschen Augustinerordens, Förderer Luthers
Teuschel, Caspar – Stadtrichter in Wittenberg
Tetzel, Johann – Dominikaner, Ablassprediger
Wittenberg nach Ostern 1517 Prolog
Durch das Gitter des Beichtstuhls erkannte Martin Luther, dass ein Mann auf der schmalen Bank Platz nahm. Sein Bart war sorgfältig gekämmt, seine Kleider raschelten, und das Holz des Sitzes knarrte, während er versuchte sich möglichst bequem hinzusetzen. Geduldig wartete Martin Luther darauf, dass er seinen Mund nahe an das Gitter heranbrachte und die Hände faltete. Nur tat der es nicht. Er schien etwas in der Hand zu halten.
»Von welcher Sünde möchtest du deine Seele reinigen, mein Sohn?«, fragte Luther.
»Meine Seele ist rein.«
»Du führst ein gottesfürchtiges Leben, vom Aufwachen bis zum Einschlafen und auch in der Nacht?« Unauffällig streckte Luther den schmerzenden Rücken. Die Enge des Beichtstuhls machte das Sitzen nicht angenehm. In der Früh ab sechs hatte er vor verschlafenen Studenten über den Hebräerbrief gelesen, war dann durch die Stadt geeilt, um den Gläubigen die Beichte abzunehmen, und nun saß ihm ein Mann gegenüber, der sich ohne Sünde wähnte. Geduld war eine Tugend, seine wurde gerade stark strapaziert.
»Warum bist du zu mir gekommen?«
»Ich erbitte Euren Segen, Pater.«
»Ohne Beichte?«
»Ich habe das hier. Ich muss keine Buße mehr tun. Nie mehr.« Der Mann hielt tatsächlich etwas in der Hand. Es war ein zusammengerollter Zettel, den er durch das Gitter steckte.
»Was ist das?« Luther griff nicht danach, wartete auf eine Erklärung seines Beichtkindes.
»Das ist ein Ablassbrief. Er erspart mir die Qualen des Fegefeuers für Millionen von Jahren. Meine Seele ist so rein, wie sie reiner nicht sein könnte. Ich habe dafür drei Gulden bezahlt. Das ist viel Geld für einen Schneider wie mich.« Der Stimme war die Zufriedenheit ihres Besitzers anzuhören.
»Wie viele Millionen Jahre sind es genau?«
»Achtundzwanzig Millionen.«
»Da kommt es ja auf ein paar mehr oder weniger nicht an.«
»Ich hoffe jedenfalls, dass meine Seele direkt ins Paradies einfährt. Meiner Frau und meinen Kindern habe ich ebenfalls Ablassbriefe gekauft. Auch meinen toten Eltern. Das war meine beste Tat, denn damit habe ich ihre armen Seelen direkt aus dem Fegefeuer befreit. Sie sitzen nun im Paradies an der Seite unseres Herrn.«
»Dort sitzen sie bestimmt nicht.« Luther sprach etwas lauter, als er eigentlich vorgehabt hatte.
»Die Briefe haben ihre Seelen gereinigt. Ich habe sie dabei, wollt Ihr sie sehen?«
»Bestimmt nicht!« Luther sprang aus dem Beichtstuhl. »Raus hier!«, befahl er dem Schneider.
Schmächtig und mit einem Wams aus gutem Stoff stand der Mann vor ihm. Er sah erschrocken aus und hielt Luther den Ablassbrief entgegen.
Dieser Brief!
Luther nahm ihn an sich und warf ihn auf den Boden. »Das ist es, was dieser Brief wert ist. Einen Dreck! Er erspart niemandem auch nur ein Jahr im Fegefeuer. Das ist nur durch ein gottesfürchtiges Leben und lebenslange Buße zu erreichen. Nur dann kann eine Seele darauf hoffen, aus dem Fegefeuer ins Paradies zu kommen.«
Der Schneider bückte sich und sammelte seinen Brief hastig wieder auf. »Da hat mir der Dominikanermönch etwas anderes erzählt. Und er hat seinen Auftrag direkt vom Papst.«
»Das ändert nichts. Gott ist doch kein Krämer, mit dem man um seine Seele handeln kann wie um einen alten Mantel. Er blickt tief in uns hinein und erkennt unser wahres Gesicht.« Luther schaute sich in der Stadtkirche um.
Außer dem Schneider standen noch ein Mann und eine Frau neben dem Beichtstuhl und warteten. Sie ließen ihre Blicke durch die Kirche schweifen, schauten überallhin, nur nicht auf ihn.
»Und was ist mit euch?«, fuhr er sie an. »Wollt ihr zur Beichte kommen oder mir auch nur diese Drecksbriefe zeigen, weil ihr eure Seele mit ein paar Gulden freigekauft habt? Um einen Judaslohn habt ihr sie in die Hölle gestürzt. Habt ihr nicht gehört, was ich zu Ostern über den falschen Glauben an den Ablass gesagt habe? Das ist erst eine Woche her. Der Ablass ist dem Teufel näher als Gott.«
Die beiden sahen betreten zu Boden.
»Von mir bekommt ihr keinen Segen. Packt euch fort.«
Die beiden schauten auf ihre Schuhe und verließen dann langsam die Kirche.
Der schmächtige Schneider stand mit vorwurfsvoll vorgeschobener Unterlippe neben dem Beichtstuhl. Den Ablassbrief hatte er unter seiner Kleidung versteckt.
»Was willst du noch?«
»Ihr stellt Euch gegen den Heiligen Vater in Rom?«
»Ich stelle mich auf Gottes Seite.«
»Dann finde ich eben einen anderen Priester, der mir den Segen nicht verweigert«, sagte der Schneider trotzig und verließ die Kirche mit langen Schritten.
Luther schaute ihm nach, rieb sich dabei über die Stirn. Er war erschöpft, fühlte sich, als hätte er die ganze Nacht im Gebet verbracht.
Elf Leute hatten an diesem Morgen die Beichte besucht. Elf! An Mariä Lichtmess hatte noch eine Schlange von reuigen Sündern vor seinem Beichtstuhl gestanden, inzwischen waren es nur noch elf. Außer dem Schneider hatten ihm noch sechs andere einen Ablassbrief vorgelegt und verlangt, sie ohne Beichte von ihren Sünden zu erlösen.
Zwei Beichtkinder hatten sich ihre Sünden von der Seele gesprochen. Davon war der eine ein Knabe von neun Jahren gewesen. Einer von der Sorte, die einem Erwachsenen alles versprachen und nichts hielten. Luther war nicht sicher, ob er das Vaterunser, das er ihm aufgegeben hatte, wirklich betete. Bei dem anderen handelte es sich um einen jungen Tagelöhner aus der Elstervorstadt. Ein ernsthafter und frommer Mann, aber auch bitterarm. Der fehlende Ablasszettel konnte auf seine Frömmigkeit oder seine Armut zurückzuführen sein.
Das Übel das Ablasshandels griff wie eine Krake um sich, obwohl Kurfürst Friedrich, genannt der Weise, ihn in seinen Ländern untersagt hatte. Daran hatte er recht getan, denn auf diese Weise ließ sich Gottes Vergebung nicht erkaufen. Der Fürst mochte bei seiner Entscheidung vielleicht eher daran gedacht haben, dass seine Untertanen ihr schwerverdientes Geld nicht verschleuderten.
Luther verließ die Kirche durch eine kleine Seitentür neben dem großen zweiflügeligen Eingangsportal. Draußen empfing ihn leichter Nieselregen. Noch bevor er sich die Kapuze seiner Kutte über den Kopf ziehen konnte, fiel vom Dach ein dicker Tropfen in seinen Nacken und rann ihm kalt den Rücken herunter. Aber sowenig ihm dieser Tropfen etwas anhaben konnte, sowenig konnte ein Ablasszettel an Gottes Meinung über die Sünden eines Menschen etwas ändern. War das ein guter Vergleich? Luther bejahte seine rhetorische Frage. Das könnte er in einer Predigt verwenden. Unwillkürlich entfuhr ihm ein Seufzer. Er ahnte, dass es mehr brauchte als einen eingängigen Vergleich, um die Leute vom Ablass abzubringen.
Von der Stadtkirche führte ihn sein Weg durch die schmale Mittelgasse bis zum Schwarzen Kloster der Augustinereremiten. Obwohl er Pfützen und Unrat in den Gassen auswich, waren seine Schuhe durchweicht, als er an die Pforte pochte.
Es dauerte geraume Zeit, bis der Pförtner die kleine Luke in der Tür öffnete und denjenigen musterte, der Einlass begehrte. Sein breites Gesicht glänzte vom Regen.
»Ah, Bruder Martin, du wirst in der Bibliothek des Schlosses erwartet.«
»Ich will nur erst …«
»Du sollst unverzüglich in die Bibliothek kommen, wurde mir aufgetragen. Am besten machst du dich sofort auf den Weg.« Die Luke wurde wieder zugeschlagen, und Luther hörte, wie sich auf der anderen Seite die Schritte des Bruders entfernten.
Er schüttelte Regentropfen von seiner Kutte und besah sich einen Moment seine nassen und schlammbespritzten Schuhe. In der Bibliothek des Schlosses konnte ihn eigentlich nur Spalatin erwarten, Hofprediger und vom Kurfürst ernannter Bibliothekar für die Werke im Wittenberger Schloss. Wenn es einen Menschen auf der Welt gab, den Luther Freund nannte, war es Spalatin – trotzdem wäre er ihm lieber mit sauberen Schuhen gegenübergetreten.
1. Teil Von Mitte Juli 1517 bis Mitte September 1517
Kapitel 1
Auf der Bank in der Küche hockte ein Kaninchen und fraß das Kraut einer Möhre. Das Mahlen seiner scharfen Zähne war deutlich zu hören. Vor dem Tierchen saß rittlings ein magerer Junge und hielt den Stängel. Genauso aufmerksam wie er beobachtete ein etwas jüngeres Mädchen das Kaninchen beim Fressen. Eine Hand hatte sie dabei auf dessen Rücken gelegt und streichelte das seidige Fell.
Außer dem Mahlen der Zähne war das Hacken eines Messers, das unbarmherzig in Karotten und Kohlrabi fuhr und das Gemüse zu kleinen Würfeln verarbeitete, zu hören. Almuth Gronenberg stand am Küchentisch und bereitete die Suppe vor, die am Abend serviert werden sollte. Sie arbeitete schnell und geschickt und musste kaum einmal auf ihre Finger schauen, die der Schneide des Messers gekonnt auswichen. Das Gemüse türmte sich bald zu einem Haufen auf dem Tisch auf.
Almuth unterbrach ihre Arbeit einen Augenblick, wischte die Hände an der Schürze ab und betrachtete die Kinder auf der anderen Seite des Tisches. Die beiden hätten unterschiedlicher nicht sein können. Alles, was bei Eufemia rund und rosig war, stand bei Hinke-Cuno spitz und eckig ab, seine Nase, sein Kinn, die mageren Schultern und die Ellenbogen. Der Knabe war Waise und lebte bei einem arbeitsscheuen Tagelöhner. Beide behaupteten voneinander, Onkel und Neffe zu sein, deshalb hatte der Rat der Stadt Hinke-Cuno nicht im Waisenhaus untergebracht. Ob der Junge dabei ein besseres Leben hatte, bezweifelte Almuth, denn der ›Onkel‹ arbeitete von sieben Tagen in der Woche höchstens zwei und verlangte von Cuno, kräftig zum gemeinsamen Lebensunterhalt beizutragen. Obwohl dessen rechtes Bein kürzer war als das linke, erfüllte er seine Pflichten, in dem er für ein paar Groschen, etwas zu essen oder ein abgetragenes Kleidungsstück Botschaften überbrachte. Er kannte jeden Bürger Wittenbergs, und jeder kannte ihn.
Ganz anders verlief dagegen Eufemias Leben als einziges Kind des Buchdruckers Johann Gronenberg. Sie trug Kleidung aus gutem Tuch, aß drei Mahlzeiten am Tag, und das blonde Haar hatte Almuth am Morgen gekämmt und zu zwei ordentlichen Zöpfen geflochten. Über ihrem Bett hing nicht nur ein Kreuz an der Wand, daneben stand auch eine Truhe, die Puppen und Bälle aus Stoffresten, einen Kreisel und eine von ihrem Vater gestaltete Fibel enthielt.
Das Kaninchen hatte das Möhrenkraut aufgefressen, und Cuno nahm einen neuen Stängel vom Tisch, hielt ihn dem Tier hin. Das drehte den Kopf weg.
»Es hat keinen Hunger mehr«, sagte Eufemia mit heller Kinderstimme. Sie zog das Kaninchen sacht an einem Ohr.
»Wohl nicht.« Cuno zerdrückte den Stängel Möhrenkraut zwischen den Fingern.
Hunger war das Stichwort. Almuth ging zum Herd. Der stand, aus Ziegeln gemauert, an der Rückwand der Küche. Aus einem Kessel schöpfte sie ein paar Kellen Getreidebrei vom Morgen in eine Schüssel. Zusammen mit einem Holzlöffel stellte sie das Essen vor Cuno hin. Obwohl sie dem Jungen bereits eine dicke Scheibe Brot mit Butter gegeben hatte, leuchteten seine Augen auf. Er hatte immer Hunger und griff hastig nach der Schale, den Löffel ließ er dabei unbeachtet auf dem Tisch liegen. Dass der Brei kalt war, störte ihn nicht, er hob die Schale dicht vor den Mund und langte mit der Rechten hinein.
Blitzschnell nahm Eufemia den Löffel und schlug dem Jungen damit leicht auf den Kopf. »Du musst hiermit essen, nicht mit den Fingern. Weißt du das denn nicht?«
Cuno jedoch ließ sich nicht beirren.
»Du darfst ihn nicht schlagen«, sagte Almuth entrüstet. »Cuno hat eben viel Hunger.«
»Trotzdem muss man einen Löffel nehmen, nur Tiere fressen aus dem Trog. Cuno muss das wissen, er ist älter als ich.«
»Kein Jahr«, warf der Junge mit vollem Mund ein. Danach leckte er sich die Finger ab und nahm den Löffel, um den restlichen Brei manierlicher zu essen.
Almuth wandte sich wieder dem Gemüse zu und schnitt einen Kohlrabi in Würfel. Eufemia schob ihre Hand über den Tisch und nahm ein paar. Ein Stück hielt sie dem Kaninchen hin. Gierig schnappten die scharfen Zähne zu.
Die junge Frau sagte nichts gegen diesen Mundraub, solange er nicht überhandnahm und genug für die Suppe am Abend übrig blieb. Sie waren eben Kinder. Nächstes Jahr um diese Zeit wäre sie vielleicht selbst Mutter. Seit dem Herbst war sie mit dem Studenten der Rechte, Tamme Redecker, verlobt, und für diesen Sommer war die Hochzeit geplant. Sie konnte es kaum erwarten. Tamme war der Mann, an dessen Seite sie den Rest ihres Lebens verbringen, dem sie Kinder schenken wollte. Kinder wie Eufemia und Cuno.
Das Kaninchen hatte den Kohlrabiwürfel gefressen, Cuno die Breischale geleert, und Eufemia teilte mit ihm die restlichen vom Tisch stibitzten Gemüsewürfel. Der Zwist um den Löffel war längst vergessen.
Ein gellender Schrei erklang aus dem ersten Stock des Hauses. Almuth ließ das Messer auf den Tisch fallen. Die Kinder hörten auf zu kauen, Cuno allerdings nur für einen Moment, dann mahlten seine Zähne weiter.
»Das war die Frau Mutter«, sagte Eufemia. »Was ist mit ihr?«
»Ich sehe nach ihr. Bleibt ihr hier.«
»Es ist wegen des Kindes. Das ist es doch immer«, seufzte Eufemia altklug.
Cuno sah verständnislos drein, als Almuth sich an der Tür noch einmal umdrehte. »Macht keinen Unsinn«, mahnte sie. Ihre Nichte verstand offenbar besser, was im Hause vorging, als sie je vermutet hatte.
Im ersten Stock des Hauses, im Schlafzimmer ihres Bruders und seiner Frau, kniete Sibilla Gronenberg unter dem an der Wand hängenden Heiland. Ein blutbefleckter Unterrock lag auf dem Boden. Almuth hob ihn auf, legte ihn auf eine Truhe.
»Ist es wieder passiert?«, fragte sie ihre Schwägerin sanft.
»Der Heiland straft mich, deshalb schenkt er mir kein Kind.« Sibillas Stimme zitterte.
»Du hast eine Tochter.«
»Aber keinen Sohn. Und diesen Monat wieder nicht, obwohl ich mir fast sicher war, schwanger zu sein. Aber ich habe wieder die Blutungen bekommen.«
Sibilla war sich jeden Monat fast sicher, schwanger zu sein, und haderte dann mit sich und dem Himmel, wenn sie wieder ihre Blutungen bekam. Almuth legte ihrer Schwägerin eine Hand auf die Schulter, mehr Nähe ließ die andere nicht zu. Sie war eine Frau, die sich nicht leicht öffnete. Dass sie überhaupt in dieser aufgelösten Situation anzutreffen war, zeigte, wie groß ihre Seelenqual sein musste. Almuth half Sibilla, sich zu säubern, holte warmes Wasser aus der Küche und legte einen neuen Unterrock und Leinenstreifen zurecht.
Nachdem Sibilla sich gereinigt und umgezogen hatte, riet Almuth der Schwägerin, sich eine Weile hinzulegen und auszuruhen.
»Ich bin doch nicht krank«, widersprach Sibilla und drängte sich an ihr vorbei aus der Kammer.
Almuth folgte ihr.
In der Küche saßen noch immer die Kinder mit dem Kaninchen auf der Bank. Von dem geschnittenen Gemüse fehlte ein sichtbarer Teil, gerade schob sich Hinke-Cuno eine Handvoll Kohlrabiwürfel in den Mund. Das Kaninchen war mittlerweile damit beschäftigt, an einem Stück Karotte zu nagen.
Sibilla Gronenbergs Miene verfinsterte sich. Sie packte Cuno am Ohr und zog ihn von der Bank.
»Unseliger Bengel!«, schimpfte sie. »Frisst sich bei uns durch. Und du lässt das zu.« Dieser letzte Vorwurf richtete sich an Almuth. Sie blitzte die junge Frau und ihre Tochter an. Cunos Ohr wurde feuerrot, und er griff nach seiner Peinigerin, um sich von ihrer Hand zu befreien. Doch Sibilla ließ nicht locker.
»Frau Mutter, du hast geschrien …«, sagte Eufemia mit leiser, zitternder Stimme.
»Kaum lässt man euch einen Augenblick allein, glaubt ihr, unser Tisch ist überreich gedeckt.« Sie zog Cuno noch stärker am Ohr, und er biss mit schmerzverzerrtem Gesicht die Zähne zusammen, gab aber keinen Laut von sich. »Das wird dich lehren, dich nicht noch einmal bei uns einzuschleichen und unsere Speisekammer zu plündern.« Sibilla zog Cuno zur Tür und stieß ihn in den Flur. Dort schubste sie ihn den schmalen Gang entlang an der Buchdruckerwerkstatt vorbei zur Haustür und auf die Straße hinaus.
Cuno hielt sich das Ohr und gab Fersengeld, so schnell es sein Hinken erlaubte. Bevor er um die Ecke verschwand, rief Sibilla ihm hinterher: »Unverschämter Bengel, komm mir nicht noch mal unter die Augen.«
Sie kam gerade rechtzeitig in die Küche zurück, um zu sehen, dass ihre Tochter sich mit dem Kaninchen im Arm davonstehlen wollte.
»Junge Frau.« Sibillas Stimme peitschte durch den Raum.
Eufemia zuckte zusammen, das Kaninchen rutschte aus ihrem Arm und hoppelte in eine Ecke neben dem Herd. »Du hast genug von unserem Abendessen in dich hineingestopft und wirst von der Suppe nichts mehr bekommen.«
Die Augen der Achtjährigen wurden groß und rund, ihre Unterlippe zitterte.
»Sie ist doch noch ein Kind«, versuchte Almuth zu vermitteln.
»Sie ist meine Tochter, deshalb mischst du dich da nicht ein. Wenn du eigene Kinder hast, kannst du es halten, wie du willst. Lass sie zügellos alles essen, was sie in die Finger bekommen, und du wirst sehen, was du davon hast.«
»Sie zittert, weil sie sich vor ihrer eigenen Mutter fürchtet.« Almuth wurde langsam ärgerlich. Hinke-Cuno zu bestrafen, war eine Sache. Die Enttäuschung über ihre erneute Blutung an der Tochter auszulassen, eine andere.
»Schwägerin.«
Sibilla tat, als hätte sie nichts gehört und deutete mit dem Finger auf das in der Ecke kauernde Kaninchen. »Nimm das Tier, und dann will ich dich heute nicht mehr sehen.«
Eufemia folgte der Aufforderung ihrer Mutter und rannte in den Hof hinaus. Wortlos setzte sich Sibilla an den Küchentisch und begann, auf das Gemüse einzuhacken. Almuth beobachtete sie.
»Willst du mir nicht helfen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Ich schicke dir Els.«
Almuth verließ die Küche durch die gleiche Tür wie kurz zuvor Eufemia. Der angrenzende Hof wurde auf der einen Seite von dem zum Haus gehörenden Stall und auf der anderen Seite vom Stall des Nachbarhauses begrenzt. Eufemia war nicht zu sehen. An den Hof schloss sich der Garten an, in dem die Magd Els zwischen Karotten und Kohlrabi Unkraut jätete. Almuth schickte die Frau in die Küche und übernahm deren Platz im Beet.
Der Schrei war auch in der Buchdruckerwerkstatt gehört worden. Johann Gronenberg und sein Geselle Hans Lufft unterbrachen ihre Arbeit und schauten sich gegenseitig an. Hans Lufft wartete darauf, dass sein Meister aufstand und nachschaute. Er biss sich auf die Lippe und fragte sich, ob er etwas sagen sollte. Aber was?
Sie hörten, wie die Küchentür geöffnet und wieder zugeschlagen wurde, es folgten eilige Schritte auf der Treppe. Almuth war auf dem Weg zur Meisterin. Hans Lufft senkte den Blick und wandte sich wieder seiner Arbeit zu, spannte den Rahmen um eine fertig gesetzte Seite. Einen Augenblick später begann auch Johann wieder damit, Buchstaben in einen Setzrahmen einzulegen. Ein unhörbarer Seufzer war seiner Kehle entschlüpft.
Almuth hatte es übernommen, seine Frau wieder einmal über ihre ausbleibende Schwangerschaft hinwegzutrösten.
Am Abend, nachdem Eufemia zwar ohne Suppe, aber doch mit einem Stück Brot zu Bett geschickt worden war, saßen die beiden Eheleute in ihrer Schlafkammer auf dem Bett. Johann auf der einen Seite, Sibilla auf der anderen.
»Ich habe mitbekommen, was wieder geschehen ist«, sagte Johann, als er die Stille nicht länger ertragen konnte.
»Der Allmächtige wird uns kein Kind mehr schenken.«
»So etwas darfst du nicht sagen, Frau.«
»Eufemia ist bereits acht Jahre alt. Seitdem war es mir nicht vergönnt, ein Kind länger als bis zum dritten Monat zu tragen. Das auch nur zweimal in all der Zeit.«
»Wir werden schon noch ein Kind bekommen. Wir müssen es nur oft genug versuchen und darum beten.«
»Ich bin bald dreißig Jahre alt. Jeden Tag bete ich, aber der Allmächtige wird uns kein Kind mehr schenken, er sieht unsere Sünden.«
»Welche Sünden?« Das war das erste Mal, dass Sibilla so etwas redete. Es musste ihr diesmal wirklich hart zugesetzt haben. »Wir sind Mann und Frau, es ist keine Sünde, was wir tun.«
»Wir sündigen jeden Tag, weil wir nicht dafür sorgen, dass die Leidenszeit unserer Eltern und Großeltern im Fegefeuer abgekürzt wird. Wir kümmern uns auch nicht richtig um die Vergebung unserer eigenen Sünden.«
»Wir beide gehen jede Woche zur Beichte.« Johann Gronenberg beugte sich zu seiner Frau.
Sie wich ihm aus und ließ ein verächtliches Schnauben hören. »Das erspart nicht einmal uns das Fegefeuer, und unsere Vorfahren werden weiter Jahr um Jahr dort schmoren, weil wir keinen Ablass für sie kaufen.«
»Hast du nicht gehört, was Martin Luther über den Ablass gesagt hat? Das sind nichts als bedruckte Zettel.«
»Martin Luthers Worte retten die Seelen nicht aus dem Fegefeuer, der Ablass schon«, wiederholte Sibilla stur. Eine letzte Strähne ihres dunkelblonden Haares schob sie unter die Nachthaube.
»Ich sehe dein Haar so gern offen«, schmeichelte Johann ihr, allerdings ohne große Hoffnung, seine Frau damit abzulenken.
Sibilla zögerte, schaute ihn von unten herauf an.
»Wenn du mich nur nach Jüterbog reisen ließest, um die nötigen Ablässe zu kaufen. Ich spüre, dass ich dann einen Monat später schwanger werden würde.«
Johann schüttelte den Kopf. »Unser Kurfürst hat verboten, dass der Ablass in seinen Landen verkauft wird, weil er ihn auch für eine Verschwendung guten Geldes hält.«
»Wissen diese Männer denn alles besser als der Papst in Rom und unser guter Erzbischof!«, rief sie empört aus.
»Das Geld für die Ablassbriefe wandert in die Schatztruhen genau dieser beiden Männer. Frage dich doch einmal, wie der Allmächtige im Himmel davon etwas abbekommt. Du kannst das Geld so hoch werfen, wie du willst, es bleibt nicht dort.« Diesen Vergleich hatte Luther verwendet, als er vor Ostern in der Buchdruckerei gewesen war, um zu besprechen, welche Bücher seine Studenten in nächster Zeit benötigen würden.
»Der Allmächtige erfährt von dem Ablass, und dann werden einem die Sünden im Fegefeuer erlassen. Ich möchte, dass wir alles tun, damit ich schwanger werden kann.«
Was sollte er dazu sagen? Es widersprach seiner Überzeugung. Der Ablass beseitigte die Sünden nicht, er vergrößerte sie noch, denn neben allem anderen lud man nun noch Götzendienerei auf die schmalen Schultern der Seele.
Beten, bereuen und ein gottesfürchtiges Leben führen waren die einzigen Mittel, die Seele reinzuwaschen. Wie konnte er Sibilla von der Wahrheit überzeugen? Oder die Gulden für den Ablass opfern, das Gewissen seiner Frau beruhigen und weiter auf ein Kind hoffen? Er erschrak über diesen Gedanken, aber nachdem er sich einmal in seinem Kopf festgesetzt hatte, ließ er sich von dort nicht wieder vertreiben.
»Schlaf jetzt, Frau«, sagte er mit rauer Zärtlichkeit.
Als sie im Bett nebeneinanderlagen, ergriff er unter der Decke ihre Hand.
»Ich liebe unsere Tochter, und wenn sie unser einziges Kind bleiben sollte, müssen wir Gottes Willen hinnehmen. Trotzdem dürfen wir die Hoffnung nicht aufgeben.«
»Du lässt mich die Ablassbriefe besorgen?«
»Wenn es uns hilft, ein Kind zu bekommen und es dich glücklich macht«, antwortete er, ohne zu zögern.
Kapitel 2
Almuth eilte mit fliegenden Röcken den Weg entlang zur Elbe. Unter den ausladenden Ästen einer Eiche saß ihr Verlobter auf einem Stein. An derselben Stelle am Ufer des Flusses hatte sie ihn zum ersten Mal erblickt. Seitdem trafen sie sich an diesem Ort, wann immer sie sich davonstehlen konnten, er von seinem Studium, sie aus dem Haus ihres Bruders. Er hatte ihr den Rücken zugewandt, aber die Allmacht Gottes schien ihm zuzuflüstern, dass sie kam. Er drehte sich um.
Sie beobachtete, wie sich ein Strahlen in seinem Gesicht ausbreitete. Er sprang auf und lief auf sie zu. Bei seinem Anblick machte ihr Herz einen Satz. Dunkles lockiges Haar, in dem sie gern ihre Hände vergrub, liebevolle braune Augen, ein energisches Kinn und eine Nase, die ein Jota nach links gebogen war. Diese störte sie jedoch kein bisschen. Im Gegenteil, sie wunderte sich immer noch, dass dieser junge Mann, der zwischen allen unverheirateten Mädchen in Wittenberg hätte wählen können, sich ausgerechnet für sie entschieden hatte. Betrachtete sie sich heimlich im Spiegel ihrer Schwägerin, so erblickte sie ein höchstens durchschnittliches Gesicht. Die Nase war ebenfalls nicht gerade zu nennen und nicht so zierlich, wie es als schön galt, überdies war ihre Stirn zu hoch und ihr Kinn zu kurz. Zufrieden war sie dagegen mit den langen Wimpern, die ihre Augen umrahmten, und mit ihren Zähnen. In zwei vollständigen Reihen und von heller Farbe schmückten sie ihren Mund. Das war längst nicht selbstverständlich. Der Magd Els, kaum älter als sie, hatte der Bader im Oberkiefer bereits zwei Zähne ziehen müssen, weil sie verfault gewesen waren und ihr unerträgliche Schmerzen verursacht hatten. Seitdem lachte Els weniger.
Tamme stand vor ihr, strahlte sie an, ergriff ihre Hände und näherte seinen Mund dem ihren. Wie sehr sie diesen Kuss ersehnt hatte.
Hand in Hand gingen sie zum Ufer. Tamme legte seinen Studentenkittel auf den Stein, bevor sie sich setzten. Der Stein war zum Sitzen gerade groß genug für zwei – wenn sie sich eng aneinanderdrückten. Den Verlobten kam das entgegen. Tamme legte einen Arm um Almuth, und gemeinsam schauten sie auf das langsam dahinziehende Wasser der Elbe. Auf dem Fluss fuhr ein Kahn vorbei. Er war hoch mit Holz beladen und wurde von zwei Treidelpferden gezogen. Sie beobachteten, wie sich die Tiere mit kräftigen, gleichmäßigen Schritten ins Geschirr legten.
»Weißt du inzwischen, wann du deine Studien beendest?«, wollte sie wissen.
»Ich könnte die Disputation jederzeit ablegen, um Assessorius zu werden und meine Studien zu beenden, sagt mein Professor. Mein Stiefvater sagt, dass er mir die Gulden für die Gebühren nicht geben kann. Das Erbe meines leiblichen Vaters hat sie nicht abgeworfen.« Tamme klang bitter.
Sein leiblicher Vater, ein vermögender Jurist, war an einer Lungenentzündung gestorben, da war sein einziger Sohn gerade einmal so alt gewesen wie Eufemia jetzt, acht Jahre. Er hatte Tamme drei verpachtete Bauerngüter überlassen. Über deren Einnahmen sprachen sie.
»In all den Jahren nicht?«, fragte Almuth. Sie hatte keine Ahnung von den Einnahmen eines Pachthofes, meinte jedoch, dass schon ein paar Gulden hätten zusammenkommen müssen.
»Es sind immerhin fünfzig Gulden. Die anschließende Feier muss ich auch bezahlen, da kommt noch einmal ein Sümmchen zusammen. Insgesamt sind es vielleicht siebzig Gulden, die ich brauche.«
»Kann dein Stiefvater es dir nicht vorstrecken? Du gibst es ihm zurück, sobald die Höfe das Geld abgeworfen haben.«
Almuth hielt das für einen vernünftigen Vorschlag, die Miene ihres Verlobten verdüsterte sich jedoch. Die zusammengepressten Lippen glichen einem Strich, und als er sprach, klang er, als bekäme er die Kiefer nur mit Mühe auseinander.
»Das will ich nicht. Es reicht, wenn er mein Erbe verwaltet, ich will ihm nichts schuldig sein. Er sagt sowieso, dass er mir das Geld nicht geben kann. Die Ausbildung meiner jüngeren Brüder in Leipzig verschlingt mehr als genug. Das Apothekenprivileg, das er vor zwei Jahren von den Mellerstedts erworben hat, ist noch nicht abbezahlt. Und die Apotheke wirft wohl nicht so viel ab, wie er sich erhofft hatte.«
Tammes Stiefvater war der Wittenberger Apotheker Georg Herkner, der zweite Mann seiner Mutter. Gemeinsam hatten sie zwei Söhne, Tammes jüngere Halbbrüder und die Lieblinge ihres Vaters. Einer studierte in Leipzig an der artistischen Fakultät, der andere besuchte dort eine Lateinschule. Für sie musste es das traditionsreiche Leipzig sein, Wittenberg war nicht gut genug.
Almuth war anderer Meinung: Je eher Tamme sein Studium beendete, desto eher konnten sie heiraten, und desto eher wäre er frei von seinem Stiefvater. Die beiden kamen ihr vor wie zwei Katzen, die um denselben heißen Brei schlichen: bestehend aus drei Bauerngütern. Georg Herkner verwaltete sie, bis Tamme sein Studium abgeschlossen hatte und sich Assessorius Iuris nennen durfte.
»Kannst du nichts gegen deinen Stiefvater unternehmen? Du bist doch in der Lage, die Höfe selbst zu verwalten.«
»Ich habe das längst geprüft, Liebes. Das Testament meines Vaters ist nicht angreifbar. Er war selbst Jurist, Doktor beider Rechte. Der zweite Mann meiner Mutter bleibt der Verwalter meines Vermögens, bis ich Assessor bin. So ist es im Testament verfügt, und so lange bin ich von Georg Herkner abhängig.«
»Siebzig Gulden stehen zwischen uns und unserem Glück«, fasste Almuth enttäuscht zusammen.
»In etwa.«
Die winzige Einschränkung tröstete sie nicht. Tatsächlich waren siebzig Gulden ein Betrag, den sie sich nicht vorstellen konnte. In ihrem ganzen Leben hatte sie noch nie mehr als vier Gulden auf einmal in der Hand gehalten. Sie hantierte mit Kupfergeld, Pfennigen und Groschen. Trotzdem wollte sie die Sache nicht auf sich beruhen lassen. »Macht dein Stiefvater dir keine Abrechnungen?«
»Dazu ist er nach dem Testament nicht verpflichtet. Außerdem muss ich von den Einkünften meines Erbes leben. Die Bücher für das Studium, die Kleidung der Gelehrten, das ist alles nicht billig.«
»Ich frage meinen Bruder. Er wird dir das Geld leihen, damit wir endlich heiraten können und er eine Esserin weniger im Haus hat.«
»So denkt Meister Gronenberg nicht über dich.«
Das stimmte. Johann hatte sich sein Leben lang um sie gekümmert und ihr nie etwas vorgerechnet. »Er vielleicht nicht. Meine Schwägerin sieht das anders. Sie meint, ich übe einen schlechten Einfluss auf Eufemia aus, weil ich sie mit Hinke-Cuno spielen lasse und die Kinder nicht bestrafe, wenn sie aus dem Topf naschen.«
»Das machst du ganz recht, ich möchte auch nicht, dass du unsere Kinder bestrafst, nur weil sie naschen.« Tamme gab ihr einen Kuss aufs Haar. »Trotzdem werde ich von deinem Bruder kein Geld nehmen. Ich will niemandem etwas schulden, das musst du verstehen.«
Sie verstand es – nicht wirklich. Männer verwandten eine Menge Stolz auf Dinge, über die Frauen nicht einmal nachdachten. Dennoch nickte Almuth.
Ihr trauriger Blick griff Tamme ans Herz. »Ich werde das Geld besorgen. Mein Stiefvater muss mir eine Abrechnung geben und das Geld, das mir zusteht.«
»Das wird er auch.« Almuth schaute ihren Verlobten an.
Tamme verspürte einen Stich im Herzen, aber er ließ sich nichts anmerken. Niemand kannte die Bestimmungen des Testaments besser als er. Solange sein Vermögen für ihn verwaltet wurde, besaß er keinerlei Rechte daran. Es stand ganz im Belieben seines Stiefvaters, wie er mit dem Geld umging und was er ihm davon gab, um ihm ein angemessenes Leben zu ermöglichen. Jeweils zu Michaelis gab Georg Herkner ihm ein flüchtig mit Zahlen beschriebenes Blatt Papier, auf dem er die Einnahmen und Ausgaben der Pachtgelder notiert hatte. Beides deckte sich in der Regel, aber ob die Rechnungen richtig waren? Er hatte keine Möglichkeit, das zu kontrollieren. Leider stand es mit dem Einvernehmen zwischen ihm und seinem Stiefvater auch nicht zum Besten, und das hatte er den Apotheker stets spüren lassen. Der ließ nun wiederum ihn seine Macht spüren, indem er sich buchstabengetreu an die Bestimmungen des Testaments hielt.
»Wir werden noch in diesem Jahr heiraten. Ich werde das Geld zusammenbekommen, und wenn ich mich als Tagelöhner verdingen muss«, bekräftigte Tamme.
»In dem Fall wird das in diesem Jahr nichts mehr«, erwiderte Almuth schlagfertig. Ihre braunen Augen lachten.
Er wollte nichts so sehr wie dieses Mädchen zu seinem Weib nehmen. Am liebsten hätte er sie sofort geheiratet, nachdem ihr Bruder sich mit der Verbindung einverstanden erklärt hatte. Johann Gronenberg verlangte allerdings von ihm, dass er seine Schwester auch standesgemäß als seine Ehefrau unterhalten könne und über ein Einkommen verfüge. Beides traf auf einen Studenten nicht zu. Wohl oder übel hatte Tamme eine Verlobungszeit bis zum Ende seines Studiums akzeptieren müssen.
Sie saßen nebeneinander auf dem Stein, die Arme umeinandergelegt, bis die Sonne im Sinken begriffen war. Nach einem letzten Kuss trennten sie sich. Im festen Vertrauen auf ihre baldige Hochzeit strebte Almuth dem Elstertor zu. Tamme sah ihr nach. Er wusste noch nicht, wie er es anstellen sollte, aber er war fest entschlossen, seine Verlobte noch in diesem Jahr zu seinem Weib zu machen.
Zwei Tage nachdem Almuth sich von Tamme in der festen Überzeugung verabschiedet hatte, bald seine Ehefrau zu sein, betrat Georg Herkner die Buchdruckerwerkstatt ihres Bruders. Der Juli verwöhnte die Wittenberger mit warmen, sonnigen Tagen, ihr zukünftiger Schwiegervater jedoch trug einen knielangen Mantel aus einem schweren dunkelbraunen Stoff. Sorgfältig über seine Schultern gebreitet, lag ein weißer Spitzenkragen. Die Arbeit seiner Frau, vermutete Almuth, denn Tammes Mutter war geschickt mit der Nadel.
Der Wittenberger Apotheker sah aus, als wäre er einer der höchsten Würdenträger der Stadt, an seinen Fingern blitzten mehrere Ringe, seine Mantelschließe bestand aus Silber und umrankte einen Bernstein. Unter seiner Kappe quollen Schweißtropfen hervor und rannen die Schläfen entlang. Herkner wischte sie mit einem Tüchlein fort, sein Gesicht war puterrot. Almuth war zwar von der Meinung ihres Verlobten beeinflusst, aber auch Herkners Eitelkeit nahm sie nicht für den Mann ein.
Sie ließ sich von ihren Gedanken nichts anmerken und schenkte ihm ein Willkommenslächeln. Sofern ihr Bruder und sein Geselle nicht im Haus waren oder in der Werkstatt viel zu tun hatten, war es ihre Aufgabe, sich um Kunden zu kümmern, die Bücher kaufen wollten. Im vorderen Teil der Werkstatt war ein Bereich abgetrennt, und dort lagen in Schränken die Stapel bedruckten Papiers. Sie mussten vom Käufer erst noch zum Buchbinder gebracht werden, um zu einem richtigen Buch mit einem ledernen Einband zu werden. Die meisten Käufer waren allerdings Studenten, sie brauchten Bücher für ihr Studium und hatten kein Geld mehr für den Buchbinder. In einem Fach lagen auch einige gebundene Bücher, die Johann Gronenberg in Zahlung genommen oder selbst hatte binden lassen, um seinen Kunden zu zeigen, wie schön seine Druckwerke aussehen konnten.
»Gott zum Gruße, Meister Herkner. Was kann ich für Euch tun? Wollt Ihr etwas drucken lassen?«
Er schaute sie forschend an, bevor er ihren Gruß erwiderte. »Ich bin gekommen, um einige Bücher zu kaufen«, sagte er hoheitsvoll. Er verschränkte die Hände vor dem Leib und sah sich um.
»Sehr gern. Sagt mir nur, was Ihr sucht.«
»Das möchte ich mit Eurem Bruder klären, Jungfer Almuth.«
»Er ist nicht da und sein Geselle auch nicht.« Es fiel Almuth nicht leicht, weiterhin ihren freundlichen Tonfall beizubehalten. Offensichtlich traute er ihr nichts zu, und das ärgerte sie. »Die beiden sind am Morgen fortgegangen und werden nicht vor dem Abend zurückkommen. Ihr müsst mit mir vorliebnehmen. Ich kenne mich mit den von meinem Bruder gedruckten Büchern so gut aus wie er selbst«, fügte sie hinzu.
»Wenn das so ist.« Herkner holte einen Zettel hervor und faltete ihn auseinander. »Ich suche eine der logischen Schriften des Aristoteles, ›De interpretatione‹. Und außerdem …«, er warf einen weiteren Blick auf seinen Zettel, »… eine griechische und eine lateinische Grammatik. Ist das vorrätig, Jungfer Almuth?«
»Die griechische Grammatik nicht. Mein Bruder druckt nicht mit griechischen Lettern. Das andere haben wir.« Sie ging zu einem der Schränke und nahm zielsicher einen mit einer Schnur zusammengebundenen Papierstapel heraus, gleich darauf einen zweiten aus einem oberen Fach, das sie gerade noch so erreichen konnte, wenn sie sich auf Zehenspitzen stellte. Dabei spürte sie die ganze Zeit Georg Herkners Blick in ihrem Rücken.
Sie legte die beiden Stapel vor ihm auf dem Tresen ab. »Das sind Aristoteles’ ›De interpretatione‹ für das Studium der Logik und eine lateinische Grammatik.« Dabei tippte sie jeweils auf das entsprechende Werk.
»Ihr beherrscht das Lateinische, Jungfer Almuth?«
»Ich, ein Weib! Wo denkt Ihr hin?«
»Aber Ihr seid sicher, mir tatsächlich ›De interpretatione‹ und eine lateinische Grammatik vorgelegt zu haben?«
»Ich kann lesen, und der Name Aristoteles steht hier auf dem Titelblatt. Da braucht es keine Lateinkenntnisse. Und hier steht Grammatikus. Was soll das sonst für ein Werk sein?« Almuth hatte die Stimme erhoben. Das Misstrauen schürte ihren Ärger.
Herkner musterte sie immer noch zweifelnd. Deshalb legte sie nach. »Ich helfe meinem Bruder seit Jahren in der Werkstatt und weiß genau, welche Bücher er vorrätig hat und wo sie liegen.«
Georg Herkner schaute sich die beiden Druckwerke genau an. Er blätterte durch die Seiten und befühlte das Papier.
»Ist alles zu Eurer Zufriedenheit?« Almuth hatte eigentlich vorgehabt, ihn nicht zu unterbrechen, aber je länger er die Bücher prüfte, desto ungeduldiger wurde sie.
Herkner fuhr mit dem Finger ein paar Zeilen entlang und las einen Absatz im Aristoteles zu Ende.
»Das sieht für mich sehr gut aus. Damit sollte mein Ältester etwas anfangen können.«
Sein Ältester war Michael Georg Herkner, Student in Leipzig. Almuth kannte ihn nur aus Tammes Erzählungen, danach war der junge Mann klug, aber auch gefühllos und bestrebt, immer und überall vorn dabei zu sein. Dabei fragte er nicht nach Sinn und Gottgefälligkeit seines Handelns, sondern nur, wie er vor seinen Freunden dastehen mochte.
»Dann ist die Grammatik wohl für Euren jüngeren Sohn, Meister Herkner?«
Dessen Name war Jakobus Georg, und er besuchte in Leipzig eine Lateinschule. Jakobus war eine jüngere Ausgabe seines Bruders, zeigte aber nach Tammes Meinung mehr Rückgrat.
»Sie haben mir beide geschrieben und um Geld für Bücher gebeten. Ich habe mir gedacht, ich schicke ihnen gleich die benötigten Werke.«
»Das wird sie sicher freuen. Soll ich Euch die Bücher einpacken?« Almuth nannte dem Apotheker den Preis und macht sich auf Verhandlungen gefasst.
»Mehr ist es nicht?« Herkner hielt seine Geldbörse ungeöffnet in der Hand.
»Nein.«
»Ihr habt Euch nicht verrechnet?«
»Ganz bestimmt nicht. Ich kann ein paar Zahlen zusammenzählen.« Nach diesen Worten presste Almuth die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen. Zweifelte Herkner erneut an ihren Fähigkeiten?
»Meine Söhne haben mir andere Summen geschrieben.«
»Bücher kosten in Leipzig eben mehr.« Sie sagte es leichthin und war sich sicher, die beiden Herkner-Söhne durchschaut zu haben.
Anders als ihr Vater, denn als er das Geld abzählte, drückte seine Miene immer noch Unglauben aus. Die Jungen hatten ihm offensichtlich höhere Summen genannt, um das restliche Geld für sich zu verbrauchen. Möglicherweise benötigten sie auch gar keine Bücher, sondern nur Geld. Es tat ihr nicht leid, ihnen nun einen Strich durch die Rechnung gemacht zu haben.
Almuth legte die Münzen in einen verschließbaren Kasten und machte für ihren Bruder eine Notiz über die verkauften Werke und das eingenommene Geld. »Erlaubt mir eine Frage, Meister Herkner. Euer Stiefsohn benötigt fünfzig Gulden, um sein Assessorexamen abzulegen. Ich kann einfach nicht glauben, dass das Geld aus seinem Vermögen nicht aufgebracht werden kann.«
»Was geht Euch das an, Jungfer Almuth?«, fuhr Herkner sie an, kaum dass sie das letzte Wort ausgesprochen hatte.
»Ich bin mit ihm verlobt.«
»Ihr versteht nichts von der Sache. Es ist kein Geld da, Tamme ist ein eitler junger Mann und verprasst alles – so sieht es nämlich aus.«
In den Beschreibungen des Apothekers erkannte Almuth Tamme nicht wieder.
»Gebt ihm doch einfach eine Abrechnung und beschwört öffentlich deren Richtigkeit, dann kann er selbst sehen, ob er zu viel Geld ausgibt oder nicht.«
»Das werde ich nicht tun«, giftete Georg Herkner. Speicheltröpfchen sprühten von seinen Lippen. Almuth trat hastig einen Schritt zurück. »Das geht Euch alles nichts an, vorlautes Weib!«
Georg Herkner lief nun der Schweiß in zwei Bächen die Schläfen herunter. Gleichzeitig sah er sie an wie ein Wolf, der sich auf sein Opfer stürzen und ihm die Kehle herausreißen wollte. Er raffte die gekauften Bücher vom Tisch und stürmte aus dem Laden. Almuth atmete auf, als die Tür hinter ihm ins Schloss krachte.
Sie biss sich auf die Lippe. Hätte sie bloß den Mund gehalten, denn einen Gefallen hatte sie Tamme gerade wohl nicht getan.
Kapitel 3
Der Geldkasten war so schwer gewesen, dass ihn zwei Knechte tragen mussten. Von den beiden Männern, die nicht einmal beim Scheißen von Tetzels Seite wichen, griff außerdem der lange dünne zu. Friedrich Boethius und Ferdinand Naber hießen die beiden, er nannte sie nur Feist und Frech. Boethius schob einen mächtigen Brustkasten über einem noch mächtigeren Bauch vor sich her, und Naber wusste nie, wann er besser das Maul halten sollte. Die beiden nannten sich Kommissare der Augsburger Kaufmannsfamilie Fugger. Für ihn waren sie nur Aufpasser, die ihm auf die Finger sahen, dass auch genügend Geld in den Ablasskasten wanderte. Die Ablassgroschen standen weder ihm zu, obwohl er ihn predigte, noch dem Erzbischof von Mainz und Magdeburg, in dessen Namen er ihn verkündete, sondern den bayerischen Pfeffersäcken. Sie hatten dem Erzbischof Geld geliehen, und mit den Einnahmen aus dem Ablass musste er nun die Schulden begleichen.
Tetzel folgte den Männern aus der Kirche St. Wenzel in Naumburg in das nahegelegene Haus des Doktors beider Rechte, Peter Klumpe. Die Truhe schleppten sie in seine Schlafkammer und ketteten sie an der Wand an. Sie selbst war mit drei Schlössern verschlossen, und er, Feist und Frech verwahrten je einen Schlüssel. Niemand sollte in Versuchung geführt werden.
Feist verwahrte außerdem die Bücher, in denen aufgezeichnet war, was die Leute in den Kasten geworfen hatten und wie viele Jahre im Fegefeuer ihnen dafür erlassen wurden. Er selbst predigte den Ablass, und Frech achtete darauf, dass niemand die Kirche verließ, ohne einen Ablassbrief zu erwerben. Nur wenige verschlossen ihre Herzen und ihre Geldbeutel.
Nachdem sie die Truhe angekettet hatten, gingen Feist und Frech in die gute Stube, wo ein gedeckter Tisch, nicht aber der Hausherr auf sie wartete. Die Knechte verschwanden in ihrer Kammer über dem Stall. Tetzel verschloss sorgfältig die Tür seiner Schlafkammer und folgte Feist und Frech in die Stube. Der Hausherr hielt sich nicht in der Stadt auf, betrachtete es aber als Ehre, dem Dominikanermönch und seinen Begleitern sein Haus zur Verfügung zu stellen. Tetzel wäre es andersherum lieber gewesen: Feist und Frech hielten sich nicht in der Stadt auf, dafür aber der gute Notarius, mit dem er einen Abend in gelehrtem Gespräch hätte verbringen können.
Während er den gedeckten Tisch in der Stube betrachtete, kommentierte Frech sofort, was auf Platten und in Schüsseln auf dem Tisch angerichtet stand. Er tippte mit einem Finger auf die Äpfel und fand sie zu hart, bei der Fischpastete fragte er sich, ob sie aus Hecht oder Forelle bestand und ob sie mit genügend Pfeffer gewürzt war. Er war noch nicht fertig mit seinen Betrachtungen über das Essen, als Tetzel längst saß und sich ein Hühnchen und eine dicke Scheibe Brot auf seinen Teller gelegt hatte. Dann füllte er sich eine Schale mit Suppe.
Die Krüge mit Wein und Bier standen außerhalb von Tetzels Reichweite, und eben wollte er Feist bitten, ihm von dem guten Rebensaft einzuschenken, als der Mann sich räusperte. Feist zog mehrere Papiere unter seinem Wams hervor und breitete sie neben seinem Teller aus. Sie enthielten Listen. Es sah ganz so aus, als würden sie erst zum Essen kommen, wenn alles kalt war. Wehmütig betrachtete Tetzel das Hühnchen vor sich.
»Die Einnahmen sind nicht das, was wir erwartet haben«, sagte er und stieß mit seinem dicken linken Zeigefinger auf die Listen.
Der gesamte Satz ärgerte Tetzel, aber am meisten regte er sich über das ›wir‹ auf. Feist meinte damit nicht etwa Albrecht von Brandenburg, den Bruder des Kurfürsten von Brandenburg und Erzbischof von Mainz und Magdeburg, in dessen Namen er den Ablass predigte, oder den Heiligen Vater in Rom. Er meinte die Augsburger, die nur ihr Geld, aber nicht das Seelenheil der Gläubigen interessierte. Deshalb musste er sich das Gerede über Geld anhören, obwohl er den beiden am liebsten einen Tritt in den Hintern versetzt hätte.
Feist erwartete keine Antwort, sondern redete gleich weiter: »Eure Überzeugungskraft lässt nach, Meister Tetzel. Ihr müsst den Leuten mehr von den Qualen des Fegefeuers erzählen, damit sie nicht nur für sich, sondern auch für ihre verstorbenen Verwandten den Ablass kaufen. Welche liebende Mutter, welcher Vater kann es ertragen, dass sein frühverstorbenes Kind auf Jahre hinaus in den Feuern der Vorhölle schmoren muss?«
»Wie viel Geld haben wir diesmal eingenommen?«, wollte Frech wissen und biss ein großes Stück von einer Fischpastete ab. »Hecht«, kommentierte er.
Feist fuhr mit dem Finger die Liste entlang bis ganz nach unten auf dem Blatt und drehte es dann um. Auf der nächsten Seite verfuhr er genauso. »An diesem Tag waren es keine vierhundert Gulden. Das deckt kaum die Zinsen. Insgesamt liegen erst einundzwanzigtausend Gulden im Kasten.«
Von der Tageseinnahme waren drei Gulden abzuziehen. Diesen Betrag hatte Tetzel nach seiner Predigt selbst als erster in den Kasten geworfen und einen Ablass erworben. ›Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt‹, pflegte er dazu zu sagen, und nichts heizte das fromme Bedürfnis der Menschen nach Vergebung ihrer Sünden so sehr an wie diese Geste.
Normalerweise.
An diesem Tag, er hatte es selbst bemerkt, waren nicht so viele Menschen nach St. Wenzel gekommen, wie er es aus anderen Städten gewohnt war. »Wir bleiben noch bis zum Wochenende in Naumburg. Dann werden sie alle kommen, die Handwerker und Krämer und schließlich auch die Stadtväter. Der Kasten wird das Geld nicht fassen, Ihr werdet sehen.«
»Ich nehme Euch beim Wort, Meister Tetzel.«
Der eine war so schlimm wie der andere. Er könnte sie auch beide Frech nennen. Tetzel schnaubte. Solche Bemerkungen waren einer Antwort nicht würdig, er begann zu essen.
Kalt – wie er erwartet hatte. Auf der Suppe schwammen geronnene Fettaugen. Er schlürfte sie und wischte die Schale mit einem Stück Brot aus, bevor er sich dem Hühnchen widmete.
Das Essen zog sich hin. Feist machte seinem Namen dabei alle Ehre; er aß zwar nicht schnell, aber dafür gründlich und beendete das Mahl erst, als nur noch Reste übrig waren. Der dürre Frech hörte selbst beim Essen nicht auf zu reden und bekam deshalb weniger ab. Tetzel erinnerte sich an kein einziges der vielen Worte, und das lag auch an den mehreren Krügen Rheinwein, die die alte Magd des guten Notarius ihnen servierte.
»Es gibt reiche Städte, ganz hier in der Nähe. In ihnen könnten wir den Kasten so sehr füllen, dass wir bald einen zweiten bräuchten«, sagte Frech auf einmal. Der Wein hatte seine Zunge schwer und die Sprache undeutlich werden lassen.
Sein Kumpan hob den Kopf. »Welche sollen das sein?«
»Altenburg.«
»Und welche noch?«
»Torgau.«
»Aha.«
»Wittenberg weiter im Norden.«
»Die liegen alle in Kursachsen«, warf Feist ein. »Da können wir nicht hin. Der Kurfürst hat es verboten.«
»Was für ein gottloser Mann«, rief Frech.
»Das stimmt nicht.« Tetzel schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, traf jedoch den Tellerrand, und Hühnerknochen flogen durch den Raum. »Er hat mehr Reliquien als die meisten anderen zusammengetragen.«
»Und deswegen erlaubt er nicht den Ablass?« Feist knallte seinen Becher auf den Tisch. »Deswegen lässt er Euch nicht predigen.« Seine Aussprache war ebenfalls verwaschen. »Die Leute sollen zahlen, um vor seinen eigenen Reliquien zu beten.«
»Das ist eben so.«
»Ärgert Euch das nicht?«
»Ich nehme das Leben demütig hin, wie es mir geschenkt wurde.« Tetzel senkte bescheiden den Kopf.
»Wollt Ihr nicht die Seelen im Kurfürstentum Sachsen retten?«
»Ich bin zufrieden mit dem Platz, an den Gott mich gestellt hat. Wer auch nur eine Seele errettet, hat ein gutes Werk getan.«
»Mönchsgefasel. Juckt es Euch nicht manchmal im Hintern?«, fuhr Frech mit lauter Stimme dazwischen.
»Nur beim Scheißen.«
Der hagere Mann lachte auf und schenkte allen noch eine Runde nach. »Trotzdem sollten wir in die reichen Städte gehen und auf den Kurfürsten scheißen.«
»Ich will nicht im Loch landen.«
»Als Mönch kommt man in kein Loch.« Immer noch lachte Frech.
Tetzel fragte sich, was der andere so lustig fand, während Feist trübsinnig in seinen Becher starrte.
»Man müsste es einfach machen«, sagte der langsam. »Euer Erzbischof würde Euch vor Dankbarkeit die Füße waschen.«
»Nein!«
»Doch! Natürlich könnt Ihr nicht einfach in eine Kirche gehen und den Kasten aufstellen, aber es gibt Mittel und Wege. Heimlich in der Nacht kommen, auf einem Hügel das Kreuz aufrichten. Ein paar Leuten Bescheid sagen, wie es läuft. Sie werden in Scharen kommen.«
Der Mann spinnte.
»Denkt mal darüber nach, Tetzel.«
Er meinte es ernst.
»Da gibt es nichts nachzudenken.«
»Wisst Ihr, woran das liegt?«, mischte Frech sich in das Gespräch ein.
»Was?« Feist stützte sich mit beiden Händen auf der Tischplatte ab und ließ seinen Blick über die Platten schweifen, als suchte er noch etwas zu essen. Doch mehr als abgenagte Knochen gab die Tafel nicht mehr her.
»Dass wir nicht in die reichen Städte kommen.«
»Am Verbot des Kurfürsten.«
»An dem liegt es nicht. Der hat Männer, die ihm was einflüstern. Allen voran dieser Mönch in Wittenberg. Dieser … dieser …«
»Der gegen den Ablass predigt?« Tetzel fühlte sich immer noch angenehm leicht im Kopf, dennoch begann ihn die Sache zu interessieren.
»Martin Luther heißt der«, kam es von Feist.
»Auf den soll der Kurfürst hören? Das glaube ich nicht.«
»Dieser Mönch, der ist es. Das sage ich Euch, Tetzel. Der muss weg.«
»Mönche müssen weg.« Feists Kopf pendelte hin und her, als würde er nicht mehr zu dessen Körper gehören.
»Na hört mal.«
»Der muss weg. Dieser Luder … Luther … Und der Erzbischof wird Euch jeden Tag die Füße waschen für den Rest Eures Lebens.« Frech lachte wieder. »Und das Beste ist, wir werden zwei Kästen brauchen für das ganze Geld. Oder drei oder vier.«
»Jeder Wurm hat mehr Verstand als Ihr.« Tetzel stemmte sich mühsam hoch und wankte aus der Stube. Er stieg die Treppe hinauf, und dann brauchte er eine Weile, bis er die Tür seiner Kammer entriegelt hatte.
Durch seinen Kopf trampelte eine Horde Landsknechte, und sie hatten ihn außerdem auf mindestens den dreifachen Umfang aufgeblasen und mit Steinen gefüllt. Jedenfalls schien er Tetzel zu schwer, um ihn vom Kissen zu heben. Nachdem er es endlich doch geschafft hatte und auf der Bettkante saß, trampelten die Landsknechte wie eine Horde Wildschweine. Den Kopf so ruhig wie möglich haltend, angelte er nach seinen Pantoffeln. Sein Blick fiel dabei auf den Geldkasten. Das Metall der Schlösser und der Ketten glänzte kalt. Es sah aus, als lächle ihn der Kasten böse an.
Ihm fiel das Gespräch wieder ein. Trunkenes Gefasel. Bei Nacht nach Kursachsen hineinschleichen und ein Kreuz auf einem Berg … So etwas konnte auch nur Frech einfallen.
Tetzel stemmte sich mühsam hoch, schlurfte aus der Kammer, die Treppe hinunter über den Hof zur Abfallgrube. Ein fauliger Geruch schlug ihm entgegen und ließ ihn würgen. Hastig schlug er sein Wasser ab und verließ den Hof wieder, so schnell es sein schmerzender Kopf zuließ.
Im Haus kam er an der Küchentür vorbei. Sie war nur angelehnt, und dahinter wurde mit Geschirr geklappert. An ein Frühmahl war für ihn nicht zu denken.
»Meister Boethius, Ihr habt einen gewaltigen Appetit«, hörte er die Magd sagen, die ihnen gestern Abend unzählige Male die Weinkanne nachgefüllt hatte.
»Du hast auch viel zu bieten, schönes Kind«, schnurrte Feist zweideutig. Die Magd war weder jung noch schön, aber für eine Mahlzeit sah er wohl über manchen Makel hinweg.
Tetzel wandte sich ab und wollte die Treppe hochsteigen.
»Mönchlein, schleicht Ihr da vor der Tür herum?«, rief Feist.
Der Dominikaner machte, dass er die Treppe hochkam und die Tür seiner Kammer von drinnen verriegelte. Er setzte sich an seinen Studiertisch unter dem Fenster und nestelte am Ausschnitt seiner Kutte, bis er das Lederband um seinen Hals zu fassen bekam. Daran hing sein Schlüssel für den Geldkasten. Er hielt ihn in das durch das Fenster scheinende Sonnenlicht und beobachtete, wie sich der Schatten auf der Tischplatte änderte, wenn er den Schlüssel drehte. Das Gespräch der letzten Nacht spukte wieder durch seine Gedanken.
Wie viele Gulden ließen sich verdienen, wenn man sich nachts nach Kursachsen hineinwagte? Das Risiko war vielleicht gar nicht so groß. Sie mussten ja auch nicht weit reisen – nur ein Stück hinter die Grenze, und bevor Friedrichs Büttel etwas bemerkten, wären sie längst wieder in Sicherheit.
Der Gedanke war reizvoll – oder waren das die Nachwirkungen des Weins? Jedenfalls ärgerte es ihn, dass ein weltlicher Fürst seine gottgewollte Mission behinderte, weil ein kleiner Mönch in Wittenberg Gottes Wesen besser kennen wollte als alle anderen. Mehr als ein verzweifelter Wittenberger war zu ihm gekommen, um einen Ablass zu erwerben. Sie hatten berichtet, wie sehr der Mönch um Ostern herum in seinen Predigten gegen den Ablass gewettert hatte. Teufelszeug hatte er es geschimpft! Je mehr Ablässe man erwerbe, desto sicherer lande man im Fegefeuer! Er war selbst den Einflüsterungen des Teufels erlegen, ein armer, irregeleiteter Geist. Verdammte mit seinen Reden die Seelen zu unendlichen Qualen im Fegefeuer, obwohl es doch nur einer kleinen Geste bedurfte, sie zu retten. Die List des Teufels kannte keine Grenzen.
Der Schlüssel entglitt Tetzels Hand und polterte auf die Tischplatte. Das Geräusch jagte einen Dolchstoß durch seinen Kopf. Er presste die Hände auf die Schläfen.
Man musste etwas tun, um die Seelen der Gläubigen im Kurfürstentum Sachsen zu retten, vorerst jedoch plagte ihn brennender Durst. Tetzel erhob sich ächzend, quälte sich in die weiße grobgewebte Kutte der Dominikaner und tappte erneut die Treppe hinab. Die Küchentür war nur angelehnt, und bevor er die Hand nach dem Griff ausgestreckt hatte, ertönte von drinnen ein Ruf.
»Tetzel, seid Ihr das wieder?«, rief Feist.
Durch den Türspalt war zu sehen, dass sich der Mann hinter einen Tisch gezwängt hatte. Vor ihm standen ein Laib Brot und eine Platte mit Käse und Würsten. Beidem sprach Feist wacker zu. Allein der Gedanke an Essen verursachte Tetzel einen sauren Geschmack im Mund.
»Kommt her, es schmeckt alles köstlich«, murmelte Feist mit vollen Backen.
Zum Essen ließ Tetzel sich nicht überreden, aber einen Krug angewärmtes Würzbier von der alten Magd akzeptierte er. An die Wand gelehnt blieb er stehen und schlürfte das Bier, er bemühte sich dabei, nicht genau hinzuschauen, was Feist alles in sich hineinstopfte.
»Wir machen es«, sagte er und leckte sich Bierschaum von der Oberlippe.
»Was?« Feist hielt mit dem Bissen, den er gerade zum Mund führen wollte, auf halbem Wege inne.
»Ich predige in Kursachsen den Ablass. Nachts, auf einsamen Höhen. Ganz wie Euer Begleiter es vorgeschlagen hat.«
»Trunkenes Gerede.«
»Mir tun die Menschen leid, die ohne Möglichkeit auf Vergebung im Jenseits auskommen müssen. Sie gehen einem wahrlich schweren Schicksal entgegen, denn nicht jeder kann eine weite Reise auf sich nehmen, um einen Ablass zu erwerben. Deshalb werde ich meine eigenen Sorgen hintanstellen und die Gefahr auf mich nehmen.«
Feist schüttelte den Kopf, sein Mund stand dabei offen.
»Ich werde es machen. Ihr könnt fortbleiben, wenn Ihr Euch nicht traut.«
Das überzeugte Feist. Je länger Tetzel über seinen Plan nachdachte, desto besser gefiel er ihm. Es stand einem wahren Christenmenschen gut an, seine eigene Bequemlichkeit hintanzustellen und den Bedürftigen zu helfen.
Feist und Frech standen an der Stalltür und beobachteten einen Knecht, der ein Pferd rückwärts an die Wagendeichsel heranschob. Das Tier schlug unwillig mit dem Kopf und rollte die Augen, aber sein Wille war nicht stark genug, um sich der schiebenden Hand des Knechts an seiner Brust zu widersetzen.
»Der alte Dominikaner hat doch Schneid in den Knochen. Heimlich den Ablass in Kursachsen zu predigen. Wir könnten aber mehr tun für unsere Sache«, sagte Frech. »Ich will nicht noch jahrelang auf den Straßen unterwegs sein, um Ablassgelder einzusammeln.«
Beide wussten längst, welche Spitznamen Tetzel ihnen gegeben hatte und störten sich nicht mehr daran.
»Was?«, fragte Feist nur mäßig interessiert. Gleich dem Ablassprediger gab er nicht allzu viel auf die Geistesgaben des dürren Franken. Und nach Augsburg zurück in seine leere Wohnung zog ihn nichts.
»Man muss nur dafür sorgen, dass der Ablass in Kursachsen erlaubt wird. Der gute Friedrich muss nur seine Meinung ändern.«
»Du bist wohl der Mann, um ihm das einzugeben?«
»Ich nicht.« Frech senkte die Stimme. »Er müsste dem Einfluss dieses Wittenberger Mönchs entzogen werden.«
»Lass gut sein. Wir wurden hergeschickt, um die Rückzahlung des von Jacob Fugger an den Erzbischof gegebenen Kredits zu überwachen. Etwas anderes braucht uns nicht zu kümmern.«
»Dich vielleicht nicht. Mich kümmert es schon. Ich bin mir sicher, Jacob Fugger wird meinen Einsatz zu schätzen wissen.«
Feist schwante Übles. »Was hast du gemacht?«
»Einen Brief nach Augsburg geschrieben.«
»Was steht drin?«
»Nur so eine Idee, die mir in der Nacht kam. Da trifft es sich auch richtig gut, dass der dicke Mönch heimlich in Kursachsen predigen will.«
Feist war jetzt wirklich alarmiert. »Was hast du Jacob Fugger geschrieben? Hast du den Brief noch?«
»In der Früh abgeschickt.« Frech grinste breit.
Er ließ sich nicht entlocken, was er an ihren Prinzipal geschrieben hatte.
»Jacob Fugger ist hoffentlich so klug, deinem trunkenen Gefasel nicht mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als nötig ist, um den Brief ins Feuer zu werfen«, fauchte Feist. Sicher war er sich jedoch keineswegs. Die Fugger waren nicht die mächtigste Kaufmannsfamilie nördlich der Alpen geworden, weil sie sich scheuten, neue Wege zu beschreiten, sondern gerade deswegen. Der Himmel mochte wissen, was sein Kollege angerichtet hatte.
Kapitel 4
Luther schreckte aus dem Schlaf hoch. Das Bettgestell knarrte, als er sich aufsetzte. Die Fetzen eines Traumes trieben davon. Er drückte die Handflächen gegen die Schläfen. Um ihn herum war es dunkel, bis auf einen Streifen Mondlicht, der durch den offenen Fensterladen fiel. Außer seinen eigenen Atemzügen war nichts zu hören. Obwohl er den Kopf reckte, war der Mond nicht zu sehen, aber er schätzte, dass es noch eine Weile dauerte, bis die Glocken zu den Laudes läuteten und die Nacht für die Augustinereremiten zu Ende ging.
Er schlug die dünne Decke zurück und schwang die Beine aus dem Bett. Nur im Untergewand und barfuß reckte er sich. Seine Kutte hing an einem Haken neben der Tür. Ohne hinzusehen, griff Luther danach und wollte sie sich über den Kopf streifen. In der Dunkelheit verhedderte er sich mit dem langen Gewand, war viel zu ungeduldig, es zu sortieren, und eilte schließlich mit der Kutte über dem Arm aus der Kammer.
Er begab sich in die kleine Kapelle des Klosters. Auf dem Altar brannten zwei Kerzen und spendeten warmes Licht. Vor dem Abbild des gekreuzigten Christus fiel Luther auf die Knie und faltete die Hände zum Gebet.
In der gleichen Haltung kniete er immer noch auf den Steinplatten, als es zu den Laudes läutete. Er war so in seine Gedanken versunken, dass ihn das laute Glockengeräusch aufschreckte. Die kleine Glocke der Kapelle wurde dann von den viel größeren der nahen Stadtkirche übertönt.
Das Läuten war noch nicht verklungen, als die ersten Mönche hineinschlurften und zu ihren Plätzen gingen. Es gab einiges Getuschel, als sie Luther vor dem Altar bemerkten. Er hörte es als ein fernes Rauschen. Nach einem letzten Amen erhob