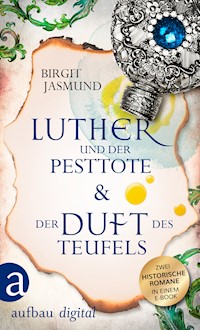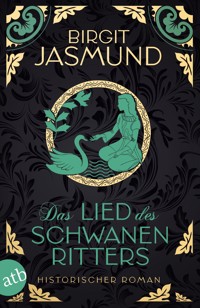
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Retelling der mittelalterlichen Lohengrin-Sage.
Nach dem Tod ihres Vaters herrscht Elsa über Brabant. Doch Graf Telramund verweigert ihr die Gefolgschaft und behauptet, der verstorbene Herzog habe ihm das Herzogtum und Elsa zur Frau versprochen. Elsa widerspricht, und König Heinrich bestimmt, dass ein Zweikampf die Entscheidung bringen soll. Unerwartet erscheint ein fremder Ritter zu Elsas Unterstützung. Sein Name ist Lohengrin. Er kämpft für Elsa, aber seine Herkunft muss für immer geheim bleiben. Ist mit ihm Elsas Zukunft als Herrscherin über Brabant gesichert?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Elsa von Brabant tritt die Nachfolge ihres Vaters auf dem herzoglichen Thron an. Doch Graf Telramund hält sich nicht an seinen Treuschwur, den er dem Herzog am Krankenbett geleistet hat. Er begehrt Elsa zur Frau und behauptet, der Herzog hätte ihm die Hand seiner Tochter und das Herzogtum versprochen. Elsa widerspricht. Doch Telramund ist in Brabant nicht ohne Anhänger und überzieht das Land mit einer Fehde. Der König ordnet einen Zweikampf an, um die Entscheidung herbeizuführen. Gegen den kampferprobten Grafen hat Elsa keine Chance, aber sie will ihren Schwur erfüllen. Die beiden stehen sich schon mit den Waffen in der Hand gegenüber, als ein unbekannter Ritter mit heruntergeklapptem Visier auftaucht und sich als ihr Kämpfer anbietet ...
Über Birgit Jasmund
Birgit Jasmund, geboren 1967, stammt aus der Nähe von Hamburg. Sie hat Rechtswissenschaften in Kiel studiert und lebt in Dresden.
Im Aufbau Taschenbuch Verlag sind ihre Romane »Die Tochter von Rungholt«, »Luther und der Pesttote«, »Der Duft des Teufels«, »Das Geheimnis der Porzellanmalerin«, »Das Geheimnis der Zuckerbäckerin«, »Das Erbe der Porzellanmalerin«, »Die Maitresse. Aufstieg und Fall der Gräfin Cosel«, »Das Geheimnis der Baumeisterin« und »Die Elbflut« lieferbar.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Birgit Jasmund
Das Lied des Schwanenritters
Historischer Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
TEIL I — Die Herzogin von Brabant in den Jahren 925 und 926 nach Christus
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Kapitel XXXIV
Kapitel XXXV
Kapitel XXXVI
Kapitel XXXVII
Kapitel XXXVIII
Kapitel XXXIX
Kapitel XL
Kapitel XLI
Kapitel XLII
Kapitel XLIII
TEIL II — Die Erben von Brabant 13 Jahre später
Kapitel XLIV
Kapitel XLV
Kapitel XLVI
Kapitel XLVII
Kapitel XLVIII
Kapitel XLIX
Kapitel L
Kapitel LI
Kapitel LII
Kapitel LIII
Kapitel LIV
Kapitel LV
Kapitel LVI
Kapitel LVII
Kapitel LVIII
Kapitel LIX
Kapitel LX
Kapitel LXI
Kapitel LXII
Kapitel LXIII
Kapitel LXIV
Kapitel LXV
Kapitel LXVI
Kapitel LXVII
Kapitel LXVIII
Kapitel LXIX
Kapitel LXX
Kapitel LXXI
Kapitel LXXII
Kapitel LXXIII
Kapitel LXXIV
Kapitel LXXV
Kapitel LXXVI
Kapitel LXXVII
Kapitel LXXVIII
Kapitel LXXIX
Epilog
Und zum Schluss
Impressum
TEIL I
Die Herzogin von Brabant in den Jahren 925 und 926 nach Christus
Kapitel I
Es gibt Herrscherinnen, und es gab sie stets. Das weiß ich aus den Lektionen mit Pater Clement. In einem Land namens Ägypten herrschte eine Königin Kleopatra, in Connacht in Irland regierte Königin Medb mit starker Hand, sie führte Krieg gegen Ulster und raubte Rinder bei ihren Nachbarn, um ihren Reichtum zu mehren. Furcht kannte sie nicht. Diese Frauen will ich mir zum Vorbild nehmen.«
Elsa stürmte aus dem Gemach ihres Vaters. Er traute ihr nicht zu, seine Nachfolgerin zu werden. Er traute ihr nicht zu, über Brabant zu herrschen. Weil sie eine Frau war. Dabei gab es niemanden, der klüger war als sie. Das hatte er selbst gesagt. Und trotzdem wollte er sie schnellstmöglich verheiraten. Und noch dazu mit Graf Telramund. Elsas Gedanken überschlugen sich. Fast hätte sie auch noch die Tür hinter sich zugeknallt, aber sie hatte sich in letzter Sekunde zusammengerissen. Ihrer Wut hätte es gutgetan, aber hätte es nicht die Ansicht ihres Vaters über sie und über Frauen im Allgemeinen untermauert? Wofür hatte sie jahrelang alles an Wissen aufgesaugt, nicht nur Lesen, Schreiben und Latein gelernt, die Bibel, Werke der Kirchenväter und römische Klassiker gelesen, um dann in Spinnstube und Wochenbett verbannt zu werden? Dabei hatte sie gehofft, er wollte etwas Ernsthaftes mit ihr besprechen, als er sie vorhin fragte, ob sie etwas Zeit für einen alten Mann habe.
Sie hatte den Korb mit dem Nähzeug beiseitegesetzt und ein Lächeln auf ihr Gesicht gebracht. Schlug ihr Vater diesen freundlich gelassenen Ton an, duldete er kein Nein. Gleichzeitig brachte er sie dazu, sich wieder wie ein Kind zu fühlen, obwohl sie bereits mehr als zwei Jahrzehnte auf Gottes Erde weilte. Seine ausgestreckte Hand ignorierend, angelte sie mit dem Fuß einen Schemel herbei und ließ sich darauf nieder.
»Für Euch immer, Vater. Ihr seid kein alter Mann, sondern steht in der Blüte Eurer Jahre.« Es kam nicht infrage, etwas anderes zu sagen, gleichzeitig fragte sie sich, was er besprechen wollte. Das Brabanter Hauswesen, dem sie vorstand, funktionierte reibungslos. Sie wusste nicht, wo sie sich etwas hatte zuschulden kommen lassen.
Der Herzog strich ihr über den Kopf. Einen Augenblick verweilte seine Hand auf ihrer linken Wange. Eine kräftige Hand, die es immer noch gewohnt war, ein Schwert zu führen. Sie spürte Geschmeidigkeit und Gesundheit im Leib ihres Vaters, der von keinerlei Leiden bedroht schien. Dieses Gefühl überfiel sie mit einer Plötzlichkeit … Elsa musste sich zusammenreißen, um nicht zurückzuzucken. Nicht nur, weil es schon wieder etwas war, das ein Vater mit seiner kleinen Tochter machte, sondern weil sie seit etwa einem Jahr bei Berührungen oft spürte, was im Körper eines Menschen vor sich ging. Schwäche, Stärke, Gesundheit oder Krankheit. Besonders schlimm war es, wenn sie bei der Berührung eines Kindes spürte, dass es den Tod in sich trug. Es war unmöglich, diesen Begegnungen auszuweichen, regelmäßig wurden ihr kleine Kinder entgegengestreckt, damit sie sie berührte und etwas von ihrem Heil als Tochter Herzog Gottfrieds auf sie überging. Eine Weigerung hätte die Leute vor den Kopf gestoßen.
Dieses Empfinden machte ihr Angst, und sie fühlte sich hilflos. Sprechen konnte sie mit niemandem darüber, denn für eine gute christliche Frau gehörte es sich nicht, Derartiges zu fühlen.
Während sie ihren Gedanken nachgehangen hatte, hatte ihr Vater offenbar weitergesprochen, denn nun blickte er sie ungeduldig an.
»Verzeiht, Vater«, murmelte sie. »Was habt Ihr gesagt?«
»Pater Clement hat dich gelobt. Er hat noch niemanden unterrichtet, der seine Lektionen schneller lernt als du«, wiederholte der Herzog und nahm seine Hand von ihrer Wange. »Dafür bin ich stolz auf dich.«
»Er übertreibt.«
»Am Hof gibt es niemanden, der weniger übertreibt als Pater Clement. Es gibt bald nichts mehr, was er dir noch beibringen kann, sagt er.«
Der Geistliche war nicht nur der Kaplan und Beichtvater des Hofes, sondern auch der Berater ihres Vaters, sein Verwalter und der Vorsteher der herzoglichen Kanzlei. Zu all diesen Aufgaben hatte er es noch übernommen, Elsa als einziges Kind des Herzogs zu unterrichten. Er hatte sie Schreiben und Lesen gelehrt, auch Rechnen und Latein, sogar ein wenig Griechisch hatte er ihr beigebracht. Sie lasen zusammen die Bibel und römische Klassiker wie Cicero oder Senecas Lehrbriefe an seinen imaginären Zögling Lucius. In der letzten Zeit führten sie viele Gespräche über theologische oder moralische Themen. Trotzdem war sie der Meinung, ein derartiges Lob nicht verdient zu haben. Es gab viele Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen sie keine Ahnung hatte. Je mehr sie lernte, desto mehr wurde ihr das bewusst.
»Doch, Elsa. Du hast ein umfassendes Wissen erworben. Bereits jetzt bist du mir eine Stütze bei den Gerichtstagen oder gegenüber den einfachen Menschen.«
»Vater, ich bitte Euch. Es ist selbstverständlich für mich, Euch zu helfen, wo ich kann.«
»Dennoch wäre es mir die größte Beruhigung, einen Ehemann an deiner Seite zu wissen. Die Linie der Brabanter Herzöge muss fortgeführt werden, dazu ist es nun einmal nötig, dass du dir einen Gatten nimmst und Kinder bekommst. Einen guten Mann, der mit dir zusammen über Brabant herrscht. Ein Mann wie Graf Telramund aus dem Valkengau.«
Darum ging es also. Sie hätte gleich daran denken sollen. Ihr Vater hatte mehrfach mit ihr darüber gesprochen, welche Beruhigung es für ihn wäre, Graf Telramund als Ehemann an ihrer Seite zu wissen. Auch Pater Clement und Simona von Kleve und Margot, aus der Sippe der Ewouldinger, beide leisteten ihr bei Hofe Gesellschaft und waren seit Kindertagen bei ihr, hielten es für ihre Pflicht, Graf Telramund zu ehelichen. Besonders Margot schilderte ihr dessen Vorzüge in den glühendsten Farben.
Der Graf war mächtig, reich, der Valkengau eine blühende Landschaft, niemand überflügelte ihn an den Waffen, nicht in Brabant und nicht sonst wo in der Christenheit. Er war hochgewachsen und der stattlichste Herr, den sich eine Edelfrau ausmalen konnte. Und ob sie sich noch nie gewünscht habe, von seinen Lippen geküsst zu werden, hatte Margot gefragt. Das hatte Elsa nicht; wenn sie von den Küssen eines Mannes träumte, war es immer ein Unbekannter, dessen Gesicht sie nicht genau erkennen konnte. Es war alles richtig, was über den Grafen gesagt wurde, aber ihr wurde kalt, wenn sie an ihn dachte. Sein Blick kam ihr stets vor, als sehe er nicht die Frau in ihr, sondern nur ein Herzogtum.
»Vater …« Sie schüttelte den Kopf.
»Du wirst eines Tages heiraten müssen.«
»Das weiß ich, und das will ich auch.«
»Also warum nicht Graf Telramund?«
»Es ist … ist …« Elsa geriet ins Stottern, weil sie nicht wusste, wie sie ihre Gefühle ausdrücken konnte, damit ihr Vater sie verstand. »Es ist nicht gerecht, dass ich nur wegen Brabants Zukunft heiraten soll und es um mich dabei gar nicht geht. Warum muss es unbedingt ein Herzog sein, wenn Brabant doch auch von einer Herzogin regiert werden könnte? Ihr habt gesagt, dass ich Euch eine Stütze bin, ich kann alles wie Ihr tun«, platzte sie schließlich heraus.
»Dir mag es nicht gerecht vorkommen, aber Gottes Wege sind für uns unerforschlich, und seine Gerechtigkeit ist mit unserem Verstand nicht zu ermessen. Fürstentümer werden von Männern regiert, das ist nun einmal so. Sie fechten auf dem Schlachtfeld, die Frauen in der Gebärstube. Meine Augen könnte ich beruhigt schließen, wüsste ich einen guten Mann an deiner Seite.«
»Vater, Ihr werdet die Augen nicht schließen, noch lange nicht.«
»Unsere Tage auf Erden sind gezählt. Alle unsere Tage. Graf Telramund hat mit mir gesprochen. Er ist bereit. Du wirst niemanden finden, der besser geeignet wäre, an deiner Seite zu regieren.«
»Vater …«
»Als dein Herzog und als dein Vater kann ich dir die Ehe befehlen. Das Recht dazu habe ich.«
Tut es doch, wollte Elsa rufen. Dann könnte ich schreien und toben, bis ich keine Kraft mehr habe und weinend auf dem Boden liege – soll es dann immer noch Graf Telramund sein, ist es so und mein Leben vorbei. Aber diese quälende Situation hätte ein Ende. Gleichzeitig fürchtete sie, dass ihr Vater genau diese Entscheidung treffen könnte, und schwieg.
»Ich will es nicht tun, weil deine Mutter und ich uns so sehr geliebt haben und ich dich dieses Glücks unter Eheleuten nicht berauben will. Hast du eine Neigung zu einem anderen Mann gefasst?«
Diese Frage hatte er ihr noch nie gestellt.
»Da gibt es niemand«, antwortete Elsa. »Darf ich mich zurückziehen, oder habt Ihr mir noch mehr zu sagen?«
»Geh, aber denke über meine Worte nach. Ich will nichts weiter als das Beste für dich und die Zukunft.«
Bevor der Herzog den Satz beendet hatte, war Elsa schon von ihrem Schemel aufgesprungen. Das Sitzmöbel polterte hinter ihr zu Boden. Sie raffte den Nähkorb an sich und verließ das Gemach.
Sie stand jetzt mit dem Rücken an die Wand gelehnt, und ihre Brust hob und senkte sich unter heftigen Atemzügen. Wut und Enttäuschung fochten eine endlose Schlacht in ihrem Inneren. Bisher hatte sie Gesprächen über eine Heirat mit Desinteresse und Schweigen begegnen können, aber das würde nicht mehr funktionieren. Ihr Vater würde es ihr nicht mehr lange durchgehen lassen. Die irische Königin Medb wäre wahrscheinlich losgeritten und hätte sich einen Mann nach ihrem Geschmack geraubt. Die Zeiten waren nicht mehr danach, und sie war nicht so wild, wie Medb es in ihrer Vorstellung gewesen sein musste. Am meisten enttäuscht war sie aber, dass ihr Vater ihr erst Hoffnungen auf eine Herzogin in Brabant gemacht hatte und sie nun meistbietend verschachern wollte. Sie würde noch anfangen zu heulen, wenn sie hier noch länger herumstand. Entschlossen stieß Elsa sich von der Wand ab und packte ihren Nähkorb fester. Eine Frau konnte nähen und Herzogin sein, und sie würde einen Weg finden, das zu beweisen.
***
Graf Telramund ballte die Hände zu Fäusten. Die Fingernägel schnitten in die Handballen. Er trat von der hölzernen Rückseite eines Wandschrankes zurück. Jedes Wort war durch die dünne Barriere zu hören gewesen.
Zunächst hatte er nur Gemurmel vernommen und war näher herangetreten, hatte das Ohr gegen das Holz gepresst. Er erkannte Elsas Stimme und die des Herzogs. Er hatte den Lauschposten schon wieder verlassen wollen, als er seinen Namen hörte. Deshalb drückte er das Ohr dichter ans Holz. Elsa sagte klar und deutlich, dass sie ihn nicht zum Manne nehmen wollte – er fühlte seine Ohren heiß werden, als hätte ihn jemand geohrfeigt. Was seit Jahren ausgemacht schien, sollte wegen der Launen eines Weibes nicht mehr gelten? Vater und Tochter sprachen über die weibliche Erbfolge; der Lauscher hörte den Namen einer Königin, die ihm nichts sagte. Nur mit Mühe unterdrückte er einen Aufschrei der Wut. Herzog Gottfried war ein schwacher Herrscher, er hatte es immer geahnt, aber nun wusste er es sicher. Dieser Mann verdiente kein Herzogtum wie Brabant, und Elsa verdiente es noch weniger.
In Gedanken sah er sie vor ihm knien und ihn anflehen, sie zu heiraten. Er hörte sie winseln und sich nach seiner Aufmerksamkeit verzehren. Brabant war längst sein, und sie wäre nichts als die Frau des Herzogs. Wenn sie regierte, dann weil er es ihr erlaubte, nicht weil es eine weibliche Erbfolge gab.
Schwierigkeiten waren dazu da, um überwunden zu werden. Nun galt es erst recht, die Hand der schönen Elsa zu erobern und sie dann spüren zu lassen, wer das Sagen hatte. Weibliche Erbfolge – lachhaft. Sie würden es bei König Heinrich versuchen, aber das konnte er auch, und dann würde sich zeigen, wessen Einfluss größer war. Er lächelte grimmig.
Leise verließ er die Kammer. Die Scham über das Gehörte brannte heiß in seinem Gemächt. Es drängte gegen die Hose und spannte den Stoff. Er brauchte ein Weib, das ihm Erleichterung verschaffte.
Kaum war dieser Gedanke in ihm aufgekeimt, kam ihm eine Magd entgegen. Ein graubrauner Kittel schlotterte um ihren mageren Leib, und sie schleppte schwer an einem Eimer. Dem Inhalt entstieg ein durchdringender Geruch. Die Magd machte ihm Platz und knickste. Im Eimer schwappte es hin und her. Telramund blieb stehen, sie schaute zu ihm auf. Ein dümmlicher Ausdruck im Gesicht, aber darauf kam es nicht an.
»Komm mit!«, verlangte er.
Sie griff wieder nach dem Eimer, den sie zuvor abgestellt hatte. Etwas vom Inhalt floss über den Rand. Einige Spritzer landeten auf ihren Holzpantinen.
»Edler Herr? Ihr wünscht?«
Der stinkende Unrat im Eimer und dass etwas davon auf ihren Schuhen gelandet war … Wer weiß, was davon an ihren Händen klebte. Sehr sauber sah sie ihm nicht aus. Graf Telramund schüttelte den Kopf.
»Mach einfach weiter deine Arbeit.« Das Verlangen nach einem Weib war ihm vergangen.
Kapitel II
Wo willst du hin?«
»Ich muss fort. Es geht nicht anders.«
»Aber warum?« Gräfin Ingalisa von Nevers lehnte den Oberkörper zurück und brachte ihren Busen zur Geltung. »Niemand hat mich in der letzten Zeit so gut unterhalten wie du. Du bist nicht nur ein begabter Erzähler aller Mären und Sagen, sondern hast dazu noch eine angenehme Stimme und ein ebensolches Äußeres.«
»Gerade deshalb muss ich fort.« Der junge Mann senkte den Kopf, bis sein blondes Haar nach vorne fiel. Seine Hände glitten leicht über die Seiten der Leier in seinem Schoß. Es waren kräftige Hände, die nicht nur ein Instrument zu spielen, sondern auch ein Schwert zu führen wussten.
»Willst du eine Jungfrau retten? Ihr edlen Herren wollt doch immer Jungfrauen retten.« Ingalisa blickte nun neckisch. Sie hatte bei dem jungen Mann ein kurzes Zusammenzucken bemerkt und wusste, dass sie mit ihrer Vermutung richtiglag. »Du kannst mich retten.«
»Wovor müsst Ihr gerettet werden, edle Dame?«
»Zum Beispiel vor einem unerträglich langweiligen Ehemann. Wenn mich seine groben Hände packen, schreie ich nur deshalb nicht, weil ich an deine geschickten Finger denke. Dass sie auf meinem Körper spielen, wie sie die Saiten der Leier zupfen.«
Er schaute weiter auf sein Instrument, aber zufrieden bemerkte sie, dass sich seine Ohren röteten.
»Ihr dürft das nicht sagen. Der Graf von Nevers ist ein guter Herr.«
»In deinen unschuldigen Augen ist jeder ein guter Herr, der einen Habenichts an seinem Tisch speisen lässt und ihm einen Strohsack zum Schlafen überlässt. Köstliche Unschuld, aber eine hochgeborene Frau wie ich ist nicht derart anspruchslos.«
»Der Graf legt Euch zu Füßen, was Euer Herz begehrt. Kleider, kostbare Geschmeide, hochblütige Zelter …«
»Er gibt mir nicht, was ich am meisten begehre: Jugend und Schönheit.«
Der Graf war mehr als zehn Jahre älter als seine Frau, und man konnte ihm vieles nachsagen, aber mit einer Narbe quer über einem Auge und zotteligem Haar war er sicherlich kein schöner Mann. Nicht einmal schamlose Schmeichler hatten das je behauptet.
»Ich kann Euch nicht helfen, edle Frau.«
»Du musst nur wollen.«
»Das ist nicht mein Weg.«
»Woher willst du das wissen?«
»Der Allmächtige …«
»Der hat nichts damit zu tun. Ich sage dir, dass er nicht einmal weiß, dass wir existieren«, fuhr Ingalisa auf. Sie wusste, dass sie ihn verloren hatte. Bereits zu Beginn des Gespräches hatte sie es geahnt, nun wusste sie es sicher. Der schönste Gefolgsmann ihres Gatten, und all ihre Künste konnten ihn nicht halten. Wäre es nicht so tragisch, sie hätte darüber lachen mögen.
Der Blonde legte die Leier weg und erhob sich von dem dreibeinigen Schemel, auf dem er bisher mehr gehockt als gesessen hatte. Er warf ihr einen kurzen Blick zu. »Ihr entschuldigt mich, edle Frau. Ich will mich von Eurem Gatten verabschieden. Er hat es mir gegenüber an nichts fehlen lassen.«
Kaum hatte sich die Tür hinter ihm geschlossen, schleuderte Ingalisa einen mit rotem Wein gefüllten Zinnpokal dagegen. Dabei stieß sie einen Schrei der Enttäuschung aus. Der Wein spritzte wie Blut überall hin, und der Pokal rollte zerbeult über den Boden.
Von Nevers hatte er sich nach Norden gewandt. Das Königreich Burgund seinen Schätzungen nach bereits hinter sich gelassen. Unterkunft und Verpflegung der letzten Tage hatten in den Beutel mit kleinen Münzen, den der Graf von Nevers ihn zum Abschied gab, ein Loch gefressen. Kaum noch der Boden war bedeckt. Er hatte Silbermünzen, vielleicht sogar goldene erwartet, aber seine Dienste waren mit Kupfer abgespeist worden.
Der letzte Kanten Brot war verzehrt, bevor die Sonne den höchsten Stand erreichte. Auf dem Bauerngut, wo er die vergangene Nacht verbrachte, hatten sie ihm geraten, immer nach Norden zu reiten, er würde vor Einbruch der Dunkelheit eine Unterkunft in einem Dorf finden, er könne es gar nicht verfehlen. Bisher aber fand er keine Anzeichen einer Ortschaft, dafür tropfte ihm Schneeregen in den Kragen und in die Stiefel. Er hätte den Helm aufsetzen sollen, statt ihn hinter sich an den Sattel zu hängen. Der hätte seinen Kopf vor dem Regen geschützt. Nun war es zu spät dafür, und den ganzen Tag am Nasenschutz des Helms vorbeizuschielen war auch nicht angenehm.
Die verschwommen blasse Sonnenscheibe kratzte am Horizont, und noch immer war keine Ortschaft in Sicht. Was hätte er für ein wärmendes Herdfeuer und für eine heiße Suppe mit gepökeltem Fleisch und ordentlich Fettaugen obendrauf gegeben. Ein Brei täte es auch. Ihm lief das Wasser im Mund zusammen.
Der Hengst unter ihm schnaubte unwillig und schüttelte die graue Mähne. Er klopfte dem Tier den Hals. Dieser Freund war ihm geblieben. Seine Treue war bedingungslos und unerschütterlich. Die rasch herabsinkende Dunkelheit hielten solche Gedanken nicht auf. Er musste zusehen, dass er einen Unterschlupf für die Nacht fand. Eine Höhle, es täte auch ein überstehender Fels oder die Krone eines dichten Baumes. Er richtete sich im Sattel auf und schaute sich um.
Wald, Wald und wieder Wald.
Die kahlen Bäume boten keinen Schutz gegen die Nässe von oben. Er könnte sein Schwert nehmen, Äste herunterhacken, sich daraus einen Unterschlupf flechten und seinen Schild als Windschutz benutzen. Neben dem Hengst waren Schwert und Schild sein kostbarster Besitz, und nach einer solchen Misshandlung wäre die Schneide unweigerlich verdorben. Ein Krieger mit einem schartigen Schwert war nur noch eine traurige Gestalt.
Schließlich hielt er unter einem Baum an, sattelte den Hengst ab und band ihn fest. Der senkte sofort den Kopf und suchte zwischen den heruntergefallenen Blättern nach etwas Schmackhaftem. Bald mahlten seine Zähne herzhaft. Das Pferd hatte es eindeutig besser als er, es konnte überall etwas zu fressen finden. Er musste sich in seinem Hunger einrichten.
Der nächste Tag unterschied sich vom vorangegangenen nur dadurch, dass das Loch in seinem Magen größer geworden war.
Etwas raschelte, und der blonde Ritter richtete sich im Sattel auf. Er spähte umher, konnte aber nichts entdecken. Der Wind war es nicht gewesen, der bewegte gerade einmal die dünnsten Zweiglein. Das Rascheln erklang erneut. Diesmal wurde dem Ritter klar, woher das Geräusch kam. Von der anderen Seite eines Busches. Dort bewegte sich etwas, als reckte sich ein Tier.
Er griff nach einem Jagdspeer, der an seinem Sattel befestigt war. Er schwang ihn in der Hand, balancierte dessen Gewicht aus. Durch das Gebüsch hindurch war nicht genau auszumachen, was sich dort aufhielt. Ein Fasan vielleicht oder ein Reh. Der Ritter nahm Maß und schleuderte den Speer. Der durchschlug den Busch.
Ein Schrei ertönte.
Kapitel III
Die Ländereien, die Elsa von ihrer Mutter geerbt hatte, waren das Peelland im Nordosten Brabants. Eine wald- und wildreiche Gegend, streckenweise morastig. Die Bewohner waren Bauern, Holzfäller und Köhler. An den Flüssen gab es Fischer. Der Reichtum des Landes wurde in Schweinen und Rindern berechnet, und fast überall gab es Gerber, die die Rinder- und Schweinehäute zu Leder verarbeiteten. Als einziger Ort verdiente Helmont die Bezeichnung Stadt. Elsa trug Überlegungen mit sich herum, den Peelländern mit der Herstellung von Pergament mehr Reichtum zu verschaffen. Ihre Idee war bisher überall auf Misstrauen gestoßen – auch bei den Peelländern selbst.
Zwei- bis dreimal im Jahr besuchte Elsa das Peelland, sprach Recht und kümmerte sich um die Menschen, ganz so wie es als Herzogin ihre Aufgabe für ganz Brabant wäre und wie sie es seit Jahren tat, ohne dass Pater Clement ihr als Berater zur Seite stand. Das erste Mal kam sie im zeitigen Frühjahr, um sich davon zu überzeugen, dass ihre Peelländer den Winter gut überstanden hatten. Es war ihr hauptsächlich darum zu tun, Kranken und Hungernden Linderung zu verschaffen.
Diesmal begleitete sie Graf Telramund. Er hatte sich angeboten, mit seinen Männern für ihren Schutz zu sorgen, und ihr Vater hatte freudig zugestimmt. Sie war nicht mehr gefragt worden. Beim Aufbruch hatte sie deshalb keine Szene machen wollen, aber unterwegs gab sie ihm meist einsilbige Antworten und trachtete danach, immer einen gewissen Abstand zwischen ihm und sich zu halten. Letzteres war nicht einfach, denn Graf Telramund drängte sein Pferd immer wieder neben ihres und plauderte ungewöhnlich redselig über das Wetter und andere Nichtigkeiten. Sie nahm sich fest vor, sich auf ihrer nächsten Reise von Herrn Lothar aus der herzoglichen Leibwache begleiten zu lassen und dies mit ihm rechtzeitig vorher abzusprechen. Ihr Vater sollte sie nicht noch einmal mit Graf Telramund als Begleiter überraschen können.
In Helmont war vor einem Haus eine Frau an einen Pfahl gebunden. Zwei lange Zöpfe verrieten die Slawin. Ihr Gewand lag zerrissen zu ihren Füßen, und auf ihrem Rücken überkreuzten sich blutige Striemen. Blut lief auch an ihren Beinen hinunter.
Elsa zügelte ihr Pferd. Bevor jemand etwas sagen konnte, war sie abgesessen und stürmte auf das Haus zu. Dem äußeren Anschein nach handelte es sich bei dem aus Lehm und Holz errichteten Gebäude um das eines wohlhabenden Bauern oder Handwerkers. Ohne anzuklopfen, riss sie Tür auf. Die quietschte in ihren Lederangeln.
Ein magerer Mann, einen Kopf größer als sie, erschien vor Elsa. Er sah erschrocken aus. Sie kannte ihn, auch wenn ihr sein Name im Moment nicht einfiel, aber er war kein Bauer, sondern ein Lederhändler.
»Frau Elsa«, sagte er völlig überrumpelt und verneigte sich linkisch. »Ich fühle mich geehrt, Euch in meinem Haus begrüßen zu dürfen. Darf ich Euch eine Erfrischung anbieten oder eine warme Suppe?«
»Nichts davon. Ich verlange zu erfahren, was mit der Frau an dem Pfahl draußen ist. Das ist doch deine Sklavin?«
»Sie hat eine Bestrafung verdient.«
»Was hat sie sich zuschulden kommen lassen?«
Inzwischen standen sie neben dem Pfahl. Die Haut der Slawin schimmerte fahl im Winterlicht, ihre Lippen waren blau angelaufen. Sie musste frieren und Schmerzen leiden, aber ihr Augen funkelten wie die eines in die Enge getriebenen Tieres.
»Das Heidenweib.« Der Händler spuckte aus.
In diesem Moment fiel Elsa ein, dass der Mann Hunold hieß. Er war mehrfach bei Hofe gewesen, hatte mit Leder gehandelt und die Gerichtstage besucht. Vor Jahren hatte er einen Prozess gegen einen anderen Händler geführt, aber welches Urteil gesprochen worden war, erinnerte sie nicht mehr. Sie war damals noch ein Mädchen gewesen, das mit Puppen spielte, die Gerichtsbarkeit im Peelland hatte ihr Vater für sie ausgeübt.
»Ich bin Christin«, widersprach die Slawin in Elsas Gedanken hinein.
Die meisten slawischen Sklaven, die den Glauben ihrer Herren annahmen, hofften, damit ihr Los zu erleichtern. Bei einigen mochte sich das bewahrheiten, bei dieser Frau offensichtlich nicht.
»Ich kann das Credo und das Paternoster aufsagen«, beharrte die Frau. »Auch kenne ich die zehn Gebote und die Geschichte des Herrn Jesus.«
Ob sie nun aus Überzeugung oder aus Opportunismus Christin geworden war, auf jeden Fall beeindruckte ihre stolze Haltung Elsa. Sie hob das zerrissene Gewand auf und wollte die Blöße der Slawin bedecken, so gut es sich bewerkstelligen ließ. Der Fetzen taugte jedoch nur noch als Putzlumpen, deshalb nahm Elsa ihren eigenen Umhang und legte ihn der Gefesselten um die Schultern. Sofort biss sie kalter Wind in Schultern und Leib.
»Auf deren Lug und Trug falle ich nicht herein«, geiferte Hunold. »Sie verdirbt mir die Kinder.«
»Was hat sie getan?«
»Erzählt ihnen Geschichten von einem Schwanenkämpfer. Ein unbesiegbarer Krieger, auf dessen Schild das Abbild eines Schwanes prangt. Er steht edlen Jungfrauen in Nöten bei und eilt dazu auf einem von Schwänen gezogenen Nachen herbei. So ein Quatsch.«
Elsa kannte die Geschichten auch. Sie wurden landauf und landab erzählt, und manchmal wurde das Boot des Schwanenritters von den Tieren auch durch die Lüfte gezogen.
»Die Jungen sollen bei meinen Geschäften helfen, der Älteste sie einst übernehmen, aber jetzt stehlen sie sich zu jeder Tageszeit weg, um im Wald mit Stöcken herumzufuchteln, von denen sie behaupten, es wären ihre Schwerter. Die Mädchen kämmen den ganzen Tag ihr Haar und wollen gerettet werden«, pestete Hunold. »Das ist alles die Schuld von der da.«
Hinter Elsa erklang ein Schnauben von Graf Telramund, und auch sie musste an sich halten, um nicht zu grinsen. Es war nichts als Unfug, den Hunold da von sich gab, aber für die Slawin war es bitterernst.
»Die Kinder wollen diese Geschichte hören«, verteidigte sie sich. »Ich erzähle sie den Mädchen beim Kochen oder Spinnen. Die Jungen haben sie nur deshalb gehört, weil sie um die Zeit der längsten Nacht alle mit Fieber darniederlagen.«
»Stimmt das?«, wollte Elsa streng wissen.
»Die Jungen waren um das Weihnachtsfest herum krank.«
»Keiner von ihnen ist gestorben, weil ich mich gut um sie gekümmert habe«, warf die Slawin ein.
»Das Leben deiner Söhne dankst du ihr auf diese Weise? Mach sie endlich los«, verlangte Elsa. »Du hörst doch, dass sie keinerlei Schuld trifft.«
»Sie gehört mir, und sie hat Strafe verdient.« Hunold schaute zu Graf Telramund, der immer noch im Sattel saß und nun mit den Schultern zuckte, als wollte er sich auf keinen Fall einmischen.
»Mein Name ist Rhuna«, sagte die Slawin so leise, dass nur Elsa sie hören konnte. »Lasst mich nicht bei diesem Menschen, ich bitte Euch. Ich stand hier schon einmal.«
»Das Weib hat keine Seele und verdient jeden Schlag und noch viel mehr.« Hunold stand in einer Mischung aus Aufmüpfigkeit und Unterwürfigkeit vor Elsa.
»Du schlägst sie oft?«
»Das muss so sein bei diesen Weibern, sonst gehorchen sie nicht.«
»Hast du noch andere Sklavinnen?«
»Nur diese.«
»Und eine Frau?«
»Die schlägt mich auch«, flüsterte Rhuna.
Jeder freie Mann konnte mit seinem Besitz verfahren, wie es ihm gutdünkte. Darunter fielen auch seine Sklaven, dennoch missfiel es Elsa, wenn eine Frau ausgepeitscht wurde und dann in winterlicher Kälte ausharren musste.
»Ich nehme sie dir ab, da du keine echte Verwendung für sie hast. Dann bist du das Problem los. Kochen, spinnen und weben kann auch deine Frau.«
Hunold und Telramund wirkten beide gleichermaßen erstaunt. Auf das Gesicht des Händlers trat ein gieriger Ausdruck.
»Sie ist mir trotz allem teuer«, beharrte er.
»In ihrem jetzigen Zustand ist sie nicht viel wert«, widersprach Elsa. »Sie wird noch tagelang keine einzige Arbeit verrichten können.«
»Das schafft sie schon.«
Es schloss sich ein erbittertes Feilschen an, an dessen Ende eine Handvoll Münzen den Besitzer wechselte und Hunold Rhuna vom Pfahl schnitt. Ihre Hände waren immer noch zusammengebunden, den Strick reichte er Elsa und verschwand nach einer erneuten Verneigung im Haus.
Elsa befreite Rhunas Hände. Die machte Anstalten, vor ihr auf die Knie zu fallen. Elsa hinderte sie daran. Der Schmerz der Slawin fuhr in ihren Leib, aber sie spürte, dass deren Lebensfaden kräftig pulsierte.
»Danke mir nicht. Du wirst dein Leben bei mir verdienen müssen«, sagte sie steif.
»Ihr werdet mit mir zufrieden sein, Herrin.« Rhuna sammelte ihr Gewand vom Boden auf und wickelte es sich unter dem Umhang um ihren spindeldürren Leib.
Auf dem Anwesen in Helmont, auf dem ihre Mutter aufgewachsen war, scherte sich Elsa nicht darum, dass Graf Telramund allein in der Halle saß und Bier trank. Sie hatte im Frauengemach einheizen lassen und wusch nun das Blut von Rhunas Rücken. Die Striemen waren zum Teil tief und mussten der Slawin heftige Schmerzen verursachen, aber sie verzog keine Miene. Unter den Wunden bemerkte Elsa ältere Narben.
Rhuna hatte also recht gehabt, dass dieser Hunold mit der Peitsche nicht sparte. Bei jeder Berührung spürte Elsa wieder den starken Lebensfaden im Leib der Slawin. Es fühlte sich so an, als wären die Wunden nicht mehr als ein Ärgernis, das schon bald vergessen wäre. Der Salbe aus Schweineschmalz, Flussschlamm und Eisenkraut bedurfte es nicht, aber Elsa rieb die Striemen trotzdem damit ein. Der Lebensfunken schien danach noch einmal heller zu werden.
Rhuna richtete sich halb auf und schaute Elsa forschend an. Die verbarg hastig die Hände im Schoß.
»Ihr seid mit einer Gabe gesegnet, Herrin.« Elsa wollte den Kopf schütteln, aber die Slawin sprach schnell weiter: »Leugnet es nicht. Bei meinem Volk war ich eine Priesterin der Makusha. Ich spüre etwas in Euch, das Euch von anderen Menschen unterscheidet.«
»Es ist ein Fluch.«
»Eine Gabe.« Rhuna ergriff Elsas Hände und küsste die Fingerspitzen. Einzeln. »Ihr seid von der Göttin berührt«, sagte sie dazu. »Aber Ihr müsst lernen, Eure Gabe zu kontrollieren, dass sie Euch nicht jedes Mal hinterrücks überfällt. Es wird schlimmer werden, wenn es Euch nicht gelingt, und eines Tages wird es Euch ganz und gar beherrschen. Dann verliert Ihr den Verstand.«
»Das ist heidnisches Zauberzeug. Davon darf eine gute Christin nichts wissen. Ich will davon nichts mehr hören.«
»Die Gabe ist in Euch, und sie ist ein Geschenk der Göttin. Ob Ihr sie wollt oder nicht«, sagte Rhuna eindringlich.
»Es gibt nur einen Gott, und du sollst keine anderen Götzen haben neben ihm«, zitierte Elsa das erste Gebot.
»Die Mutter unseres Herrn Jesus war eine Jungfrau, und trotzdem hat sie ihn geboren. Ein Zeichen ungezügelter Fruchtbarkeit. Mutter Maria, oder wie Ihr sie nennen wollt. Die Götter haben vielerlei Namen und Gestalt. Ihr habt mir Gutes getan, und ich möchte etwas zurückgeben. Ihr solltet unter Eurer Gabe nicht leiden, aber ich werde Euch dienen, wie Ihr es verlangt.« Rhuna erhob sich vollends von dem Lager, auf dem sie zuerst bäuchlings und dann halb aufgerichtet gelegen hatte.
Die Bewegungen mussten ihr Schmerzen bereiten, aber sie zeigte es nicht, sondern schlüpfte in das Gewand, das Elsa für sie herausgesucht hatte. Das älteste und einfachste Kleid, das sie für diese Reise ins Peelland mitgenommen hatte. Rhuna griff nach der Schüssel mit dem blutigen Wasser und trug sie hinaus.
An diesem Abend bekam Elsa ihre neue Sklavin nicht mehr zu Gesicht, aber am nächsten Morgen brachte Rhuna ihr eine Schale Grütze mit getrockneten Apfelschnitzen und einen Becher kuhwarme Milch ans Bett. Sie meldete, alles sei zum Aufbruch bereit, wenn die Herrin mit dem Frühstück fertig sei.
Kapitel IV
Nach dem unmenschlichen Todesschrei war ein Zischen zu hören gewesen. Dem blonden Mann rieselte es kalt den Nacken herunter. Er brach durch den Busch, um zu sehen, was er getroffen hatte. Dornen kratzten über sein Gesicht, rissen an seiner Kleidung. Auf der anderen Seite zitterte der Spieß noch von der Wucht, mit der er in den Körper eingeschlagen war.
Blutverschmierte weiße Federn. Ein schlanker Hals, ein geöffneter Schnabel im Schlamm und das Auge gebrochen. Sein Jagdspieß steckte in einem Schwan.
Er zog den Speer heraus und schleuderte ihn fort. Er sank auf die Knie und streichelte die schmutzigen Federn. »Das habe ich nicht gewusst. Herr im Himmel, verzeih mir. Wenn ich das geahnt hätte …«, murmelte er mit tränenreicher Stimme.
Der Schwan war sein Wappentier. Seine Reinheit und Majestät sollten ihm Vorbild und Mahnung sein, die ritterlichen Tugenden nicht nur in Worten, sondern auch in Taten zu führen. Beschützer der Witwen und Waisen zu sein und sich jeder Ungerechtigkeit entgegenzustellen. Dessen Bildnis war auf seinen Schild gemalt. Er war der Ritter vom Schwan. Er hatte das Tier getötet, das seinem Herzen am nächsten stand, weil er die Bedürfnisse seines Körpers nicht beherrschen konnte. Weil er hungrig auf fleischliche Nahrung gewesen war. Er war seines Wappens und seines Namens nicht mehr würdig. Die Tränen strömten ungehindert über seine Wangen. Unterdessen saugten sich die Federn mit Schlamm voll, und der Schwan sah schon gar nicht mehr aus, als hätte er vor weniger als einer Stunde noch gelebt.
Ein Fauchen ließ den Trauernden herumfahren. Ein zweiter Schwan kam flügelschlagend auf ihn zu. Sein Kopf zuckte vor, der Mann wich zurück, die Arme abwehrend erhoben. Neben seinem toten Partner blieb der Schwan stehen, fuhr mit dem Schnabel zärtlich durch das Gefieder und zischte, als wollte er ihn bitten, doch wieder aufzustehen. Dem Blonden schossen erneut Tränen in die Augen, und er schämte sich ihrer nicht. Der zweite Schwan stocherte mit dem Schnabel im stumpfen Gefieder seines toten Gefährten herum.
»Jesus, Maria und Joseph.« Er faltete die Hände.
Der Tag neigte sich dem Ende zu, und der blonde Krieger kniete immer noch auf der Erde. Die Feuchtigkeit hatte längst seine Hosen durchdrungen. Es war der letzte Dienst, den er seinem Wappentier noch erweisen konnte: Eine Nacht neben dem toten Leib zu wachen. Tiere hatten keine Seele, nicht wie die Menschen, aber er war überzeugt, dass es auch etwas an ihnen gab, dass unsterblich war und in den Himmel kam. Nicht umsonst hatte Noah auf seiner Arche von jedem Tier ein Paar gerettet.
Der zweite Schwan stand einer Statue gleich neben seinem toten Partner. Er hatte sich nicht einmal gerührt, als der Mann näher getreten war. Sie wachten zusammen. Seit Stunden, und sie hatten noch Stunden vor sich.
Langsam senkte sich die Nacht herab. Die Stille des Waldes wurde nur unterbrochen von den Geräuschen kleiner Nachttiere. Der Mann spürte seine Beine nicht mehr, die Kälte auch nicht. Es war, als hätte er keinen Körper. Nur sein Geist existierte und weinte. Kein Mondlicht drang herab, nicht einmal mehr die Schwäne waren als verschwommene weiße Flecken erkennbar.
Erst die Morgendämmerung änderte das wieder. Der Schwan, den er erlegt hatte, sah aus, als wollte er langsam in die Erde einsinken. Daneben lag der andere, die Hälse übereinander und die Köpfe dicht nebeneinander.
»Nein!« Der Schrei hallte durch den morgendunstigen Wald.
Er hatte nicht nur einen Schwan getötet, sondern zwei. Weil der andere nicht ohne seinen Partner zurückbleiben wollte. Aus Kummer war er gestorben. Der Mann rutschte über den Boden, bis er neben beiden Schwänen kniete. Alle Gebete hatte er bereits gesprochen, sein Kopf war leer.
»Bei Gott, dem Allmächtigen, Jesus und dem Heiligen Geist schwöre ich, niemals wieder werde ich zur Jagd gehen oder einen Spieß auch nur berühren. Ich bin nicht länger würdig, den Schwan in meinem Wappen und meinem Namen zu führen. Auf meinem Schild und meiner Kleidung soll er nicht mehr zu sehen sein. Niemand soll meine Herkunft und meinen wahren Namen erfahren. Von jetzt an werde ich mich Lohengrin nennen, der Lothringer. Das soll mich immer an meine Schande erinnern. Ich will willig der geringste unter den Kriegern sein. So soll es sein bis an das Ende meiner Tage. Das gelobe ich, so wahr mir der Herr helfe. Sollte ich gezwungen sein, meine Tat und Abstammung preiszugeben, werde ich noch am selben Tage fortgehen und nie zurückkehren.« Er legte die Hände auf die beiden Schwanenköpfe.
Um sich immer an seinen Schwur zu erinnern, nahm er von jedem Schwan eine Feder aus dem Flügel und steckte sie unter seinen Kittel. Mit dem Dolch kratzte er die Farbe von seinem Schild, bis der Schwan nicht mehr zu sehen war, und verdeckte die Spuren mit einer Schicht feuchter Erde, bis er Farbe fand, um sie zu übermalen. Aus der Satteldecke schnitt er das Stück heraus, wo das Wappen eingestickt war. Die toten Tiere bedeckte er mit Zweigen und beschwerte sie mit Steinen. Nach einem letzten Gebet verließ er diesen Ort.
Kapitel V
Was tut Ihr da?«, wollte Elsa wissen. Sie hatte bereits eine Weile vor der halb offenen Tür gestanden und Gudmund, den jungen Gehilfen Pater Clements, beobachtet. Er hatte vor einer geöffneten Truhe gekniet und in den Papieren gesucht, die darin lagen.
Bei ihrer Frage wirbelte er herum, richtete sich auf und fuchtelte mit den Armen, als hätte ihn eine Biene gestochen. Hektische rote Flecken erschienen auf seinem Hals. Gudmund war ein Mensch, der den leiblichen Genüssen nicht abgeneigt war, und sein ohnehin rundes Gesicht wirkte feist – in wenigen Jahren wird er Hängebacken bekommen, dachte Elsa.
»Warum wühlt Ihr in Brabants Papieren herum?«, wiederholte sie ihre Frage.
»Ich habe etwas gesucht«, verteidigte sich Gudmund. Seine Stimme klang höher als gewöhnlich. Als Pater Clements Gehilfe war es nicht nur seine Pflicht, die Kapelle auszufegen, sich um die Kerzen zu kümmern und während der Messe die Liturgie zu singen, sondern auch dem Pater in der Schreibkanzlei zu helfen. Sein Tun war nicht verdächtig, aber die roten Flecken an seinem Hals und dass er vor ihr stand wie ertappt machten Elsa misstrauisch.
»Das ist offensichtlich«, erwiderte sie streng.
»Pater Clement bat mich, etwas für ihn zu holen.«
»Dann wird er Euch auch gesagt haben, wo es zu finden ist.«
Gudmund nickte. »Da war es jedoch nicht.«
»Was sollt Ihr Pater Clement bringen?«
»Die Liste mit den Bauern und der Höhe ihrer Abgaben.«
Elsa trat an ein Regal heran und nahm ein ledernes Futteral heraus. Sie hielt es Gudmund hin. »Seit eh und je wird die Liste hier drin aufbewahrt. Das hat Pater Clement sicher so gesagt.«
»Ich habe gedacht, er meint eine Ledermappe. Wahrscheinlich habe ich ihn nicht richtig verstanden. Ich danke Euch.« Er nahm das Futteral und huschte auf leisen Sohlen aus dem Raum hinaus.
Zurück blieb ein Geruch nach Schweiß und Schuldbewusstsein. Elsa trat an die offene Truhe heran. Die Unterlagen darin befanden sich in großer Unordnung. Für sie erhärtete sich der Verdacht, dass Gudmund etwas gesucht hatte, das ihn nichts anging. Die Frage war nur, worauf er es abgesehen hatte. Sie entdeckte aufgeklappte Wachstafeln, auf denen Pater Clement Entwürfe für einen Antrag an König Heinrich zur Anerkennung der weiblichen Erbfolge in Brabant festgehalten hatte. Sollte es das gewesen sein? Sie grub die Zähne in die Unterlippe, während sie die Ordnung in der Truhe wiederherstellte. Es war kein Geheimnis, dass Gudmund es streng mit den Geboten der Bibel hielt, wenn es darum ging, dass das Weib dem Manne untertan sei, weil der Herr Eva aus Adams Rippe geformt hatte. Eine Frau konnte niemals die Aufgaben eines Mannes übernehmen und über ein Herzogtum herrschen. Konnte er einen Antrag an König Heinrich hintertreiben? Elsa nahm sich vor, wachsam zu sein. Gegenwind durfte sie nicht nur aus Telramunds Richtung erwarten, sondern sie musste auf alles gefasst sein.
»Dieser Mensch ist nicht gut.« Rhuna stand in der Tür und schüttelte den Kopf.
»Wo kommst du her?«
»Von hier und dort. Wohin der Wind ein Samenkorn weht.«
Aus der Slawin wurde Elsa nicht schlau, aber über deren Arbeitseifer konnte sie sich nicht beklagen. Deshalb sagte sie nichts weiter.
»Habt Ihr über meine Worte nachgedacht? Niemand muss davon erfahren.«
»Behalte dein Heidenzeug für dich.«
Rhuna zuckte mit den Achseln, drehte sich um und verschwand. Sie besuchte regelmäßig die Messe. Konnte ihre Gebete fehlerfrei aufsagen, aber in ihrem Herzen war sie die Priesterin eines Götzen geblieben. Elsa fühlte sich von ihr angezogen und abgestoßen zur gleichen Zeit. Sie behielt Rhuna in ihrer Nähe, hatte ihr die Sorge über ihre Garderobe übertragen. Aber auf ihre Zauberei würde sie niemals hereinfallen.
***
Lohengrin ließ seinen Hengst den Weg allein suchen. Es kam ihm nicht darauf an, ob er irgendwohin gelangte und wo das war. Nicht mit dieser auf seinen Schultern lastenden Schuld. Kälte, Regen, Wind kümmerten ihn nur noch, indem er diese Unbill begrüßte. Die beiden Schwanenfedern steckten unter seinem Kettenhemd, immer wieder zog er sie heraus, strich mit den Fingern darüber. Die harten Schäfte, die der Feder Stabilität verliehen, und die fein verzahnten Fahnen auf beiden Seiten. Er hatte sie sich dicht vor die Augen gehalten und betrachtet. Das Gebilde wirkte fragil und war doch in der Lage, die Schwäne durch die Lüfte zu tragen. Bis er zwei von ihnen das Leben genommen hatte.
Der Graue hob den Kopf und schnaubte. Augenblicklich schüttelte Lohengrin seine Versunkenheit ab, er packte die Zügel fester und schaute sich aufmerksam um. Der Hengst hatte eine Witterung aufgenommen, und das konnten nur andere Pferde sein. Sie konnten Freund oder Feind bedeuten. Vorsichtiger und aufmerksamer setzte er seinen Weg fort.
Auch an seine Nase wehte jetzt der Geruch nach Pferd. Gleich darauf erblickte er einen Zaun aus in die Erde gesteckten und miteinander verflochtenen Ästen. Dahinter taten sich ein halbes Dutzend oder mehr Stuten am ersten Gras des Frühlings gütlich. Sie waren unschwer an ihren trächtigen Leibern zu erkennen. Bewacht wurden sie von einem schmalen Jungen, der für diese Jahreszeit viel zu dünn gekleidet schien. Die Stuten grasten friedlich weiter, aber eine hatte den Kopf gehoben und spähte ihm entgegen. Der Junge war ebenfalls aufmerksam geworden. Er nagte an seiner Unterlippe und wusste offenkundig nicht, ob er fliehen oder die Stuten verteidigen sollte.
»Hab keine Furcht«, rief Lohengrin ihm zu. »Ich will dir nichts tun.«
»Das schafft Ihr auch nicht, guter Herr.« Offenbar hatte der kleine Kerl sich fürs Frechsein entschieden. Er schwang einen Stecken gegen Lohengrin, der erheblich länger war als er selber.
»Sei vorsichtig damit, sonst tust du dir selbst weh«, warnte Lohengrin ihn vom Sattel herab.
»Ich kann kämpfen.«
»Das sehe ich, aber ich will mich nicht mit dir anlegen.« Ein schnelles Lächeln huschte über Lohengrins Gesicht. »Wem gehören diese Pferde?«
Der Junge setzte seinen Stab auf die Erde und stützte sich darauf. »Mir.«
»Bestimmt nicht. Jemand wie du besitzt keine solchen Pferde.«
»Meinem Herrn.«
»Wer ist das?«
»Der edle Graf Telramund, Herr über den Valkengau. Ihr befindet Euch auf seinem Land.«
»Wo ist die Burg des Grafen?«
»Weiß nicht. Ich war immer nur hier.« Der Junge zuckte mit den Schultern.
»Ist ein Eigengut des edlen Grafen in der Nähe?«
»Ein Hof. Reitet immer nur weiter, dann könnt Ihr ihn gar nicht verfehlen.«
»Ist der Graf da?«, fragte Lohengrin.
»Der kommt nur selten. Vielleicht ein Mal im Sommer.«
»Ich danke dir. Solange du die Stuten bewachst, braucht sich der Graf nicht um sie zu sorgen.«
Der Junge reckte die magere Brust stolz heraus, und Lohengrin ritt nach einem letzten Blick auf ihn weiter. Es dauerte nicht lange, bis der Hof sichtbar wurde. Er war von einer Holzpalisade umgeben, aber das Tor stand einladend offen. Dahinter herrschte geschäftiges Treiben. Unter einem Vordach hingen zwei geschlachtete Schweine und wurden ausgenommen, jemand rührte Blut in einem Kessel, Holz wurde ins Haus geschleppt, im Stall wieherte ein Pferd. Es gab keine Anzeichen des Schlendrians, der sich in Nevers eingeschlichen hatte, sobald der Graf abwesend war. Dieser Graf Telramund hatte entweder einen fähigen Verwalter oder war ein strenger Herr oder beides. Lohengrin holte tief Luft und legte eine Hand auf die Stelle, wo die Schwanenfedern ruhten.
Ein Mann kam auf ihn zu. Besser gekleidet als der Junge und auch besser genährt. Er verneigte sich vor Lohengrin und sprach ihn höflich an, fragte nach seinem Begehr und seinem Namen, mit Kennerblick betrachtete er das Pferd und lobte dessen Güte. Sich selbst stellte er als Verweser dieses Gutes dar und nannte sich Gernwardt.
Lohengrin dachte nicht daran, auf die Frage zu antworten. »Der Hof gehört Graf Telramund, hörte ich. Wo befindet sich der Valkengau, in dem der Graf der Herr ist?«
»Wir gehören zu Brabant.«
»Brabant?«, fragte Lohengrin mit gerunzelter Stirn.
»Ihr kommt hin, wenn Ihr immer weiter nach Norden reitet. Herzog Gottfried herrscht dort mit weiser Hand und Gottes Hilfe. Graf Telramund ist sein edelster Gefolgsmann.« Gernwardt klang stolz.
»Ist der Graf ein strenger Herr?«
»Er ist gerecht gegen jedermann.«
Also war er ein strenger Herr, übersetzte Lohengrin das Gesagte. »Dann ist es sicher gut, in seinen Diensten zu stehen?«, fragte er weiter.
»Er verlangt Fleiß und Gehorsam, dann ist das Leben in seinem Dienst angenehm. Seid Ihr auf der Suche nach einem Herrn?«
»Ein Quartier für die Nacht reicht mir.«
»Das könnt Ihr haben.« Gernwardt neigte den Kopf. »Für einen vornehmen Herrn auf Wanderschaft stehen Graf Telramunds Türen stets offen. Wie war noch einmal Euer Name?«
Wieder antwortete Lohengrin nicht auf diese Frage, sondern saß ab. »Ich bin mit einem einfachen Lager in der Halle zufrieden.«
»Alles, wie es Euch angemessen ist.«
Der Grauschimmel erhielt einen Platz im Stall und Lohengrin eine hastig hergerichtete Kammer für sich allein. In den Ecken lag noch Staub, aber auf dem Bett türmte sich ein halbes Dutzend Decken. Die strohgestopfte Matratze roch frisch und war weich. Es war das bequemste Quartier seit Langem. Lohengrin schlief auf dem Boden vor dem Bett. Mit der auf ihm lastenden Schuld hielt er sich nicht für würdig, in einem weichen Bett zu nächtigen.
Kapitel VI
Elsas Blick verfolgte den Flug ihres Gerfalken am Himmel. Sie erfreute sich an seinen eleganten Bewegungen. Es war ein kleineres Männchen, und sie hatte ihn Severus getauft und sich nicht daran gestört, dass ihre Freundin Margot, aus der Sippe der Ewouldinger, gesagt hatte, dann könne sie ihn auch gleich Pompeius Magnus nennen. Es bedeutete streng oder auch ernst und passte gut zu einem Falken, dem nie eine Gefühlsregung anzusehen war. Er zog seine Kreise am Himmel, und für Elsa war es auch nach Jahren noch erstaunlich, dass er immer zu ihr zurückkehrte, obwohl er nur einige Flügelschläge von der Freiheit entfernt war.
Severus legte die Flügel an und schoss im Sturzflug herab.
»Er hat etwas erspäht.« Elsa war aufgeregt. Sie saß auf einer Schimmelstute im gleichen Sitz wie die Herren, und sie trug auch eine Hose und Stiefel. Darin ließ es sich besser reiten als im Rock.
»Vielleicht ein Kaninchen?«, sagte Simona von Kleve.
»Zu groß, es wird eine Maus sein«, wies Margot sie zurecht.
Beide waren in Elsas Alter, und sie waren die einzigen Frauen der Jagdgesellschaft. Seit Jahren lebten Margot und Simona am Brabanter Hof, waren mit ihr zusammen aufgewachsen und leisteten ihr Gesellschaft.
Nachdem Severus dicht über dem Boden abgebremst hatte, stieg er wieder auf. Seine Fänge waren leer, die Beute entkommen. Er kreiste erneut.
»Er hat versagt.« Graf Telramund lenkte sein Pferd neben Elsas. Auf seiner Hand saß ein weiblicher Gerfalke und schaute sich hochmütig um. Die Weibchen waren deutlich größer als die Männchen und schwerer. Sein Arm zitterte leicht. »Bei den Falken ist es umgekehrt wie bei den Menschen. Da sind die Weibchen die besseren Jäger, weil sie Junge zu versorgen haben.«
»Bei den Menschen versorgen die Männer die Kinder?«, fragte Elsa mit Schärfe in der Stimme. Sie lenkte ihr Pferd ein paar Schritte zur Seite und benutzte eine Pfeife, um Severus zurückzurufen. Ein hoher Ton stieg auf. Elsa streckte den rechten Arm aus, ein dicker Lederschutz bedeckte die Hand und den Unterarm.
Severus stutzte im Flug, und Elsa pfiff erneut. Er kam herabgestürzt und landete auf dem Lederschutz. Ein Diener reichte ihr ein Stück Fleisch, das sie Severus zwischen die Fänge legte. Gierig riss er daran.
»Warum soll er sich etwas erjagen, wenn er nach einem Misserfolg gefüttert wird? Bei meiner ist das anders: Wenn sie keine Beute schlägt, kehrt sie hungrig in ihren Verschlag zurück.«
»Das ist der Unterschied zwischen uns.«
»Sind es nicht gerade die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die den Reiz ausmachen?« Telramund grinste breit und neigte sich zu ihr. »Ich will es Euch gern beweisen, Ihr müsst es nur zulassen. Jeder in Brabant erwartet unsere Verbindung.«
Elsa erstarrte. Solche Dreistigkeit hatte sich Graf Telramund bisher nicht herausgenommen. War er sich einig geworden mit ihrem Vater? Wie passte es dazu, dass er mit Pater Clement einen Antrag an König Heinrich zur Anerkennung der weiblichen Erbfolge vorbereitete? Sollte sie in Sicherheit gewiegt werden, derweil hinter ihrem Rücken … Ärger stieg in ihr auf, und sie warf einen schnellen Blick auf ihren Vater, der zufrieden herschaute. Elsa musste zunächst einmal mit Telramund fertigwerden. »Die Zukunft wird zeigen, was das Beste für Brabant ist«, antwortete sie schmallippig.
»Zögert nicht zu lange. Es kann schneller zu spät sein, als Ihr denkt.« Die Worte klangen wie eine Drohung, obwohl sie mit einem Lächeln im Gesicht hervorgestoßen worden waren.
Elsa hätte ihn gerne mit einer passenden Antwort auf seinen Platz verwiesen, aber ihr war ein Schreck in die Glieder gefahren und verschloss ihre Lippen.
»Willst du ihn noch mal aufsteigen lassen?«, rief ihr Vater herüber. Die übrige Jagdgesellschaft hatte sich etwas zurückgezogen, damit der Falke bei der Jagd nicht gestört wurde. Der Herzog hatte seinen Falken vor sich auf dem Sattelhorn sitzen – so wie auch noch ein halbes Dutzend anderer Edelinge.
»Ich lasse es für heute gut sein.« Sie ließ Severus auf den Arm des Knechts klettern und gab ihm auch den Lederschutz.
Die Jäger ritten weiter zu einer Stelle, wo die Tiere noch nicht durch die Anwesenheit der Falken gewarnt waren. Im zügigen Trab ging es voran. Elsa mochte die weichen Bewegungen ihrer Stute, und am besten gefiel es ihr, im Galopp über die Wege zu fliegen und sich die Haare vom Wind zerzausen zu lassen.
Sie erreichten das Ufer des Flusses Aa, und das Wasser schäumte neben ihnen mit starker Strömung. Simona von Kleve kam mit ihrer Fuchsstute an Elsas Seite geritten.
»Severus ist ein wunderbarer Falke«, sagte sie. »Er ist so viel zahmer als alle anderen.«
»Sie sind zum Jagen da und nicht, um zahm zu sein. Du hast es gehört.«
»Gib nichts darauf. Ich beneide dich jedenfalls um deinen Severus und wünschte, mein eigener Falke wäre so zahm.« Simona gehörte seit einem Jahr ein Wanderfalkenweibchen. Eine zierliche Vertreterin ihrer Art, die noch nicht mit auf die Jagd kam, sondern nur kurze Strecken frei flog, von einer Atzung zur anderen.
In einer Flusskehre ließ der Herzog anhalten. Als Erstes stieg sein eigener Falke auf und schlug nach kurzer Zeit eine Ente. Graf Telramund zwinkerte Elsa zu. »So muss das gehen.«
Elsa drängte ihre Stute zurück.
»Gebt acht, edle Frau.« Der Graf gestikulierte.
Die Schimmelstute knickte mit der Hinterhand weg. Die Uferkante brach ab, und sie rutschte ins Wasser. Vor Schreck keilte sie aus. Elsa wurde im Sattel erst nach hinten und dann nach vorn geschleudert, sie konnte sich gerade noch am Sattelhorn festhalten. Die Zügel entglitten ihren Händen. Die Stute wollte ans Ufer zurückklettern, aber es war nun steil, und sie kam nicht hoch. Dafür erfasste sie die Strömung.
Telramunds Ruf hatte alle aufmerksam werden lassen, und nun standen sie am Ufer, während Elsa versuchte, im Sattel zu bleiben. Sie war inzwischen nass bis zur Hüfte, aber sie war auch eine gute Reiterin und wusste, dass sie ihrer Angst nicht nachgeben, noch ihr Pferd in seinem Kampf gegen das Wasser behindern durfte.
»Jemand muss etwas tun!«, rief Herzog Gottfried. Er fuchtelte mit den Armen, und der Falke auf seiner Hand hielt sich nur mit Mühe. Wahrscheinlich nur deshalb, weil das Gebinde um seinen Fuß am Handschuh angebunden war.
Elsas Stute wurde vollends von der Strömung erfasst und verlor den Boden unter den Hufen. Am Ufer rührte sich niemand. Das kalte Wasser biss in ihren Leib, dass es schmerzte. Sie klammerte sich weiter am Sattel fest, obwohl sie nicht länger darin saß, sondern mitgezogen wurde. Pferde waren keine gewandten Schwimmer, und die Stute kam gegen die Strömung nicht an.
»Es muss sie jemand retten!«, rief wieder ihr Vater. »Mein einziges Kind.«
Sehen konnte sie es nicht genau, aber es fühlte sich für Elsa an, als wagte sich niemand zu ihrer Rettung in den Fluss.
»Edle Frau, haltet durch! Ich komme!« Die Stimme kam von der anderen Flussseite.
Dort entdeckte Elsa einen Reiter auf einem Grauschimmel. Er hielt etwas, was sie nicht richtig erkennen konnte. Im Galopp preschte er am Ufer entlang und überholte sie. Er zügelte sein Pferd und zwang es mit entschlossenem Schenkeldruck ins Wasser. Bis zum Bauch stand es im Fluss. Der Reiter hielt ihr einen langen Ast entgegen.
»Haltet Euch daran fest! Dann ziehe ich Euch raus!«
Elsa wollte den Kopf schütteln, aber vor Kälte war sie wie gelähmt.
»Habt Mut, dann wird alles gut«, rief wieder der Reiter.
Dann hatte sie den Stock erreicht. Elsa dachte nicht länger über das Schicksal nach, sondern griff nach dem Stecken. Sie bekam ihn zu fassen. Aber ihr Griff war schwach, lange würde sie sich nicht halten können. Der Fremde zog sie mit einem Ruck zu sich heran. Er schlang die Arme um sie, hob sie hoch, und sie lag sicher vor ihm über dem Sattel. Vom anderen Ufer klangen Rufe herüber. Er trieb den Grauschimmel ans Land zurück.
Hier setzte er Elsa vorsichtig auf den Boden, ehe er aus dem Sattel stieg. Elsa konnte sich kaum auf den Beinen halten, sie musste sich auf seinen Arm stützen. Er schlang einen Umhang um sie, dessen unteres Drittel vor Nässe schwer herunterhing.
»Mein Pferd …« Elsas Stimme zitterte.
»Weiter vorn gibt es eine Furt. Dort kann es sich aus dem Fluss retten.« Er strich ihr eine nasse Haarsträhne aus dem Gesicht.
»Da hätte auch ich mich retten können.«
»So lange konnte ich Euch nicht in der Gefahr lassen. Ihr müsst etwas trinken, aber ich habe nur schales Dünnbier in einer Schweinsblase. Das ist nicht das Richtige für eine edle Dame. Es sollte ein heißer Würzwein sein.«
»Ich nehme auch das Bier.«
Elsa trank gierig aus der Blase, die er ihr reichte, und ließ sich dann von ihm in den Sattel zurückheben. Er führte den Grauschimmel am Zügel zur Furt. Der Umhang spendete ihr eine erste Ahnung von Wärme.
Kapitel VII
An der Furt überquerten Elsa und ihr unbekannter Retter den Fluss. Ihre Stute hatte sich bereits ans Ufer gerettet. Elsa wurde von ihrem Vater in Empfang genommen. Er herzte und küsste sie.
»Mein Kind, mein einziges Kind.« Tränen tropften in seinen Bart.
Jemand entzündete ein Feuer, ein Klappstuhl wurde aufgestellt, und Graf Telramund hüllte sie in seinen wollenen, pelzverbrämten Umhang. Er führte sie zu dem Stuhl, wo sie dankbar niedersank. Dann war Margot da, umgab sie mit Fürsorglichkeit und scheuchte die Männer fort.
»Nein, lass sie … Der fremde Ritter, er hat …« Elsas Zähne klapperten so sehr, dass sie kaum ein Wort herausbrachte.
»Sie müssen trotzdem nicht alle hier herumstehen und auf dich niederstarren, als wärst du ein Wesen zwischen Engel und Teufel.«
Das entlockte Elsa ein schmales Lächeln. Aber dann war es ihr sehr recht, dass Margot und Simona sich um sie kümmerten. Sie halfen ihr, die nassen Kleidungsstücke abzulegen, und häuften noch mehr Umhänge um sie, bis Elsa unter deren Gewicht beinahe niedergedrückt wurde. Simona versorgte sie mit einem Becher heißen Weins, der ihre Kehle und ihre Hände wärmte. Das Getränk stieg ihr zu Kopf, und ihr wurde leichter ums Herz. Außer dass ihr kalt war, hatte sie weiter keinen Schaden davongetragen.
»Du kannst mein Pferd nehmen«, bot Margot an. »Ich finde schon jemanden, der mich hinter sich aufsitzen lässt.«
Daran hatte Elsa keinen Zweifel, aber sie verbot sich diesen gehässigen Gedanken sofort. Margot war eine fröhliche und angenehme Gesellschafterin, und natürlich wussten das auch die Herren. Sie spähte unter den Schichten aus Umhängen hervor zu ihrem Vater, der inmitten seiner Gefolgsleute ein Stück entfernt stand. Er unterhielt sich mit ihrem Retter. Der hatte seinen Helm abgesetzt, und blondes Haar hing ihm verschwitzt ins Gesicht. Beide hielten Becher mit Wein in den Händen.
»Ich will Euch danken für die Rettung meiner einzigen Tochter. Sie ist mein Augenstern. Die Zierde meines Herzogtums«, sagte Gottfried von Brabant erleichtert. »Wie kann ich Euch belohnen?«
»Ich verlange keine Belohnung für die Rettung einer edlen Frau. Ich habe nur meine Pflicht getan. Jeder andere wäre ebenfalls herbeigeeilt, da bin ich sicher, aber das Glück war auf meiner Seite.«
Keiner hatte auch nur einen Versuch gemacht, sein Pferd in den reißenden Fluss zu treiben. Elsa fühlte sich zu erschöpft, um auf diese Worte zu reagieren. Sie sah aber an Simonas Miene, dass dieser ähnliche Gedanken durch den Kopf gingen. Margots Gesichtsausdruck war unergründlich.
»Ich möchte Euch Euren Dienst lohnen. Das ist etwas anderes, als wenn Ihr es verlangt hättet. Sagt mir, womit ich Euch erfreuen kann, und es soll Euer sein. Ein Pferd? Eine Rüstung oder ein Diener? Ein Beutel Münzen?«
»Nichts davon«, verneinte der Blondschopf.
»Sagt mir wenigstens Euren Namen, damit ich weiß, wem ich Dank schulde. Meine Tochter wird für Euer Wohlergehen beten wollen.«
»Man nennt mich Lohengrin.«
»Aus Lothringen?«
Der Ritter zuckte mit den Schultern.
»Zögert nicht, an meinen Hof zu kommen und Eure Belohnung zu fordern, wenn Ihr eines Tages anderen Sinnes werdet.«
»Ich verkaufe nicht, was meine Pflicht ist.«
»Herr Jesus im Himmel, ist dieser Mensch dämlich«, flüsterte Margot.
»Ich nenne es ehrenhaft«, widersprach Simona.
»Übertrieben ehrenhaft.«
Elsa mahnte ihre Freundinnen zur Ruhe und schlürfte den Rest ihres Weines, ehe er kalt wurde.
»Dient Ihr einem Herrn?«, fragte Herzog Gottfried weiter.
»Ich diene nur einem Herrn.« Lohengrin zeigte dabei gen Himmel, und Margot verdrehte die Augen.
»Tretet in meinen Dienst. Für einen mutigen Mann habe ich immer Platz.« Der Stimme des Herzogs war jetzt ein Lächeln anzuhören. »Das ist keine Belohnung. Ihr werdet hart ranmüssen. Wachen, Botengänge, der Schutz meiner Bauern und Bürger, jeden Tag Leibesübungen. Fragt nur herum.«
Die anderen nickten.
»Was denkt Ihr darüber? Heimatlos umherzuziehen ist kein Leben für einen Mann wie Euch.«
Lohengrin ließ seinen Blick über das herzogliche Gefolge schweifen, betrachtete die Knechte, die in einer eigenen Gruppe die Pferde und Falken hüteten. Zuletzt glitt sein Blick über die Frauen am Feuer. Für Elsa fühlte es sich an, als bohrten sich seine Augen bis in die Tiefe ihres Geistes, ja bis in ihre Seele. Sie richtete sich gerade auf. Seit ihr Vater das letzte Mal einen fremden Herrn in Dienst genommen hatte, waren etliche Jahre vergangen. Und natürlich nicht jemanden, von dem er nicht mehr als den Namen wusste. Sie hatte aber auch noch nie von einem Fremden gerettet werden müssen.
»Ich nehme an und trete in Euren Dienst, edler Herzog von Brabant. Ich muss allerdings zwei Bedingungen stellen.«
»Nennt sie.«