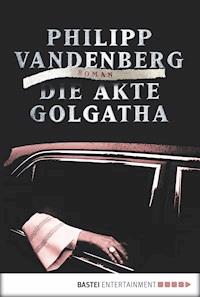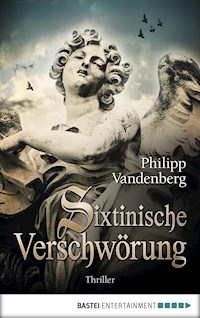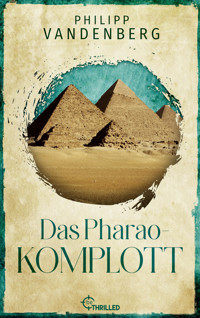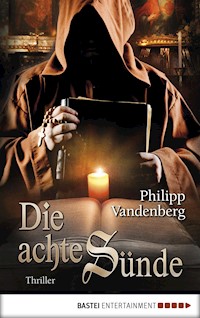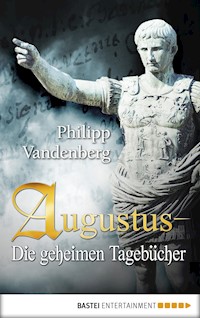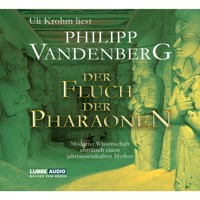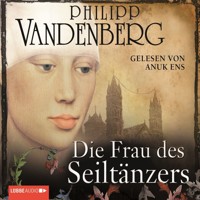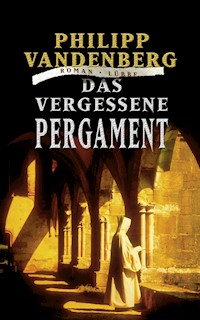4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die junge, couragierte Anne von Seydlitz ist der Verzweiflung nahe, als ihr Mann, ein Münchner Kunsthändler, bei einem mysteriösen Autounfall ums Leben kommt. Das einzige, was ihr bleibt, ist ein Film, dessen Aufnahmen alle dasselbe Motiv zeigen: ein Pergament mit einer alten koptischen Inschrift. Bald wird Anne klar, dass dieses Schriftstück ein Geheimnis birgt, denn für das Original wird ein phantastischer Preis geboten. Die Suche nach dem verschwundenen Pergament führt sie nach Paris, wo gerade ein amerikanischer Professor in die Schlagzeilen geraten ist, der einen scheinbar völlig unmotivierten Säureanschlag auf ein Bild von Leonardo da Vinci verübt hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
VORWORT
Erstes KapitelORPHEUSUND EURYDIKEtodbringend
Zweites KapitelDANTEUND LEONARDOverschlüsselte Geheimnisse
Drittes KapitelST. VINCENTDE PAULPsychiatrie
Viertes KapitelLEIBETHRAdem Wahnsinn nahe
Fünftes KapitelDAS PERGAMENTSpurensuche
Sechstes KapitelDer Pferdefuß des Teufels Indizien
Siebentes KapitelUNVERHOFFTE BEGEGNUNGEinsamkeit
Achtes KapitelDAS ATTENTATdunkle Hintermänner
Neuntes KapitelDIE VERLIESEDES INNOZENZwiederentdeckt
Zehntes KapitelVIA BAULLARI 33 zwielichtig
NACHSATZ I
NACHSATZ II
MARGINALIE
Über den Autor
Philipp Vandenberg, geboren 1941 in Breslau, landete gleich mit seinem ersten Buch einen Welterfolg: »Der Fluch der Pharaonen« war der phänomenale Auftakt zu vielen spannenden Thrillern und Sachbüchern, die oft einen archäologischen Hintergrund haben. Vandenberg zählt zu den erfolgreichsten Schriftstellern Deutschlands. Seine spannende Erzählweise und seine außerordentlichen Kenntnisse im archäologischen und kirchengeschichtlichen Bereich machten ihn zum »Meister des Vatikan-Thrillers«. Seine Bücher wurden in 33 Sprachen übersetzt. Der Autor lebt mit seiner Frau in einem tausend Jahre alten Dorf zwischen Starnberger und Tegernsee.
Philipp Vandenberg
Das fünfteEvangelium
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch vonÜbersetzer
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 1993/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Einbandgestaltung: CCG, Köln
Titelfoto: Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-5770-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Hütet euch vor dem Sauerteig, ich meine vor der Heuchelei der Pharisäer. Nichts ist verborgen, was nicht offenbar, und nichts geheim, was nicht bekannt werden wird. Darum wird alles, was ihr im Unstern gesprochen habt, am hellen Tag vernommen werden; und was ihr ins Ohr gesagt habt in Kammern, das wird verkündet werden auf den Dächern.
Lukas 12,1-3
VORWORT
In keiner Stadt, die ich kenne, gibt es so interessante Friedhöfe wie in Paris. Sie sind so ganz anders, beinahe heiter, und haben nichts Morbides oder Unheimliches an sich, wie man das von deutschen Friedhöfen gewöhnt ist. Es scheint, als pflegten die Franzosen ihre Toten einfach besser, und jedes Schulkind weiß, dass zum Beispiel Edgar Degas auf dem Montmartre beerdigt ist, Maupassant und Baudelaire hingegen auf dem Montparnasse.
Vom Boulevard de Ménilmontant gelangt man zum Cimetière du Père-Lachaise – so heißt der größte und schönste Friedhof von Paris; ein ungewöhnlicher Name, der auf Père Lachaise, den Beichtvater Ludwigs XIV., zurückgeht. Neben Edith Piaf, Jim Morrison und Simone Signoret findet man hier die Gräber von Molière, Balzac, Chopin, Bizet und Oscar Wilde. Wo, sagt einem der Gardien, der für ein paar Francs auch einen Plan bereithält.
An schönen Tagen, vor allem im Frühjahr und Herbst, pilgern viele Menschen zu den Grabstätten ihrer Idole, und dabei begegnen sich jene, die von hier den flüchtigen Eindruck des Einmalgesehenhabens mitnehmen, und jene, die regelmäßig, manche sogar täglich, hierher kommen, meist um die gleiche Zeit und mit dem gleichen Ritus kurzen Gedenkens.
Das zu bemerken setzt voraus, dass man selbst mehrere Tage zur gleichen Zeit den Cimetière du Père-Lachaise besucht – was ich tat, zunächst ohne Hintergedanken, jedenfalls gewiss nicht in der Erwartung, auf eine der aufregendsten Geschichten zu stoßen, denen ich je begegnet bin.
Am zweiten Tag schon wurde ich auf einen gut aussehenden älteren Mann vor einem Grab mit der schlichten Aufschrift »Anne 1920-1971« aufmerksam; das heißt, rückblickend war es eigentlich jene exotische orange-blaue Blume in seiner Hand, die meine Neugierde erregte, und weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass sich hinter einer außergewöhnlichen Blume oft eine außergewöhnliche Geschichte verbirgt, sah ich mich veranlasst, den Fremden einfach anzusprechen.
Mit Erstaunen nahm ich zur Kenntnis, einem Deutschen zu begegnen, der in Paris lebte; im Übrigen gab er sich aber recht zugeknöpft, beinahe abweisend, was die Bedeutung jener exotischen Blume betraf (es handelte sich um eine Paradiesvogelblume, auch Strelitzie genannt). Als sich unsere Begegnung am folgenden Tag wiederholte, verkehrte sich die Situation insofern ins Gegenteil, als nun der andere daranging, mich auszuforschen, und es dauerte lange, bis er mir glaubte, dass mich allein meine schriftstellerische Neugierde zu dieser Frage veranlasst hatte und dass es keine dunklen Hintermänner gab, die mich auf ihn angesetzt hatten.
Allein das skeptische Verhalten des Mannes gegenüber meiner harmlosen Frage bestärkte mich in der Vermutung, hinter der kleinen, alltäglichen Zeremonie im Cimetière du Père-Lachaise könnte sich weit mehr verbergen als nur eine rührende Geste. Obwohl ich mich dem anderen längst vorgestellt hatte, kannte ich seinen Namen noch immer nicht, doch ich erkannte darin kein Hindernis, ihn in mein Hotel zum Essen einzuladen – falls es seine Zeit erlaubte. Mit dieser Bemerkung erntete ich ein Lächeln und den Hinweis, ein Mann in seinem Alter habe viel Zeit, er werde kommen.
Ich muss gestehen, damals glaubte ich nicht so recht daran, dass der Fremde seine Zusage einhalten würde; ich vermutete eher, er habe nur zugesagt, um sich meiner Hartnäckigkeit zu entledigen. Umso mehr erstaunte es mich, als der Mann, wie vereinbart, im Restaurant des Grand Hotels im 9. Arrondissement, wo ich wohnte, erschien und eine uralte Illustrierte auf den Tisch legte, die sofort meine Neugierde erregte.
Als hätte er es darauf abgesehen, mich auf diese Weise auf die Folter zu spannen, was bei einem neugierigen Menschen wie mir beinahe krankhafte Zustände hervorruft, plauderte er mit Wonne (aus meiner Sicht war das purer Sadismus) über die Schönheiten von Paris, und jedes Mal, wenn ich den Versuch unternahm, das Gespräch auf das eigentliche Thema zu lenken, fiel ihm wieder eine Sehenswürdigkeit ein, deren Besichtigung sich lohne für einen Fremden. Später erst wurde mir bewusst, dass der Mann mit sich kämpfte, ob er mir seine Geschichte anvertrauen konnte oder nicht.
Schon hatte ich die Hoffnung aufgegeben, als er unvermittelt die Illustrierte zur Hand nahm, sie in der Mitte aufschlug und so über den Tisch schob mit den Worten: »Das bin ich. Oder besser: Ich war es. Oder noch besser: Ich hätte es sein sollen.« Er sah mich prüfend an.
Die Sekunden, in denen ich mich in den Illustriertenbericht vertiefte, bereiteten dem Unbekannten offensichtlich Vergnügen; ich spürte seinen Blick auf mich gerichtet und fühlte, wie er jede meiner Regungen verfolgte, als erwarte er einen Ausruf des Erstaunens. Aber nichts dergleichen geschah. Der Artikel berichtete von einem Reporter der Illustrierten, der im Algerienkrieg umgekommen war, und zeigte Fotos aus seinem Leben und das Bild eines scheußlich zugerichteten Leichnams. Ich war ziemlich ratlos.
»Sie werden das nicht begreifen«, meinte er schließlich, »es hat lange gedauert, bis ich es selbst kapiert habe. Und ganz gewiss ist das die wahnsinnigste Geschichte, die Sie je gehört haben.«
Ich erwiderte, ich sei schon mit unbegreiflichen Geschichten konfrontiert worden, das Gewöhnliche sei nur selten Sache eines Schriftstellers. Und ich verwies meinen Gast auf jenen gelähmten Mönch im Rollstuhl, der mir vor Jahren einmal seine Lebensgeschichte erzählte und mit eindringlichen Worten erklärte, warum er sich in selbstmörderischer Absicht aus einem Fenster des Vatikans gestürzt hatte. Dieses sein Leben hätte ich in meinem Buch »Sixtinische Verschwörung« beschrieben, aber noch vor dem Erscheinen des Buches sei der Gelähmte aus seinem Kloster verschwunden, und sein Abt habe standhaft behauptet, einen Mönch in einem Rollstuhl habe es in seinem Kloster nie gegeben; dabei, betonte ich, seien wir uns dort mehrere Tage gegenübergesessen.
Es wäre besser gewesen, ich hätte davon nicht berichtet; denn der Mann hatte es auf einmal eilig und meinte, er müsse, bevor er bereit sei auszupacken, sich alles noch einmal durch den Kopf gehen lassen, und wir sollten uns am folgenden Tage im Café »La Flore« am Boulevard Saint-Germain treffen, wo im Übrigen viele Schriftsteller verkehrten.
Um es vorwegzunehmen: Meinen Kaffee im »La Flore« trank ich allein, und ich muss gestehen, es überraschte mich nicht einmal. Offenbar hatte den Unbekannten angesichts der Vorstellung, sein Schicksal könnte als Buchvorlage dienen, der Mut verlassen. Das aber bestärkte mich in meiner Auffassung, dass das, was der Mann mit sich herumtrug, über das persönliche Schicksal eines einzelnen Menschen weit hinausging.
Alle großen Geheimnisse der Menschheit haben einen unscheinbaren Ursprung. Ich witterte hinter dem Schicksal des fremden Mannes ein solches Geheimnis. Dass es von so fundamentaler Bedeutung sein würde, konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, auch nicht die Tatsache, dass der Fremde mit der Papageiblume in diesem Drama nur eine Nebenrolle spielen würde. Die Hauptrolle, das sei vorweggenommen, spielte jene Frau auf dem Friedhof, von der ich nur den Vornamen kannte: Anne.
Doch ich hatte eine Spur, den Artikel in der Illustrierten. Eine Fährte führte nach München, eine zweite zurück nach Paris, dann überschlugen sich die Ereignisse in meinen Recherchen. Rom, Griechenland und San Diego waren weitere Stationen, und langsam, ganz allmählich, wurde mir klar, warum der Unbekannte Hemmungen hatte, mir seine Geschichte anzuvertrauen.
Den Friedhof habe ich noch einige Male besucht, aber dem fremden Mann bin ich nie mehr begegnet.
Erstes KapitelORPHEUSUND EURYDIKEtodbringend
1
Um sie herum war alles weiß, und als schmerzten die weißen Wände, der weiße Boden, die spiegelblanken weißen Türen und die grellen Neonröhren an der Decke, vergrub Anne ihr Gesicht in den Händen. Sie begriff gar nichts. Sie hatte nur das Wort »Koma« gehört und dass es schlecht um ihn stehe. Eine geschlechtslose Gestalt im weißen Kittel hatte sie auf diesen Stuhl gedrückt und einfühlsam wie eine Flugbegleiterin, die mit den Vorschriften für den Notfall vertraut macht, erklärt, die Ärzte täten ihr Bestes, das könne dauern, sie möge das Formular ausfüllen und unterschreiben.
Das Blatt lag neben ihr auf dem Boden. Von Zeit zu Zeit öffnete sich eine der glänzenden Türen. Gummisohlen quietschten über den langen Gang und verschwanden in einer anderen Tür. Von irgendwoher drang der Rhythmus einer stampfenden Maschine, es roch nach Carbol, und die Wärme war beinahe unerträglich.
Anne blickte auf, sie holte tief Luft, öffnete ihren dünnen Mantel, lehnte sich mit geschlossenen Augen auf dem Stuhl zurück und verschränkte die Arme. Ihre Lippen zitterten, und sie fühlte einen Schmerz, den sie nicht lokalisieren konnte; sie ahnte, dass ihr Leben auseinanderbrach, und ein Gedanke aus ihrer Kindheit kam ihr in den Sinn, wenn sie sich manchmal gewünscht hatte, ein Zauberspruch könne ein Erlebnis vergessen machen und alles sei so wie vorher.
Sie hatte nie darüber nachgedacht, wie das sein würde, wenn einem von ihnen etwas zustieße. Sie liebte Guido, und Liebe fragt nicht nach dem Ende; aber jetzt erkannte sie das Törichte dieser Haltung. Auf einen Anruf wie diesen war sie einfach nicht vorbereitet: »Es tut uns leid, wir müssen Ihnen eine traurige Mitteilung machen. Ihr Mann hatte einen schweren Unfall. Machen Sie sich auf das Schlimmste gefasst.«
Wie im Traum war Anne zum Klinikum gerast. Sie wusste nicht, auf welchem Weg sie hierher gelangt war, wo sie den Wagen geparkt hatte; unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, hatte sie zwei oder drei Weißkitteln »Intensivstation?«, entgegengerufen und war schließlich hier auf diesem grell erleuchteten Korridor gelandet, wo die Zeit endlos schien.
Sie erschrak, als sie sich dabei ertappte, wie sie in Gedanken das Haus neu einrichtete und das Antiquitätengeschäft verkaufte, wie sie den Entschluss fasste, erst einmal eine Weltreise zu machen -um Abstand zu gewinnen. Guido war nie zu einer Weltreise zu bewegen gewesen. Er hasste die Fliegerei.
Mein Gott! Anne sprang auf, sie schämte sich wegen dieser Gedanken und ging unruhig, die Hände in den Taschen ihres Mantels vergraben, auf und ab. Die lässige Geschäftigkeit, mit der Kittelträger an ihr vorbeihuschten, ohne ihr einen Blick zuzuwerfen, wirkte provozierend, und es hätte nicht viel gefehlt, und Anne wäre auf eine der geschäftigen Schwestern losgegangen und hätte sie angeschrien, es gehe um das Leben ihres Mannes, ob sie das nicht begreife.
Dazu kam es aber deshalb nicht, weil im selben Augenblick ein hagerer Mann mit verschmutzter randloser Brille aus einer Tür trat. Er nestelte, während er auf Anne zukam, an einem grünen Mundschutz, der um seinen Hals hing, dann wischte er sich mit dem Oberarm über die Stirn.
»Frau von Seydlitz?«, fragte er tonlos.
Anne fühlte, wie sich ihre Augen weiteten, wie das Blut in ihren Kopf schoss. In den Ohren pochte es. Das Gesicht des Arztes verriet keine Regung.
»Ja«, presste Anne leise hervor. Ihre Kehle war trocken und spröde.
Der Arzt stellte sich vor; aber noch während er seinen Namen nannte, änderte sich der Tonfall seiner Stimme und verfiel in den Singsang eines Leichenbestatters. Das Folgende hatte er schließlich schon viele Male von sich gegeben: »Es tut mir leid. Für Ihren Mann kam jede Hilfe zu spät. Es mag in dieser Situation ein schwacher Trost für Sie sein, wenn ich sage, es ist vielleicht besser so. Ihr Mann wäre vielleicht nie mehr zu sich gekommen. Die Schädelverletzungen waren zu schwer.«
Zwar nahm Anne noch wahr, dass der Arzt ihr die Hand reichte, aber in ihrer hilflosen Wut drehte sie sich um und ging. Tot. Zum ersten Mal begriff sie die Endgültigkeit dieses Wortes.
Im Lift roch es nach Küche wie in allen Klinikaufzügen. Angeekelt ergriff sie die Flucht, kaum dass die Aufzugtüren sich geöffnet hatten.
Nach Hause nahm sie ein Taxi. Sie war nicht in der Lage, sich selbst ans Steuer zu setzen. Dem Fahrer hielt sie wortlos einen Schein hin, dann verschwand sie im Haus. Fremd, kalt und abweisend erschien ihr auf einmal alles. Sie entledigte sich ihrer Schuhe, hastete die Treppe empor in ihr Schlafzimmer und ließ sich auf das Bett fallen. Dann endlich weinte sie.
Das geschah am 15. September 1961. Drei Tage später wurde Guido von Seydlitz auf dem Waldfriedhof beerdigt. Am Tage darauf begannen die – nennen wir es zunächst einmal – Merkwürdigkeiten.
2
Damit Anne von Seydlitz nicht von vornherein in falschem Licht erscheint, was dem wahren Gehalt der Geschichte nur abträglich wäre, muss man zunächst ein paar Worte über diese Frau verlieren. Anne Seydlitz gebrauchte nie das von ihrem Mann angeheiratete Adelsprädikat. Ihrem Mann als Kunsthändler mochte der Titel bisweilen von Nutzen sein, aber Anne machte sich eher lustig über den im 19. Jahrhundert verliehenen »Werksadel«. Damals wurden verdienstvolle Unternehmer von einem Tag auf den anderen in den Adelsstand erhoben, und dieser fragwürdige Vorgang brachte dann so kuriose Geschlechter wie das derer von Müller oder jenes derer von Meyer hervor.
Anne verfügte über genug Selbstbewusstsein, als Frau Seydlitz durchs Leben zu gehen, denn Bildung und eine herbe Schönheit hatten sich in ihr auf so faszinierende Weise verbunden, dass sie, wo immer sie auftauchte, stets gesellschaftlicher Mittelpunkt war. Wie alle, die nicht unter ihrer Klugheit leiden, sondern aus ihr Nutzen ziehen, besaß Anne Witz, und ihre Schelmereien wurden oft zum Tagesgespräch. Mit ihrem Alter von gerade vierzig Jahren kokettierte sie gerne, indem sie darauf hinwies, sie befinde sich nun im fünften Jahrzehnt.
Natürlich hatte sie der Tod ihres Mannes schwer getroffen, und sie begann gerade das Leid, das ihr unerwartet begegnet war, mit der Kraft ihres Verstandes zu verarbeiten, als die Klinik anrief, sie möge die letzten Habseligkeiten ihres Mannes abholen.
Obwohl es ihr nicht leichtfiel, kam Anne der Aufforderung noch am selben Tag nach. Eine Schwester übergab ihr gegen Quittung einen verschweißten Plastiksack, der neben Guidos Kleidungsstücken seine Uhr und Brieftasche enthielt. Dabei erfuhr sie eher beiläufig, dass Guido zur Zeit des Unfalles nicht allein im Auto gesessen habe. »Die Beifahrerin hat nur leichte Verletzungen davongetragen, man hat sie heute entlassen.«
»Beifahrerin?«
Anne von Seydlitz zog ihre Stirn in Falten, ein untrügliches Kennzeichen für ihre innere Erregtheit.
Die Schwester zeigte sich erstaunt, dass Frau von Seydlitz von der Beifahrerin nichts gewusst haben sollte, ja sie wurde sogar misstrauisch und bat, bevor sie den Namen bekannt gab, den Oberarzt um Rat. Anne erkannte in ihm den Arzt, der ihr die Todesnachricht überbracht hatte, und sie hielt es für angebracht, sich für ihr Verhalten zu entschuldigen.
Der Doktor nannte ihr Verhalten in Anbetracht der Umstände nicht außergewöhnlich, er bezeichnete es sogar als ziemlich normal, dennoch gelang es Anne erst nach zähen Verhandlungen, Namen und Adresse der Beifahrerin ihres Mannes zu erfahren.
Sie kannte die Frau nicht. Es ging ihr zunächst auch nur darum, mehr über die Umstände des Unfalles zu erfahren.
Zu diesem Zweck setzte sie sich mit der Polizei in Verbindung. Dort erfuhr sie, dass der Wagen mit zwei Personen, einem Mann und einer Frau, besetzt gewesen sei, bei Kilometer 7,5der Autobahn München-Berlin von der Fahrbahn abgekommen, sich mehrmals überschlagend über eine Böschung gestürzt und mit den Rädern nach oben liegen geblieben sei. Die Frau habe das Unglück offenbar nur deshalb überlebt, weil sie aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Zur Klärung der Unfallursache werde das Autowrack untersucht, aber das könne dauern.
Ob sie den Wagen sehen könne.
Natürlich, wenn sie sich das antun wolle.
Die Halle im Norden der Stadt bot Raum für zwei Dutzend Autowracks, und mindestens ebenso viele standen im Freien herum, zerbeulte, zerfetzte, verbrannte Automobile, die mit dem Schicksal irgendwelcher Menschen verbunden waren.
Obwohl sie sich vorgenommen hatte, kühl und gefasst zu bleiben, begann Anne beim Anblick des Wracks am ganzen Körper zu zittern, und es dauerte eine ganze Weile, bis sie näher zu treten wagte. Das Armaturenbrett war in der Mitte eingeknickt. Auf der linken Seite sah man Blutspuren. Front- und Heckscheibe lagen zersplittert auf den zerbeulten Polstern. Von der Kühlerhaube war nur noch die Hälfte der normalen Länge zu erkennen. Die Kofferraumklappe stand offen, sie ließ sich nicht mehr schließen. Es roch nach Benzin und Öl und verbranntem Kunststoff.
Beinahe andächtig umrundete Anne das demolierte Fahrzeug, da fiel ihr Blick auf eine Aktentasche im Kofferraum. Der Polizeibeamte, der sie begleitete, nickte und meinte, sie könne sie an sich nehmen, und er angelte die Ledertasche hervor.
»Aber das ist nicht die Tasche meines Mannes!«, rief Anne und trat einen Schritt zurück. Sie machte eine Bewegung, als habe der Mann ihr ein ekelerregendes Tier vor die Nase gehalten.
»Dann wird sie der Beifahrerin gehören«, meinte der Polizeibeamte beschwichtigend. Er verstand die Aufregung der Frau nicht.
»Aber wo ist der Aktenkoffer meines Mannes? Er hatte einen braunen Aktenkoffer bei sich mit seinem Monogramm G. v. S. auf der Oberseite!«
Der Polizist hob die Schultern. »Sind Sie sicher?«
»Ganz sicher«, erwiderte Anne, und nach einem Augenblick des Nachdenkens sagte sie: »Geben Sie her!«
Sie legte die Tasche auf das Dach des Unfallwagens, hantierte ungeübt an den Schlössern und öffnete den Deckel. Der Inhalt – Unterwäsche (nebenbei gesagt, nicht sehr feine), Kosmetika und Zigaretten – gehörte zweifellos der Frau.
»Darf ich ihn mitnehmen?«, fragte Anne.
»Selbstverständlich.«
Sie klappte die Tasche zu und ging.
3
Die unsagbare Trauer, der Schmerz und die Leere, die Guidos Tod in ihr hervorgerufen hatte, schienen auf einmal wie weggefegt, ja, sie erlebte einen Gefühlswandel ungewöhnlichster Art: Schmerz, der sich in der Regel erst nach Jahren verflüchtigt, schlug bei Anne von einer Stunde auf die andere um in Verbitterung, ja, auf einmal empfand sie Hass gegen den Mann, den sie am Tag zuvor zu Grabe getragen hatte. Zehn Jahre Ehe, vermeintliches Glück, stürzten plötzlich in sich zusammen wie ein abrissreifes Gebäude unter der Gewalt der Bulldozer. Ihr war, als hätte sie ihren Mann zweimal verloren, einmal vor wenigen Tagen – und dann jetzt.
Auf dem Heimweg, den Anne in einem Taxi zurücklegte, wurden Erinnerungen wach, Gedanken, Erlebnisse, die nun auf einmal einen Sinn ergaben. Ihre linke Hand krallte sich in den Handgriff der fremden Tasche, als sammelte sie Kraft für einen furchtbaren Angriff. Mit der anderen wühlte sie in ihrem Mantel nach dem Zettel, den ihr der Arzt in der Klinik gegeben hatte: Hanna Luise Donat, Hohenzollern-Ring 17.
Anne biss sich auf die Unterlippe. Das tat sie immer, wenn sie wütend war. Dann hielt sie dem Taxifahrer den Zettel vors Gesicht. »Fahren Sie mich zum Hohenzollern-Ring 17.«
Das Haus im Osten der Stadt war nicht die feinste Adresse, machte aber, so weit man in der Dämmerung erkennen konnte, einen gepflegten, gediegenen Eindruck. Ein grau gestrichenes Eisentor in der Gartenmauer trug ein ovales Messingschild ohne Namen. Anne zögerte keinen Augenblick. Sie drückte auf den Klingelknopf. Im Inneren des Hauses, das etwas zurücklag, brannte Licht, und kurz darauf erschien ein kleiner, dicklicher Mann in der Tür.
»Bin ich hier richtig bei Hanna Luise Donat?«, rief Anne dem Mann entgegen. Der kam ihr, ohne zu antworten, mit einem Schlüssel entgegen, schloss das graue Gartentor auf, streckte die Hand aus, an deren Zeigefinger das oberste Glied fehlte, und sagte, während er sich mit ungeschickter Höflichkeit verneigte: »Donat. Sie wollen zu meiner Frau. Bitte!«
Die Bereitwilligkeit, mit der der Mann, ohne zu fragen, was sie denn überhaupt wolle, Anne einließ, versetzte sie in Verwunderung, aber in ihrer Wut ging sie darüber hinweg, im Augenblick kannte sie nur ein Ziel: Sie wollte diese Frau sehen.
Donat bat Anne in ein spärlich möbliertes Zimmer mit zwei alten Schränken und einem schwülstigen Bild aus der Jahrhundertwende: »Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick!«
Er verschwand hinter einer der hohen, mit heller Ölfarbe gestrichenen Türen. Nach einer Weile kehrte er zurück, hielt die Tür auf und bat Anne herein.
Natürlich hatte Anne eine Vorstellung von der Frau, die sie in dem Zimmer erwarten würde. Sie erwartete eine Schlampe mit hochtoupierten Haaren und grell geschminkten Lippen, pummelig an den typischen Stellen, eben wie man sich eine vorstellt, die sich mit einem verheirateten Mann einlässt, und bei dieser Vorstellung wuchs ihre Wut.
Sie hatte sich die Begegnung minutiös ausgemalt; vor allem hatte sie sich geschworen, ruhig zu bleiben, kühl und zynisch, denn nur so konnte sie die fremde Frau verletzen. Ich bin Anne von Seydlitz, wollte sie sagen, die Ehefrau, und dass sie schon immer einmal das Frauenzimmer kennenlernen wollte, mit dem Guido seine angeblichen Dienstreisen verbracht hatte. Sie wollte sie einladen, die blutverschmierten Kleidungsstücke ihres Mannes abzuholen – zur Erinnerung sozusagen. Aber dann kam es doch ganz anders.
In der Mitte des Raumes, der mit Grünpflanzen verstellt war, saß eine Frau, wohl etwa im selben Alter wie sie. Sie saß starr wie eine Statue, die Beine in eine Decke gehüllt, sie saß in einem Rollstuhl. Alle Bewegungen, die ihr der Körper vom Hals abwärts offenbar verweigerte, spiegelten sich in ihrem schönen Gesicht wider.
»Ich bin Hanna Luise Donat«, sagte die Frau im Rollstuhl freundlich, und mit einer leichten Neigung des Kopfes bedeutete sie der Besucherin, näher zu treten.
Anne stand wie angewurzelt. Ihr, die sonst eigentlich nie um eine Antwort verlegen war, fehlten in diesem unvorhersehbaren Augenblick die Worte. So kam es, dass die gelähmte Frau, offenbar an Situationen wie diese gewöhnt, mit betont ruhiger Stimme sagte: »Bitte, nehmen Sie doch Platz!« Und nach einem weiteren Augenblick, in dem nichts geschah, fügte sie, nun etwas drängender, hinzu: »Wollen Sie mir nicht sagen, was Sie zu mir führt, Frau …«
»Seydlitz«, ergänzte Anne. Sie vermochte ihre Aufregung nicht zu unterdrücken, wühlte in ihrer Manteltasche den Zettel hervor und las, was in dieser Situation in gewisser Weise komisch wirkte: »Hanna Luise Donat, Hohenzollern-Ring 17.«
»Richtig«, kommentierte die Frau im Rollstuhl, und der Mann trat hinter sie und schob die Gelähmte näher an die Besucherin heran.
Anne stammelte ein paar entschuldigende Worte: Offensichtlich sei sie einem Irrtum aufgesessen, aber man habe ihr in der Klinik diesen Namen und diese Adresse gegeben, eine Frau gleichen Namens sei im Unfallwagen ihres Mannes gesessen und nach dreitägigem Klinikaufenthalt nach Hause entlassen worden.
»Dieses Missverständnis«, gab der Mann zu bedenken, »kann doch Ihr Mann sehr leicht klären.«
»Er ist tot«, stellte Anne nüchtern fest.
»Verzeihen Sie, es tut mir leid, das konnte ich nicht wissen.«
Anne nickte. Wie immer sie die Situation überdachte, diese Frau konnte weder die Beifahrerin im Auto noch die Patientin in der Klinik gewesen sein. Aber während sie die Situation als mysteriös, um nicht zu sagen unheimlich empfand, zeigten sich die beiden an dem Geschehen der letzten Tage äußerst interessiert. Noch ehe Anne in ein längeres, erklärendes Gespräch verwickelt werden konnte, drückte sie dem Mann die Tasche in die Hand, und sie verabschiedete sich schneller, als der Takt es geboten hätte.
4
In dieser Nacht fand Anne keinen Schlaf. Sie wandelte durch das große Haus wie ein Gespenst auf erfolgloser Suche nach seiner Seele. In einen langen weißen Hausmantel gehüllt, setzte sie sich auf die Treppe, die zu ihrem Schlafzimmer führte, und versuchte auf all das einen Reim zu finden. Manchmal glaubte sie zu träumen; dann lauschte sie den fernen Geräuschen der Nacht. Sie war darauf gefasst, dass sich jeden Augenblick ein Schlüssel im Schloss drehte und Guido ins Haus träte, so wie er es immer getan hatte, aber es geschah nichts, und alsbald erreichte ihr Delirium jenen gefährlichen Grad von Rausch, der zwischen Trug und Wahrheit nicht mehr zu unterscheiden weiß.
Anne erschrak, als sie sich dabei ertappte, wie sie vor der Tür von Guidos Schlafzimmer stand, mit der flachen Hand gegen den Rahmen schlug und ihren Mann einen Hurenbock schimpfte und mit weiteren ähnlichen Schimpfwörtern bedachte, als habe dieser sich in seinem Zimmer eingeschlossen.
Das Geschehen der letzten Tage war einfach zu viel für sie gewesen. Heulend wie ein Kind sank sie vor der Tür auf die Knie und gab sich ihrer Wut hin. Ja, Annes Tränen waren keine Tränen des Schmerzes, weil sie ihren Mann verloren hatte, Anne heulte vor Wut – über ihn und seine Dreistigkeit und über ihre eigene Naivität, ihr blindes Vertrauen, das sie Guido entgegengebracht und das dieser schändlich missbraucht hatte.
Von Wesensart und Charakter war Anne durchaus belastbar, unerträglich erschien ihr jedoch die Vorstellung eigener Dummheit; denn Anne von Seydlitz war eine ungewöhnlich kluge Frau, eine Frau, die es immer verstanden hatte, diese Klugheit zielgerecht einzusetzen. Nichts hasste sie mehr als Dummheit, und nun, ein Opfer ihrer eigenen Dummheit, hasste sie sich selbst.
Wuttränen klebten wie Sirup im Gesicht. Eigentlich schämte sie sich vor sich selbst. Sie konnte sich nicht erinnern, sich jemals so gehen gelassen zu haben, nicht einmal in der Zeit, die sie als Kind in einem Waisenhaus verbracht hatte.
Im Badezimmer lag der Plastiksack, den man ihr in der Klinik übergeben hatte. Sie erkannte Guidos Uhr, eine goldene Hamilton aus dem Jahre 1921, Guidos Geburtsjahr. Er hatte sie auf einer Auktion erstanden. An der Unterseite war eine Widmung eingraviert: Syd to Sam 1921. Anne riss den Beutel auf, zog den blutverschmierten Anzug hervor und breitete Hose und Sakko wie die Figur eines Hampelmannes aus. Und wie er so dalag, der Anzug, den er mit Vorliebe getragen hatte, begann Anne mit bloßen Füßen auf den Kleidungsstücken herumzutrampeln, als wollte sie Guido wehtun. Als wollte sie ein Geständnis aus ihm herauspressen, stampfte sie wild auf den Boden des Badezimmers, gab sie schnaubende Laute von sich und stieß immer wieder dasselbe Wort hervor: »Betrüger – Betrüger – Betrüger!«
Bei ihrem orgiastischen Tanz hatte sie in dem Sakko Widerstand gespürt. Unerwartet zog Anne Guidos Brieftasche hervor. Sie atmete heftig, als sie ein Bündel Geldscheine aus der Tasche nahm. Den weiteren Inhalt kannte sie: Kreditkarten und Fahrzeugpapiere. Aber während sie die Scheine mechanisch zu zählen begann, stieß sie auf eine gelbe Eintrittskarte. Deutsche Oper Berlin, Mittwoch, 20. September, 19 Uhr.
Anne hielt das Billett mit Daumen und Zeigefingern beider Hände. Guido war, bei Gott, kein Opernfreund gewesen. Die wenigen Male, die sie zusammen eine Oper besucht hatten, konnte sie an einer Hand abzählen. Für Anne erschien das nur ein Beweis mehr, wie Guido sie hintergangen hatte. Und sie gehörte zu den Frauen, die alles verzeihen könnten, nur nicht die Gewissheit, dass ihr Mann sie betrog.
Während sie den Inhalt der Brieftasche vor sich auf dem Boden des Badezimmers ausbreitete wie ein Puzzle oder eine Patience, begann sie, ihre Gedanken zu ordnen. Längst hatte sie sich grübelnd so in das Doppelleben ihres Mannes verstrickt, dass es für sie kein Halten mehr gab: Sie würde nicht eher Ruhe geben, bis sie dies in allen Einzelheiten aufgeklärt hatte.
Der Tag, der gegen sieben allmählich zum Fenster hereinschimmerte und sich mit dem Gelb der Wandleuchten mischte, trug merklich dazu bei, Annes Sinne zu beruhigen. Diese Besänftigung verdrängte ihre Wut jedoch keineswegs, sie ließ nur ihr Ziel klarer erscheinen.
Anne war alles andere als der Typ eines Schnüfflers; aber es ist bekannt, dass Ehebruch nie gekannte Charaktereigenschaften freisetzt. In ihrem Fall konnte man sogar sagen: Es war ihre Wut, die sie vor dem totalen Zusammenbruch bewahrte.
Noch während sie mit der Klinik telefonierte, wo sie wie erwartet erfuhr, dass jene Frau aus dem Unfallwagen, die sich als Hanna Luise Donat ausgegeben hatte, ganz anders aussah als die Frau im Rollstuhl, fiel ihr Blick auf das Datum der Opernkarte: 20. September. – Heute!
Anne schnippte mit dem Finger, und zum ersten Mal seit Tagen huschte ein kleines Lächeln über ihre Mundwinkel, ein kleines teuflisches Lächeln. Gewiss, die Hoffnung war gering, aber je länger sie das Billett in der Hand hielt, desto mehr kam in ihr das Gefühl auf, die Opernvorstellung könnte sie auf irgendeine Spur bringen. Sie konnte und mochte sich einfach nicht vorstellen, dass Guido über Nacht zum Opernfan geworden war und allein eine Opernvorstellung besuchte – noch dazu, ohne dies mit einem Wort zu erwähnen.
5
Im Flugzeug nach Berlin erinnerte sich Anne der Zeit vor sechs, sieben Jahren, als ihre Ehe zur Routine geworden war, nicht gerade unerträglich, aber doch so, dass es keine Aufregungen mehr zu geben schien in ihrer Beziehung, keinen Krach, aber auch keine Versöhnung; alles lief – wie man so zu sagen pflegt – wie am Schnürchen. Damals, eben vor sechs, sieben Jahren, hatte sie sich allen Ernstes überlegt, mit dem jungen Volontär in der Firma etwas anzufangen, der sie seine Blicke spüren ließ, sobald sie auftauchte. Diese Lust, die jede Frau überkommt, sobald sie ihre sogenannten besten Jahre erreicht hat, quälte sie monatelang; denn zum einen hätte es sie gereizt, die Wirkung ihrer 35 Jahre auf einen schüchternen, aber nicht unattraktiven Jüngling auszuprobieren, zum anderen wollte sie Guido merken lassen, dass sie auf andere, sogar jüngere Männer durchaus anziehend wirkte.
Auf diesem Umweg hoffte Anne, ihrem Mann in Erinnerung zu bringen, dass eine Ehe aus mehr besteht als aus Arbeit, Erfolg und zweimal Urlaub im Jahr. Aber eine plötzliche Erkenntnis im Hinterzimmer des Geschäftes, in das sie an einem ruhigen Montagnachmittag Wiguläus – so hieß der studierte Knabe, und er sah auch so aus – mit der Absicht gerufen hatte, ihn zu verführen (sogar dass sie lila Unterwäsche und gleichfarbige Strümpfe trug, war ihr noch gegenwärtig), führte sie jäh in die Wirklichkeit und auf den Pfad der Tugend zurück. Jedenfalls hatte sie, als der Jüngling begann, mit seinen schlanken weißen Händen unter ihrem Kaschmirpullover herumzuwühlen wie ein Bäcker im Teig, ausgeholt und ihm, dem Knaben, eine schallende Ohrfeige verabreicht und mit gespielter Bestimmtheit, wie es einer verheirateten Frau zukam, erklärt, er möge das nie wieder tun – im Übrigen aber wolle man die Angelegenheit vergessen.
Erst viel später hatte sie begriffen, dass dieses Erlebnis der klassische Sieg des Verstandes über das Gefühl gewesen war, jene seltene Art von Sieg, die im Abstand der Jahre nicht immer und nicht unbedingt erstrebenswert erscheint. Im beschriebenen Fall hätte ein vollzogener Seitensprung – um das hässliche Wort Geschlechtsverkehr zu vermeiden – vielleicht wirklich mehr bewirkt, vorausgesetzt, ihr Mann hätte davon Wind bekommen und sie hätten sich in angemessener Weise versöhnt. Umso mehr musste es sie kränken, dass ihre Treue von Guido auf so perfide Weise missbraucht worden war; nun aber reute es sie erst recht, sich dem jungen Wiguläus nicht hingegeben und statt dessen geordnete Verhältnisse aufrechterhalten zu haben wie in einer ganz normalen Ehe.
Das Hotel, in dem Anne von Seydlitz abstieg (Hotel Kempinski), ist für den Fortgang der Geschichte ohne Bedeutung, anders die Operninszenierung (Orpheus und Eurydike von Christoph Willibald Gluck); beide seien indes der Vollständigkeit halber erwähnt. Jedenfalls nahm sie ihren Opernplatz, Parkett, siebente Reihe, erst im allerletzten Augenblick ein und war erstaunt, zu ihrer Rechten einen rotbackigen, glatt rasierten Herrn mit randloser Brille zu finden, dem zum Domprediger nur der Talar fehlte, und zu ihrer Linken eine zauberhafte alte Dame, hätte sie nur nicht andauernd Eukalyptusbonbons gelutscht.
Fehlanzeige!, ging es ihr durch den Kopf, während sich auf der Bühne ein schmächtiger Kastrat mit Altstimme als trauernder Orpheus abmühte. Anne ließ sich von der gluckschen Musik einlullen; ja, die Musik kam ihrer Stimmung sehr entgegen, und so bemerkte sie auch nicht, dass der Glattrasierte zu ihrer Rechten sie mit verstohlenen Blicken zu mustern begann.
Vielleicht hätte sie die Blicke sogar genossen; jedenfalls blieb sie in der Pause auf ihrem Platz sitzen, ratlos in Gedanken versunken, bis die Reihe sich füllte, und der Rotbackige zu ihrer Rechten Platz nahm. Und während dieser sich umständlich in seinen Sessel gleiten ließ, wandte er ihr seitlich den Kopf zu und sagte, kaum dass er die Lippen bewegte: »Auf diesem Platz hätte ich Guido von Seydlitz erwartet. Wer sind Sie?«
Anne schwieg. Aber dieses Schweigen fiel ihr nicht leicht. Sie musste sich jetzt jedes einzelne Wort überlegen. Jetzt ja keinen Fehler machen! Für die Bemerkung des Unbekannten fand Anne absolut keine Erklärung. Er musste Guido gekannt haben. Was wollte er von ihm, hier in der Oper? In welchem Zusammenhang stand er mit der rätselhaften Frau aus dem Unfallwagen?
Sie konnte Guido verleugnen, irgendeinen Namen nennen und behaupten, sie habe das Billett einem Unbekannten vor der Tür abgekauft; aber das hätte bedeutet, dass überhaupt keine Chance bestand, das Rätsel aufzuklären. Und nun, da die Situation noch viel verworrener erschien als zuvor, wollte sie nur das eine wissen: Was spielte sich da hinter ihrem Rücken ab?
Nachdem sich ihre Blicke viel zu lange herausfordernd gemessen hatten, beantwortete Anne die ihr gestellte Frage mit gezwungener Ruhe: »Ich bin Anne von Seydlitz, seine Frau.«
Der rotbäckige Glattrasierte schien diese Antwort erwartet zu haben, jedenfalls machte er keinen aufgeregten Eindruck; im Gegenteil, er wirkte eher verärgert, stieß Luft durch die Nase – eine Angewohnheit, die Anne nicht ausstehen konnte – und fragte herausfordernd wie ein unwilliger Schalterbeamter: »Und, was haben Sie für eine Nachricht?«
In diesem Augenblick war Anne klar, dass irgendetwas im Gange war, von dem sie keine Ahnung hatte. Gewiss, es gibt auf der ganzen Welt keinen Kunsthändler, der nicht schon Geschäfte am Rande der Legalität gemacht hätte, und sie wusste auch von dieser oder jener Mauschelei ihres Mannes, die nicht unerheblichen Gewinn gebracht hatte; aber sie wusste eben immer davon, und derlei Geschäfte pflegten bei einem noblen Dinner in einem noch nobleren Restaurant abgeschlossen zu werden, keineswegs jedoch in Reihe sieben einer Opernvorstellung.
Sie hätte jetzt natürlich die Wahrheit sagen können, dass sie von nichts eine Ahnung habe, weil ihr Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen sei, aber sie hielt das für falsch, und deshalb nahm sie sich vor, die Wissende zu spielen, so lange es ging. Zu Annes hervorragenden Eigenschaften gehörte es, in ungewöhnlichen Situationen, und anders war diese ja wohl nicht zu bezeichnen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wenn sie etwas verunsicherte, dann war es die Eiseskälte, die Unempfänglichkeit für ihren Charme. In diesem Falle aber verursachte sie keine Gefühlsregung, das spürte sie genau. War sie in den letzten Tagen so gealtert, oder stand ihr die Wut ins Gesicht geschrieben wie einer Erinnye? Der Unbekannte wartete noch immer auf Antwort.
»Eine Nachricht?«, meinte Anne mit gespielter Verlegenheit.
Und während sie scheinbar nach Worten rang wie ein Kind, das bei einer Lüge ertappt wird, fiel ihr der Glattrasierte ins Wort: »Eine halbe Million war vereinbart. Sie sollten den Bogen nicht überspannen! Also, was wollen Sie?«
In diesem Augenblick verlosch das Licht, der Dirigent trat ans Pult, das Publikum klatschte höflich, der Vorhang hob sich, und Orpheus (Alt) ging Eurydike (Sopran) gute zwanzig Minuten voran, ohne, wie es das Libretto vorschrieb, sich umzudrehen. Es kam dann noch zu irgendwelchen Selbstmordabsichten vonseiten des Kastraten, welche dieser mithilfe der Arie »Ach, ich habe sie verloren« zu untermauern suchte, aber die Ausführung des Vorhabens ließ auf sich warten, und Anne interessierte sich ohnehin nicht sonderlich dafür. Ihre Gedanken kreisten um diesen seltsamen Mann an ihrer Seite, und sie spürte, wie sich in ihrem Nacken Schweißperlen bildeten.
Der dritte Akt dehnte sich endlos lang. Sie hatte Schwierigkeiten, ruhig zu sitzen, schlug einmal das rechte Bein über das linke, ein andermal das linke über das rechte, krallte sich an ihrer schwarzen Handtasche fest und stellte sich vor, wie ihr Gesicht wohl glänzen würde, wenn das Licht anging. Um Himmels willen, dachte sie, es muss doch etwas geschehen, und noch immer stand die Frage des Mannes im Raum. Derart in die Enge getrieben und weil sie einfach nicht weiterwusste, zischelte sie zur Seite: »Ich denke, wir sollten noch einmal verhandeln …«
»Wie bitte?«
»Ich denke, wir sollten …«
»Pssst!«, tönte es aus der achten Reihe, und der Glattrasierte machte, so weit man das in der Dunkelheit erkennen konnte, eine beschwichtigende Handbewegung, die wohl andeuten sollte, er habe sie genau verstanden und nur zum Zeichen seiner Entrüstung ›wie bitte?‹ geflüstert.
Sie bemerkte noch, während Orpheus und Eurydike sich singend in die Arme fielen, was auch in dieser Oper als untrügliches Zeichen des nahenden Endes erkannt werden darf, dass der Unbekannte eine Karte aus seinem Sakko zog und mit einem Stift darauf herumkritzelte.
Mit dem Schlussakkord ging der Vorhang nieder, das Publikum applaudierte, und gerade in dem Augenblick, als die Schummrigkeit des Parketts von gleißend hellem Glanz vertrieben wurde, sprang der Mann neben ihr auf, drückte ihr die Visitenkarte in die Hand und drängte sich ziemlich rücksichtslos aus der Mitte der Zuschauerreihe, noch ehe Anne ihm folgen konnte.
Später, im Foyer, betrachtete Anne die Visitenkarte, auf der sich der Autovermieter AVIS, Budapester Straße 43, am Europa-Center, empfahl, was ihr der rotbäckige Glattrasierte gewiss nicht nahe bringen wollte. Anne drehte die Karte um und erkannte eine ungelenke Notiz von altmodischer Handschrift, die sie endlich nach mehreren Ansätzen entzifferte als: »Morgen 13 Uhr – Museum – Nofretete – neues Angebot.«
Zum Teufel mit dem Kerl! Der Mann war ihr höchst zuwider. Man kennt das: Es gibt Leute, denen begegnet man zum ersten Mal, man wechselt nicht ein Wort mit ihnen, aber dennoch empfindet man unbeschreibliche Antipathie gegen sie. Anne hasste rotbackige Männer, und sie hasste Männer, die wie eine Speckschwarte glänzten.
Aber dennoch zweifelte sie keine Sekunde, dass sie morgen zu dem Treff gehen würde.
6
Jede andere hätte der Treffpunkt vermutlich in tiefe Ratlosigkeit gestürzt; schließlich war Nofretete eine ägyptische Königin. Anne von Seydlitz wusste natürlich, dass die weltberühmte Kalksteinbüste der Nofretete, um die Jahrhundertwende von Deutschen ausgegraben, seit Kriegsende im Dahlemer Museum ausgestellt wurde. Der Treffpunkt bestätigte ihren von Anfang an gehegten Verdacht, der Unbekannte könnte hinter einer kostbaren Antiquität her sein.
Leute dieser Art werden von Kunsthändlern geschätzt, weil sie bereit sind, für das Objekt ihrer Begierde jeden Preis zu zahlen. Unter dieser Klientel kannte Anne mehr als einen Sammler, der, obwohl durchaus wohlhabend, sich auf bedrohliche Weise verschuldet hatte, nur um in den Besitz irgendeiner aberwitzigen Kostbarkeit zu gelangen, die geeignet schien, seine Sammlung zu krönen.
Ähnliches vermutete sie hinter der Absicht des Unbekannten, und weil sie befürchtete, sich in irgendeine kriminelle Sache zu verstricken (ein Mann, der sie mit einer anderen betrog, war auch fähig, sie mit unlauteren Geschäften zu hintergehen), fasste sie den Entschluss, den Rotbackigen beim morgigen Treffen über den Tod ihres Mannes aufzuklären; dann müsste jener die Katze aus dem Sack lassen und erklären, was in aller Welt ihm so viel Geld wert sei und warum das alles auf derart merkwürdige Art und Weise vonstattengehe. So dachte sie.
Gegen Mittag sind alle Museen der Welt halb leer, und das Museum in Dahlem machte da keine Ausnahme. Anne fand den Mann aus der Oper in den Anblick des Fußbodenmosaiks versunken. Sie erkannte ihn schon von Weitem, obwohl er nun, bei Tageslicht, und mit einem hellen Trenchcoat bekleidet, einen viel jugendlicheren Eindruck machte. Mit auf dem Rücken verschränkten Händen stand er da und starrte auf das Mosaik.
Anne trat von der Seite an ihn heran. Der andere schien sie zwar zu bemerken, machte aber keinerlei Anstalten, den Blick zu heben und sie anzusehen. In Gedanken verloren, begann er auf einmal zu reden: »Das ist Orpheus mit seiner Leier, einer, der die Geheimnisse der Gottheit kannte«, und er lächelte beinahe verlegen. Dann fuhr er fort: »Es gibt viele Versionen um seinen Tod. Eine besagt, er sei von Zeus durch einen Blitz getötet worden zur Strafe dafür, dass er den Menschen die göttliche Weisheit übermittelt habe. Glauben Sie mir, es ist die einzige richtige Version.«
Anne stand wie erstarrt; sie hatte sich diese Begegnung ganz anders vorgestellt, und nun begann der mit einer Vorlesung über Orpheus. Orpheus? Das alles konnte doch kein Zufall sein: Am Abend zuvor Glucks Orpheus, und jetzt stand er vor diesem Mosaik und faselte über den Tod des Sängers.
Nach einer Weile blickte der Mann auf, er sah Anne prüfend an wie ein Käfer die Ware, dann verschränkte er die Arme vor der Brust, und in dieser Haltung begann er, während er von einem Fuß auf den anderen trat, zu reden: »Also gut, wir sind bereit, unser Angebot auf eine Dreiviertelmillion zu erhöhen …«
Der Gebrauch des Personalpronomens wir machte Anne nachdenklich. Kein wirklicher Sammler gebrauchte das Fürwort ›wir‹, ein wirklicher Sammler, für den sie den Rotbackigen bisher gehalten hatte, kannte nur ›ich‹, und zum ersten Mal kam in ihr der Verdacht auf, sie könnte, ohne es zu wollen, in eine Geheimdienstsache verstrickt sein. Der Geheimdienst ist neben der Kirche die einzige Institution, die nur das Wort ›wir‹ kennt.
»Ich befürchte«, sagte Anne, »wir reden aneinander vorbei.«
»Ich verstehe nicht. Wollen Sie sich etwas klarer ausdrücken?«
»Das wollte ich Sie bitten!«
Rotbacke holte Luft: »Sie sind doch Frau von Seydlitz?«
»Ja. Und wer sind Sie?«
»Das tut im Zusammenhang mit unserem Geschäft nichts zur Sache; aber wenn es Ihnen hilft, nennen Sie mich Thaies.«
Es half nicht, und Anne hätte es auch als albern empfunden, den Fremden mit ›Thaies‹ anzureden, obwohl der Name irgendwie gut zu ihm passte.
»Mich interessiert«, begann Thaies aufs Neue, »mich interessiert vor allem eines: Wo befindet sich das Pergament zurzeit?«
Anne begegnete der Frage mit gespielter Ruhe, obwohl ihr tausend Dinge durch den Kopf rasten. Welches Pergament? Sie hatte keine Ahnung. Was hatte Guido ihr verschwiegen? Für gewöhnlich hatte Anne um alle Geschäfte gewusst, zumindest um die größeren. Warum hatte er ihr ausgerechnet dieses Geschäft verschwiegen? Ein Pergament für eine Dreiviertelmillion?
Mit einem Mal erkannte sie Zusammenhänge, und sie ahnte, warum Guidos Aktenkoffer bei dem Unfall verschwunden war. Welche Rolle aber die Frau dabei gespielt haben konnte, blieb ihr verborgen.
Ihr langes Schweigen machte Thaies sichtlich nervös; jedenfalls blies er wieder auf abscheuliche Weise Luft durch die Nase. Es hörte sich an wie das Schließen einer U-Bahn-Tür. »Wo ist von Seydlitz?«, schob er seiner ersten eine zweite Frage nach.
»Mein Mann ist tot«, erwiderte Anne mit fester Stimme, ohne dass dabei ein Anflug von Trauer mitschwang, und sie sah dem Rotbackigen in die Augen.
Der runzelte die Stirn, dass seine buschigen Augenbrauen hinter den Brillengläsern hervortraten. Man konnte nicht sagen, dass die Antwort ihn traf wie der Tod eines Menschen, den man kennt; vielmehr wirkte er äußerst verunsichert und besorgt um den Fortgang seines Geschäftes. Insofern war es nicht Trauer, die auf einmal in seiner weinerlichen Stimme schwang, sondern eher Selbstmitleid: »Aber wir haben letzte Woche noch telefoniert. Das kann doch nicht sein!«
»Doch!«, meinte Anne bestimmt.
»Herzinfarkt?«
»Verkehrsunfall.«
»Tut mir aufrichtig leid.«
»Schon gut.« Anne senkte den Blick. »Um Ihrer Frage zuvorzukommen: Ja, ich werde die Firma weiterführen, und insofern bin ich jetzt Ihr Ansprechpartner.«
»Ich verstehe.« Thaies’ Stimme klang resigniert. Offenbar war ihm Guido der angenehmere Geschäftspartner gewesen. Möglich, dass Rotbacke Frauen grundsätzlich nicht mochte. Von seinem Aussehen konnte man darauf schließen. Einerlei, das stärkte nur ihre Position.
Thaies versuchte angestrengt, die Unterhaltung von Neuem aufzunehmen: »Wir haben uns gut verstanden, Ihr Mann und ich, sehr sympathisch, wirklich, korrekter Geschäftsmann.« Mit der Linken machte er eine ausholende Handbewegung wie ein schlechter Schauspieler, um anzudeuten, dass es vielleicht besser wäre, sich etwas von der Stelle zu bewegen. Er schien bemüht, ihr Zusammentreffen so unauffällig wie möglich zu halten.
»Sie kannten meinen Mann?«, fragte Anne im Gehen, während sie gelangweilt auf die ägyptischen Exponate zu beiden Seiten des Raumes blickte.
»Was heißt kennen«, antwortete Thaies. »Wir standen in Verhandlungen.«
Warum hatte Guido den Namen Thaies nie erwähnt? Irgendetwas stimmte an der Sache nicht. Eigentlich hatte sie vor, dem Rotbackigen die Wahrheit zu sagen, sie wisse überhaupt nicht, worum es gehe und wo sich das Pergament befinde, für das er ein Vermögen auszugeben bereit sei; aber dann kam alles ganz anders, weil der fremde Mann zu reden begann, und dabei gebrauchte er wieder das Personalpronomen ›wir‹.
»Sie fragen sich natürlich, warum wir bereit sind, für ein Stück Pergament mit ein paar alten Schriftzeichen so viel Geld auszugeben. Allein an der Summe mögen Sie erkennen, wie wertvoll das Stück für uns ist, das wollen wir nicht verhehlen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihnen irgendjemand mehr bietet. Wichtig ist uns nur, dass niemand von dem Pergament erfährt und schon gar nicht von dem Kauf, und damit wir Sie gar nicht erst in Schwierigkeiten bringen können, wollen wir absolut anonym bleiben. Wir zahlen die geforderte Summe bar auf die Hand, das Geschäft braucht also in keiner Bilanz aufzutauchen. Wir verstehen uns?«
Anne verstand keineswegs. Sie begriff nur, dass der seltsame Mann neben ihr bereit war, ihr eine Dreiviertelmillion für ein Objekt zu zahlen, das sich angeblich in ihrem Besitz befand, von dem sie allerdings keine Ahnung hatte – und das möglicherweise sogar gestohlen war.
Ganz unvermittelt fragte Thaies auf einmal: »Haben Sie das Pergament mitgebracht? Ich meine, befindet es sich hier in Berlin?«
»Nein«, erwiderte Anne, ohne zu überlegen und durchaus wahrheitsgemäß.
Die Antwort enttäuschte den Rotbackigen sehr. »Ich verstehe«, sagte er mit einem Ausdruck von Betroffenheit; und mit einer Schnelligkeit, die sie verwirrte, machte er eine höfliche Kopfbewegung, um sich zu verabschieden, und während er sich umdrehte, sagte er noch: »Wir melden uns wieder, auf Wiedersehen.«
Anders als an dem vorangegangenen Abend hätte Anne den Rotbackigen diesmal leicht verfolgen können, sie hätte ihn sogar aufhalten, ihm irgendwelche Fragen stellen können; aber der Augenblick solcher Gedanken fand ein schnelles Ende, weil sie nicht wusste, was sie überhaupt von ihm wollte.
7
Anne hielt sich keinen Tag länger in Berlin auf. Sie hatte das unerklärliche Gefühl, irgendetwas Außergewöhnliches könnte geschehen. Nebelverhangene Straßen, stinkender Dampf aus den Gullys und lauter Verkehr, all das wirkte mit einem Mal bedrohlich auf sie. Derlei Gefühle hatte sie nie gehabt, weil es keinen Anlass dazu gegeben hatte, schließlich war sie eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben stand, und schrecken konnten sie nur schlechte Bilanzen und das Finanzamt.
Nun aber ertappte sie sich dabei, dass sie zur Seite wich, wenn ein Auto neben ihr anhielt, und dass sie um einen Bettler am Straßenrand einen großen Bogen machte, nur weil er sie mit hoffnungsvollem Blick musterte. Es kam ihr vor, als drehte sich alles nur um sie, obwohl die Ereignisse doch nach wie vor mit ihrer eigenen Person wenig zu tun hatten.
Auf dem Flug nach München, der ihr in angenehmer Erinnerung blieb (es war für lange Zeit die letzte angenehme Erinnerung), weil über dem Nebel die Sonne strahlte und ihr eine ganze Sitzreihe allein zur Verfügung stand, versuchte Anne irgendeine Erklärung für all das zu finden, was sich in den letzten Tagen ereignet hatte. Sie fand sie nicht. Dabei stellte sich ihr die Frage, ob Guidos tödlicher Unfall ein Zufall war oder ob jemand dabei nachgeholfen hatte.
Zu Hause fand sie einen roten Zettel mit Polizeistempel an die Eingangstür geklebt und dem handschriftlichen Vermerk, sie möge sich umgehend auf ihrem Polizeirevier melden. Der Grund für diese Aufforderung wurde ihr sehr schnell klar, als sie die Haustür öffnete. Einbrecher hatten das ganze Haus durchwühlt, Schränke und Kommoden aufgebrochen, den Inhalt wahllos verstreut, Bücher aus den Regalen gerissen, Bilder abgehängt, sogar die Teppiche umgedreht.
Als sie sich dem Chaos gegenübersah, setzte sich Anne auf einen Stuhl und heulte. Zu ihrem Erstaunen hatten die Einbrecher weder das kostbare Silbergeschirr noch die Porzellanfigurensammlung mitgenommen; ja, nach einer ersten Bestandsaufnahme stellte sie fest: Es fehlte überhaupt nichts, nicht einmal das Bargeld, ein paar Hundert Mark, das offen in einem Barocksekretär herumlag.
Damit schien klar, dass hier nicht gewöhnliche Einbrecher am Werk waren, sondern dass die Tat im Zusammenhang mit dem verfluchten Pergament stand. Kein Zweifel, die Leute hatten im Haus nach dem Pergament gesucht, nichts gefunden und waren unverrichteter Dinge wieder verschwunden. Leute, die bereit sind, für ein Pergament eine Dreiviertelmillion zu bezahlen, vergreifen sich nicht an Silber.
Doch da gab es einige Ungereimtheiten in ihren Überlegungen: etwa warum die Leute mit ihr in Berlin verhandelten, während sie in München in ihr Haus einbrachen. Oder warum ihnen ihre, Annes, Abwesenheit bekannt war, nicht aber der Tod ihres Mannes.
Auf dem zuständigen Polizeirevier erfuhr sie, dass Nachbarn den Einbruch gemeldet hätten, nachdem ihnen zwei verdächtige Gestalten mit Taschenlampen im Garten aufgefallen waren. Man teilte ihr auch mit, die Untersuchungen an dem Unfallwagen hätten weder einen technischen Defekt noch einen Fremdeinfluss erkennen lassen; mit anderen Worten, Guido habe seinen Tod selbst verschuldet, menschliches Versagen – die teilnahmsloseste Bezeichnung, die es für den Tod eines Menschen gibt.
In einem Umschlag überreichte ihr der Beamte einige belanglose Dinge, die bei der Untersuchung des Wagens gefunden worden waren, darunter ein lange vermisster Briefkastenschlüssel, eine Kreditkarte mit ähnlicher Geschichte, ein zerbrochener Füllfederhalter, den sie bei Guido, soweit sie sich erinnern konnte, nie gesehen hatte, und – eine Filmpatrone. Die Kamera, die stets im Handschuhfach des Wagens gelegen hatte, fehlte, und ihre Rückfrage wurde dahingehend beantwortet, in dem Autowrack sei keine Kamera gefunden worden.
In einer so ausweglosen Situation wie dieser, die, wie es schien, nicht nur eine Ursache und nicht nur ein Motiv hatte – a) wollte Anne immer noch wissen, mit wem ihr Verblichener seine angeblichen Dienstreisen verbracht hatte, b) interessierte sie sich dringend für den Verbleib des Pergaments; eine Dreiviertelmillion war schließlich kein Pappenstiel, und c) ging es ihr darum, Licht in eine Angelegenheit zu bringen, in die sie, ohne es zu wissen, tiefer verwickelt war, als ihr lieb sein konnte -, in einer solchen beinahe metaphysischen Situation greift man nach jedem Strohhalm: Insgeheim hoffte Anne, als sie den Film zur Entwicklung gab, Schnappschüsse der Geliebten ihres Mannes zu entdecken; sie suchte ja nur nach einer Bestätigung für ihre Vermutung. Dann wäre ihre Welt zumindest in dieser Hinsicht wieder in Ordnung gewesen; sie hätte schlecht gedacht über Guido und die Männer im Allgemeinen und vielleicht den Entschluss gefasst, sich an der erwähnten Allgemeinheit auf diese oder jene Weise zu rächen.
Deshalb war Anne von Seydlitz zunächst enttäuscht, als sie den entwickelten Film ausgehändigt bekam und statt irgendwelcher pikanter Schnappschüsse einer Bildserie ansichtig wurde, die an Langeweile kaum zu überbieten war, sie aber schon im nächsten Augenblick elektrisierte wie ein Schlag aus der Steckdose. Man sah Aufnahmen von einem zerfledderten Schriftstück, sechsunddreißigmal ein und dasselbe Motiv.
Das Pergament! Anne presste die Hände vor den Mund. Bei näherer Betrachtung der Negative war zu erkennen, dass die Aufnahmen offenbar in großer Eile im Freien gemacht worden waren, indem irgendjemand das kostbare Objekt in die Kamera gehalten hatte. Wiguläus, den Anne sofort in Verdacht hatte, stritt seine Mitwirkung an den Aufnahmen ab, bekräftigte jedoch, das Original zu kennen, es jedenfalls im Tresor des Ladengeschäfts gesehen zu haben, ein Umstand, der ihn verwundert habe, weil im Tresor nur Objekte von hohem Wert wie Schmuck oder Goldkunst aufbewahrt worden seien. Auf die Frage, ob Guido je über das Pergament geredet habe, erwiderte der Junge, nein, er habe von der Existenz überhaupt nur durch das Wareneingangsbuch erfahren, wo er den Einkauf weisungsgerecht mit eintausend Mark verbucht habe.
In der Tat war das Objekt als »koptisches Pergament« ordnungsgemäß verbucht. Unter der Rubrik »Herkunft« fand Anne die Eintragung: privat. Wann er das Pergament zuletzt im Tresor gesehen hatte, vermochte Wiguläus nicht mit Sicherheit zu sagen, vermutlich am Tage vor Guido von Seydlitz’ Tod, und entschuldigend fügte er hinzu, er habe das Pergament einfach nicht für so bedeutend gehalten, um sich dafür zu interessieren. Aber jetzt sei es verschwunden.
Ob er wisse, welchen Inhalt der Text des Pergaments wiedergebe?
Oh nein, lachte Wiguläus, der Wert des Schriftstückes beruhe mit Sicherheit nicht auf seinem Inhalt, sondern auf seinem Alter. Im Übrigen seien die Schriftzeilen an vielen Stellen unleserlich. Allein die Tatsache, dass es auf dem Kunstmarkt angeboten wurde, erlaube die Schlussfolgerung, dass es kaum von historischer Bedeutung sei.
So endete dieses Gespräch wie alle Gespräche, die Anne seit Guidos Tod geführt hatte, mit tiefem Misstrauen und dem festen Vorsatz, das Geheimnis um das Pergament auf eigene Faust zu ergründen. Immerhin hatte sie nun mehrere Kopien unterschiedlicher Bildqualität vorliegen, alle etwa in der Originalgröße eines halben Briefbogens, die für einen Fachmann durchaus aussagefähig sein mussten. Insgeheim knüpfte Anne an den Inhalt jetzt die Vermutung, die sie in keiner Weise zu begründen wusste, dass Guidos Tod mit dem Papier in irgendeiner Weise in Zusammenhang stand.
8
Es war dies jene selbst ernannte Form von Logik, die bei Außenstehenden nur Kopfschütteln hervorruft, dem Betroffenen aber so einleuchtend erscheint, dass er jedem Zweifler mit Misstrauen begegnet. Getragen von diesem Misstrauen, ging Anne daran, nach einem Experten zu suchen, der ihr den Inhalt des Pergaments erklären konnte. Aber weil sie fürchten musste, man könnte ihr unangenehme Fragen wegen Herkunft und Verbleib des Dokumentes stellen, wandte sie sich nicht an einen anerkannten Experten für koptische Kunst und Geschichte, sondern sie nahm die Dienste eines stadtbekannten Expertisenvermittlers in Anspruch, der gegen Bares Spezialisten für jedes nur erdenkliche Fachgebiet vermittelte, meist uralte, halb blinde emeritierte Professoren oder versoffene Privatgelehrte mit durchaus respektablem Wissen, welche Gutachten nach den Wünschen des Auftraggebers zu schreiben bereit waren.
Dr. Werner Rauschenbach gehörte zu Letzteren. Er bewohnte eine Mansardenwohnung in der Kanalstraße, deren Häuser besondere Verkommenheit, aber niedrige Mieten aufwiesen. »Vorsicht im Treppenhaus!«, hatte er Anne am Telefon gemahnt. »Die Stiegen haben Löcher, und das Treppengeländer hält auch nicht mehr viel aus!« Er hatte nicht übertrieben.
Rauschenbachs Wohnung erwies sich in mehrfacher Hinsicht als bemerkenswert, sie zeichnete sich vor allem durch zwei Dinge aus, von denen Anne noch nie so viele auf einem Fleck gesehen hatte: Bücher und Flaschen, eine gar nicht seltene Kombination, aber unerwartet in dieser Anhäufung. Bücher waren an den Wänden gestapelt, die meisten ohne die stützende Hilfe eines Regals, kniehohe Stöße von Gedrucktem standen scheinbar ungeordnet auf dem Boden herum, dazwischen Flaschen, kantige Rotweinflaschen. Die einzige freie Wandfläche des düsteren Arbeitsraumes nahm ein vergilbtes Illustriertenfoto von Rita Hayworth aus den Vierzigerjahren ein.
Dort schien die Zeit Rauschenbachs stehen geblieben zu sein; hier hatte er seine Traumwelt aus Suff und Wissenschaft gezimmert, die er unaufgefordert vor jedem rechtfertigte, der ihn besuchte. Und so musste auch Anne eine ganze Biografie über sich ergehen lassen, nicht ohne Mitgefühl übrigens, weil die Geschichte zeigte, dass ein Mensch, einmal aus der Bahn geworfen, kaum eine Chance hat, sich wieder mit dem normalen Leben zu arrangieren. Meist beginnt dies mit einer gescheiterten Ehe, und bei Rauschenbach war das nicht anders. Ob Alkohol die Ursache für das Scheitern oder das Scheitern Ursache für den Alkohol war, ging aus seiner Schilderung nicht eindeutig hervor.
Der Vater, so musste Anne sich anhören, habe sein Geld, das er als Tuchhändler verdiente, zielstrebig verspielt. Er selbst habe Kindheit und Jugend in einem frommen Heim verbracht, was die Ursache dafür sei, dass er noch heute einen Bogen um jede Kirche und jeden Pfaffen schlage. Früh, allzu früh, verbesserte er sich, habe er eine ältere Frau geheiratet, mit weißem Kleid und grünen Myrten, aber das sei auch das Einzige gewesen, was an eine Ehe erinnert habe. Die Frau habe mehr ausgegeben, als er verdiente – Kunsthistoriker werden nicht unbedingt gut bezahlt -, Schulden, Verlust der Arbeit, Scheidung, Gott sei Dank keine Kinder.
Während dieser Lebensbeichte dudelte irgendwo ein Plattenspieler den Gefangenenchor »Teure Heimat«, was zu ertragen gewesen wäre, hätte das Gerät nicht ständig dieselbe Platte wiederholt. Rauschenbach, von Natur mager und hochgeschossen, mit aus dem Kopf quellenden Augen, saß, während er redete, auf einem uralten, knarrenden Holzstuhl und sagte, als er endlich sein Schicksal mit Worten bewältigt hatte: »Was ist Ihnen die Expertise wert, Frau Seiler?«
»Seydlitz«, korrigierte Anne ihn höflich und fügte hinzu: »Das ist ein Missverständnis.« Und dabei zog sie eine große Fotografie aus einem Umschlag. »Ich will von Ihnen keine Expertise. Sehen Sie, ich habe hier die Kopie eines Pergaments. Von Ihnen möchte ich nun wissen, worum handelt es sich bei diesem Objekt, was ist der Inhalt des Textes, und welchen Wert würden Sie für das Original ansetzen?«
Rauschenbach nahm die Kopie in die Hand und musterte sie mit weit ausgestreckten Armen. Dabei machte er ein Gesicht, als hätte er gerade Essig getrunken.
»Tausend«, sagte er, ohne den Blick von der Fotografie zu wenden, »fünfhundert sofort, Rest bei Lieferung des Gewünschten, keine Rechnung.«
»Einverstanden«, entgegnete Anne, die schnell begriffen hatte, dass ein armer Hund wie Rauschenbach nicht aus Liebe zur Kunst arbeitete, sondern um zu überleben. Sie zog fünf Scheine aus ihrer Handtasche und legte sie auf den schwarz gestrichenen Küchentisch, der als Schreibtisch diente. »Wie lange werden Sie dafür brauchen?«
»Kommt drauf an«, meinte der Dürre und ging zu dem einzigen Mansardenfenster, das den Raum dürftig erhellte. »Kommt ganz darauf an, womit wir es hier zu tun haben. Das Original steht Ihnen nicht zur Verfügung, Frau Seiler?«
»Seydlitz.« Anne zeigte sich bemüht, möglichst wenig Information über das rätselhafte Pergament herauszugeben. »Nein«, sagte sie knapp.
»Verstehe«, knurrte Rauschenbach unwillig. »Hehlergut?«
Da brauste Anne auf: »Ich muss doch sehr bitten, Herr Doktor Rauschenbach! Mir ist das Pergament zum Kauf angeboten worden, und ich möchte von Ihnen wissen, ob es sein Geld wert ist – vor allem, was es ist. Aber wenn Sie Bedenken haben …« Anne machte das einzig Richtige, was sie in dieser Situation tun konnte: Sie gab vor, das Geld wieder einstecken zu wollen, und damit zerstreute sie mit einem Mal alle Bedenken des Mannes.
»Nein, nein«, rief dieser, »verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich bin ein vorsichtiger Mann, ich darf mir in dieser Hinsicht einfach nichts zuschulden kommen lassen. Sie dürfen nicht glauben, ich wüsste nicht, dass alle Leute, die zu mir kommen, einen Grund dafür haben. Schließlich gilt Professor Guthmann als der Experte schlechthin. Natürlich haben auch Sie einen triftigen Grund, gerade zu mir zu kommen, aber das soll mich nicht stören, solange das alles unter uns bleibt – wenn Sie verstehen, was ich meine, Frau – Seydlitz.«
Immerhin hatte er schon ihren Namen behalten, dachte Anne, und zur selben Zeit wurde ihr bewusst, dass dieser Kerl, der in der Hauptsache von Menschen aufgesucht wurde, die etwas zu verbergen hatten, immer für eine Erpressung gut war. Der Gedanke bereitete ihr Unbehagen, aber noch ehe sie die missliche Idee weiterverfolgen konnte, begann Rauschenbach, in die Fotografie vertieft wie ein Kriminalist, langsam zu sprechen:
»Soweit ich das erkennen kann, handelt es sich hier um ein koptisches Blatt, die Schrift ist jedenfalls griechisch, mit demotischen Schriftzeichen durchsetzt, typisch für das Koptische der ersten nachchristlichen Jahrhunderte. Das würde bedeuten – vorausgesetzt, das Pergament ist echt und keine Fälschung, was ich aber nur anhand des Originals feststellen könnte -, das Objekt ist mindestens eineinhalbtausend Jahre alt.«
Rauschenbach fühlte, dass Anne ihn aufgeregt anstarrte, und er versuchte ihre Erwartungen von Anfang an zu dämpfen: »Ich hoffe, Sie nicht zu enttäuschen, wenn ich Ihnen sage, dass Blätter dieser Art gar nicht selten und infolgedessen auch nicht besonders wertvoll sind. Man hat sie zuhauf in Klöstern und Höhlen gefunden, meist Urkunden ohne Bedeutung, aber auch Bibeltexte und gnostische Schriften. Bei gutem Erhaltungszustand werden für solche Pergamente tausend Mark bezahlt, aber bei diesem Stück handelt es sich, soweit ich das erkennen kann, um kein erstklassiges Objekt. Wissen Sie, Frau -«
»Seydlitz!«, ergänzte Anne aufgeregt.
»Wissen Sie, Frau Seydlitz, es gibt nicht viele Sammler für koptische Manuskripte, und Museen und Bibliotheken sind nur an ganzen Rollen, vor allem an zusammenhängenden Texten interessiert, welche als Grundlage für wissenschaftliche Forschungen dienen.«
Anne nickte: »Ich verstehe. Sie können sich also nicht vorstellen, dass dieses Pergament – wieder vorausgesetzt, es ist auch echt – für irgendwelche Leute ein Objekt besonderer Begierde sein könnte?«
Rauschenbach sah Anne ins Gesicht. Die seltsame Formulierung schien ihn zu beeindrucken. Er versuchte ein Lächeln. »Wer will schon wissen, was für wen zum Objekt der Begierde werden kann. Tausend Mark«, meinte er schließlich, während er den Kopf schüttelte, »mehr würde ich dafür nicht ausgeben.«
Anne überlegte, wie sie dem anderen die Bedeutung dieses Pergaments nahe bringen konnte, ohne sich selbst zu verraten. Sie hätte Rauschenbach natürlich alles erzählen können, was bisher passiert war, aber sie zweifelte, ob er ihr überhaupt glauben würde. Und außerdem fehlte es ihr an Vertrauen, und deshalb bat sie, er möge ihr den Text so genau wie möglich übersetzen oder zumindest inhaltlich wiedergeben.