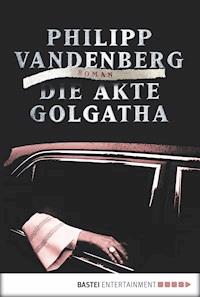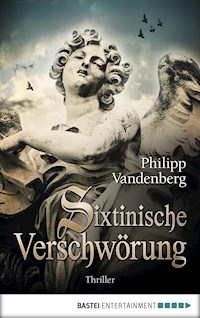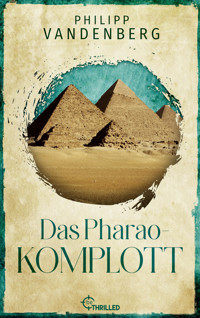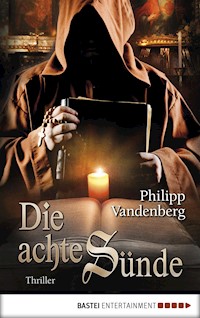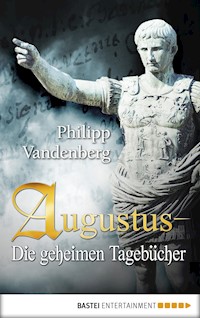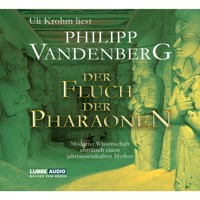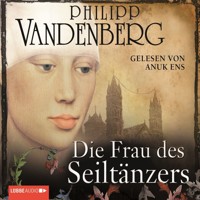4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Europa im fünfzehnten Jahrhundert. Michel Melzer, ein Spiegelmacher aus Mainz, reist in das ferne Konstantinopel, um sein Glück zu machen. Durch Zufall gelangt er dort in den Besitz einer Erfindung, die unermesslichen Reichtum verspricht: das Geheimnis der künstlichen Schrift. Dadurch gerät er in den Konflikt zwischen dem Kaiser von Byzanz und dem türkischen Sultan, dem Papst in Rom und dem Dogen von Venedig. Doch der Spiegelmacher lässt sich allein vom Zauber der schönen Lautenspielerin Simonetta blenden, die im Dienst einer fremden Macht steht, welche die Schwarze Kunst für ihre eigenen Zwecke missbrauchen will...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 675
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
PHILIPPVANDENBERG
DERSPIEGELMACHER
ROMAN
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 1998/2014 by
Bastei Lübbe AG, Köln
Lizenzausgabe in der Bastei Lübbe AG, Köln
Einbandgestaltung: Guido Klütsch, Köln
Titelbild: »Scherzendes Paar mit Spiegel« (um 1596),
Gemälde von Hans von Aachen (Ausschnitt)
Innenillustrationen:
Stadtansichten von Konstantinopel und Venedig aus dem Liber Chronicarum (Weltchronik) des Hartmann Schedel, gedruckt zu Nürnberg, 1493
Stadtansicht von Mainz aus dem Liber Chronicarum (Weltchronik) des Hartmann Schedel, gedruckt zu Augsburg, 1497
Bildvorlagen: Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-5771-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Mehr als das Goldhat das Blei in der Welt verändert.Und mehr als das Blei in der Flintedas im Setzkasten.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
INHALT
Zu Anfang das Ende
KAPITEL I
Die Spiegel von Mainz
KONSTANTINOPEL
KAPITEL II
Das Geheimnis des Würfels
KAPITEL III
Die Hand im Spiel des Teufels
KAPITEL IV
Das Fest am Hofe des Kaisers
KAPITEL V
Die dunkle Seite des Lebens
KAPITEL VI
Das Schicksal in der Kugel
VENEDIG
KAPITEL VII
Die Schatten des Verbrechens
KAPITEL VIII
Freiheit und Versuchung
KAPITEL IX
Der Fluch der Schwarzkunst
KAPITEL X
Die zwei Gesichter eines Lebens
KAPITEL XI
Wahre Liebe und falsche Gefühle
KAPITEL XII
Das seltsame Rauschen im Ohr des Dogen
KAPITEL XIII
Die Träume des Leonardo Pazzi
KAPITEL XIV
Der Zorn des Himmels und der Hölle
MAINZ
KAPITEL XV
Die Frau mit den dunklen Augen
KAPITEL XVI
Die Weisheit in den Wäldern
KAPITEL XVII
Schmerz im Schatten der Liebe
Die Fakten
Die Personen
ZU ANFANG DAS ENDE
Es ist dies das Eintausendvierhundertachtundachtzigste Jahr seit der Fleischwerdung des Herrn, und gewiss wird es – so diese Welt das Jahrhundert überdauert – einmal heißen, es sei ein gar unwichtiges, unbedeutendes, unmaßgebliches Jahr gewesen. Was mich nicht juckt. In meinem Alter ist das Bedürfnis nach Wichtigkeiten ohnehin gering. Nein, für einen Greis wie mich gewinnen ganz andere Dinge an Bedeutung.
Wie viel Zeit habe ich verschwendet, irdische Güter anzuhäufen, wie viel Gefühl, um das zu erleben, was gemeinhin als Liebe beschrieben wird! Nun, da mein Bart weiß ist wie das Fell eines Schneehasen und meine Männlichkeit zwischen den Beinen hängt – erspart mir jeden Vergleich –, nun, da mein Buckel krumm und mein Augenlicht nur noch nützlich ist, den Tag von der Nacht zu unterscheiden, da ich also unzufrieden, unglücklich, schwermütig und von Gram zerrissen sein müsste, empfinde ich seltsame Zufriedenheit und ein gewisses Glück. Fragt nicht warum, es ist widersinnig genug.
Ich, Michel Melzer, Spiegelmacher von Mainz und Schwarzkünstler dazu, zähle hier im Gewölbe des Erzbischofs meine Tage, und ich wundere mich, wie lange ich schon zähle, und frage mich täglich, wie lange ich noch zählen soll, wo meine Uhr, die das Schicksal einem jeden hinstellt, doch längst abgelaufen sein müsste. Sind es achtundsiebzig Jahre oder weniger – was kümmert’s mich? Und Euch schon gar nicht!
Obwohl ich seit Laurenzi Anno ichweißnichtmehr hier sitze und die Schergen mir alles andere als wohlgesinnt sind, obwohl mein Leben auf drei Schritte nach vorn und zwei zur Seite eingeengt ist, erscheint mir dieser Sommer als der glücklichste meines Lebens. Ihr werdet fragen, warum. Ich werde Euch die Antwort geben.
Teilt sich das Leben nicht von Anfang an in Licht und Schatten – in Krieg und Frieden, Arbeit und Muße, Leidenschaft und Gleichmut, Chaos und Harmonie? Wenn dem so ist, so lebe ich hier und jetzt am Ende meiner Tage in Frieden, Muße, Gleichmut und Harmonie. Gibt es ein besseres Leben als dieses?
Nun, da ich mich an diesen Ort gewöhnt habe, fernab von Chaos, Leidenschaft, Arbeit und Krieg; nun, da es mir Glück bedeutet, den Morgenstrahl der Sonne zu erwarten und das Abendgeläute von St. Alban zu vernehmen; nun empfinde ich mehr Zufriedenheit als in meinen sogenannten besten Jahren.
Meine Zelle teile ich mit einem Spinnentier, welches auf Nahrungssuche in der Dämmerung täglich denselben Weg an der Längswand gegenüber meiner Holzpritsche zurücklegt. Anfangs musste ich mich still halten, damit die Spinne ihren Weg zu dem vergitterten Fenster fortsetzte, doch seit geraumer Zeit haben wir uns so aneinander gewöhnt, dass das Getier in der Mitte der rauen Wand einhält, sich einmal um die eigene Achse dreht, als wollte es mir einen Gruß zuteilwerden lassen, und sich dann geradewegs seinem Ziel nähert, dem Mauervorsprung der Luke, auf dem es seine Nahrung findet.
Ich hätte wirklich nicht geglaubt, dass ich auf meine alten Tage noch zum Arachnologen würde. Doch ich schätze die Spinne. Nicht nur, weil sie mir alles Ungeziefer vom Leibe hält, sondern auch wegen ihrer prophetischen Gabe. Sie vermag durch ihr Verhalten das Wetter vorherzusagen, und dabei irrt sie nie. Bewegt sie sich hastig und schnell, so kündet sie Sturm, Regen und düstere Wolken an. Ist ihr Lauf aber gleichmäßig ruhig, so bedeutet dies einen heiteren Himmel. Dem nicht genug, wies mir die Spinne sogar den rechten Weg, meine Erinnerungen der Nachwelt weiterzugeben, was mir von höchster Stelle untersagt worden war, weil die hohen Herren nichts mehr fürchten als die Wahrheit. Und Ihr wisst ja, wer die Wahrheit redet, findet selten geneigte Zuhörer.
Ich glaube, sie wollten mich mundtot machen, sogar leibestot, als sie mir Papier und Feder, meinen kostbarsten Besitz, wegnahmen. Doch die Pfeffersäcke in den schwarzen Talaren vergaßen mich zu verbrennen. Sie scheinen noch immer nicht begriffen zu haben, dass die größte Gefahr von den Gedanken ausgeht; und Gedanken nehmen ihren Lauf, solange der Mensch atmet.
Also folgte ich, in Gedanken verloren, dem immer wiederkehrenden Lauf der Spinne bis zu jenem Tag, an welchem sie, Gott weiß warum, einen anderen Weg einschlug, und zwar auf jene Seite, wo mein Lager stand. Sie kam mir zum Greifen nahe, und plötzlich verschwand die Spinne in einer Mauerritze, der ich bisher keine Beachtung geschenkt hatte.
Als sie tags darauf nicht mehr auftauchte, versuchte ich den Spalt in der Mauer zu erkunden. Verwundert stellte ich fest, dass der Ziegel locker in der Wand steckte, und nach heftigem Rütteln löste sich der Stein aus dem Gemäuer. Wie erschrak ich, als in der armdicken Öffnung das bleiche Gesicht eines Mannes erschien. Doch noch mehr als ich erschauerte der andere. Er glaubte wohl, Beelzebub in Person blicke aus der Mauer.
So dauerte es eine Weile, bis wir uns durch das enge Loch ein Bild voneinander gemacht und so viel Zutrauen zueinander gefunden hatten, dass wir uns überwanden, ein Gespräch aufzunehmen. Es endete für uns beide mit der Erkenntnis, dass wir einander nicht zu fürchten hatten; schließlich erduldeten wir das gleiche elende Schicksal. Der andere – ich nenne ihn so, weil er sich weigerte, seinen Namen zu sagen –, dieser andere büßte für den Frevel, eine Nonne der heiligen Hildegard verführt und sie gesegneten Leibes gemacht zu haben, was nach dem Willen der Kirche zwar eine Sünde, aber durchaus absolutabel sei, solange der Samenspender sich heftigst bekreuzige und die Tat ebenso entschieden leugne. Beides aber lehnte er ab. Als die ehrwürdige Mutter gar ein Paar gesunder Zwillinge gebar – was selbst in zölibatären Kreisen als besonderer Segen des Allerhöchsten betrachtet wird – und als der gesegnete Vater sein augustinisches Gewand an den Nagel hängen und die Nonne heiraten wollte, da wurde er von den Oberen des Irrsinns bezichtigt und hierher gebracht. Er meint deshalb, dies sei gar kein Gefängnis, sondern ein Irrenhaus.
All das und noch mehr erfuhr ich durch das Loch in der Mauer in einer einzigen Nacht. Aus Furcht vor Entdeckung schob ich den Stein wieder an seinen Ort. Am folgenden Tag ließ mich der andere wissen, er verfüge über Papier und Tinte und die Möglichkeit, seine Gedanken niederzuschreiben, doch – behauptete er – ihm selbst sei nicht an Worten gelegen.
Am dritten Tag hatten wir bereits Zutrauen zueinander gefasst, und der andere erbot sich, als er erkannte, wie sehr ich unter dem Schreibverbot litt, wohl mehr aus Langeweile, aufzuzeichnen, was ich zu sagen hätte.
Und bei Gott, ich habe viel zu berichten! Zwar weiß keiner von uns beiden, ob er diese Mauern je lebend verlassen und ob nicht die ganze Arbeit vergeblich sein wird; aber mir geht es darum, meine Ehre zu retten. Und besteht nur ein Funken Hoffnung, dass meine Aufzeichnungen den Kerker überdauern, so will ich nichts unversucht lassen.
Zwar gönne ich den Reichen ihr Gold, den Frommen das ewige Leben und den Erleuchteten die Glückseligkeit ihres Wissens, aber jenem perfiden Gensfleisch gönne ich nicht den Triumph, sich als Weltveränderer zu brüsten, weil es nicht die Wahrheit ist. Jeder Triumph ist das Ergebnis eines himmelschreienden Betruges; und das, was ich zu berichten habe, ist die Geschichte meines lebenslangen Kampfes gegen jenen Rivalen, der, von Kussmäulern und Sausuhlen umgeben, mit dem Satan im Bunde stand oder jenen Zwischenwesen, welche Oriens, Amaymon, Paymon und Egim heißen. Das hat man zwar auch mir nachgesagt, aber ich schwöre bei der Liebe zu Simonetta, dem einzigen Lichtblick in meiner Dunkelheit: Es ist nicht die Wahrheit – auch wenn es den Anschein haben mag, weil ich schon bald mit völliger Blindheit geschlagen sein werde.
Schon immer galten Menschen, die sich mit Dingen beschäftigten, welche anderen fremd und unerklärlich sind, als Magier, Zauberer und Meister der Schwarzen Kunst. Merkwürdig nur, dass noch keiner den Pfaffen diesen Vorwurf machte, wo sie doch jahraus, jahrein nichts anderes tun. Als ich noch Spiegel schliff, mit deren Hilfe fromme Menschen die Strahlen des Heiligen Geistes und tumbe Tore die wundertätige Wirkung der vollgeschissenen Windeln des lieben Jesuleins einzufangen glaubten, da schien mein Werk sogar dem Papst im fernen Rom genehm. Als aber aus meinen Spiegeln lüsterne Weiber hervorlugten und ihre Röcke hoben bis zur Scham und ihre fetten Brüste zeigten ohne Tuch darüber, da nannte mich der Erzbischof in aller Öffentlichkeit einen Hexenmeister und meine Kunst verwerflich, obwohl gerade er wissen müsste, dass die Wahrheit im Auge des Betrachters liegt – zumal er selbst zu meinen besten Kunden zählte.
Als ich vermittels jener Kunst, um die ich mich seit Jahr und Tag mit dieser Ausgeburt des Satans streite, an einem Tag der heiligen Mutter Kirche mehr an Pfründen einbrachte als die Mönche von dreißig Klöstern, da wurde mir neben gutem Lohn sogar ein vollkommener Ablass zuteil, welcher für alle Zeiten alles verzieh, was ich je an Sünden begangen haben sollte und begehen würde. Ihr seht ja, was so eine Sündenvergebung wert ist: nicht das Papier, auf dem sie gedruckt ist! Dabei habe ich nichts verbrochen, außer dass ich mit eigenen Augen gesehen habe, was ich nie hätte sehen dürfen – und, bei allen Heiligen, mein Augenlicht war damals noch scharf wie das eines Adlers.
Aber ich will nicht klagen, auch wenn es jeden Tag um mich herum dunkler wird. Ich habe genug gesehen, viel mehr, als sich ein einfacher Spiegelmacher aus Mainz hätte träumen lassen. Ich habe in einer Zeit gelebt, die aus den Fugen geraten ist wie noch nie zuvor, in einer Welt, die ihr Aussehen verloren hat, in der das Unterste zuoberst und das Obere ganz unten ist. Sogar ihre Form hat diese Welt verändert und ihre Richtung. Dreitausend Jahre segelte man nach Osten, um nach Indien zu gelangen; nun auf einmal heißt es, musst du nach Westen fahren und gelangst ebenso nach Indien. Aber was will ein alter Mann wie ich in Indien!
Waren das noch Zeiten, als Kriege mit dem Kopf und, wenn es sich nicht vermeiden ließ, mit Muskelkraft geführt wurden – anständige Kriege und Schlachten Mann gegen Mann. Der Bessere, Stärkere und Schnellste siegte, und er hatte es verdient. Und heute? Heute werden Kriege durch das Schwarzpulver entschieden. Du brauchst kaum noch zu zielen. Je mehr Geschosse du in Richtung des Feindes feuerst, desto größer die Hoffnung auf den Sieg. Welch eine Zeit, in der sich der Feind nicht einmal auf Sichtweite nähert, in welcher Gegner zu Tode kommen, ohne ihren Widersachern je begegnet zu sein! Wenn das so weitergeht, werden noch Feldherren allein gegeneinander ins Feld ziehen, nur die Lunten entzünden und mit einem einzigen Geschoss das gesamte feindliche Heer niedermetzeln.
Welch eine Zeit, in der es mehr Huren gibt beim Konzil als Bischöfe, in der sich Mönche und Nonnen in den Klöstern zerfleischen und die Oberen sich nach dem astrologischen Kalender begatten, um den Übermenschen zu zeugen! Ist es ein Wunder, wenn auf diese Weise menschliche Kreaturen mit drei Augen und einer gespaltenen Lippe geboren werden oder Kühe mit zwei Köpfen zur Welt kommen oder nackte Katzen oder Fische, die ihr Element verlassen und fliegen wie Lerchen?
Die Welt giert nach Außergewöhnlichem, nach Magiern, die mit dem Bauche reden statt mit dem Mund, die Steine in Käse verwandeln und Wasser bergan fließen lassen. Ein Esel, der Harfe spielt, findet mehr Interesse als die Rede eines Philosophen; ein Goldscheißer, der dies vor aller Augen tut, stellt jeden Prediger in den Schatten. Und hätte Hieronymus Bosch, der berühmteste Maler unserer Tage, gemalt wie die anderen großen Künstler vergangener Zeiten, so würde sein Name schon bald der Vergessenheit anheimfallen, wie es den anderen erging. Er aber zerrt die Teufel aus der Hölle, lässt die Geister vom Himmel schweben, gibt Nonnen das Antlitz von Lästerweibern und Bischöfen das von Gespenstern, zeichnet Zwitter und Schimären, und über allem hängt die Verdammnis der Menschheit in grellen Farben.
Welch eine Zeit, in der die Fratze mehr bedeutet als ein schönes Antlitz; in der sich Päpste ihre eigenen Magier halten und Könige ihre Kristallkugel-Propheten! Welch eine Zeit, in der Mütter die Flüssigkeit aus der Nabelschnur ihrer Neugeborenen feilbieten, welche, so man nur recht daran glaubt, zur ewigen Jugend verhelfen soll; in der ein abgehackter Wieselschwanz die Zahnpein vertreiben und trinkbares Silber die französische Krankheit heilen soll. Gebildete Mönche, die früher der Kontemplation nachgingen und frommen Gebeten, erschnuppern aus fremdem Urin die bevorstehende Geburt eines Kindes. Von Alchemisten werden immer schlimmere Elixiere erfunden, welche Träume und Trugbilder vermitteln und ein bisschen Glückseligkeit für den Augenblick, aber, kaum sind sie verflogen, die süchtigen Menschen zu Fetzen verfaulen lassen.
Salz und Honig, seit Erschaffung der Welt willkommen als das Gewürz der Erde, haben ausgedient und genügen unserem Geschmack schon lange nicht mehr. Für ein paar Säcke Pfeffer, Zimt, Ingwer und Gewürznelken reisen manche nach Arabien und Indien, und jene, deren Gaumen durch nichts anderes gekitzelt werden kann, wiegen diese mit Gold auf. Dabei ist bekannt, dass Gewürze der triefenden Zunge nur etwas vorgaukeln, was gar nicht vorhanden ist, vergleichbar der bunten Welt eines Märchenerzählers oder der Krume vom Letzten Abendmahl, die jetzt überall herumgezeigt wird. Ist’s nicht von Nutzen, so schadet es wenigstens nicht – im Gegensatz zu den Gewürzen des Orients. Die zersetzen die Gedärme, und was der Zunge für kurze Zeit Lust bereitet, bringt den Innereien den Tod.
Wem aber, frage ich, habe ich geschadet, ich, der Spiegelmacher Michel Melzer, als ich – lange ist’s her – verkündete, in meinen Spiegeln könne jeder sein Glück erkennen, so er nur lange genug hineinstarre und an dieses Wunder glaube. Dass ich dem Glück bisweilen ein wenig nachhelfen musste, das mögen mir jene, die es traf, verzeihen – betrogen habe ich sie nicht. Nicht einmal jene sechsunddreißig Mönche vom Orden des heiligen Benedikt, denen ich in jener Nacht einen Augenblick Glückseligkeit versprach und sie die Wollust in personam sehen ließ. Noch nach Tagen waren sie verzückt wie der heilige Antonius, als hätten sie wirklich einen verbotenen Blick ins Paradies getan. Da wurde mir klar, dass ein Spiegel die Macht hat, Menschen zu verändern, und ich machte reichlich Gebrauch davon.
Das Leben ist vom Kindbett bis zum Totenbett eine Anhäufung von Wünschen. Doch die Erkenntnis, dass die meisten unerfüllbar bleiben, ist den wenigsten eigen. Töricht greifen wir zu jedem Mittel, das uns Hoffnung macht. Da wird von einem Spiegel gewiss der geringste Schaden angerichtet.
Doch will ich der Reihe nach erzählen, wie sich die Dinge zugetragen haben. Ich will nichts auslassen und nichts beschönigen und hoffe nur, dass Ihr, mein treuer Zellennachbar, genug Eichengallentinte zur Verfügung habt. Ihr braucht nicht jedes meiner Worte aufzuschreiben und mögt ruhig selbst entscheiden, was Euch wichtig erscheint und was nicht. Doch nehme ich Euch das Versprechen ab, nichts zu verfälschen oder zu verdrehen und, beim heiligen Eid auf Eure geschwängerte Nonne, auch Anstößiges nicht zu verschweigen und meine Geschichte wahrheitsgemäß zu berichten.
In der fünften Woche der Fasten – was mir indes nichts ausmacht, da ein Alter wie ich ohnehin nur noch von Erinnerungen lebt.
Michel Melzer
KAPITEL I
DIE SPIEGEL VON MAINZ
Bis zu seinem siebten Jahr war Michel Melzer der einfältigste Tropf unter der Sonne, aufgeweckt zwar und neugierig, aber dabei hatte er, wie es schien, kaum Verstand genug, die Bibel zu begreifen. Nur Wunder, von denen es im Buch der Bücher nicht wenige gibt, erregten sein Interesse, und Oswald, wie sein Vater hieß, musste ihm, so es die Zeit und das spärliche Licht in der Werkstatt erlaubte, vorlesen, wie Moses die Schlange verhext oder das Wasser aus dem Fels gezaubert hatte, und der Junge wünschte nichts mehr, als selbst ein Prophet zu werden wie Moses.
Sein Vater ließ die Frage nach dem hehren Berufsziel zunächst unbeachtet wie die meisten Fragen aus Kindermund. Später, als Michel nicht nachließ in seinen Erkundigungen nach einer prophetischen Ausbildung, sah Oswald Melzer sich genötigt, seinem Jüngsten alle weiteren Fragen zu verbieten. Statt einer Antwort bekam Michel vom Vater einen Spiegel aus eigener Fertigung samt dem Hinweis, er solle sich gefälligst mit diesem beschäftigen, früher oder später müsse ihn der Spiegel ernähren. Vor allem solle er vorsichtig damit umgehen, weil ein aus eigener Schuld zerbrochener Spiegel ewiges Unglück auf seinen Besitzer ziehe. Diese Worte blieben nicht ohne Eindruck.
Obwohl oder weil er diese Rede nicht begriff, beschäftigte sich der Junge tagein, tagaus mit seinem Spiegel. Seine Mutter, eine gottesfürchtige Frau, fand ihn oft dumpf vor sich hin starrend oder wie gelähmt in den Spiegel blickend unter dem Fenster oder vor der Haustür oder in den Ästen eines nahen Baumes, und wenn sie fragte, was Michel tue, bekam sie von ihm keine Antwort. Nicht selten geschah es sogar, dass sie Michel abends stumm und wie von Sinnen ins Bett bringen musste, und so erwarteten seine Eltern mit Bangen den Ausbruch einer krankhaften Narrheit.
Um den Knaben von dieser Selbstbespiegelung abzubringen, beschlossen seine Eltern, ihn in die Schule zu schicken. Und da Oswald Melzer den Schulen der Mönche nicht traute, die seinem Sohn nur den Kopf verdrehen und ihn zu einem Pfaffen machen würden, gab er ihn in die Obhut eines Tutors, eines gelehrten Mannes und Freigeistes, der sich Bellafintus nannte und auf dem Großberg eine kleine Schar von Schülern in den Anfangsgründen des Lateinischen und Griechischen unterrichtete, um selbst die Freiheit zu haben, seinen eigenen, verborgenen Studien über die menschliche Natur nachzugehen. Dort erwies sich der kleine Michel als ein aufgeweckter Knabe mit einer besonderen Begabung für fremde Sprachen, auch wenn er lieber den Erzählungen der griechischen Zugehfrau oder den unwahrscheinlichen Berichten des italienischen Gärtners über die Wunder Venedigs lauschte, als die trockenen Klassiker des Altertums oder die Schriften der Kirchenväter zu übersetzen. Doch stets behielt er seinen Spiegel bei sich, den ihm der Vater gegeben hatte, und immer noch fand man ihn mitunter, in einer Ecke seines Zimmers kauernd, in die Betrachtung dessen versunken, was er darin außer seinem eigenen Gesicht noch sehen mochte.
Als der Junge nach Jahren des Lernens, Schweigens und der Betrachtung seines Spiegels – inzwischen war Michel zu seinem Vater in die Lehre gegangen – zu reden begann, entwickelte er die bewunderungswürdigsten Fantasien, welche tausendmal mehr wert schienen als der nüchterne Menschenverstand. Ein Blick in den Spiegel bewirkte die hellsten Ideen; ja, der junge Melzer schien Dinge zu erkennen, welche der Zukunft oder dem verborgenen Wissen der Nigromantie vorbehalten waren.
Es begann damit, dass der Lehrling Melzer Blei, Zinn und Antimon mit einem Zusatz von Wismut zu einer glänzenden Legierung schmolz und in eine leicht gewölbte Form goss wie eine umgedrehte Schale. Dieser Wölbspiegel begann nach tagelanger Bearbeitung mit dem Schleifstein zu glänzen wie der Mond in der Nacht, und wer ihm mit den Augen nahe kam, den gab der Spiegel auf denkwürdige Weise wider, nicht wie nach der Natur zu erwarten, sondern so, als lägen Jahre zwischen dem Einfall des Augenlichts und der Reflexion: Dünne, magere, selbst unterernährte Müßiggänger, Bettelvögte und Seifensieder, denen garstige Arbeit die Wangen geschmälert hatte, als habe der Tod seit Lichtmess schon mehrmals angeklopft, erkannten sich in den Wölbspiegeln feist und gesund.
Vonseiten des Spiegelmacherlehrlings bedurfte es da nur noch geringer Überzeugungskraft, um zu verkünden, ihnen wie den übrigen Menschen stünden bessere Zeiten bevor. Zu seinem Vorteil fügte es sich, dass fünf fruchtbare Sommer aufeinanderfolgten und Winter, die das Wort nicht verdienten, und es so viel zu essen gab, dass sogar Hühner und Schweine sich an Dingen labten, die für gewöhnlich nur der Obrigkeit vorbehalten sind.
Diesen Überfluss, so ging es in Mainz bald von Mund zu Mund, habe der Spiegelmacher Michel Melzer allein vorhergesehen.
Die fünf fetten Jahre waren noch nicht vergangen und Melzer war nun schon Geselle, da goss er einen neuen Spiegel von ganz anderer Art. Er wölbte ihn zur Innenseite und fertigte so einen Hohlspiegel, der die satten, fetten Köpfe der Wohlgenährten eingefallen und mager erscheinen ließ. Und alle, die einen Blick in diesen Spiegel geworfen hatten, verfielen in Demut, und sie begannen, da sie nun große Not befürchteten, die Nahrung zu horten, welche zuvor den Tieren zum Fraß vorgeworfen worden war.
Das Wunder geschah. Bald darauf vernichteten Fröste von September bis Mai jede Ernte. Kein Saatkorn wuchs zum Halm, keine Knolle gedieh, es gab keine Blüten auf den Bäumen, und an Rhein, Main, Mosel und Nahe wurden alle Weinstöcke vernichtet. Doch während andernorts der Hunger Einzug hielt und die Menschen starben, hatten die Bürger von Mainz dank der spiegelnden Prophetie des Michel Melzer so viel an Vorräten gehortet, dass der Hunger nur wenige Opfer forderte, und alten Wein gab es im Überfluss.
Der junge Spiegelmacher aber wurde gefeiert, weil er mithilfe seiner Spiegel die Gabe der Prophetie zu besitzen schien, und viele nannten ihn sogar einen Zauberer. Michel Melzer dachte nach, fand jedoch beim besten Willen keine Erklärung für seine angebliche Zauberei außer jene, dass wir doch alle Zauberer sind, weil wir uns alle unsere eigene Welt zurechtzaubern. Ist es nicht so?
Bei allen Heiligen und den Gesetzen der Natur, nichts lag dem Spiegelmacher ferner als Scharlatanerie oder Gaukelspiel! Aber so oft er es auch sagte, man wollte ihm nicht glauben und schrieb ihm und seinen Spiegeln hellseherische Fähigkeiten zu, und sein Handwerk blühte, dass er kaum mit der Arbeit nachkam.
In der Spielmannsgasse hinter dem Dom, wo die Blechschläger, Zinngießer, Gold- und Kupferschmiede zu Hause waren, richtete sich Michel Melzer als Meister eine neue Werkstatt ein und nahm zwei Gesellen für ein Brotgeld von zwei Schillingen. Der eine schrieb sich Gothardt Huppertz und stammte aus Basel, wo sein Vater, ein Nadelmacher, sich zu Tode gesoffen, und seine Mutter aus Gründen der Not einen reichen Brauer geehelicht hatte, dass Gott ihr gnädig sei. Von dem anderen, einem gewissen Johann Gensfleisch, wird noch öfter die Rede sein und nicht nur auf angenehme Weise.
War der eine, vom Schicksal und Jahren der Entbehrung gezeichnet, ein gottesfürchtiger, ehrlicher Geselle, so geriet der andere schon bald mit seinem Meister in Zwiespalt. Vor allem zweifelte Gensfleisch die seherische Wirkung von Melzers Spiegeln an, bezichtigte ihn gar der Scharlatanerie wie die Magier und Astrologen, die aus so unterschiedlichen Stoffen wie den menschlichen Exkrementen oder dem Lauf der Gestirne die Zukunft vorhersagten – noch dazu gegen Geld!
Der Kritik des Gesellen vermochte Melzer kaum etwas entgegenzusetzen als den Hinweis, nicht er habe die fetten und mageren Jahre vorhergesagt, sondern die Menschen selbst seien es gewesen, die ihr Schicksal in den Spiegeln erkannt hätten. Am liebsten hätte Melzer den Rummel um seine Spiegel ungeschehen gemacht, doch diese verschafften ihm inzwischen ein respektables Einkommen, und wer verschnürt schon den Geldsack, wenn andere ihn gerade füllen.
Hinzu kam, dass Melzer die unverhoffte Bekanntschaft der Ursa Schlebusch machte, einer wunderschönen elternlosen Jungfrau, welche aus dem Kölner Büßerinnenkonvent entsprungen war, wo ihr eine christliche Erziehung und die Vorbereitung für ein klösterliches Leben zuteilwerden sollte. Ursa jedoch zeigte sich in dem strengen Konvent mehr der Freude des Lebens, dem Singen und Lachen zugetan, und beim stundenlangen Gebet auf den Knien fehlten ihr die nötige Einkehr. Daher hatte sie sich bei der erstbesten Gelegenheit unter den Deckmantel einer Pilgerschar aus Mainz begeben, welche dem Schrein der Heiligen Drei Könige ihre Aufwartung gemacht hatte, und sich ihnen auf der Rückfahrt angeschlossen. Damit Ursa dem leichtfertigen Leben oder der Schande entging, von Rutenschlägern am helllichten Tage aus der Stadt getrieben zu werden, nahm Melzer die Maid bei sich auf.
Das war nicht schicklich und für seinen und des Mädchens Ruf in gleicher Weise schädlich, zumal der Geselle Gensfleisch das Ereignis überall hinausposaunte. Es gab daher nur eine Möglichkeit, den Marktweibern, Großsprechern und Gerüchtemachern die lasterhaften Mäuler zu stopfen: Michel Melzer musste das schöne Mädchen aus dem Büßerinnenkonvent, dessen Herkunft außer ihm selbst keiner kannte, heiraten. Dass Ursa erst vierzehn Jahre zählte, rief dabei weniger Erstaunen hervor als die Schnelligkeit, mit der Melzer seinen Plan in die Tat umsetzte.
Zwar hielten damit wieder Recht und Ordnung Einzug in der Spielmannsgasse, aber die Zwietracht mit seinem Gesellen steigerte sich zur offenen Rivalität. Gensfleisch machte Ursa schöne Augen, und Melzer setzte, von Eifersucht getrieben, alles daran, seine junge Frau zu schwängern. Mehrmals am Tag und sooft es seine Manneskraft erlaubte, begattete er Ursa mit großer Heftigkeit und besessen von dem Gedanken, einen Sohn zu zeugen. Und seine Brunft ließ erst nach, als Ursas Leib deutliche Anzeichen einer Schwangerschaft zeigte.
Melzer war glücklich, und Gensfleisch stellte seine Nachstellungen ein. Aber das Glück ist launisch wie das Wetter im April, wo sonnige Tage und Unheilsstürme dicht beieinanderliegen. Es war eine schwere Geburt, und Ursa verlor sehr viel Blut dabei. Ihr Blut sei noch zu jung gewesen, um ein Kind zu ernähren, sagte die Hebamme, und daher habe der Körper es abgestoßen. Wie dem auch sein mochte: Ursa erholte sich nie wieder von den Strapazen, sondern siechte bleich und blutleer dahin.
Das kleine Mädchen dagegen, gestärkt durch die Milch einer kräftigen Amme, wurde zu einem rechten Sonnenschein, und Melzer gewann es über alle Maßen lieb. Er taufte es auf den Namen Editha, nach der Märtyrerin, an deren Tag es zur Welt gekommen war, und ließ ihm alles Wohlwollen zuteilwerden, das sich ein Kind seines Standes und Geschlechts wünschen konnte. Da wurde Melzer aufs Neue vom Leid geprüft.
Die kleine Editha war gerade drei Jahre alt, da starb ihre Mutter nach langem Siechtum. Zwar gab es Stimmen unter dem Gesinde des Spiegelmachers, der Meister habe sich, da ihm ein Sohn versagt geblieben sei, in seiner aufgestauten Brunst auf sein Weib geworfen, und dies sei für ihren geschwächten Leib zu viel gewesen. Doch dies war ein übles Gerücht, und als Melzer ihm nachging, wiesen alle Finger auf seinen Gesellen Gensfleisch, der dies verbreitet habe, was selbiger freilich entschieden bestritt. Nein, Ursa war einfach erloschen, wie eine Flamme erlischt, weil sie nicht genug Kraft zum Leuchten hat.
Doch von Stund an wurde das aufgeweckte, fröhliche Mädchen, zu dem die kleine Editha sich entwickelt hatte, von Schwermut befallen, und dies traf den Vater mehr noch als der Tod seiner geliebten Frau, der ihm als eine gewisse Erlösung erschienen war. Trübe und stumpf starrte die Kleine vor sich hin, und nicht die freundlichsten und liebevollsten Worte und das schönste Spielzeug, mit dem der Spiegelmacher sie überhäufte, konnten ihr auch nur ein Lächeln entlocken. Es war, als wäre mit dem Tod ihrer Mutter auch Edithas Lebensfreude erloschen.
In seiner Not wandte sich Melzer an Bellafintus, den Magister vom Großberg, der behauptete, dass jedes Gebrechen, ob nun eine Krankheit des Geistes oder des Körpers, eine natürliche Ursache habe. Er erbot sich, Editha die Lebensfreude zurückzugeben. In diesem Falle, erklärte er, seien durch die Erregung, welche der Verlust der Mutter bewirkt habe, die vier Körpersäfte – Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Phlegma – in Unordnung geraten, sodass die schwarze Galle überwiege, welche Schwermut hervorrufe, und jene gestörte Ordnung gelte es durch einen gezielten Eingriff wieder ins Lot zu bringen. Für zwei Kühe oder den Gegenwert eines Pferdes, versprach Bellafintus, sei er in der Lage und bereit, das Kind zu heilen.
Ein Spiegelmacher wie Melzer verfügte nicht über zwei Kühe, über ein Pferd schon gar nicht. Dies entsprach dem Verdienst eines Jahres. So nahm das Schicksal seinen Lauf.
Der Geselle Johann Gensfleisch erkannte die Geldnot seines Meisters und entbot sich, ihm zu einem Geschäft zu verhelfen, welches mehr Geld einbringen könne als alle gewölbten und gehöhlten Spiegel zusammen. Doch stelle er zur Bedingung, an jenem einträglichen Handel zur Hälfte beteiligt und darüber hinaus als Teilhaber der Werkstätte aufgenommen zu werden.
Sorgen machen blind; das haben sie mit der Liebe gemeinsam. Doch wenn Sorgen und Liebe sich mit Kummer und Schuld vereinigen, dann setzt der Verstand aus, und Verderben breitet sich aus.
Wenn, so erklärte Gensfleisch seinem Meister, das gemeine Volk bereit sei, die Zukunft in gewölbten und gehöhlten Spiegeln zu erkennen, dann sei es ein Leichtes, ebendieses Volk von einer weiteren geheimen Kraft der Spiegel zu überzeugen.
Melzer sah Gensfleisch fragend an. Er konnte sich beim besten Willen kein Bild machen, was jener im Schilde führte.
Nun, meinte der Junker, er, Melzer, habe konvexe und konkave Spiegel geschliffen, welche den Betrachter in widernatürlichen Bildern größer oder kleiner erscheinen ließen. Ein ebener Spiegel sei zwar schwerer zu fertigen, bringe aber ungeahnte Vorzüge an den Tag, sofern er nur glatt und gerade sei wie die Oberfläche des Wassers.
Melzer verstand noch immer nicht.
Seht, fuhr Gensfleisch fort, nicht nur, dass ein ebener Spiegel den Betrachter ebenmäßig wiedergebe; ein gerade geformter Spiegel habe auch den Vorzug, die Strahlen der Sonne einzufangen und auf große Entfernung zurückzuwerfen. Natürlich kannte Melzer diesen Vorgang, und er wusste um die Möglichkeit, die Strahlen der Sonne in jede gewünschte Richtung umzulenken, ja, sie sogar dorthin zu schicken, woher sie gekommen waren.
Doch, so erkundigte er sich, welchen Nutzen solle ihnen dies Zauberspiel bringen?
Ganz einfach, erwiderte Gensfleisch, man müsse den Leuten nur glaubhaft versichern, dass diese gerade geschliffenen Spiegel in der Lage seien, die heilige Gnade, welche von einer Reliquie ausgeht, einzufangen und mit nach Hause zu nehmen. Man müsse nur einen Ort auswählen, wo in jedem Jahr möglichst viele Pilger zusammenkämen …
Melzer begriff, was sein Geselle meinte. Alljährlich zwischen Ostern und St. Remigius wurden, wie alle Welt wusste, auf der Galerie des Aachener Münsters der Unterrock der Jungfrau Maria und die Windeln des Jesukindes vom Bischof und seinen Prälaten hochgehalten, und Zehntausende, die das Ereignis wegen des damit verbundenen Ablasses anzog, gerieten darob in Verzückung, fielen auf die Knie oder in Ohnmacht oder redeten in Zungen wie die Apostel bei der Ausgießung des Geistes oder genasen, so sie krank und siech gekommen waren, von einem Augenblick auf den anderen. Zehntausende und mehr stürmten an jenen Tagen die Stadt. Und ein ums andere Mal sahen die Türmer sich genötigt, die Stadttore zu schließen, weil der Bischof um sein irdisches Leben fürchtete und um die Mauern seines Heiligtums.
Der Spiegelmacher hegte Misstrauen gegenüber seinem geschäftstüchtigen Gesellen und stellte ihm die Frage, warum er, wenn er vom Erfolg seines Unternehmens überzeugt sei, dieses nicht ohne sein Zutun anpacke.
Gensfleischs Antwort klang ebenso schmeichelhaft wie überzeugend: Gewiss sei nur ein Meister wie Melzer in der Lage, einen wirklich ebenen Spiegel zu fertigen. Zum anderen kenne er keinen, der so wie Meister Melzer in der Lage sei, den Menschen wundersame Dinge nahezubringen.
Also goss Melzer in tönernen Formen ein Dutzend Platten aus Blei und Zinn so groß wie ein Handteller, schliff sie zwischen Walzen aus Sandstein platt, bis ihre Oberfläche wie Eis schimmerte, und polierte jede einzelne mit nassem Speckstein. Am nächsten Morgen – es war der vierte Sonntag der Fasten, und die Sonne brachte sich nach einem düsteren Winter mit den ersten warmen Strahlen in Erinnerung – betrat Melzer mit dem besten seiner Spiegel den Dom, wo der Erzbischof das Hochamt zelebrierte.
Der Spiegelmacher drängte sich in die Mitte des Bauwerks, wo sich Längs- und Querhaus kreuzten und die einfallenden Sonnenstrahlen bizarre Muster an die Innenwände warfen. Dort, am nördlichen rechten Eckpfeiler, zog er seinen Spiegel hervor und richtete seinen Strahl auf den Altar, just in dem Augenblick, als der Erzbischof den Kelch zur Wandlung in die Höhe hielt. Der dachte ob des gleißenden Lichts, in dem der Kelch plötzlich erstrahlte, an einen Widerschein des Himmels und ein Wunder und sank mit den übrigen Gläubigen im Dom in die Knie. In dieser Haltung stimmte der Eminentissimus das Te Deum an, und die Gemeinde fiel in den Gesang ein.
Michel Melzer erschrak zu Tode ob dieser Wirkung seines Spiegels und zog es vor, sich im Schutz der allgemeinen Verwirrung zurückzuziehen. Um die weitere Ausführung des Planes kümmerte sich Johann Gensfleisch. Dieser verkündete, als die Mainzer wundertrunken aus dem Dom torkelten, die Erscheinung sei ein Werk des Meisters Melzer und dazu geeignet, die Gnade eines heiligen Gegenstandes einzufangen.
Allein die Erwähnung von Melzers Namen genügte, um das Misstrauen zu beseitigen, das Gensfleisch entgegenblickte. Und sofort setzte Nachfrage ein nach dem Preis und den Möglichkeiten des wundersamen Gnadenerwerbs. War der Erzbischof zunächst verärgert, weil er dem Spiegelmacher auf den Leim gegangen war, so belehrten ihn seine Prälaten bald eines Besseren, und sie erinnerten an den Korintherbrief, wonach der Glaube Berge versetzen könne oder die Worte des Kardinals Nikolaus von Kues, der verkündete, er glaube gerade deshalb, weil es widersinnig sei.
Mit dem Segen der Kirche wuchsen die Aufträge für die Heilsspiegel, wie das schimmernde Zierwerk genannt wurde. Und bei dem Reliquienspektakel in Aachen richteten sich im selben Jahr schon Dutzende von Spiegeln auf die gottgefällige Unterwäsche, im nächsten waren es Hunderte. Und noch nie in der jahrhundertealten Wallfahrt zeigten sich die Menschen so verzückt, berauscht und ergriffen von der aufgesogenen Gnade.
In Melzers Werkstatt hinter dem Dom arbeiteten nun bereits fünf Gesellen beinahe Tag und Nacht, um die große Nachfrage zu befriedigen. Und endlich hatte der Spiegelmacher genug verdient, um die Operation des Magisters bezahlen zu können.
Editha zitterte am ganzen Leib, als Melzer sie eines Tages im September zu Bellafintus brachte. Sein auf dem Großberg gelegenes Haus glich einer turmbewehrten Festung und war von einer Mauer und hohen Bäumen umgeben, welche kaum einen Sonnenstrahl ins Innere ließen. Das Gewölbe, in dem der Eingriff stattfinden sollte, war kalt und nur spärlich beleuchtet, und an den Wänden stapelten sich dunkle Schriften, mit Zeichen und Formeln, die dem Uneingeweihten unverständlich blieben. Sie wirkten eher feindselig als vertrauenerweckend; jedenfalls trugen sie nicht dazu bei, Editha die Furcht zu nehmen vor dem, was ihr bevorstand.
Melzer hatte seiner Tochter die Notwendigkeit des Eingriffs mit einfachen Worten erklärt, und obwohl Editha erst viereinhalb Jahre zählte, hatte sie die Unabwendbarkeit des Schicksals verstanden und traurig genickt. Nun aber verließ sie der Mut, und sie weinte heftige Tränen.
Der Magister blieb ungerührt, und nachdem er die vereinbarte Summe ausgezahlt bekommen hatte, band er das Kind mit Riemen auf einen hohen, kantigen Stuhl. Dann verabreichte er ihm mit einem großen Löffel eine Unze Syrup von weißem Mohn. Editha schlief sofort ein. Schließlich schnürte er ihren Kopf an die Lehne und schor sämtliche Haare von dem kleinen Schädel.
Melzer wurde es immer unheimlicher zumute, aber er ließ sich nichts anmerken, kannte er doch den Magister als seinen alten Lehrmeister des Lateinischen und Griechischen, der keinen Widerspruch duldete. Doch als Bellafintus seine Gelehrtenkappe abstreifte, die er bis dahin getragen hatte, und sich die Ärmel seines schwarzen Gewandes aufkrempelte, bekam der Spiegelmacher es mit der Angst zu tun.
Aus einem Kasten holte Bellafintus Hammer, Zange und mehrere fingerlange dünne Nägel. Diese brachte er über einem offenen Feuer zum Glühen. Sie waren kaum abgekühlt, da begann er den ersten Nagel mit kleinen, kurzen Schlägen in die Schädeldecke des Mädchens zu treiben. Melzer wandte sich würgend ab und stürzte aus dem Gewölbe ins Freie.
Als er zurückkehrte, fand der Spiegelmacher sein Kind röchelnd und mit einem blutigen Verband um den Kopf. Editha gab schnarrende Laute von sich, und der Magister meinte, die Operation sei gelungen, er habe die Säfte im Körper wieder geweckt und in die richtigen Meridiane geleitet.
Behutsam trug Melzer seine betäubte Tochter nach Hause, und er wich nicht von ihrer Seite, bis sie nach zwei Tagen erwachte. Schmerz stand dem Kind ins Gesicht geschrieben; aber es gab keinen Laut von sich. Ja, von diesem Tage an redete Editha überhaupt kein Wort mehr, zu keinem Menschen, und wenn sie auch von ihrer trüben Schwermut geheilt schien, so hatte die Heilung doch eine nicht minder schlimme Nebenwirkung mit sich gebracht. Der Eingriff mit den Nägeln in die Schädeldecke hatte dem Mädchen im Wortsinne die Sprache verschlagen.
Da bereute der Spiegelmacher seine Tat, dass er sein Kind solchen Qualen ausgesetzt hatte, nur damit es so sei wie alle anderen Menschen. Aber war nicht jedem Menschen sein Schicksal vorgezeichnet? Und war es nicht sündhaft, sich gegen dieses Schicksal aufzulehnen?
Aus diesen Überlegungen heraus ging der Spiegelmacher nicht erneut zu dem Quacksalber, auf dass dieser Editha die Sprache zurückbrächte, zumal dies Melzers finanzielle Mittel völlig erschöpft hätte. Insgeheim hegte er ohnedies Zweifel an Bellafintus’ wahren Fähigkeiten, zumal dessen Eingriff Editha keineswegs die unbeschwerte Fröhlichkeit ihrer jungen Jahre wiedergegeben hatte. Sie wirkte nun, da sie heranwuchs, aufgrund ihrer mangelnden Sprachfähigkeit eher verschlossen und zurückhaltend, und Melzer machte sich Vorwürfe, ob nicht er schuld sei an diesem Zustand. Dabei bereitete es ihm kaum Schwierigkeiten, sich mit seiner Tochter zu verständigen, denn Editha las seine Sprache von den Lippen ab, wohingegen Melzer Edithas Meinung in ihren Augen erkannte.
Was Frauen betraf, so war der Spiegelmacher viel zu jung, um als Witwer durchs Leben zu gehen, und es gab mehr als einen Handwerker aus der Spielmannsgasse, der Melzer seine heiratsfähige Tochter andiente. Doch diesem wollte es einfach nicht gelingen, die Erinnerung an seine Frau Ursa aus dem Gedächtnis zu löschen. Statt sich anderen Frauen zuzuwenden suchte er Zuflucht in der Liebe zu seiner Tochter Editha. Er ließ ihr eine vortreffliche Erziehung angedeihen und achtete darauf, dass es ihr auch sonst an nichts fehlte.
Als das Mädchen gerade zwölf war, verfügte es nicht nur über bewundernswerte Manieren, Editha sah auch allerliebst aus, und in ihrem Verhalten war nun ein gewisser Stolz, fernab von Hochmut, erkennbar, der ihrer Erscheinung sogar noch entgegenkam. In diesem Jahr kam es zu einer Begegnung, die Melzers Leben und das seiner Tochter auf ungeahnte Weise verändern sollte.
Ein reicher, aus Köln gebürtiger Kaufmann mit Sitz in Konstantinopel, der für gewöhnlich mit Seide aus China und kostbaren Stoffen handelte, machte auf dem Weg in die Niederlande in Mainz Station und sah beim Wirt am Markt einen von Melzers Spiegeln. Aber nicht die wundertätige Wirkung, welche angeblich von dem Glitzerwerk ausging, erregte sein Interesse, sondern die gefällige Form des Spiegels und das Material, aus dem er gefertigt war. Gewiss, venezianische Spiegel mochten hellere Leuchtkraft haben, doch sie waren aus Glas gefertigt und so zerbrechlich, dass schon ein heftiger Zugriff sie zum Splittern brachte. Melzers Spiegel hingegen konnten sogar zu Boden fallen, ohne zu zerspringen.
Gero Morienus, so der Name des stattlichen Byzantiners, gab bei Melzer fünfhundert Spiegel in Auftrag. Just als die beiden den Auftrag per Handschlag besiegelten, betrat Editha das Gewölbe der Werkstatt, und von einem Augenblick auf den anderen war der Seidenhändler wie von Sinnen. Mit überschwänglichen Worten schwärmte er von Edithas Schönheit, ihrem ebenmäßigen Wuchs und der Unergründlichkeit ihrer Augen, und mit bebender Stimme stellte er die Frage, ob dieses bezaubernde Geschöpf bereits einem Mann versprochen sei.
Obwohl dergleichen für ein Mädchen in ihrem Alter nicht ungewöhnlich war, überraschte Melzer der Antrag, und er beeilte sich zu sagen, dass Editha zwar wohlerzogen und schreibkundig, aber aufgrund eines Unglücksfalls seit sieben Jahren stumm sei und nur mit den Augen reden könne. Damit hoffte er insgeheim den Byzantiner von seinem Gedanken abzubringen.
Editha verstand nicht, worüber die beiden Männer redeten; aber als sie der Fremde mit den Augen verschlang, drehte sie sich um und verschwand. Erst ein Jahr später erfuhr das Mädchen von ihrem Vater, dass er sie in dieser Nacht dem Byzantiner versprochen hatte, und als es die Botschaft vernahm, begriff es die Tragweite dieser Entscheidung in keiner Weise.
Zu dieser Zeit häuften sich die Zwistigkeiten zwischen Melzer und seinem Teilhaber Gensfleisch. Der nahm sich immer größere Freiheiten gegenüber seinem Meister heraus, die ihm nicht zustanden, und machte sich über Editha und deren Sprachlosigkeit lustig, indem er ihr anmutiges Gebärdenspiel nachäffte. Wenn es um seine Tochter ging, kannte der Spiegelmacher keine Nachsicht, und so kam es, dass Melzer seinem Teilhaber eines Tages vor allen Gesellen mit der Hand ins Gesicht schlug, und es hätte nicht viel gefehlt und zwischen den beiden wäre es zu einem Kampf gekommen. Die Auseinandersetzung endete damit, dass Gensfleisch ohne ein Wort verschwand und nie mehr in das Gewölbe hinter dem Dom zurückkehrte.
Seit dem Streit waren noch keine zwei Wochen vergangen, als Editha gegen Mitternacht in die Schlafstube ihres Vaters stürzte und die Arme zum Himmel reckte, als sei höchste Gefahr im Verzug. Und noch ehe er sich versah, stieg beißender Brandgeruch in seine Nase.
»Feuer!«, rief der Spiegelmacher. »Es brennt!« Er fasste seine Tochter am Arm und hastete ins Treppenhaus, wo ihnen bereits Flammen entgegenschlugen. An ein Durchkommen war nicht zu denken. Also drängte Melzer Editha zurück, riss ein Fenster auf und brüllte aus Leibeskräften: »Feurio, Feurio, zu Hilfe!« in die Nacht.
Sein Schreckensruf hallte durch die Spielmannsgasse, und sofort kamen Männer mit Ledereimern und Reisigbesen, um die Flammen zu bekämpfen. Über eine rasch herbeigeschaffte Leiter konnten sich der Spiegelmacher und seine Tochter ins Freie retten. Das Haus aber brannte beinahe völlig aus.
Für den Spiegelmacher war es keine Frage, dass Johann Gensfleisch das Feuer aus Rache gelegt hatte. Zwei Bettelleute aus Worms behaupteten, sie hätten kurz vor Mitternacht einen hochgewachsenen, bärtigen Mann mit einer Laterne unter dem Umhang in Richtung Spielmannsgasse laufen sehen. Aber wer glaubte schon fremden Bettlern? Die Saufkumpane des abtrünnigen Gesellen schworen hoch und heilig, sie hätten zum fragwürdigen Zeitpunkt mit Gensfleisch im Goldenen Adler gehockt, und selbst der Wirt war bereit, dies zu bezeugen.
Seit dem Brand schlug dem Spiegelmacher viel Feindseligkeit entgegen. Es ging das Gerücht, Michel Melzer habe sein Haus selbst angezündet, um zu vertuschen, dass es mit seiner Werkstatt bergab ginge. Liefen ihm nicht bereits die Gesellen davon? Dass Gensfleisch den Brand gelegt haben könnte, daran glaubte niemand, zumal dieser durch Erbschaft eines feinen Hauses zu plötzlichem Reichtum gekommen war. Dort richtete er sich schon bald darauf eine eigene Werkstätte ein, stellte drei von Melzers ehemaligen Gesellen ein und fertigte mehr Heilsspiegel, als sein Meister je gegossen hatte.
Michel Melzers ganzes weltliches Gut war mit dem Haus verbrannt, und auch von den Barren aus Blei, Zinn und Antimon, die im Gewölbe der Werkstatt gelagert hatten, war kaum noch etwas zu finden, als hätte sich alles im Feuer in Nichts aufgelöst. Zauberei oder Diebstahl? Melzer hatte den Verdacht, dass es bei dem plötzlichen Reichtum seines ehemaligen Gesellen nicht mit rechten Dingen zugegangen war, aber er konnte nichts beweisen. Ihm fehlte das Geld, um sein Haus wiederaufbauen zu können. Und weil ihm sonst nichts anderes übrig blieb, verkaufte er die Ruine um hundert Gulden an den Einzigen, der sich dafür interessierte – seinen ehemaligen Gesellen Johann Gensfleisch.
Es war eine Schmach, gewiss, aber was sollte er tun?
Mit ihren vierzehn Jahren war Editha inzwischen zu einem wunderschönen Mädchen herangewachsen, und der Spiegelmacher fasste den Entschluss, den Staub von Mainz von seinen Stiefeln zu schütteln und seine Tochter nach Konstantinopel zu geleiten, wo Gero Morienus auf sie wartete. Er selbst gedachte sich irgendwo, vielleicht in Venedig, wo die Spiegelmacher zu Hause waren, niederzulassen und ein neues Leben zu beginnen.
KONSTANTINOPEL
Von den Venezianern erobert und von den Türken bedroht,ist Konstantinopel eine sterbende Stadt. Mit 700 000Einwohnern zählte es einst zu den größten undaufregendsten Städten der Welt, doch Mittedes 15. Jahrhunderts lebt hier lediglich einBruchteil davon, in der HauptsacheItaliener und Griechen. Die Tagedes einst mächtigen Kaisersdes Oströmischen Reichesneigen sich demEnde zu.
KAPITEL II
DAS GEHEIMNIS DES WÜRFELS
Am 26. Tag ihrer Reise hallte vom Fockmast der Karracke Utrecht die Stimme des Obermaats: »Land, Land! Konstantinopel!«
Vom Unterdeck, wo die Reisenden zwischen Kisten und Säcken, Wollballen und Salzrädern die Tage verdöst und sich ein um das andere Mal ihr Leben erzählt hatten, lief die Aufregung zum Ankerdeck. Dort stand Michel Melzer an der Reling. Er hielt die flache Hand über die Augen, und obwohl er nichts weiter wahrnahm als einen dunklen Strich am Horizont, der schon im nächsten Augenblick wieder verschwand, als wäre es nur ein Trugbild gewesen, sagte er, an seine Tochter Editha gewandt: »Konstantinopel! Das ist der Tag, den Gott gemacht hat.«
Editha, das schweigsame Mädchen mit dem üppigen Blondhaar und den dunklen traurigen Augen, schienen die Worte wenig zu beeindrucken. Sie blickte gen Himmel, als wollte sie sagen: Was geht es mich an? Ja, es schien, als sei sie ganz woanders mit ihren Gedanken. Dabei wusste Editha ganz genau, dass ihr Vater die weite Reise ihretwegen auf sich genommen hatte. Zumindest hatte dieser nicht versäumt, sie während der vergangenen fünfundzwanzig Tage immer wieder darauf hinzuweisen.
Ja, Vater, das ist der Tag, erwiderte das schöne Mädchen mit den Augen. Es tat dies, weil es seinen Vater liebte. Dieser kindlichen Unbefangenheit stand freilich schon das Bewusstsein herausfordernder Weiblichkeit entgegen, eine Mischung aus Wasser und Feuer, welche geeignet ist, selbst gestandene Männer aus der Fassung zu bringen.
»Kind!«, sagte Melzer und schloss Editha in die Arme. »Auch mir fällt diese Reise nicht leicht; dabei will ich nur dein Bestes!«
Ich weiß, nickte Editha und wandte den Kopf zur Seite. Ihr Vater sollte die Tränen nicht sehen, die ihre Augen füllten.
Die harschen Winde der vergangenen Wochen waren von der lauen Frühlingsluft der Ägäis verdrängt worden, und die gereizte Stimmung der Passagiere – es mochten etwa sechzig sein – war verflogen. Vergessen waren der Streit um den besten Schlafplatz unter Deck, die Auseinandersetzungen mit dem Koch über das schlechte Essen und der Ärger über die ungehobelte Mannschaft. Nun, da das ersehnte Ziel vor Augen lag, schlugen sich jene, die sich lange Tage nur scheele Blicke zugeworfen hatten, erlöst auf die Schultern, streckten die Arme zum nördlichen Horizont und riefen: »Konstantinopel!«
»Man sagt, die Stadt wäre wundervoll!«, bemerkte Melzer, während er verlegen an seiner Tochter vorbeisah. Ihre Tränen waren ihm nicht verborgen geblieben. »Sie habe, sagt man, tausend Türme und mehr Paläste als alle Städte Italiens zusammen. Ich bin sicher, Konstantinopel wird dir gefallen.« Als Editha keine Regung zeigte, nahm er das Mädchen in die Arme, strich ihm das Haar aus dem Gesicht und redete eindringlich auf es ein: »Du wirst in einem Palast wohnen wie eine Prinzessin und Kleider aus chinesischer Seide tragen, und eine Dienerin wird dir jede Arbeit abnehmen. Du solltest glücklich sein!«
Editha wich dem Blick des Vaters aus; den Kopf zur Seite gewandt, begann sie wild zu gestikulieren. Melzer verfolgte jede ihrer Bewegungen. Er verstand, was sie meinte: Wie kann der Mann behaupten, mich zu lieben? Als er mich sah, war ich noch ein Kind!
»Morienus?«
Das Mädchen nickte.
»Gewiss«, erwiderte Melzer, »du warst erst zwölf, als er dir begegnete, aber auch einem zwölfjährigen Mädchen sieht man an, ob es einmal eine schöne Frau wird. Und vergiss nicht, Morienus ist ein erfahrener Mann. Er versteht etwas von Frauen!«
Auf dem Vorderdeck begannen die Passagiere sich an den Händen zu fassen und übermütig zu tanzen. Es waren in der Hauptsache Kaufleute, Kunsthandwerker und Sendboten, außerdem eine Abordnung würdiger Professoren aus Gent und eine Handvoll Abenteurer, die durch nachlässige, schmutzige Kleidung auffielen. Insgesamt befanden sich nur sieben Frauen an Bord: zwei ehrbare in Begleitung ihrer Ehemänner; zwei weitere von zweifelhaftem Ruf unter der Obhut einer Kupplerin, eines hässlichen, buckeligen Weibes; eine Sprachkünstlerin aus Köln, welche angeblich in fünf Sprachen reden konnte und die ihr rotes Haar unter einem dichten Netz verborgen hielt; und Editha.
Melzer hatte gut daran getan, das schöne Mädchen in Männerkleider zu stecken; denn trotz dieser Kostümierung war Editha mehrfach von Männern bedrängt worden. Vor allem ein dicker, stets schwarz gekleideter Medikus namens Chrestien Meytens hatte ihr heftig nachgestellt. Zwar war es Frauenspersonen für gewöhnlich untersagt, Männerkleider zu tragen, aber auf See gelten eigene Gesetze.
»Es wird Zeit, dass du dich wieder in eine Frau zurückverwandelst«, meinte Melzer, als schon die Silhouette der Stadt sichtbar wurde. Editha löste sich aus seiner Umarmung. Sie nickte, zupfte ihr derbes Lederwams zurecht und verschwand unter Deck.
Meytens hatte die Szene aus der Nähe beobachtet, nun trat er an Melzer heran und fragte: »Warum weint Eure Tochter? Ein trauriger Anblick bei einem so schönen Mädchen.«
Der Spiegelmacher hielt den Blick schweigend nach Norden gerichtet, wo die Stadt wie ein stolzes Schiff aus dem Wasser ragte. Er hatte bisher keinem Mitreisenden vom Zweck seiner Reise erzählt. Nun aber, da sich die Fahrt ihrem Ende näherte, sah er keinen Grund mehr für sein Schweigen.
»Wisst Ihr«, begann Melzer umständlich, und der dicke Medikus hielt eine Hand an sein Ohr, damit er die Worte verstand, »ich bringe meine Tochter Editha zu ihrem künftigen Gemahl.«
»Ich hätte es mir denken können«, rief Meytens und klatschte einmal in die Hände.
»Wie soll ich dies verstehen?«
»Nun ja, es wäre doch ein Wunder, wenn ein so schönes Mädchen nicht längst einem Mann versprochen wäre. Lasst mich raten: Er ist alt, reich und hässlich, und Eure Tochter liebt ihren Zukünftigen nicht.«
»Keineswegs!«, tat Melzer entrüstet. »Edithas Zukünftiger ist zwar reich, aber weder zu alt noch unansehnlich. Er hat Haare auf dem Kopf wie ein Faun und überragt mich um einen ganzen Kopf an Körpergröße, wirklich eine stattliche Erscheinung.«
»Aber warum weint dann das Kind?«
Melzer ließ sich mit der Antwort Zeit, ja, es schien, als wollte er die Frage überhaupt nicht beantworten; aber weil der Medikus ihn lange ansah, begann er: »Edithas Mutter starb bald nach ihrer Geburt, und seit jenem Tag ist das Mädchen mein Ein und Alles. Ich habe meiner Tochter Erziehung und Bildung angedeihen lassen, entgegen dem Geist der Zeit, der Mädchen lieber hinter Klostermauern sieht als in einer Bildungsanstalt. Und ich habe gelobt, sie einem Manne zuzuführen, welcher ihr ein besseres Leben bieten kann. Es schien, als hätte der Himmel meinen feierlichen Eid vernommen, als eines Tages Gero Morienus, ein junger, reicher Kaufmann aus Konstantinopel, nach Mainz kam. Er handelte mit kostbaren Tuchen und Seide aus China, und als er vernahm, dass meine Spiegel besser und schöner waren als jene der Venezianer, suchte er mich auf, und wir kamen ins Geschäft. Dabei sah er Editha, und er war wie verzaubert von ihrer Anmut. Ohne Umstände zog er einen Beutel aus seinem Wams und warf ihn vor mir auf den Tisch. Als ich ihn fragte, was das zu bedeuten habe, meinte er, er verzichte auf jede Mitgift; er wolle das Mädchen zur Frau nehmen und dies sei das Lösegeld: Hundert Gulden!«
»Eine Menge Geld!«, bemerkte der dicke Medikus. »Was habt Ihr getan?«
»Zuerst habe ich nein gesagt und den Fremden darauf hingewiesen, dass Editha stumm war.«
»Nein. Ihr wart von Sinnen, Melzer!«
»Aber sie war damals noch ein Kind, versteht Ihr, und sie ist stumm! Schließlich haben wir einen Vertrag ausgehandelt. Sobald Editha fünfzehn sei, würde ich mit ihr nach Konstantinopel reisen. Dann könne sie seine Frau werden. Das Lösegeld ließ Morienus zurück und einen Batzen für die Reise obendrein.«
»Und Eure Tochter?«
»Wie ich schon sagte, sie war damals viel zu jung und bekam von alledem nichts mit. Als ich ihr später die Wahrheit eingestand, da konnte sie sich an den fremden Mann nicht einmal erinnern. Nun befürchtet sie, ich hätte sie mit einem buckeligen Alten oder einem griesgrämigen Scheusal verlobt.«
»Oder mit einem dicken, fetten Medikus!«, lachte Meytens.
»Oder das!« Melzer grinste.
Der Übermut der Passagiere, welche, das nahe Ziel vor Augen, lärmten und tanzten, und die Nachlässigkeit der Mannschaft hatten bewirkt, dass niemand an Bord die drei schnellen Segler bemerkt hatte, welche sich von Osten näherten. Erst als eine Salve über das Meer hallte und kurz darauf eine zweite, schrien die Reisenden wild durcheinander. Der Obermaat, der inzwischen seinen Ausguck verlassen hatte, sprang auf eines der Fässer an Deck, hielt beide Hände an den Mund und rief: »Alle Mann unter Deck!«
»Diese gottverdammten Türken!«, zischte Meytens, der diesen Meeresteil nicht zum ersten Mal befuhr, und schob Melzer vor sich her in Richtung der vorderen Luke, die unter Deck führte. Aber noch ehe sie sich in Sicherheit gebracht hatten, wurde das Schiff von einem furchtbaren Schlag erschüttert. Ein Feuerball zerfetzte das Focksegel, und in Sekunden standen die herabhängenden Fetzen in Flammen. Verzweifelt versuchte der Obermaat ein Tau zu lösen, um das brennende Focksegel einzuholen. Es konnte jeden Augenblick das Großsegel in Brand setzen. Aber noch ehe er sich am Ziel sah, brach die Rahe in der Mitte entzwei, und die brennenden Fetzen des Segels begruben den Obermaat unter sich.
Die alte Kupplerin, die während der ganzen Reise kaum ein Wort gesprochen hatte und die ihrem Gewerbe nur mit einem vielversprechenden Grinsen und unzüchtigen Handbewegungen nachgegangen war, erhob beim Anblick des Geschehens ihre Stimme und kreischte in hohen Tönen: »Jesus, Maria und Josef, Uriel und Sabaok, Luzifer und Beelzebub, steht mir bei!« Aber ihr seltsamer Fluch ging in dem lärmenden Durcheinander unter.
»Alle Männer bilden eine Kette nach achtern!«, schallte von irgendwoher die Stimme des Kapitäns.
Vom Achterdeck ließen Matrosen Ledereimer zu Wasser. Von Hand zu Hand gereicht gelang es auf diese Weise, das Feuer zu löschen, bevor es das Schiff in Brand setzen konnte. So blieb der Obermaat das einzige Opfer. Seine Leiche war bis zur Unkenntlichkeit verkohlt.
Unterdessen kamen die drei türkischen Schnellsegler immer näher; doch den Kapitän schien die Lage wenig zu beunruhigen. Er baute sich, die Fäuste in die Seiten gestemmt, inmitten des Achterkastells auf und kommandierte: »Großsegel hart an den Wind, Besan und Blinde aussetzen! Hart an den Wind!«
Seine Befehle waren kaum ausgeführt, da legte sich die Utrecht ächzend wie ein gequältes Tier zur Seite, und dabei nahm sie Fahrt auf, mehr als man bei dem lauen Wind erwarten durfte.
»Hart an den Wind!«, tönte die raue Stimme des Kapitäns erneut.
Die Verfolger hatten dieses Manöver wohl nicht erwartet. Sie schossen noch eine Salve ab, dann fielen sie deutlich zurück. Schließlich drehten sie ab in die Richtung, aus der sie gekommen waren.
»Das probieren die Hurensöhne jedes Mal!«, brüllte der Kapitän vom Achterkastell auf die Passagiere herab. Diese beklatschten ihn und ließen ihn hochleben. »Es ist das gefährlichste Wasser im ganzen Mittelmeer. Konstantinopel ist von allen Seiten von türkischen Eroberern umgeben. Sogar das Marmarameer ist in ihrer Hand. Sie pressen jedem Segler die Hälfte der Ladung ab. Gottverdammte Türkenhunde!«
Ängstlich kam Editha an Deck zurück. Sie war kaum wiederzuerkennen in ihrem grün schimmernden Reisekostüm, dessen langer Rock bis zum Boden reichte. Ein weißer, hoher, gewellter Kragen ragte bis unter das Kinn, und die weiten, an den Schultern aufgesetzten Ärmel waren von Längsschlitzen durchbrochen, aus denen gelbes Futter leuchtete. Ihr Haar trug Editha unter einer sackartigen, nach hinten abfallenden Kappe verborgen.
Das Mädchen zitterte am ganzen Körper.
»Keine Angst!«, versuchte Melzer seine Tochter zu beruhigen. »Es ist noch einmal gut gegangen.« Und im Wortlaut des Kapitäns fügte er hinzu: »Gottverdammte Türken!«
Betroffen verfolgten die Passagiere an Deck, wie zwei Matrosen die verkohlte Leiche des Obermaats in einen derben Sack wuchteten, diesen zubanden und, nachdem der Kapitän eine Art Gebet gesprochen hatte, von dem keiner ein Wort verstand, steuerbord ins Wasser stießen. Das ging so schnell und ohne Pathos vonstatten, dass nicht die geringste Trauer aufkam.
Zunächst blähte sich der Sack wie der Hals einer Kröte, doch schon nach wenigen Augenblicken tauchte er im Sog des Kielwassers unter. Und der Kapitän, der die Szene vom Achterdeck verfolgt hatte, brummte zu seiner Rechtfertigung: »Nur keine Leiche an Bord! Aus Angst vor Seuchen schicken die Hafenwächter von Konstantinopel jedes Schiff zurück, das einen Toten an Bord hat.«
»Wie schade«, meinte der dicke Medikus, an Editha gewandt, ohne auf das dramatische Geschehen einzugehen, »dass Ihr schon vergeben seid, schöne Jungfrau, ich würde Euch mein Herz zu Füßen legen.« Bei diesen Worten hielt er seine breite Hand auf die Wölbung seines Bauches und verneigte sich, als wollte er seine guten Manieren zeigen.
Melzer fand die Szene peinlich und fuhr dazwischen: »Ihr solltet eher daran denken, dass Ihr ein frommes Weib zu Hause habt, edler Herr, anstatt einer züchtigen Jungfrau unschickliche Anträge zu machen!«
Meytens schwieg einen Augenblick, dann entgegnete er ungehalten: »Wäre es, wie Ihr behauptet, so wüsste ich wohl, was ich zu tun hätte. So aber leide ich nicht weniger als Ihr; denn wie Ihr habe ich meine Frau in jungen Jahren verloren.« Und traurig fügte er hinzu: »Und obendrein mein Kind.«
»Verzeiht, das konnte ich nicht ahnen«, bat Melzer um Vergebung. Und während er Editha bei der Hand nahm, meinte er lächelnd: »Aber dann werdet Ihr verstehen, wie sehr ich mich um mein Kind sorge. Ich will noch gar nicht daran denken, dass ich einem anderen die Verantwortung für sie überlassen soll.«
Auf dem Unterdeck herrschte große Aufregung. Passagiere suchten nach ihrem Gepäck, das in große Stoffballen geschnürt oder in Holzkisten verstaut war. Dazwischen mühten sich ein paar Matrosen, die Spuren des Feuers zu beseitigen. Schließlich holten sie Besan- und Toppsegel ein und hievten das Großsegel quer in den Wind, sodass die Utrecht nun sanft wie ein Schwan dahinglitt.
Der Hafen, im Süden der Stadt gelegen, glich einem Wald mit kahlen Bäumen, ja, es schien, als hätten sich die Masten und Takelagen unzähliger Schiffe unentwirrbar ineinander verhakt. Hinter diesem Wald aus Masten erhob sich die Stadt wie ein gewaltiges Bollwerk: Terrassen und Mauern, Pavillons und Paläste, Säulenhallen und Türme, Kasernen und Kirchen, so weit das Auge reichte. Von Dächern und Zinnen, Säulen, Obelisken und monumentalen Statuen ging ein Flimmern und Glitzern aus, als wäre alles aus purem Gold. Dazwischen ragten Palmen und Platanen aus dem Häusermeer, das von bewachsenen Arkadenhöfen durchsetzt war und von kunstvoll gestalteten Parkanlagen unterbrochen wurde. Welch eine Stadt!
Am Hafenkai wurde der fremde Segler von aufgeregten, schreienden Menschen begrüßt. Lastenträger, Fuhrleute, Fremdenführer, Händler und Geschäftemacher balgten sich um einen Platz in der vordersten Reihe. Lärmend und in allen Sprachen boten sie ihre Dienste an, noch bevor das Schiff überhaupt angelegt hatte.
Editha schmiegte sich an ihren Vater. Die Vorstellung, sich einen Weg durch dieses Menschengewirr bahnen zu müssen, machte ihr Angst. Sieh nur die schwarzen Menschen mit den breiten Lippen und jene mit den geschlitzten Augen! Editha deutete aufgeregt nach unten. Und, bei der Heiligen Jungfrau, jene schwarzhaarigen Teufel tragen Haare und Bärte so lang, dass sie ohne Kleider herumlaufen könnten, und niemand würde es bemerken!
Melzer gab sich weltgewandt und lachte: »Die Schwarzen kommen aus den fernen Ländern Afrikas, aus Syrien, Mauretanien und Ägypten, und jene mit dem Turban auf dem Kopf sind Araber. Die Schlitzäugigen sind in China zu Hause und die schwarzhaarigen Teufel sind Bewohner der asiatischen Steppen. Man nennt sie Sarmaten, Chasaren, Saken und Petschenegen.«
Das Mädchen schüttelte den Kopf und formulierte mit den Händen eine Frage: Aber warum treffen sie sich alle hier an diesem Ort?
Melzer hob die Schultern. »Konstantinopel ist die größte Stadt der Welt, gewiss zweihundertmal so groß wie Mainz. Man sagt, wer hier sein Glück nicht macht, macht es nirgendwo.«
Editha verstand die Andeutung ihres Vaters und schlug die Augen nieder.
Die Schiffsglocke gab das Zeichen, dass die Utrecht fest vertäut war und die Passagiere von Bord gehen durften. Treffsicher warfen einige ihr Gepäck über die Reling auf die Kaimauer, wo sich sogleich mehrere Träger darum stritten, es auf Karren verladen oder auf ihre Schultern wuchten zu dürfen.
Vom Achterdeck herab winkte Melzer einen Träger herbei und rief ihm zu, er solle ihre beiden Gepäckballen in Empfang nehmen; doch kaum hatte der Mann die Gepäckstücke gepackt, verschwand er blitzschnell im Menschengewühl.
Was nun? Editha sah ihren Vater an, während sie von Bord gingen.
Der blickte sich ratlos um. Dann schlug er sich schmunzelnd auf die Brust, als wollte er sagen: Nur gut, dass ich all unser Geld am Leibe trage!
Ein junger Mann von olivfarbener Haut mit einer Narbe an der Stirn machte sich an die beiden heran und fragte in allen möglichen Sprachen, ob er ihnen dienlich sein könne.