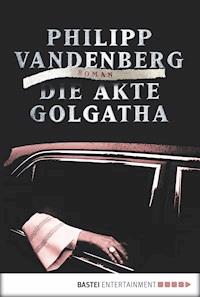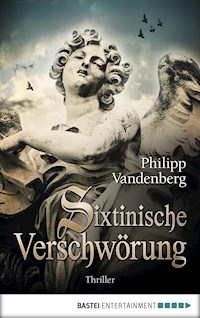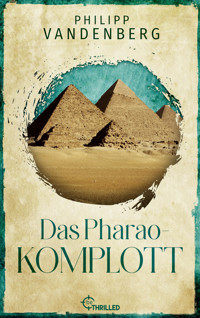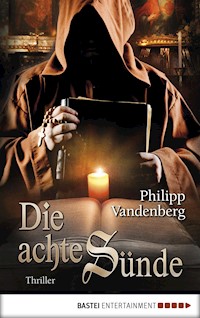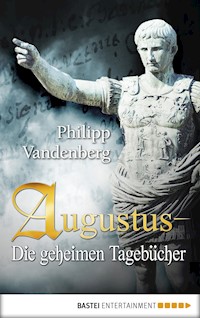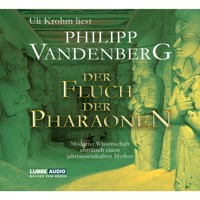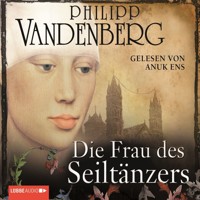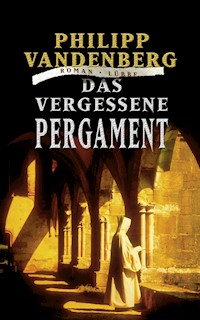4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Thriller von Bestseller-Autor Philipp Vandenberg
- Sprache: Deutsch
Europa im 16. Jahrhundert. Zwischen dem Steinmetz Leberecht Hamann und dem Jesuiten Christoph Schlüssel entsteht eine tödliche Feindschaft. Denn Leberecht liebt heimlich die Mutter seines Rivalen, und er kennt ein Geheimnis, das ihm unendliche Macht verleiht. Es ist das verschollene Erbe des großen Astronomen Nikolaus Kopernikus, das die Welt verändern, die Kirche in ihren Grundfesten erschüttern und die Zeit aus ihren Fugen heben wird. Ein gefährliches Spiel beginnt, bei dem jede Entscheidung Leben kosten kann ...
»Es geht hoch her in Der Fluch des Kopernikus, dem neuen Roman von Erfolgsautor Philipp Vandenberg. Für Spannung ist gesorgt.« Aachener Zeitung
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Vorbemerkung
Kapitel I Verlockung und Sünde
Kapitel II Inquisition und Leidenschaft
Kapitel III Die Bücher und der Tod
Kapitel IV Freunde und Feinde
Kapitel V Erpressung und Verzweiflung
Kapitel VI Fluch und Vergessen
Kapitel VII Gestirne und Erscheinungen
Kapitel VIII Künstler und Propheten
Kapitel IX Genie und Wahnsinn
Kapitel X Mord und Verführung
Kapitel XI Furcht und Verblendung
Kapitel XII Α und Ω
Post scriptum
Weitere Titel des Autors
Feedbackseite
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
ÜBER DIESES BUCH
Europa im 16. Jahrhundert. Zwischen dem Steinmetz Leberecht Hamann und dem Jesuiten Christoph Schlüssel entsteht eine tödliche Feindschaft. Denn Leberecht ist in verbotener Liebe zur Mutter seines Rivalen entbrannt, und er kennt ein Geheimnis, das ihm unendliche Macht verleiht. Es ist das verschollene Erbe des großen Astronomen Nikolaus Kopernikus, das die Welt verändern, die Kirche in ihren Grundfesten erschüttern und die Zeit aus ihren Fugen heben wird.
ÜBER DEN AUTOR
Philipp Vandenberg wurde am 20. September 1941 in Breslau geboren. Er wuchs nach dem Zweiten Weltkrieg bei einer Pflegemutter und im Waisenhaus auf und kam 1952 ins oberbayrische Burghausen.Er besuchte dort dasselbe Gymnasium wie Ludwig Thoma und flog, eigenem Bekunden zufolge, wie dieser von der Schule. Er kehrte »reumütig« zurück und konnte in der Folge die mangelhaften Leistungen in Griechisch sowie Mathematik durch hervorragende Leistungen in Deutsch und Kunst ausgleichen. 1963 machte er am humanistischen Gymnasium Burghausen/Salzach Abitur und studierte anschließend an der Universität München Kunstgeschichte und Germanistik (ohne Abschluss). Ein Volontariat machte Vandenberg 1965/1967 bei der Passauer Neue Presse, die ihn 1967 zum Redaktionsleiter des Burghauser Anzeigers machte.Anschließend wurde er Nachrichtenredakteur bei der Münchener Abendzeitung. 1968–1974 arbeitete er für die Illustrierte Quick. Dann war Vandenberg bis 1976 als Literaturredakteur für das Magazin Playboy beschäftigt. Seither ist er als freier Autor tätig.Vandenbergs Karriere als Sachbuchautor begann 1973, als er seinen Jahresurlaub nahm und begann, über den »Fluch des Pharao« zu recherchieren. Über den rätselhaften Tod von dreißig Archäologen veröffentlichte er das Buch »Der Fluch der Pharaonen« (1973), das ein Weltbestseller wurde. Quick hatte das Manuskript als Serie abgelehnt. Auf den Bestsellerlisten platzierten sich auch Vandenbergs weitere Publikationen wie die archäologische Biographie »Nofretete« (1975). 1977 wechselte Vandenberg seinen Verlag, blieb aber der kulturgeschichtlichen Thematik treu und war in der 80er Jahren als Autor historischer Sachbücher wie »Cäsar und Kleopatra« (1986) erfolgreich. Mitunter versuchte die Fachkritik, seine populären Sachbücher als »Archäo-Krimis« abzutun. Vandenbergs 30 Bücher, mit einer weltweiten Gesamtauflage von über 24 Millionen, erschienen bisher in 34 Sprachen übersetzt, darunter, neben allen Weltsprachen, ins Türkische, Bulgarische, Mazedonische und Rumänische.Vandenberg hat aus erster geschiedener Ehe einen Sohn Sascha (geb. 1965). Seit 1994 ist er mit Evelyn, geb. Aschenwald, verheiratet, beide leben in Baiernrain, in einem tausend Jahre alten Dorf zwischen Starnberger- und Tegernsee. Sein Hobby ist das Sammeln von Oldtimern und Phonographen.
Philipp Vandenberg
Der Fluch des Kopernikus
VORBEMERKUNG
Im Jahre 1582
wurde der alte Julianische Kalender
durch eine neue, christliche Zeitrechnung ersetzt,
die bis heute Gültigkeit hat.
Grundlage dieses Kalenders,
dem Papst Gregor XIII. seinen Namen gab,
waren Forschungen und Berechnungen
des italienischen Astronomen Luigi Lilio
und des deutschen Jesuiten
Christoph Clavius.
Bei der Kalenderreform kam es zu einer
merkwürdigen Erscheinung:
Auf den 4. Oktober folgte der 15. Oktober 1582.
Zehn Tage wurden also aus dem
Gedächtnis der Menschheit gestrichen.
Dieser Roman beschreibt,
wie es zur Streichung dieser zehn Tage
gekommen sein könnte.
Die Handlung hat also einen wahren Hintergrund,
und das Wechselspiel
zwischen frei erfunden und
historischen Charakteren ist durchaus
beabsichtigt.
KAPITEL I
VERLOCKUNG UND SÜNDE
Anno Domini 1554, im 1484. Jahre seit der Zerstörung Jerusalems, dem 224. nach Erfindung des Pulvers, dem 110. seit Einführung der Buchdruckerkunst, dem 62. seit der Entdeckung der Neuen Welt und dem 37. nach der Reformation des unseligen Doktors der Theologie aus Wittenberg, in diesem ganz und gar unbedeutsamen Jahre verschied an Lichtmess der ebenso unbedeutsame Totengräber Adam Friedrich Hamann unerwartet und in Verrichtung seiner Arbeit, die Schaufel umklammernd wie einen kostbaren Besitz.
Als hätte er geahnt, dass ihm vom Schicksal das geschaufelte Grab als eigene Ruhestätte bestimmt war, hatte Hamann aus unerklärlichen Gründen eine schmale, aber ungewöhnlich lange Grube ausgehoben, welche der ursprünglich zugedachten Gerberswitwe in keiner Weise angemessen gewesen wäre. Hamann hingegen verfügte über eine Körpergröße, stattlich wie ein Pferderücken, so dass er zeit seines Lebens die meisten Menschen um mehr als einen Kopf überragte. Dies war umso augenfälliger in Erscheinung getreten, weil Hamann seit jungen Jahren, als ihm ein Aussatz alle Haare raubte, eine rote Kappe trug, welche diesen Makel jedoch eher hervorhob als kaschierte.
Der Schlag, hieß es, habe ihn gerührt; aber die Wäscherinnen am Fluss wussten es wie immer besser und behaupteten, der »kahle Adam« – so wurde Hamann allgemein genannt – sei an gebrochenem Herzen gestorben, weil er am Tag nach Mariä Empfängnis Auguste, seiner eigenen Frau, die an den Blattern erkrankt und nach wenigen Tagen verschieden war, die Grube hatte schaufeln müssen.
Kaum war Auguste, die fromme Frau, unter der Erde, da hatte der kahle Adam sein Testament geschrieben, weniger wegen der Aufteilung seines bescheidenen Vermögens unter seine beiden Kinder, als aufgrund besonderer Umstände, die er im Falle des eigenen Hinscheidens herbeiwünschte. Sein Beruf und die damit verbundenen Grabungen in geweihter Erde hatten ihn in der Überzeugung bestärkt, dass viele Menschen scheintot beigesetzt würden. Hamann hatte Reste dieser armen Seelen gefunden, mit in die Sargdeckel eingekrallten Fingernägeln; andere lagen auf der Seite anstatt auf dem Rücken.
Aus Angst, ihm könnte ein ähnliches Schicksal widerfahren, hatte der kahle Adam testamentarisch verfügt, man möge auf seinem Sarg ein neun Ellen langes Eisenrohr anbringen, damit er, falls er je scheintot begraben würde, sich rufend bemerkbar machen könnte.
Das eigenwillige Begehren des kahlen Adam fand bei der niederen Geistlichkeit von St. Michael, in dessen Kirchhof er zahllose Überreste armer Seelen vergraben hatte, wenig Verständnis und wurde glattweg abgelehnt. Vermutlich hätte so der entseelte Leib des Adam Friedrich Hamann im genannten Jahre die gleiche ausweglose Bestattung erfahren wie Tausende vor ihm, wäre der redliche Wunsch des allzeit frommen Bestatters nicht dem Koadjutor seiner Eminenz auf dem Domberg zu Ohren gekommen, der im Ruf angehender Heiligkeit stand: Zum einen, weil er alljährlich von Aschermittwoch bis Ostersonntag fastete und nur Wasser zu sich nahm wie einst der Herr in der Wüste; zum anderen, weil er den gesamten Pentateuch und alle vier Evangelisten auswendig hersagen konnte; eine Fähigkeit, dank derer er selbst beim Hochamt im Dom auf das Missale verzichtete. Ein Wort aus seinem Mund hatte Gewicht wie ein käuflicher Ablass auf den Stufen von St. Peter in Rom.
Dieser weise und heilige Mann meinte mit der Ernsthaftigkeit eines Bußpredigers, weder ein Gesetz Gottes noch eines der Kirche schreibe vor, wie die sterblichen Überreste eines Christenmenschen der geweihten Erde zu übergeben seien, nicht senkrecht und nicht waagrecht; ja, nicht einmal eine Kleidervorschrift habe in die christliche Lehre Eingang gefunden. Deshalb könne dem letzten Wunsch Hamanns, der in Glauben und Rechtschaffenheit gelebt und mit seiner Schaufel christliche Nächstenliebe gezeigt habe, auch stattgegeben werden; ja, er und alle christkatholischen Seelen des Abendlandes müssten sich fragen, ob diese Art von Bestattung nicht sogar die angemessenere sei. Denn, so fragte der heilige Mann, welchen Wege finde die Seele im Falle des Scheintodes? Zu Gott könne sie nicht gegangen sein, denn dann wäre der Mensch wirklich tot. Im Körper könne sie jedoch auch nicht verweilen, denn in diesem Fall könne der Körper nicht ganz ohne Leben sein. O welche Seelenpein!
Über diesem theologischen Zwiespalt wurde Adam Fridrich Hamann beerdigt samt einem Rohr, das aus dem Sarg über den Grabhügel herausragte wie der Rauchfang der Fischerhütten am Fluss. Er bot Leberecht und Sophie, den beiden Kindern Hamanns, Gelegenheit, jeden Morgen den steilen Kirchhof aufzusuchen und kniend an dem Rohr zu lauschen oder, den Mund an die enge Röhre gepresst, heimliche Worte zu flüstern.
Leberecht, der hochaufgeschossene Junge, war gerade 14 Jahre alt und ein getreues Abbild seines Vaters, bis auf das Haar, das ihm in langen Locken auf die Schultern fiel. Sophie, seine um zwei Jahre ältere Schwester, wies weder mit der Mutter noch mit dem Vater irgendeine Ähnlichkeit auf, was der Schönheit des Mädchens jedoch nur dienlich sein konnte.
Nach zwei Wochen beschlossen Leberecht und Sophie, ihre täglichen Besuche auf dem Friedhof von St. Michael einzustellen, nicht ohne zuvor ihrem Vater am Grabe ein letztes Lebewohl gesagt zu haben. Bei der Rückkehr erwartete sie vor dem Wohnhaus am Kranen ein hochmütiger, eitler Mensch. Er saß, bunt gekleidet wie ein fahrender Handelsmann und mit einer üppigen samtenen Haube auf dem Kopf, auf der Holzbank neben dem Eingang und blinzelte in die matte Wintersonne.
Sophie, die ältere, erkannte ihn sofort und ahnte nichts Gutes. Der eitle Geck war Jakob Heinrich Schlüssel, der Wirt vom Sand, von dem die Mutter erzählt hatte, sie sei mit dem Schurken über fünf Ecken verwandt – mehr hatte sie nie angedeutet.
Besorgt, beinahe ängstlich fasste Sophie ihren Bruder an der Hand, da trat ihnen der Alte in den Weg: »Ich habe es mir nicht ausgesucht; bei allen Heiligen, ich wüsste mir Besseres. Aber der Magistrat hat entschieden. Ich bin euer Vormund.«
Sophie, genannt »Veilchen« wegen ihrer auffallend blassen Haut, ließ Leberechts Hand los und begann an ihrem langen Gewand herumzuzupfen, so als wollte sie ihre Ordentlichkeit demonstrieren; dann blickte sie Schlüssel an und sagte schüchtern: »Bei der Heiligen Jungfrau Maria, wenn es denn so gewollt ist!« Und an Leberecht gewandt, der starr stand wie eine Salzsäule in der Wüste: »Sag schon, dass es uns eine Ehre ist. Das ist es doch, oder?«
Leberecht nickte geistesabwesend. Es fiel ihm schwer, mit der Situation fertigzuwerden. Vormund? Wozu brauchten sie einen Vormund? Er und Sophie waren alt genug, um sich selbst zu helfen.
Schließlich entgegnete er: »Es ist uns eine Ehre, Herr Vormund.«
Aber wie er das sagte, wie Leberecht dabei die Augen zusammenkniff und die Stimme verstellte, das blieb dem Wirt vom Sand, der die Menschen kannte, nicht verborgen. Schlüssel wischte sich mit dem Ärmel seines Gewandes die Nase, räusperte sich lautstark und spuckte, was nur einem Mann von hohem Ansehen erlaubt war, in weitem Bogen auf die Straße.
»Damit«, meinte er, und es klang etwas verlegen, »ist alles gesagt. Ich erwarte euch am Nachmittag bei mir, um das Weitere zu besprechen. Und zieht euch saubere Kleidung an! Verstanden?«
»Ja, Herr Vormund, wir haben verstanden«, antwortete Sophie, um der peinlichen Situation die Schärfe zu nehmen. »Ja, Herr Vormund.«
Der feine Herr Schlüssel erhob sich von der Bank und nahm den Weg zum Rathaus auf der Brücke inmitten des Flusses. Leberecht betrachtete die Ärmel seines Wamses. Gewiss, man sah ihm an, dass schon sein Vater das Gewand getragen hatte. Die Ärmelränder waren zerschlissen, die Nähte spröde und kaum zum Nachbessern geeignet; aber ging er nicht sauber gekleidet, viel sauberer, als es seinem Stand zukam?
Sophie, die ihres Bruders Gedanken lesen konnte, zog Leberecht ins Haus und schob ihn die enge Holztreppe empor in das erste Stockwerk. Zwei Kammern mit je einem Fenster zur Straße und ein verrußter Verschlag, dessen eine Hälfte ein gemauerter Ofen einnahm, waren das Zuhause ihrer Kindheit gewesen. Der Lärm vom Kranen, wo die langen Flusskähne entladen wurden, wo die Marktfrauen schon frühmorgens ihre Waren ausriefen, dass es in den engen Gassen hallte, der ölige Geruch von gebratenem Fisch, der sich mit dem warmen Gestank feilgebotener Eingeweide mischte, der beißende Qualm aus der Schmiede im Erdgeschoss, der das ganze Haus mit einer fahlen Rußschicht überzog, das Kindergeschrei an den Nachmittagen – Erinnerungen an eine unbeschwerte Kindheit: All das sollte nun auf einmal zu Ende sein?
Durch die kleinen Fenster fiel ein zaghafter Sonnenstrahl, gerade ausreichend, den länglichen Tisch und die hölzernen Sitzbänke auf beiden Schmalseiten zu erhellen. Leberecht ließ sich auf seine angestammte Bank fallen, die ihm ans Herz gewachsen war wie ein kostbarer Besitz, schob die angewinkelten Arme auf den Tisch und verbarg seinen Kopf in den Ärmeln seines Gewandes. Er schluchzte. Erst jetzt wurde ihm so richtig bewusst, was der frühe Tod der Eltern für sein künftiges Leben bedeutete. Mehr als die Mutter hatte Leberecht seinen Vater geliebt. Er hatte ihn bewundert und verehrt, weil er auf alle Fragen des Lebens eine Antwort wusste und, obwohl er nie eine Lateinschule besucht hatte, von hervorragender Bildung, ja Gelehrsamkeit gewesen war, die einem Totengräber in keiner Weise zukam.
Adam Friedrich Hamann, der Totengräber vom Michelsberg, hatte sich all sein Wissen selbst angeeignet; er war häufiger Gast in der Bibliothek des Klosters gewesen, häufiger als die hohen Herren Fratres, die sich weiße Stulpen über die schwarzen Kutten ihrer Ärmel zogen, wenn sie die Worte des Herrn oder jene der Weisheit und Wissenschaft studierten und dabei einschliefen. Ein Totengräber, des Lesens und Schreibens kundig und erfahren in den Gesetzen der Geometrie, wie sie Pythagoras und Euklid gelehrt haben, war äußerst ungewöhnlich und suspekt und gab Nahrung für vielerlei Gerüchte und Spekulationen, von denen das niederträchtigste Hamann als abtrünnigen Jesuiten verleumdete, welcher aus Leidenschaft zu einer Frau der heiligen Mutter Kirche den Rücken gekehrt habe.
Der Hauptgrund für diese Verleumdung lag darin begründet, dass Hamann die Evangelien in lateinischer Sprache las, wie das vor Luthers Zeiten jeder fromme Christenmensch tun musste, wollte er Gottes Wort auf eigene Weise erfahren. Weil er nicht über das Geld verfügt hatte, das erforderlich war, seine Kinder in die Schule zu schicken, und weil er eine natürliche Neigung zu allem, was mit Wissenschaft und Gelehrsamkeit in Zusammenhang stand, an den Tag legte, hatte der Vater seine Kinder gleichsam spielend und ohne Zwang im Lesen und Schreiben, sogar in lateinischer Sprache, und im Christentum unterrichtet.
Daneben – oder richtiger: In der Hauptsache – hatte Leberecht beim Steinmetz Carvacchi eine Lehre begonnen. Das entsprach seiner Neigung, denn nichts beeindruckte den Jungen mehr als das Säulen- und Skulpturenwerk aus feinkörnigem Sandstein, das dem hohen Dom die kunstvolle Weihe gab. Dreihundert Jahre alt, zeigte das weiche Gestein, das von der Härte des Marmors so weit entfernt war wie die kleine Stadt am Fluss vom päpstlichen Rom, erste Verfallserscheinungen, und Carvacchi stand jener Bauhütte vor, welche mit zwei Dutzend Gesellen und einer wechselnden Zahl von Tagelöhnern die Ausbesserungsarbeiten besorgte.
Carvacchi, den sie wegen seines unaussprechlichen Namens, aber auch, weil es – anatomisch gesehen – den Tatsachen entsprach, »Schwellkopf« nannten, gehörte zu jenen gar nicht seltenen Menschen, denen Verachtung und Bewunderung in gleichem Maße zuteilwerden. Der Schwellkopf, von florentinischer Herkunft, obwohl er besser fränkisch sprach als die arroganten Domherren, war ein Genie, wenn es darum ging, die zerstörte Hand einer Statue, eine gelockte Haarsträhne oder den gesplitterten Saum eines steinernen Gewandes zu ersetzen. Mühelos gelang es Carvacchi, die Technik des Originals nachzuempfinden, so dass, obwohl kaum zwei Kunstwerke des Domes aus der Hand desselben Künstlers stammten, seine Renovierungskunst nicht die geringsten Spuren hinterließ. Daneben aber neigte er zum Trinken, zu losen Weibern, verschwenderischer Lebensweise, zum Schuldenmachen und zur Händelsucht. Zänkisch wie die Waschfrauen an der Regnitz, ging er keinem Streit aus dem Weg, ja, er fühlte sich von Streitereien magisch angezogen wie der Teufel von der Sünde, vor allem im Umgang mit den Pfaffen, bei denen er in Brot und Arbeit stand.
Bei Leberecht Hamann hinterließ der Mut des Lehrmeisters tiefen Eindruck. Er hatte mit eigenen Augen gesehen, wie der Schwellkopf auf dem Weg zum Domberg vor dem Prediger Dr. Athanasius Semler, der stets purpurfarben gegürtet auftrat, ausspuckte und seines Weges ging. Und das vor einem heiligen Mann, dem die Herren des Magistrats, wenn sie ihm begegneten, unter Kniefall den Ring küssten, während ihre Frauen drei Kreuze über die Schnürbrust schlugen!
Leberecht spürte Sophies Hand auf seinem Haar und er hörte ihre Stimme: »Es wird alles gut werden. Schlüssel ist ein guter Mensch, glaube mir!«
Der Junge wischte sich mit der Hand übers Gesicht. Er nickte, obwohl er gerade davon in keiner Weise überzeugt war.
»Was ist ein Vormund?«, fragte Leberecht und sah zu Sophie auf.
Die hob die Schultern, malte mit dem Finger ein Kreuz auf die Tischplatte und erwiderte unsicher: »So eine Art Ersatzvater, der auf uns aufpasst, dein Lehrgeld bezahlt und über meine Unschuld wacht.«
Leberecht blickte aus dem Fenster und fragte: »Aber warum gerade Schlüssel, der Wirt vom Sand?«
»Der Wirt vom Sand ist ein wohlhabender Mann, er ist rechtschaffen und angesehen, und obwohl er sich mehr Kinder leisten könnte als jeder andere in der Stadt, blieb ihm nur ein einziger Sohn. Wir sollten Schlüssel dankbar sein, hörst du!«
Während sie das sagte, begann Sophie Leibwäsche aus einem Schrank zu nehmen, der in die Innenwand eingelassen und mit einem breiten Holzrahmen verblendet war. Sie stapelte die einzelnen Stücke in einem hohen Weidenkorb, wie ihn die Marktfrauen auf dem Rücken tragen, und mahnte ihren Bruder, indem sie ihm einen Leinensack zuwarf: »Du solltest ebenfalls deine Kleider einsammeln.«
Die dunkle Zukunft, von der Leberecht sich mit einem Mal bedroht sah wie von einem gefährlichen Ungeheuer, ließ sein Gesicht erstarren. Leberecht hatte Angst, eine Angst, die sogar die Trauer über den Verlust des Vaters übertraf. Er fühlte sich allein gelassen, einsam und hilflos wie noch nie in seinem Leben. Wie im Traum suchte er seine Kleidung zusammen, stopfte sie in den Sack und ergriff das Lederband des Holzkästchens, das sein Steinmetzwerkzeug enthielt, seinen ganzen Stolz und einzigen Besitz. Ohne einen letzten Blick auf die glückliche Umgebung seiner Kindheit zu werfen, verließ er die finstere Stube, polterte die abgetretene Stiege hinab und trat ins Freie. Sophie folgte verstört mit dem Weidenkorb auf dem Rücken.
Während sie ein Stück flussaufwärts gingen zu der oberen Brücke, die vom ärmlichen und arbeitsamen Viertel über den Fluss zum Sand führte, und während Leberecht, den Blick zu Boden gesenkt wie ein Kanoniker beim Miserere, vor sich hin stapfte, kam Sophie eine Aufmunterung in den Sinn, die ihr Vater oft gebraucht hatte, wenn widrige Umstände es erforderten. Sophie sagte: »Kopf hoch, mein Junge, wo bleibt dein Stolz?«
Da musste Leberecht lachen, wenngleich seine Augen feucht glänzten wie dunkle Beeren im Morgentau. Ohne diese Aufmunterung hätte Leberecht Mühe gehabt, den Mantel abzustreifen, der seine Gedanken einhüllte und ihm die Armseligkeit seiner Existenz vergegenwärtigte. Leberecht rang sich ein Lächeln ab, nickte seiner Schwester zu und warf demonstrativ den Kopf in den Nacken.
So trafen sie lachend und scherzend beim Wirt im Sand ein, einem breitbrüstigen Fachwerkhaus aus rotbemalten Balken und weißem Mauerwerk. Zu beiden Seiten des spitzbogigen Eingangs, dessen zweiflügeliges Tor mit eisernen Rauten beschlagen war wie der Schild eines Kreuzfahrers, reihten sich vergitterte Fenster mit Butzenscheiben.
Drei oder vier steinerne Stufen führten zu einem großen, gewölbten, mit rohen Ziegeln gepflasterten Raum hinauf, von dem links und rechts und an der Stirnseite spitzbogige Türen abgingen. Dazwischen standen an den Wänden lange schwarze Bänke und ausgediente Weinfässer als Tische.
Obwohl es noch hell war, war die Wirtsstube bereits erfüllt von dem lauten Geschrei eines Trinkgelages.
Leberecht hatte noch nie eine Gaststube betreten, erst recht nicht Sophie; aber ein dicklicher Junge, der an einer gedörrten Pferdewurst kaute und die Pelle genüsslich auf den Boden spuckte, erlöste Leberecht und Sophie aus ihrer Verlegenheit.
»Die Hamann-Waisen!«, rief er süffisant, wie es einem Jungen seines Alters überhaupt nicht zukam. »Gott schütze uns vor Lumpenpack und Gesindel!«, und dabei schlug er mit der Pferdewurst in der Hand ein flüchtiges Kreuzzeichen.
Leberecht ließ seinen Kleidersack zu Boden fallen, und er holte gerade mit seinem Holzkasten aus, um den unverschämten Fettwanst damit niederzuschlagen, da erschien in der Tür zur Linken die massige Gestalt des alten Schlüssel, und seine gewaltige Stimme schallte durch das Gewölbe: »Christoph! Silentium! Abitus!1«
Der dickliche Junge senkte den Kopf, drehte sich um und verschwand wie ein dressierter Köter.
Grinsend, aber mit finsteren Brauen baute sich der Wirt vom Sand vor ihnen auf. Er trug ein dunkelrotes vornehmes Wams mit aufgepluderten Ärmeln. Seine Hände hielt er im Rücken, die fetten Beine geschlossen. In kurzen Abständen hob er die Fersen, als wollte er dadurch noch größer erscheinen. Sein Blick verriet nicht die geringste Anteilnahme; er war eher drohend.
»Martha!«, rief Schlüssel mit lauter Stimme, und über die seitliche Treppe kam eine schöne rothaarige Frau herabgeschritten. Ihr stolzes Aussehen war ebenso berühmt in der Stadt wie ihre Tugendhaftigkeit und Güte. Zweimal im Jahr an den Festen der Erscheinung des Herrn und der heiligen Martha, speiste sie die Armen und zog so die Dankbarkeit aller auf sich und den Verdacht, eine Heilige zu sein wie jene fromme Elisabeth von Thüringen, die während einer Hungersnot täglich 900 Menschen versorgt und nach dem Tod ihres Mannes bei ihrem Oheim, einem leibhaftigen Bischof, Schutz gefunden hatte. Zweifellos verkörperten Jakob Heinrich Schlüssel und seine Frau Martha jene Gegensätze, die so verschieden sind wie Wasser und Feuer, Himmel und Hölle, Gut und Böse. Denn was Martha Schlüssel an Güte verströmte, das strahlte der Wirt vom Sand an Boshaftigkeit aus.
Man konnte nur spekulieren, welche Fügung des Himmels oder der Erde diese beiden Menschen zueinandergeführt hatte; aber vermutlich verbarg sich dahinter jenes Gesetz der physikalischen Wissenschaft, nach welchem Gegensätze die größte Anziehung bewirken, während Eintracht und Harmonie sich abstoßen wie die gleichgerichteten Enden zweier Magnetsteine. Hielten sie Martha für eine schöne Heilige, so nannten sie den Wirt vom Sand einen hochmütigen, eitlen, nichtswürdigen Schurken, für den seine Wirtschaft nur ein angenehmer Zeitvertreib war. Für gewöhnlich fuhr er im Lande umher und suchte vielerlei Geschäfte, getreu dem Motto, dass nur mit Geld Geld zu verdienen sei. Daher liebte er das Spiel, die Tafelfreuden und das schöne Geschlecht, und die Leute tuschelten, er halte sich die schöne und edle Martha nur, um sich selbst zu schmücken wie mit einem Kleinod. Jedenfalls kühlte er seine Leidenschaften – das war kein Geheimnis – mit einer liederlichen Edeldame namens Ludowika, die auch dem Fürstbischof zur Hand ging – vermutlich aus diesem Grunde.
Schlüssel versuchte, vor seiner Frau freundlich zu sein, was jedoch gründlich misslang, als er sagte: »Das sind sie, die Waisen vom Kranen!«
In seinen Worten lag so viel Überheblichkeit, dass Leberecht am liebsten auf der Stelle kehrtgemacht hätte und fortgelaufen wäre. Jedenfalls wusste er von diesem Augenblick an, dass er hier nicht bleiben würde. Er war jung und kräftig und nicht auf den Kopf gefallen; er brauchte den alten Schlüssel nicht zum Überleben.
Zur Begrüßung fasste die Frau Leberecht und Sophie an den Händen und drückte sie. Leberecht genoss die Wärme, die von Martha ausging.
»Mutter«, meinte die Wirtin, »kann ich euch nicht sein; aber ich will für euch sorgen, als wäre ich euch eine Schwester.«
»Recht so!«, drängte der Wirt sich dazwischen. »Oben unter dem Dach ist eine Kammer gerichtet. Martha wird sie euch zeigen.«
Sie stiegen fünf steile Treppen nach oben. Neben dem Taubenschlag, wo auch das Gesinde seine Schlafstellen fand, gab es eine kleine Kammer mit einem knorrigen Bett aus rohem Holz und einem winzigen Fenster zum Domberg hin. Der breite Kamin, der mitten durch das karge Zimmer ging, verbreitete wohlige Wärme.
Leberecht und Sophie sahen sich an. Eine Kammer für sie beide allein! Nicht einmal bei ihren Eltern hatten sie eine eigene Kammer gehabt. Vater, Mutter und beide Kinder hatten in einem Bett geschlafen, einem quadratischen Kasten mit einem Holzdach darüber zum Schutz vor der Kälte, die von oben kam, und vor dem Ungeziefer, das sich nachts von der Decke fallen ließ.
»Es wird schon alles gut werden«, meinte Sophie, nachdem die Wirtin gegangen war.
Leberecht wiegte den Kopf hin und her, als glaubte er Sophies Worten nicht so recht. Dann sagte er zu seiner Schwester: »Ich glaube nicht an die Güte des alten Schlüssel. Es muss doch einen Grund geben, warum er so bereitwillig unser Vormund wurde. Der Wirt vom Sand tut nichts ohne eigenen Nutzen!«
»Aber vielleicht sein Weib. Die Wirtin ist eine herzensgute Frau. Das weiß doch jedes Kind. Danken wir Gott, dass uns der Wirt vom Sand das Waisenhaus erspart hat.«
Leberechts größte Sorge galt der Fortsetzung seiner Lehrzeit. Wie sollte er die zwölf Gulden Lehrgeld aufbringen, die Carvacchi im Jahr verlangte?
Am Abend bei der gemeinsamen Suppe verkündete der Wirt vom Sand in Anwesenheit seiner Frau Martha und des Sohnes Christoph, wie er sich die Zukunft der Ziehkinder vorstellte. Sophie sollte die Stelle einer Hausmagd einnehmen, ohne Lohn, aber gegen freies Essen und ein neues Gewand im Jahr. Für Leberecht wollte Schlüssel zwei Jahre lang das Lehrgeld übernehmen, finanziert aus dem Erlös des Nachlasses des verblichenen Adam Friedrich Hamann, den der Wirt vom Sand, nach Abzug aller Kosten, auf etwa 25 Gulden schätzte.
Während sich Jakob Heinrich Schlüssel auf keine weitere Erklärung einließ, was die Vormundschaft betraf, rührte Martha verlegen in ihrer Suppe. »Ihr werdet euch natürlich die Frage gestellt haben«, platzte sie endlich heraus, »warum gerade der Wirt vom Sand die Vormundschaft für euch übernommen hat …«
»Jeder Mensch kennt Eure Güte«, fiel Sophie der Wirtin ins Wort.
Die schlug die Augen nieder und fuhr fort: »Gott, der Allmächtige hat uns nur einen Sohn geschenkt. Es war sein Wille, uns für unsere Sünden zu strafen und uns keine weiteren Nachkommen zuteilwerden zu lassen. Für jedermann erkennbar schwebte der Makel der Sünde, des einzigen Kindes, über unserem Haus. Wenn wir euch an Kindes Statt aufnehmen, so ist es unser Wunsch, diesen Makel zu tilgen. Ihr gehört von nun an zur Familie.«
Martha schien erleichtert, nachdem sie sich erklärt hatte. Nur der Wirt vom Sand und sein Sohn sahen sich ziemlich ratlos an. Mutters Erklärung war ihnen sichtbar peinlich.
Schließlich fuhr Schlüssel seinem dicken Sohn durchs Haar und verkündete stolz: »Dafür macht uns dieser eine viel Freude. Christoph besucht das Jesuitenkolleg. Er studiert Latein und Mathematik und Euklids Lehre von den Elementen.« Und an seinen Sohn gewandt: »Sag etwas auf Lateinisch, damit sie sehen, wie klug du bist! Sag was!«
Verlegen begann Christoph Schlüssel: »Gallia omnis est divisa in tria partes …«
»Partes tres!«, unterbrach Leberecht. »Gallia est omnis divisa in partes tres!2 So jedenfalls hat es Gaius Julius Caesar niedergeschrieben.«
Der Wirt lachte. »Ein Steinmetzgeselle will einen Schüler des Jesuitenkollegs korrigieren!«
»Warum nicht!«, meinte Leberecht vorlaut. »Wenn er das Lateinische besser hersagen kann?«
»Du? Du?«, lachte der alte Schlüssel nun noch lauter. »Du willst Latein können? Wer hat dir das beigebracht?«
»Mein Vater«, erwiderte Leberecht knapp, und Sophie nickte stolz.
»Der Totengräber?«
»Ja, der Totengräber!«
Schlüssel schüttelte sich vor Lachen. »Und wer, mit Verlaub, hat ihm das beigebracht, dem Totengräber?«
»Die Mönche vom Michelsberg, mit Verlaub.«
Der Wirt hielt verwundert inne. Der dicke Junge blickte erst verwirrt, dann zornig, dann meinte er weinerlich: »Die Mönche vom Michelsberg unterhalten keine Lateinschule!«
»Nein«, antwortete Leberecht, »aber sie haben eine große Bibliothek mit vielen lateinischen Büchern. Ich habe sie selbst gesehen.«
Die Stimme des Jungen wurde heftig: »Es ist nicht erlaubt, dass Ungebildete Bücher lesen!«
Leberecht zog seine Stirn in Falten: »Wer sagt das?«
»Die heilige Mutter Kirche. Sie gestattet nur Bücher zu lesen, die im christlichen Glauben geschrieben sind. Und um zu erkennen, dass ein Buch die christliche Lehre verbreitet, muss man gebildet sein.«
»So wie du.«
»Ja.«
»Aber Gaius Julius Caesar war ein Heide!«
»Ganz recht!«
»Trotzdem hast du seine Schrift gelesen.«
»Ich habe sie in dem Bewusstsein gelesen, dass seine Schriften heidnische Schriften sind. Ein Ungebildeter liest sie ohne Kritik. Das ist schädlich für den Glauben.«
Leberecht zog die Augenbrauen hoch; aber er schwieg. Doch von Stund an hatte er für diesen vollgefressenen Dickwanst nur noch Verachtung übrig, und er wusste, dass es früher oder später zu einer Auseinandersetzung kommen würde.
Am folgenden Morgen, es war der fünfte Fastensonntag, ging Martha Schlüssel mit Christoph, ihrem leiblichen, und Leberecht, ihrem Ziehsohn, zur Messe im Dom. Sophie hatte Küchenarbeiten zu verrichten.
Die hochherzige Entscheidung des Wirtes vom Sand, die Waisen bei sich aufzunehmen, hatte sich in Windeseile herumgesprochen, und der unerwartete Schritt fand große Anerkennung. Martha, die ihre Schönheit ebenso bereitwillig zur Schau trug wie ihren frommen Glauben, hatte zum Schutz vor der Märzkälte einen schwarzen Umhang um die Schultern geschlungen. Darunter trug sie ein grünes wollenes Kleid mit breiten senkrechten Samtstreifen, ein Gewand, das ihr die Bewunderung von Frauen und Männern im gleichen Maße einbrachte.
Vorbei am Georgentor betraten sie den Dom durch die der Stadt zugewandte Gnadenpforte. Die Messe wurde vom Domprobst gelesen. Der Bischof selbst verfolgte das Geschehen eher teilnahmslos von einem roten Thronsessel im schwarzverhangenen Peterschor.
Nach Verkündung des Evangeliums zum fünften Fastensonntag bestieg der Domprediger Athanasius Semler die steinerne Kanzel. Unruhe kam auf, dann starrten die Kirchenbesucher wie gebannt auf die kleine dürre Gestalt über ihren Köpfen. Semler genoss die fromme Erwartung und ließ den Blick unendlich langsam über das Volk der Gläubigen schweifen, als suchte er einen Sünder.
Endlich erhob er seine hohe Stimme und begann leise: »Gott sei euch armen Sündern gnädig, euch elenden Kreaturen der Sünde, euch Werkzeug des Teufels und der bösen Mächte, die ihr« – seine Stimme wurde lauter und lauter – »Schindluder treibt mit den Gaben Gottes tagaus, tagein. Aber Gott der Allmächtige wird euch strafen mit dem ewigen Höllenbrand. Satans Knechte werden euch rösten auf glühenden Eisen und vierteilen mit schartigen Schwertern, und euer Wehgeschrei wird lauter sein als die Posaunen von Jericho und es wird den Donner des Himmels übertönen …«
Im Dom wurde es totenstill. Die Menschen standen mit gesenkten Köpfen. Martha hatte ihren schwarzen Umhang über den Kopf gezogen und presste ihn krampfhaft unter dem Kinn zusammen. Leberecht, auf den die geifernden Worte des Predigers wenig Eindruck machten, sah, dass Martha beschämt die Augen niederschlug. Zu seiner Verwunderung trug sogar Christoph ein reumütiges Gesicht zur Schau.
»Die Qual«, fuhr Semler fort und zeigte mit ausgestrecktem Arm in die Menge, »die Qual der Hölle wird unvorstellbar sein, unvorstellbar größer als Kreuz und Trübsal, Pein und Schmerz, mit denen dieses Jammertal überhäuft ist. Aber wie groß und vielfältig diese Qualen auch sein mögen, so sind sie doch geteilt und gemäßigt, und niemals werden alle zusammen und zur selben Zeit denselben Menschen anfallen und peinigen. Wer arm ist, ist deshalb nicht krank am Leib. Wer krank ist, wird deshalb nicht verspottet. Wer betrübt ist, muss deshalb nicht Durst und Hunger leiden. Wer von einem Menschen gehasst und gequält wird, erleidet deshalb nicht von allen Menschen Verfolgung. Augenpein macht keine Schmerzen in den Händen. Lahmheit verursacht keine Zahnpein. Leidet der Leib, so ist der Geist nicht verstört. Stets bleibt dem Menschen noch etwas übrig, das frei ist von Qual. Und wenn ein Kranker sich zuweilen einbildet, alles tue ihm allenthalben wehe, so ist doch gewiss, dass derselbe Schmerz, der ein einzelnes Glied heimsucht, nicht zugleich in allen Gliedern sein kann. Denn wo er von Hitze gepeinigt wird, da kann er keine Kälte leiden. Wo ihm vor Speisen ekelt, da kann er nicht von Hunger gequält werden. Und das Leid, das einer gestern aushielt, kann er heute nicht mehr fühlen. Ich aber sage euch Sündern vor Gott dem Allerhöchsten: Über euch werden alle Höllenqualen auf einmal kommen, über eure Leiber alle Schmerzen und Peinen im höchsten Grade und zur selben Zeit.
Geht mit euren Gedanken in die Spitäler und Siechenhäuser, die mit Pesthaften und Verwundeten angefüllt sind. Hört, wie das arme Volk ächzt und jammert, greint und schreit. Der eine wegen unerträglicher Schmerzen im Gehirn, jener wegen Pein an den Zähnen, ein anderer vom Schneiden in den Därmen. Arme und Beine sind jenem gebrochen wie dürre Äste, der Kopf zerschlagen ist diesem, dem Dritten ist der Leib durchstochen, der kalte Brand hat dem vierten Mund und Nase abgefressen. Wundärzte mit glühenden Eisen brennen hier und schneiden dort mit scharfen Messern in das lebendige Fleisch. Hier sägen sie einem die Hand, dort einem andern den Fuß vom zuckenden Leib. Allenthalben ist Jammer und Elend und kaum einer kann, ohne ohnmächtig zu werden, dem furchtbaren Spektakel zuschauen. Stellt euch in euerem Gehirn alle Torturen vor, die von grausamen Tyrannen jemals erfunden, und entweder aus Rache an ihren Feinden oder aus Hass an Märtyrern und Blutzeugen Christi in teuflischer Tobsucht ausgeübt wurden. Seht nur die Folterbänke, auf welchen sie ausgestreckt wurden wie zuckendes Schlachtvieh, Galgen und Räder, mit denen sie lebendig zergliedert, die Geißeln und Skorpione, mit denen sie zerfleischt wurden bis aufs bloße Gebein und mit Salz bestreut. Riecht ihr den Geruch der glühenden Pfannen, in denen sie zerkocht und gebraten wurden, das siedende Blei, das ihnen in den Mund gegossen, das Pech, mit dem ihre Leiber beschmiert und angezündet wurden? Erdenkt alles, was ihr an Torturen und Pein ersinnen könnt, denkt euch alle Wunden und Krankheiten zusammen und stellt euch vor, ihr müsstet alles auf einmal erleiden! Dann hättet ihr für einen kurzen Augenblick eine Vorstellung von der Hölle, jene Pein, die euch elende Sünder erwartet!«
Unterhalb der Kanzel begann eine Frau laut zu schluchzen, eine andere fiel in Ohnmacht, ein kleines Mädchen erbrach sich in die Hände seiner Mutter. Martha atmete schwer. Leberecht beobachtete, wie sie am ganzen Leib zitterte. Sie wagte nicht, zu dem Prediger aufzublicken.
Der zeigte sich von der Angst und dem Ekel seiner Zuhörer unbeeindruckt und fuhr in seiner Bußpredigt fort. Semler geißelte die Fleischeslust, hervorgerufen durch die Sichtgier der Augen. Semlers Stimme überschlug sich mehrfach, als er auf die »Pforten des Satans« oder das »teuflische Geschlecht« zu sprechen kam, wie er Frauenspersonen mit Vorliebe nannte. Nur sie trügen die Schuld an der Unzucht und Schamlosigkeit allerorten. »Ejicientur in tenebras exteriores; ibi erit fletus et stridor dentium!«, geiferte der Prediger überschäumend – »Sie werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis; dort wird Weinen und Zähneklappern sein.«
Durch den hohen Dom schallten unflätige Laute: »Huren!« – »Hexen!« – »Bräute des Satans!«
Mit einer heftigen Handbewegung, wobei er unwillig die Finger spreizte, gebot Semler zu schweigen. Er duldete, wenn er predigte, keine andere Stimme als die seine. »Wie oft«, fuhr er fort, »habt ihr euch versündigt mit geilen Anblicken des anderen Geschlechts? Wie oft habt ihr euch unreinen Gedanken hingegeben in Betrachtung eurer eigenen Gestalt vor dem Spiegel? O welche Pein werdet ihr in der Hölle erleiden, wo euch nur die abscheulichsten Missgestalten begegnen, Weiber mit dicken Bäuchen und krummen dünnen Beinen, Weiber mit hängenden Lappen statt Brüsten und ohne ein Haar auf dem Kopf. Dann werdet ihr bereuen, dass ihr zu Lebzeiten Sklaven der nackten Schönheit gewesen seid, der Abbilder der Sünde, die unter dem Deckmantel der Kunst ihr Unwesen treibt!«
Bei diesen Worten hielt der Domprediger inne. Er stand starr wie eine Statue. Sein ausgestreckter Arm zeigte in Richtung der steinernen Pfeilerfiguren, welche rätselhafte Namen trugen wie »Ekklesia«, »Synagoge« oder »Zukunft« und leichtgewandete Frauenspersonen darstellten mit deutlichen Formen wollüstiger Weiblichkeit. Obwohl der Neubau des Domes nach einem verheerenden Brand eines älteren Bauwerkes gerade erst 300 Jahre zurücklag, wusste niemand um Herkunft und Bedeutung dieser Statuen weiblichen, äußerst weiblichen Geschlechts, mit spitzen Brüsten und einem sündhaften Lächeln im Gesicht.
Das allegorische Abbild der Zukunft erregte Athanasius Semler in besonderem Maße, weil die Weibsperson, die sie versinnbildlichte, eine andere Skulptur im Dom, Abbild der Gottesmutter Maria, an Schönheit und Weiblichkeit in den Schatten stellte. Wie die Statue mit schmaler Hand und spitzem Finger in die Zukunft wies und in gebogener Haltung ihren schlanken Körper zur Geltung brachte, das konnte einen frommen Christenmenschen durchaus in Erregung versetzen und schürte Zweifel, ob dieses Kunstwerk überhaupt je für den Dom geschaffen wurde. Seit Beginn seiner Lehre hatte Leberecht viele Stunden vor der Statue verbracht. Carvacchi hatte ihm im Anblick der Zukunft jene Grundbegriffe der Kunst erklärt, die von den großen italienischen Meistern zum Gesetz erhoben wurden: dass die Harmonie am größten ist, wenn die Länge des Körpers acht und zwei Drittel Gesichtslängen betrage; dass das Gesicht eines Menschen stets die Fläche seiner Hand einnimmt; Nase und Ohren immer in gleicher Höhe sitzen, sowie den Unterschied zwischen Stand- und Spielbein, Wand- und Gewandfigur. Und weil die »Zukunft« so zart bekleidet war, als verhüllte sie nur ein Nebel im Herbst, hatte Leberecht an der edlen Skulptur die weibliche Anatomie studiert, wie sie eine reife Frau nur selten zur Schau trägt. Seither maß er die Erscheinung jedes weiblichen Wesens an dieser einen Statue.
Natürlich war ihm, dem jungen Steinmetz, sofort aufgefallen, dass Martha, die Wirtin vom Sand, die ihm nun Ziehmutter sein sollte, in ihrem Ebenmaß viel mit der »Zukunft« gemein hatte: Das schmale Gesicht und in Zusammenhang damit die schmalen Hände, vor allem aber ihre geschwungene Haltung, hervorgerufen dadurch, dass sie nie auf beiden Beinen zugleich stand, sondern stets Stand- und Spielbein wechselte wie die alten Statuen der Griechen. Umso mehr trafen Leberecht die geißelnden Worte des Dompredigers, der in der »Zukunft« die Stein gewordene Sünde erblickte.
Semler hatte kaum geendet, da warfen sich Frauen auf die Knie, alte Männer stießen ihre Köpfe gegen die Pfeiler der Kirche, um sich Schmerz zuzufügen. Vom Georgenchor hallte der Ruf »peccavi – ich habe gesündigt!«, und im selben Augenblick brach ein hundertfaches Klagegeschrei aus, wie es die armen Seelen im Fegefeuer nicht trefflicher verrichten konnten.
Bei Leberecht rief das entwürdigende Schauspiel nur Abscheu hervor. Er wusste aus Erzählungen seines Lehrmeisters Carvacchi, dass andernorts die Zeit der Finsternis längst vorbei war, dass die Reformation des Mönchs aus Wittenberg eine neue Zeit eingeläutet, neuen Gedanken Raum gegeben hatte. Nur hier, am Zusammenfluss von Main und Regnitz, schien die Zeit stehen geblieben zu sein, wurden neue Gedanken als Sünde gegeißelt. Dabei stand die Reformation vor den Toren, und der Fürstbischof verlor nach und nach die Hälfte seiner Besitzungen.
Semlers Bußpredigt blieb nicht ohne Wirkung. Schweigend gingen Martha und die beiden Jungen nach Hause. Obwohl es bis Ostern nicht mehr als zwei Wochen hin waren, hatte sich der Winter noch immer nicht verabschiedet. Der Atem der Kirchgänger hinterließ dicke Dunstwolken in der kalten Luft.
Auf den Steintreppen hinab zum Sand steckten Frauen die Köpfe zusammen, und als Martha mit den Jungen die Menschenansammlung passierte, rief eine der Frauen mit gellender Stimme: »Gott sei mit uns, der Hamann-Sohn, der Hamann-Sohn!«
Die Frauen stoben auseinander wie eine Schar Hühner, in die der Fuchs gefahren ist. Nur zwei würdige Matronen blieben zurück.
»Was ist geschehen?«, fragte Martha Schlüssel, an eine der beiden gewandt.
Die zeigte ein verlegenes Gesicht und betrachtete abwechselnd die Fragestellerin und den jungen Hamann. Endlich fasste sich die eine ein Herz und antwortete mit einer Kopfbewegung auf Leberecht: »Sein Vater, der Totengräber vom Michelsberg, ist der Leinweberin Hussmann erschienen.«
Martha legte ihren Arm um Leberecht, als wollte sie ihn schützen. Der sah seine Ziehmutter mit unsicherem Blick an. Er brachte kein Wort hervor.
»Die Leinweberin redet Unsinn«, entgegnete Martha. »Die Alte sieht Gespenster.«
»Das mag schon sein!«, ereiferte sich die andere. »Aber fest steht, dass die Leinweberin dem kahlen Adam auf dem Kirchhof vom Michelsberg begegnet ist, als sie das Grab des Leinwebers besuchte. Sie hat Hamann genau erkannt, er trug eine rote Kappe und hielt die Schaufel in der Hand, und als sie auf ihn zutrat, verschwand er, als hätte ihn der Erdboden verschluckt.«
Als Leberecht das hörte, riss er sich von Martha los, rannte die steinerne Treppe abwärts zum Sand, hastete wie von Furien gejagt die Straße entlang zur Oberen Brücke, überquerte den Fluss und schlug keuchend den Weg zum Kranen ein. Vor dem Haus seiner Kindheit angelangt, schob er den Riegel beiseite, der die Türen neben der Schmiede versperrte. Er nahm zwei, drei Stufen der Holzstiege auf einmal und gelangte atemlos zu der niedrigen Eingangstür, hinter der sich die meisten Erinnerungen seiner Kindheit verbargen.
Vaters Schaufel, das wusste er, lehnte hinter der Tür. Mit ihr hatte er Hunderten die letzte Ruhestätte geschaufelt. Und wenn er sich recht entsann, so lag die rote Kappe noch immer in dem schwarzen Kasten hinter dem Tisch.
Der Raum war durchwühlt. Bei den Gebeinen des heiligen Otto: Räuber hatten die ärmliche Behausung heimgesucht! Schubladen lagen auf dem Boden, die Türen des ärmlichen Kastens standen offen, die Bänke waren umgestoßen, nicht einmal den gemauerten Herd hatten die Einbrecher verschont und unter dem Aschenrost nach versteckten Schätzen gesucht. Als ob Adam Friedrich Hamann ein reicher Mann gewesen wäre!
Weder die Schaufel noch die rote Kappe waren an ihrem Platz. Welchen Reim sollte er sich darauf machen?
Während Leberecht seinen Gedanken nachhing, fiel sein Blick auf die eine der beiden Holzbänke, seine Lieblingsbank, die umgekehrt auf dem Boden lag, und als er daran ging, sie aufzurichten, erkannte er auf der Rückseite der Sitzfläche eine in das Holz geritzte Inschrift:
FILIO MEO L. T TERTIA ARCA.
Für einen, der Gaius Julius Caesar lesen konnte, war die Übersetzung der lateinischen Inschrift ebenso einfach wie rätselhaft: »Meinem Sohn L. – der dritte Kasten.« Adam Friedrich Hamann, der seinen Sohn im Lateinischen unterrichtet hatte, hatte derlei Rätselsprüche geschätzt, aber wie so oft wusste der Junge auch diesmal nichts damit anzufangen.
Noch am selben Tag suchte Leberecht das Grab seines Vaters auf dem Kirchhof am Michelsberg auf, aus dem das Eisenrohr ragte. Er verrichtete ein stummes Gebet und gewiss hätte er die Angelegenheit mit der angeblichen Erscheinung als eine der vielen Bosheiten abgetan, die in einer kleinen Stadt zum täglichen Umgang gehörten, hätte ihn Sophie nicht bei der Rückkehr mit der Nachricht überrascht, Ortlieb, der Fuhrknecht des Wirtes vom Sand, sei am Abend zuvor in der Teuerstadt dem kahlen Adam begegnet!
»Glaubst du etwa an dieses Geschwätz?«, erkundigte sich Leberecht bei seiner Schwester, nachdem er sich von dem Schock erholt hatte.
Sophie antwortete nicht. Sie hatte feuchte Augen. Auch Leberecht kämpfte jetzt mit den Tränen. Aber nicht etwa aus Furcht vor den Erscheinungen, sondern aus Wut. Die Gier der Menschen nach wundersamen Erscheinungen war grenzenlos. Während andernorts, nicht einmal weit vor den Toren der Stadt, mit der Lehre Martin Luthers eine neue Zeit Einzug hielt, in der Bußpredigten, Ablässe und Folter im Namen Jesu Christi der Vergangenheit angehörten, hielt hier der Fürstbischof seine segnende Hand über die finstere Endzeit, welche seiner Ansicht nach angebrochen war. Zwar hatte sich die Weissagung der Propheten, das Jüngste Gericht würde eineinhalb Jahrtausende »post passionem«3, also im Jahre des Herrn 1533, eintreffen, nicht erfüllt, aber im Glauben der weisen Frömmler konnte der Fehler – und als solcher wurde das Ausbleiben des Weltuntergangs seitdem bezeichnet – keinesfalls bei den Propheten liegen, sondern nur bei den Jüngern Euklids, die sich, Gott sei’s geklagt, bei ihren Berechnungen heidnischer arabischer Schriftzeichen bedienten.
Das furchtbare Jahr, für das die Weisen das Ende prophezeit hatten, an dem die Berge Feuer speien, die Flüsse über die Ufer treten und die Toten aus ihren Gräbern auferstehen sollten, lag nun 21 Jahre zurück; aber das Verhalten der Menschen von damals war noch allgegenwärtig, und nirgends konnte die heilige Inquisition mit so viel Zuspruch, so vielen Spitzeln und Zeugen rechnen wie hier.
Von seinem Vater, der sich in der Abtei Michelsberg eine Menge Wissen angelesen hatte, hatte Leberecht denkwürdige Dinge erfahren. Zum Beispiel, wie ehrsame Bürger, einfache Häcker oder steinreiche Brauer sich von der Unreinheit ihrer Seele säuberten oder das ewige Heil zu erkaufen suchten. Seither wurde sein frommer Glaube, der einem Jüngling in dieser Zeit an diesem Ort bereits in die Wiege gelegt worden war, von immer heftigeren Zweifeln geplagt. Jedenfalls glaubte Leberecht nicht daran, dass das Geißeln der eigenen Glieder, der Kauf von Gebeten und das unaufhörliche Sündenbekenntnis der rechte Weg sei, um ins Paradies zu gelangen.
Fieberkrank von den selbstauferlegten Martern und Torturen, begegneten viele der Heiligen Jungfrau Maria; ja, sogar Otto, der heilige Bischof, und Kaiserin Kunigunde, von der jeder wusste, dass sie im Dom neben Heinrich, dem Kaiser, begraben lag, trieben bisweilen ihr Unwesen. Das wurde von durchaus ehrsamen Bürgern behauptet, denen die armen Seelen in irdischer Gestalt an verschiedenen Orten leibhaftig begegnet sein sollten.
»Die Leute sagen, unser Vater sei ein Hexer gewesen, einer, der mit dem Teufel im Bunde stand!«
Die Worte Sophies holten Leberecht in die Gegenwart zurück. »Vater ein Hexer, mein Gott!« Leberecht schüttelte den Kopf. »Vater war kein Hexer. Dafür war er viel zu klug.«
Sophie lachte bitter. »Der Satan macht vor den Klugen nicht halt. Denk nur an Nikolaus von Kues. Hat Vater nicht seinen Scharfsinn gerühmt, wenn er von seinen Büchern erzählte? Und doch predigte der Cusaner die docta ignorantia, die belehrte Unwissenheit, als höchstes Ziel. Nein, der Fehler, den unser Vater beging, war ein ganz anderer. Er passte nicht in das Bild vom frommen Christenmenschen. Ein Totengräber, der das Lateinische besser hersagen kann als der Fürstbischof und der seine Kinder die heidnischen Schriftsteller der Antike lehrt, gerät allzu leicht in Verdacht, ein Ketzer zu sein.«
»Vielleicht …« Leberecht wurde nachdenklich. »Vielleicht sind die Erscheinungen unseres Vaters gar keine Erscheinungen, sondern ein von der Kurie der Domstiftskanoniker erdachtes Theater.«
»So darfst du nicht denken!«, entrüstete sich Sophie. »Welchen Grund sollte die Geistlichkeit haben, so etwas zu tun?«
Schweigend stiegen beide die steilen Treppen hinauf zu ihrer Kammer.
»Warum sollten die so etwas tun?«, nahm Sophie ihre Frage wieder auf und ließ sich auf dem Bettkasten nieder.
Leberecht lehnte sich unschlüssig an den wärmenden Kamin, schließlich tat er drei Schritte zu der winzigen Dachluke, die mit Stofffetzen abgedichtet war. Ihn fröstelte. Aber mehr als die Kälte machte ihm der Gedanke zu schaffen, welche Intrige gegen ihren toten Vater gesponnen würde.
»Da kann ich dir gleich mehrere Gründe nennen«, begann Leberecht, ohne seine Schwester anzusehen. »Vater wusste zu viel über die dunklen Machenschaften der Domstiftskanoniker; vor allem aber hielt er sich mit seinem Wissen nicht hinterm Berg. Außerdem stand er bei den Mönchen der Klosterimmunität Michelsberg in Sold, ja, er genoss – wie ich aus eigener Anschauung weiß – bei den Mönchen sogar hohe Achtung, war also gleichsam einer der ihren. Wie jeder weiß, sind aber die Mönche vom Michelsberg und die Domstiftskanoniker verfeindet wie Hund und Katze. Es hätte mich doch gewundert, wenn der Domprediger Athanasius Semler das eiserne Rohr auf dem Grab unseres Vaters nicht als einen Gedanken des Teufels verdammt hätte. Er wettert doch gegen alles, was nicht wortwörtlich in der Bibel steht.«
Sophie fühlte plötzlich, wie ihr das Blut in den Kopf schoss und wie sich ein heißes Feuer ihres ganzen Körpers bemächtigte. Es war, als nehme der Teufel persönlich von ihr Besitz, als lähmte eine unbekannte Macht ihre Gedanken. Ängstlich sah sie zu ihrem Bruder auf: »In welcher Sünde leben wir, dass Gott uns das antut?«
Leberecht lachte: »Jetzt lässt du dich auch schon anstecken von dem dummen Gerede! Vielleicht beruhigt es dich, wenn ich dir sage, dass unsere Wohnung durchwühlt worden ist. Nach Reichtümern hat man dabei wohl nicht gesucht. Aber eigenartigerweise sind Vaters Schaufel und seine rote Kappe verschwunden.«
»Und? Was willst du damit sagen?«
»Nichts. Nur so viel: Vielleicht hat sich irgendjemand aus irgendeinem Grund mit dem Andenken des Totengräbers vom Michelsberg einen üblen Scherz erlaubt.«
»An eine Erscheinung glaubst du also nicht?«
»Nein!«, antwortete Leberecht mit klarer Stimme. »Ich habe heute Vaters Grab besucht. Es ist unversehrt. Oder hältst du es für möglich, dass seine arme Seele durch das Eisenrohr entwichen ist?«
Leberecht und Sophie hatten erwartet, dass der Wirt vom Sand, seine Frau Martha oder der Sohn des Hauses sie auf die denkwürdigen Vorfälle ansprechen würden. Doch es schien, als ginge ihnen die Familie, ja sogar das Personal aus dem Wege. Den ganzen Tag fand sich niemand, der mit ihnen über die rätselhaften Erscheinungen gesprochen hätte.
Als endlich im Wirtshaus Ruhe einkehrte und die Lichter gelöscht waren, legten sich Leberecht und Sophie zu Bett. Die Nacht war ungewöhnlich kalt für die Jahreszeit. Vom Fluss her stiegen feuchte Nebelschwaden auf, klamme Nachtluft drang durch Fenster- und Mauerritzen. Die beiden hatten ihre Kleider anbehalten und lagen zum Schutz vor der Kälte eng aneinandergekuschelt. Eine aus Flicken und Fetzen zusammengenähte Decke hielt die Kälte, die von der schrägen Decke herunterdrang, kaum ab.
War es die Kälte, oder hinderten ihn die trüben Gedanken am Schlaf? Irgendwann löste sich Leberecht aus der Umarmung seiner Schwester und schlich aus der Kammer. Er wusste selbst nicht, was ihn dazu veranlasste, mitten in der Nacht das Innere des Hauses zu erkunden. Ihn drängte Neugier. Vorsichtig und bemüht, das Knarren der Holztreppe zu vermeiden, tastete sich Leberecht vom Dach, wo das Gesinde seine Kammern hatte, in das darunter liegende Stockwerk.
Matter Lichtschein drang durch ein kleines verhangenes Fenster, eine winzige Luke, die von einer Kammer her dem Treppenhaus Licht spendete. Vier Türen führten auf dem quadratischen Treppenabsatz in vier verschiedene Räume. Es war still. Nur aus dem erleuchteten Fenster drang leises Wimmern, dann ein unerklärliches Stöhnen.
Leberecht erkannte Marthas Stimme. Er musste sich nicht einmal besonders strecken, um einen Blick in die Kammer zu erhaschen. Ein schmaler Spalt in der Mitte des Vorhangs ermöglichte die Sicht auf das, was im Innern vor sich ging.
Martha kniete mit dem Rücken zu der Luke auf dem Boden. Sie trug einen langen rauen Rock, in der Taille gegürtet; ihr Oberkörper war entblößt, und die offenen Haare fielen wie rote Flammen auf ihren Rücken. Während sie sich tief verneigte – vermutlich vor einem Kreuz, welches Leberecht nicht sehen konnte –, murmelte sie eine fromme Litanei. Ihre Worte waren nicht zu verstehen. Kaum hatte sie geendet, da schleuderte Martha einen beinahe armdicken Stock mit kurzen Lederriemen rückwärts über den Kopf, dass die Riemen, welche mit künstlichen Knoten versehen waren, auf ihren nackten Rücken klatschten wie die Peitsche eines Fuhrknechts auf die Hinterbacken seines Pferdes. Dabei bäumte Martha sich auf und gab einen dünnen Laut von sich wie eine getretene Katze.
Heilige Jungfrau! Leberecht erschrak zu Tode. Es dauerte eine Weile, bis der heimliche Beobachter begriff, dass Martha sich diesen Schmerz mit voller Absicht zufügte. Aber als er die ganze Tragweite dieses Vorganges begriffen hatte und als Martha dieses grausame Spiel mit der Geißel ein zweites und drittes Mal wiederholte, da fühlte Leberecht auf einmal, dass es ihm Lust bereitete. Er ergötzte sich an den Peitschenhieben, an dem Klatschen der Riemen auf ihrer Haut, an ihrem leisen Stöhnen und an der Röte, welche das Folterinstrument auf ihrem Rücken verursachte.
Noch nie hatte sich Leberecht von einer Frau so angezogen gefühlt wie von Martha bei diesem heimlichen Schauspiel. Nicht in seinen schmutzigsten Träumen, in denen meist strenge Mönche und levitierende Nonnen eine Rolle spielten, hatte er so viel Wollust empfunden, wie durch diesen schmalen Spalt im Vorhang. So musste König David im Anblick von Bathseba empfunden haben, Assuerus im Anblick von Ester und Samson, als er Dalila begegnete.
Um sich im Zaume zu halten, biss sich Leberecht auf den gekrümmten Daumen, er hielt die Luft an, solange er konnte, aber die selbstgesuchte Kasteiung zeigte keine Wirkung, und sein Drang und der Wunsch, Martha möge immer nur fortfahren mit dieser Selbstzüchtigung, wurde nur noch stärker. O welche Lust wäre es gewesen, selbst die Geißel zu schwingen gegen den weißen Körper der schönen Frau! Welch eine Verlockung …
Was Frauen betraf, so kannte Leberecht nur den Körper Sophies bis in alle Einzelheiten. Er kannte ihn so, wie Sophie ihm seit Kindertagen begegnet war: Züchtig, rein und ohne Verlockung und Leidenschaft. Leberecht hatte nie verstanden, wenn der Domprediger von der Kanzel das weibliche Geschlecht als teuflisch und alle Frauen als Pforten des Satans bezeichnete. Nun aber begriff er auf einmal, was Athanasius Semler meinte. Der Leib eines Weibes war durchaus geeignet, einen Mann um den Verstand zu bringen, ihm alle Gedanken an das Edle im Menschen zu rauben, ihn zum Frauenschänder, Verführer, Ehebrecher und Lüstling zu machen, zu einem Werkzeug der Willkür und der Genusssucht.
Im Anblick der geißelnden, klagenden Frau hätte Leberecht alles gegeben, damit das berauschende Schauspiel weiter ging bis zum Jüngsten Tag. Nur mit Mühe unterdrückte er ein Stöhnen und versuchte, seine Gedanken zu sammeln, doch nur wilde Fantasien kamen ihm in den Sinn. Er war bereit, abzuschwören der Heiligen Jungfrau und allen heiligen Weibern – Appolonia, Irmhild, Barbara, Katharina, Agnes, Hedwig, Roswitha, Hildegunde, Elisabeth, Thekla, Ermelindis und Martha. Nur dieser Martha nicht.
Leberecht wusste nicht, wie lange er gaffend vor der Fensterluke verbracht hatte; doch als Martha nach einem kraftvollen »Amen« und drei Kreuzzeichen über Stirn und Brüste ihre Zeremonie beendete, da erschrak er wie ein Kind, das aus dem Schlaf gerissen wird. Martha indessen erhob sich und verschwand aus seinem Blickwinkel. Auf dem Boden blieb ein Häuflein Erbsen zurück, auf denen die Frau gekniet hatte, um ihren Gliedern noch größeren Schmerz zuzufügen. Dann verlosch das Licht.
Enttäuscht und befriedigt zugleich schlich Leberecht die Treppen hinauf zum Dachgeschoss. Er fror. Sophie schien seine Abwesenheit nicht bemerkt zu haben. Sie erwachte nicht einmal, als der Bruder zu ihr ins Bett stieg und sich zitternd an sie schmiegte. Sophie ließ es auch geschehen, als Leberecht mit den Händen ihren Leib abtastete. Das hatte er schon oft und in aller Unschuld getan, und seine Schwester hatte ihn gewähren lassen. Aber diesmal war alles anders.
Am nächsten Morgen war Leberecht bemüht, seiner Ziehmutter aus dem Wege zu gehen. Das Morgenmahl – Brotbrocken in Milch getaucht – wurde ohnehin nie gemeinsam eingenommen. Vielmehr suchte jeder eine Ecke zur ungestörten Nahrungsaufnahme.
Zur Winterszeit begann die Arbeit der Steinmetze erst spät am Morgen, zum einen wegen der Kälte, welche die Finger lähmte, zum anderen aber auch wegen des fehlenden Tageslichts. Leberecht machte einen leicht verstörten Eindruck, als er Carvacchi an jenem Morgen vor die Augen trat.
Der Dombaumeister war ihm ein zweiter Vater und Vorbild in vieler Hinsicht, und gewiss hätte dieser die flammende Unruhe im Gesicht seines Lehrjungen bemerkt und sich nach der Ursache erkundigt, wäre er nicht an diesem Tage selbst verwirrt gewesen wie der Apostel Thomas im Angesicht des Herrn.
Carvacchi stieß unverständliche Schimpflaute aus in einem Kauderwelsch aus Deutsch, Lateinisch und Italienisch. Das entsprach seiner Art und verhieß nichts Gutes. »Diese jämmerlichen Kreaturen, diese Pfaffenlecker, diese Kirchbankfurzer!«, geiferte er schließlich, umringt von einer Handvoll Lehrlingen und Gesellen, die sich ratlos ansahen, wem wohl das Donnerwetter gelte.
»Kommt mit!«, bellte Carvacchi und wies mit einer Kopfbewegung hinüber zum Dom.
Sie betraten den Dom über die Stufen der nördlich gelegenen Veitstüre. Carvacchi stampfte zornig voran und durchquerte das Kirchenschiff in Richtung der Adamspforte. Hinter dem vierten Pfeiler, der das Gewölbe trug, machte er halt. Auf dem Boden lagen Teile einer Statue verstreut.
Erschrocken blickte Leberecht nach oben: Der Sockel, der die Skulptur der »Zukunft« getragen hatte, war leer.
Wie aus weiter Ferne hörte Leberecht die Stimme des Predigers Athanasius Semler, der die »Zukunft« als sündhaft verurteilt hatte; er sah das schmale Gesicht der Statue und jenes von Martha, seiner Ziehmutter, die so viel mit dieser Statue gemein hatte, und durch seinen Kopf schoss der absurde Gedanke, dass dies die Strafe für seine nächtliche Sünde sei. Er hatte die »Zukunft« geliebt wie die Jungfrau Maria – soweit man eine Statue überhaupt lieben kann –; jedenfalls hatte Leberecht in der Anmut des aus Stein geschaffenen Körpers jene himmlische Schönheit entdeckt, welche fromme Menschen anbetungswürdig nennen.
Eines Tages war er Carvacchi aufgefallen, wie er in Gedanken versunken am Pfeiler emporblickte und die von unbekannter Menschenhand geformten Reize entzückt in sich aufsog. Seit jenem Tag behandelte der Meister Leberecht wie seinen Sohn, weil er wusste, dass der Junge ebenso fühlte wie er. Auf Carvacchis Frage, was er im Anblick der steinernen Statue empfinde, hatte Leberecht nur hilflos herumgestottert, bis der Meister selbst die Antwort gab: den Drang, diese Frau leibhaftig zu besitzen. Genau das hatte Leberecht angesichts des Kunstwerks gefühlt. Und Carvacchi hatte hinzugefügt, von nun an werde er nur noch nach dem Abbild der »Zukunft« unter den Frauen suchen, und er werde alle Frauen an dieser Statue messen, weil sie für ihn das Urbild des Weiblichen darstelle. Damals hatte er die Worte seines Lehrmeisters nicht richtig verstanden, aber seit der vergangenen Nacht war ihm klar, dass Carvacchi recht hatte.
»Was glaubt ihr wohl«, begann Carvacchi nach endlosem Schweigen vor den Trümmern am Boden, »wer ist der Tugendhaftere unter den Menschen – der, welcher die Statue geschaffen hat oder jener, der für ihren Sturz verantwortlich ist?«
Keiner von den Lehrlingen und Gesellen wagte den Meister anzusehen oder gar zu erwidern. Denn jeder wusste, dass Carvacchi seine Fragen immer selbst beantwortete, ja, es hätte ihn irritiert, wenn ein anderer diese Aufgabe übernommen hätte. Und so begann er weit ausholend:
»Der Name dessen, der die ›Zukunft‹ geschaffen hat, ist uns nicht bekannt, da das Werk in einer Zeit entstand, in der jede Art von künstlerischem Schaffen nur zur höheren Ehre Gottes geschah. Ein Künstler war nur ein Sandkorn auf dem weiten Feld der Frömmigkeit. Aber jener Mann, unter dessen Händen die ›Zukunft‹ entstand, formte das Kunstwerk mit der Reinheit seiner Gedanken. Er bejahte das Leben und schuf eine Allegorie auf das Kommende in Gestalt einer schönen, in die Ferne weisenden Frau, einer Göttin, wie sie Phidias nicht anmutiger hätte schaffen können im Anblick seiner Geliebten Phryne. Dreihundert Jahre schmückte die Statue diesen Dom; dann kam dieser Menschen verachtende Prediger Athanasius Semler, der für sich in Anspruch nimmt, fromm und rechtschaffener zu sein als unser Herr Jesus und reiner als die Jungfrau Maria. Dabei hat er einen so verdorbenen Charakter, dass er sogar im Anblick einer Statue aus Stein auf schlechte Gedanken kommt. Einer wie er, der seine Leidenschaft nie stillen durfte, trägt nur Sünden im Kopf. Sogar am Sandstein reibt sich seine Fantasie. Sein Geist ist vom Teufel umnachtet. Er fühlt sich als Großinquisitor und das ist sein Werk! Pfui Teufel!«
Teufel, Teufel! hallte es durch den leeren Dom, und es schien, als verstärkte die Kälte das mehrfache Echo. Carvacchi hielt noch einen Augenblick inne, dann ging er in der Richtung davon, aus der sie gekommen waren.
Wortlos begannen die Steinmetze, die Steinbrocken in ihre Lederschürzen aufzusammeln. Leberecht griff nach der rechten Hand, die in die Ferne gewiesen hatte. Das Bruchstück reichte von der Handwurzel bis zum gestreckten Zeigefinger und war unversehrt geblieben. Handrücken und Zeigefinger bildeten eine gerade Linie, während der Daumen auf der Innenseite des angewinkelten Mittelfingers zu liegen kam. Es war die Hand eines vornehmen Fräuleins; jedenfalls stellte er sich so die Hand einer Dame vor.
Bei dem Sturz aus großer Höhe war die »Zukunft« in viele kleine Teile zersprungen. An eine Restaurierung war nicht zu denken. Einen Tag und eine Nacht lagerten die Steinbrocken vor der Holzhütte, in der Carvacchi seiner Arbeit nachging. Dann beauftragte der Meister Leberecht, neben der Hütte ein Loch zu graben, soweit es der gefrorene Boden erlaubte, und die Bruchstücke darin zu versenken.
Leberecht kam dem Auftrag nach, obwohl er ihm ziemlich seltsam vorkam, aber er hätte nie gewagt, Carvacchi zu widersprechen. Vor allem hatte er so die Möglichkeit, die faszinierende Hand der »Zukunft« für sich zu behalten, und niemand bemerkte es.
Seit jener Nacht, als Leberecht seine Ziehmutter heimlich beobachtet hatte, verlangte irgendetwas in ihm nach noch mehr von dieser sündigen Nacktheit. Der Drang, Martha bei ihren Kasteiungen zuzusehen, trieb ihn jede Nacht um dieselbe Stunde aus dem Bett. Er musste fürchten, von Sophie oder irgendjemand anderem bei seinen nächtlichen Streifzügen entdeckt zu werden, doch der unheimliche Trieb war stärker. Für zufällige Begegnungen im Treppenhaus hatte Leberecht sich allerlei fadenscheinige Erklärungen zurechtgelegt, die von Verrichtung der Notdurft reichten – was unwahrscheinlich genug war angesichts eines Nachtgeschirrs, das in jeder Kammer bereitstand – bis zum quälenden Durst – was kaum glaubhafter erscheinen durfte, da es in jeder Kammer eine Kanne Wasser gab.
Die zweite Nacht endete für Leberecht insofern enttäuschend, als er zwar das Fenster zum Treppenhaus erleuchtet fand, doch diesmal ließ der grobe Vorhang nicht den kleinsten Spalt frei, durch den seine lüsternen Augen hätten spähen können. Was blieb ihm also anderes übrig, als das vereitelte Abenteuer der Augen seinen Ohren zu überlassen und zu lauschen, wie Martha sich dem frommen Schmerz hingab.
Schon beim ersten Mal hatte Leberecht sich gefragt, welchen Grund Martha für ihre Torturen haben könnte. Sie galt als fromm und edelmütig, kümmerte sich um die Armen, und die Großmut ihres Gemahls gegenüber den Klöstern der Stadt sei – so erzählten die Leute – weniger ein Akt der Frömmigkeit Jakob Heinrich Schlüssels als seiner Frau Martha.
Hatte er zuerst noch den Verdacht gehegt, Martha könnte die Geißel aus purer Lust gebrauchen – die Gesellen der Dombauhütte redeten manchmal von derlei unverständlichen Praktiken –, so musste Leberecht dieses Mal alle derartigen Gedanken verdrängen. Das Wehklagen, das durch das Fenster drang, war ohne Frage Ausdruck von Schmerz. Vor allem versäumte es Martha nicht, zwischen den einzelnen Peitschenschlägen inbrünstige Gebete zu flüstern, deren Wortlaut er jedoch nicht verstand, von einem einzigen Mal abgesehen, als ihre Stimme eindringlicher als je zuvor den Satz sprach: »Jesu Domine nostrum. Erlöse mich vom Laster des Fleisches …«