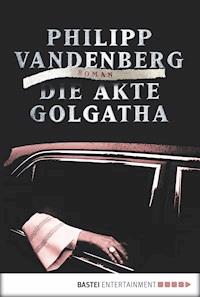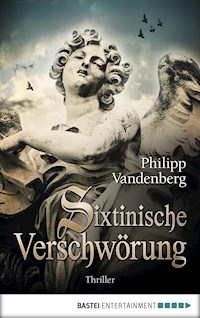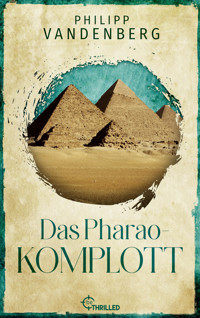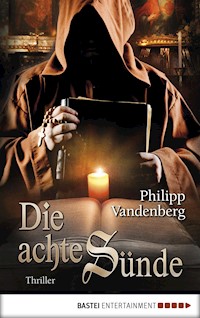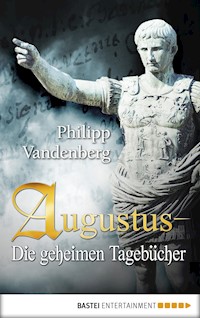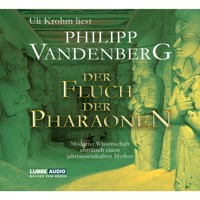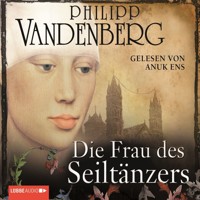4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es ist die aufregendste und zugleich die undankbarste Rolle, die eine Frau spielen kann: Die Rolle der Geliebten.Warum das so ist und schon immer so war, erzählt Philipp Vandenberg in seiner lehrreichen, vergnüglichen und kuriosen Zusammenschau über das Schicksal der Geliebten in der Geschichte. Vom Kampf der Rivalinnen Charlotte von Stein und Christiane Vulpius um Johann Wolfgang von Goethe, über die lasterhaften Frauen Napoleons III., bis hin zu Katharina Schratt, die Frühstücksfrau des Kaisers Franz Josef I. - begleiten Sie Philipp Vandenberg auf eine Reise in die Welt, in der Macht das mächtigste Aphrodisiakum ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
PHILIPPVANDENBERG
DIE FRÜHSTÜCKSFRAUDES KAISERS
Vom Schicksal derGeliebten
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
© 2007/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Daniela Bentele-Hendricks
Umschlaggestaltung: Gisela Kullowatz
Titelbild: © Interfoto – Archiv
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-5773-5
Sie finden uns im Internet unter
www.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Inhalt
Die Rolle der Geliebten in der Geschichte
I Die tödliche Liebe der Mary Vetsera
II Wilhelmine von Lichtenau und ihre Geister
III Rivalinnen: Charlotte von Stein und Christiane Vulpius
IV Teresa und der Vater von Maigret
V Lola Montez: Der König und die Tänzerin
VI Konstanze von Cosel, die vergessene Geliebte
VII Das Geheimnis der Marquise de Pompadour
VIII Jeanne Du Barry – ein grausames Mätressenschicksal
IX Die lasterhaften Frauen Napoleons III.
X Katharina Schratt, die Frühstücksfrau des Kaisers
Literaturhinweise
Über den Autor
Die Rolle der Geliebten in der Geschichte
Premiere im Pariser Théâtre Français am 28. November 1802. Das Publikum tobte vor Begeisterung, der Applaus wollte nicht enden. Vor allem galt der Jubel der graziösen Mademoiselle George, der Darstellerin der Klytämnestra in dem Stück Iphigenie in Aulis. Blumen wurden auf die Bühne geworfen, und die schöne Schauspielerin in dem lang wallenden, durchsichtig schimmernden Gewand musste sich ein um das andere Mal verneigen. Sie war gerade sechzehn. In der Königsloge winkte der kleine, wie stets in grünen Samt gekleidete Herr seinen Diener Constant herbei, flüsterte ihm etwas ins Ohr; der Diener verschwand, noch ehe der Beifall geendet hatte.
Am nächsten Morgen stand eine grüne Equipage vor der Wohnung der gefeierten Schauspielerin. Mademoiselle George stieg ein. Sie trug ein rosafarbenes Kleid mit tiefem Dekolleté, einen Schal und einen Schleier. Dann ging die Fahrt durch die Stadt in Richtung Saint Cloud. Vor dem Schloss wurde die Sechzehnjährige schon erwartet. Ein Kammerdiener führte sie durch die Orangerie, dann durch eine leere Zimmerflucht mit Kandelabern und brennenden Kerzen. Es sah aus, als wäre alles zu einem festlichen Ball vorbereitet. In einem großen Boudoir, dessen Fenster den Blick freigaben auf Terrasse und Park, und das von einem großen Bett und einem noch größeren Diwan beherrscht wurde, bat der Kammerdiener die aufgeregte Besucherin um einen Augenblick Geduld. Aber noch bevor Mademoiselle George Gelegenheit hatte, sich in dem märchenhaften Zimmer umzusehen, ging neben dem Kamin eine Tür auf, und er stand vor ihr: Napoleon Bonaparte, Erster Konsul der Franzosen, wie er sich damals nannte, auffallend klein und in grüner Uniform mit rotem Kragen und roten Ärmelaufschlägen; über seine Stirn hing eine verwegene Haarlocke.
»Madame«, sagte Napoleon zu dem hochgewachsenen, schlanken Mädchen, »ich möchte Sie beglückwünschen, Sie waren wunderbar!« Und als er sah, wie sehr sein Kompliment die Schauspielerin in Verlegenheit brachte, fügte er hinzu: »Wie Sie vielleicht bemerken, bin ich netter und höflicher, als Sie es sind.«
»Aber wieso?«, stammelte Mademoiselle George verwirrt.
»Hatte ich Sie nicht schon einmal beklatscht? Hatte ich Ihnen nicht nach der Vorstellung 3000 Franc zukommen lassen? Haben Sie sich jemals dafür bedankt?«
»Aber ich wusste nicht … ich dachte … ich fürchtete …«
»Sie hatten Angst?«
»Ja, Monsieur.«
»Vor mir?«
»Ja, Monsieur.«
Napoleon lachte, er lachte laut und herzlich, und da lachte auch das Mädchen. Sie lachten und lachten, bis sie sich schließlich in den Armen lagen. Mademoiselle George blieb den ganzen Tag und die ganze Nacht. Das Einzige, das sie dabei anbehielt, waren ihre Strümpfe.
Am nächsten Morgen erst bewunderte Napoleon ihre Garderobe, die über dem Stuhl hing. »Von meinem Geld?«, erkundigte er sich selbstsicher und in der Überzeugung, sie habe sich mit seiner Zuwendung neu eingekleidet.
Die Schauspielerin schüttelte den Kopf.
»Ein anderer Mann, Madame?«
Mademoiselle George nickte. »Fürst Sapieha aus Polen. Von ihm sind Schal und Schleier.«
Da nahm Napoleon die Kleidungsstücke und zerriss sie in tausend Fetzen. Als er sich beruhigt hatte, sagte der Erste Konsul ernst: »Sie sind ehrlich, Madame, das gefällt mir. Aber Sie dürfen nie mehr etwas tragen, was nicht von mir stammt.« Dann schickte er seinen Kammerdiener Constant zum Ankleidezimmer seiner Frau Josephine und ließ neue Garderobe holen.
Josephine Bonaparte, verwitwete Marquise de Beauharnais, Tochter eines Hafenkapitäns von der Insel Martinique und seit sechs Jahren mit General Napoleon verheiratet, musste nicht nur ihre Kleider teilen, sie teilte fortan auch den Ehemann – bis Januar 1805. So lange war Mademoiselle George die Zweitfrau Napoleon Bonapartes, geliebt, beneidet, vor allem aber gut bezahlt. Es geschah häufig, dass Napoleon seiner Geliebten größere Geldsummen zusteckte. Den 2. November 1803 behielt Mademoiselle George in besonderer Erinnerung: »An diesem Abend schob mir der Konsul ein dickes Bündel Banknoten in den Ausschnitt. Es waren 40 000 Franc.«
Es wäre falsch, Mademoiselle George in die Kategorie der Prostituierten einzureihen. Das war sie nicht, weder vor noch nach Napoleon, sie war eher flatterhaft wie die Midinetten vom Montmartre, eine leichtlebige Schauspielerin, deren Berufszweig bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts in dem Ruf stand, für die Eugerasie – die »Altenpflege« des Adels – zuständig zu sein.
Nicht zufällig gehörten die meisten Zweitfrauen der Geschichte diesem Berufszweig an, und die zahlreichen Hoftheater, die selbst an kleineren Residenzen wie Weimar, Bayreuth oder Ansbach aus dem herzoglichen oder markgräflichen Boden gestampft wurden, werfen die Frage auf, ob hinter der Gründung solcher Liliputbühnen wirklich Thalia und Melpomene oder nicht vielmehr Venus und Aphrodite standen, ob sich nicht die Liebe zur Kunst der Leidenschaft finanzkräftiger Potentaten unterordnen musste.
So gesehen verdankt die Menschheit den priapeischen Gelüsten vieler Herrscher architektonische Kostbarkeiten von Rang, aber auch eine bittere Erkenntnis: Ein Herrscher, der Herz und Genitalien in die Geschichte einbringt, läuft immer Gefahr, sich lächerlich zu machen. Das ist zwar ungerecht, weil diese Organe zweifellos zum Angenehmsten gehören, das menschliche Regungen hervorruft, und sogar bei Menschen wie du und ich nicht selten zu Problemen führen; doch wer auf dem Sockel der Geschichte steht, muss es sich nun einmal gefallen lassen, mit anderen Maßstäben gemessen zu werden.
Gewiss, es gibt Männer, die leben dreißig Jahre mit einer Zweitfrau, was – sagen wir es frei heraus – den Tatbestand der Misogynie erfüllt; aber wer würde glauben, dass sich hinter diesem Verhalten Seine Apostolische Majestät Kaiser Franz Joseph von Österreich-Ungarn verbirgt, der Heiligkeit und Tugend im Namen führte, ohne ehrlich davon Gebrauch zu machen. Er investierte in seine Zweitfrau, die Hofschauspielerin Katharina Schratt, umgerechnet gut 25 Millionen Euro, und das nur, weil er die resolute Dame auf andere Art und Weise liebte als seine Ehefrau, die Kaiserin Sisi. Ja, die eigenwillige Ehefrau war es sogar, die dem Kaiser die Schauspielerin zuführte, um ihren Einsamkeitskult und ihre Egozentrik besser leben zu können, ein Psychodrama auf höchster Ebene.
Schauspielerinnen waren es auch, die den englischen König Edward VII., einen Bonvivant mit Hang zu aufregenden Frauen und französischer Lebensart, um den Verstand brachten. Obwohl alles andere als ein schöner Mann, klein, dick und beinahe glatzköpfig, hatte Edward keine Schwierigkeit zu finden, was er suchte. Macht ist ein mächtiges Aphrodisiakum, es stimuliert Frauen wie Männer, selbst in England, wo null beim Tennis dieselbe Bezeichnung wie Liebe hat. Einer von Edwards Biographen brachte dessen Liebesleben auf einen einfachen Nenner: Edward zog ständig einen Schweif von verbotenem Samt und Atlas hinter sich her. Nachdem er sich einmal auf die Untreue eingelassen hatte, wurde der Prince of Wales von dieser überwältigt.
Nein, Edward VII. war nicht zu beneiden, denn bis es so weit war, bis er diesen Namen überhaupt tragen durfte, vergingen sechzig Jahre seines Lebens, und in einem Alter, in dem andere daran denken, sich aus den Regierungsgeschäften zurückzuziehen, konnte er damit erst beginnen. So lange blieb er der berufsmäßige Sohn Queen Viktorias, einer Witwe, die mit ihrem Puritanismus einem ganzen Zeitalter den Namen gab und damit den Jungen zum Hedonismus drängte. Es ist dies der gleiche Effekt, der Klosterschüler zu gottlosen Kommunisten und Seminaristen zu glühenden Antiklerikalen macht.
Obwohl seit 1863 glücklich verheiratet mit der attraktiven Alexandra von Dänemark, begann der Prince of Wales schon bald, seine Langeweile mit außerehelichen Affären zu kultivieren. Die Wohnsitze des Kronprinzenpaares, Marlborough House in London und Sandringham Hall in Norfolk, wurden zu Mittelpunkten des gesellschaftlichen Lebens in England und zur Anlaufstelle ehrgeiziger Mütter, die dem gierigen Prince of Wales ihre schönen Töchter – bei Bedarf auch sich selbst – ins Bett zu legen trachteten.
Zwei Damen der Gesellschaft spielten die Rolle der Zweitfrau des Prince of Wales und späteren Königs mit Bravour, und sie teilten sich dabei die drei letzten Jahrzehnte im Leben Edwards: Lily Langtry und Alice Keppel. Zwar lebte Edward in ständiger Geldnot, aber das hinderte ihn nicht, in die beiden Zweitfrauen ein Vermögen zu investieren, in Lily, die Schauspielerin, mehr als in Alice. Es kann aber auch sein, dass Lily mit der Freigebigkeit ihres Geliebten nur weniger diskret umging als ihre Nachfolgerin. Von Miss Langtry wissen wir jedenfalls, dass Edward ihr haufenweise Diamanten und den größten Rubin der Welt schenkte. Sie lag ihm dafür die achtziger und frühen neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts zur Seite, soweit das ihre Schauspielerkarriere zuließ.
Alice Keppel übernahm Lily Langtrys Part mit neunundzwanzig, da war Edward schon siebenundfünfzig Jahre alt und ein wohlgesetzter älterer Herr, seine Frau Alexandra hatte sechs Kinder zur Welt gebracht, und Queen Viktoria regierte noch immer. Die südländische Erscheinung Alices und ihre dralle Kleinheit nahmen den Prince of Wales sogleich gefangen. Anders als die vorlaute Schauspielerin verlor Mrs Keppel nie ein Wort über ihr ungewöhnliches Verhältnis, sodass es lange Zeit unentdeckt und auch später tabu blieb. Edward VII. liebte Alice mit der gleichen Hingabe wie seine Frau Alexandra. Die jedoch, schwerhörig und vom Schicksal mit einem steifen Knie geschlagen, was beides in Salons und Ballsälen hinderlich war, sah mit seltener Großzügigkeit über die Eskapaden ihres Mannes hinweg, solange sie nicht öffentlich wurden.
Als »Baron Renfrew« reiste Edward VII. unzählige Male übers Wochenende nach Paris, wo er im Hôtel Bristol abzusteigen pflegte, während Alice nachkam und im nahen Hôtel Vendôme logierte. Die Schlafwagenschaffner und Bahnhofsvorsteher auf beiden Seiten des Kanals waren instruiert und besorgten diskret die anfallenden Pass- und Zollformalitäten. Es war ein ungeschriebenes Gesetz – das auch nie gebrochen wurde, dass das königliche Dreiecksverhältnis nicht in den Klatschspalten der Boulevardpresse und schon gar nicht in seriösen Publikationen erwähnt werden durfte.
Nach der Thronbesteigung Edwards VII. erwarteten viele Ladys und Lords, die schon lange wegen der Geliebten die Nase gerümpft hatten, das Ende der Liaison. Aber es zeigte sich bald, dass die für ihre Diskretion bekannte Mrs Keppel nicht nur dem König, sondern sogar seinen Beratern eine Stütze war. Freilich brachte das Dreiecksverhältnis Seiner Majestät auch Probleme. Der königliche Etat sorgte zwar für eine Ehefrau, aber für eine zweite war kein Budgetposten vorgesehen, und Edwards Privatschatulle war so gut wie leer.
In Anbetracht seiner großen Tat für König und Vaterland ließ sich Alices Mann, der Hon. George Keppel, der bisher von den Latifundien seines Vaters gelebt hatte, herbei, in die Niederungen eines Londoner Geschäftsmannes einzutauchen. Womit er handelte, wusste niemand, aber Alice trug immer die vornehmste Garderobe, nahm sich Lady Sarah Wilson als Hofdame, und George, der Gehörnte, durfte ab und zu bei Königs in Schloss Sandringham dinieren. Bisweilen schlug das Protokoll Purzelbäume, wenn König Edward mit zwei Frauen an Staatsbanketten teilnahm. Alice entledigte sich jedoch aller Verpflichtungen mit Bravour. Sie verstand es sogar, den deutschen Kaiser Wilhelm II., dem sie bei seinem England-Besuch im November 1902 als Tischdame beigegeben war, für sich einzunehmen.
Als Edward VII. nach nicht einmal zehnjähriger Regierung starb, wurde Sir Ernest Cassel, der deutschstämmige Bankier und Finanzberater des Königs, bei Mrs Keppel in ihrem Haus am Londoner Portman Square vorstellig und eröffnete ihr, Seine Majestät habe für sie großzügige finanzielle Verfügungen getroffen. Alice scheint das wohl nicht so recht geglaubt zu haben. Sie zog einen Monat später aus, »um Ruhe zu haben«, wie sie sagte, und »um den Gläubigern zu entgehen«.
Die Gesetze der Wahrscheinlichkeit, welche für die Mathematik und eine legale Ehe gelten, haben für Zweitfrauen keine Gültigkeit. Nur wenigen wie der Marquise de Pompadour (mit Ludwig XV.) oder der Hofschauspielerin Katharina Schratt (mit Kaiser Franz Joseph) gelang der große Wurf. Die meisten Zweitfrauen der Geschichte fielen tief, sehr tief. (Vom Kopf der Jeanne Du Barry, der im Korb des Henkers landete, wollen wir gar nicht reden). In jungen Jahren an der Seite eines bedeutenden Mannes mit Macht und Reichtum ausgestattet, standen sie oft nur kurze Zeit im Rampenlicht. Verglühte aber die Leidenschaft des Mannes, so drängte sie ihre Verzweiflung oft genug in den Wahnsinn, ihr Gefühl in bitterste Armut.
Contessa Virginia di Castiglione galt zu ihrer Zeit als schönste Frau Europas, der Marquis de Herfort soll ihr für eine einzige Liebesnacht eine Million Franc geboten haben, und sie war die Geliebte Napoleons III., eine der Geliebten, die sich der Neffe des großen Bonaparte leistete. Virginia konnte nicht fassen, dass Napoleon ihr den Laufpass gab; sie wurde damit nicht fertig, ihre Sinne spielten verrückt, und sie glaubte auf einmal, hässlich zu sein wie ein Monster; sie zerschlug alle Spiegel und lebte nur noch in Dunkelheit hinter geschlossenen Fensterläden. Ihr letzter Wunsch: Sie wollte in einem Nachthemd begraben werden, das sie beim kaiserlichen Beischlaf im Schloss Compiègne getragen hatte.
Neunundvierzig Jahre lebte Anna Konstanze Gräfin von Cosel auf der einsamen Festung Stolpen. Wahrscheinlich wusste sie in ihren späten Jahren selbst nicht mehr, warum sie seit beinahe einem halben Jahrhundert in einem heruntergekommenen Turmzimmer hauste, das sie schon mehrere Male bei dem Versuch zu heizen angezündet hatte. Wände und Decke waren rußgeschwärzt, es stank bestialisch, aber niemand kümmerte sich darum. Einmal eroberten Preußen die Festung, dann wieder Österreicher, doch das Gemäuer erschien niemandem besitzenswert – wer die verrückte Alte war, interessierte ohnehin nicht. Die älteren Leute aus der Umgebung kannten die Cosel zwar noch, aber sie durften nicht darüber reden. Die Älteren starben, und die Jüngeren verloren sie aus dem Gedächtnis. Auch der, dem sie dieses Leben zu verdanken hatte, Kurfürst Friedrich August von Sachsen, starb, und nun geriet sie in völlige Vergessenheit.
Dabei war sie einmal eine ebenso schöne wie mächtige Frau, die Zweitfrau August des Starken, dem dreihundertfünfundsechzig Kinder nachgesagt werden, so viel wie das Jahr Tage hat. Im Jahre 1699 hatte sie sich vom sächsischen Kabinettsminister Adolf Magnus von Hoym scheiden lassen, um mit ganzer Hingabe die Geliebte des sächsischen Potenzprotzes zu werden, und dreizehn Jahre hatte sie dieses »Amt« auch inne, legitimiert durch eine Art Ehevertrag, der ihr Exklusivitätsrechte an Seiner Majestät und eine Jahresapanage von 100 000 Talern zusicherte. Am Ende blieb ihr weder das eine noch das andere. Zweitfrauen haben keine Rechte.
Die Geschichtsschreibung hat sich nie mit dem Leben von Zweitfrauen beschäftigt (Lola Montez und die Marquise de Pompadour sind die große Ausnahme, weil sie selbst Geschichte gemacht haben). Der Grund: Zweitfrauen schlugen keine Schlachten und unterzeichneten keine Verträge. Dass ihre Bedeutung in vielen Fällen jedoch weit über ein Liebesverhältnis hinausgeht, wird in diesem Buch deutlich. Es zeigt die Hauptpersonen der Geschichte, von denen manche einem Zeitalter oder einer Epoche den Namen gaben, einmal als Nebenfiguren und aus einer höchst ungewöhnlichen Perspektive, nämlich aus der Perspektive der Zweitfrau.
Sigmund Freud, der mit einem wahren furor biographicus an die Analyse großer Charaktere heranging (und dabei nicht einmal vor dem biblischen Moses zurückschreckte), forderte für die Therapie der Gegenwart und wissenschaftliche Bearbeitung der Vergangenheit äußerste Indiskretion. Freud bedauerte: »Für gewöhnlich erfahren wir ja, dank ihrer eigenen Diskretion und der Verlogenheit ihrer Biographen, von unseren vorbildlichen großen Männern wenig Intimes.« Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard, Meister in der Kunst der Lebensanalyse, kleidete das gesamte Problem in vier Worte: »Ohne Sexualität keine Geschichte.«
Die Aura des Schweigens, die Zweitfrauen zu Lebzeiten und in den meisten Fällen auch später umgab, hatte für die Damen oft wenig erfreuliche Folgen. Viele gerieten vollkommen in Vergessenheit, weil sie es verabsäumten, gewinnbringend ihre Memoiren zu schreiben oder kompromittierende Briefe aufzubewahren. Dazu gehörten Maria Mancini, die ungekrönte Geliebte Ludwigs XIV., ebenso wie die Schwestern Louise, Pauline und Marie-Anne de Nesle, die, als Vorgängerinnen der Pompadour, Ludwig XV. die Regierungszeit vertrieben, oder Cora Pearl, die sich als Zweitfrau Edwards VII. versuchte, oder Cléo de Mérode, die Mätresse des Belgierkönigs Leopold II., eine Tänzerin, die bisweilen ihre Arbeitskleidung vergaß, oder Mlle. Gaby Deslys, die sich am portugiesischen König Emanuel II. versuchte.
Kein Mensch würde heute von Diane de Poitiers reden, der um achtzehn Jahre jüngeren Zweitfrau Heinrichs II. von Frankreich, hätte sie nicht die Maler ihrer Zeit in Verzückung versetzt. Die in jungen Jahren verwitwete Frau Groß-Seneschall der Normandie pflegte gewagte Kleider mit freien Brüsten zu tragen – darüber hinaus führte sie eine rege Korrespondenz mit ihrem Geliebten, die mindestens ebenso tief blicken ließ. Lola Montez, als Zweitfrau des Bayernkönigs Ludwig I. viel bekannter als dessen Ehefrau Therese, obwohl sie als dessen Geliebte nur zwei Jahre ihr Leben mit dem König teilte, wurde vor allem durch Zeitungsberichte und die spätere Herausgabe ihrer Memoiren bekannt.
Die stets schwarz gekleidete Lola, die statt einer Handtasche lieber eine symbolträchtige Reitpeitsche trug, verstand es, sich mit äußerster Raffinesse der damaligen Medien zu bedienen. Dazu gehörten Interviews, Vorträge und Leserbriefe ebenso wie ein eigenes Pressearchiv, das sie stets, auf mehrere Koffer verteilt, bei ihren Reisen begleitete. Ihre mehr als zweitausend Buchseiten umfassenden Memoiren sind das Werk eines oder mehrerer Ghostwriter. Sie erschienen 1851 und brachten ihr immerhin so viel Geld, dass sie damit ein neues Leben beginnen konnte.
Beinahe noch populärer als ihre autorisierten Memoiren, von denen nur ein Fünftel des Inhaltes einer objektiven Nachprüfung standhält, machten Lola Montez gefälschte Lebenserinnerungen von skandalträchtigem Inhalt. Ein Lohnschreiber namens August Papon, der bei der verstoßenen Zweitfrau für kurze Zeit die Stelle eines Sekretärs bekleidete und Einsicht in ihre Korrespondenz nehmen konnte, bot das Machwerk seiner ehemaligen Arbeitgeberin sogar zum Kauf an. Lola Montez besaß jedoch genug Selbstbewusstsein und ließ den miesen Erpresser gewähren.
Ähnlich erging es Wilhelmine Enke, geadelte Gräfin von Lichtenau, der Zweitfrau König Friedrich Wilhelms II. von Preußen. Kaum begann ihr Stern zu sinken, kaum hatte der Preußenkönig die Augen für immer geschlossen, da tauchten in Berlin und Potsdam gefälschte Memoiren und Schmähschriften auf, die ihren Herausgebern aus den Händen gerissen wurden: Geheime Papiere der Gräfin Lichtenau, Bekenntnisse der Gräfin Lichtenau, ehemalige Madame Rietz, Biographische Skizze der Madame Rietz, jetzige Gräfin Lichtenau, Versuch einer Biographie der Gräfin von Lichtenau, einer berühmten Dame des vorigen Jahrhunderts.
Aus der Feder Wilhelmines stammte keines dieser Werke. Sie selbst sah sich zehn Jahre später genötigt, eine Apologie der Gräfin Lichtenau herauszugeben, eine Verteidigungsschrift, eine Rechtfertigung. Aber zu dieser Zeit war Wilhelmine Enke, geadelte Gräfin Lichtenau, schon vergessen, und kaum jemand interessierte sich für die Wahrheit, wie es wirklich war, das Verhältnis zwischen ihr und dem Preußenkönig.
Was Kaiser Franz Joseph von Österreich-Ungarn drei Jahrzehnte für sich in Anspruch nahm, wollte er seinem designierten Nachfolger Kronprinz Rudolf in keiner Weise zugestehen: eine Zweitfrau. Nun waren Konkubinen im Hause Habsburg zwar schon immer eine Institution, aber eine Institution im Geheimen, ein Geheim-Dienst sozusagen, von dem die Ehefrauen durchaus Kenntnis hatten, aber nicht das Volk. Das eineinhalb Millionen Euro teure Konkubinat des verheirateten Kronprinzen mit der »Soubrette« Mizzi Caspar – so nannte man Ende des 19. Jahrhunderts in Wien eine Prostituierte der höheren Kreise – konnte der Märchenkaiser durchaus akzeptieren, erforderte es doch nur einen Bruchteil seiner eigenen extramatrimonialen Aktivitäten. Aber dass Rudolf eines Tages tot im Lotterbett mit einer ebenfalls toten siebzehnjährigen Baroness gefunden wurde, die er, bevor er Selbstmord beging, erschossen hatte, das war dem schockierten Kaiser zu viel. Er wies seine Geheimpolizei an, den Fall zu vertuschen. Zeugen, die die wahren Hintergründe der Tragödie von Mayerling kannten, wie Marie Gräfin Larisch oder die Mutter der beklagenswerten Baroness Vetsera, wurden geächtet und verbannt.
Da fragt man sich, was reizt eine Frau, den zweifelhaften Rang einer Zweitfrau einzunehmen? Für die abenteuerlustige, kindhafte Mary Vetsera mögen ihre siebzehn Lebensjahre und Rudolfs Stellung als Kronprinz Erklärung genug sein. Die meisten Geliebten gehen mit dem Ruf oder der Brieftasche des Angebeteten ins Bett. Tragisch wird es, wenn wahre Liebe im Spiel ist. Jede Geliebte hofft, einmal die Nummer eins zu werden, und dieser Hoffnung opfert sie alle Gefühle. Doch diese Hoffnung ist trügerisch. Männer vergessen schnell, selbst wenn sie der Geliebten das Eheversprechen mit dem eigenen Blut geschrieben haben wie Heinrich IV. von Frankreich. Es gibt nur wenige Beispiele dafür, dass die Geliebte zur Ehefrau wurde.
Manche Frauen würden es empört von sich weisen, je den Part einer Zweitfrau zu übernehmen, auf andere übt diese Rolle eine faszinierende Wirkung aus. Mit Treue oder Untreue hat das wenig zu tun – nicht vonseiten der Frau. Lola Montez, eine Frau, die es wissen muss, erklärte sich so: »Meine Natur gestattete es mir nicht, ein Weib der Gewohnheit, ein sozusagen traditionelles Weib zu sein, ein Weib, welches sein höchstes Glück darin sieht, dem Mann eine gute Brühe und ein freundliches Gesicht zu machen.« Lola Montez war drei Mal verheiratet. Wohlgefühlt hat sie sich nur in ihrer Rolle als Zweitfrau Ludwigs I.
Was den Begriff Treue betrifft, also das Festhalten an einem Partner, so hat sich die Auffassung darüber seit Adam und Eva mehrfach gewandelt. Seltsamerweise wird heute Untreue als viel verwerflicher angesehen als in früheren Zeiten, seltsam deshalb, weil viele glauben, unsere Gegenwart sei die moralisch verkommenste Zeit, die es je gab. Davon kann keine Rede sein. Karl der Große, der allzu gerne in den Zustand der Heiligkeit gerückt wird, war vier Mal verheiratet: mit der Langobardin Desiderata (die der »Heilige« in die Wüste schickte), mit der Alemannin Hildegard (die ihm vier Söhne und fünf Töchter gebar), mit der Fränkin Fastrada (von der er zwei Töchter bekam) und mit der Alemannin Liutgard (die seine Kaiserkrönung nicht mehr erlebte). Daneben zog Karl immer einen Pulk Zweitfrauen hinter sich her, mit denen er in sogenannter Friedelehe lebte, einer Ehe mit einer freien Frau, die er ohne Verpflichtungen lösen konnte, wann immer es ihm beliebte. Und es beliebte häufig.
Im Mittelalter, ja bis ins 19. Jahrhundert hatten Ehe und Treue einen anderen Stellenwert als heute, vor allem wenn sich die Partner in erlauchten Kreisen bewegten, also von Adel waren. Ein König heiratete aus Gründen der Staatsräson eine Frau, die er meist noch nie gesehen hatte. Der Name genügte oder die Mitgift oder Macht- und Gebietsansprüche, die sich aus der Verbindung ergaben. Eine Zweitfrau, welche die erotischen, manchmal auch geistigen Bedürfnisse des Ehegatten befriedigte, war von vornherein eingeplant, provozierte also keinen Skandal – wie das heute der Fall ist.
Eine französische Autorin, die alle Herrscher Frankreichs unter die Lupe genommen hat, kam zu dem verblüffenden Ergebnis, dass nur zwei von ihnen aus Liebe geheiratet haben. Aber alle hatten eine oder mehrere Zweitfrauen: Franz I. schenkte seine Gunst Françoise de Châteaubriand und der Herzogin von Étampes. Heinrich II. war Diane de Poitiers verfallen. Heinrich IV. liebte Gabrielle d’Estrées, Henriette d’Entragues und Charlotte de Montmorency. Ludwig XIV. brachte es auf vier Zweitfrauen: Maria Mancini, Louise de La Vallière, die Marquise de Montespan und die Marquise de Maintenon. Ludwig XV. war den Schwestern Louise, Pauline und Marie-Anne de Nesle verfallen, außerdem der Marquise de Pompadour und Madame Du Barry. Napoleon I. verfügte über Mademoiselle George und die Gräfin Marie Walewska, Napoleon III. über Harriet Howard, Marguerite Bellanger und Virginia di Castiglione. Nebenbei waren alle verheiratet.
Zweitfrauen begegnen wir nicht erst in der neueren Geschichte, in dieser Epoche hat ihnen das Christentum nur einen pikanteren Status verliehen. Von Zweitfrauen ist schon im Alten Testament die Rede und im Zusammenhang mit so honorigen Männern wie Abraham oder König David, und eigentlich ist dort auch schon die gesamte Problematik der Zweitfrau erklärt. Abrahams Zweitfrau Hagar verrichtete ihren Dienst mit Billigung von Ehefrau Sarah – bis Hagar ein Kind zur Welt brachte und Sarah von oben herab behandelte. So endete das Dreiecksverhältnis. Der biblische David war ein rechter Weiberheld mit mehreren Ehefrauen und einer Reihe Zweitfrauen, von denen Bathseba wohl die bekannteste ist, eine verheiratete Frau. Damit er ganz allein über sie verfügen konnte, stellte David ihren Ehemann Uria in die vorderste Schlachtreihe. Uria fiel, und Bathseba gebar einen Sohn, den berühmten Salomo. »Doch dem Herrn missfiel, was David getan hatte« (2. Kg, 11,27).
Im alten Griechenland hatten Zweitfrauen einen besonderen Namen, vorausgesetzt, sie bewegten sich in besseren Kreisen. Diese Zweitfrauen hießen Hetären, was so viel wie Lebensgefährtin bedeutet, und sie standen – im Gegensatz zu heute – in hohem öffentlichen Ansehen. Viele waren hochgebildet und dienten einflussreichen verheirateten Männern sowohl als Bettgespielin wie als politische Beraterin. Die zwei bekanntesten Hetären sind Phryne und Aspasia.
Phryne gelang es, Praxiteles, dem bedeutendsten Bildhauergenie aller Zeiten, den Kopf zu verdrehen, als sie ihm Modell saß. Phryne, die nie Make-up auflegte und dennoch jede geschminkte Konkurrentin ausstach, hatte, noch bevor sie Praxiteles kennenlernte, mit Hingabe so viel Geld verdient, dass sie den Männern von Theben den Vorschlag machte, die von Alexander dem Großen zerstörte Stadt auf eigene Kosten wiederaufzubauen. Einzige Bedingung: Im Zentrum der Stadt sollte eine Tafel aufgestellt werden mit der folgenden Inschrift: »Alexander hat die Stadt zerstört, aufgebaut hat sie Phryne, die Hetäre.« Die Thebaner lehnten dankend ab.
Dennoch, ihr Selbstbewusstsein blieb ungebrochen. Den Athenern bot sie eine Wette an, den Philosophen Xenokrates, einen Schüler Platons, der mit der Philosophie verheiratet war (er pflegte seine Wirkungsstätte, die Athener Akademie, nur einmal im Jahr zu verlassen), mit ihren Reizen zu verführen. Xenokrates galt schlichtweg als unempfänglich für weibliche Reize, so sie nicht der göttlichen Erleuchtung dienten. Aber welche Frau mag das schon von ihren primären Geschlechtsmerkmalen behaupten – von den sekundären ganz zu schweigen. Trotzdem passte Phryne Xenokrates ab, als er gerade wieder einmal seine Studierstube verließ. Auf welche Weise sie dem Vergeistigten dabei gegenübertrat, überliefern weder Pausanias noch Plutarch, die sonst jeden Skandal breitgetreten haben; wir erfahren nur, dass Phryne die Wette verlor.
Der Reiz des Verbotenen fordert eben immer eine Portion Dummheit, und dennoch: Was wäre das Leben auf diesem Planeten ohne Dummheit? Nein, Phryne verlor zwar die Wette gegen Xenokrates, aber sie gewann gegen die obersten Richter Athens, und dieser Sieg war von viel größerer Bedeutung; denn Phryne war der Asebie, der Gotteslästerung angeklagt, und darauf stand die Todesstrafe. Es sah nicht gut aus für sie in dem Prozess, aber in ausweglosen Situationen können Frauen immer auf zwei todsichere Mittel zurückgreifen: heiße Tränen und weibliche Reize. Also ließ Phryne erst ein paar Tränen, dann ihr Gewand zu Boden fallen, reckte den Richtern ihre Brüste entgegen und schluchzte in aller Unschuld: »Und so was wollt ihr in den Hades schicken?« Der Prozess endete mit einem Freispruch.
Nicht weniger Ruhm erntete Aspasia, eine Schönheit aus Milet. Sie kam in den vierziger Jahren des 5. Jahrhunderts vor der Zeitenwende nach Athen, um Perikles kennenzulernen, den größten Verehrer weiblicher Schönheit, Politiker und Feldherrn seiner Zeit – in dieser Reihenfolge. Perikles ist ein frühes Beispiel für ein Naturgesetz, nach dem die hässlichsten Männer die schönsten Frauen haben. Perikles hatte einen katastrophalen Eierkopf, und das war der Grund, warum er nie ohne Helm herumlief (behauptete schon Plutarch). Obwohl verheiratet mit einer Athenerin, wurde er von Frauen verfolgt und angebetet wie eine Statue des Phidias, und nicht selten erhörte Perikles die Gebete frommer Frauen. Er pflegte seine Geliebten auf ungewöhnliche Weise zu beschenken, der »Meerzwiebelkopf« – so sein Spitzname bei den Athenern – schenkte nicht etwa Gold oder Edelsteine, er schenkte jedes Mal einen Pfau. Zu diesem Zweck unterhielt Perikles eine Pfauenfarm.
Eine Frau wie Aspasia, deren Ruhm weit über die Grenzen des persischen Großkönigtums hinausging (selbst König Kyros nannte seine liebste Beischläferin Aspasia, obwohl sie Milto hieß), gab sich natürlich nicht mit einem Pfau zufrieden. Sie wollte Perikles, und zwar ganz. Aspasia ruhte nicht eher, bis der »Meerzwiebelkopf« sich von seiner Frau scheiden ließ und sie heiratete. Der Fall erregte in der Hauptstadt Athen großes Aufsehen. Honorige Männer schickten ihre noch honorigeren Ehefrauen zu Aspasia mit der Bitte, sie doch teilhaben zu lassen an ihren Künsten. Ob auch Xanthippe, die Frau des weisen Sokrates, unter den Klientinnen war, ist nicht überliefert; Plutarch weiß jedoch zu berichten, dass Sokrates durchaus zu Aspasias Verehrern gehörte und manchmal sogar seine Musterschüler mitbrachte, obwohl Aspasia »ein keineswegs ehrbares und anständiges Gewerbe trieb«. Neben ihrer Schönheit verfügte Aspasia über eine Reihe von Talenten, die bei Frauen des klassischen Altertums nur selten anzutreffen waren. Ihre Umgangsformen waren ebenso beispielhaft wie ihre Redegabe, eine Kunst, die den alten Griechen mehr bedeutete als alles andere, und dazu verfügte sie noch über eine politische Begabung. Perikles machte Aspasia nicht nur zur Bettgespielin, sie wurde auch seine engste Beraterin. Der Samische Krieg, heißt es, habe auf ihre Initiative hin stattgefunden.
Ungewöhnlich ist das Andenken, das die Athener Aspasia bewahrten. Es entspricht dem Gegenteil von der Regel. Gemeinhin finden Frauen vom Schlage Aspasias bei Dichtern Verständnis, bei Philosophen aber Verachtung. Bei Aspasia war es umgekehrt: Die Dichter Athens machten Aspasia in ihren Komödien lächerlich, nannten sie eine »hundsäugige Dirne« (was im Gegensatz zur kuhäugigen Athene ein Schimpfwort war), die Sokratiker aber schlossen sie noch jahrzehntelang in ihre hohen und edelmütigen Gedanken ein.
Künstler standen seit jeher den sexuellen Gewohnheiten des Adels in keiner Weise nach. Das Volk gestand ihnen Narrenfreiheit zu, und die galt auch im Hinblick auf eine Zweitfrau. Musiker, Maler und Dichter rechtfertigten ihre Geliebten als Musen zur Anregung der – künstlerischen! – Potenz, und nicht selten war das auch so. Johann Wolfgang von Goethe, der gehemmte Spätentwickler und späte Ehemann, machte das Thema Zweitfrau zum Thema seines Lebens. Ehefrau Christiane, vom Dichter geliebt und begehrt, nimmt in seinen Werken nur Statistenrollen ein. Die Hauptrollen sind von seinen Geliebten besetzt, und der Dichter machte daraus kein Geheimnis: Seine Figuren, sagte er, seien alle erlebt.
Man muss keine großen Forschungen betreiben, um Charlotte von Stein als Iphigenie wiederzuerkennen, Friederike Brion als Marie im Clavigo, Marianne Willemer als Suleika im Westöstlichen Diwan, Minna Herzlieb als Ottilie in den Wahlverwandtschaften und die siebzehnjährige Altersliebe des Vierundsiebzigjährigen, Ulrike von Levetzow, als Pandora in der Marienbader Elegie. Sie war auch die einzige Frau, der Johann Wolfgang von Goethe spontan einen Heiratsantrag machte. Der abschlägige Bescheid hatte für beide katastrophale Folgen: Goethe zog sich in Depressionen und Einsamkeit zurück, Ulrike suchte das Vergessen im Kloster.
Mit den wenigsten Verhältnissen, die Goethe »angedichtet« werden, hat der Dichter auch geschlafen. Leidenschaft bedeutete für ihn in erster Linie Unerfülltsein, Sehnsucht. Und dieser Sehnsucht verdanken wir die aufregendsten Rollen in seinen Werken und die glutvollsten Texte. Seiner Dauergeliebten Charlotte von Stein, die er zwölf Jahre glühend verehrte, ohne auch nur einmal zum Ziel zu kommen, schrieb er 1800 Briefe, obwohl sie nur ein paar Häuser weiter lebte. Ehefrau Christiane musste sich mit 354 bescheiden.
Was ihren Hang zu Zweitfrauen betrifft, so werden Dichter nur noch von Musikern übertroffen, allerdings wurden ihre Affären weniger bekannt als die der Dichter. Denn während Dichter schon einen unverhofften Beischlaf in ein Theaterstück, zumindest aber ein Gedicht, umsetzen, schreiben Komponisten in der gleichen Situation nur selten eine Oper. Zu mehr als einem Lied ließ sich kaum ein Komponist hinreißen. Nur Johann Strauß, der große Charmeur und Walzerkönig, machte eine (un)rühmliche Ausnahme: Er schrieb eine Helenen-, Cäcilien-, Elisen- und Olga-Polka, einen Adelen-Walzer, Josefinen-Tänze, die Annika-Quadrille und den FannyMarsch, was voraussetzte, dass Strauß mit den betitelten Damen mehr als nur diniert hatte.
Strauß war drei Mal verheiratet und nahm weitere dreizehn Mal Anlauf zu einem solchen Unternehmen, jedenfalls bezeichneten sich dreizehn Damen als verlobt mit Strauß – seine kurzen Abenteuer wollen wir in diesem Zusammenhang gar nicht erwähnen. Wie Goethe war Strauß der geborene Junggeselle, und er blieb es auch, wenn er gerade wieder einmal verheiratet war. Als er mit siebenunddreißig diesen Schritt zum ersten Mal wagte, trugen die Wiener Madln Trauer. Warum ausgerechnet die?, fragten sie, eine sieben Jahre ältere Sängerin mit sieben (!) unehelichen Kindern, abgelegte Zweitfrau des Wiener Bankiers Moritz Todesco?
Jetty Treffz, so nannte sich die Auserwählte (richtig hieß sie Henriette Chalupetzky), hatte für Strauß die gleiche Bedeutung wie Christiane für Goethe, sie war ihm Mutter, Geliebte und Hausfrau und sah auch über alle Zweitfrauen hinweg, denen der Walzerkönig nach wie vor huldigte. Jetty starb nach sechzehn Jahren, und Strauß ging schon sechs Wochen später eine neue Ehe ein: Lily, ebenfalls Sängerin, aber um fünfundzwanzig Jahre jünger als der Hochzeiter, hielt es nur ein paar Wochen bei ihm aus, sodass Strauß es noch ein drittes Mal versuchte. Die Auserwählte hieß Adele, war einundzwanzig Jahre jünger, aber dennoch schon Witwe, und hieß, ohne verwandtschaftliche Zusammenhänge, ebenfalls Strauß. Um Adele Strauß heiraten zu können (die Gesetze der k.u.k. Monarchie verboten die Wiederverheiratung Geschiedener), wurde Johann Strauß evangelisch und Bürger von Sachsen-Coburg-Gotha. Er liebte Adele, aber auf andere Frauen wollte er deshalb nicht verzichten.
Zweitfrauen, immer wieder Zweitfrauen waren es, die Theaterdichter in abgründige Theatergeschichten verstrickten. Ihr Leben geriet bisweilen zur Posse, viel häufiger aber zur Tragödie. Johann Nestroy und Ferdinand Raimund ähneln sich nicht nur im literarischen Genre, auch ihr Schicksal trägt verwandte Züge (eigentlich zählte auch Franz Grillparzer zu dieser Kategorie, der Finanzverwaltungs-Archivdirektor mit seiner »ewigen Braut« Kathi Fröhlich; Grillparzer jedoch war nie verheiratet). Nestroy und seine Zweitfrau Marie Weiler fanden trotz vollzogener Scheidung des Bühnendichters kein Happy End, weil Nestroy als Geschiedener nicht mehr heiraten durfte und, statt Umwege über Sachsen-Coburg-Gotha zu machen wie Johann Strauß, lieber oberflächliche Zerstreuung suchte bei den süßen Wienerinnen, die dem gefeierten Bühnenstar zu Füßen lagen. Dass er in seinem Innersten unglücklich blieb und zum Satiriker und beißenden Kritiker des Biedermeier wurde, das verdanken wir in der Hauptsache seinen persönlichen Umständen.
Sein älterer Kollege Ferdinand Raimund sprach ganz offen aus, dass er dem heftigen Temperament seiner Zweitfrau Toni Wagner »die Geburten seiner Kunst« verdankte. Verheiratet war Raimund nur kurz und widerwillig, denn die Frau, die er eigentlich haben wollte, Toni Wagner, deren Vater ein reicher Kaffeehausbesitzer war, hatte dem hergelaufenen Komödianten kategorisch die Ehe verweigert. Deshalb stürzte sich Ferdinand in seiner Verzweiflung auf die minderjährige Schauspielerkollegin Luise Gleich, mit der er allabendlich auf der Bühne stand, und die Raimund-Posse nahm ihren Lauf.
Am Morgen des anberaumten Hochzeitstages kam es zum Streit zwischen den Ehestandskandidaten, und Luise biss Ferdinand in den Finger, was den unter einer Tollwutphobie leidenden Komödianten zu dem Ausruf: »Beißen auch noch!« und anschließender Flucht veranlasste. Das war am 4. April 1820. Am 5. April stand Raimund im Theater in der Leopoldstadt auf der Bühne und wurde ausgebuht, weil er die bissige Braut sitzengelassen hatte. Drei Tage später gab er schließlich doch noch sein Jawort, keine zwei Jahre später wurde die Ehe geschieden. Grund: »Unordentlicher Lebenswandel, Treulosigkeit, Misshandlungen und wiederholte Kränkungen nach Paragraph 109«.
Noch während seiner Ehe hatten sich Raimund und Toni Wagner regelmäßig im Haus Ankergasse 25 getroffen, wo ihnen eine Theaterfriseurswitwe ein Zimmer vermietete, und zum Schein ließ Toni sich jahrelang von Anton Collet, einem Hauptpostamtoffizial, ausführen, der ihr den Hof machte. Heiraten konnten und durften sie nicht, also spielten sie ein Leben lang Theater. Von Ferdinand Raimund glaubt man zu wissen, dass er nach seiner Scheidung Toni kein einziges Mal betrogen hat. Ob das auch für Toni Wagner gilt, ist keineswegs sicher. Und das stürzte den Komödianten in tiefe Unruhe, er wurde immer mehr zum Sonderling. Sein Stück Der Alpenkönig und der Menschenfeind trägt starke autobiographische Züge.
Raimund wurde selbst zum Menschenfeind, ging nie ohne Pistole auf die Straße und verrammelte sein Haus wie eine Festung. Seine Zweitfrau, die er liebend gerne zur Erstfrau gemacht hätte, überwachte er mit einer gewissen Hilflosigkeit. Das führte zu immer neuen Problemen zwischen den beiden. Vor allem beklagte Raimund Tonis sexuelle Reserviertheit.
Auf einer der ganz seltenen gemeinsamen Reisen im August 1836 kam es zur Katastrophe. Im Gasthof Zum Hirschen in Pottenstein, wo Ferdinand und Toni sich eingemietet hatten, steckte sich der schwierige Komödiant eine Pistole in den Mund und drückte ab. Es dauerte sechs Tage, bis er tot war. Angst vor Tollwut sei das Motiv gewesen, heißt es. Die Wahrheit kannte nur die von Raimund zur Universalerbin eingesetzte Antonie Wagner, aber die schwieg.
Wiener Ärzte nahmen im Hirschen die Obduktion der Leiche vor. Dabei wurde die Hirnschale abgespalten. Toni bewahrte sie dreiundvierzig Jahre in einem Kästchen auf. So lange überlebte sie Ferdinand Raimund.
Diese Geschichte ist ungewöhnlich. Denn im Dreiecksverhältnis Mann-Ehefrau-Zweitfrau trifft den Mann, den eigentlichen Urheber des Problems, das tragische Ende nur selten. In erster Linie ereilt es die Geliebte, seltener die Ehefrau, und das hat einen einfachen Grund: Zweitfrauen sind relativ leicht zu ersetzen, Ehefrauen nur unter hohem Aufwand.
Für den Mann ist die Geschichte der Geliebten kein Ruhmesblatt. August der Starke, Ludwig XV. von Frankreich, König Friedrich Wilhelm II. von Preußen, Ludwig I. von Bayern, Kaiser Franz Joseph von Österreich oder Johann Wolfgang von Goethe – sie alle haben ihre Meriten. Aber betrachtet man ihr Privatleben, das in Geschichtsbüchern keinen Eingang findet, so schwankt ihr Charakterbild in der Geschichte, und Goethe wird zum verklemmten Sexualneurotiker, Franz Joseph zum sabbernden Lustgreis, Ludwig I. zum Busenfetischisten, König Friedrich Wilhelm II. zum Peepshow-Besucher, Ludwig XV. zum Bordellbetreiber und August der Starke zum krankhaften Potenzprotz. »Ich erfahre es alle Tage«, sagte die Marquise de Pompadour, »dass es keine schlimmere Gesellschaft gibt als die gute.«
IDie tödliche Liebe der Mary Vetsera
»Ein letzter Abschiedsgruß in Gedenken allen schönen Frauen Wiens, die ich so sehr geliebt …«
Aus dem Testament Erzherzog Rudolfs,Kronprinz von Österreich-Ungarn
Ein Fall für Sigmund Freud: Mann (30) erschießt nach dem Geschlechtsverkehr siebzehnjährige Geliebte, anschließend sich selbst. Selten finden Freuds Theorien der Psychoanalyse so eindeutige Bestätigung: Nach Freud ist die Libido der Hauptantrieb menschlichen Verhaltens, und eine gestörte Libido provoziert einen Todes- und Destruktionstrieb. Ja, sogar seine Theorie, dass zwischen dem ersten und fünften Lebensjahr das Schicksal des Einzelnen besiegelt wird, scheint hier Bestätigung zu finden.
Arzt und Patient wären – so sie sich jemals getroffen hätten – etwa gleich alt gewesen, und zeitweilig lebten sie nur wenige Gehminuten voneinander, aber zu einer Begegnung ist es nie gekommen. Denn als Freud seine revolutionären Erkenntnisse veröffentlichte, war der andere schon lange tot, erschossen, seinem Destruktionstrieb folgend.
Erzherzog Rudolf, Kronprinz von Österreich-Ungarn, war von Geburt ausersehen, Kaiser zu werden, und vermutlich wäre die Weltgeschichte anders verlaufen, hätte er nicht 1889 sein Leben im Bett mit einer Siebzehnjährigen und einer Pistole beendet. Das Mädchen wie die Pistole sind in diesem Zusammenhang – auch das bestätigt Freud – nur Symbole. Das Mädchen kannte er wohl, er hatte mit ihm aber nur einmal geschlafen. Eigentlich hasste er Frauen (sein Verschleiß an Zweitfrauen ist ein Beweis dafür). Die Pistole erschien ihm als die schnellste und sauberste Sterbehilfe. Doch Rudolf wäre auch ohne den tödlichen Schuss vom 29. Januar 1889 vorzeitig aus dem Leben geschieden, dahingesiecht an Syphilis, am Suff und Morphium, ohnehin halbirre. Frauen, von denen er mehr verbrauchte als sein unsterblich scheinender Vater Kaiser Franz Joseph, waren nicht die Ursache für diese Entwicklung, aber sie waren ihm eine Hilfe bei seinem Selbstvernichtungstrieb. In der Tat ein Fall für die Psychoanalyse.
Rollen wir den Fall, der unter dem Codewort »Mayerling« in die Geschichte eingegangen ist, von hinten auf:
Kaiser Franz Joseph zitierte seinen Sohn und Thronfolger Rudolf am Sonntag, dem 27. Januar 1889, in die Hofburg. Grund der – wie später zu hören war – heftigen Unterredung: Seine Apostolische Majestät hatte auf Umwegen erfahren, dass sein eigener Sohn, der künftige Kaiser von Österreich-Ungarn, beim Papst um die Annullierung seiner Ehe angesucht habe. Rudolf hatte, um der Staatsräson zu genügen, im Mai 1881 die Tochter des wegen seiner Grausamkeit als Kolonialherr berüchtigten Belgierkönigs Leopold II., Stephanie, geheiratet, mit dieser aber, trotz anfänglicher Zuneigung, kein Glück gefunden, dafür aber ständige Schwierigkeiten wegen seiner zahllosen Liebschaften. Die Unterredung zwischen Vater (Kaiser) und Sohn (Feldmarschallleutnant, Generalinspekteur der Infanterie und Vizeadmiral) endete mit einem lautstarken Krach, in dessen Verlauf Franz Joseph seinen Sohn Rudolf anschrie, er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um diese Scheidung zu verhindern, während Rudolf resigniert erwiderte, nun wisse er, was er zu tun habe.
Am Vormittag gegen zehn Uhr desselben Tages betrat Kronprinz Rudolf das Grand Hotel an der Wiener Ringstraße, um sich mit Marie Gräfin Larisch-Wallersee zu treffen. »Die Larisch«, wie sie allgemein genannt wurde, bewohnte samt Zofe Jenny und Hund in dem feinen Hotel die Zimmer 21, 23 und 28, um sich, wie sie hatte wissen lassen, in Wien einer Zahnbehandlung zu unterziehen. Das mag gestimmt haben oder nicht – den Zahnärzten im heimischen Pardubitz ging nicht der beste Ruf voraus, aber Marie war jedes Mittel recht, um der langweiligen Ehe mit dem Grafen Georg Larisch-Mönnich zu entkommen.
Alle wussten, dass Marie ein wilder Trieb am Stammbaum der Wittelsbacher war (weniger poetisch: Herzog Ludwig in Bayern hatte ein Techtelmechtel mit der Schauspielerin Henriette Mendel gehabt), aber als sie Georg heiratete, war sie längst geadelt und damit von der Unperson zu einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens geworden, die genug Gesprächsstoff hergab. Mehr als es ihrem Stand zukam, pflegte sie das gesellschaftliche Leben, und obwohl ihre Ehe alle Züge einer Tragödie trug, spielte sie mit ihrem Ehemann nach außen hin die immerwährende Komödie. Über Rudolfs Mutter Elisabeth, die aus Bayern stammte, waren der unglückliche Kronprinz und die erlebnishungrige Gräfin Cousin und Cousine, ein Umstand, den die Larisch vor allem nutzte, um den österreichischen Vetter um Geld anzupumpen.
Nun konnte die Cousine sich revanchieren. Nicht, dass er mit ihr ein Verhältnis anfangen wollte, Marie war nicht sehr hübsch, vor allem erfüllte sie nicht ein wesentliches Kriterium: Sie war weder wesentlich jünger noch wesentlich älter als Rudolf, sondern gleich alt; aber Frauen, die den dreißigjährigen Kronprinzen interessierten, mussten entweder älter sein oder naive junge Mädchen, und damit scheint der Fortgang der Geschichte vorgezeichnet.
Die Larisch war mit einem siebzehnjährigen Mädchen befreundet, das den Kronprinzen, von dem es wusste, dass dieser verheiratet, aber auch ein Schwerenöter war, glühend verehrte: Marie Alexandrine, genannt Mary Vetsera. Monatelang hatte Mary den Kronprinzen auf Schritt und Tritt verfolgt, ihm aufgelauert, wenn er mit der Kutsche durch die Stadt fuhr, im Theater das Opernglas auf seine Loge gerichtet statt auf die Bühne, und endlich hatte sie ihm einen Brief geschrieben, dessen Wortlaut wir nicht kennen, dessen Inhalt jedoch unschwer zu erraten ist: Mary Vetsera dürfte dem Kronprinzen ihre Liebe gestanden, vielleicht sogar einen »unsittlichen Antrag« gemacht haben.
Von besonderer Pikanterie war die Situation schon allein deshalb, weil Marys Mutter, die Baronin Helene Vetsera, geborene Baltazzi, eine Schönheit der Wiener Szene, verheiratet mit einem zweiundzwanzig Jahre älteren k.u.k. Diplomaten, dem Kronprinzen zehn Jahre zuvor auf ähnliche Weise nachgestellt hatte. Wie ihre Tochter hatte sie Rudolf lange Zeit auf Schritt und Tritt verfolgt. Sogar der Kaiser hatte sich darüber mokiert: »Was diese Frau mit Rudolf treibt, ist unglaublich!« Nicht selten zwingen Mütter ihren Töchtern das auf, was sie selbst nicht erreicht haben. Es ist daher denkbar, dass Baronin Helene hinter den Schwärmereien ihrer Tochter Mary stand, und Gräfin Larisch sollte in der Angelegenheit vermitteln.
Obwohl seit Jahren mit dem stadtbekannten »Callgirl« Mizzi Caspar verbandelt, zeigte Kronprinz Rudolf an dem Abenteuer mit einer Siebzehnjährigen größtes Interesse. Warum, wo Rudolf doch nicht klagen konnte, was einen schnellen Seitensprung betraf?
»Als ich das erste Mal Gelegenheit hatte, ihre Schönheit zu bewundern«, notierte Prinzessin Louise von Coburg in ihren Lebenserinnerungen, »habe ich wirklich beinahe die Fassung verloren.« Nun gibt es in Bezug auf die Schönheit einer Frau keine härteren Kritiker als Frauen. Mary Vetsera muss also wirklich unbeschreiblich schön gewesen sein; denn auch die Gräfin Larisch geriet ins Schwärmen und beschrieb Mary als so süß und lieblich, »dass jeder sie gern haben musste«. Sie sei vom Instinkt her kokett und unbewusst unmoralisch in ihren Neigungen gewesen, dabei sinnlich wie eine Orientalin.
Die Gräfin über die junge Baronesse: »Sie war nicht groß, ihre geschmeidige Gestalt und ihr voll entwickelter Busen ließen sie älter als achtzehn Jahre erscheinen. Ihr Teint war wunderbar zart, ihr kleiner roter Mund öffnete sich über kleinen weißen Zähnen, die ich Mäusezähne zu nennen pflegte, und niemals wieder habe ich solche beseelte Augen gesehen mit solch langen Wimpern und solch fein gezogenen Brauen. Ihr dunkelbraunes Haar war sehr lang, die Hände und Füße klein. Ihr Gang war von einer verführerischen und unwiderstehlichen Grazie …«
Fotografische Darstellungen zeigen Mary schon als Fünfzehnjährige mit dem bemerkenswerten Aussehen einer Dreißigjährigen. Aber nicht nur in Pose und Toilette konnte es das Baronesserl aus dem 2. Wiener Gemeindebezirk mit jeder Prinzessin aufnehmen, Mary war ebenso gebildet, sprach Englisch und Französisch, konnte singen, tanzen und Klavier spielen, und gesellschaftliche Umgangsformen pflegte sie auf so vorbildliche Weise, dass das bei Gleichaltrigen nur Neid hervorrief. Trotz dieser Vorzüge blieb Mary ein Baronesserl und bedurfte, um beim Hochadel Zugang zu finden, starker Protektion.
Bälle, Empfänge, Theaterbesuche, vor allem aber exklusive Pferderennen, bei denen Marys drei Onkel mütterlicherseits, Alexander, Aristides und Hector Baltazzi, Triumphe feierten, brachten Mary nicht den erwünschten gesellschaftlichen Aufstieg. Mutter Helene hätte sicherlich mit Begeisterung zur Kenntnis genommen, dass ihr Idol, der Kronprinz, ein Auge auf Mary geworfen hatte. Später, nach der Katastrophe von Mayerling, die auch sie nicht vorhersehen konnte, wird Helene Vetsera behaupten, sie habe von den Zusammenkünften zwischen Kronprinz Rudolf und ihrer Tochter Mary nichts gewusst, andernfalls hätte sie diese verhindert.
Am 5. November 1888 hatten Rudolf und Mary sich zum ersten Mal getroffen. Gräfin Larisch spielte die Kupplerin, vor allem musste sie als Alibi gegenüber Marys Mutter herhalten. In aller Aufregung und Schwärmerei bemerkte Mary Vetsera nicht, dass ihr ein zerstörter, alkohol- und drogensüchtiger Mann gegenübertrat, der sich zu diesem Zeitpunkt längst mit dem Gedanken trug, aus dem Leben zu scheiden, und in seinem Destruktions- und Todestrieb nur eine Partnerin suchte, die ihn im Sterben begleitete.
Etwa zwanzig Mal begegneten sich der Kronprinz und das Baronesserl vor jenem verhängnisvollen 27. Januar 1889, wobei es erst relativ spät, am 13. Januar, zu Intimitäten gekommen zu sein scheint. Der 13. Januar war in Marys Kalender eingerahmt und mehrfach gekennzeichnet, und Bemerkungen, die Mary Vetsera an diesem Tag machte, lassen keinen anderen Schluss zu. Ihrer Kammerzofe sagte die Baronesse, sie gehöre nun nicht mehr sich selbst, sondern ihm, Rudolf, ganz allein. Und in einem Brief an ihre Vertraute Hermine Tobis, bei der sie regelmäßig Klavierstunden nahm, meinte sie in ähnlicher Formulierung, sie hätten beide den Kopf verloren, aber nun gehörten sie sich mit Leib und Seele. Eine Tabatière, die Mary dem Kronprinzen schenkte, trug die Widmung: »13. Januar. Dank dem Schicksal«.
Man kann nur darüber spekulieren, ob Kronprinz Rudolf an den von Mary herbeigesehnten Beischlaf die Bedingung knüpfte, sie müsse dafür bereit sein, mit ihm aus dem Leben zu scheiden. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, denn wie wir noch sehen werden, befand sich Rudolf keineswegs in sexuellem Notstand. Die Umstände der Tragödie machen auch deutlich, dass der Kronprinz die Baronesse keineswegs geliebt hat, im Gegenteil, er hat sie auf perfide Weise missbraucht, nicht sexuell, sondern weil er nicht alleine sterben wollte. Mit Hilfe der Gräfin Larisch-Wallersee gelang es Rudolf und Mary, sich am Nachmittag des 27. Januar im Prater zu treffen. Zwischen Mutter und Tochter Vetsera war es am Tag zuvor zu einer Auseinandersetzung gekommen. Die Baronin hatte bei Mary eine Zigarettendose mit dem Namenszug des Kronprinzen, Privatfotos und – was ihr zu denken gab – ein Testament der Siebzehnjährigen entdeckt. An diesem Nachmittag des 27. Januar im Prater fassten Rudolf und Mary den Entschluss, am folgenden Tag gemeinsam in den Tod zu gehen. Sie sahen sich noch einmal am selben Abend zu einem Geburtstagsempfang des deutschen Kaisers. Von dem Empfang in der Metternichgasse kehrte Mary nach Hause zurück, Rudolf nahm den Weg zu Mizzi Caspar, seiner Geliebten. Nach erfolgtem Beischlaf und der Erklärung, er werde sich am folgenden Tage umbringen (eine Drohung, die Mizzi Caspar nicht ernst nahm), kehrte Rudolf in den frühen Morgenstunden in seine Wohnung in der Hofburg zurück.
Am Montag, dem 28. Januar 1889, verlief alles wie von Kronprinz Rudolf geplant. Die politischen Geschäfte (eine militärische Lagebesprechung mit Oberstleutnant Albert Mayer und Pressegespräche mit Berthold Frischauer und Moritz Szeps vom Neuen Wiener Tagblatt) wurden in Kurzform abgehandelt, danach änderte Rudolf sein Testament und schrieb einige Abschiedsbriefe. Gegen elf Uhr trafen Gräfin Larisch und Baronesse Vetsera beim Kronprinzen in der Hofburg ein. Unbemerkt gelang es Mary, zusammen mit Josef Bratfisch, einem gelernten Fiaker, begeisterten Heurigensänger und seit gemeinsamen Saufgelagen in üblen Vorstadtkneipen zum Vertrauten des Kronprinzen avancierten Kraftpaket, in Richtung Mayerling zu verschwinden. Dort hatten sich beide für ihr gemeinsames Ende verabredet. Gegen Mittag trafen sich Rudolf, Mary und Bratfisch in einer Gaststätte außerhalb von Wien, um das letzte Stück gemeinsam zurückzulegen. Mayerling war das Jagdschloss des Kronprinzen. Es liegt im Wienerwald in der Gemeinde Alland, Bezirk Baden bei Wien. Unbemerkt gelang es Mary Vetsera, das Schloss durch das Südtor zu betreten. Nur Bratfisch und Kammerdiener Johann Loschek, an den Mary stets ihre Briefe für Rudolf adressiert hatte, wussten Bescheid, nicht jedoch das übrige Personal.
Dies war auch der Grund, warum Mary Vetsera das Schlafzimmer des Kronprinzen, in das sie Loschek heimlich gebracht hatte, nicht mehr verlassen durfte. Gemeinsam verbrachten sie die Nacht zum 29. Januar, einem Dienstag. Für den 29. Januar hatten sich Jagdfreunde angemeldet, Josef Graf Hoyos und Prinz Philipp von Sachsen-Coburg-Gotha. Rudolf frühstückte mit ihnen, ohne dass einer der Gäste Mary bemerkte. Der Kronprinz mimte eine Erkältung und bat Josl und Philipp, ohne ihn auf die Pirsch zu gehen.
Das unabänderliche Ziel vor Augen, hatte Rudolf an alles gedacht. Sogar die am 29. Januar vorgesehene Familienfeier bei Kaiser Franz Joseph war eingeplant. Im letzten Augenblick überbrachte Hofjäger Püchel Kronprinzessin Stephanie in Wien eine schriftliche Botschaft aus Mayerling: »Ich bitte Dich, schreibe Papa, dass ich gehorsamst um Verzeihung bitten lasse, dass ich zum Diner nicht erscheinen kann, aber ich möchte wegen starkem Schnupfen die Fahrt jetzt Nachmittag unterlassen und mit Josl Hoyos hier bleiben. Umarme Euch herzlichst – Rudolf.«
Diese letzten Zeilen spiegeln jene Eiseskälte, die Rudolf zeitlebens von seinen Eltern erfahren hatte.
Rudolf und Mary verbrachten den ganzen Tag im Schlafzimmer des Kronprinzen. Die meiste Zeit dürfte die Abfassung der Abschiedsbriefe in Anspruch genommen haben. Von großer Sachlichkeit, beinahe geschäftsmäßig ist der Abschiedsbrief Rudolfs an seine Frau Stephanie.
»Liebe Stephanie!Du bist von meiner Gegenwart und Plage befreit, werde glücklich auf Deine Art. Sei gut für die arme Kleine [Tochter Elisabeth Marie, geb. 2. September 1883], die das Einzige ist, was von mir übrigbleibt. Allen Bekannten, besonders Bombelles [Obersthofmeister Rudolfs], Spindler [sein Lehrer], Latour [Erzieher], Wowo [Rudolfs geliebte Amme Baronin Charlotte von Welden], Gisela [ältere Schwester], Leopold [Prinz von Bayern, Schwager] etc. etc. sage meine letzten Grüße. – Ich gehe ruhig in den Tod, der allein meinen guten Namen retten kann. – Dich herzlichst umarmend,Dein Dich liebender Rudolf.«
Anders Mary Vetsera. Ihre Abschiedsbriefe an Bruder, Schwester und die Mutter Helene zeigen ein zutiefst aufgewühltes Mädchen, das im Zustand der Schwärmerei für den Kronprinzen den Kopf verloren hat. »Liebe Mutter«, schrieb Mary, »verzeiht mir, was ich getan, ich konnte der Liebe nicht widerstehen.« Ihr letzter Wunsch: Mary wollte auf dem Gemeindefriedhof von Alland neben Rudolf begraben sein – ein Wunsch, der nicht in Erfüllung gehen durfte. Und abschließend: »Ich bin glücklicher im Tode als im Leben.«
Zwielichtig erscheint die Rolle der beiden Jagdfreunde Coburg und Hoyos in dieser Situation, mit denen Rudolf am Nachmittag noch Tee trank und später zu Abend aß. Außer einer gewissen »Milde in seinem Urteil« wollen beide nicht bemerkt haben, was sich auf Schloss Mayerling anbahnte. Gegen 21 Uhr ließ der Kronprinz seine Freunde allein. Er bat seinen Freund Bratfisch ins Billardzimmer, Mary kam hinzu, und der Leibfiaker musste noch einmal seine Wienerlieder singen und pfeifen, wie er es so oft getan hatte. Danach zogen Rudolf und Mary sich ins Schlafzimmer zurück.
Zur selben Zeit fand in der Wiener Hofburg ein festliches Diner statt. Geplant war, während der Abendgesellschaft die Verlobung von Erzherzogin Marie Valerie und Erzherzog Franz Karl Salvator von Toskana bekanntzugeben. Marie Valerie war die jüngste Tochter von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth und für Kronprinz Rudolf seit Kindertagen ständiger Anlass zur Eifersucht. Franz Salvator stammte aus der toskanischen Linie des Hauses Habsburg-Lothringen. Von der bevorstehenden Verlobung der beiden hatte Kronprinz Rudolf erst vier Wochen zuvor erfahren, und er hatte die kleine Schwester sogar beglückwünscht, obwohl ihm ganz anders zumute war. Sein Verhältnis zu Marie Valerie war komplexbeladen, er hasste sie sogar, und da seine eigene Ehe seit zwei Jahren nur noch auf dem Papier bestand, gönnte er ihr dieses Glück schon gar nicht.
Dass es an diesem Abend nicht zu der Verlobung kam, ist auf sonderbare Weise rätselhaft. Als hinge das drohende Unheil in der Luft, wollte schon beim Diner keine Freude aufkommen. Kronprinzessin Stephanie wedelte mit dem Brief ihres Gatten aus Mayerling, aber Kaiser Franz Joseph hoffte immer noch, Rudolf würde zu später Stunde erscheinen, und ließ dessen Gedeck nicht abräumen. Tatsächlich kam noch Besuch aus Schloss Mayerling, aber nicht Rudolf, sondern sein Freund Philipp von Sachsen-Coburg-Gotha, den der Kronprinz mit der Entschuldigung losgeschickt hatte, er selbst sei unpässlich wegen einer schweren Erkältung, die er sich im Wienerwald zugezogen habe. Und so zogen sich die Majestäten schon bald nach dem Diner in ihre Gemächer zurück.
Mittwoch, 30. Januar 1889. Kurz nach zehn Uhr morgens preschte eine Kutsche, von Schloss Mayerling kommend, in die Wiener Hofburg. Noch ehe der Kutscher die Pferde zum Stehen brachte, sprang Josef Graf Hoyos heraus, hetzte über die Küchenstiege zur Wohnung des Obersthofmeister Bombelles und rief außer Atem: »Der Kronprinz ist tot. Seine Hoheit wurde heute Morgen tot im Bett aufgefunden. Vermutlich vergiftet – Zyankali. An seiner Seite Baronesse Mary Vetsera, ebenfalls tot.«
Bombelles, »Charly« – wie Rudolf seinen Obersthofmeister immer genannt hatte, war geschockt. Er hatte mit dem Kronprinzen, den er von Kindertagen an kannte, alle Späße und Vergnügungen erlebt, die einem übermütigen Jüngling einfallen, aber er hatte mit seinem Schützling auch alle Leiden und Depressionen durchgemacht, die einen Charakter vom Schlage Rudolfs befallen. Und nun, gerade dreißig, sollte er tot sein? Der Thronfolger von Österreich-Ungarn?
Hektisch überlegten Bombelles und Hoyos, wer dem Kaiser die Schreckensnachricht überbringen sollte, schließlich entschieden sie sich für folgenden Weg: Sie informierten Franz Freiherr von Nopcsa, den Obersthofmeister der Kaiserin, und Eduard Graf Paar, den Generaladjutanten Kaiser Franz Josephs. Nopcsa gab die Nachricht an Elisabeth weiter. Paar rief Franz Joseph zur Kaiserin. Schließlich informierte Elisabeth Kaiser Franz Joseph. Es geschah während ihrer Griechischstunde.
Wie es zu der Fehlinformation kam, Rudolf sei mit Zyankali vergiftet worden, ist unklar, wie so vieles bei der Tragödie von Mayerling. Trotz der Aufregung, die in Mayerling bei der Entdeckung der Tat geherrscht haben mochte, konnte Graf Hoyos nicht entgangen sein, dass Rudolfs Schädel durch einen Schuss in die Stirn zertrümmert war. Eine naheliegende Erklärung wäre: Graf Hoyos verbreitete bewusst eine Falschinformation, um das Kaiserpaar in gewisser Weise zu schonen; denn Mord und anschließender Selbstmord waren eine Schande für einen Kronprinzen der k.u.k. Monarchie. In der Tat spricht vieles für diese Annahme, denn die erste Information, die der kaiserliche Hof zum Tode des Kronprinzen herausgab, lautete: Todesursache Herzschlag – ein »sauberer« Tod, der sich aber nicht lange aufrechterhalten ließ.
Innerhalb kurzer Zeit sickerte nämlich die ganze Wahrheit durch und – zumindest im Ergebnis – wurde bekannt, was sich im Jagdschloss des Kronprinzen wirklich zugetragen hatte, obwohl Kaiser Franz Joseph alles versucht hatte, dies zu vertuschen. Das Leben des Kronprinzen-Darstellers – nichts anderes war Rudolf von seinem ersten bis zum letzten Lebensjahr – durfte nicht so zu Ende gegangen sein. Ein Habsburger stirbt nicht mit einer Siebzehnjährigen im Bett. Also wurde die Leiche der Vetsera auf kaiserliche Anordnung umgehend in ein anderes Zimmer des Schlosses Mayerling gebracht, mit Kleidern zugedeckt und somit »aus der Welt geschafft«. Der Leichnam des Kronprinzen Rudolf wurde von Leibarzt Dr. Hermann Widerhofer untersucht und noch am selben Tag in die Wiener Hofburg überführt, wo man ihn in seinem Schlafgemach aufbahrte, mit einem Verband um die zerschossene Stirn.
Der harte oder besser: hart gewordene Kaiser, der ein Leben lang die Konvention über die eigenen Bedürfnisse gestellt hatte (wenigstens nach außen hin – aber das ist ja der Inhalt von Konventionen), sank zuerst auf die Knie und bekam einen Weinkrampf. Doch die Tränen waren nicht die Tränen eines Vaters, der den Sohn betrauerte, vielmehr beweinte der Kaiser von Österreich-Ungarn das Sich-aus-der-Verantwortung-Ziehen des Thronfolgers. Von seinem Schock erholt, fand Kaiser Franz Joseph nur abfällige Worte über den Freitod seines Sohnes: Er sei wie ein kleinbürgerlicher Schneider gestorben, kommentierte er hämisch.
Auf Schloss Mayerling kleideten Lakaien die Leiche der Baronesse Vetsera notdürftig an, schleppten sie in eine Kutsche, setzten sie auf die Rückbank und fuhren mit ihr in schneller Fahrt zur Leichenhalle des nahen Friedhofs Heiligenkreuz. Mit in der Kutsche saßen zwei Onkel Marys, der Reiter Alexander Baltazzi und Graf Georg Stockau. Die beiden hatten auch der Leichenbeschau des kaiserlichen Leibarztes Dr. Franz Auchenthaler beigewohnt und aus Unwissenheit, Gleichgültigkeit oder im Zustand ehrlicher Trauer nicht Einspruch erhoben, als dieser »Selbstmord durch Erschießen« feststellte. Die Folge dieses Gutachtens: Marie Alexandrine Freiin von Vetsera wurde einen Tag später, am 1. Februar 1889, auf dem Pfarrfriedhof Heiligenkreuz eingegraben – ohne den Segen eines Pfarrers und an einer Stelle, die weniger heilig und für Selbstmörder reserviert war.
In der Zwischenzeit wurde die Leiche Rudolfs von drei Ärzten obduziert. Das Ergebnis wurde zuerst dem Kaiser und der Ehefrau des Kronprinzen zur Kenntnis gebracht: »Seine k.u.k. Hoheit der durchlauchtigste Kronprinz ist zunächst an Zertrümmerung des Schädels und der vorderen Hirnpartien gestorben. Diese Zertrümmerung ist durch einen aus unmittelbarer Nähe gegen die rechte vordere Schläfengegend abgefeuerten Schuss veranlasst worden.« Und schließlich die für den Kaiser ernüchternde und deprimierende Feststellung: »Es unterliegt keinem Zweifel, dass seine k.u.k. Hoheit sich den Schuss selbst beigebracht hat und dass der Tod augenblicklich eingetreten ist.«
Davon abgesehen, dass der österreichische Thronfolger seine siebzehnjährige Geliebte ermordet hatte (das sollte für alle Zeiten verschwiegen werden), stellte sich nach dem erwiesenen Selbstmord für die Kirchenbehörden die Frage, ob Kronprinz Rudolf überhaupt mit dem Segen der Kirche bestattet werden durfte, ob ihm die Kapuzinergruft, die letzte Ruhestätte der Habsburger, zur Verfügung stand. Ein Selbstmörder hätte eigentlich, wie Mary Vetsera, irgendwo abseits verscharrt werden müssen.
Wohl aus diesem Grund nahmen die Leichensezierer ihre Aufgabe besonders genau. Sie untersuchten Schädel und Gehirn des Toten und entdeckten dabei »zufällig« gewisse anatomische Anomalien: »Die vorzeitige Verwachsung der Pfeil- und Kranznaht, die auffällige Tiefe der Schädelgrube und der sogenannten ›fingerförmigen Eindrücke‹ an der inneren Fläche der Schädelknochen, die deutliche Abflachung der Hirnwindungen und die Erweiterung der Hirnkammer sind pathologische Befunde, welche erfahrungsgemäß mit abnormen Geisteszuständen einherzugehen pflegen und daher zur Annahme berechtigen, dass die Tat in einem Zustand von Geistesverwirrung geschehen ist.«
Diese Passage im Obduktionsbefund war für Kronprinz Rudolf, vor allem aber für die Hinterbliebenen, sein Passierschein in die Kapuzinergruft. Einem Thronfolger, der sein Leben im Zustand geistiger Umnachtung beendet hatte, stand ein kirchliches Begräbnis zu. Rudolf selbst hatte nicht daran geglaubt und sich eine Beerdigung im Friedhof Heiligenkreuz neben Mary Vetsera gewünscht. Aber das wäre gegen jede Konvention gewesen, und mit der stand Rudolf ein Leben lang auf Kriegsfuß.
Scheinbar abseits hielt sich in diesen Tagen die Kronprinzessin Stephanie. Sie benahm sich, registrierte Schwägerin Marie Valerie, als wäre überhaupt nichts geschehen. Und Kaiserin Elisabeth, die ihre Abneigung gegenüber der Schwiegertochter nie hatte verbergen können, meinte nun, kein Wunder, dass Rudolf Betäubung bei anderen gesucht habe, bei dieser Frau! Stephanie selbst nahm dazu erst viele Jahre später in ihren Memoiren Stellung. Der Tod Rudolfs, schrieb sie, habe sie von einem angstvollen, sorgenvollen und trostlosen Zusammenleben erlöst. Der Grund für seinen Freitod sei weder in erbbiologischen Mängeln noch in geistiger Umnachtung zu sehen, sondern einzig und allein in der Haltlosigkeit seines Wesens.
Ausgestattet mit einer Witwenrente von 150 000 Gulden jährlich musste sich Ihre Kaiserliche Hoheit, die durchlauchtigste Kronprinzessin-Witwe Erzherzogin Stephanie, um ihre Zukunft nicht sorgen. In ihrer Wohnung in der Hofburg beseitigte sie alle Hinterlassenschaft ihres Mannes, sie reiste viel und heiratete zehn Jahre später den protestantischen ungarischen Edelmann Elemér Lónyay. Dafür gab sie ihren Titel, die jährliche Apanage und jede Verbindung zum Kaiserhaus auf.
In den Geschichtsbüchern wurde versucht, die Hintergründe des Mordes und Selbstmordes von Mayerling politisch zu motivieren, schließlich sei Kronprinz Rudolf ein höchst politischer Mensch gewesen. Dies soll hier keinesfalls in Abrede gestellt werden. Die spätere Feindschaft zwischen Rudolf und Kaiser Franz Joseph rührte auch von den konträren politischen Ansichten zwischen Vater und Sohn, und natürlich hatte es seinen tiefen Grund, wenn Rudolf seinen Kammerdiener Loschek mit einem Abschiedsbrief bedachte, den eigenen Vater aber mit keiner Zeile.