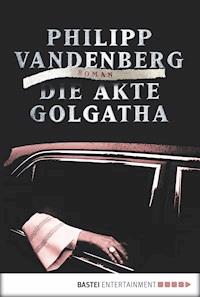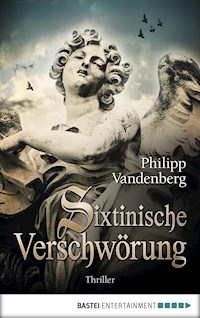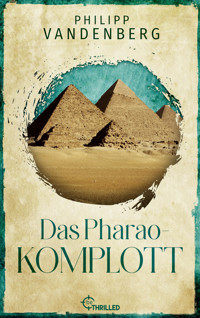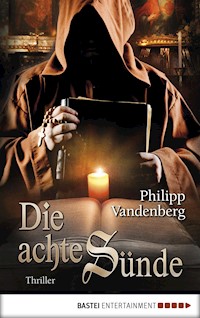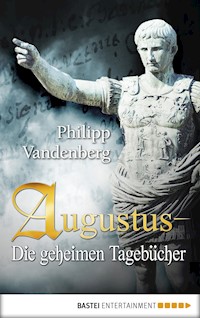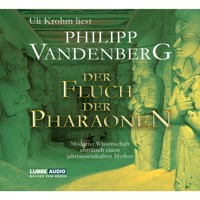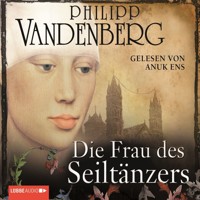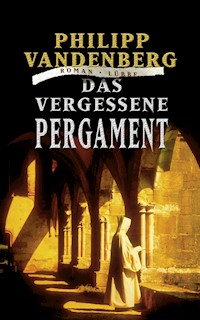4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der mysteriöse Tod seiner Mutter, ein gescheitertes Attentat und andere unerklärliche Vorgänge veranlassen den Fotojournalisten Alexander Brodka, seine eigene Vergangenheit zu erforschen. Dabei gerät er immer mehr in den Sog einer geheimen Organisation. Bestürzt muss er feststellen, dass alle Spuren nach Rom führen, hinter die Mauern des Vatikans, wo dunkle Mächte die Fäden ziehen. Und diese Männer in Purpur kennen nur ein Ziel: ihn zum Schweigen zu bringen. Gemeinsam mit seiner Geliebten stellt sich der Journalist der Heiligen Mafia, die ein beispielloses Verbrechen plant ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 677
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
CoverInhaltTitelImpressumKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Philip Vandenberg
Purpurschatten
Thriller
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 1999/2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelbild: © shutterstock/lakov Kalinin, © shutterstock/Vinogradov Illya
Umschlaggestaltung: Jeannine Schmelzer
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-5774-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
KAPITEL 1
Brodka liebte Farben, schließlich lebte er davon. Doch auf unerklärliche Weise empfand er eine tiefe Abneigung gegen Purpur in all seinen Schattierungen, ja, er hasste diese Farbe sogar, wie man ein Empfinden nur hassen kann. Wann immer möglich, mied er sie. Ließen sich das verdammte Purpur, Lila oder Violett nicht vermeiden, setzte er all seine Kunst ein, um diese scheußlichen, dekadenten Farben zu verfremden oder zu verfälschen.
Alexander Brodka, ein gut aussehender Vierziger mit kurz geschnittenem dunklem Haar, war Bildreporter und Fotograf für Hochglanzmagazine und seit zwanzig Jahren in der ganzen Welt zu Hause. In all den Jahren hatte er es vortrefflich verstanden, seine Abneigung gegen Purpur zu verbergen, weil er fürchtete, kluge Leute könnten irgendwelche Schlüsse daraus ziehen. Er selbst wusste keine Erklärung für seinen Ekel dieser Farbe gegenüber, wenngleich er sich mehr als einmal Gedanken darüber gemacht hatte. Brodka hatte sich zu der Ansicht durchgerungen, dass Farben nun einmal eine unterschiedliche Wirkung auf Menschen ausübten, und dass es den meisten nicht einmal bewusst war.
Diese Gedanken gingen ihm auch jetzt wieder durch den Kopf, als er die Strandszene durch den Sucher seiner Kamera betrachtete: Irina, mit gespreizten Beinen nackt auf einem Motorroller, im weißen Sand von Marco Island, dahinter Palmen und die endlose Skyline der Strandhotels.
»Musste der Scooter unbedingt lila sein?«, murrte Brodka, während er in den Lichtschacht seiner Hasselblad blinzelte.
Florentina, die rothaarige Stylistin und Requisiteurin, kurz Flo genannt – alles andere als eine Schönheit und bei Fotoshootings Mädchen für alles –, erwiderte giftig: »Du wolltest doch eine dunkle Farbe als Kontrast zum hellen Sand. Aber bitte, wenn lila dir nicht gefällt, besorge ich einen Roller in grün oder rot oder …«
»Um Himmels willen«, unterbrach Brodka, »das kostet nur Zeit. Dann steht die Sonne zu hoch, und die Hitze wird unerträglich. Benni, mehr Licht von unten, und näher ran!«
Kameraassistent Benni, ein hagerer, hoch aufgeschossener junger Bursche von zwanzig Jahren mit langem, strähnigem Haar, kniete mit einem runden, silberfarbigen Plastiksegel im Sand und spiegelte das von hinten einfallende Sonnenlicht auf den nackten Körper des Mädchens auf dem Motorroller.
Irina übte sich in bewundernswerter Geduld und warf auf Kommando ein ums andere Mal den Kopf in den Nacken. Sie stammte aus St. Petersburg und war Lehrerin, hatte aber keine Anstellung gefunden und verdiente seither ihren Lebensunterhalt als Fotomodell. Eine Bildserie im Magazin »Flot« hatte Irina im Westen bekannt gemacht.
Obwohl das Motiv geeignet war, die sexuelle Lust des Betrachters zu erregen – und zu nichts anderem war es gedacht –, war die Arbeit alles andere als lustvoll.
Flo fingerte unentwegt Eiswürfel aus einer Plastikbox und rieb damit über Irinas Brustwarzen, die sich daraufhin für eine, zwei Minuten aufstellten und das Aussehen zweier rosafarbener, feuchter Süßwasserperlen annahmen. Bei einem neuerlichen Blick durch den Sucher störte Brodka eine Bauchfalte Irinas, die auf ihre sitzende Haltung zurückzuführen war. Flo beseitigte den Makel, indem sie, für die Kamera unsichtbar, einen zwei Finger breiten Streifen Klebeband von Irinas rechter Taille bis zu den hinteren Rippen spannte, die Haut nach hinten zog und den Klebestreifen fest anpresste. In dieser Haltung wurde es jedoch unmöglich für Irina, den Kopf in den Nacken zu werfen. Der Klebestreifen schmerzte, und das Mädchen verzog das Gesicht.
»Ich brauche mehr Bewegung in Irinas Haar«, rief Brodka schließlich und drückte Benni die Kamera in die Hand.
Flo verstand, was Brodka meinte, und dachte nach. »Der Scooter-Vermieter verleiht auch Airboats, diese flachen Boote mit dem riesigen Propeller am Heck. Die machen ganz schön Wind. Ich könnte eines hierher bringen lassen.«
»Gute Idee«, erwiderte Brodka, und kopfschüttelnd fügte er hinzu: »Flo, du bist wirklich unbezahlbar!«
»Dann könnte ich auch den lila Scooter umtauschen.«
Brodka nickte.
»Und welche Farbe hätten Sie gern, Maestro?«
»Egal. Hauptsache kein Lila.«
Flo half Irina vom Roller und befreite sie von dem Klebestreifen, was der jungen Russin beinahe noch mehr Schmerzen bereitete als der Streifen selbst; dann warf sie ihr ein weißes T-Shirt zum Überziehen zu.
»Es ist deine Zeit, Brodka!«, rief Florentina schnippisch, während sie den Roller startete. Knatternd und schlingernd fuhr sie durch den Sand zu dem schmalen Weg aus Holzplanken, der vom Strand zum South Collier Boulevard führte.
»Jetzt steht die Sonne ohnehin schon zu hoch«, bemerkte Brodka, an seinen Assistenten gewandt. »Außerdem sind mir hier zu viele Gaffer. Wir versuchen es am Nachmittag noch einmal. Dann will ich eine Absperrung. Kümmerst du dich drum?«
»Geht klar, Brodka.«
Die Gaffer zerstreuten sich, als sie sahen, dass die Arbeit beendet war. Brodka, der alte, ausgefranste Jeans und ein weißes T-Shirt trug, ließ sich unter dem Sonnenschirm in den Sand fallen. Er war rücksichtslos gegen sich und andere, wenn es darum ging, gute Fotos zu schießen. Brodka war nicht unbedingt ein cooler Typ. Er neigte zu spontanen gefühlsmäßigen Reaktionen – bis hin zu gelegentlichen Wutausbrüchen –, doch zu den Leuten, die mit ihm arbeiteten, war er immer fair, solange sie sich um ein optimales Ergebnis bemühten. Gute Arbeit zu liefern war sein oberstes Ziel.
Brodka hatte sich daran gewöhnt, mit Superlativen zu leben. In Biarritz hatte er die schönsten Frauen der Welt vor seiner Kamera; in Monterey, Kalifornien, bannte er beim jährlichen Concours d’Elegance die exklusivsten und teuersten Automobile auf Film; für »Magnum« hatte er die höchsten Gebäude der Welt in den fünf Erdteilen abgelichtet, und »Vogue« brachte zwanzig Seiten Farbfotos, auf denen Brodka das süße Leben der Superreichen an der Côte d’Azur zeigte.
Das alles verlieh Alexander Brodka eine gewisse Weltgewandtheit, vor allem aber die Möglichkeit, Aufträge abzulehnen, die ihm nicht gefielen. Bevor er zugesagt hatte, Irina zu fotografieren, hatte er sich das Mädchen erst angesehen, denn – so pflegte er sich auszudrücken – zwischen Fotograf und Model müsse die Chemie stimmen, sonst sei alle Mühe vergebens. Die Chemie stimmte; aber darüber hinaus gab es zwischen ihm und dem schönen Mädchen aus St. Petersburg keine Annäherungen. In dieser Hinsicht hatte er seine Prinzipien.
Brodka wischte sich mit dem Arm den Schweiß von der Stirn und drückte seine Sonnenbrille fester auf die Nase. Auch Irina, deren Make-up bereits verlief, suchte nun Schutz unter dem Sonnenschirm. Benni fischte sich ein paar Eiswürfel aus der Box und presste sie in den Nacken.
Auf Marco Island, vor der Westküste Floridas im Golf von Mexiko, herrschte Anfang November für gewöhnlich frühlingshaftes Klima. In diesem Jahr war im Sommer Regen gefallen; selbst die ältesten Einwohner konnten sich nicht erinnern, wann dies das letzte Mal geschehen war. Dafür hatte im Oktober eine ungewöhnliche Hitzeperiode eingesetzt, die bis jetzt anhielt, wenige Tage vor Thanksgiving Day.
Brodka reichte Irina wortlos ein feuchtes Handtuch.
Sie verstand seinen Wink und schlang sich das Tuch wie ein Beduine um den Kopf, bis nur noch ein Schlitz für die Augen frei blieb.
»Dein Gesicht quillt sonst auf wie ein Pfannkuchen. Geh auf dein Zimmer, schmink dich ab, und leg dich möglichst nahe an die Klimaanlage. Benni gibt dir Bescheid, sobald wir mit der neuen Einstellung fertig sind.«
Irina nickte wortlos und verschwand in Richtung des Marriott-Hotels.
Während der Assistent die Kameras, Objektive, Stative und Sonnenblenden in Aluminiumkoffern verstaute, kam Flo zurück.
Sie schwenkte einen Umschlag in der Luft und rief schon von Weitem: »Brodka, ein Fax für dich!«
Brodka war es gewöhnt, Faxbriefe und Anrufe zu erhalten, wo immer er sich gerade aufhalten mochte. Er riss den Hotelumschlag auf und las.
Florentina ging davon aus, dass es sich um eine wichtige Mitteilung handelte, die mit diesem Auftrag zu tun hatte, und blickte Brodka fragend an.
Sie konnte die Bedeutung der Nachricht anfangs nicht in seinem Gesicht ablesen. Erst als Brodka den Kopf hob, wortlos in die Ferne blickte und die Augen zusammenkniff, als wollte er ein paar Tränen zerdrücken, ahnte Flo, dass etwas vorgefallen sein musste.
Ohne ein Wort reichte er Flo die Nachricht. Die zog die Stirn in Falten, als sie den Absender las: Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, 100 North Biscayne Boulevard, Miami, Florida 33132.
Sehr geehrter Herr Brodka!
Zu unserem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihre Mutter, Frau Claire Brodka, am 21. November verstorben ist. Da bis zu diesem Zeitpunkt weder Ihr Aufenthaltsort noch nähere Angehörige zu ermitteln waren, fand die Beisetzung am 25. November statt.
Hochachtungsvoll,
Meller, Generalkonsul.
»Welches Datum haben wir heute?«, fragte Brodka tonlos.
»Den Sechsundzwanzigsten«, antwortete Florentina.
Brodka nickte. Dann trat er unter dem Sonnenschirm hervor und ging zum Strand, wo die Brandung sich im Sand verlief. Brodka trug Jeans und Schuhe aus Segeltuch, aber das kümmerte ihn nicht. Er watete ins seichte Meer hinaus, bis das warme Wasser ihm an die Hüfte reichte. Mit verschränkten Armen blickte er zum Horizont.
Es war kein Schmerz, den Brodka verspürte, nicht einmal Trauer. In diesem Augenblick empfand er lediglich tiefe Ratlosigkeit; er wusste nicht, wie seine Gefühle dieser Situation begegnen würden. Zwischen Claire und Alexander Brodka hatte nie ein inniges Mutter-Sohn-Verhältnis geherrscht. Was die Ursachen betraf, waren sie stets unterschiedlicher Meinung gewesen – mit der Folge, dass sie sich aus dem Weg gingen und ernsthafte Gespräche vermieden.
Über den Vorwurf, nichts Anständiges gelernt zu haben – wie Claire Brodka sich ausdrückte –, hatte Brodka sich stets nur amüsiert. Die Benediktiner, in deren Internat er aufgewachsen war, hatten ihn dazu gedrängt, Priester zu werden. Aber mit der Religion hatte Brodka immer seine Probleme gehabt.
Doch der Tod, mit dem er sich nun so plötzlich und unerwartet konfrontiert sah, jagte Brodka Schauder über den Rücken und verunsicherte ihn zutiefst, weil ihm mit einem Mal die Unabänderlichkeit des Schicksals deutlich wurde. Obwohl die Sonne gnadenlos vom Himmel brannte, fröstelte er innerlich und ertappte sich dabei, wie er den Kopf schüttelte, als wollte er das Geschehene ungeschehen machen, als wollte er sagen: Es ist nicht wahr, du träumst …
Während vor ihm weiße Seevögel ins Meer schossen und mit zappelnder Beute aus dem Wasser tauchten, dachte Brodka an seine ferne Kindheit zurück.
Er erinnerte sich noch gut an den Tag, als seine Mutter ihn mit neun Jahren auf ein Internat der Benediktiner schickte. Oder wie er mit vierzehn zum ersten Mal fortlief, wütend über die strenge Erziehung, und wie er drei Tage in einer Scheune schlief, bis der Hunger ihn aus seinem Versteck trieb – direkt in die Arme einer Polizeistreife. Oder wie er sich gegen den Willen der Mutter eine Posaune kaufte, auf Teilzahlung und ohne Aussicht, die Raten bezahlen zu können (was sich als zutreffend erwies), weil er ein zweiter Glenn Miller werden wollte (was sich als Fehlschlag erwies).
In seinem Innern mischten sich Verunsicherung und Ratlosigkeit, als er hinter sich Florentinas Stimme hörte: »Tut mir leid für dich, Brodka, wirklich.«
Brodka wandte sich um und nickte. »Schon gut.« Dann watete er zurück in den Sand.
Flo blickte ihn von der Seite an. Nach einer Weile sagte sie: »Ich glaube, es ist besser, wenn wir abbrechen.«
Die Bemerkung riss Brodka aus seiner Lethargie. »Abbrechen? Bist du verrückt? In zwei Tagen ist die Produktion im Kasten. Wir machen weiter. Am Nachmittag, wie abgesprochen.«
»Wie du willst«, erwiderte Flo. Eigentlich hatte sie von Brodka nichts anderes erwartet.
Novembernebel tropfte von den Bäumen, als Brodka seinen Jaguar an der Backsteinmauer vor dem Waldfriedhof in München parkte. Fröstelnd schlug er den Kragen seines Mantels hoch und strebte dem Eingang zu, der von einem hohen Eisengitter verschlossen wurde.
Bisher hatte Brodka nicht in Erfahrung bringen können, weshalb seine Mutter gerade auf diesem Friedhof beerdigt worden war; es erwies sich ohnehin als schwierig, die näheren Umstände ihres Todes und der anschließenden Beisetzung zu klären. Zuerst einmal mussten Behördengänge erledigt, Rechnungen beglichen, Telefonate geführt und ein endloser Strom von Formularen ausgefüllt werden – der Tod war eine komplizierte Angelegenheit.
Am Tor kam Brodka eine schweigsame, dunkel gekleidete Trauergesellschaft entgegen, gefolgt von zwei beschirmten älteren Damen, die aus nicht erkennbarem Grund in heftigen Streit vertieft waren. Ein Schild mit der Aufschrift »Friedhofsverwaltung« und einem Pfeil zeigte nach links zu einem ebenerdigen Gebäude mit vergitterten Fenstern.
Ein grauhaariger, nachlässig gekleideter Mann, den der tägliche Umgang mit Tod und Trauer vorzeitig hatte altern lassen, erklärte Brodka mit ausgesuchter Höflichkeit, auf welcher Parzelle das Grab seiner Mutter zu finden sei, nicht ohne ihm freundlich nickend eine Karte zuzustecken, auf der sich ein Steinmetzunternehmen in der näheren Umgebung zur Anfertigung eines Marmorgrabsteins empfahl.
Brodka machte große Schritte auf dem sandigen Weg, um Pfützen und Morast auszuweichen. Am Brunnen, in dem Schiffchen braunen Laubes trieben, wandte er sich nach links. Nach wenigen Schritten gelangte er zu einem frischen Grab, das mit Blumengebinden und Kränzen überhäuft war. Brodka reckte den Kopf aus dem hochgestellten Kragen, um nach einem bescheideneren Grab in der Nähe Ausschau zu halten, als er das schlichte Holzkreuz inmitten der durchnässten Blumen sah. Auf dem Querbalken stand der Name »Claire Brodka«.
Er hätte nie geglaubt, dass es so weit kommen würde; doch nun, da er den Namen seiner Mutter las, schossen ihm Tränen in die Augen. Von tiefer Trauer übermannt, weinte er so hemmungslos wie seit seinen Kindertagen nicht mehr. Die Blumen vor seinen Augen zerrannen wie die Farben eines wirren Gemäldes, und er ertappte sich dabei, dass er heftig, beinahe unwillig den Kopf schüttelte. Unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, starrte er mit gefalteten Händen auf das Grab, so tief in Trauer und Erinnerungen versunken, dass er nicht bemerkte, wie von der Seite eine Gestalt zu ihm trat und in der gleichen Haltung wie er neben ihm stehen blieb.
Selbst als der Mann zu reden begann, war Brodka so abwesend, dass er kein Wort mitbekam. Erst als der andere so nahe an ihn herantrat, dass dessen Oberarm ihn berührte, wandte Brodka dem Mann seinen Blick zu. Der trug den schwarzen Umhang eines Sargträgers und eine zylinderartige, runde Kappe auf dem Kopf.
Er räusperte sich und begann von Neuem: »Ein merkwürdiger Tod, sehr merkwürdig, hm.«
Erst jetzt betrachtete Brodka den Mann neben sich genauer. Sein rundes, glatt rasiertes, rötliches Gesicht wirkte beinahe jugendlich im Vergleich zu seiner ältlichen Fantasieuniform. Über seiner rechten Braue erkannte Brodka ein großes dunkles Muttermal. Die hellen Augen blickten listig, und der gedrungene Hals bildete ein feistes Doppelkinn.
Da Brodka noch immer nicht reagierte, erkundigte sich der Fremde: »Sind Sie ein Angehöriger, wenn ich fragen darf?« Sein Tonfall klang irgendwie hinterhältig.
Brodka nickte und schwieg.
Der Mann im schwarzen Umhang nickte ebenfalls, hüstelte hinter vorgehaltener Hand und sagte nach einer Pause: »Ich meine, es geht mich ja nichts an, aber …«
»Dann verschwinden Sie, und lassen Sie mich in Ruhe!«, unterbrach Brodka ihn barsch und machte eine Handbewegung, als wollte er ihn verscheuchen wie einen lästigen Köter.
Zögernd entfernte sich der Fremde, trottete mit gesenktem Kopf in Richtung des niedrigen Gebäudes. Unweit des Brunnens holte Brodka ihn ein. »Warten Sie!«, rief er. »Einen Augenblick!«
Nun zeigte der schwarze Mann sich seinerseits unwillig. Er ging weiter, ohne Brodka auch nur einen Blick zu gönnen.
»Ich möchte mich entschuldigen«, sagte Brodka und wischte sich mit der flachen Hand über die Augen. »Ich war in Gedanken. Sie sagten etwas von einem ›merkwürdigen Tod‹. Was haben Sie damit gemeint?«
Der Fremde blieb abrupt stehen. Er legte den Kopf zur Seite und machte ein gequältes Gesicht. »Eigentlich geht es mich ja wirklich nichts an. Sie haben völlig recht, mein Herr, aber …«
»Aber?« Brodka ließ den anderen nicht aus den Augen.
»Nun ja, es ist so. Wenn man einen Sarg in die Grube lässt … verzeihen Sie bitte, dass ich mich so profan ausdrücke … bekommt man mit den Jahren ein Gefühl dafür …«
»Ein Gefühl wofür?«
»Nun ja … man bekommt ein Gefühl dafür, ob der, den man ins Grab lässt … wie soll ich sagen … wohlbeleibt war oder hager, ein Schwergewicht oder ein Leichtgewicht. Aber in diesem Fall war es weder das eine noch das andere.« Er zog die Nase hoch.
»Was meinen Sie damit?«
»Wie ich schon sagte. Es war … merkwürdig. Ich hatte gar kein Gefühl …«
Viel hätte nicht gefehlt, und Brodka wäre dem anderen an die Gurgel gefahren; dann aber besann er sich eines Besseren und sagte nur abfällig: »Sie sind ja verrückt, Mann! Was faseln Sie denn da?«
Der Fremde blickte Brodka nachdenklich an. »Ich bin mir ziemlich sicher, mein Herr, dass der Sarg leer war.«
Brodka wich einen Schritt zurück. Er fühlte, wie ihm das Blut in den Kopf schoss, holte tief Luft und rief: »Wie können Sie so einen Unsinn behaupten? Wie kommen Sie darauf?«
Der Fremde hob die Schultern. »Entschuldigen Sie, mein Herr. Ich hätte es für mich behalten sollen.« Dabei machte er eine ungelenke Bewegung, als wollte er sich vor Brodka verneigen; dann verschwand er in Richtung des flachen Gebäudes.
Auf dem Weg zu seinem Wagen machte Brodka sich weniger Gedanken über die Aussage des Fremden, den er für einen Spinner hielt, als über das Blumenmeer auf dem Grab seiner Mutter. Wer in aller Welt hatte zur Beerdigung gut und gerne eine Lastwagenladung Blumengestecke und Gebinde geschickt? Solange Brodka zurückdenken konnte, hatte seine Mutter allein gelebt. Gewiss, er hatte sie in den letzten Jahren kaum noch zu Gesicht bekommen, aber der Gedanke, dass sie eine Schar von Verehrern gehabt haben könnte, war so absurd, dass Brodka ein Lächeln nicht unterdrücken konnte.
Die nächsten Tage waren mit Behördengängen und dem Begleichen von Rechnungen ausgefüllt. Brodka blieb es nicht erspart, die Wohnung seiner Mutter in der Prinzregentenstraße aufzulösen – eine Aufgabe, die ihm tiefes Unbehagen bereitete. Er fühlte sich irgendwie als Eindringling, als er hinauf in den ersten Stock stieg, nachdem der Hausmeister ihm mit misstrauischem Blick die Schlüssel ausgehändigt hatte.
Brodka hasste alte Treppenhäuser wie dieses: Jugendstil, blaue Fliesen, roter Kokosläufer. Alles wirkte irgendwie beklemmend.
Das Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter war in den letzten zehn Jahren eher gespannt als harmonisch gewesen, und in dieser Zeit hatte er die Wohnung nur ein einziges Mal betreten. Jedenfalls hatte das Gespräch, das damals stattfand, Brodka dazu bewogen, seine Mutter nie mehr zu besuchen.
Er hielt einen Augenblick inne – wie jeder, dem ein schwerer Gang bevorsteht –, dann öffnete er die Wohnungstür.
Auf dem Fußboden des Flurraumes lag Post, die man durch den Briefkastenschlitz in der Tür eingeworfen hatte. Brodka suchte den Lichtschalter. Eine runde Deckenleuchte aus gefrostetem bläulichem Glas, gewiss sehr alt und kostbar, doch für seinen Geschmack ebenso scheußlich, verbreitete fahles Licht. Es roch nach Mottenkugeln und altem Vorhangstoff, ein Geruch, den Brodka nicht ausstehen konnte. Am liebsten wäre er wieder umgekehrt.
Als er die Post vom Boden aufhob, fiel sein Blick auf die gegenüberliegende Tür. Sie war nur angelehnt, und ihm war, als könne er unter dem Türspalt den warmen Schein einer Lampe erkennen.
»Ist da jemand?«, rief er und lauschte.
Nichts.
Brodka stieß vorsichtig die Tür auf, wobei er angespannt und ein bisschen ängstlich nach der Lichtquelle suchte.
Auf einem runden, niedrigen Tisch neben einem bequemen Sofa an der rechten Wand des Zimmers brannte eine kleine Lampe.
»Ist da jemand?«, rief Brodka noch einmal. Ohne eine Antwort abzuwarten, trat er an die Fenster und zog die Rollläden hoch.
Neben der Couch führte eine Tür ins Schlafzimmer. Brodka öffnete sie vorsichtig und machte Licht. Er hatte nicht erwartet, ein aufgeräumtes Zimmer vorzufinden, doch der Anblick, der sich ihm bot, jagte ihm einen Schauder über den Rücken. Das Bett war zerwühlt. Über den Boden verstreut lagen Kleidungsstücke und Medikamentenschachteln.
Brodka stürzte zum Fenster, riss beide Flügel weit auf und holte tief Luft. Von der Straße drang Verkehrslärm herauf, und die Dämmerung senkte sich über die Stadt. Angewidert verließ Brodka den Raum.
In der Tür zum Wohnzimmer blieb er stehen. Als er den Blick über die Einrichtung schweifen ließ, wurde ihm klar, wie weit er sich von seiner Mutter entfernt hatte.
Der quadratische Raum war vollgestopft mit antikem Mobiliar, jedes Stück eine Kostbarkeit für sich, doch angesichts dieser Anhäufung wirkte das Zimmer eher wie eine Abstellkammer. Die linke, der Fensterfront zugewandte Ecke wurde von einem hohen Regal eingenommen, das bis unter die Decke reichte. Davor stand über Eck ein Biedermeier-Sekretär aus Kirschholz, mit schwarzen Halbsäulen verziert. Zwischen den Fenstern sah Brodka eine Vitrine mit alten Gläsern; da sie breiter war als das Wandstück zwischen den Fensteröffnungen, ragten die Ecken der Vitrine darüber hinaus.
An der Wand gegenüber der Tür hing ein riesiges italienisches Barockgemälde: die nackte Göttin Diana auf einem von Schwänen gezogenen Wagen. Darunter ein Biedermeier-Sofa mit rosa und blaugrünen Streifen, das einzige Möbelstück, das Brodkas Gefallen fand. Links davon ein kleiner Tisch mit der brennenden Lampe, rechts eine zierliche Truhe, darauf eine Vase mit vertrockneten Rosen, davor ein großer runder Tisch und zwei Ohrensessel.
Zwischen der Tür, die zum Flur führte und einer weiteren, hinter der sich ein Abstellraum befand, stand eine barocke Kommode mit vergoldeten Beschlägen, darauf allerlei Krimskrams, Väschen und Döschen, eine uralte Bibel und zwei Fotografien in silbernen Rahmen, die Brodkas Interesse erregten.
Er trat heran und erschrak für einen Moment, als ihm aus einem venezianischen Spiegel mit bemaltem Rahmen, der über der Kommode hing, sein eigenes Gesicht entgegenblickte. Dann betrachtete er das eine Foto, das einen kleinen Jungen auf dem Arm seiner Mutter zeigte. Wenngleich Brodka das Bild nie gesehen hatte, wusste er sofort, das Baby auf dem Foto war er selbst.
Das zweite Foto kannte er bereits. Es zeigte eine vornehme ältere Frau in einem auffälligen Kostüm und einem schwarzen Hut mit breiter, geschwungener Krempe – seine Mutter, wie er sie in Erinnerung behalten hatte.
Wahllos und gleichgültig machte Brodka sich daran, Schubladen und Türen zu öffnen, als suchte er nach der Vergangenheit seiner Mutter, einer Vergangenheit, die ihm völlig fremd war. Gewiss, jeder Mensch hat seine geheime Existenz, eine Wand, hinter der er sich versteckt; aber das Leben seiner Mutter war ihm stets so rätselhaft und unergründlich geblieben wie die Funktion eines Computers.
Er hatte sich immer gefragt, woher seine Mutter das Geld gehabt hatte, ihn als Jungen auf ein teures Internat zu schicken. Später, als seine Begabung sich zeigte, hatte er die Fachhochschule für Fotografie besucht. Als er seine Mutter einmal fragte, ob die Kosten für seine Ausbildung nicht ihre Verhältnisse überstiegen, hatte sie ihm erwidert, er solle sich deswegen keine grauen Haare wachsen lassen – so hatte sie sich ausgedrückt.
Brodkas Mutter war eine Frau ohne Vergangenheit, sogar noch im Alter, wo die Vergangenheit für gewöhnlich immer größere Bedeutung erlangt.
So weit Brodka zurückdenken konnte, war seine Mutter nie einer regelmäßigen Arbeit nachgegangen. Die einzige Regelmäßigkeit in ihrem Leben waren die Kuren, die sie im Frühjahr und Herbst eines jeden Jahres antrat und mit großem Ernst absolvierte.
Als Brodka den Sekretär öffnete, dessen Vorderfront sich zu einer Schreibplatte herunterklappen ließ, fielen ihm Bündel von Papieren entgegen, Bankauszüge, Aktien, Quittungen und Belege. Brodka hatte nie daran gezweifelt, dass seine Mutter wohlhabend gewesen war; nun aber, da er die Konten und Belege in Augenschein nahm, wurde ihm klar, dass sie reich gewesen sein musste, ziemlich reich sogar.
In einer kleinen Schublade machte Brodka schließlich eine Entdeckung, die ihn mit Erschrecken und Verwunderung erfüllte: eine Walther PPK, Kaliber 7,65, und zwanzig Schuss Munition.
Während er die Waffe vorsichtig aus der Lade nahm und ebenso vorsichtig von einer Hand in die andere wechselte, brach Brodka plötzlich in lautes Gelächter aus, ja, er schüttelte sich geradezu vor Lachen, hustete laut heraus und schritt zwischen dem Sekretär und der Tür hin und her, um sich abzureagieren. Seine Mutter mit einer Pistole in der Hand!
Die Türglocke schellte.
Abrupt hielt Brodka inne, als erwachte er aus einem Traum.
Er öffnete.
Im Treppenhaus stand eine gut gekleidete ältere Dame, das dünne Blondhaar hochfrisiert.
»Sie sind gewiss der Sohn«, meinte sie ein wenig dünkelhaft und zog dabei ihre schwarz nachgezogenen Brauen hoch.
»Und wer sind Sie?«
»Mein Name ist von Veldhoven. Ich bin … ich war die Nachbarin Ihrer Frau Mutter.« Dabei wies sie mit der flachen Hand auf die Eingangstür gegenüber.
Brodka wollte der Fremden die Hand reichen, doch in seiner Rechten hielt er noch immer die Pistole. Er wechselte die Waffe in die Linke und verbarg sie hinter dem Rücken. Dann bat er die Frau in die Wohnung.
»Ich wusste, dass Claire eine Waffe hatte«, bemerkte Frau von Veldhoven und fuhr fort: »Obwohl ich sonst nicht allzu viel von ihr wusste. Ich glaube, es gab niemanden, der sie wirklich gut kannte.«
»Sie waren befreundet?«
»Befreundet? Wo denken Sie hin! Claire lebte hinter einem Schutzschild aus geheimnisvoller Zurückhaltung. Wir nannten uns beim Vornamen, aber es blieb stets beim distanzierten ›Sie‹. Ich wusste nur sehr wenig über Claire, außer dass sie einen Sohn hatte.« Dabei wies sie auf die Fotografie auf der Kommode.
»Ich glaube, sie lebte in ständiger Angst«, sagte die Nachbarin nachdenklich und blickte suchend um sich. »Es fällt schwer, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass sie tot ist.« Plötzlich schaute sie Brodka ins Gesicht. »Ich weiß, Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter war nicht gerade das Beste.«
Brodka hob die Schultern. »Ehrlich gesagt, meine Trauer hält sich in Grenzen. Ich kannte meine Mutter kaum, jeder lebte sein eigenes Leben. Sie verstand es auf unerklärliche Weise, mich auf Distanz zu halten. Ich habe den Eindruck, erst jetzt lerne ich sie besser kennen, je mehr Schubladen und Türen ich öffne.«
Frau von Veldhoven nickte. Dann fragte sie unvermittelt: »Sie wissen, wie Ihre Mutter starb?«
»In den Papieren steht Herzversagen.«
»Claire bat mich zum Tee, was selten genug vorkam. Wir saßen uns hier gegenüber. Plötzlich rang sie nach Luft und sank lautlos in ihrem Lehnstuhl zusammen. Es dauerte nur zehn Minuten, bis der Arzt eintraf … aber er kam zu spät. Ich war die Einzige an ihrem Grab.«
»Dann waren Sie es, die mich in Amerika aufgespürt hat?«
»Nein«, erwiderte Frau von Veldhoven, »das war Sache der Behörden.«
»Und die vielen Blumen am Grab?«
»Ich dachte, die wären von Ihnen.«
»Keineswegs. Als ich vom Tod meiner Mutter erfuhr, war sie schon unter der Erde.«
Brodkas Worte schienen die Besucherin zu verunsichern. Sie zog die Stirn in Falten.
»Hinzu kommt«, bemerkte sie und machte eine lange Pause, »Ihre Mutter hatte nie Besuch, aber am Tag nach ihrem Tod erschienen zwei gut gekleidete vornehme Herren und baten um Zutritt zur Wohnung.«
»Und? Haben Sie die Männer eingelassen?«
»Natürlich nicht, ich bitte Sie. Sie nannten zwar ihre Namen und beteuerten, sie seien Angehörige, aber ich hatte ja gar nicht das Recht, sie in die Wohnung Ihrer Mutter zu lassen. Ich hoffe, ich habe da nichts falsch gemacht. Wissen Sie, wer die beiden Männer gewesen sein könnten?«
Brodka hob die Schultern. »Ich habe keine Ahnung. Ich kann Ihnen nur danken, dass Sie sich so verhalten haben.«
Eine Pause entstand. Beide schauten sich im Zimmer um, als suchten sie nach einer Antwort auf all die Fragen. Als ihre Blicke sich schließlich trafen, wobei Brodka seine Verlegenheit nicht verbergen konnte, fragte er unvermittelt: »Was haben Sie gemeint, als Sie sagten, meine Mutter habe in ständiger Angst gelebt?«
»Ehrlich gesagt, kann ich Ihnen das auch nicht erklären. Es war nur so ein Gefühl. Gewiss, manche Frauen sind von Natur aus schreckhaft, aber Claires Verhalten ging weit darüber hinaus. Sie war äußerst empfindlich, misstrauisch, ich möchte sogar sagen abweisend … auch mir gegenüber. Und wenn ich sie darauf ansprach, zog sie sich in ihr Schneckenhaus zurück und erging sich in endlosem Schweigen, als wollte sie mich für meine vorlaute Frage bestrafen. Aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen.« Sie reichte Brodka die Hand und verschwand.
Die Weichheit ihrer Hand wirkte abstoßend auf Brodka. Irgendwie hatte er das Gefühl, als würden sich hinter dem gezierten Auftreten der Frau nur Berechnung und Hinterhältigkeit verbergen. Aber vielleicht lag es auch nur an der ganzen Atmosphäre.
Die Wohnung war ungeheizt, und Brodka fröstelte. Er beschloss, das Haus zu verlassen.
Draußen schlug ihm feuchte, eisige Luft entgegen.
Brodka hatte seinen Jaguar an der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt. Im dichten Verkehr überquerte er die Fahrbahn. Er zog den Autoschlüssel aus der Tasche und war gerade dabei, die Wagentür zu öffnen, als ein merkwürdiges Geräusch ihn erschreckte. Es klang wie ein Schuss, nur nicht so laut und dröhnend. Sekundenbruchteile später spürte Brodka einen heftigen Schlag an der rechten Wade.
Instinktiv fuhr er herum und blickte zur anderen Straßenseite, wo im selben Augenblick das Mündungsfeuer einer Waffe zu sehen war. Sekunden später folgte ein zweiter Lichtblitz, dann ein dritter. Mit metallischem Klingeln schlug eine Kugel in die hintere Tür seines Wagens ein.
Brodka reagierte rein instinktiv. Er riss die Fahrertür auf, ließ sich auf den Sitz fallen, presste den Kopf auf den Beifahrersitz und blieb starr vor Schreck liegen.
Wie lange er in dieser Haltung verharrte, vermochte er später nicht zu sagen. Erst ein heftiges Klopfen gegen die Scheibe holte ihn in die Wirklichkeit zurück.
»Sind Sie verletzt?«, rief eine aufgeregte Stimme durch die geschlossene Tür.
Brodka rappelte sich hoch. Draußen stand ein Polizist. Das Blaulicht eines Streifenwagens kreiselte grell.
»Sind Sie verletzt?«, wiederholte der Polizist, während er die Fahrertür öffnete.
»Nein, nein. Alles in Ordnung«, stammelte Brodka, immer noch benommen.
»Jemand hat auf Sie geschossen. Ihr Bein ist verletzt«, sagte der Polizist und half Brodka aus dem Wagen. Dann zeigte er auf dessen blutenden Unterschenkel und auf den Einschuss an der hinteren Tür: eine Beule im Blech, in deren Mitte die Kugel ein kleines schwarzes Loch gestanzt hatte.
Der Polizeibeamte musterte Brodka. »Sie hatten großes Glück. Von wo kamen die Schüsse, Herr …?«
Brodka schüttelte seine Benommenheit allmählich ab. »Brodka«, sagte er. »Alexander Brodka.« Er deutete zur anderen Straßenseite. »Die Schüsse kamen von da drüben. Aber sie haben nicht mir gegolten. Bestimmt nicht. Wer sollte die Absicht haben, mich zu erschießen? Und vor allem aus welchem Grund?«
Nachdem die Fleischwunde an der Wade von einem Notarzt behandelt worden war, wurde Brodka auf dem Polizeirevier von einem Kriminalkommissar zum Tathergang befragt. Er bezweifelte Brodkas Ansicht, durch Zufall in eine Schießerei geraten zu sein.
Der Kommissar, ein alter Fuchs in seinem Job mit grauem Kraushaar und dunklen, buschigen Brauen, lächelte säuerlich und meinte, während er mit den Fingern auf der Tischplatte trommelte: »Sie sind Fotograf und Bildreporter, Herr Brodka. In Ihrem Beruf hat man doch Feinde, oder?«
»Feinde? Mag sein. Jeder Mensch hat seine kleinen persönlichen Feindschaften und den einen oder anderen Rivalen; aber diese Rivalitäten werden doch nicht mit der Waffe ausgetragen!«
»Da haben Sie wohl recht«, erwiderte der Kommissar. »Aber bei den Schüssen ging es nicht um irgendwelche Rivalitäten. Wir müssen davon ausgehen, dass sie Ihnen galten. Aber Sie sollten nicht ernsthaft verletzt oder gar getötet werden. Der Täter war kein Killer. Er hat auf die Beine gezielt. Er wollte Sie warnen, Ihnen einen Denkzettel verpassen, was weiß ich. Wissen Sie, wer so vorgeht?«
»Wer?«
»Die Mafia.«
Im ersten Augenblick erschrak Brodka; dann aber löste sich die Spannung in seinem Inneren, und er musste lachen. »Ich glaube, da überschätzen Sie meine Bedeutung, Herr Kommissar. Ich bin weder so reich, dass diese Herrschaften sich für mich interessieren könnten, noch deale ich mit Heroin, Kokain oder dergleichen. Alles was ich besitze, habe ich mit ehrlicher Arbeit verdient. Was sollten diese Leute also von mir …«
»Sie halten sich doch viel im Ausland auf«, unterbrach ihn der Kommissar.
»Ja, sicher. Aber ist das ein Grund, von der Mafia verfolgt zu werden?«
»Das allein gewiss nicht«, entgegnete der Kommissar. »Aber es wäre denkbar, dass Ihr Weg sich mehrmals mit denen der ehrenwerten Gesellschaft gekreuzt hat … zufällig oder nicht. Und das mögen diese Leute gar nicht gern, wissen Sie.«
Brodka schaute den Kommissar lange und durchdringend an. Er fühlte das Misstrauen, das dieser ihm gegenüber an den Tag legte, und es machte ihn wütend. Verdammt, warum glaubte der Mann ihm nicht? War es an ihm, sich zu rechtfertigen, weil irgendjemand auf ihn geschossen hatte?
Die mysteriösen Umstände des Todes seiner Mutter waren mit einem Mal vergessen, zumal Brodka weit davon entfernt war, sie auf irgendeine Weise mit den Schüssen in Verbindung zu bringen. Er wusste, dass es Tage gibt, da es den Anschein hat, als wollten sämtliche Widrigkeiten des Lebens auf einmal über einen hereinbrechen. Und obwohl er alles andere als ängstlich war, hatten die Schüsse ihm doch einen gehörigen Schrecken eingejagt.
Wieder zu Hause, sperrte Brodka entgegen seiner sonstigen Gewohnheit die Tür hinter sich zu. Er ging ins Badezimmer und spritzte sich unter dem laufenden Hahn kaltes Wasser ins Gesicht. Seine verbundene rechte Wade schmerzte; das Hosenbein war von der Kugel zerfetzt.
Geistesabwesend hörte er den Anrufbeantworter ab. Allerlei Unwichtigkeiten. Er wandte sich vom Gerät ab, wollte sich in einen Sessel fallen lassen …
… und fuhr plötzlich herum, spulte den Anrufbeantworter zurück. Eine Stimme mit rollendem R und fremdem Akzent: »Hören Sie auf, das Leben Ihrer Mutter auszuforschen. Das ist eine ernste Warnung!«
Brodka drückte erneut auf »Repeat«, und die Stimme wiederholte ihre Drohung.
Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte Alexander Brodka wirklich Angst.
KAPITEL 2
Sie hatten sich in der Bar des Hotels Waldorf Astoria in New York kennengelernt, die eine Frau auch ohne männliche Begleitung besuchen konnte, ohne anrüchig zu wirken, und wo der Barmann mit schöner Regelmäßigkeit frisch geröstete Nüsse auf die Tische stellt, während der Pianist »As Time Goes By« spielt. Brodka hatte eine unbrauchbare Fotoreportage über den Modeschöpfer Sam Suller hinter sich – ein ziemliches Ekel, wie sich herausgestellt hatte –, und Juliette Collin hatte bei einer Impressionisten-Auktion bei Christie’s in der Park Avenue den erfolglosen Versuch unternommen, für ihre Galerie in München drei Grafiken von Marc, Heckel und Kandinsky zu ersteigern. Niederlagen verbinden, und so hatten sich beide damals ihr Leid geklagt. Man kam sich näher, und die Tatsache, dass sie beide aus derselben Stadt kamen, half dabei ein wenig – immerhin so viel, dass sie die Nacht gemeinsam verbrachten.
Es wäre verkehrt gewesen, Juliette Collin deshalb für leichtfertig oder gar liederlich zu halten, und auch Brodka war keineswegs der Typ, der, was Frauen betraf, jede Gelegenheit nutzte, die sich ihm bot. Nein, diese Begegnung im September vor drei Jahren hatte beide mit der Wucht eines Sinnenrausches getroffen, wie weder Brodka noch Juliette dies zuvor erlebt hatten.
Gewiss, Juliette war verheiratet. Ihr Mann, Professor Hinrich Collin, besaß einen hervorragenden Ruf als Chirurg; aber nur seine nächste Umgebung wusste davon, dass er vor jeder Operation eine halbe Flasche Cognac konsumierte. Ohne Alkohol lief bei ihm gar nichts, wenngleich er mit fünfundvierzig Jahren seine Potenz versoffen und seine Liebesfähigkeit verspielt hatte. Was Wunder, dass Juliette darunter litt. Sie fühlte sich vernachlässigt, frustriert, und nur ihre gesellschaftliche Stellung hatte sie bis dahin davon abgehalten, sich einen Liebhaber zu nehmen.
Zum damaligen Zeitpunkt war Brodka bereits seit mehr als zehn Jahren geschieden. Es war keine Scheidung aus Hass oder Überdruss gewesen. Brodka und seine Frau hatten schlichtweg eingesehen, dass sie nicht zueinandergepasst hatten. So hatten sie sich nach drei Jahren getrennt, ohne Streit, ohne Zorn und ohne dem anderen wehzutun – und mit der Erkenntnis, dass eine Stierfrau nicht zu einem Steinbock passt.
Nicht mehr, aber auch nicht weniger wussten Brodka und Juliette voneinander, nachdem sie ihre erste gemeinsame Nacht verbracht hatten. Sie waren beide alt genug, davon auszugehen, dass sich keine feste, ernsthafte Beziehung daraus entwickeln würde, doch beide hatten sich getäuscht. Brodka liebte Juliette noch immer so sehr wie vor drei Jahren – eine Liebe, die sie mit der gleichen Intensität erwiderte.
Juliette war ein kleines, energiegeladenes Persönchen mit braunen Augen und schwarzem Haar, das sie meist streng nach hinten gekämmt und im Nacken geknotet trug. Wie alle Schwarzhaarigen besaß sie eine dunkle Haut. Früher hatte sie darunter gelitten, dass sie von der Natur nur mit ein Meter sechzig Körpergröße gesegnet worden war, und sie hatte stets hohe Absätze getragen, was ihrem Typ sehr entgegenkam, doch seit Brodka ihre 160 Zentimeter als die schönsten der Welt bezeichnet und erklärt hatte, jeder Zentimeter mehr würde nur die Harmonie des Ganzen stören, hatte ihre Kleinheit sich in pures Selbstbewusstsein gewandelt, und Juliette trug ihr Aussehen mit jenem gewissen Stolz zur Schau, der Frauen so anziehend macht.
Ihre Galerie in bester Lage der Stadt lief gut, besser als die meisten anderen Kunsthandlungen in der Gegend, die nach Abzug der horrenden Mieten kaum Gewinn abwarfen. Juliette hatte Kunstwissenschaft und Deutsch für das Lehramt studiert, ihre Pläne aber nach sechs Semestern aufgegeben, weil Hinrich Collin ihr einen Heiratsantrag machte. Sie legte unerwartetes kaufmännisches Geschick an den Tag, als sie ihre neue Karriere begann, indem sie den zehnjährigen Mietvertrag einer in Konkurs gegangenen Boutique übernahm und einem Schulfreund die Expressionisten-Sammlung seines verstorbenen Vaters abschwatzte. Der Sohn hatte kein Interesse an den Gouachen von Klee, Munch, Feininger und Nolde und verkaufte sie für eine halbe Million, die Juliette über einen Kredit finanzierte, welchen sie bei der Bank ihres Mannes aufnahm, der die erforderlichen Sicherheiten bieten konnte. Nach einem halben Jahr hatte sie bereits die Hälfte der Bilder verkauft – mit den üblichen 100 Prozent Aufschlag, versteht sich – und damit einen Großteil ihrer Schulden getilgt. Seither galt die Galerie Collin unter Sammlern von Impressionisten und Expressionisten als erste Adresse.
Professor Collin stand den Aktivitäten seiner Frau von Anfang an mit Argwohn gegenüber, und je mehr Erfolg Juliette für sich buchte, desto misstrauischer wurde ihr Mann; ja, seine anfängliche Eifersucht steigerte sich bisweilen zur Bösartigkeit, und er ließ keine Gelegenheit aus, sie zu kränken, beispielsweise, indem er ihre Galerie als Dorado für Müßiggänger bezeichnete oder – schlimmer noch – als Tante-Emma-Laden für infantile Kritzeleien.
Von ihrem Verhältnis mit Brodka ahnte Collin nichts, da war Juliette sich ziemlich sicher – jedenfalls bis zu jenem Tag Anfang Dezember, als sie in ihrer Galerie eine Vernissage veranstaltete. Sie hatte eine Sammlung von Kubin-Zeichnungen erworben und präsentierte sie einem ausgewählten Publikum.
Brodkas Anwesenheit würde nicht weiter auffallen, auch wenn er – wie er sich selbst eingestehen musste – von expressionistischer Kunst wenig Ahnung hatte; aber diese Ahnungslosigkeit teilte er mit manch anderem der Anwesenden, denen Kunst nur als Vorwand für ein gesellschaftliches Ereignis diente oder als Demonstration vermeintlicher Bildung.
Juliette wusste inzwischen vom Tod der Mutter Brodkas und auch, dass sein Schmerz sich in Grenzen hielt, wenngleich der Tod in nächster Umgebung stets dazu geeignet ist, einen Menschen aus der Bahn zu werfen – selbst wenn Liebe und Zuneigung zu Lebzeiten des Verstorbenen nicht allzu groß waren.
Die mysteriösen Umstände jedoch, die mit dem Tod seiner Mutter verknüpft waren, hatte Brodka seiner Geliebten bisher verschwiegen. Er wollte sie nicht beunruhigen, solange er selbst keine Erklärung für all die Ungereimtheiten fand.
Als Brodka die Galerie betrat, in der sich mehr als hundert Menschen drängten, löste Juliette sich lächelnd aus einer Menschentraube. Sie trug einen schwarzen Hosenanzug mit Nadelstreifen und schwarze Stilettos, die Brodka so sehr an ihr liebte. Juliette trat auf ihn zu und küsste ihn länger auf den Mund, als schicklich war, was aber in keiner Weise Aufsehen erregte, weil das Küssen und andere Berührungen in diesen Kreisen zu den alltäglichen Umgangsformen gehörten wie andernorts das Händeschütteln.
»Was ist mit dir? Du humpelst ja«, sagte Juliette und wies auf Brodkas rechtes Bein.
Der machte eine beschwichtigende Handbewegung. »Nichts weiter. Kaum der Rede wert.«
Juliette hakte Brodka unter und führte ihn in eine Ecke, wo es ruhiger war, und wiederholte ihre Frage: »Was ist? Bist du verletzt? Warum sagst du nicht, was los ist?«
Brodka kannte Juliettes Beharrlichkeit. Er wusste, dass es unmöglich war, ihr etwas zu verheimlichen, an dessen Aufklärung sie interessiert war. Deshalb rang er sich zu einer Erklärung durch: »Mach dir keine Sorgen, Juliette, es wird sich alles aufklären … als Irrtum erweisen. Man … man hat auf mich geschossen.«
»Wer?«, rief Juliette entsetzt. »Was ist passiert?«
Brodka fasste Juliette an den Oberarmen. »Bitte, mach kein Aufsehen. Es ist ja nichts geschehen. Bloß eine Schramme, nichts weiter. Ich bin ganz sicher, dass ich durch Zufall in eine Situation geraten bin, die …«
»Zufall?« Juliette lachte schrill. »Du wirst von einer Kugel getroffen und redest von Zufall!«
»Aber wer sollte auf mich schießen?«
»Was weiß ich! Wieso haben die Zeitungen nichts davon gebracht?«
»Weil ich darauf bestanden habe.«
»Wo ist es passiert?«
»Vor dem Haus meiner Mutter. Ich habe mich in meinen Wagen in Deckung geworfen.«
Juliette blickte Brodka prüfend an. »Und was hat die Polizei unternommen?«
»Die Ermittlungen laufen. Aber der oder die Täter sind im dichten Verkehr untergetaucht. Weiß der Teufel, auf wen die Kerle geschossen haben.« Er zögerte, fügte dann hinzu: »Der Kommissar, der das Protokoll aufnahm, meinte allerdings, es hätte sich um einen gezielten Anschlag gehandelt, um mich zu warnen.«
»Mein Gott!« Juliette presste beide Hände vor den Mund. »Dich zu warnen? Wovor? Du verschweigst mir etwas, nicht wahr?«
Brodka senkte den Kopf wie ein Junge, der beim Lügen ertappt wurde. »Ich wollte dich nicht beunruhigen, Liebes, glaub mir. Ich weiß selbst nicht, in was ich da plötzlich geraten bin. Als ich nach Hause kam und den Anrufbeantworter abhörte, sagte eine fremde Stimme, ich solle aufhören, das Leben meiner Mutter auszuforschen, das sei eine ernste Warnung.«
An Juliettes zittrigen Bewegungen erkannte Brodka, wie aufgeregt sie war. Immer wieder schüttelte sie den Kopf. Brodka bemerkte, dass ihr Gespräch bereits Aufmerksamkeit erregte; deshalb versuchte er Juliette zu beruhigen und meinte mit betont ruhiger Stimme: »Ich weiß wirklich nicht, um was es dabei geht. Die ganze Geschichte ist so … widersinnig. Aber glaub mir, es wird sich alles als Irrtum erweisen. Jedenfalls kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass meine Mutter mit der Mafia oder sonst irgendwelchen Verbrechern in Verbindung stand.«
Er lachte, doch Juliettes Miene blieb ernst und besorgt.
»Du solltest dich um deine Kunstliebhaber kümmern«, sagte Brodka.
Sie zögerte, ging dann aber zurück zu ihren Gästen.
Die Zeichnungen, vor denen sich die Besucher drängten, riefen bei manchen Laute des Entzückens hervor. Brodka, eher der Harmonie und dem Schönen zugetan, vermochte die Begeisterung nicht zu teilen. Ihm gefielen eher Macke mit seinen fröhlichen Figurinen oder Nolde mit seinem leuchtenden Blau und Rot. Kubin erschien ihm zu trist, gequält und mystisch.
So wandte er sich der Beobachtung der kunstbeflissenen Gäste zu, die allesamt piekfein gekleidet waren und sich einer höchst intellektuellen Sprechweise bedienten.
In der Luft hing der gewohnte Geruch einer Vernissage, jene Mischung aus Zigarettenrauch, Parfüm und Rotwein, die geeignet ist, einem normalen Menschen den Kopf zu verwirren – von den mehr oder weniger fachkundigen Gesprächen ganz zu schweigen. Es war eine Atmosphäre, in der Brodka sich unwohl fühlte.
Er hoffte auf einen raschen Abgang der Kunstliebhaber, damit er den Abend mit Juliette verbringen konnte.
Ein Glas Orangensaft in der Hand, drängte Brodka sich durch die Reihen der Besucher zu Juliette, die sich auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes befand, in ein Gespräch mit einem älteren Herrn vertieft. Doch plötzlich hielt Brodka inne. Aus den Wortfetzen, die an sein Ohr drangen, glaubte er eine männliche Stimme herauszuhören, die ihn erschauern ließ. Er wagte nicht, sich umzudrehen und den Mann zu betrachten, der mit schwerem ausländischem Akzent sprach und der das R rollte, als würde seine Zungenspitze flattern.
Es war die drohende Stimme, die Brodka auf dem Anrufbeantworter gehört hatte.
Mit aller Kraft versuchte er sich zu konzentrieren und diese Stimme aus dem allgemeinen Lachen, Plaudern und Diskutieren herauszufiltern.
Kein Zweifel. Er war sich ganz sicher. Es war dieselbe Stimme.
Während Brodka noch überlegte, wie er der Situation begegnen sollte, kam Juliette, die ihn in der Menge ausgemacht hatte, auf ihn zu, nahm ihn bei der Hand und führte ihn energisch beiseite.
Brodka widersetzte sich, zog die Hand zurück, wollte Juliette erklären, was er soeben bemerkt hatte, doch sie schien so aufgeregt zu sein wie er. Eilig zog sie ihn in die andere Richtung. »Komm mit!«, zischte sie ihm zu. »Bitte!« In einer Ecke blieb sie stehen; es schien, als wollte sie sich hinter ihm verstecken. Brodka sah, wie ihre Augen funkelten.
Sie wirkte wütend und verängstigt zugleich. Noch nie hatte er diesen Gesichtsausdruck bei ihr gesehen. Juliette, einen Kopf kleiner als er, blickte zu ihm auf und sagte in verzweifeltem Tonfall: »Mein Mann ist hier. Er ist völlig betrunken, kann kaum noch stehen. Was soll ich bloß tun?« Sie presste die Hände vor den Mund.
Brodka, der sich immer noch über die Männerstimme den Kopf zerbrach, fragte geistesabwesend: »Wo ist er?«
Juliette schluckte und holte tief Luft. »Da drüben. Wie ich den Kerl hasse. Ich könnte ihn umbringen!«
Brodka warf einen verstohlenen Blick zur gegenüberliegenden Seite des Raumes. Er hatte den Professor noch nie gesehen, nicht einmal ein Foto von ihm; dabei wusste er fast alles über diesen Mann. Und jetzt, wo er ihn zum ersten Mal sah, überkamen ihn keine Hassgefühle, wie er es eigentlich erwartet hatte; stattdessen empfand er Mitleid mit dieser Jammergestalt, die wankend und mit stumpfem Blick dastand, so verloren und einsam, als gäbe es die Menschen um ihn herum gar nicht.
Professor Collin war ein kleiner Mann mit Stirnglatze, nicht viel größer als Juliette, und unscheinbar. Wer ihn nicht kannte, hätte ihn für einen Beamten bei irgendeiner Behörde halten können. Er trug einen grauen Anzug, der bestimmt teuer gewesen war; dennoch wirkte er schlampig, ja heruntergekommen. Seine Krawatte hing eine Handbreit unter dem Hals. Nur seine Brille mit Goldrand verlieh ihm etwas Professorenhaftes.
Während er Collin beiläufig musterte, hatte Brodka noch immer die Stimme im Ohr, diese fremde drohende Stimme, und er überlegte, ob er Juliette davon erzählen sollte. Aber noch während er darüber nachdachte, kamen ihm Zweifel, und er fragte sich, ob er sich das alles nicht nur einbildete, ob ihm seine Sinne nach den Anspannungen der letzten Tage nicht bloß einen Streich spielten. Vielleicht sah er Gespenster. Mein Gott, was war los mit ihm?
Juliettes Stimme holte Brodka in die Wirklichkeit zurück. »Wenn Hinrich hier aufkreuzt, hat das nichts Gutes zu bedeuten. Er ist noch nie zu einer Vernissage gekommen. Herrgott, was soll ich tun? Ich kann ihn doch nicht rausschmeißen! Aber ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Es wird nicht lange dauern, und er wird randalieren wie ein besoffener Penner. Mein Gott, es sind Leute aus der Münchner Gesellschaft hier – und welche von der Presse. Wenn er so weitermacht, ruiniert er sich selbst und seine Klinik – und mich dazu!«
Noch während sie redete, begann Collin die Gäste bereits mit lallenden Worten zu beschimpfen. Juliette trat auf ihren Mann zu und redete besänftigend auf ihn ein. Gleichzeitig versuchte sie, den Betrunkenen in den hinteren Büroraum zu drängen.
Brodka beobachtete die Szene zunächst aus einiger Entfernung, doch als Collin sich immer ungestümer wehrte, wild mit den Armen wedelte und schließlich auf Juliette einzuschlagen drohte, kam er ihr zu Hilfe, packte den schwankenden Mann am Arm und zerrte ihn gemeinsam mit Juliette in den hinteren Raum.
Dort wankte Collin zu einem Sessel und ließ sich erschöpft hineinfallen. Sein Kopf sank zur Seite; sein Körper wurde schlaff. Er gab noch ein paar unverständliche Laute von sich und schlief schließlich ein, wobei er schnarchend durch den weit geöffneten Mund atmete.
Kurz vor Mitternacht, als die letzten Besucher gegangen waren, hoben Brodka und Juliette den immer noch laut schnarchenden Mann auf den Rücksitz ihres Wagens. Juliette wollte nicht, dass Brodka sie begleitete, doch der bestand darauf. »Dein Mann ist volltrunken«, sagte er. »Ich fahre mit dir. Außerdem … wie willst du ihn allein ins Haus bringen?«
Die Fahrt nach Bogenhausen, im Osten der Stadt, wo Collin und seine Frau eine luxuriöse Villa bewohnten, verlief ziemlich schweigsam. Brodka saß am Steuer. Immer wieder warf er einen Blick in den Innenspiegel, hielt den Betrunkenen im Auge, der ab und zu ein Grunzen von sich gab. Nach einer Weile sagte Juliette mit gedämpfter Stimme: »Jetzt hast du ihn kennengelernt. Jetzt weißt du, mit wem ich seit fünfzehn Jahren zusammenlebe.«
Brodka legte den Zeigefinger auf den Mund zum Zeichen, dass sie lieber schweigen solle.
»Ach was«, erklärte Juliette. »Der ist vor morgen früh nicht ansprechbar.«
»Und morgen früh?«
»Nimmt er einen kräftigen Schluck aus der Pulle und ist wieder völlig klar. Für ihn ist das normal.«
»Normal?« Brodka schüttelte den Kopf.
»Er ist Alkoholiker, kein gewöhnlicher Säufer, der ab und zu einen über den Durst trinkt und einen heiligen Eid schwört, das Saufen sein zu lassen, wenn ihm hundeelend ist. Nein, dieser Versager« – dabei zeigte sie mit dem Daumen auf den Rücksitz – »ist süchtig. Ohne seinen Stoff kann er gar nicht mehr leben.«
»Und seine Arbeit?«
»Als Arzt hat er einen hervorragenden Ruf. Viele Chirurgen hängen an der Mineralwasserflasche.«
»An der Mineralwasserflasche?«
»Ja, sie haben ständig eine mit Schnaps gefüllte Mineralwasserflasche bei sich.«
Brodka lachte auf. »Und ich dachte, Journalisten sind die größten Trinker vor dem Herrn.«
»Das kann ich nicht beurteilen«, antwortete Juliette, »aber es stellt sich natürlich die Frage, wer dabei mehr Schaden anrichten kann.«
Sie dirigierte Brodka von der Hauptstraße in einen schmalen, von dürren Hecken gesäumten Weg zu einer Einfahrt. Wie von Geisterhand öffnete sich ein halbhohes, braunes Holztor, und automatisch schaltete sich die Hausbeleuchtung ein. Vor der grünen Eingangstür, die mit Messingbeschlägen verziert war, hielt Brodka den Wagen an.
Während Juliette die Tür aufschloss, fasste Brodka den Professor unter den Armen und zog ihn aus dem Wagen. Noch bevor Juliette ihm zu Hilfe eilen konnte, schleifte er den Besinnungslosen ins Haus und wuchtete ihn auf eine Couch in der Wohnhalle.
Dabei erwachte Collin kurz aus seiner Bewusstlosigkeit.
Über den Goldrand seiner Brille warf er Brodka einen spöttischen Blick zu, wobei er ein paar unverständliche Worte lallte, die sich anhörten wie: »Gut gemacht, mein Junge.«
Dann fiel er wieder in tiefen, alkoholseligen Schlaf.
Juliette nahm ihrem Mann die Brille ab und zog ihm die Schuhe aus, kümmerte sich ansonsten aber nicht weiter um sein Wohlbefinden. Für sie war eine derartige Situation nicht neu.
»Ich mache uns einen Kaffee«, sagte sie und ging rechter Hand durch eine Rundbogentür in die Küche.
Aus der Entfernung beobachtete Brodka, wie Juliette die Kaffeemaschine bediente; dann schaute er sich in der Wohnhalle um, die halbkreisförmig angelegt war. In der Mitte des Bogens befanden sich zwei Flügeltüren, die nach draußen führten. Zu beiden Seiten reichten Bücherschränke bis zur Decke, und in der Mitte machte sich eine wuchtige Sitzgarnitur breit. Wo noch Platz war, standen kleine Tischchen mit allerlei Krimskrams darauf. Von einem eher konventionellen Ölgemälde mit einem Porträt des Professors abgesehen gab es keinerlei Bilder, was Brodka seltsam vorkam.
»Komm, du kannst mir helfen«, rief Juliette aus der Küche.
Brodka warf noch einen Blick auf den Betrunkenen; dann ging er zu Juliette.
Kaum hatte er die Tür geschlossen, fiel sie ihm um den Hals und küsste ihn ungestüm.
Brodka war die Situation unangenehm, ja peinlich. Er versuchte, sich mit sanfter Gewalt von Juliette zu befreien, doch sie ließ es nicht zu; je mehr Brodka sich sträubte, desto heftiger, leidenschaftlicher klammerte sie sich an ihn und schlang die Beine um seine Schenkel.
»Du … bist verrückt«, stammelte Brodka. Oh, es gefiel ihm, was sie tat; er genoss ihre Berührungen. Er liebte Juliette gerade wegen ihrer Wildheit, Triebhaftigkeit und Hemmungslosigkeit, die sie bisweilen alles um sich herum vergessen ließ, doch hier und jetzt schien ihm ihr Verhalten ordinär – und zu riskant. »Wenn dein Mann aufwacht …«, murmelte er.
»Unsinn«, raunte Juliette heiser und fingerte nach Brodkas Hosenschlitz.
Brodka hielt ihre tastende, streichelnde Hand fest. »Hör auf, Juliette. Nicht hier, verdammt!«
»Warum nicht? Die meisten Ehen werden auf dem Küchentisch gebrochen.«
»Woher hast du das denn?«
»Hab ich gelesen.«
»Aber wir haben deine Ehe schon an angenehmeren Orten gebrochen, oder?«
»Das braucht uns doch nicht zu hindern …«
»Stimmt, aber ich finde es nicht so angenehm, wenn dein Mann betrunken im Nebenzimmer liegt. Warum willst du das nicht einsehen?«
Von einem Augenblick auf den anderen ließ Juliette von Brodka ab; schmollend wandte sie sich der Kaffeemaschine zu. »Du liebst mich nicht«, sagte sie, ohne sich umzudrehen.
Brodka schmunzelte. Er kannte sie nur zu gut und wusste, dass sie nun zurückerobert werden wollte. Seit ihrer ersten Begegnung vor drei Jahren, als ihre Leidenschaft Feuer gefangen hatte, gab es ein ständiges Hin und Her zwischen ihnen. Jeder lebte sein Leben, und jeder war davon überzeugt, dass der andere genau der Partner war, den er brauchte.
Brodka kannte Juliette vermutlich besser als ihr eigener Mann, vor allem was ihre heimlichen Gedanken und Wünsche betraf, und so wusste er natürlich, was sie jetzt, in dieser Situation, von ihm erwartete.
Deshalb warf er all seine Bedenken und Vorsicht über Bord, trat von hinten an sie heran und umfasste ihre Brüste.
Juliette stöhnte leise auf und warf den Kopf in den Nacken, während Brodka sich wollüstig an ihrem Po rieb. »Spürst du, wie sehr ich dich liebe?«, fragte er leise und herausfordernd, und Juliette antwortete mit einem langen, genießerischen »Jaaa«, gab sich ganz dem herrlich schamlosen Treiben hin.
Dann, mit einem Mal, löste sie sich von ihm.
»Brodka …«
Am Klang ihrer Stimme erkannte er sofort, dass sie etwas Bedeutungsvolles sagen wollte. Sie nannte ihn nie beim Vornamen; das war nicht nötig. Wie sie mit ihrer weichen Stimme seinen Familiennamen modulierte, genügte vollauf, um jede Empfindung zu artikulieren: Zärtlichkeit und Begierde, Zorn und Enttäuschung, Heiterkeit und Ernst.
»Brodka«, wiederholte Juliette, drehte sich um und schaute ihm in die Augen. Dann, nach einer winzigen Pause, fragte sie leise, beinahe flüsternd, aber mit fester Stimme: »Willst du mich heiraten?«
War die Situation schon ungewöhnlich genug – wie auch die Tatsache, dass nicht er sie mit dem Ansinnen überraschte, sondern sie ihn –, ließen die Umstände alles geradezu absurd erscheinen.
»Liebes«, meinte Brodka beinahe hilflos, »du scheinst vergessen zu haben, du bist verheiratet.«
»Noch«, erwiderte Juliette. Sie hatte keine andere Reaktion erwartet, und ihre Stimme wurde heftiger: »Glaubst du, ich will mein ganzes Leben so verbringen? Immer nur Heimlichkeiten? Du reist mit den hübschesten Mädchen der Welt zu den schönsten Flecken der Erde. Soll ich warten, bis du dich in eine andere verliebst?«
Brodka wich ihrem Blick aus, schaute betroffen zur Seite.
Er verstand sie nur zu gut. Und wenn er ehrlich zu sich selbst war – bisher hatte er alle Gedanken an eine gemeinsame Zukunft verdrängt. Was sollte er tun? Seine Leidenschaft für Juliette war so überwältigend, dass er sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen konnte; aber sie zu heiraten und als biederer Ehemann in einem Häuschen mit Garten zu wohnen erschien ihm ebenso unvorstellbar. War es nicht gerade der Reiz des Heimlichen, Verbotenen, der für sie beide so anziehend war, so erregend?
Wortlos reichte Juliette ihm eine Tasse Kaffee.
Brodka trank einen Schluck, stellte die Tasse zur Seite und meinte: »Lass uns ein andermal darüber reden. Bitte, Juliette.« Er trat auf sie zu, fasste sie an den Armen und küsste sie.
Sie ließ es teilnahmslos über sich ergehen, hielt den Blick gesenkt und schwieg.
»Rufst du mir ein Taxi?«, fragte Brodka.
Immer noch schweigend ging Juliette aus dem Zimmer.
Brodka hörte sie telefonieren.
Der volltrunkene Professor lag noch immer in tiefem Schlaf, als Brodka aus der Küche trat.
»Lass uns ein andermal darüber reden«, wiederholte er.
Juliette setzte ein gequältes Lächeln auf und nickte.
Er bemerkte ihre Traurigkeit und wusste, dass es in dieser Situation das Beste war, keine weiteren Worte zu verlieren.
»Ja?«, sagte er hilflos.
»Ja«, antwortete Juliette.
Brodka verließ das Haus.
Am nächsten Tag meldete Juliette sich am Telefon. Ihre Niedergeschlagenheit vom Vortag war hörbarer Aufgeregtheit gewichen.
»Brodka!«, rief sie in den Hörer. »Wir sind in eine ganz unmögliche Situation geraten!«
Es gelang ihm nur mit Mühe, Juliette zu beruhigen. Schließlich erfuhr er, dass Collin, als er am Morgen aus seinem alkoholseligen Schlaf erwachte, gefragt hatte, wer der freundliche junge Mann gewesen sei, der ihn nach Hause gebracht hatte.
»Und was hast du gesagt?«
»Ich hab ihm deinen Namen genannt. Und gesagt, dass du ein Sammler bist. Ein Kunde, den ich gut kenne. Und dass ich mich bei dir schon für deine Hilfe bedankt hätte.«
»Gut gemacht, Liebes«, erwiderte Brodka.
»Das dachte ich auch!«, erregte sich Juliette. »Ich konnte ja nicht ahnen, wie Hinrich reagieren würde.«
»Was meinst du damit?«
»Er ließ es sich nicht ausreden, dich zu uns einzuladen. Zum Abendessen.«
Eine lange Pause entstand. Brodka war sprachlos.
Schließlich fuhr Juliette fort: »Ich habe mit Engelszungen versucht, ihm diese Idee auszureden. Aber er lässt sich nicht davon abbringen. Er meint, er müsse sich unbedingt auf diese Weise bei dir persönlich bedanken.«
»Das … das ist doch unmöglich!«, rief Brodka entsetzt.
»Natürlich ist es unmöglich. Aber hast du eine Idee, wie wir aus dieser Sache rauskommen?«
Wieder entstand eine lange Pause. Schließlich sagte Juliette: »Siehst du? Ich fürchte, es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen gute Miene zum bösen Spiel machen.« Sie lachte bitter.
»Wann?«, fragte Brodka und holte tief Luft.
»Am besten gleich morgen Abend«, erwiderte Juliette und fügte mit bitterem Humor hinzu: »Wenn es dir recht ist.«
Von der Polizei erfuhr Brodka an diesem Tag, dass die Projektile, die der unbekannte Schütze vor dem Haus seiner Mutter abgefeuert hatte, vom Kaliber 7,65 mm waren und dass es sich bei der Waffe mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Walther PPK handelte – eine Pistole, die kaum einen Schluss auf den oder die Täter zuließe. Eine solche Waffe sei in München zuletzt bei einem Kapitalverbrechen vor drei Jahren benutzt worden. Der Fall sei jedoch geklärt, die Waffe sichergestellt; ein Zusammenhang mit dem damaligen Verbrechen sei daher auszuschließen. Man wolle ihn weiter auf dem Stand der Ermittlungen halten. Ob er irgendwelche neue Beobachtungen gemacht habe oder sich verfolgt fühle?
Nein, beeilte Brodka sich zu antworten, dann legte er auf.
In Wahrheit hatte das Ausmaß seiner Psychose – als solche betrachtete Brodka seinen Zustand mittlerweile – ein Stadium erreicht, in dem er selbst nicht mehr zu erklären vermochte, was um ihn herum vorging. Das Blumenmeer auf dem Grab seiner Mutter. Die rätselhaften Andeutungen des Mannes auf dem Friedhof, der Sarg seiner Mutter sei leer gewesen. Die seltsamen Äußerungen der Nachbarin. Die Stimme auf dem Anrufbeantworter, die er in Juliettes Galerie wieder zu hören geglaubt hatte. Die Schüsse, die nach Meinung der Polizei tatsächlich ihm, Brodka, als Warnung zugedacht gewesen waren. Es war ein verrücktes, unentwirrbares Knäuel. Brodka neigte inzwischen sogar dazu, die unerwartete Begegnung mit Professor Collin und die unwillkommene Einladung zum Abendessen mit den mysteriösen Umständen des Todes seiner Mutter in Zusammenhang zu bringen. Doch er verwarf diesen Gedanken rasch wieder. Es war verrückt. Das alles war verrückt. Er war fast so weit, an seinem Verstand zu zweifeln.
Zumindest was die fremde Stimme betraf, die ihn bei der Vernissage beinahe aus der Fassung gebracht hätte, hatte er sich bestimmt getäuscht. Er war überdreht gewesen. Kein Wunder bei all der Aufregung, die er in den letzten Tagen hatte durchmachen müssen.
Oder? Kaum hatte Brodka sich mit dem Gedanken angefreundet, überkamen ihn neuerliche Zweifel. Die Stimme war zu markant, um sie nicht aus Hunderten heraushören zu können. Er schaltete den Anrufbeantworter ein, um sich noch einmal zu vergewissern. Das Gerät gab mehrere Pieptöne von sich; dann folgte nur noch Rauschen.
Brodka stutzte, versuchte es erneut – mit dem gleichen Ergebnis. Wütend begann er an dem Gerät herumzuschalten, doch so sehr er sich auch mühte, es war nur ein Zischen und Rauschen zu hören.
»Das gibt’s doch gar nicht!«, rief er zornentbrannt und drosch mit der flachen Hand auf das Gerät. Das Band war von Anfang bis Ende gelöscht, und er hatte nicht die leiseste Ahnung, wie das geschehen sein konnte. Er selbst war es jedenfalls nicht gewesen.
Wer dann?
Noch einer dieser seltsamen »Zufälle«? Furcht stieg in Brodka auf. Er fühlte sich beobachtet. Irgendjemand musste bei ihm eingebrochen sein und das Band gelöscht haben.
Brodka ging zur Tür, betrachtete das Schloss von beiden Seiten, konnte aber keine Spuren entdecken, die auf einen Einbruch schließen ließen. Hastig begann er seine Wohnung zu durchsuchen, um festzustellen, ob irgendetwas fehlte oder verstellt war oder ob es irgendeinen anderen Hinweis auf einen ungebetenen Besucher gab. Als er keine Anhaltspunkte dafür fand, durchwühlte er Schubladen und Schränke, fluchend, verzweifelt, von Furcht und hilfloser Wut angetrieben.
Minutenlang wütete er wie von Sinnen. Als er erschöpft innehielt und sah, was er in seinen eigenen vier Wänden angerichtet hatte, ließ er sich auf einen Stuhl fallen, stützte die Ellbogen auf die Knie und verbarg das Gesicht in den Händen.