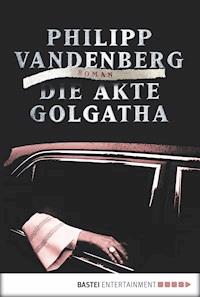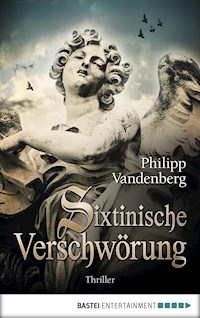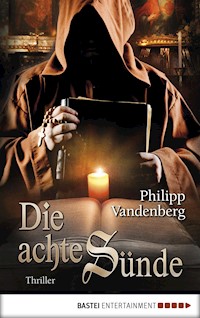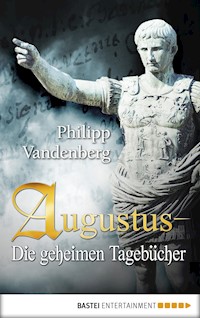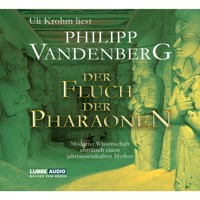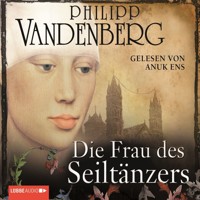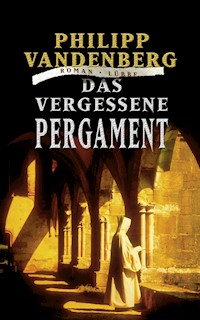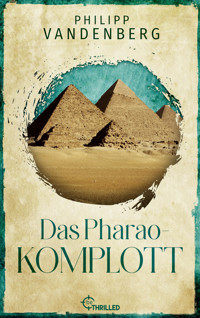
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Thriller von Bestseller-Autor Philipp Vandenberg
- Sprache: Deutsch
In den Wüsten Ägyptens suchen die europäischen Geheimdienste nach dem Grab des Imhotep - Wunderheiler, Arzt und Gott - und seinem tödlichen Vermächtnis. Eine altägyptische Schrifttafel führt auf die Spur eines der ungelösten Rätsel der Geschichte. Wer dieses Grab im Wüstensand findet, dem winken nicht nur unermesslicher Reichtum, sondern auch Macht und unsterblicher Ruhm.
Von der Gefahr des Wissens und der Verlockung der Macht, von der Weisheit der Pharaonen und der Torheit der Menschen unserer Tage erzählt Philipp Vandenberg in seinem Roman, der archäologisches Kriminalstück, historisches Panorama und politischer Thriller zugleich ist.
»Vandenberg hat einen flüssigen, ungewöhnlich spannenden Roman geschrieben.« Welt am Sonntag
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Spurensuche
1 Mena House und Winter Palace
2 Luxor
3 Berlin, Unter den Linden
4 Sinai
5 London im Herbst
6 Von Kairo nilaufwärts
7 Ein Konsulat in Alexandria
8 Auf der Flucht
9 Berlin, zwischen Gendarmenmarkt und Urania
10 Vom Tal der Könige nach Sakkara
11 Berlin – London – Berlin
12 Sidi Salim
13 Im Schatten der Pyramide
Wo die Spuren enden
Weitere Titel des Autors
Feedbackseite
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
ÜBER DIESES BUCH
In den Wüsten Ägyptens suchen die europäischen Geheimdienste nach dem Grab des Imhotep – Wunderheiler, Arzt und Gott – und seinem tödlichen Vermächtnis. Eine altägyptische Schrifttafel führt auf die Spur eines der ungelösten Rätsel der Geschichte. Wer dieses Grab im Wüstensand findet, dem winken nicht nur unermeßlicher Reichtum, sondern auch Macht und unsterblicher Ruhm.
Von der Gefahr des Wissens und der Verlockung der Macht, von der Weisheit der Pharaonen und der Torheit der Menschen unserer Tage – von all dem erzählt Philipp Vandenberg in diesem gelungenen Werk!
ÜBER DEN AUTOR
Philipp Vandenberg wurde am 20. September 1941 in Breslau geboren. Er wuchs nach dem Zweiten Weltkrieg bei einer Pflegemutter und im Waisenhaus auf und kam 1952 ins oberbayrische Burghausen.Er besuchte dort dasselbe Gymnasium wie Ludwig Thoma und flog, eigenem Bekunden zufolge, wie dieser von der Schule. Er kehrte »reumütig« zurück und konnte in der Folge die mangelhaften Leistungen in Griechisch sowie Mathematik durch hervorragende Leistungen in Deutsch und Kunst ausgleichen. 1963 machte er am humanistischen Gymnasium Burghausen/Salzach Abitur und studierte anschließend an der Universität München Kunstgeschichte und Germanistik (ohne Abschluss). Ein Volontariat machte Vandenberg 1965/1967 bei der Passauer Neue Presse, die ihn 1967 zum Redaktionsleiter des Burghauser Anzeigers machte.Anschließend wurde er Nachrichtenredakteur bei der Münchener Abendzeitung. 1968–1974 arbeitete er für die Illustrierte Quick. Dann war Vandenberg bis 1976 als Literaturredakteur für das Magazin Playboy beschäftigt. Seither ist er als freier Autor tätig.Vandenbergs Karriere als Sachbuchautor begann 1973, als er seinen Jahresurlaub nahm und begann, über den »Fluch des Pharao« zu recherchieren. Über den rätselhaften Tod von dreißig Archäologen veröffentlichte er das Buch »Der Fluch der Pharaonen« (1973), das ein Weltbestseller wurde. Quick hatte das Manuskript als Serie abgelehnt. Auf den Bestsellerlisten platzierten sich auch Vandenbergs weitere Publikationen wie die archäologische Biographie »Nofretete« (1975). 1977 wechselte Vandenberg seinen Verlag, blieb aber der kulturgeschichtlichen Thematik treu und war in der 80er Jahren als Autor historischer Sachbücher wie »Cäsar und Kleopatra« (1986) erfolgreich. Mitunter versuchte die Fachkritik, seine populären Sachbücher als »Archäo-Krimis« abzutun. Vandenbergs 30 Bücher, mit einer weltweiten Gesamtauflage von über 24 Millionen, erschienen bisher in 34 Sprachen übersetzt, darunter, neben allen Weltsprachen, ins Türkische, Bulgarische, Mazedonische und Rumänische.Vandenberg hat aus erster geschiedener Ehe einen Sohn Sascha (geb. 1965). Seit 1994 ist er mit Evelyn, geb. Aschenwald, verheiratet, beide leben in Baiernrain, in einem tausend Jahre alten Dorf zwischen Starnberger- und Tegernsee. Sein Hobby ist das Sammeln von Oldtimern und Phonographen.
Philipp Vandenberg
Das Pharao-Komplott
Thriller
SPURENSUCHE
Bastet, die ägyptische Göttin der Liebe und Freude, wird von alters her in Gestalt einer hockenden Katze dargestellt.
Auftrag Nr. 1723 im Münchner Hermes-Institut, einem weltweit anerkannten Forschungslaboratorium zur Prüfung und Datierung von Kunstwerken, war reine Routine. Eine altägyptische Bastet-Katze sollte für ihren Besitzer, einen privaten Sammler, mithilfe der Thermolumineszenzmethode auf ihre Echtheit untersucht werden. Für die vorgesehene Prüfung war es notwendig, drei Gramm Material an einer möglichst unsichtbaren Stelle abzuschaben. Wie üblich nahm die zuständige Assistentin die Probe von der Unterseite des Sockels, in diesem Fall von der Innenseite eines fingerdicken, etwa zehn Zentimeter tiefen Loches, um die Beschädigung so unauffällig wie möglich zu halten.
Dabei entdeckte die Wissenschaftlerin in der Höhlung einen eingerollten Zettel mit der Aufschrift »MURDERER No 73«, welchem sie zunächst keine Beachtung schenkte, den sie dann aber im Kuriositätenkabinett des Instituts ablegte, wo allerlei Fälschungen und Merkwürdigkeiten aufbewahrt werden.
Die wissenschaftliche Untersuchung der Bastet-Katze bestätigte zweifelsfrei deren Echtheit, und das Objekt konnte mit einer Genauigkeit von ± 100 Jahren in die dritte Dynastie datiert werden. Mit Datum 7. Juli 1978 wurde das Stück dem Sammler samt Expertise und Rechnung zurückgegeben und im Band 24/78 des Auftragsbuches archiviert.
Bei einem Besuch des Hermes-Instituts in der Münchner Meiserstraße, wo ich im September 1986 ein Stück aus meiner eigenen kleinen Sammlung ägyptischer Altertümer prüfen lassen wollte, wurde ich auf den seltsamen Zettel mit der Aufschrift »MURDERER No 73« aufmerksam, und ich erhielt auf Befragen die geschilderte Auskunft. Meinem Einwand, der Besitzer des Kunstobjekts müsse doch eine Erklärung für den Zettelfund haben, begegnete man mit dem Hinweis, dieser sei von dem Zettel in Kenntnis gesetzt worden. Er habe jedoch nur gelacht und sich dahingehend geäußert, irgendein Vorbesitzer des Kunstobjekts habe sich wohl einen Scherz erlaubt; im Übrigen interessiere ihn nur die Echtheit des Stückes.
Daraufhin bat ich, mir Namen und Adresse des Besitzers des Kunstobjektes bekannt zu geben, was man aber aus prinzipiellen Erwägungen ablehnte. Ich hatte mich jedoch inzwischen gedanklich so in den Fall – das heißt, ob es ein Fall sein würde, wusste ich damals noch gar nicht –, dass ich nicht lockerließ und vorschlug, dem Besitzer der Bastet-Katze meinen Wunsch vorzutragen; vielleicht sei er bereit, sich mir zu offenbaren. Das Institut versprach, meinem Wunsch nachzukommen.
Ich war damals im Zweifel, welche Wege ich gehen sollte, falls sich der Eigentümer nicht meldete, ich dachte sogar an Bestechung im Institut, um so an den Namen des Besitzers der Katze mit der mysteriösen Inschrift heranzukommen; denn je mehr ich mich mit der Angelegenheit auseinandersetzte, desto mehr wurde ich überzeugt, dass sich hinter dem Zettel mit der Aufschrift »MURDERER No 73« alles andere als ein Scherz verbarg. Ein weiterer Versuch beim Direktor des Instituts, mir den Namen preiszugeben, endete immerhin mit dem Versprechen, man wolle den Zettel (den man dort gewiss insgeheim längst verflucht hatte) einer wissenschaftlichen Analyse unterziehen.
Zu meiner großen Überraschung wurde mir drei Wochen später über das Institut ein Brief zugestellt, in dem sich ein Dr. Andras B., ein Wirtschaftsanwalt aus Berlin, als rechtmäßiger Besitzer der Katzenskulptur ausgab; er habe von meinem Interesse Kenntnis genommen, müsse mich jedoch leider enttäuschen, das Objekt sei, da ein Erbstück, unverkäuflich.
Daraufhin rief ich Dr. B. in Berlin an, erklärte, dass es mir nicht um die Katze an sich ginge, sondern allein um den Zettelfund mit der mysteriösen Aufschrift »MURDERER No 73«, was bei meinem Gesprächspartner eine gewisse Skepsis erkennen ließ, sodass ich alle Überredungskunst aufbringen musste, ihn zu bewegen, sich mit mir im Hotel Schweizer Hof in Berlin zu treffen.
Ich flog nach Berlin, und bei einem gemeinsamen Abendessen in dem genannten Hotel, zu dem Dr. B. einen Bekannten als Zeugen mitbrachte, was mich in meinen Verdächtigungen nur bestärkte, erfuhr ich, jedenfalls behauptete das mein Gesprächspartner, dass der derzeitige Besitzer die Katzenskulptur von seinem Vater Ferenc B., einem bekannten Sammler ägyptischer Antiquitäten, geerbt habe. Ferenc B. sei vor drei Jahren im Alter von sechsundsiebzig Jahren gestorben. Über die Herkunft des Objektes wusste Dr. B. nichts zu sagen, sein Vater Ferenc B. habe bei Händlern und auf Auktionen in aller Welt gekauft.
Auf meine Frage, ob nicht Kaufunterlagen existierten, wie das bei Sammlern üblich sei, wiegelte mein Gesprächspartner ab, alle diese Unterlagen halte seine Mutter in Verwahrung, die auch noch über den größeren Teil der Sammlung verfüge und sich in Ascona am Lago Maggiore bester Gesundheit erfreue. Die Unterredung dauerte insgesamt vier Stunden und endete, nachdem ich den beiden Gesprächspartnern versichert hatte, dass steuerliche Aspekte des Themas außerhalb meines Interesses lägen, unerwartet freundschaftlich.
Auf diese Weise hatte ich erfahren, dass Dr. B.s Mutter in der Zwischenzeit wieder geheiratet hatte und nun E. hieß. E. war ein etwas dubioser Charakter, und niemand in der Gegend wusste so recht, womit er sein Geld gemacht hatte, aber das ist in dieser Gegend nicht selten. Es erschien angebracht, Frau E. unangemeldet zu überraschen, denn ich musste befürchten, sie würde ein Gespräch mit mir rundweg ablehnen. Ich ließ keine Zeit verstreichen und reiste umgehend nach Ascona, wo ich Frau E. alleine antraf, etwas verhärmt und leicht versoffen, was mir allerdings sehr entgegenkam, weil sich Frau E. sehr aussagefreudig zeigte. Zwar war Frau E. nicht bereit, die Kaufunterlagen der Bastet-Katze preiszugeben, sie erklärte, diese Unterlagen existierten nicht mehr, doch gab sie mir, ohne es zu ahnen, einen wertvollen Hinweis über die Herkunft des Stückes: Ja, sie erinnere sich gut, im Mai 1974 sei die Katze des Hausherrn auf rätselhafte Weise verendet und zu eben dieser Zeit habe Ferenc B. die Bastet-Katze in einem Auktionskatalog entdeckt und erklärt, er wolle das Stück zum Andenken an seine Lieblingskatze erwerben, was dann auch geschehen sei.
Zu meinem Bedauern wurde unser Gespräch jedoch unterbrochen, weil Frau E.s Mann plötzlich erschien und mir und meinem Anliegen mit größtem Misstrauen begegnete und mich nicht unhöflich, aber sehr bestimmt hinauskomplimentierte.
Immerhin war ich nun schon so weit, dass die Dinge eine gewisse Eigendynamik entwickelten. Ein gleich lautender Brief an alle führenden Auktionshäuser mit der gleich lautenden Frage, ob ihre geschätzte Firma im Mai 1974 eine Auktion ägyptischer Kunst durchgeführt habe, hatte folgendes Ergebnis: Drei antworteten mit nein, zwei antworteten überhaupt nicht, eine Antwort war positiv. Christie’s in London vermeldete eine Auktion ägyptischer Kunst am 11. Juli 1974. Ich fuhr nach London.
Das Head Office von Christie’s in der King Street, St. James’s, macht einen sehr vornehmen Eindruck, jedenfalls was die öffentlich zugänglichen Räume (vornehm in Rot gehalten) betrifft; die internen Räumlichkeiten vermitteln eher einen heruntergekommenen Eindruck. Vor allem das Archiv, in dem Kataloge und Ergebnislisten aller Auktionen aufbewahrt werden. Ich wies mich als Sammler aus und erhielt so bereitwillig Zutritt zu dem verstaubten Raum mit den alten Katalogen. Miss Clayton, eine sehr vornehme, bebrillte Dame, die bezaubernd ihrem Alter entgegenlächelte, begleitete mich und war mir behilflich, mich zurechtzufinden.
Wie dem Katalog Ägyptische Skulpturen vom 11. Juli 1974 zu entnehmen war, stammte ein großer Teil der Einlieferung aus dem Nachlass eines New-Yorker Sammlers, darunter ein Apis-Stier aus der VI. Dynastie und eine Horus-Statue aus Memphis. Unter Los Nr. 122 stieß ich schließlich auf die gesuchte Bastet-Katze, III. Dynastie, vermutlich aus Sakkara stammend. Ich gab vor, das Kunstobjekt befinde sich in meinem Besitz, und mir sei an einem lückenlosen Besitzernachweis gelegen; ob sie mir nicht Einlieferer und Käufer des Stückes nennen könne.
Das aber lehnte die resolute Dame ab, sie schlug den Katalog zu, stellte ihn an seinen Ort zurück und fragte unwillig, ob sie noch etwas für mich tun könne. Ich verneinte und bedankte mich für die Hilfe, weil ich merkte, dass ich so in der Angelegenheit nicht weiterkam. Beim Hinausgehen verwickelte ich Miss Clayton in ein Gespräch über die Londoner Gastronomie, die für einen Kontinentaleuropäer, gelinde gesagt, ein Buch mit sieben Siegeln darstelle, und ich blieb nicht ohne Erfolg. Jeder Engländer, auf die angelsächsische Kochkunst angesprochen, beginnt diese heftig zu verteidigen – so auch Miss Clayton. Man müsse, und dabei funkelten ihre Brillengläser heftig, nur die entsprechenden Lokale kennen. Die Diskussion endete mit einer Verabredung im Four Seasons, South Kensington.
Um es gleich vorwegzunehmen: Das Dinner wäre nicht der Rede wert gewesen, hätte sich nicht zwischen Horsd’œuvre und Sweets ein äußerst interessantes Gespräch ergeben, in dessen Verlauf sich mehrmals Gelegenheit bot, Miss Claytons profunde Kenntnisse der internationalen Auktionsszene zu belobigen. Mit weiteren Komplimenten, die über ihre berufliche Tätigkeit hinausgingen, erschlich ich Miss Claytons Vertrauen und die Zusicherung, mir entgegen der Vorschrift des Hauses und unter dem Siegel der Verschwiegenheit Einlieferer und Käufer von Los Nr. 122 zu nennen.
Als ich Miss Clayton tags darauf in ihrem Büro aufsuchte, wirkte sie sichtlich nervös, und sie schob mir einen Zettel zu mit zwei Namen und Adressen, von denen ich einen bereits kannte: Ferenc B. Sie beeilte sich jedoch hinzuzufügen, ich möge das Gespräch am gestrigen Abend vergessen; sie habe mehr ausgeplaudert, als ihr zu sagen erlaubt sei, der vorzügliche Wein habe ihre Zunge gelöst, sie bedauere. Auf meine Frage, ob wir uns nicht noch einmal sehen könnten, entgegnete Miss Clayton mit einem strikten Nein und bat, sie zu entschuldigen.
An der Bar des Gloucester, wo ich in London abzusteigen pflege, machte ich mir Gedanken, was Miss Clayton ausgeplaudert haben könnte, und obwohl ich den gesprächsreichen Abend minutiös Revue passieren ließ, fand ich keinen Ansatzpunkt. Immerhin hatte ich nun den Namen des Verkäufers, offenbar eines Ägypters mit Namen Gemal Gadalla, Wohnsitz Brighton, Sussex, Abbey Road 34; es war Sommer, und ich beschloss, von London nach Brighton zu fahren, wo ich im Hotel Metropol, King’s Road, abstieg. Der Portier, ein weißhaariger, freundlicher älterer Herr, den ich mir einfach nicht anders vorstellen konnte als im Cut, hob, als ich nach der Abbey Road fragte, indigniert die Augenbrauen und artikulierte umständlich vornehm, so wie es dem Ambiente des Hotels der Jahrhundertwende entsprach, bedaure, eine Straße gleichen oder ähnlichen Namens habe Brighton nicht aufzuweisen; nein, auch im Jahre 1974 habe es eine Straße dieses Namens nicht gegeben, das wüsste er. Daraufhin rief ich Miss Clayton in London an, ob sie sich vielleicht nicht geirrt habe, aber Miss Clayton war sehr aufgebracht, beteuerte, ein Irrtum sei ausgeschlossen, und beschwor mich, die Ermittlungen in der Angelegenheit einzustellen. Auf meine eindringliche Frage, ob sie mir etwas verheimliche, blieb sie stumm, und dann legte sie auf.
Damit war für mich die Geschichte an einem »point of no return« angelangt, und wenn ich – ich muss gestehen – vorher nur Ahnungen oder eine ausgeprägte Fantasie gehabt hatte, so wuchs die Vermutung zur Gewissheit: Hinter dem unscheinbaren Zettel mit der Aufschrift »MURDERER No 73« verbarg sich irgendein Geheimnis.
Mich trieb es nach London zurück. In der Fleet Street stattete ich dem Daily Express einen Besuch ab, von dem mir bekannt war, dass er über ein ausgezeichnetes Archiv verfügt. Ich ließ mir den Zeitungsband Juli 1974 vorlegen; denn, so überlegte ich, Auktionsberichte erfreuen sich in London seit jeher großer Beliebtheit, vielleicht würde ich dort einen Hinweis finden. Ich fand ihn nicht, jedenfalls entdeckte ich in dem Bericht vom 13. Juli 1974 nichts, was über die nüchterne Berichterstattung der Ergebnisse hinausging; aber ich gab nicht auf und begab mich zu einer weiteren Londoner Zeitung, wobei mir der Zufall zu Hilfe kam. The Sun hatte vor vielen Jahren über mein erstes Buch in großen Lettern berichtet. Also suchte ich die Redaktion auf und bat ebenfalls um den Band Juli 1974, und ich wurde fündig.
Am 12. Juli 1974 berichtete The Sun unter der Überschrift »Ein Toter saß im Auktionssaal« Folgendes (ich ließ mir die Meldung fotokopieren): »Bei einer Auktion ägyptischer Skulpturen bei Christie’s, St. James’s, kam es gestern zu einem tragischen Zwischenfall. Ein Sammler mit der Bieternummer 135 wurde während der Auktion vom Herztod ereilt. Der Vorfall blieb unbemerkt. Angestellte des Hauses Christie’s entdeckten den Mann nach Ende der Auktion um neun Uhr p. m. zusammengesunken auf seinem Stuhl in der vorletzten Reihe und glaubten, er sei eingeschlafen. Als ihre Versuche, den Mann aufzuwecken, erfolglos blieben, wurde ein Arzt gerufen. Der stellte den Herztod des Mannes fest. Bei dem Toten mit der Bieternummer 135 handelt es sich um den deutsch-ägyptischen Kunsthändler Omar Moussa aus Düsseldorf.«
Für mich stellte sich damit natürlich die Frage, ob Moussa eines natürlichen Todes gestorben war. Immerhin gab es da einen wenn auch unscheinbaren Zettel mit der Aufschrift »Mörder«. War es Zufall, dass sich gerade dieser Zettel in einem Kunstobjekt befunden hatte, das auf der Auktion mit dem Toten versteigert worden war?
Eine Rückfrage beim Hermes-Institut in München, das das Papier inzwischen analysiert hatte, brachte folgendes Ergebnis: Das Papier war Anfang der Siebzigerjahre hergestellt worden, mit hoher Wahrscheinlichkeit außerhalb Europas.
Hatte der Mörder – falls es sich um einen solchen handelte – die Bieternummer 73? Wer verbarg sich hinter No 73? Um diese Frage zu klären, suchte ich Christie’s auf, wo ich mit Staunen zur Kenntnis nahm, Miss Clayton habe überstürzt ihren Schreibtisch verlassen; sie habe familiäre Probleme geltend gemacht. Ich ließ mich nicht abweisen und suchte den Deputy Chairman Christopher Thimbleby auf.
The Hon. Christopher Thimbleby empfing mich in einem beengten, dunkel gehaltenen Büroraum und zeigte sich ganz offensichtlich wenig erfreut über meinen Verdacht, in den geheiligten Hallen seines altehrwürdigen Hauses – immerhin seit 1766 – habe sich ein Mord zugetragen. Vor allem, wandte er ein, und ich konnte ihm kaum etwas entgegnen, welches Motiv sollte dieser Mann gehabt haben? Den Namen des Bieters No 73 bekannt zu geben wies Thimbleby mit Entrüstung von sich; ich hatte das nicht anders erwartet. Das, beteuerte ich, würde mich jedoch nicht von weiteren Recherchen abhalten, ja, er müsse damit rechnen, dass ich mit meinen Recherchen an die Öffentlichkeit ginge, auch wenn sich die ganze Geschichte vielleicht als ein Windei erweise. Mein Gesprächspartner wurde nachdenklich.
Also gut, meinte Thimbleby schließlich, in Anbetracht der außergewöhnlichen Situation erkläre er sich bereit, meine Nachforschungen zu unterstützen. Er stelle jedoch zur Bedin-gung, ständig auf dem Laufenden gehalten zu werden und jede Öffentlichkeit zu vermeiden, solange ein Verbrechen nicht erwiesen oder nach Lage der Dinge wahrscheinlich sei.
Ich verschwieg meine vorausgegangene Kontaktaufnahme zu Miss Clayton und tat, als wir gemeinsam das Archiv aufsuchten, als sei ich zum ersten Mal hier, was mir schwerfiel, weil Thimbleby umständlich und an falscher Stelle nach den Akten suchte, die ich schon gesehen hatte. Thimbleby entschuldigte sich, die zuständige Dame sei nicht verfügbar, stieß nach nervösem Suchen jedoch auf das richtige Fach und – auf eine Lücke im Archiv. Ich traute meinen Augen nicht. Die gesuchte Akte, die ich vor wenigen Tagen noch gesehen hatte, war verschwunden.
Mir erschien die Sache nun einfach zu durchsichtig. Ich hinterließ meine Hoteladresse für den Fall, dass man doch noch fündig würde, und verabschiedete mich – ich muss gestehen – ziemlich verärgert. Überall wo ich suchte, tat sich vor mir eine Wand auf.
In solchen Augenblicken der Ratlosigkeit, des Einfach-nicht-weiter-Wissens pflege ich ein Museum aufzusuchen und mit Exponaten Zwiesprache zu halten. Dies geschah im British Museum, und das Objekt meiner Gedanken war der Stein von Rosette, jene schwarze Basaltplatte, die von einem Offizier Napoleons nahe der gleichnamigen ägyptischen Stadt gefunden wurde und auf der ein dreisprachiger Text geschrieben steht, vierzehn Zeilen Hieroglyphen, einunddreißig Zeilen demotischer und vierundfünfzig Zeilen griechischer Schrift, welcher einem französischen Gelehrten einst als Vorlage diente zur Entschlüsselung der Hieroglyphen.
Als Ergebnis meiner Überlegungen vor dem Stein von Rosette traf ich die Entscheidung, den ganzen Weg meiner Recherchen noch einmal von Anfang an zu gehen; das jedenfalls hatte Champollion seiner Lösung nähergebracht. Vor meiner für den folgenden Tag geplanten Abreise kam mir plötzlich die Idee, nach Miss Juliet Clayton zu forschen. Ihre Adresse entnahm ich dem Telefonbuch: Queensgate Place Mews, Kensington. Schmale, einstöckige, weiß getünchte Häuser, im Parterre meist eine kleine Autowerkstätte oder ein Lagerraum, die Straße mit Kopfsteinen gepflastert.
Ob er Miss Clayton kenne, fragte ich den Automechaniker, der in regelmäßigen Abständen aus der Kühlerhaube eines alten Autos auftauchte.
Selbstverständlich, ja, aber Miss Clayton sei verreist, nach Ägypten, wann sie wiederkomme, wisse er nicht, sorry, Sir. Ich gab mich als alter Freund von Miss Clayton aus, fragte, ob er ihren Aufenthaltsort in Ägypten kenne. Der Automechaniker hob die Schultern. Ihre Mutter vielleicht, die betagte alte Dame wohne im Norden, in Hanwell, Uxbridge Road; am besten nähme ich den Zug von Victoria Station, man führe eine volle Stunde. Ich war sicher, Miss Clayton dort zu finden, und machte mich umgehend auf den Weg.
Auf der Fahrt nach Hanwell begann es zu regnen, und Regen macht die trostlosen Londoner Vororte noch trostloser. Ich war der einzige Fahrgast, der in Hanwell ausstieg, ein alter verlassener Bahnhof, zur Straße hin ein verglastes Häuschen: Taxi.
Uxbridge Road.
Ein Pfund fünfzig.
Mrs. Clayton, eine kleine, weißhaarige Dame, über deren faltiges Gesicht ständig ein Lächeln huschte, freute sich sichtlich über den unerwarteten Besuch und setzte Tee auf. Ich gab vor, ein Freund ihrer Tochter zu sein, und Mrs. Clayton begann bereitwillig über Juliet zu plaudern. Viel wichtiger war jedoch die Information, dass Miss Clayton sich im Sheraton in Kairo aufhalte, wo sie regelmäßig abzusteigen pflege.
Regelmäßig?
Nun ja, ein-, zweimal im Jahr, ich wisse doch um ihre Vorliebe für Ägypten – oder etwa nicht?
Aber natürlich, beteuerte ich. Im Lauf des Gespräches erfuhr ich auch, dass Juliet Clayton mehrere Jahre in Ägypten zugebracht hatte, fließend Arabisch sprach und mit einem Ägypter, den Mrs. Clayton Ibrahim nannte, in näherer Beziehung gestanden hatte. Als sich das Gespräch dem Londoner Wetter zuwandte, zog ich es vor, mich höflich zu verabschieden.
Zurückgekehrt erwartete mich in meinem Hotel eine Überraschung. Der Portier überreichte mir eine Message von Christopher Thimbleby: No 73 sei ein Mann namens Gemal Gadalla. Wohnsitz Brighton, Sussex, Abbey Road 34, jenes Phantom, das ich bereits als Besitzer der Bastet-Katze gesucht hatte. Damit war wieder einmal eine Situation eingetreten, die entweder den Besuch eines Museums oder einen längeren Pub-Aufenthalt erforderlich machte, und da es schon spät war, entschied ich mich für das Magpie and Stump, Old Bailey, und fand einen jener Fensterplätze, die früher bei öffentlichen Hinrichtungen für teures Geld vermietet wurden. Ich trank »Lager« und »Stout«, ja, ich soff meine ganze Ratlosigkeit in mich hinein, und ich weiß nicht, wie der Abend geendet hätte, hätte nicht auf einmal mein Gegenüber, ein rotblonder Engländer mit unzähligen Sommersprossen auf den Handrücken, einen demonstrativen Seufzer ausgestoßen und, mit seinem breiten Gesicht mir zugewandt, geschimpft: Verdammte Weiber, gottverdammte!
Höflich erkundigte ich mich, was er damit meine, und der Angeredete erwiderte mit einer verächtlichen Handbewegung, ich müsse mich doch nicht schämen, aber man sehe es mir sogar in der Schummrigkeit von Old Bailey an, dass ich Kummer mit den Weibern hätte – ja, so pflegte er sich auszudrücken –, und augenzwinkernd und mit vorgehaltener Hand, so als ob es niemand hören sollte, fügte er hinzu, in Wales gebe es die besten Frauen, ein bisschen altmodisch, aber handsam und treu, und dann streckte er mir die sommersprossige Hand entgegen und sagte, er heiße Nigel.
Nigel vernahm mit Staunen, dass ich zum einen kein Brite und zum anderen weit entfernt sei von Liebeskummer oder dergleichen, worauf er glaubte, vom Krieg zu erzählen beginnen zu müssen. Ob es das Bier war oder meine Aversion gegen derlei Erzählungen, ich weiß es nicht, jedenfalls unterbrach ich Nigels martialischen Redeschwall mit der Frage, ob er wirklich interessiert sei, meinen Kummer zu erfahren, und als er bejahte und seinen Kopf zwischen die Fäuste steckte, begann ich mit meiner Geschichte. Während ich redete, sagte Nigel kein Wort, ab und an schüttelte er nur verständnislos den Kopf, und er schwieg auch noch, lange nachdem ich geendet hatte. Ich müsse, begann er schließlich, ein Schriftsteller sein, und die Geschichte sei wirklich gut erfunden, aber wahr sei sie nicht, jedenfalls könne er nicht daran glauben, nicht an so etwas.
Es kostete mich einen hohen Aufwand an Redekunst und ein halbes Dutzend »Stouts« mindestens, um meinen Freund vom Wahrheitsgehalt meiner Erzählungen zu überzeugen, bis er schließlich einwilligte; also gut, vielleicht gebe es wirklich verrückte Begebenheiten wie diese – was ich nun zu tun gedenke. Wüsste ich das, erwiderte ich, so hätte ich die ganze Geschichte wahrscheinlich nicht erzählt.
Nigel dachte nach, und dabei klopfte er mit der flachen Hand auf die schwarz gebeizte Tischplatte und murmelte irgendetwas von Verwirrspiel oder was immer entanglement auf Deutsch bedeuten mag.
Meine Begegnung im Magpie and Stump wäre überhaupt nicht erwähnenswert, hätte nicht Nigel plötzlich aufgeblickt und gesagt, wenn es schon diesen rätselhaften Gemal Gadalla nicht gebe, dann sei vielleicht auch der Kunsthändler Omar Moussa nur ein Phantom, was meinen Sie?
Zwei Tage später in Düsseldorf ging ich dieser Frage nach, und zunächst schien es, als würde sich alles zu meiner Zufriedenheit entwickeln, denn ich entdeckte im Telefonbuch den Namen Omar Moussa und den Hinweis: Antiquitäten, Königsallee, die feinste Adresse.
Ich erwartete natürlich, in Moussa den Sohn jenes bei Christie’s umgekommenen Omar Moussa zu finden, wurde jedoch, nachdem ich das feine Ladengeschäft mit erlesenen Altertümern betreten und dem gebildeten älteren Herrn den Grund meines Kommens verraten hatte, eines Besseren belehrt. O nein, er selbst sei jener Moussa, den man in London tot aufgefunden habe, das könne er beschwören, und dabei hob er die Schultern und kicherte in sich hinein. Was blieb mir anderes übrig, als selbst ein bisschen verlegen zu grinsen, glaubte ich doch an einen Scherz des Alten. Schließlich wurde er ernst, brummelte, er wolle mit der Sache nichts mehr zu tun haben, und er muss dann wohl die Ratlosigkeit in meinem Gesicht gelesen haben, und als ob er sich meiner erbarmte, begann er plötzlich zu reden.
So erfuhr ich, dass jener Mann, den während der Auktion der Tod ereilte, eine Art Doppelgänger gewesen war, offenbar ein Geheimagent, ausgestattet mit Personalpapieren, die sich von den seinen nur durch das Passfoto unterschieden. Pass, Führerschein, sogar Kreditkarten auf seinen Namen lautend habe der Doppelgänger mit sich geführt, und er wisse auch wie das möglich war: Bei einem Autoeinbruch in der Düsseldorfer Innenstadt sei zwar sein Radio entwendet, die Brieftasche im Handschuhfach aber unbeachtet gelassen worden, was ihn, Moussa, damals fraglos gefreut hatte. Später sei ihm dann klar geworden, dass der Autoeinbruch nur als Vorwand gedient habe, um seine Personalpapiere zu kopieren und zu fälschen. Aber das alles habe er erst viel später erfahren. Zunächst sei er von der Angelegenheit überhaupt nicht behelligt worden – bis zu jenem Tag, an dem er und sein Doppelgänger, ohne es zu bemerken, einander begegnet seien; jedenfalls seien bei der Auktion in London zwei Männer mit dem Namen Omar Moussa im Saal gesessen, er, der echte Omar Moussa, und der andere, falsche – eine verrückte Situation.
Ich unterbrach meinen Gesprächspartner und fragte, ob es Zufall gewesen sei, dass Moussa gerade diese Auktion besucht habe.
Zufall? Moussa kehrte die Handflächen nach außen. Nichts sei Zufall im Leben; er habe im Kundenauftrag versucht, verschiedene Stücke zu ersteigern, nichts weiter. Er schwieg, und mir schien es, als dächten wir beide das Gleiche, und da Moussa noch immer nicht weiterredete, stellte ich kurzerhand die Frage, wer, falls es sich wirklich um ein Verbrechen gehandelt habe, nun Ziel des Anschlages gewesen sei, der echte oder der falsche Moussa.
Der alte Mann holte tief Luft, verschränkte die Arme auf dem Rücken und ging auf dem großen Seidenteppich, der die Mitte des Ladens schmückte, auf und ab, und betont umständlich begann er zu erzählen, dass ein Arzt den Herztod des Mannes festgestellt hatte, und dass er, Moussa, makaber genug, bei seiner Heimkehr aus England von seinem eigenen Ableben unterrichtet worden sei. Auf sein Lebenszeichen habe Scotland Yard den Fall übernommen; er selbst sei nach London gebeten worden, und er habe der Aufforderung bereitwillig Folge geleistet, lag es doch in seinem eigenen Interesse, den Fall aufzuklären. Viele Stunden habe er am Victoria Embankment, dem Sitz von Scotland Yard, zugebracht, und ihm seien zahllose Fragen gestellt worden, bis er sich schon selbst schuldig fühlte, nicht der tote Moussa zu sein. Von Mord sei im Übrigen nie die Rede gewesen, ein Arzt hatte ja den Herztod des Mannes festgestellt. Auch die Identität des Toten sei nie geklärt worden. Scotland Yard habe den Fall zu den Akten gelegt mit dem Ergebnis, der Doppelgänger sei Agent eines Geheimdienstes gewesen und bei der Beobachtung irgendeines Vorganges vom Tode ereilt worden.
Unser Gespräch wurde von einem Kunden unterbrochen, der sich für zwei chinesische Balustervasen interessierte: ob es sich um Wucai handele? Und während die beiden fachsimpelten, hatte ich Gelegenheit, mir diesen Moussa näher zu betrachten. Er war orientalisch-hellhäutig, mindestens eins achtzig groß, und seine schlanke Figur, der korrekte Zweireiher und eine gewisse Vornehmheit seines Auftretens verliehen ihm etwas Adeliges; kurz, er sah so aus, wie ein seriöser Antiquitätenhändler aussehen mag, und es fiel schwer, sich diesen Mann verstrickt in irgendwelche Geheimdienstangelegenheiten vorzustellen. Aber ehrlich gesagt erschien mir die Geschichte, die er mir zunächst schmunzelnd, dann mit einer gewissen Leidensmiene aufgetischt hatte, reichlich dubios; ja, sie hörte sich so an, als wolle Moussa unbedingt beweisen, dass er nichts mit dem Fall zu tun habe.
Als der Kunde gegangen war, fragte ich ihn unvermittelt, ob ihm der Name Gemal Gadalla bekannt sei. Nein, erwiderte er unwillig, im Übrigen liege das alles weit zurück, worüber er froh sei. Und er ersuchte mich höflich, aber bestimmt, die Geschichte auf sich beruhen zu lassen, er habe genug darunter gelitten, guten Tag.
Ich wollte noch fragen, ob ihm der Name Juliet Clayton etwas sage, aber dazu kam ich nicht, denn Moussa hielt mir wortlos die Tür auf.
Die Situation, in der ich mich befand, war wie beim Poker, da muss man auch mit schlechten Karten versuchen zu gewinnen, und ich muss gestehen, ich hatte denkbar schlechte Karten; aber ich war gepackt von dieser Geschichte, und um eine solche handelte es sich ohne Zweifel.
Fassen wir zusammen, was bisher geschah, und lassen wir dabei alle Namen und Schauplätze außer Acht: Eine Zufallsentdeckung deutet auf einen Mord hin. Zugegeben, die Entdeckung ist so absurd, dass sie zunächst niemand ernst nimmt. Doch schon die ersten Nachforschungen lassen sie in anderem Licht erscheinen. Da stirbt ein Mann während einer Kunstauktion. Herztod wird amtlich bestätigt. So weit, so gut. Der Name des Toten wird bekannt, es stellt sich heraus, dass dieser ein Doppelgänger war und dass sein Pendant sich zur selben Zeit im selben Raum aufhielt. Will man dem Hinweis glauben, so wurde dieser Mann auf hinterlistige Weise umgebracht, vielleicht durch Gift oder eine herzlähmende Injektion. Aber der Mann, der dieser Tat beschuldigt wird, ist ein Phantom, es gibt ihn nicht, jedenfalls nicht unter diesem Namen und dieser Adresse. Und was die Nachforschungen nicht gerade vereinfacht: Alle, die mit dem Fall irgendwie in Verbindung stehen, versuchen den Vorfall zu bagatellisieren, alle verhalten sich so, als verberge sich hinter dieser Tat eine ganz andere Geschichte.
In dieser Form aneinandergereiht machte die Kette der Indizien keinen Sinn, und ich kam zu dem Schluss, dass, wollte ich erfolgreich sein, die asphaltierten Wege der Logik verlassen werden mussten; denn wenn ich mir es recht überlegte, entbehrte eigentlich alles, was ich bisher zu dieser Geschichte erfahren hatte, der Logik.
Um über Moussa mehr in Erfahrung zu bringen, suchte ich andere Antiquitätenhändler auf, wobei ich mich als Anleger ausgab, der von der Sache weniger verstand, aber eine erhebliche Summe Geldes steuerfrei anzulegen gedenke. Das ersparte mir größere Kenntnisse in antiken Teppichen, barockem Mobiliar und fernasiatischer Keramik und ließ mein Auftreten dennoch glaubhaft erscheinen. Beiläufig ließ ich in den Verkaufsgesprächen einfließen, dass ich bei Moussa zwei chinesische Balustervasen, Wucai, gesehen hätte; ob diesem Moussa zu trauen sei?
Ich stieß die beiden ersten Male auf große Reserviertheit, man ignorierte meine Frage, und auch auf nochmaliges Nachfragen erhielt ich nur ein zurückhaltendes Lächeln; bekanntlich hackt eine Krähe der anderen kein Auge aus. Ein dritter, weit weniger vornehmer Händler, was schon die Lage seines Geschäftes in einer Seitenstraße der Königsallee andeutete, gab sich gesprächig und hielt mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Alle Zeitungen hätten doch darüber berichtet, dass dieser Moussa zwei mittelalterliche Refektoriumstische für fünfstellige Summen veräußert habe, die in Wahrheit noch keine zehn Jahre auf dem Buckel gehabt hätten, und aufgedeckt worden sei die Fälschung von einem kundigen Sammler, der noch die Schrotkugeln entdeckte, mit welchen die Wurmlöcher in das »alte« Holz geschossen worden seien.
Ich hakte sofort ein und kam auf die mysteriösen Umstände um den Tod seines Doppelgängers in London zu sprechen, und das veranlasste den Kunsthändler zu einer abwiegelnden Handbewegung und einer abfälligen, ja verunglimpfenden Bemerkung über Moussa, die ich hier nicht wiedergeben will, die mich aber in der Erkenntnis bestärkte, dass dieser Mann Moussa nicht zu seinen Freunden zählte.
Hass macht gesprächig. Insofern erwies sich der Mann als Glücksfund, und ich erfuhr in kürzester Zeit Dinge, die mich zwar in meinem Fall nicht weiterbrachten, die mir aber den Menschen Moussa plastisch vor Augen führten. Der Grund für diese Feindschaft lag in einer weit zurückliegenden Freundschaft der beiden begründet und dem gescheiterten Versuch, vor Jahren eine gemeinsame Geschäftsbeziehung aufzubauen. Er, meinte Kassar – so hieß der Enttäuschte –, glaube, dass sich hinter dem Vorfall in London mit dem mysteriösen Doppelgänger eine Riesenschweinerei verberge, an der Moussa beteiligt sei. Auf meine Frage, was man sich darunter vorzustellen habe, erwiderte Kassar, ich hätte ja keine Ahnung, was sich auf dem internationalen Antiquitätenmarkt abspiele, da herrsche Mord und Totschlag.
Nun schien es mir an der Zeit, den wahren Grund meines Kommens zu nennen. Ich erläuterte und begründete meinen Verdacht, dass der Doppelgänger ermordet worden sei, und berichtete, was ich bisher in Erfahrung gebracht hatte. Kassar war fasziniert und versprach sofort, mir bei weiteren Recherchen behilflich zu sein. Jetzt hatte ich einen Verbündeten.
Gegenüber der Rennbahn liegt ein von außen unscheinbares Lokal, Zum Trotzkopf genannt. Dort traf ich mich mit Kassar zum Abendessen und erfuhr den kompletten Lebenslauf Moussas in allen Details, von denen mir am interessantesten erschien, dass dieser mit einer Ägypterin verheiratet war. Die Art, wie er sie beschrieb, vermittelte den Eindruck, dass Kassar insgeheim in diese Frau verliebt war. Vorsicht war also angebracht bei allen Informationen über Moussa, doch schien festzustehen, dass jener weit über seine Verhältnisse lebte. Ein Haus auf Ibiza, eine Wohnung auf Sylt und ein Appartement samt Yacht am Las Olas Boulevard in Fort Lauderdale waren nur einige Dinge, von denen Kassar wusste und von denen er sagte, alle zusammen seien für einen redlichen Antiquitätenhändler unerreichbar.
Irgendwelche dunklen Geschäfte? Kassar hob die Schultern. Nachzuweisen sei Moussa nichts, obwohl er dessen Geschäfte seit Jahren beobachte. Auch meine Vermutung, dass er seine Firma nur zur Tarnung unterhalte und in Wirklichkeit ganz anderen Geschäften nachgehe, ließ Kassar nicht gelten. Moussa sei Experte auf seinem Gebiet, er gehe auf in seinem Beruf, und man könne ihm profunde Kenntnisse nicht absprechen; viele bezeichneten ihn sogar als allerersten Experten für ägyptische Antiquitäten in Europa, obwohl er nie studiert habe. Kassar sagte das nicht ohne eine gewisse Bitterkeit, die erkennen ließ, dass er wohl ein Studium aufzuweisen hatte.
Als wir das Lokal verließen, wusste ich zwar vieles über diesen Mann, und ich war mir ganz sicher, dass Moussa eine Schlüsselrolle in diesem Fall spielte, aber einer Lösung nähergebracht hatte mich der Abend nicht.
In der Hoffnung, Miss Clayton zu treffen, flog ich nach Kairo, doch erwies sich dieser Schritt als Fehlschlag. Miss Clayton war bereits abgereist, ob ins Landesinnere oder zurück nach London, vermochte man mir im Hotel nicht zu sagen. So nahm ich meinen Ägyptenaufenthalt zum Anlass, nach Spuren von Moussa zu forschen. Bei Antiquitätenhändlern und Ausgräbern in Kairo blieb ich erfolglos; ja, ich erntete so viel Misstrauen, dass ich mich nach ein paar Tagen aus dem Staub machte und nach Minia in Mittelägypten weiterreiste, wo ich vor Jahren eine Familie kennengelernt hatte, Vater, Mutter und drei Söhne, die von der Grabräuberei im Gebiet von Tell el-Amarna lebten. Aber auch hier war der Name Moussa unbekannt, sodass ich unverrichteter Dinge nach Hause zurückkehrte.
Ich hatte nun schon eine Menge Zeit investiert, ohne einen wesentlichen Schritt weiterzukommen, und da mir der Termin eines Buches im Nacken saß, legte ich diesen Fall fürs Erste beiseite, ohne verhindern zu können, dass meine Gedanken immer wieder um dieses Thema kreisten.
Darüber verging beinahe ein Jahr, als mich ein Brief von Kassar erreichte, Moussa sei verstorben – diesmal wirklich, wie er sich auszudrücken beliebte –, und in seinem Nachlass sei ein Fund gemacht worden, der mich interessieren würde. Ich reiste sofort nach Düsseldorf. Zu meinem Erstaunen fand ich Kassar mit Moussas Witwe in harmonischer Eintracht. Von dem Verblichenen war keine Rede. Dafür überreichte mir Kassar ein Bündel bräunlicher, mit arabischer Schrift versehener Papiere, die schmutzig und zerfleddert, das Ergebnis einer langwierigen Arbeit waren. Dies sei in einem Schließfach gefunden worden, das Moussa unterhalten habe.
Ich sah Kassar fragend an, doch der meinte nur, ich solle lesen, dann würden sich alle Fragen von selbst beantworten, und dabei grinste er vielsagend. Ich konnte nicht Arabisch und meinte, ich würde erst einen Dolmetscher engagieren müssen. Ja, meinte Kassar, das sei wohl angebracht.
Ob er denn wisse, was in diesen Blättern enthalten sei. Gewiss, meinte Kassar, zwar nicht alles, aber zumindest wisse er so viel, dass ihm Moussa und die Vorfälle um ihn herum nun weit weniger rätselhaft erschienen. Natürlich brannte ich darauf zu erfahren, was es mit diesen Papieren auf sich hatte; aber Kassar weigerte sich hartnäckig, beinahe sadistisch, auch nur eine Andeutung zu machen. Ich könne die Papiere haben, meinte er, vermutlich sei ich ohnehin der Einzige, der den Inhalt dieser Schrift in seiner ganzen Tragweite begreife, und er zweifle nicht, dass daraus ein Buch entstehen würde.
Kassar behielt recht. Ich betraute Frau Shirin, eine in München lebende Ägypterin, mit der Aufgabe, mir täglich drei Stunden aus dem arabischen Text vorzulesen, aus dem Stegreif, so wie es der Unbekannte niedergeschrieben hatte, und dabei machte ich mir Notizen. Bisweilen war das, was ich zu hören bekam, so aufregend, dass ich meine Notizen vergaß, sodass ich später das Gehörte mühsam aus dem Gedächtnis rekonstruieren musste. Vieles musste ich ohnehin zum besseren Verständnis umformulieren, doch bemühte ich mich so weit wie möglich, die Ausdrucksweise des Tagebuchschreibers – denn um eine Art Tagebuch handelte es sich bei den Papieren – beizubehalten, anderes habe ich aus unabhängigen Quellen, die sich mir im Laufe der Arbeit erschlossen, ergänzt.
Dies also ist die Geschichte des Omar Moussa, eines Mannes, der sich dem Unbegreiflichen genähert hat wie noch kein Mensch vor ihm.
1
MENA HOUSE UND WINTER PALACE
Einem jeden Menschen haben wir sein Geschick bestimmt, und am Tage der Auferstehung werden wir ihm das Buch seiner Handlungen geöffnet vorlegen und zu ihm sagen: »Lies selbst in diesem Buche, deine eigene Seele soll dich an jenem Tage zur Rechenschaft ziehen.«
Koran, Siebzehnte Sure (14)
»Im Namen Allahs, des Allbarmherzigen«, so beginnen die Aufzeichnungen des Omar Moussa. »Dies sind die Worte eines gealterten Frevlers, dem vielleicht ein paar Wochen verbleiben, ein paar Monate, wenn es denn sei, und dem die Pein seines Gewissens die Gedärme quält in schlaflosen Nächten. Dies sind die Worte des Omar Moussa, die er bisher keinem anvertraut hat, zum einen, weil es unnötig ist, mit lauter Stimme zu sprechen, da Allah das Geheimste und Verborgenste kennt, zum anderen aber, weil niemand meine Worte glauben würde. Gewiss habe ich Schuld auf mich geladen in meinem Leben, doch war es ein vorgezeichnetes Schicksal nach dem Willen des Allerhöchsten, der, wie er selbst sagt, alle Sünden verzeiht außer jener, ihm ein anderes Wesen zur Seite zu setzen. Dies habe ich nie getan. Auch habe ich nie die Fastenvorschriften gebrochen im neunten Monat und stets der ungeraden Nacht gedacht, in der der Koran zur Erde herabkam. Ich war zur großen Pilgerfahrt in Mekka, die täglichen Gebete und Waschungen waren mir Pflicht, und als es mir besser ging, habe ich die Armensteuer bezahlt aus freien Stücken. Wein, Schweinefleisch, Blut und Verendetes entlockten mir Ekel. Frauen, denen ich begegnete, hatten nie Grund zur Klage, und jene, die ich ehelichte, wird mich mit Sicherheit überleben.«
Omar Moussa hätte zufrieden sein können mit seinem Schicksal, das namenlos wie das des Moses begann, und mit einem Auge dem Garten der Ewigkeit entgegenblicken können, der den Frommen zur Belohnung und Wohnung versprochen ist, wäre da nicht jene Bürde gewesen, die ihm vor beinahe einem halben Jahrhundert auferlegt wurde, als er Dinge sah, die noch niemand geschaut hat, und sein armseliges Leben sich änderte von einem Tag auf den anderen.
Um zu verstehen, wie dies alles geschah, soll hier sein Leben ausgebreitet werden, so wie er sich erinnerte oder wie es ihm selbst über sich erzählt wurde: Dunkel wie der Sandsturm war seine Geburt, er kannte weder Vater noch Mutter; denn er wurde, ein paar Tage alt nur, in einem Ledersack an die Klinke des Tores zur Karawanserei gebunden, die dem Mena House-Hotel gegenüber gelegen ist. Der alte Moussa, der über sieben Kamele verfügte und ebenso viele Kinder, sagte, bei so vielen Mündern komme es auf einen mehr oder weniger nicht an, und nahm ihn an Kindes statt auf wie sein eigenes. Mehrmals im Jahr hing an der Klinke, an der man ihn gefunden hatte, ein Beutel mit Geld, dessen Herkunft niemand kannte, um dessen Bedeutung aber jeder wusste.
Seine ersten Erinnerungen gingen zurück, als er drei war, kaum älter, und als der alte Vater Moussa, ein hagerer, faltiger Mann mit schwarzem Bart und schwarzen Brauen über den tief liegenden Augen, ihm einen gewaltigen Nabut in die kleinen Hände drückte – kaum war er in der Lage, ihn mit beiden Armen zu halten. Diese hölzerne, mit Nägeln beschlagene Keule, sagte Moussa, versinnbildliche die Macht des Mannes – ein Gerede, das er damals nicht verstand; aber er verstand sehr wohl mit ihr umzugehen, indem er sie mit aller ihm zur Verfügung stehenden Kraft gegen die Knie von Moussas Kamelen drückte, so wie er es oft gesehen hatte, dass die hohen Wüstenschiffe erst mit den Vorder-, dann mit den Hinterläufen einknickten. So ist es noch heute Brauch, um den Reiter aufsitzen zu lassen.
Die Fremden vom Mena House-Hotel, die Moussa auf diese Weise zu den großen Pyramiden transportierte, fanden sein Treiben allzu drollig und sparten nicht mit Bakschisch, wenn er ihnen so auf den Rücken der Tiere und wieder herunter half. Ein oder zwei Piaster waren damals viel Geld für einen Jungen der Wüste, nicht selten aber kam er mit fünf oder sechs nach Hause. Das schaffte Neid unter seinen Stiefbrüdern, weil er, der Jüngste, mehr verdiente als die anderen. Also grub er sich ein Versteck hinter dem Abtritt, wo es fürchterlich stank, wo er jedoch sicher sein konnte, dass nur selten jemand hinkam.
Es ist merkwürdig, obwohl er beinahe im Schatten der Pyramiden lebte, nahm er sie nicht wahr. Für ihn waren sie Berge, deren Gipfel bis zu den Wolken reichten. Von Menschenhand geschaffene Bauwerke erkannte er in den Pyramiden nicht. Darin lag auch der Grund, warum Omar die Ehrfurcht nicht verstand, mit der die Fremden vor die Pyramidenberge traten.
Vor allem waren es Engländer, sauber und vornehm gekleidete Herren, bisweilen auch in Begleitung ihrer weiß geschminkten Damen, die den Weg in die Wüste fanden, um die Pyramiden zu besichtigen. Sie stiegen im vornehmen Mena House ab, das kein Fellache betreten durfte, nicht einmal der alte, allseits geachtete Moussa, von dem die Rede ging, er habe Lord Cromer persönlich auf die Spitze der großen Pyramide geführt. Zwar gab es Eingeborene, die in dem verbotenen Hotel einer geregelten Arbeit nachgingen, doch war es ihnen bei Strafe untersagt, darüber zu berichten, was hinter den ockerfarbenen Mauern vorging.
Während die Alten sich weniger für die verbotene Ausländerherberge interessierten – jeder Erwachsene konnte sich ausmalen, wie die reichen Ausländer lebten –, wurde das Hotel für die Jungen der Umgebung zum Objekt unstillbarer Neugierde, und allein die Behauptung, schon einmal bis zur Portiersloge vorgedrungen zu sein, sei es als Kofferträger oder unter dem Vorwand, eine Botschaft zu überbringen, zog allgemeine Bewunderung nach sich. Deshalb hatte Omar keinen sehnlicheren Wunsch, als einmal einen Fuß in das verbotene Mena House zu setzen. Mehr als einmal kletterte er an einer verwachsenen Stelle über die Mauer und schlich an Gärtnern und Hauswächtern vorbei zum Eingang, wo er einen Blick in das verbotene Reich zu erhaschen hoffte; aber ein jedes Mal entdeckten ihn die beiden langen weiß gekleideten Türsteher, noch bevor er das unbekannte Treiben im Inneren zu Gesicht bekam, und jagten ihn mit Peitschenhieben davon.
So grub sich der Tag, an dem Omar zum ersten Mal die Hotelhalle betreten durfte, fest in sein Gedächtnis ein. An diesem Tag, den er auch später nicht zu datieren wusste, kam Sultan Fuad, der Sohn des Khediven Ismail, Enkel von Ibrahim Pascha und Urenkel des großen Mohamed Ali, in einer schwarzen Kutsche gefahren, um auf der großen Pyramide die ägyptische Flagge zu hissen. Der Sultan trug einen dunklen Anzug und unterschied sich auch sonst in keiner Weise von den Engländern, die im Mena House abstiegen.
Omar war irgendwie enttäuscht: Den Sultan hatte er sich anders vorgestellt. Aber der alte Moussa hatte am Morgen dieses Tages seine Kinder um sich geschart und eine Rede gehalten, die Omar im Gedächtnis blieb. Dies sei, so hatte er mit heftigen Armbewegungen gesagt, ein stolzer Tag in der Geschichte Ägyptens, und jeder Einzelne von ihnen könne stolz darauf sein, ein Ägypter zu sein; und einmal werde der Tag kommen, an dem nicht die Engländer über die Ägypter herrschten, sondern die Ägypter über die Engländer.
Also empfand Omar Stolz, noch mehr freilich interessierten ihn die bewaffneten Soldaten, die, anders als der Sultan, orientalisch gekleidet und mit Säbeln und Flinten bewaffnet waren und jeden mit finsteren Blicken straften, der der Begleitung des Sultans zu nahe kam. Omar stand mit seinem Kamel abseits der großen Pyramide, so wie Moussa es ihm aufgetragen hatte, und winkte den Besuchern zu.
Fuad sah es und ging auf Omar zu, der in diesem Augenblick am liebsten fortgelaufen wäre, aber er stand wie angewurzelt und klammerte sich an seinen Nabut.
»Wie heißt du?«, erkundigte sich der Sultan lächelnd.
»Omar«, sagte der Junge artig, »der Sohn des Moussa.«
»Und du bist ein Kameltreiber?«
»Ja«, erwiderte Omar kleinlaut.
Der Sultan lachte laut, denn er hatte einen lustigen Einfall: »Könnte ich wohl auf deinem Kamel zurückreiten?« Die Aufpasser in der Umgebung des hohen Herrn sahen sich betreten an.
Omar nickte heftig.
Inzwischen war der alte Moussa hinzugekommen. Er entschuldigte sich beim Sultan wegen der Wortkargheit des Jungen. »Er ist schüchtern, hoher Herr, ein Findelkind, das ich aufgezogen habe mit meinen eigenen Kindern!«
In diesem Augenblick fühlte sich Omar klein und armselig. Warum musste der alte Moussa seine dunkle Herkunft erwähnen? Omar schämte sich.
Nach der Besteigung der Pyramide, bei der ein gutes Dutzend Leibwächter den wohlbeleibten Sultan unter Schieben und Ziehen auf die Plattform transportiert hatten, kam Fuad auf Omar zu; der zwang sein Kamel in die Knie, und der Sultan nahm auf dem Rücken des Tieres Platz.
»Zum Mena Housel«, rief er Omar zu, und Omar führte sein Kamel mit dem Sultan zum Hotel. Soldaten bahnten ihm einen Weg durch die Menge, Menschen an beiden Seiten jubelten und klatschten in die Hände. Vor dem Eingang ließ Omar den Sultan absitzen. Aus der Begleitung Fuads drückte jemand dem Jungen ein paar Piaster in die Hand, und Omar wollte sich mit seinem Kamel zurückziehen, da rief der Sultan dem kleinen Kameltreiber zu, ob er nicht mit ihm eine Limonade trinken wolle. Omar wollte eigentlich ablehnen, er hatte keinen Durst, aber da trat Moussa hinzu, nickte und schob Omar vor sich her auf den hohen Gast zu. An der Hand des Sultans betrat Omar die Halle des Hotels.
Kühle schlug ihnen entgegen. Auf dem Steinfußboden lagen Teppiche. Obwohl es Tag war, waren alle Fensterläden verschlossen, dafür leuchteten rote und blaue Messingampeln an der Decke. Ornamentkacheln schmückten die Wände. Vornehm gekleidete Damen und Herren bildeten eine Gasse, durch die Omar an der Hand des Sultans schritt.
»Eine Limonade für mich und meinen kleinen Freund!«, rief der Sultan, und sogleich trat ein Hoteldiener in einer langen schneeweißen Galabija hervor. Er trug ein blitzendes Messingtablett und auf diesem standen zwei tulpenförmige Gläser mit grüner Limonade. Nie hatte Omar so grüne Limonade gesehen. Die Getränkeverkäufer bei den Pyramiden verkauften roten Malventee, aber grüne Limonade?
Omar zweifelte, ob etwas Grünes überhaupt trinkbar sei. Aber dann griff Sultan Fuad nach seinem Glas, setzte es an die Lippen und wartete, bis der Junge es ihm gleichtat. Was blieb Omar anderes übrig, er nahm das andere Glas und trank. Der Geschmack des zuckerigen Wassers war nicht nur unbekannt, er widerte Omar an, sodass es ihn würgte, und hastig rannte er, sich mit den Armen einen Weg durch die dicht gedrängten Menschen bahnend, ins Freie, wo er die grüne Limonade ausspie.
Von diesem Tage an war Omar bei seinen Stiefbrüdern verhasst, und oft bezog er Prügel für Dinge, die ihm zur Last gelegt wurden, mit denen er jedoch nichts zu tun hatte.
Der alte Moussa war ein ebenso frommer wie weiser Mann, auch wenn er nie eine Schule besucht hatte, und eines Abends scharte er seine große Familie vor der Hütte um sich, um eine Sure aus dem Koran vorzutragen. Wie jeder gute Gläubige konnte Moussa alle 114 Suren auswendig hersagen, und an diesem Abend entschied er sich für die Zwölfte.
»Im Namen Allahs, des Allbarmherzigen«, begann er bedächtig und dann erzählte er von Joseph, der seinem Vater Jakob berichtete, er habe im Traum elf Sterne und die Sonne und den Mond gesehen, und alle hätten sich vor ihm verneigt, und der Vater habe den Sohn ermahnt, den Traum nicht den Brüdern kundzutun, weil sie Neidgefühle gegen ihn hegten, was auch geschah! Die Brüder hätten Joseph in einen Brunnen gestoßen, wo er von einer Karawane entdeckt und für ein paar Dirhem an einen Mann namens Potiphar verkauft worden sei.
Während Moussas Vortrag erhob sich einer nach dem anderen, weil die Söhne die Absicht ihres Vaters erkannten, und als nur noch Omar dem Alten gegenübersaß, hielt dieser inne. Vom Kanalufer drang das millionenfache Zirpen der Zikaden, bisweilen nur gestört von Musikfetzen aus dem Park des Mena House. Feuer flackerten vor den Türen der Häuser der Karawanserei, und hier und da verlor sich ein kurzes lautes Lachen in der warmen Nacht.
»Du kennst den Fortgang der Geschichte?«, beendete Moussa sein langes Schweigen.
Omar schüttelte den Kopf.
Da nahm Moussa seinen Vortrag wieder auf, und er rezitierte die Sure allein vor dem Jungen. Er erzählte vom Aufstieg des Joseph zum Verwalter des Hauses, von den Nachstellungen der Frau Potiphars, seiner Verurteilung aufgrund falschen Zeugnisses und seinen Erfolgen als Traumdeuter für den Pharao, der ihn daraufhin zu seinem Vertrauten machte. Moussa erzählte von dem Großmut Josephs, als seine hungernden Brüder zu ihm kamen und um Getreide baten und dieser ihnen verzieh.
Es war spät geworden, als Moussa geendet hatte, aber Omar war hellwach, denn er begann zu begreifen, warum sein Vater gerade aus dieser Sure zitiert hatte. Er, Omar, war ein Außenseiter, einer, der wohl nie von seinen Stiefbrüdern akzeptiert werden würde. Aber lehrte nicht diese Sure, dass gerade die Geächteten großer Taten fähig sind? In seinen Träumen sah er sich als Berater des Sultans, der europäische Kleidung trug und in einer schwarzen Kutsche spazieren fuhr, und in dieser Nacht fasste Omar den Entschluss, es Joseph gleichzutun.
Aber Omar war ein Kameltreiber, der Fremde für zwei Piaster vom Mena House zu den großen Pyramiden transportierte, und er trug eine lange Galabija statt der ersehnten Beinkleider, und seine Brüder nannten ihn Omar Effendi, was der respektvollen Anrede eines Herrn entsprach, ihn, den Halbwüchsigen, jedoch verächtlich machen sollte.
Es gab nur einen einzigen Menschen, dem Omar vertraute, er hieß Hassan und war ein Mikassah, ein Krüppel, wie sie Kairo zu Tausenden bevölkerten. Hassan war alt, uralt, sein wahres Alter kannte er nicht, denn er wusste nicht, wann und wo er geboren wurde, und er hatte keine Unterschenkel. Seine Knie steckten in abgeschnittenen Autoreifen; so bewegte er sich fort, indem er ein mit Glasperlen und Spiegelscherben besetztes Holzkästchen vor sich herschob, mit dem er seinen Lebensunterhalt verdiente. Hassan war Schuhputzer, und in dem Holzkästchen, das seinen Kunden als Fußpodest diente, befanden sich Schuhcreme, Bürsten und Lumpen. So sah man ihn tagein, tagaus vor dem Mena House kauern, wo er den ein und aus gehenden Gästen seine Dienste anbot, indem er mit einer Schuhbürste lautstark gegen seinen Kasten schlug und das einzige englische Wort rief, das er kannte: »Polishing, polishing!«
Hassan pflegte das Leben aus der Schuhperspektive zu betrachten; das heißt, der Mensch endete für den Mikassah an der Gürtellinie, für alles Darüberliegende hatte er kein Auge. Über die Fesseln einer Dame konnte Hassan schwärmen wie über eine laue Mondnacht, und die Wade einer Französin in einer hohen Stiefelette erregte seine Sinne.
Er war es gewohnt, zu Menschen aufzublicken, und es machte ihm nichts aus. Es störte ihn auch nicht, missachtet zu werden, wenn sich die Menschen in seiner Anwesenheit über Dinge unterhielten, die eigentlich für keines anderen Ohr bestimmt waren. Aber Hassan war ein Niemand, und so kam es, dass er mehr wusste als alle anderen.
Er kannte die meisten Gäste des Hotels mit Namen, wusste den Grund ihrer Anwesenheit, und wem er einmal die Schuhe geputzt hatte, den vermochte Hassan auch gesellschaftlich einzuordnen; denn, so behauptete Hassan: »Den Menschen erkennt man an seinem Schuhwerk!«
Staunend vernahm man die Botschaft des Alten, staunend vor allem deshalb, weil es nach Hassans Worten keinesfalls erstrebenswert erschien, neue Schuhe zu tragen, im Gegenteil. Nur Emporkömmlinge trügen stets neues Schuhwerk, ein wahrer feiner Mann pflege seine kostbaren gebrauchten Schuhe mit großer Achtsamkeit, vielmehr – er lasse pflegen, und das sehe man dem Schuhwerk einfach an. Schuhe müssten immer so aussehen, als habe sie schon der Vater bei seiner Hochzeit getragen, so gepflegt und gut erhalten; das verrate Stil, vor allem aber beweise es, dass sein Träger weder schmutzige Arbeit noch lange Wege nötig gehabt habe wie unsereins. Und dabei sah er auf seine untergeschnallten Autoreifen, und Omar blickte auf seine nackten Füße.
In einem Krüppelheim in Ain el Sira hatte Hassan lesen und schreiben gelernt, und wenn es die Zeit erlaubte, ließ der Alte den Jungen an seiner Fähigkeit teilhaben, indem er vor dem Mena House Suren des Koran mit einem Stock in den festgetrampelten Boden ritzte. Als Omar zehn war, konnte er die erste Sure schreiben und lesen, die mit den Worten beginnt: al-hamdu lillahi rabbi l-alamima r-rahmani r-rahimi – Preis sei Gott, dem Herrn der Welten, dem Barmherzigen, dem Erbarmer.
Omar war von dem Wunsch beseelt, eine Schule zu besuchen, aber der alte Moussa lehnte strikt ab; er selbst habe auch keine Schule besucht, trotzdem sei er etwas Rechtes geworden und immerhin so wohlhabend, dass er es sich leisten könne, einen wildfremden Jungen namens Omar Effendi aufzuziehen.
Die Bemerkung traf Omar schwer, und er lief weinend zu Hassan, der vor dem Mena House mit »polishing« beschäftigt war. Als er sein Werk an einer feinen Engländerin beendet hatte, winkte er Omar herbei, indem er mit der Bürste auf seinen Holzkasten klopfte und scherzhaft rief: »Polishing, Sir! Ein Piaster!«
Da erkannte er, dass sein junger Freund weinte, und er sagte: »Ein Ägypter kennt zwei Arten von Tränen, Tränen der Freude und Tränen des Schmerzes. Ich müsste mich sehr täuschen, wenn ich Tränen der Freude in deinem Gesicht erkennen würde.«
Der Junge wischte mit dem Handrücken über sein Gesicht und schüttelte den Kopf; dann kauerte er sich neben dem Mikassah auf die Erde. »Ich habe«, begann er stockend, »ich habe Moussa gefragt, ob er bereit sei, mich zur Schule zu schicken …«
Hassan fiel ihm ins Wort: »Ich kann mir denken, was er geantwortet hat«, und dabei spuckte er in weitem Bogen in den Sand. »Er hat gesagt, wozu brauchst du Schule; er selbst habe auch keine Schule besucht und sei etwas Rechtes geworden, stimmt’s?«
Omar nickte. Und unter einem Schwall von Tränen brach es aus ihm heraus: »Und er hat sogar gesagt, dass er es sich leisten könne, einen wildfremden Jungen namens Omar Effendi aufzuziehen. Hörst du, Omar Effendi hat er gesagt!« Und weinend vergrub er sein Gesicht in den Armen.
»Hör zu, Junge.« Der Alte legte Omar seine schmutzigen, braunen Hände auf die Schultern. »Du bist jung, du bist gescheit, und du hast zwei Füße, die dich tragen, wohin du willst. Sei geduldig. Allah wird dir deinen Weg weisen. Dein Leben ist vorgezeichnet wie die Bahn der Gestirne. Wenn es Allah gefällt, dich in eine Schule zu schicken, so wird er dich schicken. Hat er aber in seinem Herzen beschlossen, dass du ein Kameltreiber bleibst, so wirst du es bleiben ein Leben lang. Malesch – einerlei.«
Die Worte des weisen Mikassah trösteten Omar für kurze Zeit, und gewiss hätte er mit seinen Träumen gewartet, bis Allah ihm den vorgezeichneten Weg gewiesen hätte, wäre da nicht jener heiße, windige November gewesen, an dem der Chamsin den Sand in die Lüfte peitschte, dass der Himmel sich verdunkelte wie beim Jüngsten Gericht – sieben Tage ohne Unterlass. Die Augen tränten, und ohne Tuch vor dem Mund, das den Sand von der Lunge fernhielt, wagte sich niemand ins Freie. Die Menschen beteten um Regen; aber Allah kannte nur den heißen, stickigen, gnadenlosen Wind, der einem den Atem raubte.
Am achten Tag endlich, als der Chamsin abflaute und Menschen und Tiere wie benommen aus ihren Hütten hervorkrochen und nach Luft rangen wie an Land gespülte Fische, da wurde einer nicht mehr gesehen: der alte Moussa. Sein Herz hatte dem tobenden Wetter nicht standgehalten.
Sie zogen ihm ein weißes Laken über den Kopf, und so saß er in seinem hohen Lehnstuhl zwei volle Tage mit dem Gesicht nach Mekka wie ein Gespenst, weil für eine Bahre kein Platz war in dem Haus, und der Leichenbestatter erst später Zeit fand für sein Werk. Zu viele Opfer hatte der Chamsin gefordert.
Es war das erste Mal, dass Omar so unmittelbar mit dem Tod konfrontiert wurde, und der unter dem weißen Tuch verstorbene tote Moussa erschreckte ihn so, dass er sich zu Hassan flüchtete und schwor, das Haus des toten Moussa nie mehr zu betreten.
»Du Dummkopf!«, wetterte der Mikassah. »Glaubst du, er wird sich nachts, wenn in der Wüste die Schakale heulen, erheben und durch die Türe verschwinden oder in den Himmel fahren, wie es die Ungläubigen verkünden?« Und dabei spuckte er in hohem Bogen in den Sand.
Omar schämte sich; er schämte sich, weil er sich fürchtete, und er fürchtete sich vor etwas Unbekanntem. »Was verkünden die Ungläubigen?«, fragte er unvermittelt.
»Ach was!« Hassan reagierte unwillig und wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn; dann machte er mit dem Kopf eine Bewegung hin zum Mena House: »Alles Ungläubige, die Engländer, die Deutschen und die Franzosen. Alles Juden und Christen!« Und dabei spuckte er ein zweites Mal aus, als empfinde er allein bei der Aussprache Ekel.
»Aber du lebst von diesen Ungläubigen!«, rief Omar. »Wie kannst du sie verachten?«
»Allah weiß, was ich tue«, erwiderte Hassan, »und er hat bisher nicht zu erkennen gegeben, dass es ihm nicht recht wäre.«
»Also ist es ihm recht.«
Der Mikassah hob die Schultern und drehte die Handflächen nach außen. »Was soll ich machen? Wenn Allah nicht will, dass ich bettle und stehle, dann muss er damit einverstanden sein, dass ich Ungläubigen die Schuhe putze.« Bei diesen Worten begann er auf einmal lautstark mit der Bürste auf seinen Kasten zu schlagen. »Polishing, polishing, Sir!«
Ein großer, in eine sandfarbene Kakiuniform gekleideter Herr trat aus dem Hotel und blinzelte in die diffuse Sonne im Westen. Dann sah er an sich herab, ging geradewegs auf Hassan zu und stellte wortlos seinen rechten Fuß auf den Kasten. Hassan begann sein Werk mit theatralischen Bewegungen wie ein Säbeltänzer.
»Ein feiner Herr«, sagte der Mikassah zu Omar, ohne von seiner Arbeit aufzusehen, »das sieht man am Schuhwerk.«
»Ein Ungläubiger mit feinem Schuhwerk!«, korrigierte Omar.
Da lachte der feine Herr laut auf, und die beiden erschraken, weil er offensichtlich ihre Sprache verstand, und aus seiner Brusttasche fingerte er eine geschwungene Pfeife, und nachdem er sie liebevoll entzündet hatte, sagte er zu Hassan: »Du kennst viele Leute, Alter?«
Hassan nickte devot: »Viele, ya Saidi.«
»Hör zu, Alter«, begann der feine Herr, »ich bin Professor und werde die nächsten Jahre in Ägypten verbringen. Ich suche einen Diener, einen kräftigen jungen Mann, der für mich Botengänge erledigt, meine Frau auf den Markt begleitet, einfach ein Faktotum, verstehst du?»
»Ich verstehe, ya Saidi.«
»Kennst du jemanden, der für diese Aufgabe in Frage käme?«
»Man muss nachdenken, ya Saidi; aber ich bin sicher, dass ich jemanden finde.«
»Gut«, antwortete der feine Herr und warf dem Mikassah eine Münze zu. »Vielleicht findest du zwei oder drei zur Auswahl. Sie sollen morgen um diese Zeit hier im Hotel sein. Es soll dein Schaden nicht sein.« Grußlos ging er auf eine der schwarzen Droschken vor dem Hotel zu und verschwand.
Omar setzte sich auf Hassans Schuhputzkasten und zeichnete mit dem Finger Schlangenlinien auf das Holz. »Ob er mich nehmen würde, der ungläubige Said?«
»Dich? Ya salaam – du lieber Himmel!«
Omar ließ den Kopf hängen. Hassans Reaktion kränkte ihn, und er war den Tränen nahe.
Als er sah, was er angerichtet hatte, fasste der Mikassah den Jungen bei den Schultern und schüttelte ihn wie einen jungen Baum: »He, ist ja gut, ist ja gut!«