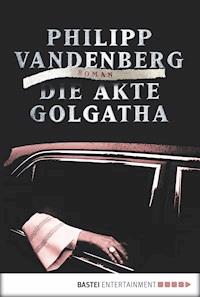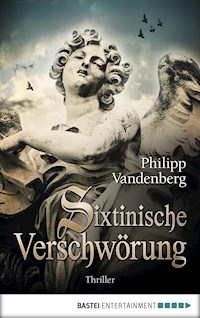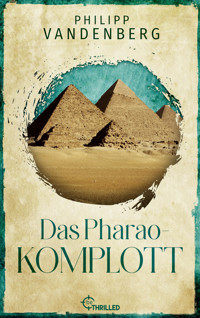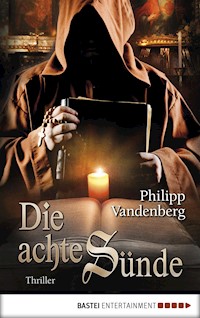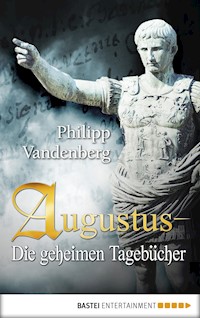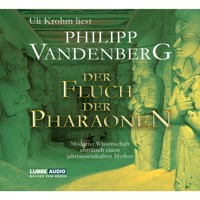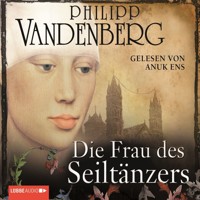4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Thriller von Bestseller-Autor Philipp Vandenberg
- Sprache: Deutsch
Sie ist schön wie Aphrodite. Die reichsten und klügsten Männer Griechenlands liegen der Hetäre Daphne zu Füßen. Doch sie verliebt sich ausgerechnet in einen Mann, der von ihr nichts wissen will: Themistokles aus Athen. Als Daphne jedoch von den Persern entführt wird, setzt Themistokles sein Leben für sie ein ...
Ein spannender, farbenprächtiger Roman von Bestseller-Autor Philipp Vandenberg über die Zeit der Perserkriege.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
Über den Autor
Weitere Titel des Autors
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Sie ist schön wie Aphrodite, und sie ist eine Frau ganz besonderer Art. Die reichsten und klügsten Männer Griechenlands liegen der Hetäre Daphne zu Füßen. Doch sie verliebt sich ausgerechnet in einen Mann, der von ihr nichts wissen will: Themistokles aus Athen. Als Daphne jedoch von den Persern entführt wird, macht er sich auf, sie zu suchen. Bestsellerautor Philipp Vandenberg schrieb diesen farbenprächtigen Roman nach authentischen Quellen aus der Zeit der Perserkriege.
Philipp Vandenberg
DIE TOCHTER DER APHRODITE
Roman
KAPITEL 1
Er fühlte einen Stich in der Herzgegend, als ob ihm ein kaltes, spitzes Messer zwischen die Rippen gestoßen würde, und einen Augenblick glaubte er, die Besinnung zu verlieren. Der staubende Pfad vor seinen Augen verschwamm und löste sich auf in eine undurchdringbare Wolke; er strauchelte und stürzte, den Ellenbogen der Linken schützend vor das Gesicht haltend. Schnaubend wälzte er sich zur Seite, spie den rötlich braunen Sand, der ihm in den Mund geraten war, von sich und zerrte wie wild am Riemen seines Kampfhelmes; dann schleuderte er ihn weit von sich. Torkelnd kam er wieder auf die Beine. Irgendeine Stimme sagte: »Diomedon, du musst rennen, du darfst jetzt nicht aufgeben! Lauf, Diomedon, lauf!«
Der Krieger riss sich die ledernen Schulterklappen vom Leib, schälte sich hastig aus seinem Brustpanzer und reckte befreit seinen nackten Oberkörper. Mechanisch, wie von selbst, begannen seine Beine zu laufen, mühsam und schwer zunächst, stampfend, doch dann auf einmal rannte Diomedon und setzte im Sprung über die knorrigen Wurzeln der Ölbäume, die seinen Weg kreuzten. Der rechte Fuß blutete.
Er mochte wohl vier Stunden gelaufen, gehetzt und gestolpert sein, das gnadenlose Licht der sinkenden Herbstsonne im Gesicht, vier Stunden, in denen seine pochenden Schläfen nur das eine Wort hämmerten: Sieg, Sieg, Sieg!
Nun aber löste sich der schmale, unwegsame Saumpfad aus dem Dickicht der silbrigen Ölbäume und führte über spitzes Karstgestein, das schmerzhaft durch seine Laufsohlen drückte; und auf einmal tat sich vor Diomedon ein Anblick auf, der all diese Qualen vergessen machte: Zu seinen Füßen lag Athen, und über der Stadt thronte die Akropolis.
Sieg! Diomedon wollte es herausschreien, aber seine ausgedorrte Kehle brachte keinen Ton hervor, die Lungen keuchten, die Schläfen pochten, als würden sie zerplatzen. Sieg! Miltiades, der siegreiche Feldherr, hatte ihm, Diomedon aus der Phyle Leontis, dem schnellsten Läufer in Attika, den Befehl erteilt: »Lauf, so schnell dich deine Füße tragen, nach Athen und melde dem Archonten: Wir haben gesiegt!«
Acht bis neun Stunden brauchten die athenischen Hopliten von den Sümpfen bei Marathon bis zur Agora. Diomedon war gerade vier Stunden unterwegs, und er hatte sein Ziel schon vor Augen, doch das letzte Stück des Weges schien endlos. Leichtfüßig war er bei den Sümpfen gestartet, jetzt stampften seine Füße nur noch schwerfällig auf dem Pflaster der Hauptstadt. Jeder Schritt schmerzte in der Leistengegend, und die ausgemergelten Wangen zuckten im Laufrhythmus.
Diomedon nahm die Menschen nicht wahr, die in einer Traube hinter ihm herrannten, aufgeregt fragend, welche Botschaft der Läufer wohl bringe. Keiner der Athener, die sich aus den Seitenstraßen dem wie im Traum laufenden Boten anschlossen, wagte ernsthaft auf einen Sieg zu hoffen. Wie sollte das kleine attische Heer, unterstützt von ein paar Hundert Platäern aus Böotien, die vielhunderttausendköpfige Phalanx der Perser bezwingen? Dareios, der Perserkönig, hatte von den Athenern zum Zeichen der freiwilligen Unterwerfung zwei Krüge mit Erde und Wasser gefordert, da hatten sie die Boten des Achämeniden in den Brunnen gestürzt. Jetzt nahmen die Barbaren furchtbare Rache.
Am Zwölfgötteraltar, wo Bettler und Arme wie gewöhnlich um hochherzige Spenden ihrer Mitbürger flehten, bog der Läufer, der totalen Erschöpfung nahe, zur Agora, dem Marktplatz der Hauptstadt, ein. Wie durch einen tanzenden Schleier nahm Diomedon das erzene Denkmal der Tyrannenmörder wahr, das in parischem Marmor leuchtende Buleuterion, wo der Senat sich hitzige Redeschlachten lieferte, und die Heliaia, den Volksgerichtshof, wo Tausende Gerechte über einen einzigen Ungerechten richteten.
Diomedons Schritte wurden langsamer und schwerfälliger, aber in traumwandlerischer Sicherheit tappte sein Körper auf die Stoa zu, zum Haus des Archonten. Das Lärmen der Athener, der Frauen, Alten und Kinder, die seinen Weg begleiteten, wuchs zu einem erregten Gebrüll und rief den Archonten auf die Eingangsstufen der Halle.
Diomedon hob den Kopf, erst jetzt schien er das Gedränge der Menschen um sich herum zu bemerken; er reckte seinen entkräfteten Körper, als wollte er dem höchsten Beamten des Staates in würdiger Haltung gegenübertreten. Der Archont, weiß gekleidet, hob wohlwollend beide Arme zum Gruß. Da blieb Diomedon stehen – er taumelte. Jäh verebbte das Geschrei der Athener.
Alle Augen richteten sich auf diesen wankenden, entkräfteten Läufer, der krampfhaft versuchte, seine müden Augen auf den Archonten zu richten. Der trat einen Schritt vor und streckte dem Boten die Hände entgegen. Diomedon versuchte, sie zu ergreifen, doch im selben Augenblick versagten seine Beine, die Knie knickten ein. Die Angst, zu guter Letzt seinen Auftrag nicht zu erfüllen, setzte er die letzten Kräfte frei, und im Fallen presste er einen Schrei aus seiner Brust: »Nenikekamen! – Wir haben gesiegt!«
Sieg! Starr, wie vom Donner des Zeus gerührt, standen die Athener da und blickten auf den zusammengebrochenen Läufer. Das Unerwartete, unfassbare lähmte ihre Glieder. »Wir haben gesiegt!« Von irgendwoher kam der leise, zaghafte Ruf. Schließlich ein zweiter: »Wir haben gesiegt!« Und auf einmal scholl er aus Hunderten von Kehlen: »Wir haben gesiegt! Die Perser sind geschlagen!«
Wie trunken stürzten sich die Athener auf den am Boden liegenden Läufer und zerrten an Armen und Beinen; ein paar Männern gelang es, Diomedon hochzuheben, und sie trugen ihn über ihren Köpfen. Jetzt sahen es alle: Der Siegesbote war tot. Kopf und Arme hingen leblos herab. Wortlos bahnten sich die Männer eine Gasse durch die Menge in Richtung auf das Denkmal der Tyrannenmörder. Es galt als Symbol der Freiheit und zeigte den Tyrannen Hipparchos, der von zwei Athenern erdolcht wurde. Behutsam legten die Träger die Leiche des Läufers auf den weißen Marmorsockel des Denkmals. Frauen und Mädchen bildeten eine Schlange, und eine nach der anderen trat vor und küsste den toten Siegesboten.
Dämmerung senkte sich über die Ebene von Marathon. Das millionenfache Zirpen der Zikaden hämmerte in den Köpfen der griechischen Soldaten. Miltiades, der athenische Sieger, hatte den Hauptmann Aristides mit seinen Soldaten auf dem Schlachtfeld zurückgelassen. Sie sollten über Beute und Gefangene wachen und die getöteten Griechen zusammentragen. Er selbst war mit den acht übrigen Feldherren in Richtung Athen gezogen; denn er erwartete nach der Niederlage der Perser einen Angriff der Achämeniden-Flotte auf die Hauptstadt.
In der Mitte des aus Wagen und Zaungittern gebildeten Heerlagers loderte ein Feuer. Hopliten in schweren Rüstungen lagen herum, kauten Weidenzweige und spuckten die Rinde in die Flammen, dass es zischte. Andere brachten in ihren Helmen Wasser vom nahen Fluss und reichten sie den übrigen zum Trinken.
»Da, seht!«, sagte Aristides und zeigte aufs Meer hinaus. Vor der qualmenden Silhouette der Insel Euböa zogen schwarze Schatten in Richtung Süden – Perser-Schiffe. »Sie werden Kap Sunion umrunden und mit der ersten Morgenröte Athen von Süden her angreifen. O popoi – entsetzlich!«
»O popoi!«, wiederholte Kallias, der Fackelträger. Man hätte ihn mit seinem langen schwarzen Bart für einen persischen Kriegsgefangenen halten können; dabei war Kallias nach dem Hierophanten der höchste priesterliche Beamte im Mysterienheiligtum von Eleusis. »Wir haben sieben Schiffe erbeutet, aber was bedeuten die schon angesichts der vielen Hundert, hinter denen sich die Perser noch immer verschanzen. Wenn uns wenigstens einer ihrer Feldherren ins Netz gegangen wäre!«
»Die beiden kämpften, umgeben von einer Horde maskierter Schildträger und furchterregender Bogenschützen; nicht einmal Zeus, der Blitzeschleuderer, hätte den Achämeniden niedergestreckt!« Aristides machte eine unwillige Handbewegung.
Kallias blickte zum Horizont, wo die Insel in der Dunkelheit versank: »Sieben Tage hielt Eretria den Belagerern stand. Und heute? Heute ist die Inselhauptstadt ein riesiger rauchender Trümmerhaufen. Möge Zeus’ männergleiche Tochter Athene unsere Hauptstadt beschützen!«
»Athene wird es nicht zulassen, dass ihre goldglänzenden Heiligtümer in Schutt und Asche fallen«, antwortete Aristides. »Denn hätte Athene nicht ihre schützende Hand über unsere Hopliten gehalten, niemals wären wir als Sieger hervorgegangen. Die Schwerbeweglichkeit unserer Schlachtordnung und die Empfindlichkeit unserer Flanken wären ein Leichtes für die geschickte Reiterei der Barbaren gewesen. Doch bei unserem Angriff waren die Pferde des Artaphernes auf ihren Schiffen …«
Noch immer hallten die Schreie der Verletzten über die Ebene von Marathon. Mit Fackeln bewaffnet, streiften Soldaten des Aristides durch das nächtliche Tal und trafen immer wieder auf Verwundete aus ihrer Truppe. Kallias griff nach einem knorrigen, brennenden Ast im Feuer und suchte sich einen Weg nach Nordosten zu dem Sumpfgelände, in das sie die geschlagenen Perser getrieben hatten. Er stieg über tote Barbaren, die sterbend ihre Waffen umklammert hatten, und manche schauten zu ihm hin und lächelten – ein furchterregender Anblick.
Keine fünf Stadien vom Lager entfernt stolperte Kallias über einen kunstvoll gekrümmten persischen Bogen, der mit funkelndem Perlmutt besetzt war. Als er sich bückte, um ihn aufzuheben, merkte er, dass eine blutverkrustete Hand ihn umklammerte. Kallias stutzte, er trat mit dem Fuß auf den Unterarm des Kriegers, um dem Gefallenen das kostbare Stück zu entwinden, doch der brüllte wie ein auf der Jagd getroffener Löwe, warf sich herum, rappelte sich auf und fiel vor dem Fackelträger auf die Knie. Soweit man seinen Gesten entnehmen konnte, flehte er um Gnade. Kallias griff zum Schwert.
Da riss sich der Barbar in Todesangst ein blinkendes Etwas vom Hals und reichte es dem eleusischen Priester, während er mit dem Kopf ehrerbietig nickte. Kallias begutachtete das Geschenk im Fackelschein: eine Kette, zusammengesetzt aus zahllosen dünnen Goldplättchen. Zufrieden ließ er das Schmuckstück in einer Falte seines Gewandes verschwinden.
Der Perser, noch immer auf den Knien, versuchte sich krampfhaft ein Lächeln abzuringen, fuchtelte unverständlich mit den Armen herum und deutete in Richtung auf die Sümpfe, als könnte er dem Griechen dort eine riesige Menge solcher Kostbarkeiten zeigen. Kallias stutzte. Gold und Reichtum der Achämeniden waren berühmt, und gewiss schleppten die Feldherren der Barbaren auf ihren jahrelangen Beutezügen eine Menge davon mit sich herum, aber schien es nicht unwahrscheinlich, dass sie es ausgerechnet hier in der Bucht von Marathon versteckt haben sollten?
Kallias’ Neugierde war größer als die Bedenken vor einem Hinterhalt, in den ihn der Barbar locken könnte. In Rufweite befanden sich griechische Soldaten. Also zog der Priester sein Schwert und ging hinter dem Perser her, mit der Fackel jedes Buschwerk, jeden Erdwall ausleuchtend. Vor zwei frei stehenden Zypressen blieb der Barbar auf einmal stehen, scharrte auf dem lockeren Boden und bedeutete, hier sei die Stelle. Der Fackelträger rammte sein Schwert in die umgepflügte Erde und spürte harten Widerstand. »Aufgraben!«, herrschte er den feindlichen Soldaten an.
Mit bloßen Händen schaufelte der Perser in dem trockenen Erdreich. Kallias hielt die Fackel näher, und der Barbar zog ein blinkendes Henkelgefäß aus dem Versteck. Strahlend zeigte er es dem Griechen, so als wollte er sagen: Na, habe ich dir zu viel versprochen?
Kallias griff gierig nach dem kostbaren Stück, wog es bedächtig in der Linken und bedeutete dem Barbaren, er solle weiterwühlen. Der Perser kniete nieder und begann erneut zu scharren: Eine Deckelvase, zwei Armspangen und mehrere flache Schalen kamen zum Vorschein. Argwöhnisch blickte der Grieche sich um, hob die Fackel hoch über den Kopf und leuchtete die nähere Umgebung ab, ob ihn auch wirklich niemand beobachtete. Durch das ohrenbetäubende Zirpen der Zikaden drangen vereinzelt die Rufe der griechischen Soldaten, die einen Verletzten auf dem Schlachtfeld entdeckt hatten und Hilfe anforderten.
Kallias steckte seine Fackel in den Boden. Er trat von hinten an den Perser heran, packte sein Schwert mit beiden Händen und stieß es dem Feind in den Rücken. Der gab einen schnarrenden, gurgelnden Laut von sich und sank langsam nach vorne in die Grube. Ein Blutschwall trat aus der Stichwunde, als der Grieche die Waffe aus dem Getroffenen herauszog, und ergoss sich über das goldene Geschirr, das der Barbar unter sich begrub.
Um das Blut abzuwischen, steckte der Priester das Schwert in den Boden. Als er aufsah, stand vor ihm ein zierliches Mädchen. Sein kurzer, ärmelloser Peplos hing nass und zerfetzt an dem wachsgleichen Körper. Eine spitze, kindliche Brust ragte hervor. Das blonde Haar fiel in Strähnen über das schmale Gesicht. Die Beine leuchteten nackt bis zu den Oberschenkeln. Das schöne Kind hielt den perlmuttverzierten Bogen des toten Persers in der Hand und blickte ihn mit großen Augen an.
Kallias wischte sich mit dem Unterarm über die Stirn. War ihm Artemis, die bogenbewehrte Jägerin, die todbringende Schwester Apollons, erschienen? Beim Zeus, das war kein Traum, vor ihm wuchs ein leibhaftiges Mädchen aus dem Boden, schön wie eine junge Göttin. Der Priester fröstelte bei dem Gedanken, dass sie ihn bei dem hinterhältigen Mord beobachtet haben könnte, und er erhob sich.
»Woher kommst du?«, fragte der Grieche in seiner Sprache, denn für ihn schien klar, dass es sich um eine Griechin handelte.
Das Mädchen deutete mit dem Bogen zum Strand. Es schwieg.
»Hast du etwas gesehen?«, fragte Kallias ungeduldig.
Das schöne Kind hob die Schultern.
»Ob du etwas gesehen hast, will ich wissen!«, rief Kallias drohend und trat ganz nahe vor die Fremde hin.
Sie schüttelte hastig den Kopf. »Ich heiße Daphne«, sagte sie unvermittelt, »ich komme aus Lesbos.«
»Aus Lesbos?«
»Mein Vater ist Artemidos aus Mytilene.«
Kallias nahm die Fackel aus der Erde und leuchtete das Mädchen ab, als wollte er die Geschichte nicht so recht glauben. »Und wie kommst du übers Meer?«, fragte er schließlich und steckte die Fackel wieder in den Sand.
Daphne blickte in die Richtung, aus der das Rauschen des Meeres kam, und sagte: »Die Barbaren sind wie wilde Tiere über die Inseln Ioniens hergefallen. Sie haben geraubt und geplündert und auf ihre Schiffe geladen, was ihnen in die Hände fiel, und sie versündigten sich an Hab und Gut, an Männern und Frauen …«
»Auch an dir?«
Daphne schlug die Augen nieder, sie schwieg. Als Kallias mit tapsigen Fingern ihre kleine Brust berührte, wich das Mädchen zaghaft zurück.
»Wie alt bist du?«, erkundigte sich der Fackelträger und fasste Daphne am Kinn.
»Ich kam in der 69. Olympiade zur Welt«, antwortete die Ionierin, während sie die Strähnen ihres Haares aus dem Gesicht strich, »Zeus schenkte mir vierzehn Lebensjahre.«
Über Kallias’ bärtiges Gesicht huschte ein süffisantes Lächeln. Wortlos trat er ein paar Schritte zurück. Ohne das Mädchen aus den Augen zu lassen, bückte er sich, zog den toten Barbaren aus der Grube, stieß die Goldgefäße mit dem Fuß in das Erdloch und scharrte etwas Sand darauf. Dann nahm er die Fackel in die Linke, sein Schwert in die Rechte und ging langsam und drohend auf Daphne zu. »Komm!«, zischte er leise, als sollte es niemand hören. »Komm schon!«
Das Mädchen verfolgte jede Bewegung des Alten mit weit aufgerissenen Augen; aber in diesen Augen verbarg sich keine Angst. Wachsam reagierte die Vierzehnjährige auf jede Bewegung des Fackelträgers, wich selbst einen Schritt zurück, in jeder Sekunde bereit, dem stämmigen Krieger auszuweichen.
»Komm schon!«, wiederholte Kallias, und seine Stimme klang kalt und drohend. In einem Augenblick der Unachtsamkeit stolperte der Fackelträger und schlug vornüber in das zertrampelte Steppengras, das sofort Feuer fing. Kallias schien es nicht zu bemerken, vielleicht war er aber auch mit dem Kopf auf den Schaft seines Schwertes gestürzt, sodass er für kurze Zeit ohnmächtig liegen blieb.
Daphne sah gerade noch, wie die Flammen auf das weite Gewand des Alten übergriffen, dann drehte sie sich um und rannte, so schnell sie konnte, in Richtung auf das Heerlager der Griechen. Im gespenstisch fahlen Licht des Mondes stolperte das Mädchen über erschlagene und erstochene persische Soldaten, bis es das im Fackelschein liegende Lager erreichte. Am Eingangstor, aufgetürmt von hochrädrigen Versorgungswagen, kreuzten zwei Hopliten in voller Rüstung ihre Lanzen. Wortlos packten sie das zierliche, halb nackte Kind und zerrten es vor das prächtige Feldherrnzelt in der Mitte des weiten Runds. Jetzt liefen auch andere Soldaten zusammen, um das schöne Mädchen zu begaffen.
Aristides trat aus seinem Zelt. »Wir haben sie vor dem Lager aufgegriffen!«, sagte einer der Hopliten und stieß sie vor die Füße des Feldherrn. Daphne schlug mit den Ellenbogen auf, es schmerzte, doch am Boden kriechend, wandte sie den Kopf zur Seite und musterte mit zornglühendem Blick den Mann, der ihr diese Schmach bereitet hatte.
Aristides half dem Mädchen auf die Beine, und noch ehe er eine Frage stellen konnte, sagte das schöne Kind, nach Atem ringend: »Schlagt mich nicht, ich bin eine Ionierin und auf eurer Seite!«
Der Feldherr schob mit einer Armbewegung die Soldaten beiseite. »Woher kommst du?«, erkundigte sich Aristides staunend, und Daphne berichtete stockend, persische Horden hätten sie und ihren Vater Artemidos von der Insel Lesbos entführt. Im Schlachtengetümmel von Marathon sei es dann ihr und ihrem Vater gelungen, vom Schiff zu springen. Doch während sie schwimmend die rettende Küste erreicht habe, sei Artemidos im Pfeilhagel der Barbaren untergegangen.
»Gebt sie uns als Siegesgeschenk!«, schrie einer der raubeinigen Soldaten, und ein anderer grölte: »Das haben wir uns schließlich verdient!« Die übrigen schlugen mit den Schwertern auf ihre Schilde und skandierten: »Her mit dem Mädchen aus Lesbos! Her mit dem Mädchen aus Lesbos!«
Daphne sah den Feldherrn mit flehenden Augen an. Verzweifelt versuchte sie, in den harten Gesichtszügen des Mannes irgendeine Reaktion zu erkennen; aber weder seine schmalen, zusammengepressten Lippen noch der kühle, durchdringende Blick seiner Augen verrieten, was in Aristides vorging, und vielleicht hatte er auch einen Augenblick gezögert, ob er den Hopliten nachgeben sollte, dann aber gab er mit fester Stimme den Befehl: »Hinaus aufs Schlachtfeld! Entzündet die Totenfeuer!«
Die Soldaten gehorchten widerwillig, sie maulten und fluchten. »Melissa soll kommen!«, rief Aristides, und ein Sklave lief eilends zu einem der Zelte in der vorderen Reihe. Er schlug den Vorhang zurück, und hervor trat eine Frau im dünnen Chiton, einem langen ärmellosen Gewand, das ihre üppigen Körperformen mehr dekorierte als verhüllte.
»Du hast mich rufen lassen, Herr«, sagte Melissa mit einem Lächeln, das jäh erstarrte, als sie Daphne sah.
»Wir haben sie auf dem Schlachtfeld aufgegriffen«, erklärte Aristides, »sie behauptet, die Perser hätten sie aus Lesbos entführt. Sie spricht ionischen Dialekt. Du sollst dich ihrer annehmen, jedenfalls fürs Erste.«
Melissa trat vor das Mädchen hin, musterte es von Kopf bis Fuß und fragte schließlich: »Wie heißt du, mein Kind?«
»Daphne«, antwortete das Mädchen und starrte bewundernd auf die vollen, großen Brüste Melissas, die sich in langsamen Bewegungen hoben und senkten.
Melissa lächelte: »Daphne – wie die Geliebte Apolls, die sich seiner Liebe durch Flucht entzog. Apollon verwandelte sie in einen Lorbeerbaum. Möge dir ein ähnliches Schicksal erspart bleiben.« Und dabei fasste sie das Mädchen am Arm und führte es in ihr Zelt.
Im Innenraum tat sich eine seltsame Welt auf. Gelb flackernde Öllämpchen verbreiteten von den Gold schimmernden Kandelabern in Kopfhöhe ein warmes, weiches Licht und zauberten gleichzeitig skurrile Schatten an die safrangelb verhängten Wände. Von der Decke hing ein vielfarbiger Baldachin, dekoriert mit glitzernden Perlschnüren, und den festgetrampelten Boden deckten kostbare persische Teppiche. Daphne war verzaubert.
Ein gutes Dutzend Frauen von der Schönheit Aphrodites, zwei davon im Mädchenalter wie Daphne, saßen, lagen und rekelten sich auf weichen phönizischen Polstern. Und über allem hing der betörende Duft von Rauchwerk, das in kleinen zierlichen Öfchen glühte, die überall herumstanden. Obgleich es wohlig warm war in dem Zelt, kreuzte Daphne die Arme vor der Brust, als fröre sie – sie kam sich nackt vor.
Melissa schien die Gefühle des Mädchens zu erahnen. Sie wies auf einen Vorhang in der Ecke des Zeltes, hinter dem riesige schwarzrot bemalte Tonkrüge standen, angefüllt mit parfümiertem Wasser. »Hier kannst du dir den Staub des Schlachtfeldes vom Körper spülen, die Badesklavinnen werden dir behilflich sein.«
Willenlos ließ Daphne mit sich geschehen, was den Sklavinnen aufgetragen war. Sie zogen ihr das zerschlissene Kleid aus, gossen duftendes Wasser über sie und massierten ihre Haut von Kopf bis Fuß mit weichem Speckstein. In flauschigen Tüchern getrocknet, musste Daphne niederknien, damit die Dienerinnen ihr langes Blondhaar kämmen und in zahlreiche dünne Zöpfe flechten konnten. Der nackte Poseidon vor ihren Augen ging auf seine schöne Gemahlin Amphitrite zu, die, wogenumbraust, sich dem Anblick der Meergötter preisgab. Die Malerei auf einem der großen Krüge wurde auf einmal lebendig, und Daphne fiel in eine Art Traum; Zweifel überkamen sie: War es Wahrheit oder Trug, was um sie herum ablief?
Weit, so weit lag ihre Kinderzeit und Jugend jenseits des sonnendurchfluteten Meeres auf der felszerklüfteten Insel Lesbos, wo sie im Kreis der schönen Gongyla aus Kolophon Dichtung und Lebensart der sagenumwobenen Sappho erlernt hatte. Die schönen Künste der Musen, feine Sitten und häusliche Arbeiten waren ihr Lebensinhalt und hatten Tag und Nacht ihres Schülerinnendaseins ausgefüllt, das ihr eine große Zukunft an der Seite eines Mannes versprach. Doch dann, ungeahnt, waren von Süden her am Horizont die hoch getakelten Schiffe der Barbaren aufgetaucht; ein grausamer, nicht enden wollender Regen feindlicher Pfeile hatte sich über die Insel ergossen und die Hälfte von ihnen getötet. Der traurige Rest blieb eine lustvolle Beute der mörderischen Männerhorde aus dem unendlichen Asien. Ihr Schicksal schien besiegelt.
Aber ihre heißen Gebete zu Zeus wurden erhört. Von den Moiren veranlasst, die das Schicksal der Menschen spinnen, war Daphne mit ihrem Vater vom Schiff der gefangenen Lesbier gesprungen. Im Getümmel, dem Lärm und Chaos der Schlacht von Marathon hatte Daphne das attische Ufer erreicht, jedoch Artemidos, ihren Vater, Poseidons Wogen geopfert. Nach Stunden der Angst, Trauer und Hoffnungslosigkeit war sie tränenleer. Welches Los hatte Lachesis, die Schicksalsgöttin, ihr zugeteilt? Oder hatte Atropos, die »Unabwendbare«, ihren Lebensfaden schon zerschnitten?
Mit einem zart getönten Peplos auf den Armen trat Melissa hinter den Vorhang. Als sie der ratlose Blick des Mädchens aus Lesbos traf, sprach sie tröstende Worte: »Sei guten Mutes, mein Kind, Athen hat eine Schlacht gewonnen, die jedermann verloren glaubte, ganz Attika jubelt. Miltiades zerschlug das Millionenheer der Perser!«
Daphne reagierte nicht. Als blickte sie durch Melissa hindurch, saß sie da, starr und regungslos – sie hatte Angst. Da trat die Frau hinzu, zog das nackte, feingliedrige Mädchen zu sich und streichelte ihm zärtlich über den Rücken. Melissa spürte, wie sich der zerbrechliche Körper an sie schmiegte, widerspenstig zuerst, dann aber hingebungsvoll und schließlich sich ergebend.
»Hab keine Furcht«, sagte Melissa, »Aristides hat dir das Sklavenschicksal erspart, als er dich aus den Fängen der Hopliten befreite.« Sie trat einen Schritt zurück und musterte Daphne. »Er hat wohl erkannt, dass ein Mädchen wie du für einen einzigen Mann viel zu schade ist.«
Daphne sah Melissa fragend an. »Man hat mich gelehrt, einem Mann zu dienen in liebender Verbundenheit. Ich beherrsche Flötenspiel, Reigentanz und Gesang und weiß den kurzen Peplos mit gleicher Anmut zu tragen wie das lange Festgewand.«
»Das eben ist es, was ich meinte«, unterbrach Melissa, »du bist kein Mädchen, dem man, vom Gynaikonomos achtsam begleitet, so einfach auf der Agora begegnet. Die meisten Athenerinnen sind schlaff wie ein Mederweib, dumm wie ein Faustkämpfer in der Palaistra und nichtsnutzig wie eine paphlagonische Sklavin. Du hingegen hast einen Körper wie eine durchtrainierte Spartanerin, und deine Rede ist klug wie eine Ode der Sappho; die Götter werden nicht zulassen, dass du deine Tage im Frauengemach eines geldgierigen Lustmolchs verbringst, der dich vor aller Welt versteckt hält und dich nur als Gebärerin einer standesgemäßen Anzahl lärmender Kinder betrachtet – vorausgesetzt, du bringst eine Mitgift in die Ehe, die sein eigenes Vermögen übertrifft!«
»Mein Vater hatte ein respektables Vermögen angehäuft, von dem er glaubte, es mir in die Ehe geben zu können; nun aber, nach der persischen Katastrophe …«
»Darüber musst du dir keine Gedanken machen. Du bist jung, dein Kopf und dein Körper sind ein Kapital, das ausreicht, Kriege zu finanzieren.«
»Aber ich will mich nicht verkaufen!«, entgegnete Daphne. »Zu Hause auf Lesbos hat man mich alle Tugenden des Lebens gelehrt.«
Melissa lächelte. »Tugend! Ist es Tugend, dein Leben irgendeinem Mann zu opfern, nur dafür, dass er für dich sorgt, dich kleidet, dich speist, dein Vermögen verwaltet? Du hast als Frau dieselben Rechte wie ein Mann; denn du bist nicht weniger klug, nicht weniger stark als ein Ephebe. Sieh sie dir doch an, diese weichlichen Jünglinge. Zur Schule wird ein jeder von einem hohlköpfigen Paidagogos begleitet, der die Schreibtafel trägt und am Unterricht teilnimmt, damit sich das Bürschchen nicht überanstrengt. In Sparta lernen die Frauen den Ringkampf, sie sind kräftig und gelten als die gesündesten und schönsten unter allen Frauen der Hellenen. Sind aber unsere Jünglinge erst einmal dem Kindesalter entwachsen, dann lauern mindestens zehn unserer Männer auf jeden. Und auch die tapferen Feldherren machen da keine Ausnahme, Miltiades nicht und Aristides nicht und Themistokles ebenso nicht. Man sagt, die Feindschaft zwischen Aristides und Themistokles habe ihren Ursprung in der Rivalität um den schönen Jüngling Stesileos von der Insel Keos. Jeder wollte den Schönling für sich alleine haben. Seither bekämpfen sie sich, wo immer sie nur können. Ein Wunder, dass die Athener die Schlacht gewonnen haben, wo die beiden in der Schlachtreihe nebeneinanderstanden!«
»Aber es ist nichts Schändliches, wenn ein Mann einen Knaben liebt«, entgegnete Daphne, »die olympischen Götter sind uns doch Vorbild: Zeus liebte den Ganymed, Apoll den Hyakinthos und Poseidon den schönen Pelops. Männer sind nun einmal das schönere Geschlecht!«
Melissa machte eine unwillige Handbewegung: »Von Schändlichkeit habe ich nichts gesagt. Wo aber steht geschrieben, der Mann sei das schönere Geschlecht? Ich jedenfalls finde den Reigentanz der Knaben beim Fest der Hyakinthien weit weniger anmutig als den Mädchenreigen im Aphroditetempel von Korinth.«
»Du«, erkundigte Daphne sich vorsichtig, »du ziehst die Frau dem Manne in jedem Falle vor?«
»O nein!«, lachte Melissa. »Wäre ich sonst eine Hetäre geworden? Den Penis eines begierlichen Mannes zu spüren, ist noch immer das erregendste Gefühl für eine Frau. Aber schließt das denn aus, dass eine Frau die Anmut, Liebessehnsucht und Zärtlichkeit einer Geschlechtsgenossin sucht?« Bei diesen Worten strich Melissa dem Mädchen sanft über die rosige Wölbung des Bauches, dass Daphne wie zur Abwehr einen kleinen Schritt zurücktrat.
Und hastig erwiderte sie: »Ich bin für die edelsten Empfindungen erzogen …«
»Beim Zeus und seiner schaumgeborenen Tochter Aphrodite!« Melissa lachte laut. »Niemand will dir deinen Edelmut streitig machen. Nur – Edelmut ist ein übermenschliches Ding und schwankend wie ein Schilfrohr im Wind. Dem einen erscheint als höchste Tugend, was der andere als verwerflich wähnt. Sind wir Hetären denn verwerflich, weil wir mit den Männern in den Krieg ziehen, uns ihnen hingeben, um ihre Kampfmoral zu steigern? Kein Hellene denkt so; denn ihre Ehefrauen meiden die Schlacht. Der Feind hingegen sieht unser Tun als verwerflich an. Dessen bin ich sicher.«
Daphne nickte stumm, zog sich das frische Kleidungsstück über, schob den Vorhang beiseite und meinte mit einem Blick auf die anderen Frauen: »Und sie sind allesamt …?«
»Gewiss. Die zehn begehrtesten Hetären Athens, für die zehn hervorragendsten Feldherren der Athener. Und wir – wir sind – stolz …«
Entsetzt starrte das Mädchen auf Melissa, bei deren letzten Worten sich plötzlich ein Schwall Blut aus ihrem Mund ergoss. Ein breites rotes Rinnsal floss über ihr Kleid.
Daphne wollte schreien, aber sie brachte keinen Laut hervor. Sie blickte in die weit aufgerissenen Augen Melissas, die sich langsam himmelwärts drehten, sah, wie die Frau langsam zusammensackte und schließlich nach vorne fiel. In ihrem Rücken steckte ein Pfeil.
Durch den Sturz aufgeschreckt, schrien die anderen wild durcheinander. Eine der Hetären zeigte auf die Zeltwand, in die ein Loch gefetzt war.
Weiß-rosa Morgenröte umspielte die Säulen des Poseidon-Tempels hoch über den Klippen von Kap Sunion. Von tief unten drang das Schlagen der Wogen herauf zu dem Heiligtum, das still und verlassen dalag, den persischen Horden preisgegeben. Zwei Priester, die sich in den Magazinen versteckt hatten, wischten sich den Schlaf aus den Augen und schlichen, vorsichtig um sich blickend, zu dem Opferaltar, der den Mittelpunkt des weiten Platzes vor dem Tempel bildete. An der Umfassungsmauer angelangt, starrten sie hinunter auf den Gischt in der Tiefe und suchten das Ufer nach Feinden ab.
Plötzlich zog der eine den anderen Priester am Ärmel und deutete wortlos auf die hohe See hinaus, wo am Horizont eine nicht enden wollende Flotte von Schiffen sichtbar wurde. Die tief stehende Sonne erschwerte das Schauen, und während sie die flache Hand über die Augen hielten, murmelten beide in einem fort: »Poseidon, Hüter der Meere, lass Gnade walten über unser Land.«
Minuten mochten vergangen sein, und ihre Augen begannen zu tränen, da stieß der eine den anderen in die Seite und sagte: »Ich habe den Eindruck, die Schiffe werden nicht größer, sondern kleiner!«
»Ja«, antwortete der andere zögernd, »mir kommt es auch so vor.«
Schließlich brachen beide in Jubelgeschrei aus: »Sie ziehen sich zurück! Sie fliehen, die Perser fliehen!«
Inzwischen war Miltiades mit dem athenischen Heer nächtens in Richtung auf die Hauptstadt zurückgeeilt und hatte in der Ringschule Kynosarges nahe dem Olympieion Stellung bezogen, von wo man die Bucht von Phaleron gut übersehen konnte. Nach dem Tod des athenischen Heerführers Kallimachos musste Miltiades das Oberkommando übernehmen.
An seiner Seite stand Themistokles, stiernackig und gedrungen, aber von lebhafter Jugendlichkeit. Die Hopliten lagerten, an ihre Schilde gelehnt. Der neunstündige nächtliche Eilmarsch in voller Rüstung hatte ihre Kräfte aufgezehrt, aber das Bewusstsein der gewonnenen Schlacht setzte ihre letzten Reserven frei.
»Sie müssten längst da sein!«, rief Themistokles dem Polemarchen zu.
Miltiades hob die Schultern, spähte unschlüssig über das Meer und antwortete mit einem Seufzer: »Ich kann nicht glauben, dass sich die Barbaren so einfach geschlagen geben. Gewiss, die Schlacht ging für sie verloren, aber das ist für den Perserkönig noch lange kein Grund, Hellas aufzugeben.«
»Ihre Verluste sind vieltausendfach!«, gab Themistokles zu bedenken, aber der alte, bärtige Miltiades schüttelte den Kopf. »Selbst wenn sie fünf- oder zehntausend ihrer Bogenschützen verloren haben, dann stehen noch immer Hunderttausende bereit, um jeden Gefallenen durch zehn neue Männer zu ersetzen. Ihre Flotte verlor sieben Schiffe. Sieben von sechshundert! Und die persische Reiterei kam nicht einmal zum Einsatz. Während unser Heerführer von den Pfeilen der Barbaren durchbohrt wurde, konnten ihre beiden Polemarchen fliehen. Nein, es käme einem Wunder gleich, würden die schwarzen Masten der Barbarenflotte nicht sogleich dort am Horizont auftauchen!«
»Aber dann sind wir verloren!«, stieß Themistokles hervor, »die Männer meiner Phyle sind am Ende ihrer Kräfte. Beim Zeus, wie sollten sie Athen verteidigen?«
Miltiades machte ein ernstes Gesicht. »Betet zur mutterlos aus dem Kopf des Zeus entsprungenen Tochter Athene, sie möge nicht zulassen, dass diese ihre Stadt den Barbaren zum Opfer falle.«
»Schweigt!« Themistokles legte die Hand auf den Mund und lauschte. Jetzt hörten es auch die anderen. Von Westen her drangen die dumpfen Schläge von Kesselpauken, als diktierten sie den Marschrhythmus eines Heeres. Die ersten Hopliten sprangen erschreckt auf und griffen nach ihren Lanzen. Bedrohlich näherte sich der Schlagrhythmus dem Lager. Und alle Augen waren auf Miltiades gerichtet. Da stürmte ein Läufer in das Lager: »Die Spartiaten!«, rief er von Weitem.
Die attischen Feldherren sahen einander verdutzt an. Vor der Schlacht hatten sie Pheidippides nach Sparta gesandt, ihren schnellsten Boten, mit der Bitte, eine Hilfstruppe zu senden, die Insel Euböa stehe bereits unter dem Sklavenjoch. Pheidippides aber war mit der Antwort zurückgekommen, die Spartaner seien zur Hilfe bereit, ein Spruch der Götter hindere sie jedoch, vor Vollmond auszurücken. Das war am neunten Tage des Mondmonats. So hatten die Athener, unterstützt von einer Abordnung Platäer, die Schlacht allein geschlagen.
»Es sind schon verwegene Kämpfer, diese Spartiaten«, bemerkte Themistokles beim Anblick der aufmarschierenden Truppe. Die schwer bewaffneten Kämpfer trugen furchterregende Helme, tief über das Gesicht gezogen, mit Sehlöchern und Nasenschutz. Ihre lederbewehrten Körper verschwanden hinter halbrunden, beinahe mannshohen Schilden.
»Ihr Leben ist der Krieg«, antwortete Miltiades und hob den Arm zum Gruß, »wären es ihrer mehr, sie könnten selbst den Barbaren die Stirne bieten. Doch so ernst scheint es ihnen mit ihrem Hilfsangebot nicht gewesen zu sein. Nicht nur, weil das Heer zu spät kommt, es wird auch von keinem ihrer Könige angeführt.«
Murrend machten die athenischen Hopliten den Spartanern Platz. Diese, es mögen zweitausend gewesen sein, formierten sich in vier quadratische Blöcke, und ihr Führer trat vor Miltiades mit den Worten: »Spartas Könige senden mich, den Polemarchen Lysias, zur Unterstützung des athenischen Heeres gegen die Barbaren!«
Miltiades lachte spöttisch: »Zu spät, zu spät! Wenn ihr Männer aus Sparta eure Schlachten von der Sichel des Mondes kommandieren lasst, werdet ihr schon bald das Nachtgestirn der Achämeniden bestaunen können, als geknechtete Siedler in der Provinz Elam oder als Periöken in der Hauptstadt Susa. Wir Athener haben die Barbaren mit Unterstützung der Platäer in die Flucht geschlagen – jedenfalls sind sie bisher nicht zurückgekehrt.«
Da machte Lysias, ein hochgewachsener, drahtiger Spartaner mit struppigen schwarzen Haaren, ein dummes Gesicht und stammelte Worte der Entschuldigung, Sparta liege über tausend Stadien von Attika entfernt, selbst in Eilmärschen brauche ein Heer drei Tage für diese Entfernung, und der Wunsch der Götter, nie vor Vollmond auszurücken, sei ihnen oberstes Gebot.
Ohne eine Antwort abzuwarten, gab der spartanische Heerführer seinen Männern eine kurze Erklärung, grüßte die Feldherren der Athener mit erhobener Hand und erteilte den Befehl zum Rückmarsch.
»Ich würde ihnen zutrauen«, bemerkte Themistokles, »dass sie den Heimweg ebenfalls in Eilmärschen zurücklegen, nur so, zur sportlichen Ertüchtigung.«
Da trat der dritte Feldherr der Athener, Aischylos, hinzu: »Du bewunderst wohl die körperliche Tüchtigkeit der Spartiaten?«, raunte er Themistokles zu. »Es sei dir unbenommen. Aber bedenke, wir Griechen bestehen nicht nur aus Muskeln unserer Gliedmaßen. Hinter diesem deinem Kopf verbirgt sich ein wacher Geist. Mag eines Mannes Kraft noch so groß sein, die ungeheuren Kräfte des Meeres, der Luft und der Erde bändigt er nur mit der Kraft seines Geistes.«
Themistokles blickte betroffen vor sich hin, und während die Spartaner sich zu neuer Marschordnung formierten, fuhr Aischylos fort: »Glaubst du, unsere Hopliten hätten die Schlacht bei Marathon aufgrund ihrer körperlichen Überlegenheit gewonnen? Gewiss nicht. Die Barbaren fielen der Kriegslist unseres Polemarchen zum Opfer. Kallimachos und Miltiades übertrafen die Barbarenanführer Datis und Artaphernes gewiss nicht an Muskelkraft, aber sie waren schlauer. Unsere Taktik, die Barbaren im Laufschritt anzugreifen, um so ihrem Pfeilehagel zu entgehen, verwirrte die geistig schwerfälligen Asiaten so sehr, dass sie zu keiner geordneten Kampfhandlung mehr fähig waren. Es war ein Sieg des Geistes über den Körper.«
Aischylos, der jüngste unter den athenischen Feldherren, wurde von Miltiades in seiner Rede unterbrochen: »Aus dir spricht Unerfahrenheit«, mahnte der Alte, »und deshalb solltest du den Mund nicht allzu voll nehmen. Denn wie so oft, liegt die Wahrheit in der Mitte. Was nützt die schlaueste Kriegstaktik, wenn sie nur von laschen oder schwächlichen Soldaten befolgt wird. Das ist genauso verhängnisvoll, als schlügen kraftstrotzende Soldaten mit schweren Keulen planlos auf jeden Gegner ein.«
Themistokles’ Miene verfinsterte sich. »Aber es ist nicht richtig, dass die Spartaner sich als Anführer Griechenlands betrachten. Wir sind genauso stark wie sie, das haben wir in der Schlacht bewiesen!«
»Gemach, gemach!«, bedeutete Miltiades. »Der Übermut des Sieges lässt vieles vergessen. So manchen Sieg hat die Verzweiflung errungen, und ich weiß nicht, ob nicht auch dieser Sieg dazu zu zählen ist. Habt ihr schon die Angst vergessen, die diesem Sieg vorausgegangen ist? Epizelos, einer unserer wackeren Hopliten, wurde blind vor Angst, als er in der Schlacht plötzlich dem goldbewehrten Feldherrn Artaphernes, dessen schwarzer Bart den ganzen Schild beschattete, gegenüberstand.«
Während die athenischen Feldherren über den Wert des Sieges diskutierten, trafen von Osten und Süden Attikas Boten ein, die meldeten, die persische Flotte sei in Richtung Kykladen entschwunden, und ein Freudengeheul setzte unter den Hopliten ein. Vergessen waren Todesangst und Strapazen der Schlacht. Sie, die vor Augenblicken noch erschöpft umherlagen, sie sprangen auf, schlugen Lanzen und Schwerter gegen ihre Schilde, umarmten und küssten sich und tanzten sich in einen ekstatischen Siegestaumel. Nur der weise Miltiades gab zu bedenken, ob der Rückzug der schwarzen Flotte nicht eine Kriegslist der Barbaren sei.
Die athenischen Hopliten indes stampften sich die Angst aus ihren ermatteten Gliedern. Der unverhoffte Sieg auf dem Schlachtfeld gegen die Übermacht der Barbaren, erst jetzt wurde er zur Gewissheit. Einer der Soldaten riss sich den Helm vom Kopf, füllte ihn mit sandigem Erdreich, spuckte hinein und brüllte: »Schickt es dem Großkönig Dareios zum Zeichen der Unterwerfung!« Auch die übrigen Herumstehenden spuckten in ihre Helme und riefen: »Wasser und Erde für die Barbaren!«
Gegen Mittag, die Sonne des Herbstmonats Metageitnion stand drückend über dem Heerlager vor der Stadt, und Düfte von fettem Speckbrei und saurer Brühe zogen durch die Reihen der Hopliten, traf ein Läufer aus Marathon ein und verlangte vor Themistokles geführt zu werden.
»Ich hoffe, du bringst gute Nachricht«, sagte der Feldherr, an den Boten gewandt. Der aber senkte den Blick und schüttelte den Kopf: »Es ist wegen Melissa, der Hetäre deines Herzens …«
»Was ist mit ihr? Sprich!«
»Ein verirrter Perserpfeil traf sie heute Nacht in ihrem Zelt. Sie starb lautlos, ohne zu klagen.«
Themistokles sah den Boten mit ausdruckslosem Gesicht an. Doch dann wandelte sich seine Miene in sichtbaren Schmerz, schließlich in finsteren Zorn. Der Feldherr fasste sein Schwert, umklammerte es mit eisernem Griff, als ringe er um einen schwerwiegenden Entschluss, und rief dann: »Sattelt mein Pferd, ich reite nach Marathon! Phrynichos soll mich begleiten!«
Einen Tag nach dem Sieg über die Perser verwandelte sich die Agora von Athen in ein Tollhaus. Furcht und Verzweiflung der vergangenen Tage hatten einer nie da gewesenen Ausgelassenheit und lautem Übermut Platz gemacht. Aus den staubigen Straßen mit den niedrigen Lehmhäusern und Werkstätten drängten Tausende im Freudentaumel auf den Marktplatz mit seinen marmornen Säulenhallen, weiß leuchtenden Tempeln und goldbeschlagenen Opferaltären.
Die Opferfeuer, die vor den Tempeln von Zeus und Ares loderten und von weiß gekleideten Priestern mit riesigen fetten Fleischbrocken genährt wurden, verbreiteten beißenden Qualm über das Zentrum der Stadt. Heimkehrende Soldaten wurden auf den Schultern getragen, und ein jeder versuchte, ihren Wurfspeer zu berühren oder wenn möglich zu küssen. Prunkvolle Sänften blieben im Menschengewühl stecken, Bettler und Tagediebe stießen die Körbe der Händler um und sammelten grüne Feigen und knuspriges Backwerk vom Boden auf, um es in die eigene Tasche verschwinden zu lassen. Halbwüchsige Epheben mit öligen Korkenzieherlocken tunkten ihre Finger in die kostbaren Salbentöpfe der Gewürzkrämer und warfen herb beißend riechende Silphionstengel in die Menge. Verzweifelt bemüht, ihre phönizischen Stoffe und Teppiche, ägyptischen Spitzen und syrischen Schleier in Sicherheit zu bringen, balgten sich die Stoffhändler mit übermütigen Halbwüchsigen. Erschreckt und aufgescheucht vom Lärm auf den Straßen, gackerten, jaulten und brüllten Hühner und Enten, Hunde und Katzen, Esel und Kühe, die von den Athenern in ihren Wohnhäusern gehalten wurden.
»Nenikekamen! – Wir haben gesiegt!«, riefen die Menschen immer und immer wieder. Bunt gekleidete Zitherspieler, das lang herabhängende Haar mit einem Stirnreif gebändigt, sangen zum Saitenklang ihrer Zupfinstrumente schwülstige Preislieder auf den Kriegsgott Ares, den die gefallenen Barbaren mit ihrem Blute sättigten, andere priesen lauthals die eulenäugige, schild- und speerführende Pallas Athene, die ihre schützende Hand über die Stadt gehalten habe.
Auf den Stufen der Säulenhalle des Volkes gaben Gaukler, Wahrsager und Kuppler sich ein Stelldichein. Die Gaukler führten sorgsam einstudierte Scheinkämpfe vor, schlugen mit Schwertern und stachen mit Lanzen theatralisch aufeinander ein, ohne sich die geringsten Verletzungen zuzufügen. Zwei blinde Seher hockten mit gekreuzten Beinen auf dem Boden und riefen Unverständliches in die Menge. Dazwischen Kuppler mit blumenumwundenen Spazierstöcken, die einem Phallus ähnelten. Sie boten mit den Worten »Kleines Vergnügen gefällig?« dralle Sklavinnen aller Hautfarben und schmächtige Jüngelchen an, von drei Obolen aufwärts.
Die Männer auf der Agora waren in erdrückender Überzahl; denn die athenischen Frauen verließen das Haus nur selten, und wenn, dann nur in Begleitung des Mannes oder einer männlichen Anstandsperson, dem Gynaikonomos. Dann allerdings traten die Athenerinnen in großer Toilette auf, in langen durchschimmernden Gewändern, hochgegürtet mit tiefem Dekolleté, das gebundene Haar gelockt, mit Mennige und Bleiweiß geschminkt, je heller der Teint, desto vornehmer. Frauen, die sich allein ihren Weg durch die Menge bahnten, gepufft, gedrückt und geschoben wurden, waren entweder ärmliche Marktweiber oder Mädchen von zweifelhaftem Ruf, denen man im Vorübergehen durchaus ein Kompliment oder gut bezahltes Angebot zuwerfen durfte, ohne gleich als verrucht zu gelten.
Hinter dem Rathaus, wo sich der beißende Geruch von Opferfleisch und Weihrauch mit dem modrigen Gestank aus dem großen Abwasserkanal vermischte, zankten sich zwei Frauen aus Alopeke, einem Vorort von Athen. Der Vorfall hätte kaum Beachtung gefunden, wären nicht beide die Ehefrauen berühmter Männer gewesen, von denen jedermann wusste, dass sie sich seit frühester Jugend nicht leiden konnten: Polykrite, Gemahlin des Aristides, Sohn des Lysimachos, und Archippe, Gemahlin des Themistokles, Sohn des Lysandros.
Sie stritten lautstark über die Straße hinweg, welcher ihrer Männer das größere Verdienst am Sieg von Marathon trage. Polykrite, eine geifernde Fünfzigjährige, der das dunkle Haar wirr ins Gesicht hing, schalt Themistokles einen unerfahrenen Emporkömmling, dessen Worte stets größer gewesen seien als seine Taten. Das aber wollte Archippe, zwar beinahe zwei Jahrzehnte jünger als ihre Gegenspielerin, aber lang und dürr und mit ihren verhärmten Gesichtszügen in keiner Weise attraktiver, nicht auf sich sitzen lassen. Sie nannte Polykrite eine bemitleidenswerte Hausverwalterin, denn Ehefrau des Aristides könne man sie ja wohl nicht mehr nennen, da jedermann in Athen wisse, dass der alte Aristides seine Tage in Gesellschaft schöner Knaben und die Nächte mit drittklassigen Hetären verbringe. Das brachte Polykrite in Rage.
»Ausgerechnet du«, schrie sie von einer Straßenseite zur anderen, und immer mehr Menschen strömten zusammen, »ausgerechnet du machst mir zum Vorwurf, ich würde meine Pflichten als Frau vernachlässigen! Hast nicht du deinen ältesten Sohn so vernachlässigt, dass er tagelang ohne Aufsicht war und von einem Pferd gebissen wurde und starb? Hat nicht dein Mann Themistokles den Sinn für alles Weibliche verloren, seit er beim Reigentanz der Knaben jenen Schönling Stesileos sah und mit Geschenken überhäufte?«
»Die Götter mögen dir vergeben«, lachte Archippe hämisch, »es war nicht Themistokles, der dem Lustknaben von der Insel Keos zuerst den Hof machte, sondern dein Mann Aristides! Er wollte es wohl dem großen Solon gleichtun; aber ein Buhlknabe macht noch keinen Staatsmann!«
Unter den Zuhörern bildeten sich zwei Parteien, welche die streitenden Weiber mit Anfeuerungs- und Zwischenrufen unterstützten. Der alte Mnesiphilos, der die Frau des Themistokles begleitete, versuchte Archippe mit mäßigenden Worten zu besänftigen, sowohl der eine wie der andere habe sich um den Staat verdient gemacht, Athen brauche weise und besonnene Strategen ebenso wie wagemutige und draufgängerische, und vielleicht sei der Sieg über die Barbaren gerade deshalb errungen worden, weil Aristides und Themistokles in der Schlachtreihe nebeneinander kämpften.
Das aber wollte Polykrite nicht gelten lassen. Im Gegenteil, der Versöhnungsversuch des Alten setzte sie in noch größere Erregung: »Schweig du, Mnesiphilos!«, rief sie über die Straße, »das Großmaul Themistokles ist doch nichts weiter als das sichtbare Ergebnis deiner langjährigen Erziehung: ein geltungsbedürftiger Intrigant, der seine Nase in alle Staatsgeschäfte und Rüstungspläne steckt und vom einen so wenig versteht wie vom anderen.«
Kaum hatte Polykrite ausgesprochen, da stürzte sich Archippe auf die Gegnerin, und Mnesiphilos gelang es nur mit Mühe, das tobende Frauenzimmer zurückzureißen. Archippe spuckte und kreischte, sie werde dieser hässlichen Hure die Augen auskratzen. Die Zuhöhrer johlten vor Vergnügen.
»Platz, Platz da für den blinden Seher Euphrantides!« Ein kleiner Junge versuchte lautstark, dem Alten einen Weg durch die Menge zu bahnen. Der Blinde hatte die Rechte auf die Schulter des Jungen gelegt, mit der Linken hielt er einen weißen Stab umklammert und stocherte auf dem Weg nach Hindernissen.
Euphrantides war stadtbekannt. Blind geboren, hatten ihn seine Eltern ausgesetzt. Als heimlicher Zuhörer in den Philosophenschulen hatte er sich eine geachtete Bildung angeeignet, und eines Tages waren seine mahnenden Voraussagen Wirklichkeit geworden – seither galt er als Seher. Zwar genoss er nicht das Ansehen eines Teisamenos von Elis, dessen Vorhersagen Schlachtpläne bestimmten, aber dafür gab Euphrantides sich mit einem Obolos zufrieden, wenn man ihn fragte.
Die Athener wichen zurück vor dem Greis. Irgendjemand warf eine Münze vor ihm auf das Pflaster, eine zweite kullerte mit hellem Klang, eine dritte, und ein übermütiger Athener rief: »He, Alter, sag uns, was du siehst!« Der Junge hob die Münzen auf.
Da blieb Euphrantides stehen, legte seinen Kopf zur Seite und blickte mit stumpfen Augen zum Himmel. »Ja, was siehst du?« wiederholte ein anderer, und der blinde Seher horchte in sich hinein. Im Gedränge um ihn herum verstummte jeder Laut.
»Ich sehe zwei Männer!«, stammelte Euphrantides.
»Hört, hört!«, rief eine Stimme aus dem Volk. Mit Zischen versuchten sie das hämische Gelächter zu ersticken.
Der Seher fuhr fort: »Ich sehe zwei Männer und einen Schmetterling, einen safrangelben Schmetterling, wie man ihn nur noch auf der Insel Lesbos kennt. Und die Männer versuchen, den Schmetterling zu fangen. Aber der eine stürzt, dem andern geht der Schmetterling ins Netz. Doch auch ihm entwischt er wieder.«
»Und wer sind die beiden Männer?«, fragte ein kecker Athener.
Der blinde Euphrantides zögerte, dann antwortete er: »Die beiden Männer sind Aristides und Themistokles.«
Unter den Athenern begann nun ein heftiges Rätselraten, was es mit diesem Schmetterling für eine Bewandtnis habe. Vergessen war die Fehde der beiden Frauen. Sie wurden von ihren Begleitern hinweggeführt. Auch der blinde Seher zog sich unbemerkt aus der Menge zurück. Als der kleine Junge dem Alten die drei Obolen in die Hand drückte, sagte Euphrantides leise: »Ich habe noch viel mehr gesehen. Aber weißt du, mein Junge, manchmal ist es besser, die Menschen über ihr Schicksal im Unklaren zu lassen.«
Themistokles sprang vom Pferd und reichte Phrynichos die Zügel. Phrynichos hatte Mühe gehabt, dem Freund zum Heerlager nach Marathon zu folgen, als er schweigsam und mit starrem Blick seinen Gaul über Hügel und durch enge Feldwege hetzte. Jetzt schritt er erhobenen Hauptes, den wuchtigen Unterkiefer nach vorne geschoben, auf das gelb leuchtende Zelt der Hetären zu, aus dem furchtbare Klagelaute drangen. Zwei lanzenbewehrte Soldaten, die den Eingang Tag und Nacht bewachten, hoben den Arm zum Gruß. Der Feldherr sah es nicht.
Als Themistokles den Vorhang am Eingang beiseiteschob, schlug ihm eine beißende Wolke Weihrauch entgegen. Das Klagen und Beten der übrigen Hetären, die mit entblößten Brüsten und offenen Haaren den Tod Melissas beweinten, brach jäh ab. In der Mitte des Zeltes lag Melissa auf einer Bahre, nackt, nur mit einem zarten Schleier bedeckt. Man konnte meinen, sie schliefe.
»Wie ist es passiert?«, fragte Themistokles leise, ohne den Kopf von der Toten zu wenden. Und als keine der Hetären zu antworten wagte, da rief der Feldherr zornentbrannt: »Aristides soll kommen!«
Die schweigsamen Hetären wichen ängstlich zurück, als Aristides eintrat. Alle wussten um die persönliche Abneigung der beiden, und in dieser Situation musste man Schlimmes befürchten.
Aristides, von Schmerz gezeichnet, trat neben Themistokles, den Blick auf Melissa gerichtet, reichte Themistokles die Hand und sprach: »Dein Schmerz ist auch der unsere.«
Themistokles schlug die Hand des anderen aus. Er starrte regungslos vor sich hin, dann sagte er: »Wie konnte das passieren?«
Aristides hob die Schultern: »Es war Nacht, als es geschah. Melissa sprach mit diesem Mädchen aus Lesbos, einer Geisel, die von den Barbaren auf dem Schlachtfeld zurückgelassen worden war. Auf einmal sank sie zu Boden. Ein persischer Pfeil hatte sie in den Rücken getroffen.«
Da begannen Themistokles’ Augen, die bisher stumpf, beinahe wie die eines Blinden geradeaus gerichtet waren, unruhig zu flackern. Wortlos reichte ihm Aristides den Pfeil. Der prüfte die Spitze, strich über die Federn am anderen Ende und starrte auf das Loch in der Zeltwand.
Aristides nickte: »Dahinter liegt das Lager der gefangenen Barbaren, allerdings« – er machte eine lange Pause – »es ist mehr als ein halbes Stadion entfernt. Kein Krieger außer Herakles kann aus dieser Entfernung einen tödlichen Pfeil abschießen.«
»Habt Ihr die Gefangenen durchsucht?«, herrschte Themistokles den Feldherrn an.
»Die Barbaren mussten sich bis auf die nackte Haut entblößen«, antwortete Aristides.
»Und?«
»Nichts. Einige Barbaren trugen kostbare Dolche auf den Leib geschnallt, aber von einem Bogen keine Spur.«
»Aber es ist doch ein Perserpfeil!«, schrie Themistokles.
Der andere schwieg.
Da stürmte Themistokles aus dem Zelt auf das Lager der gefangenen Perser zu. Im Abstand von wenigen Metern standen attische Hopliten, die den Pferch bewachten. Aristides, der dem tobenden Feldherrn ratlos hinterherrannte, rief beschwörend: »Die Wächter haben nichts bemerkt. Ich habe jeden einzelnen befragt. Es sei ruhig gewesen in dieser Nacht.«
»Aber irgendwoher, bei allen Göttern, muss der Perserpfeil doch gekommen sein!« Themistokles stieß einen der Wächter vor dem Pferch beiseite und ging hinein. Dunkle, hasserfüllte Gesichter sahen ihn schweigend an. Er fühlte die ohnmächtige Wut, die ihm aus diesen Barbarenaugen entgegenschlug; aber Themistokles blickte ebenso hasserfüllt zurück. Die Barbaren bildeten eine Gasse, es mögen etwa hundert gewesen sein. Drohend trat der Feldherr ganz nahe an jeden einzelnen heran, blickte ihm mit kalter Verachtung in die Augen und wartete unendlich lange, bis er sich dem nächsten zuwandte und das Spiel von Neuem begann. Dann zeterte er mit weinerlicher Stimme – und sie drohte jeden Augenblick zu versagen: »Jeder einzelne soll gefoltert werden, gepeitscht und mit ehernen Stechpfeilen behandelt, bis einer von ihnen gesteht, wer das Verbrechen begangen hat. Und der soll sterben nach Barbarenart. Der Kopf soll ihm zwischen zwei Mühlsteinen zerquetscht werden.«
Phrynichos trat von hinten an Themistokles heran und fasste ihn behutsam am Arm. Er, der lebensfrohe Dichter und Freund, hatte großen Einfluss auf den hitzköpfigen Feldherrn. »Zeig den Göttern ruhig deinen Schmerz«, sagte Phrynichos beschwichtigend, »aber mische nicht Zorn in deine Trauer; denn vielleicht ist, was wir Leben nennen, Tod, und unser Tod ist in der Tiefe Leben.«
Themistokles hielt inne. Vor ihm stand Daphne, das Mädchen aus Lesbos, klein, zierlich und zerbrechlich; aber vor diesem kraftstrotzenden Feldherrn wirkte sie noch kleiner, noch zierlicher, noch zerbrechlicher.
Ohne den Mann anzusehen, begann Daphne zu erzählen, es sprudelte aus ihr heraus, wie Melissa sie aufgenommen, gebadet und gekleidet hatte und ihre letzten Worte seien gewesen, sie sei stolz, die Hetäre eines der hervorragendsten Feldherren zu sein …
»Schweig!«, unterbrach Themistokles die Erzählung des Mädchens. »Wie kommst du hierher?«
Daphne antwortete furchtsam: »Die Barbaren haben meinen Vater Artemidos und mich aus Lesbos entführt. Ich konnte fliehen, mein Vater ertrank. Aristides gewährte mir Schutz.«
»Soso. Aristides gewährte dir Schutz«, wiederholte Themistokles mit süffisantem Lächeln. »Eigentlich hat er’s ja mehr mit jungen Knaben.« Er sprach leise, aber doch laut genug, dass Aristides, von dem er wusste, dass er hinter ihm stand, es hören musste. »Wie dem auch sei«, fuhr Themistokles fort, »steckt sie zu den übrigen Gefangenen und verkauft sie auf dem Sklavenmarkt!«
»Herr!«, rief Daphne und fiel dem Feldherrn zu Füßen. Doch der drehte sich um – vor seinen Augen blinkte die scharfkantige Spitze eines Schwertes. Aristides hielt den Arm ausgestreckt und sagte mit gespielter Ruhe: »Das Mädchen bleibt bei den übrigen Hetären.«
Themistokles, der diese Wende nicht erwartet hatte, wagte, das Schwert vor Augen, nicht, sich zu bewegen. Dann aber versuchte er, die Ausweglosigkeit seiner Situation herunterzuspielen. Er grinste gekünstelt und sagte: »Sie gehört zur Kriegsbeute, und deren Erlös wird unter den siegreichen Soldaten aufgeteilt.«
»Sie ist eine Griechin«, antwortete Aristides mit drohendem Tonfall, »sie spricht unsere Sprache. Sie soll frei sein wie jeder Bürger Attikas!« Und dabei ließ er sein Schwert sinken.
Da sah Themistokles seine Chance, und jetzt zog er sein Schwert. Aber er warf es herausfordernd neben sich auf den Boden. Geduckt und lauernd wie ein Ringkämpfer, den Sprung des Gegners erwartend, tappte er schwerfüßig seinem Widersacher entgegen, um sich plötzlich mit einem Satz auf Aristides zu stürzen.
Der jedoch fing, obwohl er Themistokles körperlich unterlegen war, den Gegner ab und versuchte ihn unter Aufbietung aller Kräfte niederzuringen. Das alles ereignete sich innerhalb weniger Sekunden, sodass Phrynichos erst jetzt dazwischengehen und die Kampfhähne zur Besinnung bringen konnte.
»Genügt es nicht«, rief er atemlos, »dass uns die Barbaren unserer tapfersten Männer berauben? Sollen sich die Athener jetzt auch noch gegenseitig umbringen?«
Keuchend standen sie sich gegenüber, und jeder fixierte den anderen mit hasserfülltem, stechendem Blick. Natürlich war das Mädchen Themistokles gleichgültig, 500 Drachmen mehr oder weniger Kriegsbeute, was bedeutete das schon; allein die Tatsache, dass Aristides sich für das Mädchen einsetzte, genügte jedoch, und die harmlose Episode wurde zum schicksalhaften Drama. Themistokles richtete sich auf, spuckte verächtlich auf den Boden und sagte: »Gut, Aristides, mache sie zur Hetäre; aber die Zeit wird kommen, da dieses Mädchen sich wünschte, auf dem Sklavenmarkt verkauft und treu sorgende Dienerin eines ehrsamen Mannes geworden zu sein.«
KAPITEL 2
J