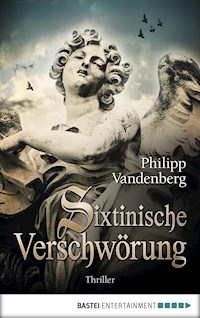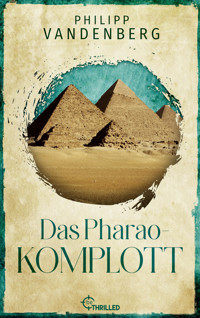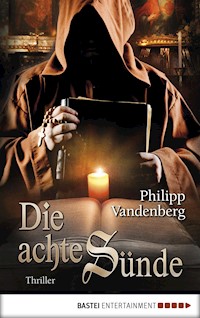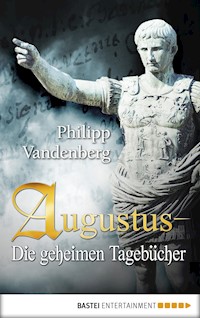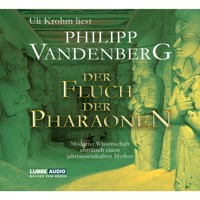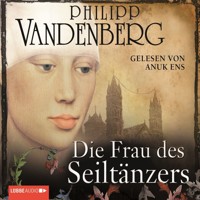Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach einer Organtransplantation stirbt der Patient. Was zunächst wie ein Kunstfehler aussieht, erweist sich als Mord. Bei seiner verzweifelten Suche nach der Wahrheit gerät der Chirurg Professor Gropius selbst in tödliche Gefahr. Kriminalistischer Spürsinn und verwirrte Gefühle treiben ihn in die Arme zweier rätselhafter Frauen. Aber nur eine bringt ihn der Lösung näher. Die Schnittstelle zwischen Organmafia und Vatikan hat drei Buchstaben: IND. Und die gefährlichste Akte der Welt einen Namen: Golgatha...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:6 Std. 56 min
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
PHILIPPVANDENBERG
DIEAKTE GOLGATHA
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2003/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Daniela Bentele-Hendricks
Umschlagmotiv: © Visum Plus 24 / B. Arnold
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-5772-8
Sie finden uns im Internet unter
www.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
FLUGANGST
Es war einer jener Horrorflüge, die den Wunsch wach werden lassen, nicht geboren zu sein. Dabei hatte alles so harmlos angefangen. LH 963 war pünktlich um 15 Uhr 10 bei sonnigem Herbstwetter gestartet, und der Flug über die Alpen nach Rom versprach pures Vergnügen. Ich hatte in Tivoli, hoch in den Albaner Bergen, ein Hotelzimmer gebucht, um in der Abgeschiedenheit des malerischen Ortes über meinen neuen Roman nachzudenken, einen Stoff, der mir schon seit zwei Jahren im Kopf herumging. Doch es kam anders.
Kaum hatten wir den Alpenhauptkamm überquert, begann die Lufthansa-Maschine, ein Airbus neuesten Baujahrs, plötzlich zu rütteln und zu schütteln. Über den Sitzreihen leuchtete die Schrift »Bitte anschnallen« auf und über Bordlautsprecher meldete sich der Kapitän: »Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, umgehend Ihre Plätze einzunehmen und sich anzuschnallen. Über Oberitalien hat sich ein extremes Tiefdruckgebiet gebildet, und wir erwarten heftigste Turbulenzen.«
Was das Fliegen anbelangt, zähle ich nicht gerade zu den Mutigsten – ich habe in Afrika und Asien so meine Erfahrungen gemacht –, und so ist es mir zur Gewohnheit geworden, stets angeschnallt zu fliegen. Leicht beunruhigt blickte ich aus dem Fenster in eine bizarre Landschaft aus grauen Wolkentürmen; doch schon bald nahmen mir feuchte Nebelschwaden die Sicht. Der Himmel verfinsterte sich, das Schütteln des Flugzeugs wurde immer heftiger, und ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass mir die Situation nichts ausgemacht hätte. Bei solchen Gelegenheiten greife ich zu einem Taschenspielertrick, den mir vor vielen Jahren ein amerikanischer Psychiater während eines Fluges nach Kalifornien verriet: Ich nehme den nächstbesten Gegenstand und drücke diesen in meiner Hand, bis es schmerzt. Die Konzentration auf den Schmerz lässt jede Flugangst vergessen. Wieder ging ein Rütteln durch die Maschine. In der Innentasche meines Sakkos bekam ich gerade noch meine Kreditkarte zu fassen. Ich legte sie in die flache Hand und drückte zu. Einen Augenblick schien es mir, als hielte ich ein zweischneidiges Messer in meiner Rechten, aber der Schmerz genügte, um mich von der höchst unangenehmen Situation abzulenken.
Wie aus der Ferne nahm ich die Gläser, Tabletts und Bestecke wahr, welche plötzlich, losgelöst von der Schwerkraft, sich selbstständig machten, gegen die Decke knallten und dort kleben blieben, als wäre dies die selbstverständlichste Sache der Welt. Aus den hinteren Reihen hörte man Angstschreie. Ein Luftloch – das Flugzeug befand sich in freiem Fall.
Ich vermag nicht zu sagen, wie lange dieser schwerelose Zustand dauerte. Ich saß regungslos da, die Kreditkarte in meiner Hand. Doch dann erwachte ich aus meiner selbst verordneten Lethargie: Mein Sitznachbar zur Rechten, dem ich bisher keine Beachtung geschenkt hatte, griff unversehens nach meinem Unterarm und umklammerte ihn mit aller Gewalt, als suchte er Halt in diesem angsteinflößenden Zustand der Schwerelosigkeit. Ich sah ihn an, aber der Fremde blickte starr geradeaus. Sein Gesicht war aschfahl, er hatte den Mund leicht geöffnet, und man konnte sehen, dass sein grauer Oberlippenbart zitterte.
Zehn, vielleicht fünfzehn Sekunden mag der freie Fall gedauert haben – es kam mir vor wie eine Ewigkeit –, dann ging ein heftiger Ruck durch das Flugzeug, es gab einen Knall, und die Gegenstände, welche eben noch an der Decke klebten, polterten zu Boden. Getroffen schrien einige Passagiere auf. Und im nächsten Augenblick war der Spuk vorüber. Ruhig, als wäre nichts gewesen, glitt das Flugzeug dahin.
»Bitte entschuldigen Sie mein ungebührliches Verhalten«, meldete sich mein Nachbar jetzt zu Wort, nachdem er meinen Unterarm losgelassen hatte, »ich dachte wirklich, wir stürzen ab.«
»Ist schon in Ordnung«, erwiderte ich generös und sorgsam darauf bedacht, meine Hand zu verstecken, in der sich, noch immer schmerzend, meine scharfkantige Kreditkarte befand.
»Sie kennen wohl keine Flugangst?«, begann der Nachbar nach einer Pause, in der er wie ich den Fluggeräuschen lauschte, ob nicht neuerliche Turbulenzen zu erwarten seien.
Haben Sie eine Ahnung, wollte ich spontan antworten, aber aus Furcht, die verbleibende Flugzeit könnte sich im wechselseitigen Austausch von schrecklichen Flugerlebnissen erschöpfen, erwiderte ich knapp: »Nein.« Als ich ihm noch einmal aufmunternd zunickte, fiel mir auf, dass er mit der anderen Hand ein Manuskript oder irgendwelche Aufzeichnungen an sich presste wie ein Kind, das fürchtet, man wolle ihm sein Spielzeug wegnehmen. Schließlich winkte er die Stewardess herbei, ein ungewöhnlich hübsches, dunkelhaariges Mädchen, hob Zeige- und Mittelfinger nach oben und bestellte zwei Whisky. »Sie nehmen doch auch einen?«, fragte er.
»Ich trinke keinen Whisky«, wiegelte ich ab.
»Macht nichts. Nach diesem Erlebnis vertrage ich auch zwei.«
Während der Mann zu meiner Rechten bedächtig, jedenfalls keineswegs in einem Zug, wie ich das erwartet hätte, beide Whiskygläser leerte, bot sich mir Gelegenheit, ihn näher zu betrachten.
Sein intelligentes Gesicht und die teuren Schuhe standen im Gegensatz zu seinem etwas vernachlässigten Äußeren und erschienen mir nicht weniger rätselhaft als sein eigentümliches Verhalten: Ein Mann mittleren Alters, mit empfindsamen Zügen, fahrigen Bewegungen und unsicherem Verhalten, ein Typ, an dem die Zeit nicht spurlos vorübergegangen war. Es schien, als habe er meine abschätzenden Blicke bemerkt, denn nach einer Weile des Schweigens wandte er sich mir wieder zu, richtete sich in seinem Sitz auf und deutete eine leichte Verbeugung an, eine Geste, die einer gewissen Komik nicht entbehrte, und mit ausgesuchter Höflichkeit sagte er: »Mein Name ist Gropius, Professor Gregor, aber das ist vorbei, verzeihen Sie.« Er beugte sich vor und steckte das Manuskript in eine Aktentasche aus braunem Leder, die unter dem Sitz stand.
Um der Konvention Genüge zu tun, nannte ich ebenfalls meinen Namen, und aus reiner Neugierde fragte ich zurück: »Wie darf ich das verstehen, Professor: Was ist vorbei?«
Gropius machte eine wegwerfende Handbewegung, als wollte er sagen: Ich will nicht darüber reden. Doch weil ich ihn weiterhin erwartungsvoll ansah, meinte er schließlich: »Ich bin Chirurg – oder besser, ich war es. Und Sie? – Einen Augenblick, lassen Sie mich raten …«
Irgendwie wurde mir die Sache unangenehm, aber da das Gespräch nun einmal in Gang gekommen und ich auf meinem Fensterplatz noch immer angeschnallt war, setzte ich mich in Positur, als wollte der andere ein Foto von mir machen, und dabei grinste ich ihm ins Gesicht.
»Sind Sie Schriftsteller?«, fragte Gropius plötzlich.
Ich stutzte. »Ja. Woher wissen Sie das? Haben Sie eines meiner Bücher gelesen?«
»Ehrlich gesagt, nein. Aber ich habe Ihren Namen schon einmal gehört.« Gropius lächelte. »Und was führt Sie nach Rom? Ein neuer Roman?« Der Mann, der eben noch aschfahl und halb tot neben mir gesessen hatte, wurde auf einmal lebendig. Aus meiner Erfahrung wusste ich, was nun kommen würde, das, was neun von zehn Menschen sagen, die einem Schriftsteller begegnen, nämlich: »Wenn ich Ihnen mein Leben erzähle – darüber könnte man einen Roman schreiben!« Aber es kam nicht. Vielmehr stand noch immer die Frage des Professors im Raum.
»Ich reise gar nicht nach Rom«, entgegnete ich also wahrheitsgemäß, »auf dem Flughafen wartet ein Leihwagen, mit dem fahre ich nach Tivoli.«
»Ah, Tivoli«, sagte Gropius anerkennend.
»Sie kennen Tivoli?«
»Nur von Fotos. Muss wunderschön sein, Tivoli.«
»Um diese Zeit vor allem ruhig. Ich kenne da ein kleines Hotel, ›San Pietro‹, nahe der Piazza Trento. Die Besitzerin, eine typische italienische Mama, macht die besten Spaghetti alla pescatore, und die Aussicht von der Terrasse des Hotels ist einfach überwältigend. Dort werde ich versuchen, mich meinem neuen Roman zu widmen.«
Gropius nickte nachdenklich: »Ein schöner Beruf!«
»Ja«, erwiderte ich, »ich wüsste keinen schöneren.«
Eigentlich hätte ich da bereits hellhörig werden müssen, weil der Professor sich in keiner Weise für den Inhalt meines neuen Romans zu interessieren schien; aber vermutlich war er beleidigt, weil ich meinerseits mich so gar nicht für den Grund seiner Reise und seine näheren Lebensumstände interessierte, jedenfalls brach er unser Gespräch und jedes weitere Kennenlernen abrupt ab, indem er noch einmal sagte: »Sie nehmen es mir doch nicht übel, dass ich mich eben so an Sie geklammert habe!«
»Ist schon in Ordnung!«, versuchte ich Gropius zu beschwichtigen. »Wenn es Sie beruhigt hat.«
Aus dem Lautsprecher quäkte die Ankündigung, dass wir in wenigen Minuten auf dem »Leonardo da Vinci«-Flughafen landen würden, und kurze Zeit später kam das Flugzeug vor dem gläsernen Terminal zum Stehen.
Im Flughafengebäude ging jeder von uns seiner Wege. Ich hatte das Gefühl, dass der kleine Vorfall Gropius ziemlich peinlich war, doch was mich betrifft, hatte ich die Angelegenheit schon am nächsten Morgen beinahe vergessen; beinahe deshalb, weil mich die Bemerkung des Professors, das sei alles vorbei, irgendwie nachdenklich gemacht hatte.
Gleich nach dem Frühstück setzte ich mich mit einem Stapel weißen Papiers, dem Schrecken eines jeden Autors, an einen grün gestrichenen Holztisch, den mir Signora Moretti, die Besitzerin des Hotels, vorne an die Balustrade der Terrasse gerückt hatte. Von hier ging der Blick über die Dächer von Tivoli nach Westen, wo sich Rom im Herbstdunst versteckte.
Ich kam mit meiner Arbeit, die nur unterbrochen wurde von langen Spaziergängen, gut voran. Am fünften Tag – ich saß gerade in der Mittagssonne und schrieb die letzte Seite meines Exposés – hörte ich hinter mir auf der Terrasse plötzlich Schritte, die sich zögernd näherten und schließlich stehen blieben. Ich spürte förmlich die Blicke in meinem Rücken, und um die unangenehme Situation zu beenden, wandte ich mich um.
»Professor, Sie?« Überrascht legte ich meinen Stift zur Seite. Weit weg mit meinen Gedanken, in die Geschichte meines Romans verstrickt, machte ich wohl einen ziemlich verwirrten Eindruck auf den unerwarteten Besucher. Gropius versuchte jedenfalls, mich mit ein paar unbeholfenen Handbewegungen zu beschwichtigen, und nach einigen höflichen Redewendungen, welche nur einem Mann mit allerbesten Umgangsformen zu Eigen sind, kam er schließlich zur Sache:
»Sie wundern sich vermutlich, warum ich Sie so einfach aufsuche«, begann er, nachdem ich ihm einen Stuhl angeboten und er in steifer Haltung Platz genommen hatte.
Ich hob die Schultern, als sei mir die Angelegenheit eher gleichgültig, eine Reaktion, die ich schon wenig später bereute; kein Wunder, wusste ich zu diesem Zeitpunkt doch noch nicht, was auf mich zukommen sollte.
Zum ersten Mal, seit wir uns vor ein paar Tagen im Flugzeug begegnet waren, musterte mich der Professor mit festem Blick. »Ich suche einen Mitwisser!«, sagte er leise, aber umso eindringlicher. Der Tonfall seiner Stimme verlieh den einfachen Worten etwas Geheimnisvolles.
»Einen Mitwisser?«, fragte ich erstaunt. »Und wie kommen Sie gerade auf mich?«
Gropius blickte sich um, als suchte er nach unerwünschten Zeugen unseres Gesprächs. Er hatte Angst, das wurde mir schnell klar, und die Antwort schien ihm nicht leicht zu fallen: »Ich weiß, wir kennen uns kaum, eigentlich kennen wir uns überhaupt nicht; aber das kann auch von Vorteil sein in Anbetracht der Situation, in der ich mich befinde.«
»Ach?« – Ich gebe zu, im Nachhinein betrachtet muss meine Reaktion ziemlich überheblich gewirkt haben, und ich bin froh, dass ich nicht so spontan reagierte, wie ich es eigentlich vorhatte. Die geheimniskrämerischen Bemerkungen des Professors gingen mir auf die Nerven, und es lag mir auf der Zunge zu sagen: Mein lieber Professor, Sie stehlen mir meine Zeit. Ich bin hier um zu arbeiten. Guten Tag. – Aber ich sagte es nicht.
»Ich habe lange überlegt, ob ich Sie mit meiner Geschichte belasten soll«, fuhr Gropius fort. »Aber Sie sind Schriftsteller, ein Mann mit Fantasie, und um sich das, was ich zu berichten habe, vorstellen zu können, bedarf es wirklich viel Fantasie. Dabei ist jedes Wort wahr, so unglaublich es auch klingen mag. Vielleicht werden Sie mir auch nicht glauben, vielleicht werden Sie mich für verrückt halten oder für einen Alkoholiker im fortgeschrittenen Stadium. Wenn ich ehrlich bin, bis vor einem Jahr hätte ich nicht anders reagiert.«
Die eindringliche Rede des Professors nahm mir allen Wind aus den Segeln. Ich merkte, dass meine Neugierde plötzlich geweckt war, und mein anfängliches Misstrauen wich dem Interesse an dem, was der merkwürdige Professor zu erzählen hatte. »Wissen Sie«, hörte ich mich plötzlich sagen, »die besten Geschichten schreibt immer noch das Leben. Ich weiß, wovon ich rede. Kein Schriftsteller vermag so verrückte Geschichten zu erfinden, wie sie das Leben vorgibt. Im Übrigen gehört es zu meinen wenigen guten Eigenschaften zuhören zu können. Schließlich lebe ich von Geschichten, ehrlich gesagt, ich bin sogar süchtig danach. Also, was haben Sie zu berichten?«
Der Professor begann umständlich sein Sakko aufzuknöpfen, eine zunächst nebensächliche Handlung, die mich nicht sonderlich interessierte, bis mit einem Mal ein Bündel Papiere unter dem Kleidungsstück sichtbar wurde.
Nach allem, was ich im Umgang mit Menschen je erlebt hatte, war dies die wohl ungewöhnlichste Geschichte, die mir je widerfahren ist, und auch mit dem Einsatz größter Fantasie fand ich keine Erklärung für das Verhalten des Professors. Ich muss gestehen, ich wäre weniger verwundert gewesen, hätte Gropius eine Pistole hervorgezogen und den Lauf mit einem fadenscheinigen Ansinnen auf mich gerichtet. So aber klopfte der Professor mit der geballten Faust auf die Papiere und sagte nicht ohne Stolz: »Das ist eine Art Tagebuch der zweihundert schlimmsten Tage meines Lebens. Und wenn ich es lese, erkenne ich mich selbst nicht mehr wieder.«
Staunend, ja ratlos, blickte ich abwechselnd auf die Papiere und das Gesicht des Professors, der zweifellos meine Unsicherheit genoss wie ein Duellant, der seinem Gegner eine Niederlage beigebracht hat. Und so kam es, dass einige Zeit verging, bis ich meinem Gegenüber die nahe liegende Frage stellte: »Und was ist der Inhalt dieses Manuskripts?«
Inzwischen war es Mittag geworden, und auf der westwärts gewandten Terrasse tauchten die ersten Sonnenstrahlen auf. Im Innern des Hotels, in dem nur drei Zimmer belegt waren, machte sich die Signora bemerkbar. Mit einem nicht enden wollenden Redeschwall erbot sie sich, mir und meinem Gast eine Pasta zu servieren, natürlich Spaghetti alla pescatore.
Nachdem Signora Moretti gegangen war, wiederholte ich meine Frage, aber Gropius wich aus und antwortete mit einer Gegenfrage, die ich zunächst nicht verstand: »Sind Sie eigentlich ein frommer Mensch?«
»Bei Gott, nein«, erwiderte ich, »wenn Sie damit fragen wollen, ob ich ein Anhänger der Kirche bin.«
Der Professor nickte. »Das meinte ich.« Und nach kurzem Zögern: »Es könnte nämlich sein, dass mein Bericht Sie in Ihrem Innersten verletzt, mehr noch, dass Ihr Glaube zutiefst erschüttert wird und Sie die Welt danach mit anderen Augen sehen.«
Befallen von einer gewissen Ratlosigkeit gegenüber dem seltsamen Professor, versuchte ich aus der Art seiner Rede, aus seinen sparsamen Gesten meine Schlüsse zu ziehen – wenn ich ehrlich bin, mit geringem Erfolg. Je länger ich Gropius meine Aufmerksamkeit schenkte, desto rätselhafter erschien mir sein Verhalten, desto faszinierter hörte ich ihm aber auch zu. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, worauf er hinauswollte, aber für den Fall, dass Gropius nicht verrückt war – und er machte wirklich nicht gerade den Eindruck –, musste er eine äußerst brisante Entdeckung gemacht haben.
»Man hat mir zehn Millionen Euro Schweigegeld geboten«, sagte der Professor in einem Tonfall, der kaum eine Emotion erkennen ließ.
»Ich hoffe, Sie haben das Geld genommen«, erwiderte ich mit ironischem Unterton.
»Sie glauben mir nicht«, meinte der Professor. Er klang enttäuscht.
»Doch, doch!«, beeilte ich mich zu beteuern. »Ich wüsste nur allzu gerne, worum es eigentlich geht.« Seine Frage nach dem Grad meiner Frömmigkeit deutete ja in eine gewisse Richtung; aber mir wurden im Laufe meines Lebens schon eine Menge Skandale im Zusammenhang mit der Kirche zugetragen, von denen der eine oder andere sogar in einem Buch seinen Niederschlag fand, seien es Finanzskandale der Vatikanbank, Klöster für schwangere Nonnen oder ein Versandhaus für Spezialkleidung masochistischer Mönche. Was sollte mich da noch schrecken!
Ohne sich von seinem Stuhl zu erheben, reckte Gropius den Hals und blickte über die Balustrade in Richtung der Piazza Trento. Dann wandte er sich mir zu und sagte: »Entschuldigen Sie mein seltsames Verhalten. Ich leide noch immer ein bisschen unter Verfolgungswahn; aber wenn Sie meine Geschichte gehört haben, werden Sie mir das nicht verübeln. Sehen Sie die beiden Männer da unten?« Gropius machte eine kurze Kopfbewegung hinunter zur Straße, wo sich zwei dunkel gekleidete Männer vor einem unscheinbaren Lancia unterhielten. Als ich mich über die Balustrade beugte, um einen Blick auf die Straße zu werfen, wandten die Männer mir wie zufällig den Rücken zu.
Vorübergehend geriet unsere Unterhaltung ins Stocken, weil die Signora mit breitem Lächeln und den üblichen Floskeln einer italienischen Köchin die Spaghetti servierte. Dazu tranken wir Frascati, nach Landessitte mit Wasser vermischt, und danach, wie sich das gehört, einen bitteren, schwarzen Espresso.
Es war still geworden, in den umliegenden Häusern wurden die hohen, meist grün gestrichenen Fensterläden geschlossen: Siesta. Die Männer vor dem Haus hatten sich getrennt. Jetzt standen sie rauchend und im Abstand von hundert Metern auf der Straße herum. Ein dreirädriger Lieferwagen knatterte über das Pflaster. Irgendwo krähte ein heiserer Hahn, als fürchte er um sein Leben. Aus dem unteren Stockwerk, wo sich die Küche befand, war das Rumoren der Spülmaschine zu vernehmen.
Der Mann an meiner Seite gab mir weiter Rätsel auf, und ich wusste wirklich nicht, wie ich ihm begegnen sollte. Wir hatten während des Essens über Belanglosigkeiten geredet, aber genaugenommen hatte Gropius mir die Tür zu seinem Leben noch keinen Spalt geöffnet. Und so fragte ich unwillig – schließlich war er gekommen, um mir irgendetwas Bedeutsames anzuvertrauen – in eine längere Pause hinein: »Wer sind Sie, Professor Gropius? Ich bin nicht einmal sicher, ob das Ihr wirklicher Name ist. Aber vor allem: Was haben Sie mir zu sagen? So reden Sie endlich!«
Da gab sich Gropius einen Ruck. Man konnte förmlich sehen, wie er alle Hemmungen, die ihn bis zu diesem Zeitpunkt gequält hatten, abstreifte. Behutsam legte er das Manuskript vor uns auf den Tisch und beschwerte es mit beiden Händen.
»Ich heiße wirklich Gropius, Gregor Gropius«, begann er so leise, dass ich näher rücken musste, um ihn zu verstehen. »Ich machte mit vierundzwanzig meinen Doktor der Medizin, mit achtunddreißig wurde ich Professor an einem Großklinikum in Süddeutschland. Dazwischen zwei Jahre Auslandsaufenthalt in renommierten Kliniken in Kapstadt und Boston. Kurz, eine Karriere wie aus dem Bilderbuch. Ach ja, und da war noch Veronique. Ich traf sie auf einem Kongress in Salzburg, wo sie als Hostess arbeitete. Eigentlich hieß sie Veronika, und von ihren Eltern, die außerhalb der Stadt ein Fiaker-Unternehmen betrieben, wurde sie Vroni gerufen. Aber daran wollte sie nicht erinnert werden. Wir heirateten vier Wochen nachdem ich meinen Doktor in der Tasche hatte, in Schloss Mirabell und mit einer von vier Schimmeln gezogenen Kutsche. Zu Beginn unserer Ehe ging alles gut. Veronique war außergewöhnlich attraktiv. Ich verehrte sie, und sie betrachtete mich als eine Art Wunderknaben; das schmeichelte mir natürlich. Rückblickend muss ich jedoch sagen, als Grundlage einer Ehe war beides zu wenig. Ich hatte nur meine Karriere im Kopf, und Veronique akzeptierte mich weniger als Partner denn als Sprungbrett in höhere Gesellschaftskreise. Nur gelegentlich oder wenn sie eine größere Summe Geld brauchte, täuschte sie Liebe vor; aber ein solches Ereignis musste dann wieder sechs Wochen reichen. Kinder standen übrigens nie zur Debatte. Kinder, pflegte sie zu sagen, sollten dankbar sein, wenn sie nicht in diese schreckliche Welt hineingeboren würden. In Wahrheit fürchtete Veronique um ihre Figur, da bin ich mir ganz sicher. Kurz, nach zehn Jahren war unsere Ehe am Ende, auch wenn keiner von uns das wahrhaben wollte. Wir wohnten zwar noch in unserem gemeinsamen Haus im vornehmsten Viertel der Stadt, aber gingen beide unsere eigenen Wege, und keiner von uns unternahm je den Versuch, unsere Ehe zu retten. Um sich endlich selbst zu verwirklichen – so pflegte sie sich auszudrücken –, eröffnete Veronique eine PR-Agentur, in der sie Werbekampagnen für Firmen, Verlage und Schauspieler konzipierte. Dass sie mich allerdings gleich mit dem ersten Großauftrag betrog, fand ich schäbig. Ausgerechnet mit einem Sauerkrautkonservenfabrikanten. Gut, er hatte Geld wie Heu und überhäufte sie mit teuren Geschenken; dabei hatte es Veronique bei mir nie an etwas gemangelt. Ich rächte mich auf meine Weise, indem ich eine niedliche Röntgenassistentin mit nach Hause brachte. Sie war fast zwanzig Jahre jünger als ich, und als Veronique uns überraschte – sie kam unerwartet von einer Geschäftsreise zurück –, da schlug die langjährige Gleichgültigkeit von einem Tag auf den anderen in Hass um. Ich werde nie das Feuer in ihren Augen vergessen, als sie zischte: ›Diese Geschmacklosigkeit wirst du mir büßen! Ich mache dich kaputt.‹ Ich muss gestehen, ich nahm ihre Drohung damals nicht ganz ernst. Aber dann, keine drei Wochen später, es war der vierzehnte September, den Tag werde ich nie vergessen, weil er mein Leben veränderte, erinnerte ich mich plötzlich an Veroniques Drohung, und ich versuchte …«
An dieser Stelle unterbrach ich den Professor, der immer lebhafter zu erzählen begann, getrieben von einer seltsamen Unruhe. Ich hatte längst die Überzeugung gewonnen, dass dieser Mann weit davon entfernt war, mir einen Bären aufzubinden. Jedenfalls faszinierte mich sein Bericht ungemein, und meine Erfahrung (oder war es mein sechster Sinn?) im Umgang mit Menschen sagte mir, dass hinter dieser Geschichte viel mehr steckte als ein Allerwelts-Ehedrama. Gropius war nicht der Typ, der einen Fremden, und ein Fremder war ich für den Professor noch immer, grundlos in sein aus den Fugen geratenes Privatleben hineinzog. Auch sah ich in ihm nicht den Mitleid heischenden Egoisten, der sein Schicksal als das schlimmste von allen beweint. Deshalb bat ich den Professor um Erlaubnis, mir Notizen machen zu dürfen.
»Das brauchen Sie nicht«, sagte der Professor. »Ich habe Sie aufgesucht, um Ihnen meine Aufzeichnungen zu überlassen. Ich glaube, bei Ihnen sind sie in den richtigen Händen.«
»Wenn ich Sie recht verstehe, Professor, wollen Sie Geld für Ihre Geschichte!«
»Geld?« Gropius lachte bitter. »Geld habe ich genug. Wie ich schon sagte, hat man mir für zehn Millionen den Mund verboten – allerdings zu einer Zeit, da noch niemand ahnen konnte, wie die Geschichte ausgehen würde. Nein, ich möchte nur, dass die Wahrheit ans Licht kommt, und Sie können das bestimmt besser in Worte kleiden als ich.«
»Die Wahrheit?«
Ohne Umschweife begann Gropius nun zu erzählen, stockend zuerst, dann immer schneller werdend und Bezug nehmend auf Querverbindungen in einem ungeheuerlichen Gewirr von Abenteuern und Intrigen. Als er zum Ende kam, war es kurz vor Mitternacht. Wir sahen uns lange an. Gropius leerte sein Glas und sagte: »Danke, dass Sie mir so lange zugehört haben.« Dann erhob er sich. »Ich denke, wir werden uns in diesem Leben nicht mehr wiedersehen.«
Ich lächelte. »Vielleicht im nächsten.«
Gropius reichte mir die Hand und verschwand in der Dunkelheit. Mich fröstelte. Schon merkwürdig, dachte ich. Da fahre ich nach Italien, um einen neuen Roman zu schreiben, und dann bekomme ich eine wahre Geschichte geschenkt, die alles, was man sich auszudenken vermag, in den Schatten stellt.
KAPITEL 1
Eintausendsechshundert Gramm braunes, wabbelndes, menschliches Gewebe in einer kalten Kristalloidlösung – eine menschliche Leber in einem hochformatigen Aluminiumkoffer mit der Aufschrift »Eurotransplant« auf dem Weg von Frankfurt nach München. Nachts um 2 Uhr 30 hatte der Fahrer im Klinikum der Johann Wolfgang von Goethe-Universität am Theodor-Stern-Kai das zur Transplantation bestimmte Organ übernommen. Jetzt jagte der schnelle Wagen in Richtung München über die Autobahn.
Für gewöhnlich werden Spenderorgane mit dem Flugzeug befördert; aber wegen des Nachtflugverbots in München hatte man den Weg über die Autobahn gewählt. Der Computer von ELAS, dem Leber-Zuteilungssystem von Eurotransplant, hatte den Altertumsforscher Arno Schlesinger als möglichen Empfänger ermittelt. Ein Gremium von drei Ärzten am Münchner Klinikum stimmte der Auswahl zu. Schlesinger, sechsundvierzig Jahre alt, stand seit vier Monaten auf der Warteliste, seit sechs Wochen lief er unter Dringlichkeitsstufe T2. Bei einem Unfall war seine Leber erheblich verletzt worden.
Wie stets blieb der Name des Spenders ungekannt. Nur soviel wurde bekannt: ein tödlicher Unfall. Hirntod gegen 23 Uhr. Blutgruppe des Spenders AB Rhesus negativ, verträgliches Antigenmuster mit A. Schlesinger, Klinikum München – so hatte die Datenbank von ELAS blitzschnell ermittelt.
Professor Gregor Gropius, als Transplanteur trotz seiner jungen Jahre eine Kapazität, war vom diensthabenden Assistenzarzt Dr. Linhart gegen 5 Uhr 30 aus dem Bett geklingelt worden. Er hatte geduscht, eine Tasse Pulverkaffee in sich hineingeschüttet, einen grauen Zweireiher angezogen, die passende Krawatte vor dem Spiegel zurechtgerückt, und jetzt steuerte er seinen dunkelblauen Jaguar vom Münchner Villenvorort Grünwald in Richtung Norden.
Die Straßen waren feucht, obwohl es nicht geregnet hatte. Der verhangene Himmel kündigte einen diesigen Tag an. Es war die sechzehnte oder siebzehnte Lebertransplantation in seiner kurzen erfolgreichen Laufbahn, wie immer war Gropius angespannt. Er hatte kaum Augen für den einsetzenden Berufsverkehr, überfuhr, ohne es zu bemerken, eine rote Ampel und schaltete das Autoradio aus, als der Nachrichtensprecher neue Anschläge in Israel verkündete.
Der diensthabende Arzt hatte bereits das Operationsteam zusammengetrommelt. Für Fälle wie diesen gab es einen Notplan, der, einmal in Gang gesetzt, mit präzisem Automatismus ablief. Die Nachtschwester hatte Schlesinger gegen sechs Uhr geweckt, vom diensthabenden Stationsarzt wurde der Patient ein letztes Mal mit der anstehenden Operation vertraut gemacht. Die Narkoseärztin verabreichte ihm eine Beruhigungsspritze.
Im Abstand weniger Minuten bogen der Fahrer von Eurotransplant und Professor Gropius in die Lindenallee ein. Gropius wählte den Weg zum rückwärtigen Personalparkplatz. Der Fahrer aus Frankfurt lieferte den Aluminiumkoffer mit dem Spenderorgan in der Notaufnahme ab. Er wurde bereits erwartet.
Zwischen dem Eintreffen des Spenderorgans in der Klinik und dem Beginn der Operation vergehen in der Regel nicht mehr als fünfundvierzig Minuten. Auch an diesem Morgen nahmen die letzten Untersuchungen und das Präparieren der Spenderleber nicht mehr Zeit in Anspruch. Um 7 Uhr 10 lag das Organ in OP 3 zur Verpflanzung bereit.
Gropius hatte in der Teeküche von Station 3 noch ein frugales Frühstück hinuntergeschlungen, zwei Brötchen mit Käse, einen Joghurt und mehrere Tassen Kaffee, dann begab er sich in den Vorraum zum Umkleiden und Waschen. Er war ein Morgenmuffel, aber die Mitarbeiter in seiner Umgebung wussten das und verhielten sich entsprechend, indem sie es bei einem kurzen »Morgen« beließen.
Ein Team von fünf Ärzten, zwei Anästhesisten und vier Schwestern stand bereit, als der Professor um 7 Uhr 15 den OP betrat. Der Patient lag abgedeckt unter einem grünen Laken. Mit einem Handzeichen gab Gropius der Narkoseärztin das Zeichen zu beginnen. Minuten später nickte die Anästhesistin, der Professor setzte den ersten Schnitt.
Es war kurz vor Mittag, als Professor Gregor Gropius als Erster aus dem Operationssaal in den Vorraum trat. Er hatte den Mundschutz herabgezogen und hielt die Arme hoch wie ein von der Polizei gestellter Gangster. Sein grüner Kittel war blutbefleckt. Eine Schwester trat hinzu und befreite den Professor von den Gummihandschuhen und der OP-Kleidung. Auch die anderen Mitglieder des Operationsteams fanden sich einer nach dem anderen in dem Vorraum ein. Jetzt herrschte gelöste Stimmung.
»Mein Patient und ich danken der gesamten Mannschaft für die tatkräftige Mitwirkung!« Gropius führte die Hand mit militärischem Gruß zur Stirn; dann verschwand er, erschöpft und mit Ringen unter den Augen, in seinem Zimmer.
In den letzten Tagen hatte Gropius wenig geschlafen, und wenn, dann nur schlecht. Das hing weniger mit seiner verantwortungsvollen Tätigkeit zusammen als mit Veronique, die ihm das Leben zur Hölle machte. Dieser Tage erst hatte er sich dabei ertappt, dass er darüber nachdachte, Veronique zu beseitigen, irgendwie, Ärzte kennen da die verschiedensten Methoden. Aber dann, wieder bei klarem Verstand, hatte er diese Gedanken bedauert, und seither war er ziemlich durcheinander, wurde von Albträumen verfolgt und von der Gewissheit, dass nur einer von ihnen diesen Kampf heil überstehen würde, Veronique oder er.
Achtzehn Jahre Ehe waren eine lange Zeit, die meisten Ehen hielten heutzutage nicht einmal so lange, doch nun war sie eben am Ende. Aber mussten sie sich deshalb bis aufs Messer bekriegen? Mussten sie mit allen Mitteln versuchen, das Leben des anderen zu zerstören? Der Aufbau seiner Karriere hatte viel Mühe gekostet – von Geld ganz zu schweigen. Und jetzt wollte Veronique alles daran setzen, diese Karriere zu zerstören?
Gropius nahm eine Captagon, wollte gerade zum Telefon greifen, um sich einen Kaffee kommen zu lassen, als das graue Gerät vor ihm einen piepsenden Laut von sich gab. Der Professor hob den Hörer ab: »Ich möchte die nächste halbe Stunde nicht gestört werden …« Er stockte. Und nach einer langen Schrecksekunde sagte er leise und mit einer gewissen Ratlosigkeit in der Stimme: »Das darf doch nicht wahr sein. Ich komme.«
Zur selben Zeit betrat Veronique Gropius ein Bistro in der Nähe des Englischen Gartens. Sie war der Typ Frau, auf die sich alle Augen richteten, wenn sie ein Lokal betrat, nicht nur die Augen der Männer. Auch wenn sie an diesem Tag, entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit, eher dezent gekleidet war, erregte ihre aparte Erscheinung im dunklen Kostüm Aufsehen.
Nur ein paar Tische waren um die Mittagszeit in dem Lokal, einem typischen Studenten- und Intellektuellentreff, besetzt, und so fiel Veronique der glatzköpfige, magere Mann an einem Tisch in der Mitte des Raumes gleich auf. Er sah genau so aus, wie er sich am Telefon beschrieben hatte, jedenfalls bestimmt nicht so, wie man sich gemeinhin einen Privatdetektiv vorstellt.
»Madame Gropius?«, sagte er fragend, während er sich von seinem Tisch erhob. Die Anrede wirkte etwas ungewöhnlich, passte aber irgendwie zu dem vornehm gekleideten, gepflegten Mann.
»Herr Lewezow?«, fragte Veronique zurück.
Lewezow nickte und schob der Dame vorsichtig einen Stuhl hin.
Einen peinlichen Augenblick musterten sie sich gegenseitig, dann meinte Veronique schmunzelnd: »So sieht also ein Privatdetektiv aus. Sie sind mir doch nicht böse, wenn ich sage: so ganz anders als im Fernsehen.«
Lewezow nickte: »Sie haben wohl eine Pfeife rauchende schmuddelige Type in Lederjacke und Jeans erwartet!« Dabei zog er angewidert die Augenbrauen hoch. »Ich mache das auch noch nicht allzu lange – worunter die Qualität meiner Ermittlungen jedoch in keiner Weise leidet, ganz im Gegenteil. Ich darf«, Lewezow holte unter dem Tisch eine dünne Mappe hervor, »ich darf Ihnen einige Referenzen vorlegen.«
Während Veronique Gropius die Aufträge, Dankschreiben und Preisliste in der Mappe überflog (in der Tat befanden sich respektable Leistungen darunter), fragte sie, um Zeit zu gewinnen: »Wie lange machen Sie das schon? Ich meine, als Privatdetektiv wird man schließlich nicht geboren.«
»Vier Jahre«, erwiderte der Glatzkopf, »davor war ich Tanztherapeut und davor Tänzer an der Staatsoper. Nach dem Tod meines Freundes habe ich buchstäblich den Boden unter den Füßen verloren. Ich brachte keine Pirouette, keinen Sprung mehr zustande. Aber ich will Sie nicht mit meiner Lebensgeschichte langweilen.«
»Keineswegs!« Veronique lächelte und gab Lewezow die Mappe zurück.
»Sie machten am Telefon eine Andeutung«, bemerkte der Detektiv, um zum Thema zu kommen.
Veronique holte tief Luft, und während sie in ihrer flachen schwarzen Handtasche kramte, begann sie zu erzählen, wobei sich ihr Gesichtsausdruck von einem Augenblick auf den anderen veränderte. Die eben noch ausgeglichenen Züge nahmen plötzlich eine sichtbare Strenge, ja Härte an. Dann zog sie aus der Tasche ein Foto hervor und reichte es dem glatzköpfigen Mann.
»Das ist Professor Gregor Gropius, mein Mann – Exmann sollte ich wohl besser sagen. Unsere Beziehung besteht seit langem nur noch auf dem Papier, unsere Ehe wird nur noch per Telefon abgewickelt.«
»Gestatten Sie mir eine Frage, Madame, warum lassen Sie sich nicht scheiden?«
Veronique faltete die Hände, dass ihre Knöchel schneeweiß hervortraten. »Da gibt es ein Problem. Wir haben bei unserer Eheschließung vor achtzehn Jahren Gütertrennung vereinbart. Wissen Sie, was das bedeutet, Herr Lewezow?«
»Ich kann es mir denken, Madame.«
»Mein Mann geht aus einer Scheidung als reicher Mann ohne Verpflichtungen hervor, und ich kann wieder von vorne anfangen.«
»Sie üben keinen Beruf aus?«
»Doch. Seit zwei Jahren betreibe ich eine PR−Agentur. Das Geschäft läuft nicht schlecht, aber im Vergleich zu dem Vermögen, das Gregor inzwischen angehäuft hat …«
Lewezow kniff die Augen zusammen. »Ich fürchte, dass es im Fall einer Scheidung kaum eine Möglichkeit gibt, legal an das Geld Ihres Mannes oder auch nur an einen Teil heranzukommen.«
»Ich bin mir dessen bewusst«, fiel Veronique dem Detektiv ins Wort, »das ist auch die Auskunft meiner Anwälte. Wie Sie sagten, besteht legal kaum eine Möglichkeit. Man müsste Gropius eben so weit bringen, dass er sich freiwillig bereit erklärt, mit mir zu teilen – mehr oder weniger freiwillig, meine ich natürlich.«
»Jetzt verstehe ich. Auch im Leben eines Professors gibt es wie im Leben jedes Menschen dunkle Flecken, die besser nicht an die Öffentlichkeit kämen. Habe ich Recht?«
Augenblicklich erhellten sich Veroniques Züge, und ein hinterhältiges Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Genauso ist es. In diesem besonderen Fall könnte es Gropius sogar Kopf und Kragen kosten. Das Problem ist nur, ich habe keine Beweise.«
»Beweise wofür?«
Veronique blickte zur Seite, ob ihr Gespräch nicht belauscht würde, und begann leise: »Gropius ist Professor am Klinikum der Universität. Er führt im Jahr einige Dutzend Organtransplantationen durch. Gregor verpflanzt Nieren, Lebern und Lungen von einem Menschen auf den anderen, wobei die Spender meist tot sind.«
Lewezow schluckte.
»Allerdings ist der Bedarf um ein Vielfaches größer als die Anzahl von Spenderorganen, sodass Organe auf dem schwarzen Markt gehandelt werden wie Gebrauchtwagen oder Antiquitäten mit Preisen bis hunderttausend Euro.«
Lewezow begann sich Notizen zu machen, schließlich blickte er auf und sagte: »Wenn ich Sie recht verstehe, vermuten Sie, dass Ihr Exmann mit Organhändlern gemeinsame Sache macht.«
Veronique sah Lewezow ohne jede Regung ins Gesicht.
»Und wenn ich Sie weiter richtig verstehe«, setzte der seine Rede fort, »möchten Sie – vorausgesetzt Ihre Vermutung sollte sich als richtig erweisen – Gropius mit Ihrem Wissen …«
»… erpressen! Sprechen Sie es ruhig aus. Ich will nicht, dass mein Mann mich nach achtzehn Jahren Ehe wie einen Dienstboten mit drei Monatsgehältern abspeist, verstehen Sie?«
Mit der flachen Hand fuhr sich Lewezow über den gepflegten, kahlen Schädel, während seine Augen auf den Notizen vor sich auf dem Tisch ruhten. »Keine leichte Aufgabe«, knurrte er nachdenklich vor sich hin, »ich möchte Sie darauf hinweisen, dass dies einen nicht unerheblichen Aufwand erfordert.«
»Am Geld soll es nicht scheitern«, entgegnete Veronique, »schließlich geht es um viel.«
Lewezow nickte stumm.
»Das Foto können Sie behalten. Und hier«, sie zog ein gefaltetes Papier aus ihrer Handtasche – »hier habe ich alle Namen und Adressen des persönlichen Umfelds meines Mannes aufgeschrieben, einschließlich der kleinen Schlampe aus der Klinik, mit der er zweimal die Woche das Bett teilt.«
Mit Staunen überflog Lewezow die Angaben, und anerkennend bemerkte er: »Höchst professionell, Madame, wirklich, höchst professionell!«
Veronique machte eine unwillige Geste, als wollte sie sagen: Bitte sparen Sie sich Ihre Komplimente. Stattdessen schob sie ihrem Gegenüber einen ausgefüllten Scheck über die Tischplatte und meinte: »Fünftausend. Das sollte fürs Erste genügen. Später rechnen wir ab.«
Es gab kaum etwas, das Lewezows depressive Stimmung mehr verbessern konnte als Geld. Nach alter Gewohnheit pflegte er Schecks zu küssen. Das tat er auch diesmal, bevor er mit den Worten verschwand: »Madame, ich bin sicher, Ihnen behilflich sein zu können.«
Als Professor Gropius den Intensivraum betrat, war Arno Schlesinger bereits tot. Das EKG gab einen konstanten hohen Pfeifton von sich. Gropius stieß den Pfarrer, eine hoch aufgeschossene schwarze Gestalt mit weißem Halskragen, der ein unverständliches Gebet lispelte, beiseite.
»Wie konnte das passieren?«, herrschte der Professor seinen Oberarzt Dr. Fichte an.
Dieser, ein jungenhafter Typ mit dunklem Kraushaar und im selben Alter wie Gropius, schüttelte den Kopf. Ratlos blickte er auf Schlesinger, der mit halb geschlossenen Augen und offenem Mund, den Kopf zur Seite gekippt, in einem Gewirr von Kabeln und Schläuchen dalag. Leise, kaum hörbar, sagte er: »Plötzlich auftretende Tachykardie, kurzzeitiger Pulsus dicrotus, wenig später Herzstillstand. Ich habe keine Erklärung.«
»Warum haben Sie mich nicht eher gerufen?«, wandte sich Gropius der Aufsichtsschwester zu.
Die Schwester, eine wohlbeleibte Blondine, die schon viele Patienten hatte sterben sehen, erwiderte eher teilnahmslos: »Tut mir Leid, Herr Professor, es ging alles so schnell.« Und nicht weniger teilnahmslos und mit einem Fingerzeig auf die Leitungen, mit denen der Tote noch immer verkabelt war, sagte sie: »Dann kann ich wohl abstecken.«
Während die Schwester das EKG ausschaltete und die Kabel einsammelte, traten Gropius und sein Oberarzt ans Fenster und blickten ins Freie. Ohne seinen Kollegen anzusehen, fragte der Professor: »Was ist Ihre Meinung, Fichte?«
Der Oberarzt zögerte.
»Sie brauchen mich nicht zu schonen!«, ermunterte Gropius seinen Oberarzt.
»Vermutlich eine Blutung der Ösophagus−Varizen.«
Gropius nickte. »Nahe liegend. Aber ich glaube nicht daran. In diesem Fall hätte ich mir einen Vorwurf zu machen.«
»Ich wollte Ihnen damit keinesfalls irgendeine Schuld …«, beeilte sich der Oberarzt hinzuzufügen, aber Gropius unterbrach ihn.
»Schon gut. Sie haben völlig Recht. Eine Blutung ist nahe liegend. Und deshalb werde ich eine Obduktion veranlassen.«
»Sie wollen …«
»Das bin ich meinem Ruf schuldig. Ich möchte nicht, dass irgendwann einmal das Gerücht aufkommt, Gropius habe in einem bestimmten Fall schlampige Arbeit geleistet. Ich bestehe auf einer Obduktion.«
Als die blonde Schwester merkte, dass das Gespräch ins Grundsätzliche ging, zog sie es vor, den Intensivraum zu verlassen. Langjährige Erfahrung in ihrem Beruf hatte sie gelehrt, dass derartige Gespräche unter Ärzten meist ein unrühmliches Ende nehmen, ohne dass je das Wort fallen würde, worum es eigentlich geht: Kunstfehler.
Mit seiner Entscheidung, eine Obduktion vornehmen zu lassen, wollte Gropius von vornherein Gerüchten den Wind aus den Segeln nehmen. Für ihn stand zunächst einmal fest, dass er keinen Fehler gemacht hatte. Aber woran war Schlesinger so plötzlich gestorben?
Die Frage beschäftigte Gropius weiter; sie würde morgen im Laufe des Tages beantwortet werden. Wer unter dem Tod eines Patienten leidet, pflegte er zu sagen, sollte nicht Arzt werden. Das hatte nichts mit Kaltherzigkeit zu tun oder gar Unmenschlichkeit, ein Klinikum war ein großes wirtschaftliches Dienstleistungsunternehmen, in dem nicht alles gelang.
Trotz dieser Abgeklärtheit gegenüber dem einzelnen menschlichen Schicksal versetzte der Fall Schlesinger den Professor in unerklärliche Unruhe. Dies hier war eine Routine-Operation gewesen, die völlig ohne Komplikationen verlaufen war. Trotzdem war der Patient gestorben, und sein Gefühl sagte Gropius, dass da irgendetwas nicht stimmen konnte.
Missgelaunt kam Gropius gegen 20 Uhr nach Hause. Seit Veronique ihn verlassen hatte, kam ihm das Haus wie leer geräumt vor, obwohl sie nur die Möbel ihres eigenen Zimmers mitgenommen hatte. Er hatte den Raum seither nicht mehr betreten – warum, konnte er selbst nicht sagen. Ohne hinzusehen, schaltete er das Fernsehgerät ein, aus der Küche holte er ein Glas Rotwein, dann ließ er sich erschöpft in einen Ohrensessel fallen und starrte vor sich hin ins Leere. D.T. nannte er seinen Zustand des Alleinseins scherzhaft gegenüber Freunden, wobei D. für Delirium und T. für tremens stand; aber das war wirklich scherzhaft gemeint in Bezug auf einen Zustand, in dem sich jeder Mann zu befinden glaubt, dem die Frau davongelaufen ist.
Gropius nahm einen Schluck und stellte das Glas ab, als das Telefon läutete. Er schaute auf die Uhr und entschied, nicht abzuheben, denn er hatte keine Lust, mit jemandem zu reden, und für den Fall, dass es Rita war, die Röntgenassistentin, auf Sex schon gar nicht.
Nach schier endlosem Klingeln kam der Apparat endlich zum Schweigen, aber nur, um nach einer kurzen Unterbrechung erneut seine Nerven zu strapazieren. Verärgert meldete sich Gropius. »Ja?«, bellte er in den Hörer.
Niemand antwortete. Gropius wollte gerade schon wieder auflegen, als er eine Stimme vernahm.
»Wer ist da?«, kläffte er nun ziemlich ungehalten.
»Eine Nachricht für Professor Gropius«, hörte er eine kalte, leicht verzerrte Stimme sagen. »Es geht um den Tod Schlesingers.«
Mit einem Mal war Gropius hellwach. »Wer sind Sie? Was wissen Sie über den Patienten? So reden Sie doch!«
»Schlesinger starb an einem Leberkoma. – Sie trifft keine Schuld. – Deshalb sollten Sie alle weiteren Nachforschungen einstellen. – Es ist in Ihrem eigenen Interesse.«
»Verdammt, wer sind Sie?«, rief Gropius in höchster Erregung.
Der Anrufer hatte aufgelegt.
Verwirrt presste Gregor Gropius den Hörer auf das Gerät, als wollte er verhindern, dass der Anrufer sich erneut meldete. Wer war der seltsame Anrufer? In seiner Ratlosigkeit rief Gropius alle Stimmen ab, die sein Gehirn gespeichert hatte. Der Vorgang dauerte einige Minuten, dann gab er auf. Er ergriff sein Glas, leerte es in einem Zug und schaltete das Fernsehgerät aus. Vom Charakter alles andere als ein Hasenfuß, bekam er es plötzlich mit der Angst zu tun, er fühlte sich beobachtet und ließ mit einem Knopfdruck die Rolladen des Hauses herab.
Wer in aller Welt wusste von Schlesingers Tod? Und wer konnte eine so präzise und durchaus mögliche Todesursache nennen? Dafür gab es nur eine Erklärung: Es musste jemand aus dem Kollegenkreis sein. Die Rivalität unter Medizinern wird nur von jener unter Hollywoodstars übertroffen. »Fichte, Oberarzt Dr. Fichte«, murmelte Gropius halblaut vor sich hin. Aber schon im nächsten Augenblick verwarf er den Gedanken. Wollte Fichte an seinem Stuhl sägen, so hätte er doch größtes Interesse an der Aufklärung des Todes von Schlesinger, jedenfalls wäre es unsinnig, ihn aufzufordern, alle Nachforschungen nach der Todesursache einzustellen.
Unruhig wie ein Raubtier ging Gropius im Salon auf und ab. Er hielt die Hände hinter dem Rücken verschränkt und schüttelte fassungslos den Kopf. Veronique! Mehr als einmal hatte sie ihm ins Gesicht gesagt, dass sie ihn hasste. Beim ersten Mal hatte es geschmerzt, schließlich hatten sie sich einmal geliebt; aber nach mehrmaliger Wiederholung hatte selbst dieser Treffer an Wirkung verloren. Ohne Zweifel wäre Veronique zu einer groß angelegten Intrige fähig. Sie hatte sie ja sogar angekündigt. Aber war sie in der Lage, den Tod eines Patienten zu inszenieren? Veronique hatte kaum Kontakte in die Klinik. Den Umgang mit Ärzten schätzte sie nicht. »Alles Spießer«, meinte sie einmal, »nur Innereien und Karriere im Kopf, widerlich!« Nein, auch Veronique schied als Urheberin dieses Anschlags aus. Und der mysteriöse Anruf machte in diesem Zusammenhang noch weniger Sinn.
Mit dieser unbefriedigenden Erkenntnis ging Gropius zu Bett; aber er lag lange wach. Das Geschehen um den Tod des Patienten hatte ihn mehr aufgewühlt, als er zunächst dachte. Bis es hell wurde, döste er im Halbschlaf vor sich hin.
Am nächsten Morgen in der Klinik empfing ihn seine Sekretärin, eine mütterliche Fünfzigerin – etwas anderes hätte Veronique nie zugelassen – wie stets mit aufgesetzter guter Laune und der Mitteilung, das Obduktionsergebnis im Fall Schlesinger stehe fest, Professor Lagermann bitte um Rückruf.
Lagermann! Obwohl er ihn noch gar nicht gesprochen hatte, war seine Stimme Gropius sofort gegenwärtig. Lagermann könnte der geheimnisvolle Anrufer gewesen sein! Mit gespielter Ruhe betrat Gropius sein Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Er sah, dass seine Hand zitterte, als er die Nummer des Pathologen wählte.
»Es wird Sie nicht überraschen, Herr Kollege, wenn ich Ihnen die Todesursache im Fall Schlesinger nenne«, begann der ohne Umschweife, »der anatomische Befund lautet Leberkoma.«
Gropius brachte kein Wort hervor, und Lagermann fragte zurück: »Sind Sie noch da?«
»Ja, ja«, stammelte Gropius und versuchte mühsam, aber vergebens sich einen Reim auf das soeben Gehörte zu machen.
»Was Sie allerdings überraschen wird, ist der histologische Befund: Das Spenderorgan war nicht clean. Ich konnte Chlorphenvinphos in hoher Dosierung nachweisen. Vermutlich eine Injektion in das präparierte Organ. Der Patient hatte keine Überlebenschance. Unter den gegebenen Umständen war es meine Pflicht, den Staatsanwalt einzuschalten. Mein schriftlicher Bericht folgt.«
»Lagermann!«, murmelte Gropius, nachdem er den Hörer aufgelegt hatte. Er spürte kalten Schweiß im Nacken. »Lagermann?«
In den folgenden Tagen überstürzten sich die Ereignisse dermaßen, dass es Gropius später schwer fiel, alles in eine chronologische Abfolge zu bringen. Es begann mit einer peinlichen Situation, die sich durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ergab, wie sie unseliger nicht hätten ablaufen können.
Beinahe wie im Traum hatte Gropius die Tagesarbeit verrichtet und sich dabei mehrfach ertappt, dass er jeden, der ihm begegnete, misstrauisch musterte, ob der bereits von dem Vorfall wusste. Dabei gewann er den Eindruck, dass die meisten Kollegen ihm geflissentlich aus dem Weg gingen.
Am späten Nachmittag saß Gropius in seinem Besprechungszimmer, einem nüchternen Raum mit Stahlrohrmöbeln und schwarzen Ledersesseln, vor sich auf dem Schreibtisch die Transplantationsakte Schlesinger, und zermarterte sich das Gehirn mit der immer wiederkehrenden Frage: Wie konnte das geschehen? Wer hatte Interesse daran, ein Spenderorgan zu vergiften? Beinahe hätte er das zaghafte Klopfen an der Tür überhört, verunsichert rief er: »Ja bitte?«
Plötzlich stand Rita vor ihm, die Röntgenassistentin, gerade mal halb so alt wie er, bildhübsch und horoskopgläubig, eine seltene Kombination, weil es meist Defizite sind, die den Weg zum Horoskop bereiten. Jedenfalls wusste er, seit sie sich näher kannten – ja, sie hatten ein Verhältnis –, dass er Jungfrau, Aszendent Löwe war mit der Sonne im ersten Haus; aber das war ihm jetzt auch keine Hilfe.
Als Gropius das rothaarige Mädchen im weißen Kittel erblickte, sprang er erschreckt auf und trat ihm entgegen: »Habe ich dir nicht gesagt, in der Klinik kennen wir uns nicht«, zischte er leise.
»Ich weiß«, erwiderte Rita, »aber man tuschelt auf den Stationen, es sei etwas Furchtbares passiert, ein Mord!« Sie schlang die Arme um Gropius’ Hals.
Er wehrte sie ab, indem er das Mädchen an beiden Handgelenken fasste. »So, man tuschelt«, bemerkte er unwillig.
»Was ist wahr an diesen Gerüchten?«, rief das Mädchen mit dünner Stimme.
»Nichts! Das heißt, ja, es ist etwas passiert. Ein Spenderorgan war vergiftet. Der Patient ist kurz nach der Operation gestorben. Jetzt weißt du’s!« Gropius’ Worte klangen ungehalten und überreizt.
In ihrer Aufregung hatten die beiden nicht bemerkt, dass zwei weitere Gestalten den Raum betreten hatten. Vor ihnen standen wie aus dem Boden geschossen Gropius’ Sekretärin und ein dem Professor unbekannter Mann. Immer noch hielt Gropius die Arme des Mädchens an seine Brust gepresst.
»Ich habe angeklopft«, meinte die Sekretärin entschuldigend, wobei sie die kompromittierende Haltung ihres Chefs mit einem strafenden Blick quittierte.
»Schon gut«, erwiderte Gropius. Er entließ das Mädchen aus seiner Umklammerung und sagte an Rita gewandt: »Wir unterhalten uns später über Ihr Problem!« Rita verschwand.
»Das ist Staatsanwalt Renner«, sagte die Sekretärin mit einer Handbewegung auf den Fremden.
Gropius musterte den Staatsanwalt, einen jungen, drahtigen Typ mit randloser Brille und strengem Bürstenhaarschnitt, und während er das tat, wurde ihm die Fadenscheinigkeit seiner Bemerkung Rita gegenüber bewusst. »Ich habe Sie erwartet«, wandte er sich dem jungen Mann zu, »bitte nehmen Sie Platz.«
Markus Renner stand erst am Anfang seiner Karriere, aber sein Verhalten wirkte alles andere als zurückhaltend. »Sie wissen, worum es sich handelt«, begann er ohne Umschweife. »Welche Erklärung haben Sie für den Vorfall? Sie müssen sich selbst nicht belasten und können jederzeit die Aussage verweigern; aber nach Lage der Dinge ermittle ich wegen fahrlässiger Tötung. Vermutlich kommt es zur Anklage. Wollen Sie aussagen?«
Die Sätze des Staatsanwalts schwirrten wie abgeschossene Pfeile durch den Raum, geradlinig und zielsicher, und sie trafen Gropius in seinem Innersten. »Ich habe nicht die geringste Erklärung für diesen Vorfall«, erwiderte er zögernd, »und Sie können mir glauben, dass ich zuallererst an einer Aufklärung des mysteriösen Geschehens interessiert bin. Schließlich geht es um meine Reputation als Arzt.«
Renner nickte zufrieden. »Dann darf ich Sie bitten, mir die Transplantationsakten zu überlassen. Ich brauche den Namen des Operateurs, der die Spenderleber entnahm, die Namen aller am Transport des Organs von Frankfurt nach München Beteiligten und die Namen aller, die hier in der Klinik mit dem Organ in Berührung kamen oder gekommen sein könnten.«
Mit einem säuerlichen Lächeln im Gesicht schob Gropius dem Staatsanwalt die Akte über den Tisch. »Hier finden Sie alle Unterlagen.«
Beinahe gleichgültig und mit einer Kaltschnäuzigkeit, die man einem Mann seines Alters kaum zugetraut hätte, nahm Renner die Akte in Empfang. Als handelte es sich um einen Werbeprospekt oder dergleichen, ließ er die einzelnen Seiten durch die Finger gleiten, dann erhob er sich mit den Worten: »Professor, ich möchte Sie bitten, sich zur Verfügung der Staatsanwaltschaft zu halten. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie die Stadt in den nächsten Tagen nicht verlassen?«
Gropius nickte unwillig, und nicht weniger unwillig knurrte er: »Wenn es denn sein muss.«
Mit einer Floskel und ohne einen Händedruck verabschiedete sich Staatsanwalt Renner. Er hatte kaum die Tür hinter sich geschlossen, als Gropius halblaut hinter ihm herrief: »Schnösel!« Er hatte eine Riesenwut im Bauch.
Aufgebracht wischte er sich mit dem Handrücken über die Stirn, als wollte er seine finsteren Gedanken auslöschen. Schließlich begann er auf ein Papier Rechtecke und Linien zu zeichnen und Pfeile, die sich wie verirrt durch ein Labyrinth bewegten: den Weg des Koffers mit dem Spenderorgan vom Eintreffen in der Klinik bis zum Operationssaal. An manchen Stellen markierte Gropius ein X, an anderen ein Fragezeichen. Das Labor im dritten Stock, wo eine letzte histologische Untersuchung stattgefunden hatte, umrundete er mit einem Kreis. Von hier auf dem Weg zum OP markierte er jede Tür mit einem Ausrufungszeichen. Nachdem der Laborbericht alle Werte bestätigt und keine Abnormitäten aufgeführt hatte, musste der Anschlag auf diesem letzten Weg verübt worden sein.
Gropius wartete bis zum Schichtwechsel um 20 Uhr. Danach kehrte auf allen Stationen Ruhe ein. Lautlos machte er sich mit seinen Skizzenblättern auf den Weg. Er hätte nie für möglich gehalten, dass er einmal heimlich wie ein Dieb durch seine Station schleichen würde, um sich irgendwelche Notizen zu machen. Aus Furcht, er könnte bei seiner seltsamen Tätigkeit entdeckt werden, schlenderte er mehrmals scheinbar ziellos durch die Gänge, wobei er sich den Anschein gab, eine wichtige Akte zu studieren. In Wahrheit notierte er jede Tür und die Bedeutung des dahinter liegenden Raumes, und dabei ließ er weder WCs noch Besenkammern aus.
Erleichtert, weil ihm niemand begegnet war, der Verdacht schöpfen konnte, strebte er gerade dem Lift zu, als ein Mann um die Ecke bog, den er um diese Zeit hier zuallerletzt erwartet hätte.
»Sie, Herr Staatsanwalt?«
Markus Renner grinste hinterhältig und rückte seine Brille zurecht. Mit zusammengekniffenen Augen musterte er die Skizzenblätter, welche Gropius in den Händen hielt, und bemerkte von oben herab: »Wie es scheint, hatten wir beide den gleichen Gedanken!«
Gropius zog es vor zu schweigen. Was immer der Staatsanwalt auch mit seiner Bemerkung hatte sagen wollen, er hatte keine Lust, Erklärungen abzugeben. Dies hier war immer noch seine Klinik. Von Anfang an war ihm dieser karrieresüchtige Schnösel unsympathisch gewesen – und nicht nur deshalb, weil ein Todesfall sie zu Gegnern gemacht hatte; das nassforsche Auftreten des jungen Mannes missfiel ihm. So kam es, dass die unangenehme Begegnung in Schweigen endete und jeder seiner Wege ging.
Als Gropius kurz vor 22 Uhr nach Hause kam, wartete Rita vor der Haustür. Er war nicht einmal überrascht. Es hatte zu regnen begonnen, und das Mädchen war völlig durchnässt.
»Ich dachte, an einem Tag wie diesem könntest du ein bisschen Aufheiterung vertragen. Aber ich kann auch wieder gehen, wenn du willst.«
Das hatte etwas Rührendes. »Nein, nein, komm schon herein!«
In Augenblicken wie diesem fragte sich Gropius, ob ihr Verhältnis nicht doch mehr war als purer Sex. Denn das hatte er Rita gegenüber unumwunden zugegeben. Von einer ernsthaften Beziehung wollte er nichts wissen. Gewiss, er war scharf auf sie, aber von Liebe konnte keine Rede sein. Rita hatte das nicht allzusehr erschüttert. Sie war seiner Ehrlichkeit mit der Bemerkung begegnet, sie könne warten.
»Du musst das verstehen«, begann Gregor Gropius, als sie im Haus waren, »das hat nichts mit dir zu tun, aber im Augenblick ist mir nicht gerade nach Vögeln zumute.«
»Hm.« Rita schob die Unterlippe vor wie ein kleines Mädchen. Sie wusste sich auch in einer Situation wie dieser in Szene zu setzen.
»Du solltest ein heißes Bad nehmen und deine Kleider kurz zum Trocknen aufhängen«, sagte Gregor und nahm das Mädchen in die Arme.
Rita entkleidete sich vor seinen Augen – was ihn an diesem Abend aber nicht aus der Fassung brachte – und hängte ihre nassen Sachen über den Heizkörper im Flur.
Wie schön sie ist, dachte Gropius. Weiter kam er nicht. Das Telefon holte ihn in die Wirklichkeit zurück. Noch bevor er seinen Namen nannte, vernahm er aus dem Hörer eine Stimme, die er schon einmal gehört hatte: »Eine Nachricht für Professor Gropius. – Es geht um den Tod Schlesingers. Schlesinger starb an einem Leberkoma. – Sie trifft keine Schuld. – Deshalb sollten Sie alle weiteren Nachforschungen einstellen. Es ist in Ihrem eigenen Interesse.« Dann brach die Verbindung ab.
Wie versteinert blickte Gropius auf das nackte Mädchen. Er hatte noch den ersten Anruf im Gedächtnis. Dies war genau derselbe Wortlaut. Eine Tonbandstimme!
»Etwas Unangenehmes?«, fragte Rita.
»Ja«, antwortete Gregor abwesend.
»Willst du, dass ich gehe?«
Gropius blickte zur Seite und nickte.
Etwa zur selben Zeit hingen Professor Lagermann und Oberarzt Dr. Fichte am Tresen einer Bierkneipe in der Innenstadt. Sie hieß »Extrablatt« und war ein ebenso beliebter wie verrauchter Treff von Journalisten, weil die wichtigsten Zeitungen nur wenige Minuten entfernt lagen. Nie im Leben wären Fichte und Lagermann Freunde geworden, dafür waren beide einfach zu verschieden, aber das Schicksal hatte sie insofern zusammengeschweißt, als Fichtes Vater und Lagermanns Mutter Geschwister waren, womit ihnen der nur mit Mühe nachvollziehbare Verwandtschaftsgrad von Cousins zukam. In der Klinik verschwiegen beide diese Tatsache, und sie hatten unterschiedliche Gründe dafür.
Während Fichte, genannt »Bäumchen«, ein ausgesprochener Frauentyp war, hatte Lagermann dem anderen Geschlecht schon lange abgeschworen. Ob aus Überzeugung oder der Not gehorchend, vermochte niemand zu sagen, auch Fichte nicht. Augenzwinkernd bezeichnete sich Lagermann als zeugungsfähigen Protestanten. Im Übrigen hatte er einmal seinem Cousin gestanden, welche Frau lasse sich schon aus freien Stücken mit einem Leichenschneider ein. Er könne, hatte er gemeint, sich auch nicht vorstellen, dass eine Frau abends nach der Arbeit frage: Na wie war’s heute?, und dass er zwischen Suppe und Pasta antworte: Heute hatte ich mal wieder Herz und Nieren oder einen vollen Magen auf dem Tisch.
Lagermann betrachtete seinen Beruf als Broterwerb, keinesfalls als Berufung, er war da, wie die meisten Pathologen, so hineingerutscht, einer musste die Arbeit ja machen. Dass sein Ehrgeiz sich in Grenzen hielt, muss daher ebenso wenig erwähnt werden wie die Tatsache, dass er dem Alkohol mehr zusprach, als es dem Organismus eines erwachsenen Mannes zuträglich war.
Fichte war das ganze Gegenteil: Nicht sehr groß, aber weltoffen und lebensfroh, hatte er eine attraktive Frau und zwei allerliebste Töchter, und seine Karriere stand ganz oben als Lebensziel. Und obwohl Gropius dieser Karriere eigentlich im Wege stand, schien Fichte Gropius zu mögen, jedenfalls beteuerte er das bei jeder Gelegenheit.
Walter Lagermann hingegen machte aus seiner Abneigung gegen Gropius keinen Hehl, ohne seine Gefühle näher zu begründen. Und so hatte er sich spontan bereit erklärt, als Daniel Breddin, ein Reporter der Bild-Zeitung, mit dem er schon öfter zu tun gehabt hatte, anrief und um ein Gespräch bat. Dass Fichte dabei war, störte nicht weiter, jedenfalls aus Lagermanns Sicht. Die beiden trafen sich alle paar Wochen auf ein Bier, und Lagermann sah keinen Grund, dieses harmlose Vergnügen ausfallen zu lassen.
Daniel, genannt »Danny« Breddin, sein träges dickliches Aussehen stand im starken Gegensatz zu seinem aufgeweckten, scharfen Verstand –, Danny kam gleich zur Sache: »Über dpa lief heute die Meldung von einem mysteriösen Todesfall im Universitätsklinikum. Was ist da dran, Professor?«
»Es war Mord«, bemerkte Lagermann sachlich, und Fichte fiel ihm sofort ins Wort: »Aber Walter! So kann man das nicht sagen.«
Beschwichtigend hob Lagermann die Hände: »Also gut, dann will ich mich anders ausdrücken: Ein Patient hat eine Lebertransplantation nur eine Stunde überlebt. Bei der anschließenden Obduktion habe ich in der transplantierten Leber eine hohe Dosis eines Insektizids festgestellt. Mit anderen Worten, das Organ war vergiftet!«
Breddin bekam große Augen, er witterte eine Sensationsgeschichte. »Der Tod ist also nicht auf einen ärztlichen Kunstfehler zurückzuführen?«, meinte Breddin fragend.
Lagermann hob theatralisch die Schultern, sodass sein breiter Schädel beinahe zwischen den Achseln verschwand. »Gregor Gropius besitzt an und für sich einen hervorragenden Ruf!«, erwiderte er in einem Tonfall, der seine Aussage eher in Zweifel stellte.
Darauf griff Fichte in die Diskussion ein und erklärte an den Reporter gewandt: »Sie müssen wissen, mein Cousin Walter Lagermann und Gregor Gropius können sich nicht leiden, oder besser: Walter mag Gropius nicht, Sie verstehen. Tatsache ist, dass das transplantierte Organ präpariert war, vermutlich durch eine Injektion. Über den Täter und seine Motive kann man nur spekulieren. Jedenfalls ist der Fall dem Renommee unserer Klinik nicht gerade zuträglich. Ich darf Sie aber bitten, dass Sie mich aus Ihrem Bericht heraushalten. Es wäre mir äußerst unangenehm, wenn der Verdacht aufkäme, ich wollte Gropius in den Rücken fallen. Nach meiner Auffassung trifft Gropius keine Schuld.«
Lagermann grinste breit, kippte einen Klaren in einem Zug hinunter und polterte los, während sein wütender Blick abwechselnd zu Breddin und Fichte wanderte: »Gropius war der verantwortliche Leiter der Operation, also muss er auch dafür gerade stehen, wenn etwas passiert. Oder sehe ich das falsch? Im Übrigen verstehe ich nicht, warum du Gropius schonen willst. Ich bin überzeugt, er würde, wenn er einen Weg fände, die Verantwortung auf dich abwälzen.«
»Du bist ja verrückt!« Wütend knallte Fichte sein Bierglas auf die Theke, beugte sich zu Lagermann hinüber und zischte so, dass Breddin es nicht hören sollte: »Hör auf zu trinken, Walter. Du redest dich noch einmal um Kopf und Kragen!«
Lagermann verzog das Gesicht und stieß Fichte von sich: »Quatsch. Ich rede was und mit wem ich will!«
Da griff Fichte in die Tasche, legte einen Schein auf den Tresen und sagte an Breddin gewandt: »Sie dürfen nicht alles glauben, was mein Cousin im Laufe eines Abends erzählt. Er trinkt manchmal ein bisschen viel und weiß am nächsten Morgen nicht mehr, was er gesagt hat. Und jetzt entschuldigen Sie mich.«
Dass Fichte seinen Cousin Lagermann einfach stehen ließ, kam gar nicht selten vor. Angeheizt von der nötigen Menge Alkohol, war dessen Redefluss kaum zu bremsen, und dabei wurde er allzu leicht ausfällig.
Kaum war Fichte verschwunden, sah Breddin seine Stunde gekommen, mehr aus Lagermann herauszuholen, als dem später lieb sein konnte. Deshalb stellte er unumwunden die nächste Frage: »Hat Professor Gropius eigentlich Feinde?«
»Feinde?« Lagermann schluckte. Er war bereits an dem Punkt angelangt, wo es ihm schwer fiel, eine kluge Antwort zu geben. Nach einer Weile scheinbaren Nachdenkens platzte es aus ihm heraus: »Ja, mich natürlich. Als Freund würde ich ihn jedenfalls nicht betrachten.« Dabei lachte er endlos lange und gekünstelt, sodass andere Gäste im Lokal bereits aufmerksam wurden.
»Und außer Ihnen?«
Lagermann machte eine wegwerfende Handbewegung. »Sie müssen wissen, unter den Medizinern einer Klinik bricht jeden Morgen der Dritte Weltkrieg aus. Die Kriegsgründe sind für Außenstehende lachhaft: ein besserer Parkplatz, ein teureres Auto, das besser gelegene Zimmer, die schönere Sekretärin, die prominenteren Patienten. Konkurrenzneid und Ruhmsucht treiben die seltsamsten Blüten. Einem armen Pathologen wie mir bleibt all das weitgehend erspart. Ich habe keine Konkurrenz, und den Ruhm kann mir niemand streitig machen, denn es gibt keinen. Oder kennen Sie einen berühmten Pathologen? Meine Patienten brauche ich nicht sonderlich behutsam zu behandeln – sie sind alle schon tot; und egal ob Penner oder Promi, sie unterscheiden sich nur durch das an der kleinen Zehe befestigte Namensschild.«
Lagermann blickte mit schweren Augenlidern vor sich auf die Theke, und ohne den Reporter anzusehen fuhr er fort: »Wissen Sie eigentlich, wie scheußlich so ein Mensch von innen aussieht? An seinem Äußeren hat der Mensch Jahrtausende gearbeitet, er wurde immer schöner, immer begehrenswerter. Denken Sie nur an den Diskuswerfer des Myron oder Michelangelos David! Aber unter der Haut sind wir noch genauso grässlich und unvollkommen wie vor einer Million Jahren. Haben Sie schon einmal das Herz eines Menschen gesehen, so einen von gelbem Fett umgebenen unförmigen Muskelklumpen, oder eine Leber wie ein im Wald verschimmelter Schwamm oder verkalkte Arterien, die wie Unterwassergestrüpp in einem Tümpel aussehen? Und das alles tagtäglich zwischen Frühstück und Mittagessen!« Lagermann steckte den Zeigefinger in sein Schnapsglas und fuhr weinerlich fort: »Ich sage Ihnen, Breddin, all das können Sie nur mit dem nötigen Quantum Alkohol ertragen. Breddin?«
Lagermann blickte auf und suchte verwirrt nach seinem Gegenüber. Aber Breddin war längst verschwunden.
Am nächsten Morgen titelte die Bild-Zeitung: »Mysteriöser Todesfall in Uniklinik.« In dem Artikel wurde Professor Lagermann mit den Worten zitiert: »Der Fall wirft kein gutes Licht auf unsere Klinik! Es wäre wünschenswert, wenn der Schuldige bald ersetzt würde.«
An allen Straßenecken sprang Gropius die Schlagzeile entgegen, als er an diesem Morgen in die Klinik fuhr. Ihm war, als ob die Menschen an den Fußgängerampeln ihn anstarrten, und manche, schien es ihm, zeigten mit Fingern auf ihn und feixten schadenfroh. Um dem Spießrutenlauf zu entgehen, presste er die Stirn auf das Lenkrad, bis die Ampel auf Grün schaltete und er durch ungeduldiges Hupen in die Wirklichkeit zurückgeholt wurde. Als er ein Stück an der Isar entlangfuhr, überlegte er allen Ernstes, seinen Jaguar über die hohe Ufermauer in den Fluss zu lenken; aber ein Sturz in den Fluss brachte keineswegs die Gewissheit zu sterben. Und wäre es nicht viel mehr die Anerkennung seiner Schuld?
Verfolgt von derlei Gedanken nahm er den Weg in die Klinik, von alter Gewohnheit gelenkt wie ein Esel, der sogar blind seinen Stall findet. Später hatte er keine Erinnerung mehr, wie er den Weg zurückgelegt hatte. Er wusste auch nicht, wie es zu dem Folgenden kam.