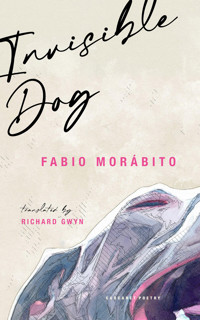Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition diá Bln
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Erzähler Morábito versteht es, den Leser in eine phantastische Welt inmitten des Alltäglichen zu versetzen. Seine Prosa schafft prägnante Bilder und Situationen - Sprache als »Zauberwerkzeug«, mit dem die Dinge ihrem gewohnten Raum entzogen und in neuem Licht präsentiert werden. Meister der präzisen Sprache und Beobachtung, lotet er in Das geordnete Leben den Mahlstrom der steten Verunsicherungen und kleinen Katastrophen im Alltag aus. Ob Verwandtenbesuch, Wohnungsbesichtigung oder Geburtstagsfest: allenthalben lauert die Anarchie, unmerklich entfalten sich Kräfte, die die Figuren den Boden unter den Füßen verlieren lassen. Doch unter dem Riss an der Oberfläche tut sich nicht nur der Abgrund auf, sondern auch eine Welt der großen Sehnsüchte im kleinen Leben. von Fabio Morábito außerdem in der Edition diá: Die langsame Wut. Prosa Aus dem mexikanischen Spanisch von Thomas Brovot und Susanne Lange ISBN 9783860345450
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
Der Erzähler Morábito versteht es, den Leser in eine phantastische Welt inmitten des Alltäglichen zu versetzen. Seine Prosa schafft prägnante Bilder und Situationen – Sprache als »Zauberwerkzeug«, mit dem die Dinge ihrem gewohnten Raum entzogen und in neuem Licht präsentiert werden. Meister der präzisen Sprache und Beobachtung, lotet er in Das geordnete Leben den Mahlstrom der steten Verunsicherungen und kleinen Katastrophen im Alltag aus. Ob Verwandtenbesuch, Wohnungsbesichtigung oder Geburtstagsfest: allenthalben lauert die Anarchie, unmerklich entfalten sich Kräfte, die die Figuren den Boden unter den Füßen verlieren lassen. Doch unter dem Riss an der Oberfläche tut sich nicht nur der Abgrund auf, sondern auch eine Welt der großen Sehnsüchte im kleinen Leben.
»Ein Meister des Beiläufigen.« (Tagesspiegel)
Der Autor
Fabio Morábito wurde 1955 in Alexandria als Sohn italienischer Eltern geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Mailand, bis seine Eltern sich 1970 in Mexiko niederließen, wo Morábito heute als Übersetzer, Literaturwissenschaftler und Schriftsteller lebt. Das Italienische ist seine Muttersprache, seine Werke jedoch verfasst er auf Spanisch: Erzählungen, Essays und Gedichte, die mehrfach mit Preisen ausgezeichnet wurden. In vordergründig einfacher Erzählweise erzeugt er in seinen Texten prägnante Bilder und Situationen, in denen Menschen und Dinge ihrem gewohnten Raum entzogen werden und in neuem Licht erscheinen.
Fabio Morábito war 1998/99 Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD. Er gilt als einer der einflussreichsten spanischsprachigen Autoren der Gegenwart, seine Werke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Die Übersetzer
Thomas Brovot, geb. 1958, lebt als Übersetzer (u. a. Juan Goytisolo, Federico García Lorca) in Berlin. Für seine Neuübersetzung von Mario Vargas Llosas »Tante Julia und der Schreibkünstler« erhielt er den Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis.
Susanne Lange, geb. 1964, lebt als Übersetzerin (u. a. Fernando del Paso, Federico García Lorca, Juan Rulfo, Luis Cernuda und Miguel de Cervantes) bei Barcelona. Sie wurde u. a. mit dem Johann-Heinrich-Voß-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ausgezeichnet und bekleidete die August-Wilhelm-von-Schlegel-Gastprofessur für Poetik der Übersetzung an der FU Berlin.
Fabio MorábitoDas geordnete Leben
Erzählungen
Aus dem mexikanischen Spanischvon Thomas Brovot und Susanne Lange
Mit einem Nachwort von Michi Strausfeld
Edition diá
Inhalt
Das Arrangement
Der Mietvertrag
Der umgestürzte Baum
Die Schlüssel
Stadt, Land, Fluss
Der Mond und die Ratten
Michi Strausfeld:Die innere Unordnung
Bibliographie
Impressum
Für Ethel
Das Arrangement
Es wurde schon dunkel, als ich zum Haus meiner Tante kam, und während ich mit dem Koffer die vier Treppen hinaufstieg (der Aufzug war außer Betrieb), fiel mir auf, wie heruntergekommen es war. Mit seinem großen, mit Bäumen bestandenen Garten, der es von den anderen Grundstücken trennte, war es in meiner Kindheit das eleganteste Gebäude der Via Sofonisba gewesen, doch jetzt, vielleicht gerade wegen dieses unzeitgemäßen Gartens, glich es einer versinkenden Insel.
Im vorletzten Stock blieb ich stehen, um Atem zu holen. Seit meinem letzten Besuch waren sechs Jahre vergangen, und ich wollte nicht den Eindruck erwecken, mit mir gehe es körperlich bergab. Ich fürchtete, mein Cousin Ruso, der Jüngste der Familie, der mit seinen dreißig Jahren noch bei den Eltern lebte, könnte eine seiner sarkastischen Bemerkungen machen. Ich ging weiter, und als mein Atem sich beruhigt hatte, klingelte ich. Meine Tante öffnete, zögerte eine Sekunde und erkannte mich: »Wir haben dich morgen erwartet!«, sagte sie und umarmte mich. Ich sah erleichtert, dass sie nicht gealtert war und noch immer ihren wachen, herrischen Blick hatte. Gleich darauf umarmte ich meinen Onkel, der aus dem Wohnzimmer kam.
»Und dieser Vorhang?«, fragte ich und zeigte auf den cremefarbenen Vorhang, der den Flur teilte.
»Das Arrangement«, sagte mein Onkel.
»Jetzt hör auf mit deinem Arrangement!«, rief meine Tante mit ihrer schrillen Stimme. »Lass ihn erst mal ausruhen.«
Sie nahm mich am Arm, führte mich in die Küche und bot mir Kaffee an. Bei meiner Tante wurde man immer mit einem Kaffee empfangen, egal zu welcher Tageszeit.
»Und Ruso?«, fragte ich.
»Eben zur Arbeit gegangen«, sagte meine Tante.
»Um diese Zeit?«
»Ist weniger anstrengend und besser bezahlt.«
Sie sagte, er arbeite als Pförtner in einem Krankenhaus und komme morgens um halb acht von der Arbeit zurück. Dann sprach sie von etwas anderem, aber ich war in Gedanken noch bei dem Vorhang im Flur, und bei der ersten Gelegenheit kam ich darauf zurück. Ich fragte sie, was für ein Arrangement das sei.
»Ich dachte, das wüsstest du«, sagte sie, und ihr Gesicht verdüsterte sich. »Vor einem Jahr habe ich deiner Mutter davon geschrieben. Hat sie nichts gesagt?«
»Sie sagte, der neue Eigentümer wolle euren Vertrag nicht verlängern.«
»Wir haben uns arrangiert.«
Mein Onkel, der am Türrahmen stand, schaltete sich ein:
»Sie haben uns einen Teil der Wohnung weggenommen. Auf der anderen Seite wohnen sie.«
Mit einer Kopfbewegung deutete er auf das Ende des Flurs. Ich schaute ihn an und wusste nicht, ob er mich auf den Arm nehmen wollte. Ich trat in den Flur, ging auf den Vorhang zu und schob ihn zurück. Dort war eine weiße Wand, und als ich dagegenklopfte, stellte ich fest, dass es massives Mauerwerk war, kein Gipskarton. Ich hörte, wie mein Onkel und meine Tante stritten. Dann ging ich ins Wohnzimmer, das nur noch die Hälfte seiner ursprünglichen Größe hatte. Auch dort hing dieser cremefarbene Vorhang, hinter dem ich wieder gegen eine Wand klopfte, so massiv wie die andere. Zwei der drei Fenster waren verschwunden, und ich ging zu dem einzigen, das geblieben war, um einen Blick hinauszuwerfen. Mein Onkel und meine Tante stritten immer noch. Ich hörte, wie sie von einer Frau sprachen, und mir schien, sie setzten einen Streit fort, den ich mit meiner Ankunft unterbrochen hatte. Ich wartete, bis wieder Ruhe eingekehrt war, und ging zurück in die Küche. Der Kaffee stand schon auf dem Tisch. Beide schwiegen bedrückt, und ich sah, dass meine Tasse die einzige war.
»Trinkt ihr keinen?«, fragte ich.
»Nicht um diese Uhrzeit«, antwortete meine Tante, »dann können wir nicht schlafen.«
Ich trat an die Glastür zum Balkon, der außen an der gesamten Wohnung entlanglief, und sah ein paar Aluminiumstäbe, die ihn teilten. Die Fläche war auf ein lächerliches Stück geschrumpft, das gerade noch die Breite der Küche maß. Das größte Stück, das auf die Sofonisba hinausging, hatte man ihnen weggenommen. Von dort aus hatte ich als Kind die Fenster unserer Wohnung auf der Straßenseite gegenüber sehen können.
»Und wann ist das passiert?«, fragte ich.
»Im Juni vor einem Jahr«, sagte meine Tante.
Sie erklärten mir, dass die neuen Eigentümer erst die ganze vierte Etage hatten haben wollen. Der Nachbarin hatten sie den Vertrag gekündigt, so dass sie ausziehen musste, doch da sie letztlich nicht so viel Platz benötigten, hatten sie beschlossen, ihnen nur einen Teil der Wohnung wegzunehmen, sie überließen ihnen sogar die Diele der Nachbarin, wo nun Ruso schlief.
»Dann muss Ruso quer durchs Treppenhaus, um in sein Zimmer zu kommen«, sagte ich.
»Sie meinten«, sagte mein Onkel, »sie würden uns einen Gefallen tun, weil wir jetzt zwei Türen auf der Treppe haben und sie nur eine.«
»Hätten wir abgelehnt, wären wir jetzt draußen«, resümierte meine Tante. »Und wo findest du heute eine bezahlbare Wohnung. Glaubst du, wir suchen nicht?«
Dann sprach sie von der Wohnungsnot und den astronomischen Mieten. Ich hörte nur halb zu, das Gesicht an die Scheibe gedrückt, und als mein Onkel aus der Küche kam, wechselte sie das Thema und fragte mich nach Amalia und dem Jungen.
Ich sagte, es gehe ihnen gut, und wollte ihr schon ein Foto der beiden zeigen, ließ es aber in der Brieftasche stecken. Ich schaute deprimiert auf den winzigen Balkon und bereute es, extra für sie meine Rückreise verschoben zu haben. Hätte ich jetzt einfach gehen können, ich hätte es mir nicht zweimal überlegt. Um die verlängerte Reise vor meinem Partner zu rechtfertigen, hatte ich zum Glück noch zwei Termine mit Verlegern in der Stadt gemacht. Es waren unwichtige Verabredungen, aber wenigstens würde ich beschäftigt sein.
»Du siehst müde aus«, sagte meine Tante.
»Ich habe mich noch nicht an die Zeitverschiebung gewöhnt.«
»Du schläfst in Rusos Zimmer, wenn es dir nichts ausmacht.«
»Und Ruso?«
»Nachts ist er im Krankenhaus.«
»Aber wenn er von der Arbeit kommt, will er sicher schlafen. Wann muss ich aufstehen?«
»Wenn er von der Arbeit kommt, geht er noch ein bisschen herum oder noch mal hinaus und kommt später wieder, also schlaf, so lange du möchtest.«
»Ich will nicht stören.«
»Was bist du auf einmal förmlich!« Und in anderem Ton fügte sie hinzu: »Das einzige Problem ist das Bad.«
Ich nahm an, sie meinte die Unannehmlichkeit, den Treppenabsatz überqueren zu müssen, um ins Bad zu gelangen.
»Kein Problem«, sagte ich, »ich gehe durchs Treppenhaus. »Ich habe meinen Morgenmantel dabei.«
»Wir haben kein Bad«, sagte mein Onkel, der wieder am Türrahmen stand und diesen Satz mit der Feierlichkeit eines schlechten Schauspielers sprach, der seinen einzigen Text im Stück aufsagt.
Ich sehe noch die Blicke der beiden, als bäten sie mich, ihnen doch zu glauben, ihnen die Demütigung zu ersparen, mich erst davon überzeugen zu müssen, dass dies kein Scherz war. Eine so klare Stille trat ein, dass das Rauschen eines Windstoßes, der in die Eukalyptusbäume im Garten fuhr, bis zu uns drang.
»Rusos Zimmer soll eigentlich unser Bad werden«, sagte meine Tante leise, als könnte uns jemand hören, »aber es muss noch umgebaut werden. Vorläufig überlassen uns die Rubios aus dem zweiten Stock ihr Bad, wenn sie morgens zur Arbeit gehen. Abends müssen wir zur Hausmeisterin hinunter. Ruso geht auch zu ihr, zu den Rubios nicht, die mag er nicht.«
»Halb so wild«, sagte mein Onkel, als er mein ungläubiges Gesicht sah. »Man gewöhnt sich daran.«
»Deswegen nur eine Tasse Kaffee«, sagte meine Tante. »Für alle Fälle steht unter Rusos Bett ein Nachttopf. Deiner Mutter habe ich es nicht gesagt, weil ich sie nicht deprimieren wollte.«
Ich wandte den Blick zur Balkontür, und da ich nichts antwortete, fügte sie hinzu:
»Sie haben die Miete auf zweitausendfünfhundert herabgesetzt, das ist das Minimum, wir können uns nicht beklagen. Unser halbes Leben haben wir hier gewohnt. In so einer Gegend findest du heute nichts unter zehntausend, und da kannst du noch froh sein.«
Erst in dem Moment war ich mir sicher, dass sie nicht den Verstand verloren hatten, und ich nickte mechanisch mit dem Kopf.
»Ich werde Mutter nichts erzählen«, sagte ich, »damit sie nicht deprimiert ist.«
»Besser so«, sagte sie. »Jedenfalls wird sich bald eine Lösung finden. In zwei Wochen, spätestens einem Monat.«
Ich weiß nicht mehr, wovon wir danach sprachen, vielleicht sprachen wir auch gar nicht, denn es war Zeit für die Fernsehserie. Wir gingen ins Wohnzimmer. Ich war so müde, dass mir die Augen vor dem Fernseher zufielen.
»Geh schlafen«, sagte meine Tante, was ich mir nicht zweimal sagen ließ. Sie gaben mir den Schlüssel für Rusos Zimmer, und mein Onkel bot an, mich zu begleiten, aber ich sagte ihm, das sei nicht nötig. Ich ging mit meinem Koffer über den Treppenabsatz, und als ich den Schlüssel ins Schloss steckte, war mir, als hörte ich ein Geräusch hinter der mittleren Tür, der Tür der neuen Hauseigentümer, und ich lauschte ein paar Sekunden. Danach öffnete ich Rusos Zimmer, trat hinein und machte Licht. Es war ein kleines Zimmer ohne Fenster. Auf den Rat meiner Tante hin schaltete ich die Lüftung an. Ein leises Brummen setzte ein, wie von einem fernen Dampfkessel, und ich musste an eine Schiffskabine denken. Ich zog mich aus, löschte das Licht, und als ich die Bettdecke aufschlug, roch ich mit Behagen den feinen Duft, den die Laken verströmten.
Meine Tante hatte mich gebeten, nicht den Schlüssel im Schloss stecken zu lassen, da Ruso, wenn er vom Krankenhaus zurückkam, vielleicht hineinmüsse, um sich etwas zum Anziehen zu holen. Als ich am Morgen das Geräusch des Schlüssels und der Tür hörte, nahm ich an, dass er es war. Zum Glück lag ich mit dem Gesicht zur Wand, und ich stellte mich schlafend. Ich hörte, wie er den Bettkasten aufzog und darin wühlte. Er machte kein Licht, sondern behalf sich allein mit dem Schein, der durch die Tür hereinfiel. Dann schloss er sie so leise wie möglich, um mich nicht zu wecken. Ich schaute auf meine Uhr und sah, dass es halb acht war. Ich schlief gleich wieder ein, doch kurz darauf weckte mich ein rasches, sanftes Klopfen an der Tür. Jemand öffnete, machte Licht, schaute kurz herein, löschte es und ging wieder.
Als ich erneut wach wurde, war es neun Uhr. Ich zog mich an und überquerte den Treppenabsatz. Meine Tante sagte mir, Ruso hätte fortgemusst, und mein Onkel begleitete mich zur Wohnung der Rubios, wo ich duschen konnte.
Die Wohnung der Rubios lag im zweiten Stock, zur selben Seite hin wie die meiner Tante. Kaum dass ich eintrat, wurde mir bewusst, wie geräumig ihre Wohnung vor dem Arrangement gewesen war, und es gab mir einen Stich, wie sie ihn wohl jedes Mal verspürten, wenn sie das Bad hier benutzten.
Mein Onkel blieb auf dem Flur und wartete, bis ich fertig war. Offenbar war er nicht so vertraut mit den Rubios, als dass er mich allein gelassen hätte. Ich erledigte rasch, was ich zu erledigen hatte, und als ich aus dem Bad kam, musste ich ihm auf die Schulter tippen, weil er auf dem einzigen Stuhl im Flur eingeschlafen war.
»Ich bin so weit.«
Er kam wieder zu sich und machte ein so erschrockenes Gesicht, dass es mir weh tat.
»Bin eingeschlafen.« Er stand auf. »Dann will ich bei der Gelegenheit auch kurz hinein. Geh schon hoch frühstücken.«
Bestimmt wollte er nur ins Bad gehen, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung war. Ich ließ ihn allein und ging frühstücken.
»Wo ist Ruso hingegangen?«, fragte ich meine Tante, die in der Küche den Boden fegte.
»Irgendwohin«, antwortete sie mit einer vagen Geste. »Hat er dich geweckt, als er heimkam?«
»Jemand hat die Tür geöffnet, aber vielleicht habe ich es nur geträumt«, sagte ich als Entschuldigung dafür, dass ich nicht den geringsten Versuch gemacht hatte, meinen Cousin zu begrüßen.
»Er war in seinem Zimmer, um sich Socken zu holen«, sagte sie.
»Danach nicht noch einmal?«, fragte ich.
»Nein, warum?«
»Mir war, als wäre noch jemand hereingekommen«, sagte ich. »Ich habe es bestimmt geträumt.«
Ihr Ausdruck änderte sich, und ihre Kehrbewegungen wurden langsamer. Sie blieb nachdenklich stehen, dann sagte sie:
»Ich wollte dir noch etwas zeigen, hatte ich ganz vergessen.« Sie verließ die Küche und kam mit einem Buch in der Hand zurück. »Sieh mal, was ich gestern in meiner Kommode gefunden habe.«
Es war mein Gedichtband, den ich ihr vor zehn Jahren bei einem meiner Besuche geschenkt hatte.
»Das hast du noch?«, sagte ich. »Wirf es lieber weg.«
»Jetzt sei nicht albern!«
Sie schlug eine beliebige Seite auf, beugte den Kopf leicht zurück und bewegte die Lippen, während sie ein paar Verse las. Zum Glück dauerte ihre Prüfung nur kurz. Sie klappte das Buch zu und wiederholte: »Sei nicht albern!«, als hätten sie die gelesenen Zeilen vom unschätzbaren Wert meines einzigen Ausflugs in die Welt der Literatur überzeugt.
»Ich lege es in Rusos Zimmer, damit er es liest«, sagte sie. »Hast du noch andere Sachen geschrieben?«
»Nein. Ich habe schon lange aufgehört.«
Sie blickte mich besorgt an:
»Und trinkst nicht mehr?«
»Fast nie.« Ich stand vom Tisch auf, stellte meine Tasse in die Spüle und trat auf den Balkon.
Der Morgen versprach einen strahlenden Tag, und ich stützte mich aufs Geländer, um die Aussicht auf den Garten zu genießen, wobei ich mich fragte, ob nach Ruso tatsächlich noch jemand ins Zimmer gekommen oder alles nur ein Traum gewesen war.
Ich hörte, wie die Wohnungstür aufging, und richtete mich auf, weil ich glaubte, es sei mein Cousin. Aber es war nur mein Onkel, und ich nahm meine bequeme Haltung wieder ein. Mir wurde klar, dass ich keine Lust hatte, Ruso zu sehen, und ich beschloss, auch wenn es noch früh war, aus dem Haus zu gehen. Zu meiner Tante sagte ich, sie sollten mit dem Essen nicht auf mich warten.
»Ich habe drei Termine hintereinander.«
In Wirklichkeit war es nur einer.
»Ruso geht um sieben zum Krankenhaus, vielleicht schaffst du es vorher und begrüßt ihn«, sagte sie.
»Bestimmt, ja.«
Die Verabredung, die ich am Nachmittag hatte, war so wenig erfolgversprechend, dass ich überrascht war, als der Mitarbeiter des Verlags pünktlich eintraf, was mir die Gerüchte, sein Haus stehe kurz vor dem Konkurs, zu bestätigen schien. Ich schlug eine vage Vereinbarung über ein paar zweisprachige Ausgaben in Koproduktion vor, und er zeigte sich interessiert am lateinamerikanischen Markt, machte aber keinerlei Anstalten, Einzelheiten zu besprechen. Es schien, als hätten wir uns einzig verabredet, um einen Kaffee zu trinken an diesem so sonnigen Tag, der dem strengen Februarwinter einen Hauch von Frühling verlieh. Beim Abschied gab er mir allerdings noch einen wertvollen Tipp, der es mir ermöglichte, für den nächsten Tag einen Termin mit einem gewichtigeren Verleger zu vereinbaren. Sollte ich mit diesem zu irgendeiner Übereinkunft gelangen, würde meine Reise, die bisher ein Reinfall gewesen war, noch eine glückliche Wendung nehmen.
Es war fünf Uhr, ich hätte also in Ruhe nach Hause gehen und Ruso sehen können, doch der ungewöhnlich klare, angenehme Nachmittag lud zu einem Spaziergang ein, und ich befand mich in dem Viertel mit den besten Buchhandlungen. Ich rief an, um zu sagen, dass etwas dazwischengekommen sei und sie mit dem Abendessen nicht auf mich warten sollten. Meine Tante protestierte schwach.
»Ist Ruso wach?« Mir fiel ein, dass ich ihn am Telefon grüßen könnte, so würde ich jederzeit abreisen können, ohne ihn sehen zu müssen.
»Nein, er schläft in seinem Zimmer«, sagte sie.
»Dann sehe ich ihn morgen. Und euch werde ich noch einen weiteren Tag auf die Nerven fallen.«
»Bleib, so lange du möchtest.«
Es war nach Mitternacht, als ich heimkam. Bevor ich hinaufging, besuchte ich noch die Bar an der Ecke, um die Toilette zu benutzen, und trank bei der Gelegenheit zwei Anis. Da es nicht der erste Schluck an diesem Abend war, hatte ich, als ich die Bar verließ, einen gehörigen Rausch, den ich recht forsch zu überspielen verstand. Doch der Aufzug funktionierte immer noch nicht, und in diesem Zustand die vier Treppen hinaufzusteigen setzte mir zu. Als ich oben war, legte ich aus Neugier das Ohr an die mittlere Tür. Ich hörte ein undeutliches Geräusch von Leitungen und Rohren und wusste nicht, ob es mein eigenes pulsierendes Blut war. Ich nahm den Schlüssel, trat in Rusos Zimmer und sah auf dem Nachttisch mein Buch, mit einem Bleistift zwischen den Seiten, wo die Lektüre unterbrochen worden war. Dass da jemand seine Nase in meine alten Gedichte steckte, schmeichelte mir gar nicht, es verdarb mir die Laune. Was konnte Ruso darin finden, wo er niemals ein Buch aufschlug? Mich störte dieser zwischen die Seiten geklemmte Stift, am liebsten hätte ich das Buch verschwinden lassen. Aber ich zog mich aus, schlüpfte in den Pyjama und knipste die Lampe aus. Sofort machte ich sie wieder an und blätterte in dem Buch. Seit acht oder neun Jahren hatte ich keinen Blick mehr hineingeworfen. Ich hatte es befürchtet: Ein paar Verse waren unterstrichen. Es waren nicht viele, aber sie zeigten mir, dass Ruso auf diesen Seiten etwas gefunden hatte, worüber er nachdenken wollte. Ich legte das Buch wieder auf den Nachttisch und löschte das Licht. Mein Herz klopfte. So viele Jahre waren vergangen, und es wühlte mich immer noch auf. Festzustellen, dass mein Buch noch lebte, dass es in den Händen anderer erblühen konnte, brachte meinen Kreislauf durcheinander.
Ich drehte mich mit dem Gesicht zur Wand, falls Ruso, zurück vom Krankenhaus, wieder ins Zimmer kam. Jetzt wollte ich ihn erst recht nicht sehen, und beim bloßen Gedanken an sein Lobesgestammel lief es mir kalt über den Rücken.
Als ich am nächsten Morgen bei meiner Tante klingelte, war Ruso nicht da, weil er etwas zu besorgen hatte, und ich fragte mich, ob er mir nicht auswich. Vielleicht fürchtete er, ich würde ihm vorwerfen, dass er dieses demütigende Arrangement zugelassen und noch keine anständige Wohnung für sich und seine Eltern gefunden hatte.
Ich ging mit meinem Onkel zu den Rubios, und als ich zum Frühstücken wieder heraufkam, fragte ich meine Tante, ob Ruso bald zurück sei. Sie sagte, während sie sich mit ihrem Besen bückte, um an eine schwierige Ecke heranzukommen, sie wisse es nicht. Wir waren allein, mein Onkel war einkaufen gegangen. Dann richtete sie sich auf, hörte auf zu fegen, blickte mich an und zischte:
»Er ist bei einer Frau.«
Zu dieser frühen Stunde hieß das, bei einer älteren Frau.
»Verheiratet?«, fragte ich.
Sie sah mich mit finsterer Miene an:
»Alt!«
»Wie alt?«
Sie zuckte mit den Schultern, als lohnte es nicht, näher darauf einzugehen. Sie war alt, Punkt.
»Wenn du nur ein Wort mit ihm reden könntest«, sagte sie.
»Was soll ich ihm sagen?«
»Egal, er soll aufpassen, keine Dummheiten machen. Und wenn ihr Mann davon erfährt? Für uns ist das so schwer, auf dich würde er hören.«
Klar, mit meiner winzigen literarischen Karriere war ich das Genie der Familie. Meinem Cousin Vorhaltungen zu machen, das fehlte gerade noch.
»Wir verpassen uns immer«, wehrte ich ab.
»Wegen seiner elenden Arbeitszeit.«
Ich dachte, dass die Nachtschicht gar nicht so elend war, sondern durchaus ihre Vorteile hatte. Morgens, wenn die Männer bei der Arbeit und die Kinder in der Schule waren, blieben viele Frauen alleine, und wer es zu nutzen verstand, für den war es ein riesiges Jagdrevier.
»Ich warte noch etwas, vielleicht kommt er zurück«, sagte ich und ging auf den Balkon.
Es war ein sonniger Morgen, wie am Tag zuvor. Kurz darauf kam mein Onkel, stützte sich neben mir aufs Geländer und fing an, von dem Garten zu erzählen, von einem Problem, das sie mit den Kiefern gehabt hatten, die hinten eine etwas düstere Ecke bildeten. Es war derselbe Garten, den ich als Kind gekannt und in dem ich nie gespielt hatte, weil es verboten war. Deshalb hatte er sich so gar nicht verändert, dachte ich, und vielleicht hatten mein Onkel und meine Tante, gewöhnt an diese tägliche Lektion in Unveränderlichkeit, eben deshalb den Wandel der Zeiten nicht bemerkt. Während die meisten Nachbarn alles unternahmen, um ihre Wohnungen zu kaufen, hatten sie weiterhin zur Miete gewohnt, im Vertrauen auf ihre dreißig Jahre als Mieter im Haus, auf ihre guten Beziehungen zum alten Eigentümer und die beständige Ordnung jenes gepflegten, phantasielosen Gartens.
Vielleicht war Ruso zum Liebhaber der verheirateten Frau geworden, um ihr Bad zu benutzen, wo er in Ruhe seine Notdurft verrichten konnte, vielleicht wollte er sich nur die Demütigung ersparen, zu den Rubios hinunterzugehen.
Auf ein Geräusch zu meiner Linken, vom Balkon der Nachbarn her, wandte ich den Kopf. Die Tür des hinteren Zimmers, das vor dem Arrangement das Schlafzimmer gewesen war, ging auf, und eine etwa vierzigjährige, große und attraktive Frau kam heraus und wünschte uns mit einer flötenden Stimme, die zu ihrer provokanten Erscheinung nicht recht passte, einen guten Tag. Die Frau des neuen Eigentümers, dachte ich, als mein Onkel sie beflissen grüßte. Sie hatte eine Pappschachtel in der Hand, hockte sich nieder und ließ einen Teil des Inhalts, der sich als Reis herausstellte, auf den Boden rieseln. Sie bildete ein Häufchen, schob es mit ihren langen, rotlackierten Fingernägeln zusammen und sagte, ohne aufzublicken:
»Ich sehe, Sie haben Besuch.«
»Mein Neffe«, beeilte sich mein Onkel zu antworten. »Ich hatte von ihm erzählt, nicht wahr?«
»Natürlich.« Sie stand auf und kam zu uns herüber, um mir die Hand zu geben. »Sie sind also der Dichter. Ich liebe Gedichte.«
»Sehr erfreut.« Über die Abtrennung hinweg gab ich ihr die Hand, und als sie sich wieder hinhockte, um ein weiteres Reishäufchen aufzuschütten, betrachtete ich ihre Füße, die aufreizend aus den offenen Schuhen herausschauten, die Nägel in derselben Farbe lackiert wie ihre Finger. Ich spürte ein flaues Gefühl im Magen. Sie schaute mich eine Sekunde an, denn offenbar hatte sie gemerkt, dass ich auf ihre Füße starrte.
»Wie lebt es sich auf der anderen Seite des Atlantiks?«, fragte sie.
»Man lebt, wie überall auf der Welt«, antwortete ich.
»Nirgendwo lebt es sich gleich«, sagte sie mit gespieltem Ernst, als wollte sie andeuten, dass sie schon an vielen Orten gewesen war.
»Das ist eine Frage der Perspektive«, sagte ich, nur um etwas zu sagen, und sie erwiderte nichts, vielleicht enttäuscht über meine Antwort. Vielleicht erwartete sie von mir, einem Dichter, etwas Tiefsinniges.
Sie fragte mich, wann ich wieder führe, und ich antwortete, am nächsten Tag.
»Er ist sehr beschäftigt«, sagte mein Onkel.
Sie stand auf und stupste mit dem rechten Fuß ein paar Körner, die fortgerollt waren, zu einem der Reishäufchen. Sie machte es absichtlich, sich der Wirkung ihrer Beine bewusst, und diese gleichwohl etwas vulgäre Koketterie richtete in meinem Inneren eine weitere kleine Verwüstung an.
»Ein paar Minuten, und sie haben den Reis weggeputzt«, sagte sie zu meinem Onkel, der aus Höflichkeit die Ellbogen vom Geländer genommen hatte.
»Vielleicht spüren sie den nahen Frühling und haben größeren Hunger«, erwiderte er.