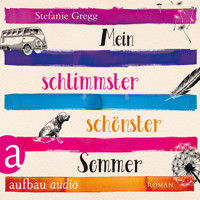9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie durch Glas.
Mayas Leben scheint nahezu perfekt. Sie arbeitet in Hamburg als Ärztin in einer Klinik und lebt in einer festen Beziehung. Doch dann erhält sie einen Anruf. Sie soll zurück nach München kommen. Ihre Mutter hatte einen Unfall, und Maya muss sich um ihren Bruder kümmern, der als Autist schon immer das Zentrum der Familie war. Bereits als Kind hatte sie das Gefühl, für ihre Eltern unsichtbar zu sein. Alle Sorge galt ihrem Bruder Tobias. Als Maya zurückkehrt, begreift sie, dass sie endlich ihren eigenen Weg finden muss – nicht gegen, sondern zusammen mit ihrer Familie ...
Nach dem Erfolg von »Nebelkinder« – der neue, zutiefst bewegende Roman von Stefanie Gregg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
»Was ist ein Glaskind? Ein gesundes Kind, das ein Geschwister mit besonderen Bedürfnissen hat, das ständige Aufmerksamkeit und Pflege braucht. Das Kind daneben wird nicht gesehen, es ist durchsichtig. Wie Glas.« Alicia Maples
Maya lebt endlich ihr eigenes Leben. In ihrer Kindheit gab es nur den kleinen Tobi, um den sie sich kümmern musste. Tobias ist ein Mensch mit genialen Fähigkeiten, aber als Autist ist er nicht fähig, ein eigenes Leben zu führen. Als ihre Mutter einen Unfall hat, soll Maya sich wieder um ihren Bruder kümmern. Vom Hamburg reist sie zurück in ihre Heimat München, doch bald begreift sie, dass sie eines nicht darf, in eine alte Rolle zurückfallen: wieder ein Glaskind werden, das sich für andere aufopfert, aber dessen Bedürfnisse selbst nicht gesehen werden.
Über Stefanie Gregg
Stefanie Gregg, geboren 1970 in Erlangen, studierte Philosophie, Kunstgeschichte, Germanistik und Theaterwissenschaften, worin sie auch promovierte. Nach Stationen in Medienunternehmen und als Unternehmensberaterin widmet sich die Autorin dem Schreiben. Mit ihrer Familie wohnt sie in der Nähe von München.
Im Aufbau Taschenbuch sind ihre Romane »Mein schlimmster schöner Sommer«, »Der Sommer der blauen Nächte« sowie »Nebelkinder«, »Die Stunde der Nebelkinder« und »Die Hoffnung der Nebelkinder« erschienen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Stefanie Gregg
Das Glaskind
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Zitat
Kapitel 1
2024
1995
2024
1991
2024
1991
2024
1992
Kapitel 2
2024
1992
2024
1996
2024
1996
2024
1997
2024
1997
2024
1997
2024
1997
2024
1998
Kapitel 3
2024
1998
2024
1999
2024
1999
2024
1999
2024
1999
2024
1999
2024
2000
2024
2001
2024
2003
2024
2004
2024
2004
2024
2004
Kapitel 4
2024
2005
2010
2024
2015
2024
2020
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
Kapitel 5
2026
2029
GLASS CHILD
NACHWORT
DANKE
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für Antje, Carla und Caro und die MeerSchreibzeit.
Die Zeit mit euch hat dieses Buch geprägt.
Danke!
What the heck is a Glass Child?
A healthy kid that has a special needs sister or brother, who needs ongoing attention and care, above and beyond what we consider normal parenting.
I am a Glass Child.
Alicia Maples
Kapitel 1
Glas, Glas, Glas.
Es ist eines jener Worte, das verschwindet, wenn man es öfter ausspricht, das seine Bedeutung verliert bei jedem weiteren Versuch, es ins Leben zu holen.
Glas, Glas, Glas.
Durchsichtig. Wunderschön und doch nicht da. Unsichtbar.
Glas, Glas, Glas.
2024
»Nein.«
Maya spürte selbst die Kälte in diesem Wort, das doch in ihr brannte. Das Nein, das kein Wort in ihrem Wortschatz war. Das über ihre Lippen nie kam.
»Nein?« Auch Merlin schien dieses Wort, von ihr ausgesprochen, unangenehm. »Du kommst nicht? Und warum nicht? Es ist nicht irgendeine Kleinigkeit für mich. Es ist einer der größten Preise, die ein junger Physiker in Deutschland erhalten kann. Und du sagst einfach Nein? Ohne Begründung?«
»Es tut mir leid.«
»Aha. Gut. Dann eben nicht, Schwesterherz.« Die Ironie war nicht zu überhören, aber auch seine Traurigkeit.
Er beendete das Gespräch, ohne auf ihre Antwort zu warten.
Das kurze Telefonat hatte sie im Stehen geführt. Nun ließ sie sich langsam auf einen Stuhl gleiten und stützte ihre Arme auf das dunkle Holz des Tisches. Verwundert spürte sie, dass Tropfen auf ihre Hand fielen. Sie schienen ihre Haut zu verbrennen. Ein Gefühl, das sie von früher kannte. Tränen waren nicht kalt, sie waren schmerzhaft heiß.
Trotzig richtete sie sich auf, spürte nur kurz diesen Schmerz, den sie kannte, der in seltsamer Weise alte Sicherheit bot, und wischte dann die Tränen aus ihren Augen. Abrupt stand sie auf.
Sie würde doch noch einmal ins Krankenhaus fahren, wo dieser Sechshundert-Gramm-Winzling auf sie zu warten schien, der ihr nicht aus dem Kopf ging. Vorhin war er blau angelaufen. Sie hatte die Sauerstoffzufuhr hochgefahren. Aber schon die ganze Zeit hatte sie ein schlechtes Gefühl gehabt. Er hieß Liem. Jetzt erst fiel es ihr auf: War Liem nicht ein asiatischer Name? Ostasiatische Kinder neigten deutlich mehr zu Gelbsucht. Daran hätte sie vorhin schon denken müssen. Vielleicht war es doch eine aufkommende Gelbsucht, die man noch nicht an Haut und Augen sehen konnte? Dann müsste sie ihm mehr Flüssigkeit zuführen – und Licht.
Sie würde nun noch einmal zu ihm gehen und seine Bilirubin-Werte bestimmen.
Seit Maya seinen Eltern gesagt hatte, dass Liem wohl blind sei, waren sie nicht mehr gekommen. Seit vier Tagen, seit die Mutter die Klinik verlassen hatte. Maya fühlte Wut und Trauer darüber. Rot und Schwarz wallten in ihr auf. Ihre Gefühle waren zugleich Farben, auch wenn sie niemandem erklären könnte, warum.
Sie würde sich um Liem kümmern und die vielleicht aufkommende Gelbsucht verhindern. Später müsste sie das Jugendamt benachrichtigen. Doch wer würde schon ein blindes Kind nehmen? Es würde in die Ursprungsfamilie gebracht werden, dort mitlaufen, irgendwie, vielleicht zu Hause versteckt. Nein, das war nicht das Mittelalter. Es war der Alltag.
»Frau Dr. Borin …« Schwester Christine hatte ihr sanft die Hand auf den Arm gelegt. »… wollen Sie nicht auch mal nach Hause gehen?«
Nur nach und nach drangen die Worte zu Maya durch. Hatte sie geschlafen? Sie saß in dem fast bettartigen Liegestuhl mit den breiten Lehnen, der Mütter und ihre Babys festhielt, wenn sie einschliefen, wie so oft hier auf der Neonatologie. Auf jenem Stuhl, der manchmal auch wie ein Sarg auf sie wirkte.
»Sie müssen auch mal etwas essen.« Christines Ton klang fürsorglich und zugleich besorgt.
Maya wusste selbst, dass ihr das eben erst neu gekaufte Sommerkleid schon wieder um die Hüften schlackerte, sie sollte wirklich wieder regelmäßiger essen.
Bevor sie antwortete, sah sie auf den Überwachungsmonitor, der alle Vitalzeichen ständig aktualisierte, EKG, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Puls, Atemluft, Körpertemperatur.
Die Flüssigkeitszufuhr hatte sie erhöht, und auf sie beide strahlte nun eine blaue Lampe, die Liem fahler und nicht mehr ganz so gelb wirken ließ, was, wie Maya wusste, nur eine Täuschung des Lichts war.
»Danke, Christine. Ich bleibe noch ein bisschen.«
»Sie haben schon gestern Nacht hier bei Liem geschlafen.«
»Kein Problem. Ich war dazwischen zu Hause.« Ein Lächeln funkelte in ihren Augen. »Ich habe auch geduscht.«
Christine schüttelte nur den Kopf.
Kurz dachte Maya an Nicholas, der ihr sicher mittlerweile zahllose WhatsApp-Nachrichten geschrieben hatte, wie so oft. Er hatte mehr Worte als sie. Sorgen würde sich Nicholas allerdings nicht um sie machen, obwohl sie sich seit zwei Tagen und Nächten nicht gesehen hatten. Eher würde er verärgert sein, vorwurfsvoll, dass sie wieder im Krankenhaus schlief, obwohl ihre Schicht längst zu Ende war. Morgen Nacht würde sie daheim bleiben.
Liems Hand schloss sich fest um ihren Finger.
Sie wusste, dass sie auch blieb, um nicht an ihren Bruder zu denken, an ihren geliebten kleinen Bruder Merlin, der sie zu der Verleihung des Physikerpreises, den er bekommen sollte, eingeladen hatte. Der bittere Grund war ein einziger Satz: »Dann kannst du mir auch bei der Gartenparty danach helfen und vielleicht ein wenig mit Anne und Leo spielen.« Solche Sätze wirkten auf Maya wie Schwerter, die andere nicht sahen. Deswegen konnte sie dieses Gefühl auch niemandem vermitteln. Sie sollte sich darüber freuen, dass die Kinder gerne mit der geliebten Tante Maya spielten. Aber sie freute sich nicht. Wenn ihr Buder sie doch einfach nur eingeladen hätte, weil er sich wünschte, dass sie käme.
Wieder blickte sie auf den leise atmenden Liem, auf die winzige Brust, die sich im Ringen um das Leben hob und senkte. Vielleicht sollte sie doch zu Merlins Feier gehen? Was war nur in sie gefahren? »Nein« – welch dummes Wort. Kein Wunder, dass Merlin sich ärgerte. Morgen würde sie ihn anrufen.
Liem atmete einen etwas tieferen Zug Luft ein.
Nicholas hantierte am Herd der offenen Küche, während Maya an der Theke mit einem Glas Weißwein saß, der leicht vor sich hin perlte. Meistens hielten sie es so: Wenn sie bei Maya waren, kochte sie; waren sie bei Nicholas, kochte er. Zum einen, weil sie beide durchaus gerne kochten, zum anderen, weil sie, was sie nie ausdrücklich geäußert hatten, beide den anderen ungerne in ihrer Küche hantieren ließen.
Maya war diese Regelung angenehm. Es tat gut, wenn manches sicher war. Wenn Nicholas kochte, baute sich mehr und mehr ein Schlachtfeld in der Küche auf mit dreckigen Töpfen, Schneidbrettern, Besteck und anderen Kochutensilien, die er dann meist bis zum nächsten Tag stehen ließ. Geschirr-Monster, fand Maya, die danach riefen, abgewaschen und aufgeräumt zu werden. Sie hingegen säuberte alles bereits während des Kochens und räumte sofort die Spülmaschine ein. War das Essen fertig, war auch die Küche wieder sauber. Die Arbeit war erledigt, auch wenn sie sich manchmal dachte, dass sie dies nur täte, um sich der nächsten Arbeit widmen zu können.
Maya beobachtete Nicholas, der in seiner üblichen Art mit schnellen, sicheren Bewegungen die Zwiebel in absolut gleich große Ringe zerschnitt. Bei ihr wurden daraus immer unterschiedlich große Scheiben, die sie dann doch in der Mitte zerteilte, damit wenigstens hier die Gleichmäßigkeit gewahrt blieb. Er hingegen zerteilte die Zwiebel wie sein Leben, in klaren Schnitten, ohne darüber nachzudenken und ohne daran zu zweifeln. Deswegen hatte sie ihn immer geliebt, oder? – Der Lotse in der Brandung ihres Lebens.
Eine Erinnerung blitzte in ihr auf. Sie sah die Bilder ihres gemeinsamen Urlaubs in Tunesien, wo sie in einem Club-Hotel abgestiegen waren, was sie nicht schätzte, aber eben doch herrlich praktisch war. Keine Sorge um Einkaufen, Kochen, schon gar nicht um das Saubermachen. Nicht einmal ein Restaurant musste man sich suchen, alles inklusive.
Sie liebte das Meer, das Azurblau. Auch wenn sie keine gute Schwimmerin war, begab sie sich gerne in das Wasser, dorthin, wo es noch nicht so tief war, dass ihre Füße nicht mehr den Sand spüren konnten. Dann konnte auch sie im Wasser entspannen, mehr jedoch, wenn sie am Strand saß und auf das weiß gekräuselte Wogen der Wellen sah.
Mit dem Bild des tunesischen Strands kam auch die Erinnerung an jenen Abend, als Nicholas zu ihr gekommen war und Champagner und Gläser mitgebracht hatte, nicht die Kunststoffbecher, die hier eigentlich nur erlaubt waren. Sogar einen Smoking hatte er an und sah darin fast noch besser aus als sonst. Groß, schlank, dunkelhaarig. Genau zum Sonnenuntergang hatte er den Champagner mit einem lauten Plopp entkorkt, wobei ein wenig Schaum die Flasche hinunterlief. Sie bemerkte, dass sie selbst nur das ärmellose Sommerkleid angezogen hatte, als er sie vorgeschickt hatte. Sie mochte es, es war zitronengelb und fiel an der Hüfte eine wenig in Falten auseinander. Sie wusste, dass ihr das Kleid zu ihren langen, dunklen Locken gut stand. Im Gegensatz zu seinem Smoking allerdings war es nicht festlich genug. Doch ein Cocktailkleid hatte sie für den Cluburlaub nicht eingepackt. Sie musste in sich hineinlächeln, sie hätte auch keins gehabt. Im Krankenhaus genügte jedes beliebige Oberteil zur weißen Hose, und in der Freizeit war sie auch eher der Jeans- und Pulli-Typ. Kein Cocktailkleid also in ihrem Schrank, kein Ballkleid, das Sommerkleid war in gewisser Weise schon eines der exklusiveren bei ihr.
Er reichte ihr das gefüllte Glas und stieß mit ihr an. Nach dem ersten Schluck nahm er es ihr wieder ab und stellte beide Gläser auf das Tischchen neben ihnen. In diesem Moment wusste Maya, was nun kommen würde. Es war die perfekte Szenerie, die einzig mögliche Inszenierung, nur eine Frage konnte jetzt kommen. Sie machte einen Schritt nach vorne, vielleicht hatte sie vorher bereits in der Dämmerung den schwarzen Fleck im Sand wahrgenommen, allerdings wohl nicht, was es war.
Doch plötzlich schrie sie auf. Ein brennender Schmerz durchfuhr sie, als Nadeln in ihre Fußsohle schossen, ein Schmerz, der sich über alle Nervenbahnen bis in den Kopf ausbreitete. Ein gleißender magentaroter Schmerz, der sie in den Sand fallen ließ. Nicholas war an ihrer Seite, hob ihren Fuß und stellte nach kurzer Betrachtung fest: »Ein Seeigel.« Er nahm sie am Arm. »Komm, wir müssen die Stacheln herausziehen.« Er stützte sie, und der Weg zum Hotelzimmer wurde unangenehm lang, weil sie auf jeden Fall zu vermeiden versuchte, mit dem schmerzenden Fuß aufzutreten.
Im Zimmer legte sie sich auf das Bett, und er zog, vor ihr kniend, mit der Pinzette Stachel für Stachel aus ihrem Fuß. Ebenso exakt und genau, wie er Zwiebeln zerteilte.
Die Situation vom Strand war nach diesem Seeigel-Unfall vorbei, das wusste sie, zerstört, vielleicht unwiederbringlich. Sie sah in die Luft, in der keine Enttäuschung lag, vielmehr strömte eine Welle der Erleichterung von Nicholas zu ihr.
Er telefonierte mit der Rezeption und bat um Essig für die weitere Behandlung ihrer Wunden. Sein Handeln war ruhig und klug. Keine Hektik in seinen Worten, er tat das Richtige für sie.
Hätte sie damals nicht traurig sein müssen, dass er ihr keinen Antrag gemacht hatte?
Sie schnupperte in die Luft und wurde mit dem Geruch nach angebratenen Zwiebeln und Knoblauch aus ihrer Erinnerung ins Jetzt zurückgeholt. Nicholas gab den Reis in die Pfanne und rührte ihn bedächtig um. Nie hatte sie ein besseres Risotto gegessen als seines. Seine Handbewegungen, sein Rühren in der Pfanne drückten Ruhe und Sicherheit aus, die davon kündeten, dass er immer wusste, was zu tun war. Sie nahm einen Schluck vom Weißwein, ein zart perlender, trockener Grüner Veltliner. Nicholas hatte immer guten Wein. Sie spürte, wie sie sich langsam entspannte. Mit der Hand griff sie auf ihre entgegengesetzte Schulter. Hart wie Stein! Sie versuchte, sie ein wenig zu massieren.
Nicholas blickte auf. »Du arbeitest zu viel.«
Sie nahm einen weiteren Schluck. »Der Wein ist großartig.«
»Du arbeitest zu viel« – sein immer wiederkehrender Satz. Nicholas wusste nichts von der Schuld, die sie abtragen musste.
»Ja, es ist ein österreichischer Wein. Nicht einmal besonders teuer, aber ich finde ihn wirklich gut. Was hält dich denn diesmal wieder nächtelang in der Arbeit?«
»Es ist ein kleiner Junge, sechshundert Gramm schwer. Einfach zu klein. Er ist blind.«
Nicholas nickte. Er wusste, dass Netzhautschäden eine nicht seltene Begleitung von Frühgeburten waren. Obwohl er Ingenieur war und mit Medizin, bevor er Maya kennengelernt hatte, nicht viel anfangen konnte, hatte er sich oft genug ihre medizinischen Fälle erklären lassen.
»Dazu kam eine Gelbsucht. Aber die haben wir jetzt im Griff.«
»Na, das ist doch sehr gut.«
»Nicht ganz. Die Eltern wollen kein blindes Kind. Sie waren nach der Diagnose nicht mehr im Krankenhaus.«
Nun sah Nicholas auf. »Das kann ja wohl nicht wahr sein.«
»Doch, leider.«
Nicholas ging um die Theke herum und nahm Maya in den Arm. »Du bist stark, du schaffst das«, sagte er. Sie legte den Kopf an seine Brust und atmete tief ein. Das Ausatmen funktionierte weniger gut, die Luft blieb stecken. Doch Nicholas ging zurück zur Pfanne, während sie lautlos nach Luft rang. Sein Risotto musste permanent gerührt werden. Er nahm die Flasche von der Theke und goss den Reis mit dem Wein auf. Nun flossen die Gerüche von der angebratenen Zwiebel mit dem Traubenduft zusammen. Maya begann wieder gleichmäßig zu atmen. Einatmen, ausatmen.
»Ich habe so einen Hunger«, erklärte sie, in die Luft schnuppernd.
Nicholas lachte. »Das dauert mindestens noch eine halbe Stunde. Hol dir doch ein paar Cherrytomaten aus dem Kühlschrank.«
Maya stand müde auf und tat, was er gesagt hatte. Sie wusch die kleinen knackigen Tomaten und schob sich bereits über der Spüle eine in den Mund. Das Rot passte zu den Lilatönen, die sie aus der Pfanne herausströmen fühlte. »Ich glaube, ich habe seit dem Frühstück nichts mehr gegessen.« Ihr Handy gab einen Ton von sich. Sie setzte sich wieder an die Theke und sah die neu hereingekommene WhatsApp. Ihre Mutter. Maya, warum kommst du nicht zu Merlins Preisverleihung?
Sie öffnete die Nachricht nicht weiter, ihre Mutter sollte nicht sehen, dass sie sie gleich gelesen hatte. Sie schaltete das Handy aus und stellte es auf den Stummmodus. Ein Gefühl überschwemmte sie, das sie verwundert als das gleiche erkannte wie beim Telefonat mit Merlin. Zu Merlins Preisverleihung musste sie kommen, fand ihre Mutter. Unbedingt. Der kleine Sonnenschein der Familie, der immer seine Fröhlichkeit versprühte, war nun ein großer Physiker geworden.
Zu ihrer Promotionsfeier war keiner von der Familie erschienen; es war nicht einmal infrage gekommen. Maya hatte sie auch nicht direkt eingeladen. Sie wollte niemanden drängen, denn alle hatten genug zu tun, und ihre Mutter hätte sowieso nicht kommen können, sie musste doch bei Tobi bleiben.
»Gibst du mir bitte noch mal den Wein?«
Nicholas reichte ihn ihr. »Ich muss morgen sehr früh raus«, erklärte er.
»Ich gehe auch gleich nach Hause«, reagierte sie sofort auf die unterschwellig ausgesprochene Aufforderung.
Er sah sie zweifelnd an. »Vermutlich würde ich dich beim Ausschlafen stören«, schob er erklärend hinterher.
In ihrem eigenen Bett schlief sie doch immer etwas besser, sagte sie sich.
Meine Schwester ist groß-klein. Das macht mir Angst. Sie sieht Farben, überall. Manchmal erzählt sie mir davon.
1995
Drei Mädchen, die in einer Wiese saßen und sich gegenseitig Kränze aus Gänseblümchen geflochten hatten. Maya sah sich wie von außen.
»Häschen kommt zum Bäcker«, sagte Hannah soeben und konnte vor Kichern kaum weitererzählen. »Es fragt: ›Haddu fünfhundert Brötchen?‹ Der Bäcker ist verwundert, sagt nein. Am nächsten Morgen kommt Häschen wieder.« Lena fiel einfach mit ein, Häschen-Witze waren durchaus voraussehbar: »Haddu fünfhundert Brötchen?« Die beiden neuen Freundinnen, die aus anderen Schulen hier im Schullandheim waren, konnten sich nicht einfangen vor Lachen, bevor Hannah weitersprach. »Der Bäcker sagt nein. Am dritten Morgen kommt das Häschen wieder in die Bäckerei und fragt …« Hannah ließ eine kleine Kunstpause, in die sie nun alle drei gleichzeitig einfielen: »Haddu fünfhundert Brötchen?« Eigentlich war es völlig egal, wie der Witz ausging, er war jetzt schon so lustig.
»Der Bäcker freut sich und sagt: ›Ja, habe ich!‹«, fuhr Hannah dennoch fort. »Sagt das Häschen: ›Kann ich zwei haben, bitte?‹«
Lena und Hannah kreischten vor Vergnügen. Maya lachte auch, wenn auch ein wenig leiser. Denn sie musste doch gleichzeitig alles genau beobachten. Sie hatte zwei Freundinnen. Zwei richtig gute Freundinnen. Niemand, der sie hänselte.
Die beiden kannten sie ja auch nicht, sie kamen aus anderen Schulen. Aber vielleicht könnte man sich doch wieder treffen.
Zwei richtig gute Freundinnen.
Das Maul der Kuh war weich wie Wackelpudding, als Maya ihre Hand daran hielt. Die lange Zunge schleckte über ihre Finger. Es kitzelte. Wenn sie den dicken Hals streichelte, spürte sie die Wärme des Tieres. Und wenn ihr Gesicht sich der Kuh näherte, roch sie den Geruch nach Stall und Wiese, nach Erde und Stroh.
Hannah und Lena standen ein wenig hinter ihr. Sie wagten sich nicht an die riesige Kuh heran. »Kommt!«, forderte Maya sie auf. »Die ist ganz lieb.« Lena folgte als Erste der Aufforderung, stellte sich ein wenig hinter Maya, die damit den gefährlichen Kopf verdeckte, und strich vorsichtig über den Hals der Kuh. In dem Moment wandte die Kuh ihren Kopf um und stieß gegen Mayas, ganz sanft, aber sofort spürte sie Hände, die sie wegzogen. Hannah riss sie panisch nach hinten, Lena packte sie am Arm. Sie stolperten drei Schritte nach hinten und fielen dann gemeinsam um. Noch mehr als sie hatte sich offensichtlich die Kuh erschreckt, die das Weite suchte.
»Maya, bist du verrückt?«, rief Hannah ihr entgegen. »Die hätte dich fast umgebracht.«
Maya sah das zwar nicht so, aber die Sorge um sie fühlte sich schön an.
»Macht nichts«, sagte Lena, die immer noch halb auf ihr lag. »Wir passen auf dich auf.«
Es rauschte Maya in den Ohren. »Wir passen auf dich auf.« Es rauschte vor grasgrünem Glück.
Hannah rappelte sich wieder auf. »Ich glaube, wir müssen zurück in die Jugendherberge. Wenn wir zu spät zum Abendessen kommen, kriegen wir Krach mit Frau Maler.«
Das sah Maya ein. Ihre Grundschullehrerin wachte mit strengem Auge darüber, dass die Kinder in der freien Zeit beim Aufenthalt im Schullandheim nicht zu lange fortblieben. Dennoch gönnte sie ihnen das Stromern über den Bauernhof.
Aber eigentlich wäre Maya lieber hier liegen geblieben. »Wir passen auf dich auf.« Sie wollte die Zeit anhalten, genau hier. Sie wusste sicher, es war der schönste Augenblick ihres Lebens. Sie hatte zwei Freundinnen, die auf sie aufpassten.
»Wartet«, sagte Lena, setzte sich auf und packte die anderen beiden an den Händen. »Wir versprechen uns jetzt etwas. Wir bleiben immer Freundinnen. Wir drei.«
»Genau«, stimmte Hannah sofort ein. »Auf immer!«
Maya drückte die Hände der Freundinnen fest, die Hände der Freundinnen, die auf sie aufpassten. »Und wir erzählen uns alle unsere Geheimnisse.« Ja, sie würde so gerne ihr Geheimnis erzählen. Diesen Freundinnen konnte sie es erzählen.
»Wenn wir dann mal Freunde haben«, Lena nickte, »dann sagen wir es nur uns dreien.«
»Und wenn wir sie küssen!« Hannah kicherte verschwörerisch.
Maya meinte ein ganz anderes Geheimnis, aber sie nickte.
»Und wir bleiben immer Freundinnen. Auch wenn wir nicht mehr in die Schule gehen«, erklärte Lena.
»Immer«, sagte Maya ernst. Dann fiel ihr etwas ein. Etwas, das ihr sehr wichtig war. Wovon sie immer träumte. »Und dann reisen wir zusammen durch die ganze Welt.«
»Ja!« Hannah gluckste vor Begeisterung. »Nach Amerika!«
»Und nach Peru!« Das war Maya eingefallen, weil Paddington, der sprechende Bär, von dort kam. Obwohl sie nicht genau wusste, wo dieses frühlingsgrüne Peru lag. Sie selbst war nämlich noch nie verreist. Einmal nach Italien, als sie zwei Jahre alt war, doch daran konnte sie sich nicht mehr erinnern. Aber dass sie Reisen gar nicht kannte, musste sie ja noch nicht sagen. Das gehörte auch zum Geheimnis. Bald jedoch würde sie es ihren Freundinnen erzählen.
»Und nach Indien«, fügte Lena hinzu.
»Und China«, bestimmte Hannah.
Welche Länder die beiden kannten, stellte Maya ehrfurchtsvoll fest. Ob die beiden dort schon gewesen waren? »Und das Taka-Tuka-Land«, sagte sie.
Hannah und Lena nickten ihr zu. Das Taka-Tuka-Land schien ihnen beiden genauso real wie Peru und Indien.
Lena streckte ihre Hand aus. »Das schwören wir uns jetzt!« Maya und Hannah legten ihre Hände darauf.
»Wir werden für immer Freundinnen bleiben. Bis zu unserem Tod«, verkündete Lena mit einem bedeutungsvollen Schwur-Ton. »Und wir werden die Welt erobern. Wir reisen gemeinsam durch alle Länder dieser Erde. Wir werden Abenteurer. Und Forscher. Wir drei!«
Maya wusste es genau, dies war der schönste Tag ihres Lebens.
Glas, Glas, Glasglück …
Sie liefen den Weg zum Landschulheim Hand in Hand.
Doch vor der Tür stand bereits Frau Maler, mit durchgestrecktem Rücken und strengem Blick. Sie mussten zu spät sein. Es würde gleich ein Donnerwetter geben, das sie auch verdient hatten, fand Maya. Die Mädchen hielten sich nur um so fester an den Händen.
»Maya, ich muss mit dir reden«, sagte Frau Maler ernst.
»Wir sind aber alle schuld«, widersprach Hannah und trat einen beschützenden Schritt vor Maya.
»An was schuld?«, fragte Frau Maler.
»Dass wir zu spät sind«, erklärte Lena verwundert.
»Ach«, meinte Frau Maler nur und schob Maya seitwärts von den anderen fort. Als sie ein paar Schritte gegangen waren, sagte sie: »Maya, du musst nach Hause. Dein Vater hat angerufen.«
Maya blieb stehen, sie widersetzte sich der schiebenden Hand. Nein, bitte nicht! Ihr Kopf füllte sich mit schwarzgrünen Schlieren. Nicht nach Hause! Ich will hierbleiben. Für immer.
»Es tut mir leid, aber es muss wohl sein. Du wirst gleich abgeholt. Du musst packen.«
Natürlich musste es sein. Maya wusste, warum. Kurz sah sie sich nach Hannah und Lena um, die immer noch am selben Fleck standen und ihr nachblickten. Und ihre Freundinnen würden nicht auf sie aufpassen können.
Glas, Glas, Glasträne …
Erst zu Hause fiel ihr auf, dass sie die Adressen ihrer beiden neuen Freundinnen nicht kannte.
2024
»Maya?«
Es war die Stimme ihres Vaters. Jahre musste es her sein, dass Maya sie am Telefon gehört hatte. Von ihrer Mutter hatte sie nach der unbeantworteten SMS vor sieben Tagen nichts mehr gehört. Ob nun ihr Vater ihr sagen wollte, dass sie kommen solle? Hatte ihre Mutter ihn dazu verpflichtet? Oder Merlin? Eigentlich undenkbar.
Aber es gab keinen Zweifel daran. Es war seine Stimme.
»Deine Mutter …« Verdammt, sie hat einen Namen, sie heißt Doris, sie war deine Frau, schoss es Maya durch den Kopf. »… hatte einen Unfall, einen Autounfall«, beendete er den Satz.
Er machte eine Pause.
Ihr Vater rief sie an. Er wusste, dass Doris einen Unfall gehabt hatte. Maya nicht. Wie konnte das sein? Das Schlimmste ging ihr durch den Kopf.
»Ja?«
»Sie ist im Krankenhaus. Rechts der Isar.«
»Ja?« Sie hasste ihn schon wieder dafür, dass er nicht einfach, sachlich und schnell sagte, was geschehen war. Sogar vor den Worten drückte er sich.
»Sie ist nicht in Lebensgefahr.«
»Papa, kannst du mir bitte genauer erklären, was geschehen ist und wie es ihr geht?«
»Das Krankenhaus hat mich angerufen.«
Warum ihn?, fragte sie sich. Hatte Doris etwa seine Nummer genannt? Das war absurd.
»Sie hatten mich in irgendeiner Kartei. Weil deine Mutter doch früher schon einmal dort war.«
Aha.
»Zu Hause haben sie niemanden erreicht. Tobias ist vermutlich nicht ans Telefon gegangen.«
Natürlich nicht.
»Wie geht es ihr?« Maya hasste seine zögerliche, sich entziehende Art.
»Stabil, aber schlecht. Geprellte Rippen. Ihr unterer Rücken ist schwer in Mitleidenschaft gezogen. Derzeit kann sie nicht sitzen, geschweige denn laufen. Vor allem aber ist ihre Hüfte gebrochen. Und mit dem Kopf ist sie wohl an die Seitenscheibe geprallt und hat eine starke Gehirnerschütterung.«
»Lebensgefahr besteht nicht?« Maya spürte selbst, dass sie dies abfragte wie eine Ärztin bei der Erstvorstellung.
»Nein, wohl nicht.«
Diesmal war die Pause sehr lang.
Obwohl Maya sofort wusste, um was es ging.
Schließlich gab sie sich einen Ruck und fragte: »Weiß Tobi es schon?«
Sie glaubte, das Kopfschütteln ihres Vaters am Telefon zu spüren. Es dauerte, bis er wiederholte: »Er geht nicht ans Telefon.«
»Du bist zwei Stunden von ihm entfernt. Ich brauche acht Stunden von Hamburg nach München«, stellte Maya sachlich fest.
Wieder dieses lange Zögern. »Ich weiß nicht einmal, ob er mir die Tür öffnen würde«, erklärte ihr Vater.
»Du könntest es probieren.«
»Ich könnte es ihm nicht sagen.«
»Warum nicht?« Maya klang schon wieder eiskalt.
»Er würde es nicht verstehen. Und dann …«
»Und dann würdest du ausrasten und nicht wissen, was du tun sollst – außer zu gehen.«
»Maya, bitte.«
Maya, bitte. Bestand ihr ganzes Leben nicht aus »Maya, bitte«?
»Und jetzt?« Sie fragte es fast provokativ, denn die Antwort kannte sie längst.
»Bitte, fahr du zu ihm.«
Nein. Sie würde es nicht tun. Nein. Wie bereits einmal zu Merlin gesagt, dieses Nein, das so schwer über ihre Lippen kam. Sein Vater war in der Nähe. Er hatte ihm zu erklären, dass seine Mutter einen schweren Autounfall gehabt hatte.
Nein. Sie würde es nicht tun.
Maya trank von dem Gin Tonic, den sie sich eingegossen hatte. Nicholas war noch nicht da. Es war siebzehn Uhr. Ihre Schicht war zu Ende, diese Schicht, auch wenn sie nahezu sechzig Stunden im Krankenhaus gewesen war.
Sie trank einen Schluck und spürte das Brennen in ihrer Kehle. Nein. Noch mal nein. Das Wort würde brennen. Und guttun. Wie der Gin.
Was tat Tobi wohl gerade?
Sie wusste es nicht. Man wusste es nie. Tobi war wohl in seinem Zimmer. Zu lange schon war Maya nicht mehr dort gewesen, aber sie konnte es sich vorstellen. Normalerweise war er um diese Uhrzeit in seinem Zimmer und arbeitete, später dann würde Mutter ihn zum Abendessen rufen, und er würde kommen. Dann sah Doris meist fern. Manchmal saß er danach mit ihr auf dem Sofa, oder er ging wieder in sein Zimmer.
Gestern hatten die beiden dies jedoch nicht getan und auch heute nicht. Das war problematisch für Tobi, nein, viel schlimmer, es war eine Katastrophe.
Maya nahm einen Schluck vom Gin, setzte das Glas ab, nahm es noch einmal und trank es zur Hälfte aus.
Oder es würde ganz anders werden.
Bilder stiegen in ihr hoch.
Selbst der nächste Schluck Gin konnte es nicht verhindern.
Das Schlagen eines Kopfes gegen Wände. Das Schreien. Wut und Angst und Wahn.
Panik, die nur sie dämpfen konnte. Indem sie ihn nahm, festhielt, auch die schlagenden Hände, selbst wenn sie sie trafen, selbst wenn sie ihr wehtaten. Die Hände haltend, den Schlägen ausweichend, bis der Wahnsinn sich auflöste in schweißtriefendes Aufgeben, in Fallenlassen, Fallenlassen in Geborgenheit, die aufnimmt und erträgt.
Maya stand auf. Ihre Füße bewegten sich zur Kaffeemaschine, sie schaltete sie an. Ein röhrender Ton zeigte an, dass die Maschine sich in Bereitschaft setzte. Sie holte eine Tasse und drückte auf den »Doppelten Espresso«. Wieder ein Röhren, das Mahlen der Bohnen, eine schwarze Flüssigkeit, die sich mit unglaublichem Aroma in die Tasse ergoss. Maya trank sie in einem Zug aus.
Fünf Minuten, der Koffer gepackt, die Gedanken geklärt, das Krankenhaus musste sie nicht benachrichtigen, da sie die nächsten zwei Tage sowieso frei hatte, obwohl alle sich trotzdem wundern würden, dass sie nicht kam. Ob sich Liem auch wundern würde? Ob er sie vermissen würde, ohne Worte dafür zu haben?
An Nicholas schrieb sie nur eine kurze Notiz, obwohl sie wusste, dass ihm die wenigen Worte nicht wirklich ihren fluchtartigen Aufbruch erklären würden.
Maya setzte sich ins Auto und fuhr acht Stunden, nur mit einem kurzen Tankstopp mit zwei doppelten Espressi, von Hamburg nach München.
Die Schuld abzutragen.
Meine Schwester kann ein Schiff besteigen. Aber auch in die Wellen fallen.
1991
Sie war die Königin der Meere. Die Piratenkönigin. Fest hielt sie das Steuerrad in der Hand, beobachtete das weite Meer und lenkte das Schiff ruhig und sicher.
Bis sie unerwartet mit einem harten Stoß beiseitegeschoben wurde, der sie stolpern ließ. Gerade noch konnte sie sich auf den Beinen halten und sah, dass Marlies, ein Mädchen aus der Klasse über ihr, das Steuer übernommen hatte. »Was soll das?«, fragte Maya empört das einen halben Kopf größere Mädchen.
»Jetzt bin ich dran«, meinte Marlies und wandte sich ab, nach vorne ins vermeintliche Meer sehend, das doch nur ein Spielplatz mit einer großen Sandfläche war.
»Ich möchte aber auch steuern.«
»Ich bin dran.«
»Du warst vor mir schon ganz lange hier, jetzt bin ich dran«, beharrte Maya, obwohl sie das Schwanken in ihrer Stimme spürte. Aber es war ihr so wichtig, sie wollte weiter über das Meer gleiten. Da spürte sie einen großen Arm um ihren Hals, der sie in den Schwitzkasten nahm und nach unten drückte. Sie sah zwei lange Hosenbeine und spürte die Luft knapp werden. Panisch ruderten ihre Arme hin und her.
»Wenn meine Schwester hier spielen will, tut sie das, wann immer sie will. Ist das klar?«
Der Druck auf ihren Hals wurde noch stärker. Maya röchelte. Dann ließ der große Junge sie los und stieß sie auf den Boden. Langsam strömte wieder Luft in ihre Lungen. Der Junge hatte sich hinter seine Schwester gestellt und sah Maya nicht einmal mehr an. Mühsam rappelte sie sich auf und stieg auf der hölzernen Leiter das Spielschiff hinunter. Ihre Kehle brannte. Sie lief noch ein Stück weiter und ließ sich auf der Parkbank nieder, wo sie ein wenig abseits saß, verdeckt von Büschen. Oben auf dem Schiff stand das Geschwisterpaar und rief laute Kommandos zu ihren imaginierten Matrosen. Langsam bekam Maya wieder genügend Luft.
Plötzlich sah sie, dass Tränen auf ihre Hand tropften. Trotzig wischte sie sie fort und richtete sich auf. Sie würde nach Hause gehen. Dort war ihre Mutter, und die hatte einen sehr dicken Bauch. Bald würde ihr Geschwisterchen da sein, ein Junge. Ein warmes Gefühl breitete sich in Maya aus. Dann wären sie zu zweit. Und wenn jemals jemand ihren kleinen Bruder wegschubsen würde, dann würde sie kommen und ihm helfen. Als große Schwester. In den Schwitzkasten würde sie trotzdem niemanden nehmen.
2024
Maya klingelte, obwohl sie wusste, dass er nicht öffnen würde. Dann klopfte sie und rief durch die geschlossene Tür: »Tobi, ich bin es, Maya.« Danach erst holte sie den Schlüssel heraus, öffnete langsam die Tür und wiederholte: »Tobi, ich bin da. Maya. Ich bin es.« Sie wollte ihn nicht erschrecken. Er sollte sicher sein, dass sie es war, die hereinkam.
Als sie die Tür öffnete, sah sie ihn sofort im Flur sitzen, sich vor- und zurückwiegend. Er blutete an der Stirn. Er musste seinen Kopf gegen die Wand gestoßen haben. Langsam ging sie auf ihn zu und murmelte beruhigende Worte. »Ich bin da, Tobi. Alles ist gut. Ich bin da.« Sie kniete sich nieder und nahm ihn in die Arme. Er wiegte weiterhin vor und zurück.
»Mama«, sagte er dann. Es war zugleich ein Ausruf und eine Frage. »Nicht da.«
»Ich weiß, Tobi.« Maya hielt ihn noch ein wenig fester, und sein Wiegen wurde weniger heftig.
»Nacht nicht da. Sterne und Sonne.«
Er war zurückgefallen in sein uraltes Muster, keine vollständigen Sätze mehr sagen zu können. Dabei hatte er das doch längst überwunden. Er musste fast wahnsinnig geworden sein in dieser ungewissen Zeit ohne Doris.
»Ich weiß, Tobi. Wir waschen jetzt erst dein Gesicht, dann erkläre ich dir alles. Alles ist gut, Tobi. Ich bin da.«
»Du bist da«, wiederholte er. »Sterne und Sonne.«
»Ich weiß, Tobi, zwei Tage waren es, zweimal Sonne und einmal Sterne.«
Zum ersten Mal spürte sie eine winzige Erleichterung bei ihm, dass sie ihn verstand.