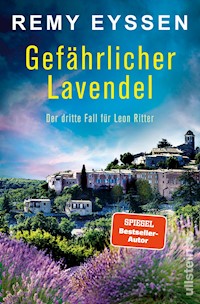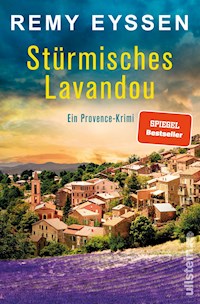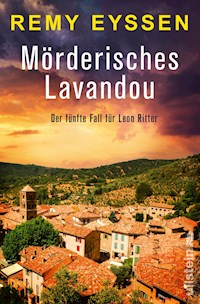8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die gefährlichen Geheimnisse der Insel Porquerolles – der vierte Fall für Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu Beginn der Sommersaison wird ein vermeintlicher Kindermörder aus dem Gefängnis entlassen. Das Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ganz Le Lavandou steht Kopf. In dieser aufgeladenen Atmosphäre wird ein Toter am Strand gefunden. Der Mörder scheint klar zu sein, aber Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter glaubt nicht an die einfache Variante. Seine Nachforschungen führen ihn auf die idyllische Insel Porquerolles. Tiefer und tiefer gräbt er sich in die Geschichte der Inselbewohner, aber seine Nachforschungen gefallen nicht allen. Denn alles deutet daraufhin, dass der Täter von damals dabei ist, weitere Verbrechen zu begehen. Doch niemand will ihm glauben...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Der Autor
Remy Eyssen (Jahrgang 1955), geboren in Frankfurt am Main, arbeitete zunächst als Redakteur bei der Münchner Abendzeitung, später als freier Autor für Tageszeitungen und Magazine. Anfang der 90er Jahre entstanden die ersten Drehbücher. Bis heute folgten zahlreiche TV-Serien und Filme für alle großen deutschen Fernsehsender im Genre Krimi und Thriller. Von Remy Eyssen sind bei Ullstein bereits erschienen: Tödlicher Lavendel, Schwarzer Lavendel und Gefährlicher Lavendel
Das Buch
Die gefährlichen Geheimnisse der Insel Porquerolles – der vierte Fall für Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter
Zu Beginn der Sommersaison wird ein vermeintlicher Kindermörder aus dem Gefängnis entlassen. Das Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ganz Le Lavandou steht Kopf. In dieser aufgeladenen Atmosphäre wird ein Toter am Strand gefunden. Der Mörder scheint klar zu sein, aber Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter glaubt nicht an die einfache Variante. Seine Nachforschungen führen ihn auf die idyllische Insel Porquerolles. Tiefer und tiefer gräbt er sich in die Geschichte der Inselbewohner, aber seine Nachforschungen gefallen nicht allen. Denn alles deutet daraufhin, dass der Täter von damals dabei ist, weitere Verbrechen zu begehen. Doch niemand will ihm glauben...
Remy Eyssen
Das Grab unter Zedern
Leon Ritters vierter Fall
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch 1. Auflage Mai 2018© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018Umschlaggestaltung: zero-media.net, München Titelabbildung: © Huber Images (Landschaft mit Abtei); © Getty Images (Bäume) E-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-8437-1728-1
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Prolog
Der kleine Junge erwachte aus einem tiefen Schlaf. Er hatte von einem Gewitter geträumt. Von Blitz und Donner. Ganz nahe hatte es eingeschlagen. Und wo er und seine Schwester auch hinliefen, überall zuckten die schrecklichen Blitze. Jetzt saß der Junge schwer atmend im Bett und starrte verwirrt in das Halbdunkel seines Kinderzimmers. Durch das Fenster schien der Mond vom wolkenlosen Nachthimmel und schickte unheimliches Licht auf die Ninja-Figuren, die im Regal neben den Büchern aufgereiht standen.
Es war totenstill im Haus. Doch in diesem Augenblick flammte wieder ein Blitz auf. Gleichzeitig krachte laut und schneidend scharf der Donner. Durch die offene Schlafzimmertür konnte der Junge für einen Augenblick den Flur sehen. War das noch immer ein Traum? Er sah sich vorsichtig um. Auf dem Nachttisch lag die kleine Tablette, die ihm sein Vater beim Zu-Bett-Gehen gegeben hatte. »Vitamine für die Kinder«, hatte er gesagt, wegen der Grippewelle. Seine Eltern gaben ihm und seiner Schwester Claudine sonst nie Tabletten. Er mochte keine Tabletten. Er hatte die Tablette nur kurz in den Mund gesteckt und sie dann heimlich wieder ausgespuckt. Sie schmeckte scheußlich, trocken und bitter.
Jetzt war es wieder ganz still im Haus. Hatten die anderen den Donner denn nicht gehört? Warum sah keiner nach ihm? Warum kam seine Mutter nicht? Dachte sie, er würde noch schlafen? Oder war sie erst zu seiner Schwester gelaufen?
»Maman …?«, rief der Junge leise. Keine Antwort. Es musste spät in der Nacht sein. Vielleicht sogar schon Mitternacht, Geisterstunde. Der Junge zog die Decke bis zum Kinn. Er hatte keine Uhr. Aber er konnte schon die Zeit lesen. Na ja, nicht so richtig. Aber Mittag war es, wenn der große und der kleine Zeiger der Küchenuhr ganz oben übereinanderstanden. Und an Silvester war es um Mitternacht mit den Zeigern genauso gewesen. Das hatte er selber gesehen.
Wo waren seine Schwester und Papa? Vielleicht stand ja das Haus in Flammen. So wie in dem Buch über die Feuerwehr, das er zu Weihnachten bekommen hatte. Da waren die Männer mit ihrem roten Leiterwagen gekommen, weil der Blitz in ein Haus eingeschlagen hatte. Und die Flammen hatten geknistert, und die Feuerwehr hatte mit dem Schlauch Wasser in das Haus gespritzt. So lange, bis die Flammen aus waren. Aber hier gab es keine Flammen, und es knisterte auch nichts. In diesem Moment glaubte der Junge, ein leises Schluchzen zu hören. Es kam von unten und es klang sehr traurig. So hatte sich seine Mutter angehört an dem Abend, als sie den schlimmen Streit mit Papa gehabt hatte. Wegen dem neuen Haus und weil alles so viel Geld kostete. Da hatten seine Schwester und er ganz oben auf der Treppe gesessen und sich eng aneinandergekuschelt und gelauscht. »Vielleicht geht Papa fort«, hatte Claudine gesagt.
»So ein Quatsch«, hatte er geantwortet. Aber Claudine hatte eine Freundin in der Schule, und da war der Papa auch fortgegangen. Einfach so.
Der Junge stand leise auf, lief barfuß zur Zimmertür und lauschte in den Flur. Er machte das Licht nicht an. Seine Mutter würde schimpfen, wenn er so durch das Haus schleichen würde, wo er doch eigentlich schlafen sollte. Seine Mutterkonnte streng sein in diesen Dingen. Aber wenn es dunkel war und niemand ihn sehen konnte, fühlte er sich sicher. Der Junge kannte jeden Winkel, jedes lose Dielenbrett und jedes Möbelstück im Haus. »Du bewegst dich wie eine Fledermaus«, hatte Maman einmal zu ihm gesagt.
Der Junge stieg langsam die Treppe hinunter. Seine Augen hatten sich inzwischen an die Dunkelheit gewöhnt. Er erkannte den Kleiderständer im Flur und die große Vase, in die seine Mutter Schilfrohre gesteckt hatte, deren Blüten sich wie zarte Federn anfühlten, wenn man mit den Fingerspitzen darüberstrich. In diesem Moment hörte der Junge wieder das Schluchzen. Vorsichtig schob er sich Richtung Küchentür. Da sah er seinen Vater. Er saß zusammengesunken auf einem Stuhl, hielt etwas in der rechten Hand und starrte auf den Küchenboden. Der Junge musste sich recken, bis er sehen konnte, was sein Vater da betrachtete. Auf dem Boden lag eine Frau und starrte mit leerem Blick an die Decke. In ihrer Stirn war ein rotes Loch, und um ihren Kopf herum hatte sich eine große Pfütze gebildet, die im Mondlicht schwärzlich glänzte. Der Junge fing plötzlich an zu zittern, ohne etwas dagegen tun zu können. Er starrte auf die blonden Haare. Das war Maman. Und sein Vater hielt seine Pistole in der Hand und weinte.
Der Junge wollte schreien und trampeln, nur um dieses Bild loszuwerden. Er war erst fünf Jahre alt, und er wusste, dass Eltern gelegentlich Dinge taten, die man nicht verstand. Aber was er hier sah, war nicht richtig. Er musste es Claudine sagen, jetzt sofort. Seine Schwester war schon sieben Jahre alt und kannte sich aus. Seine Schwester hätte eine Erklärung für das, was er da sah, und danach wäre alles wieder so, wie es zuvor gewesen war.
Der Junge hastete die Treppe zu ihrem Zimmer hinauf. Er achtete nicht auf seine Schritte, und die Stufen knarrten laut. Aber das war ihm egal. Er rannte den Flur entlang zum Zimmer seiner Schwester. Ihre Tür stand offen.
»Claudine …?«, sagte er leise.
Das Mädchen lag auf dem Bett. Der Junge konnte ihre blonden Haare sehen. Er kam näher und bemerkte dunkle Flecken an der Wand. Claudine lag davor, mit dem Gesicht auf dem Kissen, und rührte sich nicht.
»Claudine …!« Diesmal sagte er es lauter, flehentlich. Er knipste die Nachttischlampe an, die die Form eines Pinguins hatte. Jetzt sah er, dass das an der Wand Blut war. Auch auf dem Kissen und an Claudines Kopf war Blut. Überall war Blut.
»Claudine …« Das war kein Flehen mehr, sondern Fassungslosigkeit angesichts des Unbegreiflichen. In diesem Augenblick hörte der Junge Schritte. Laute Schritte. Sie waren schon ganz nahe. Dann stand sein Vater im Zimmer und hielt den Revolver in der Hand.
»Papa …!?«, sagte der Junge und sah seinen Vater an. Der schüttelte nur traurig den Kopf. Dann sah der Junge den grellen Blitz, der aus dem Revolver schoss, zusammen mit einem grässlich lauten Donnerschlag. Im nächsten Moment spürte der Junge ein Brennen im Bauch. Etwas hatte ihn zu Boden gerissen. Er sah seinen Vater näher kommen, die Waffe heben und wieder auf ihn zielen. Aber der Revolver machte nur Klick als der Hammer die Trommel mit der leeren Patronenhülse traf. Und dann noch einmal Klick. Sein Vater lief aus dem Zimmer, und der Junge hörte, wie er die Treppe hinunterpolterte.
Plötzlich war dem Jungen eiskalt. Er fasste sich an den Bauch. Dorthin, wo er das Brennen spürte. Es fühlte sich nass an. Nass und klebrig, und es roch nach rostigem Metall. Es war Blut, sein Blut. Tränen stiegen dem Jungen in die Augen. Warum hatte sein Vater ihm wehgetan? Was passierte hier? Warum konnte es nicht wieder so sein wie vorher?
Der Junge hörte von unten ein Poltern, irgendetwas stürzte um. Er wusste, dass er hier wegmusste. Er versuchte aufzustehen und wegzurennen, aber er konnte nicht mehr laufen. Da begann er auf allen vieren zu kriechen. Er musste sich verstecken, schnell. Am Treppenabsatz stand die alte Kommode. Er zwängte sich darunter und schob sich nach vorn. Gerade so weit, dass er nach unten über die Diele und in die Küche sehen konnte.
Dort stand sein Vater. Jetzt hielt er die Flinte in der Hand, mit der er im Herbst auf Kaninchenjagd ging. Der Vater setzte sich auf den Küchenstuhl und starrte auf seine Frau am Boden.
»Es tut mir leid«, murmelte er. »Es tut mir so unendlich leid.«
Dann stellte er mit einem Ruck die Flinte mit dem Schaft auf die hellen Fliesen, beugte sich nach vorn und schob die Gewehrmündung unter sein Kinn. Mit der freien Hand griff er nach unten zum Abzug, und dann tat es einen fürchterlichen Knall. Der Junge sah, wie sein Vater vom Stuhl rutschte und das Gewehr polternd auf dem Küchenboden aufschlug. Dann wurde ihm schwarz vor Augen.
1. Kapitel
Der Sturm hatte die ganze Nacht getobt und Treibholz und bunten Plastikmüll auf den Strand geworfen. Der Levant kam aus dem Osten übers offene Meer und schob warmes Oberflächenwasser gegen die Küste. Das hatte zwar den Vorteil, dass die Wassertemperatur über Nacht um bis zu sieben Grad steigen konnte, aber mit dem warmen Sturmwind landete auch der Müll des Meeres in der sonst so gepflegten Vorzeigebucht von Le Lavandou.
Leon machte einen vorsichtigen Schritt über angespülte Bretter und Äste, die Meer und Sand so glatt poliert hatten, dass sie aussahen wie alte Knochen. Er blieb stehen, ließ die nächste Welle um seine nackten Füße spülen und spürte, wie unter seinen Fußsohlen der Sand nachgab, als sich die Welle wieder ins Meer zurückzog. Es war erst halb acht Uhr morgens und die Mitarbeiter des Fremdenverkehrsamtes würden alle Hände voll zu tun haben, um den Strand wieder aufzuräumen. Nächste Woche war bereits der 1. Juli und damit Beginn der Hochsaison. Da erwarteten die Touristen, dass alles genau so aussah wie in den Urlaubsprospekten.
Leon atmete tief ein und genoss die Luft, die nach feuchtem Holz und nach Salz roch. Der Himmel, der gestern noch wolkenverhangen und stürmisch grau gewesen war, strahlte jetzt im wolkenlosen Hellblau der Provence. Der Wind schien die Luft geputzt zu haben, denn der Blick war so klar, dass Leon glaubte, einzelne Bäume auf den Îles d’Or, den goldenen Inseln, zu erkennen, die draußen im Meer im strahlenden Licht der Morgensonne schwammen. Aber das war natürlich unmöglich, denn die Inseln waren knapp 18 Kilometer von der Küste entfernt.
Das Meer war jetzt ruhig wie ein Bergsee, und kleine Wellen schwappten friedlich an den Strand. Nur das Treibholz und der Müll erinnerten daran, dass noch vor wenigen Stunden draußen im Meer die Elemente getobt hatten. Leon blinzelte in die warme Sonne und genoss den ruhigen Morgen. Genau diese Momente waren es, die das Leben hier so einzigartig machten. Deswegen hatte er es auch nie bereut, seinen Job an der Uniklinik in Frankfurt aufgegeben und stattdessen die Leitung der Rechtsmedizin an einer Provinzklinik in der Provence übernommen zu haben. Obwohl ihn seine Kollegen gewarnt hatten. Er dürfe doch seine Karriere nicht so leichtfertig aufs Spiel setzen.
Die hatten alle keine Ahnung, dachte Leon. Das war damals keine leichtfertige Entscheidung gewesen. Sicher, es war ein großer Schritt, aber der Umzug nach Le Lavandou bedeutete auch die Rettung seiner Seele. Er suchte damals nicht nur einen neuen Job, er suchte vor allem einen Platz, um zu vergessen.
»Ja, ja, ich weiß: Das Meer ist großartig.« Lilou war stehen geblieben und riss Leon aus seinen Gedanken. »Und ich habe keine Ahnung, wie gut ich es habe, dass ich hier leben darf, stimmt’s?«
»Rede ich wirklich so?«, Leon lächelte das 15‑jährige Mädchen an, das eine abgeschnittene Jeans und ein T‑Shirt mit dem Aufdruck »Save the Whales« trug. Er selber hatte keine Kinder, aber wenn er sich je eine Tochter gewünscht hätte, dann hätte sie genau wie Lilou sein müssen.
»Du solltest dich mal hören, zumindest manchmal«, Lilou sah ihn herausfordernd an. In der Hand hielt sie ein Baguette, das aus einer Papiertüte ragte.
»Es ist ein beruhigendes Gefühl, so auf das Meer hinauszusehen.« Leon schaute hinüber zu den Inseln. »Solltest du auch mal versuchen.«
»Laaaangweilig!«, Lilou tat genervt. »Es ist das gleiche Meer wie gestern und wie vorgestern und all die anderen Tage. Hier ändert sich doch nie was.«
»Stell dir vor, dass genau an dieser Stelle schon vor tausend Jahren Menschen standen und auch aufs Meer gesehen haben. Genauso wie wir.«
»Genauso hungrig wie wir, meinst du«, sie brach sich ein kleines Stück vom Brot ab und schob es sich in den Mund. »Lass uns heimgehen, frühstücken.«
»Wir laufen noch ein Stück«, sagte Leon und zeigte zum Ende der Bucht, wo die Klippen den weit geschwungenen Strand von Lavandou begrenzten. »Bis zu den Felsen.«
Eine Weile stapften die beiden stumm durch den Sand, der sich allmählich in der Junisonne erwärmte.
»Was ist, wenn er sie doch umgebracht hat?«, fragte Lilou unvermittelt.
»Was …?«, Leon blieb stehen.
»Na, Amélie«, sagte Lilou. »Kann doch sein, dass die Richter sich geirrt haben. Im ersten Prozess haben sie ihn schließlich verurteilt.«
»Aber diesmal wurde Monsieur Simon vom Berufungsgericht in Toulon freigesprochen.«
»Aber nur, weil sie keine Beweise gegen ihn haben«, sie sah Leon an. »Das bedeutet doch nicht, dass er es nicht war, oder?«
»Sagt wer …?«, fragte Leon.
»Das sagen alle … in der Schule.«
»Es ist sehr schwierig, das Oberste Gericht davon zu überzeugen, ein Urteil aufzuheben. Besonders wenn es um Mord geht. Da muss der Anwalt schon mit sehr überzeugenden Argumenten angetreten sein.«
»Und wenn dieser Simon es trotzdem war?«
»Hast du schon mal was von Unschuldsvermutung gehört?«
Lilou schien einen Moment nachzudenken und zeichnete mit ihrem nackten Zeh eine Linie in den feuchten Sand.
»Der Vater von Ingrid hat gesagt, dass er Monsieur Simon alles zutraut. Der hätte seine Tochter immer verprügelt.«
»Woher will er das denn wissen?«
»Er hat gesagt, dass die anständigen Bürger von Lavandou so einen Verbrecher hier nicht mehr haben wollen.«
»Und was sagst du?«
»Weiß nicht. Eigentlich war Amélies Papa ganz okay. Ich meine, als Biolehrer in der Schule und so. Aber wenn ich daran denke, was passiert ist …?«
»Das Urteil gegen Monsieur Simon wurde aufgehoben und damit ist er ein freier Bürger. Genauso wie der Vater von Ingrid oder ich oder alle anderen.«
Lilou schien den letzten Satz von Leon gar nicht mehr gehört zu haben. »Da vorne liegt ein Boot.« Sie deutete auf die Felsen, wo jetzt auch Leon den weißen Rumpf und das hellblaue Ruderhaus eines kleinen offenen Fischerbootes erkennen konnte.
»Wie kommt das denn dahin?« Lilou lief zu den Felsen und Leon folgte ihr.
Wellen und Wind hatten dem Boot übel zugesetzt. Der Rumpf war knapp fünf Meter lang. An Deck gab es außer dem engen Steuerhaus keine weiteren Aufbauten. Jetzt steckte das Boot halb gekippt zwischen den Felsen, wohin es offensichtlich der Sturm geschleudert hatte. Der Bug war zersplittert, sodass man das zerfetzte Laminat des Rumpfes erkennen konnte. Im Ruderhaus lagen leere, zusammengedrückte Bierdosen. Der Außenbordmotor war zertrümmert. Das Steuerrad im Ruderhaus war mit einem Seil fixiert worden. Die Registriernummer am Schiffsrumpf begann mit den Buchstaben TU. Das bedeutete, dass das Boot jemandem aus der Gegend gehörte.
»Meinst du, da war jemand an Bord?« In Lilous Frage schwang Besorgnis, aber auch Neugierde auf eine Schauergeschichte mit.
»Glaube ich nicht«, erwiderte Leon. »Wahrscheinlich hat es sich von einer der Bojen in der Bucht losgerissen und ist dann vom Sturm hierhergetrieben worden.«
Lilou hatte bereits ihr Handy gezückt und begann zu fotografieren. »Ist ja voll gruselig.« Sie machte Bilder von allen Seiten.
»Fotografier auch die Registriernummer«, meinte Leon, »die geben wir deiner Mutter.«
»Echt? Denkst du, da ist jemand ertrunken?« Lilou legte den Kopf schief und betrachtete das Wrack. »Vielleicht hat der Skipper vergeblich gegen den Sturm gekämpft … zusammen mit seiner schönen jungen Frau und den süßen kleinen Kindern … schrecklich.«
Leon seufzte. »Du solltest wirklich weniger fernsehen. Komm, lass uns frühstücken gehen.«
2. Kapitel
Isabelle stand am Fenster ihres Büros und genoss ihren ersten Schluck aus dem Cappuccino-Becher, den sie sich gerade am Automaten der Polizeistation geholt hatte. Dies würde wahrscheinlich der einzige entspannte Augenblick des Tages sein und sie wollte ihn genießen. Der Blick auf den Hinterhof der Gendarmerie Nationale war alles andere als aufregend, und ihr Büro wirkte eher schlicht. An der Wand eine Karte der Region und auf dem Tisch zwei Fotos in Holzrahmen. Eines von ihrer Tochter Lilou und ein zweites, auf dem sie zusammen mit ihrer Tochter und Leon zu sehen war. Dieser Raum war vielleicht nicht besonders repräsentativ, aber Isabelle liebte ihn, es war ihr Büro. Auf dem Messingschild an der Tür stand ihr Name, Isabelle Morell, und darunter in Großbuchstaben »Stellvertretende Polizeichefin«. Und das war wirklich etwas Besonderes. Sie war die erste Frau, die es in der einhundertjährigen Geschichte des Ortes auf diese Position geschafft hatte.
In diesem Moment hielt ein Streifenwagen im Hof der Polizeistation. Der Beamte öffnete die hintere Tür und eine Frau schob sich von der Rückbank. Isabelle erkannte die Besucherin sofort. Sie wurde nicht zum ersten Mal auf die Wache gebracht. Und heute war Markttag.
Pilar war knapp 1,55 Meter groß und recht mollig um die Hüften. Das verlieh der energischen Frau die Form eines Brummkreisels, bei dem man ständig darauf wartete, dass er jeden Moment aus dem Gleichgewicht geraten müsste. Aber Pilar bewegte sich mit geradezu tänzerischer Anmut. Sie behauptete, 45 Jahre alt zu sein, aber jeder in der Gendarmerie wusste, dass sie mindestens 15 Jahre älter war. Mit den schwarzen Haaren, den blauen Augen und der dunklen Gesichtsfarbe, die ihre Fältchen verschwinden ließ, konnte sie durchaus als Endvierzigerin durchgehen. Pilar bezeichnete sich selber als »Zigeunerin« und gab als Geburtsort Sainte-Maries‑de-la-Mer an. Aber Isabelle wusste, dass sie aus einer Romafamilie in Rumänien stammte und der Vater Bürstenmacher in Bukarest war. In jedem Fall war Pilar eine anstrengende Person.
Isabelle packte schnell ihre Unterlagen zusammen. In wenigen Minuten sollte die Besprechung beginnen, bei der sie unbedingt dabei sein wollte. Sie schaltete ihr Telefon zur Zentrale um und griff nach ihrem Block, als es klopfte, die Tür aufging und ein nordafrikanisch aussehender Polizist hereinspähte.
»Was gibt’s, Moma?«, fragte Isabelle.
»Pilar«, sagte der Mann und schaute mit genervtem Augenaufschlag zur Decke. »Sie sagt, sie will nur mit dir reden.«
»Ich hab jetzt wirklich keine Zeit. Frag jemand von der Bereitschaft. Ich muss in die Konferenz.«
»Ich auch«, sagte Moma und sein Gesichtsausdruck sagte: Bitte, lass mich mit der Verrückten nicht alleine!
In diesem Moment drängte sich Pilar an Moma vorbei in das Büro. Als sie Isabelle sah, hob sie wie in tiefer Verzweiflung beide Arme und setzte einen tragischen Blick auf.
»Was habe ich getan? Mutter Gottes, was habe ich getan …?«
»Ich muss los«, unterbrach Isabelle die Frau, ohne das Theater zu beachten. Sie deutete auf Moma. »Reden Sie mit Lieutenant Kadir.«
»Lassen Sie mich nicht allein mit diesem Pharisäer, Madame Commandante«, rief Pilar, als stände die Apokalypse bevor.
»Ich bin nur Capitaine«, sagte Isabelle ungerührt.
»Sie hat mal wieder ihren Kram ohne Genehmigung auf dem Markt verkauft.«
»Warum Genehmigung? Brauche ich Genehmigung zum Atmen, brauche ich Genehmigung zum Leben? Sie müssen helfen!«
Isabelle sah, wie Moma unauffällig das Zimmer verließ.
»Ich habe jetzt eine Besprechung.«
»Ich habe ihn wieder gesehen!«
»Wen haben Sie gesehen?«
»Den weißen Riesen«, sagte Pilar mit in die Ferne gerichtetem Blick. »Auf der Insel. Den Erzengel Gabriel, mit seiner Fee.«
Isabelle sah Pilar in die Augen. »Ich verstehe. Und der Erzengel hat Ihnen gesagt, dass Sie heute auf den Markt gehen sollen, stimmt’s?«
Pilar nickte.
»Aber er hat Ihnen keine Genehmigung mitgegeben.« Diesmal schüttelte Pilar energisch den Kopf. »Und darum müssen Sie jetzt sechzig Euro Strafe zahlen. Da kann man leider nichts machen.«
Isabelle erwartete jetzt das große Klagelied, aber ihre Besucherin schien sich gar nicht für die Strafe zu interessieren. Sie zog ein schmutziges Marmeladenglas der Marke »Bonne Maman – Abricot« aus ihrer Tasche und drückte es Isabelle in die Hand.
»Das habe ich Ihnen mitgebracht«, sagte Pilar und sah sich verschwörerisch um, als müsste sie sich überzeugen, dass sie auch wirklich allein waren.
Isabelle betrachtete das verdreckte Behältnis, in dem sich scheinbar ein etwa drei Zentimeter langes Stück Holz befand, das sich an beiden Enden verdickte. »Was soll ich damit?«
»Das ist ein Knochen«, sagte Pilar und nach kurzer dramatischer Pause: »Menschenknochen …«
»Danke«, sagte Isabelle unbeeindruckt und stellte das Glas auf ihren Schreibtisch. »Ich gebe es später weiter. Jetzt bringe ich Sie zu den Kollegen, für die Genehmigungen.«
Wenige Minuten später lief Isabelle den Flur entlang und öffnete die Tür zum sogenannten Einsatzraum. Er war brechend voll und die Besprechung hatte bereits begonnen. Am großen Tisch quetschte sich Isabelle auf den letzten freien Platz.
»Schön, dass Sie auch noch bei uns vorbeischauen«, sagte Polizeichef Zerna, ein kleiner, drahtiger Mann, knapp 1,70 Meter groß, der mit den extrahohen Absätzen seiner Cowboystiefel versuchte, seinem Selbstwertgefühl ein paar verstärkende Zentimeter hinzuzufügen. »Entschuldigen Sie, Kommissarin Lapierre«, sagte Zerna zu der Frau, die neben ihm saß und das Abzeichen der Police Judiciaire, der Kriminalpolizei, trug.
Die Kommissarin räusperte sich und sah kurz auf ihren Notizblock, der akkurat an der Tischkante ausgerichtet vor ihr lag. Dabei wusste sie genau, was sie sagen wollte, und ihr war auch klar, dass sie sich damit keine Freunde machen würde.
»Also noch einmal, guten Morgen«, sagte die Kommissarin und warf einen tadelnden Blick auf Isabelle. »Wie Sie alle wissen, wurde Paul Simon vergangene Woche im Wiederaufnahmeverfahren am Berufungsgerichtshof von Toulon freigesprochen.«
»Schöne Schweinerei«, rief einer der Männer. Es gab Protestgemurmel, dabei wussten natürlich alle Anwesenden, wie das Gericht entschieden hatte, und die meisten waren mit dieser Entscheidung überhaupt nicht einverstanden.
»Ich bitte um Ruhe, ja?!«, ging Zerna dazwischen, und das Gemurmel verstummte.
»Können wir jetzt weitermachen?«, fragte Madame Lapierre spitz. »Also: Der Oberstaatsanwalt von Toulon hat gestern entschieden, dass die Ermittlungen im Mordfall Amélie Simon erneut aufgenommen werden.«
»Richtig so«, rief einer der jungen Beamten.
»Dann können wir den Kerl ja gleich wieder festnehmen!« Mit seiner Bemerkung löste Lieutenant Masclau zustimmendes Gelächter aus. Kommissarin Lapierre sah vorwurfsvoll zu Zerna, der neben ihr saß.
»Hören Sie bitte zu, was die Kommissarin zu sagen hat!« Zerna hob die Hände wie ein Dirigent, der seinem Orchester »Piano« gebietet, und die Zwischenrufe ebbten ab.
Madame Lapierre blätterte in ihren Unterlagen. Sie war genervt, wie immer, wenn sie von Toulon ›in die Provinz‹ fahren musste, wie sie und ihre Kollegen die Gendarmerie Nationale in Lavandou nannten. Normalerweise kümmerten sich die Beamten der Gendarmerie selber um die örtlichen Belange. Jedenfalls solange es sich um kleinere oder mittlere Vergehen wie Einbruch, Diebstahl oder auch mal eine Körperverletzung handelte. Ging es aber um Kapitalverbrechen wie Entführung oder Mord, musste die Leitung der Ermittlungen an die Kriminalpolizei von Toulon abgegeben werden. Eine Vorschrift, die Commandant Zerna überhaupt nicht gefiel. Er hasste es, wenn er und seine Mitarbeiter die Arbeit machen mussten und die Kommissare aus Toulon die Lorbeeren ernten durften.
»Da die Staatsanwaltschaft nach wie vor davon ausgeht, dass sich der Mord an Amélie Simon in diesem Arrondissement zugetragen hat, werden auch hier die Ermittlungen wieder aufgenommen werden.«
»Was soll das denn schon wieder heißen?«, unterbrach Masclau die Kommissarin.
Sie sah den Beamten mit strengem Blick an. »Das bedeutet, dass Sie Ihre Arbeit genau so tun werden, wie das Polizeiaufgabengesetz des Innenministeriums es vorsieht.«
»Nicht schon wieder …«, rief einer der Polizisten.
»Wir haben hier doch schon jeden Stein umgedreht«, beschwerte sich ein junger Colonel und erntete zustimmendes Gemurmel.
»Sage ich doch. Nehmen wir Simon gleich fest, und der Fall hat sich.« Das war wieder Masclau.
Diesmal sprach Madame Lapierre einfach weiter. »Dabei gilt Monsieur Simon ab sofort nur noch als Zeuge, wie jeder andere«, sagte die Kommissarin knapp.
»Wie bitte?!«, protestierte Masclau.
»Es sei denn, es tauchen neue Indizien gegen den Mann auf«, kam Zerna seinem Lieutenant zur Hilfe.
»Selbstverständlich, Commandant Zerna«, sagte die Kommissarin kühl.
»Und wie lange soll das Theater gehen?« Masclau stellte die Frage an Madame Lapierre, sah dabei aber seine Kollegen an.
»Bis Sie uns eine so dichte Beweislage vorlegen, dass der Staatsanwalt darauf eine neue Mordanklage begründen kann«, antwortete Madame Lapierre und fügte hinzu: »Gegen wen auch immer, Lieutenant.«
»Beim letzten Mal konnte es Staatsanwalt Orlandy gar nicht schnell genug gehen, Monsieur Simon vor Gericht zu stellen«, sagte Isabelle.
»Was wollen Sie damit andeuten?« Die Stimme der Kommissarin bekam einen schrillen Unterton.
Zerna freute sich über den Einwand seiner Stellvertreterin. Es war immer gut, wenn man diese eingebildeten Kommissare aus Toulon spüren ließ, wer bei den Ermittlungen die Hauptarbeit leistete.
»Wir hatten von Anfang an Zweifel angemeldet, ob die Beweislage ausreicht«, sprang er Isabelle bei. Er verehrte seine Stellvertreterin. Ganz besonders, seit sie sich vor fünf Jahren von ihrem Mann hatte scheiden lassen. Und er würde es niemals verstehen, warum sich Isabelle nicht für ihn, sondern für diesen Rechtsmediziner aus Deutschland entschieden hatte.
»Das zu entscheiden, liegt ja wohl ganz eindeutig außerhalb Ihrer Zuständigkeit.« Madame Lapierres Mund wurde so klein, als hätte sie in eine Zitrone gebissen. »Wollen wir diese Dinge doch lieber der Staatsanwaltschaft überlassen.«
»Ich habe gehört, dass es in Le Lavandou eine Menge Leute gibt, die mit dem Freispruch von Monsieur Simon gar nicht einverstanden sind«, meinte Isabelle.
»Was wollen Sie damit sagen?«, fragte Madame Lapierre.
»Es könnte Ärger geben.« Isabelle sah ihren Chef an. »Es wurde bereits zu einer Initiative gegen Simon aufgerufen.«
»Wundert dich das? Er hat schließlich eine Zehnjährige umgebracht!« Masclau war aufgebracht.
»Bitte, Didier«, meinte Isabelle vorwurfsvoll.
»Ist doch wahr: Vor fünf Jahren musste er in den Knast, und alle haben ›Bravo‹ gerufen.«
»Wir stecken mitten in der Sommersaison«, sagte Zerna. »Das Letzte was ich brauche, ist eine Mahnwache vor Simons Haus.«
»Wir sollten sein Haus und die Umgebung überwachen.« Isabelle sah ihren Chef an. »Zumindest bis sich die Lage beruhigt hat.«
»Guter Vorschlag«, lobte Zerna. »Lieutenant Masclau, das organisieren am besten Sie.«
»Ich spiele doch nicht das Kindermädchen für diesen …«, er verschluckte den Rest des Satzes, als ihn der strafende Blick seines Chefs traf.
»Merde, alors«, brummte Masclau und einige Kollegen kicherten.
»Ich erwarte von Ihnen bis heute Nachmittag Vorschläge, was das Vorgehen bei den Ermittlungen angeht.« Zerna sah die Kommissarin an. »Wir werden Ihnen Listen mit den zu befragenden Personen zukommen lassen.«
»Und was ist mit all den alten Spuren und Indizien?«, wollte Isabelle wissen.
»Die werden wir natürlich alle noch einmal neu bewerten. Also, an die Arbeit.« Zerna versuchte, ein freundliches Gesicht zu machen, aber Isabelle konnte sehen, wie schwer ihm das fiel. Die Beamten standen auf und drängten zur Tür.
»Na, großartig. Also noch mal so wie beim letzten Mal?«, fragte Masclau in Richtung der Kommissarin.
»Nein, besser als letztes Mal.« Madame Lapierre setzte einen abfälligen Blick auf. »Diesmal erwarte ich, dass Sie auch die Leiche finden.«
Masclau drehte sich um und verließ ohne ein weiteres Wort den Raum. Die Beamten gingen in ihre Büros. Zerna rief Isabelle noch einmal zurück. »Capitaine Morell, kennen wir inzwischen den Besitzer des Fischerbootes?«
»André Martin. 39 Jahre.« Isabelle war in der Tür stehen geblieben. »Arbeitet für France Telecom. Wohnhaft in Saint Clair.«
»Und, haben Sie mit ihm gesprochen?«
»Er geht nicht an sein Handy«, sagte Isabelle. »Die Telecom wusste auch nicht, wo er sich im Augenblick aufhält.«
»Bleiben Sie dran.« Zerna gab vor Madame Lapierre gerne den besorgten Chef, der sich um jedes Detail in seiner Dienststelle kümmerte. »Noch etwas: Am besten, Sie gehen zu Madame Simon.«
Isabelle zögerte, dann wandte sie sich an Madame Lapierre. »Möchten Sie nicht mit der Mutter sprechen?«
»Nein«, die Kommissarin steckte Block und Unterlagen in ihren blauen Aktenkoffer. Dann ließ sie demonstrativ die Schlösser zuschnappen, blickte auf und sah Isabelle mit ihrem falschen Lächeln an. »Ich sagte ja schon, das ist Aufgabe der lokalen Behörde. Außerdem kennen Sie sie schließlich am besten.«
»Bonne journée, Madame«, zwang sich Isabelle zu sagen und ging.
3. Kapitel
Leon bog mit seinem alten Peugeot Cabrio auf den Ärzteparkplatz der Klinik Saint Sulpice ein, der von großen Pinien überschattet wurde. Doch irgendjemand hatte das Auto auf seiner Parkbucht abgestellt. Das war dreist, denn Leons Platz war, genau wie die seiner Kollegen, mit einem Namensschild deutlich gekennzeichnet: Dr. Leon Ritter. Es galt als unausgesprochene Regel, dass man niemals den Platz eines Kollegen besetzte. Leon fuhr zu dem angrenzenden Besucherparkplatz und fand nur noch eine Lücke in der prallen Sonne.
Leon klappte das Dach seines Autos zu, damit die Sonne nicht die alten Ledersitze wie Herdplatten aufheizte. Es war zwar erst Anfang Juni, aber in der vergangenen Woche waren die Temperaturen bereits bis auf 34 Grad gestiegen und auch heute war der Himmel wieder wolkenlos. Leon griff unter den Beifahrersitz, wo er eine Tüte der Bäckerei Lou hervorzog. Er ließ die Scheiben offen, damit sich die Hitze nicht im Auto staute, und ging zum Haupteingang der Klinik.
Das Krankenhaus Saint Sulpice war ein schmuckloses Gebäude aus den 1970er-Jahren, das erst kürzlich einen modernen vierstöckigen Anbau bekommen hatte. Im Zuge dieser Renovierung war die Klinik nicht nur um ein Landedeck für Rettungshubschrauber, sondern auch um eine eigene Rechtsmedizinische Abteilung erweitert worden. Ein ehrgeiziges Projekt von Klinikchef Dr. Hugo Bayet, der hoffte, auf diese Weise schneller den heiß ersehnten Ruf an die Universität in Marseille zu bekommen. Allerdings waren seine Pläne mehrfach von Leon durchkreuzt worden, der mit seinen unorthodoxen Untersuchungsmethoden immer wieder die Kritik von Presse und Staatsanwaltschaft auf die Klinik gelenkt hatte. Dr. Bayet hatte sich in letzter Zeit öfter gefragt, ob er sich mit der Einstellung des renommierten Dr. Ritter aus Deutschland wirklich einen Gefallen getan hatte.
Leon betrat die Eingangshalle und ging zum Empfang, wo eine etwas mollige, blonde Schwester im türkisfarbenen Klinikkittel saß.
»Bonjour, Schwester Monique«, sagte Leon, »die fleißigste Mitarbeiterin von Saint Sulpice.«
»Ach, Docteur«, kicherte Schwester Monique, richtete sich in ihrem Stuhl auf, zupfte die Bluse zurecht und strahlte Leon an.
Er stellte die Tüte vor Monique auf den Tisch. »Habe ich Ihnen mitgebracht.«
»Danke, Docteur«, sagte sie. »Aber Sie wissen ja, dass ich eigentlich nichts Süßes mehr esse.«
»Ich dachte, bei einem Pain au chocolat aus der Boulangerie Papou würden Sie vielleicht eine Ausnahme machen.«
»Also wirklich …«, sie sah Leon mit einem Augenaufschlag an, den sie für unwiderstehlich hielt, packte die Tüte und ließ sie blitzschnell unter dem Tisch verschwinden. Schwester Monique hatte bestimmt gute Vorsätze, aber Leon wusste auch, dass das Gebäck den Tag nicht überstehen würde.
»Dr. Bayet hat nach Ihnen gefragt.«
»Hat er gesagt, was er wollte?«
»Keine Ahnung. Er kam mit einem anderen Arzt, den er Ihnen vorstellen wollte.«
»Dr. Bodin, richtig«, erinnerte sich Leon. Der Klinikleiter hatte ihn vor einigen Tagen angerufen, um ihm den Mediziner vorzustellen, der die Rechtsmedizinische Abteilung von Saint Sulpice gerne kennenlernen wollte.
»Ja, so hieß er«, sagte die Schwester und griff zum Telefon. »Ich sage dem Chef, dass Sie hier sind.«
»Warten Sie«, sagte Leon strenger, als er wollte. Die Schwester ließ ihre Hand auf dem Hörer ruhen. »Rufen Sie ihn bitte erst in einer Stunde an. Ich habe noch eine Sektion, da würde ich gerne ungestört arbeiten.«
»Natürlich, Docteur, ich verstehe«, sagte die Schwester und zwinkerte Leon verschwörerisch zu.
Die Rechtsmedizin war im Keller des Anbaus untergebracht. Hier unten brannte den ganzen Tag Kunstlicht und die Raumtemperatur wurde auf konstanten 20 Grad gehalten. Heute waren es allerdings mindestens 25 Grad in der Abteilung.
Als Leon die Pathologie betrat, stand Olivier Rybaud neben dem Obduktionstisch. Leons Assistent war 38 Jahre alt, dünn und hochgewachsen. Er trug eine lange Gummischürze. Die Leiche auf dem Sektionstisch war mit einem grünen Tuch bedeckt. Rybaud befestigte gerade den kleinen Plastikstreifen mit dem Barcode, den sie hier ›Le Ticket‹ nannten, am Fußgelenk des Opfers. Leon wusste nur, dass es sich bei dem Opfer um eine Frau handelte. Die Polizei hatte eine dringende Obduktion angeordnet.
»Was ist mit der Klimaanlage los?«, fragte Leon seinen Assistenten.
»Keine Ahnung. Irgendeine Störung in der zentralen Steuerung, ich hab schon den Hausmeister informiert. Er hat zugesagt, länger als ›une petite heure‹ wird es angeblich nicht dauern.«
Leon wusste, was es bedeutete, wenn ein Südfranzose »eine kleine Stunde« sagte. Es konnte ohne Weiteres Abend werden.
»Was ist mit dem Kühlraum?«, fragte Leon besorgt. Die ausfahrbaren Schubladen, in denen die Toten aufbewahrt wurden, mussten auf exakt vier Grad Celsius gehalten werden und verfügten über eine separate Klimaanlage.
»Alles in Ordnung«, sagte Rybaud. »Ich habe die Kontrollanzeige gerade noch einmal überprüft.«
Leon hatte sich umgezogen. Er trug jetzt ein grünes, kurzärmeliges Kittelhemd über einer grünen Hose. Darüber hatte er die obligatorische Einmalschürze aus durchsichtiger Plastikfolie gebunden. Seine Hände steckten in hauchdünnen Gummihandschuhen der Stärke »0«. Im Gegensatz zu seinen Kollegen, die meist schwere Stulpenhandschuhe trugen, verließ er sich während der Arbeit gerne auf sein Fingerspitzengefühl. Leon nahm das Klemmbrett vom Seziertisch, warf einen kurzen Blick darauf und schlug das grüne Tuch zurück.
Die Tote war verblutet, das war offensichtlich. Es gab Schnitte über der Wange, an der linken Schulter und am Oberarm. Aber die entscheidende Verletzung war der Schnitt in die rechte Arteria carotis, die große Halsschlagader. Das Opfer musste innerhalb weniger Minuten verblutet sein. Leon sah seinen Assistenten an.
»Laut Polizeibericht ist sie in die Glastür zur Terrasse gestürzt«, erklärte Rybaud.
Leon nickte nur. Verbluten war eine hässliche Art zu sterben. Sieben Liter Blut flossen durch den menschlichen Körper. Die Halsschlagader war eines der größten Blutgefäße. Wurde sie auf diese Weise verletzt, spritzte das Blut meterweit. Es konnte entsetzliche Minuten lang dauern, bis der Blutdruck zusammenbrach und das Herz noch einige letzte leere, sinnlose Schläge machte. Ohne den nötigen Druck konnten auch keine roten Blutkörperchen mehr ins Gehirn gepumpt werden, der lebensnotwendige Sauerstoff blieb aus. Schließlich versagte das Hirn, die Atmung setzte aus, und alle übrigen Organe wurden vom Körper regelrecht abgeschaltet. All das hat diese Frau in den letzten Augenblicken ihres Lebens miterleben müssen, dachte Leon.
Leon schätzte die Tote auf Anfang sechzig. Sie war athletisch schlank für ihr Alter. Leon ging langsam um die Leiche herum und betrachtete sie sorgfältig. Er wollte die Tote ›kennenlernen‹, wie er das nannte. Er wollte begreifen, wer das Opfer war, das da vor ihm lag. Wie hatte die Person gelebt? Wie hatte sie gearbeitet? War sie glücklich oder verzweifelt gewesen? Erst wenn er das wusste, würde er auch die wichtigste aller Fragen beantworten können. Die Frage nach dem Warum. Warum hatte dieser Mensch sterben müssen?
Die Haut der Frau war gepflegt. Die Nägel an Händen und Füßen geschnitten und gefeilt. Sie hatte Wert auf ihre äußere Erscheinung gelegt. Mund, Nase, Augen und die anderen Körperöffnungen waren frei von Fliegen oder Maden. Ein sicheres Zeichen, dass die Frau keine drei Stunden nach ihrem Tod entdeckt worden sein musste und zügig in die Rechtsmedizin gebracht worden war. Leon sah seinen Assistenten an.
»Madame Landru, 65 Jahre«, sagte Rybaud.
»Die Naturheilerin?«
»Richtig.«
Leon nickte. »Ich habe kürzlich ein Interview mit ihr im Var-Matin gelesen. Sie hat behauptet, dass sie nie im Leben bei einem Arzt gewesen ist. Hatte sie nicht ein Geschäft in Hyères?«
»Und noch drei weitere in Toulon und Marseille«, sagte Rybaud. »Echte Goldgruben. Die Leute stehen auf Naturmedizin.«
»Was sagt das Polizeiprotokoll?«
»Nur dass sie in ihrem Haus in die Scheibe gestürzt ist. Ihr Enkel hat sie tot am Boden gefunden, angeblich.«
»Angeblich?«, fragte Leon, während er den Hals genauer untersuchte.
»Er ist der Alleinerbe«, meinte Rybaud. »Und er ist knapp bei Kasse. In Marseille wollten sie schon vor zwei Wochen sein Restaurant dichtmachen.«
Leon fragte erst gar nicht, woher sein Assistent das wusste. Wenn es um Klatschgeschichten aus der Gegend ging, war Rybaud der absolute Experte.
»Wird gegen den Enkel ermittelt?« fragte Leon. Obwohl er natürlich genau wusste, dass das Rechtsmediziner nicht zu interessieren hatte. Aber für ihn waren die Toten nicht einfach nur Beweisstücke, die es zu untersuchen galt. Auch wenn vielleicht die meisten seiner Kollegen so dachten. Für Leon waren die Toten »Patienten«, und genauso sorgfältig und respektvoll untersuchte er sie auch. Wie ein Arzt, der sich nach den Lebensumständen des Patienten erkundigte, »fragte« Leon auch seine Patienten nach den Umständen, die zu ihrem Tod geführt hatten.
Eine aktive Frau, die mitten im Leben stand. Würde eine solche Person in ihrem Wohnzimmer zu Tode stürzen?
»Die Polizei hat keinen Anhaltspunkt. Noch nicht. Sie wollen unseren Bericht abwarten«, sagte Rybaud, der seinen Chef genau beobachtete.
Leon griff nach dem Handgelenk der Toten und hob es leicht an. Jetzt konnte er sehen, dass die Finger sich wie die Klaue eines Vogels verkrampft hatten. Leon richtete sich auf und griff zu der großen Lupe, die an einem Gelenkarm über dem Sektionstisch hing. Er schaltete das LED-Licht ein und hielt die Lupe über die Augen der Toten. Zwischendurch diktierte er seine Beobachtungen in das digitale Aufnahmegerät, das er in der Brusttasche trug.
»Pupillen beidseitig weit gestellt …«, sagte Leon und schwenkte die Lupe wieder nach oben. Dann machte er einen Schritt zur Seite und beugte sich über den Kopf der Frau. Vorsichtig schob er die blonden Haare des Opfers nach hinten über das Ohr. Er drückte die Ohrmuschel leicht nach vorne, dann sah er die kleinen Einblutungen.
»Erstickungsanfall«, sagte Leon.
Rybaud beugte sich jetzt ebenfalls über das Opfer. »Ich kann keine Würgemale erkennen.«
»Nein, keine Fremdeinwirkung«, sagte Leon. »Haben wir schon den Kreatininwert?«
Rybaud reichte seinem Chef einen Computerausdruck. Leon brauchte nur einen kurzen Blick.
»Haben Sie das gesehen?«
»Über zwei Milligramm«, nickte Rybaud.
»Nierenversagen«, konstatierte Leon nachdenklich.
»Dafür kann es jede Menge Gründe geben« sagte Rybaud.
»Ein Krampf in der Hand, Einblutungen hinter dem Ohr. Geweitete Pupillen, Nierenversagen und der Sturz in die Scheibe …«, Leon sah seinen Mitarbeiter an. »Hatten Sie schon mal mit einer Vergiftung durch Tollkirsche zu tun?«
»Nein, aber für solche Symptome kann es doch hundert verschiedene Auslöser geben.«
»Nicht für eine Naturheilerin, die sich das Leben nehmen will«, sagte Leon.
»Sie glauben, die Frau hat sich umgebracht? Warum?«
»Lassen Sie es uns herausfinden.«
Eine halbe Stunde später zeigte sich, dass Leon mit seiner Überlegung richtiggelegen hatte. Im Magen fanden sich die halb verdauten Reste von etwa zwanzig Tollkirschen, den berüchtigten »Atropa Belladonna«. Jeder Mediziner, auch wenn er nur Naturheilkunde betrieb, wusste um die Gefahr, die von den schwarzen Beeren ausging. Sie produzierten die hochgiftigen Tropan-Alkaloide, die das zentrale Nervensystem angriffen. Die tödliche Menge der süßen Beeren lag für Kinder bei etwa vier Stück, bei einem durchschnittlichen Erwachsenen galten zwölf Beeren als letale Dosis. Leon stellte sich vor, wie die Frau die Beeren gegessen hatte. Wie schon nach wenigen Minuten ihr Puls hochschoss, wie die Pupillen ihrer Augen sich weiteten und sie die Trockenheit im Mund spürte. Dann begannen die Krämpfe, dazu Schwindel und schließlich die völlige Verwirrtheit. In diesem Moment musste sie orientierungslos durch den Raum gestolpert und in die Scheibe gelaufen sein. Den Schnitt in die Halsschlagader konnte sie nur wenige Minuten überlebt haben. Diese Frau hatte genau gewusst, was sie tat, als sie die Beeren aß. Sie hatte gewusst, dass es für sie keinen Weg mehr zurück gab.
Es dauerte noch weitere zwanzig Minuten, dann konnte Leon auch die Frage nach dem Warum beantworten. Die Tote hatte Nierenkrebs, der bereits mit seinen Metastasen ihre Wirbelsäule befallen hatte. Nach Leons Erfahrung hätte sie keine vier Monate mehr zu leben gehabt. Offensichtlich hatte sich Madame Landru, die nie zu einem Arzt gegangen war, in ihren letzten Lebenswochen doch einem Mediziner anvertraut, der ihr die schreckliche Wahrheit gesagt hatte: Krebs im Endstadium.
Leon betrachtete die Tote, während sein Assistent die letzten Gewebeproben nahm. Er konnte nur die medizinischen Fragen beantworten, der Rest war Polizeiarbeit. Aber Leon war sich sicher, dass der Enkel mit dem Tod seiner Großmutter nichts zu tun hatte. Selbstmord war eine der häufigsten Todesarten, wenn man mal von tödlichen Krankheiten und Verkehrsunfällen absah. Und in keinem europäischen Land brachten sich so viele Menschen um wie in Frankreich.
4. Kapitel
Leon betrat das Vorzimmer von Klinikleiter Bayet. Hier hatte dessen Sekretärin, Madame Koenig, das Kommando und verbreitete wie immer schlechte Laune. Die blonde, humorlose Frau mit den streng zurückgekämmten Haaren, die sie mit einer Samtschleife zusammengebunden hatte, erinnerte Leon jedes Mal an seine Lateinlehrerin aus dem Gymnasium.
»Doktor Bayet erwartet Sie«, sagte sie mit einem angedeuteten arroganten Kopfnicken in Richtung Tür, die sie wie ein Kettenhund bewachte. »Schon seit fünfzehn Minuten. Er hat bereits drei Mal nach Ihnen gefragt.«
»Drei Mal, meine Güte!«, sagte Leon in gespielter Überraschung. »Da sollten Sie ihn aber auf gar keinen Fall noch länger warten lassen, Madame Koenig.«
»Wieso? Das ist doch nicht mein Versäumnis«, Madame König war sich nicht sicher, wie ihr Besucher die Bemerkung gemeint hatte.
Leon lächelte sie freundlich an und ging zur Tür. Die Sekretärin hatte ihn in der Pathologie angerufen, und er hatte ihr versichert, dass er zu Dr. Bayet käme, sobald er die Obduktion abgeschlossen habe. Als Leon das Büro des Klinikleiters betrat, erhob sich Dr. Bayet zu Leons Erstaunen hinter seinem Schreibtisch. Das hatte er noch nie getan. Der Klinikleiter wies mit höflicher Geste auf den Besucher, einen etwa vierzigjährigen Mann mit glatt rasiertem Gesicht und hoher Stirn, der sich ebenfalls erhob. Er trug eine blaue Hose und ein hellblau-weiß gestreiftes Hemd, einen dünnen Baumwollpullover hatte er sich über die Schultern gelegt. Ein Arzt im Sommerurlaub, dachte Leon. Wahrscheinlich hatte er das in einer der Ärzteserien im Fernsehen gesehen.
»Dr. Ritter, darf ich Ihnen Dr. Alexandre Bodin vom Rechtsmedizinischen Labor in Avignon vorstellen?«
Die Männer schüttelten sich die Hand und tauschten ein paar Höflichkeiten aus. Bayet wies auf die Stühle, und man setzte sich.
»Nun ja«, sagte Dr. Bayet und suchte nach den passenden Worten. Es entstand eine kurze peinliche Pause.
»Ich habe schon viel von Ihrer … speziellen Arbeitsweise gehört«, sagte Bodin zu Leon, und es war offensichtlich, dass das nicht als Lob gemeint war.
»Die Rechtsmedizinische Abteilung von Saint Sulpice konnte in letzter Zeit zur Aufklärung einiger ungewöhnlicher Verbrechen beitragen«, sagte Leon bescheiden.
»Genau, und deshalb haben wir Dr. Bodin zu Gast«, nahm Bayet den Faden auf. »Ich hatte ja sein Kommen bereits avisiert.« Der Klinikleiter benutzte gerne Fremdwörter, um seinen Sätzen mehr Bedeutung zu verleihen. »Dr. Bodin wollte sich gerne eine Zeitlang in einer modernen klinisch-rechtsmedizinischen Abteilung umsehen. Und welcher Platz wäre da besser geeignet als Saint Sulpice.«
»Ich bin Dr. Bayet, wirklich sehr dankbar für das Angebot.« Bodin rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. »Wie schon gesagt, nach fast vier Jahren Laborarbeit möchte ich dringend mal wieder im Obduktionssaal stehen.« Dabei ballte er die Hände zu Fäusten, als könnte er seinen Tatendrang kaum bändigen.
»Schade, dass Sie nicht heute Morgen bei uns vorbeigesehen haben«, sagte Leon. »Wir hatten einen sehr interessanten Fall einer Tropan-Alkaloid-Vergiftung.«
»Einer … aha …«, der Gast warf einen schnellen, Hilfe suchenden Blick in Richtung Klinikleiter.
»Belladonna, Tollkirsche«, half Leon dem Besucher auf die Sprünge, wie einem Schüler, dem die richtige Vokabel nicht einfallen wollte.
»Vergiftung durch Tollkirsche. Nicht so ungewöhnlich hier bei Ihnen im Süden, oder?«, versuchte Dr. Bodin seine Unkenntnis zu überspielen.
»Das Opfer hatte sich vergiftet und war dann in eine Scheibe gestürzt. Wobei es sich die Halsschlagader aufgeschnitten hatte und verblutete«, ergänzte Leon. »Also ich fand es ziemlich ungewöhnlich.«
»Na, bestens meine Herren, da sind wir ja schon mittendrin im Fachgespräch.« Der Klinikleiter hob die Hände. »Also dann sagen wir doch einfach, Sie kommen morgen um neun zu Doktor Ritter in die Forensik. Das ist Ihnen doch recht, Doktor Ritter?« Er sah Leon mit einem Blick an, der jeden Widerspruch unterbinden sollte.
»Morgen machen wir nur ein paar Standarduntersuchungen in der Autopsie. Nichts Besonderes«, antwortete Leon ausweichend und wandte sich an den Gast. »Ich fürchte, das würde Sie nur langweilen. Aber wenn Sie etwas sehen wollen, dann empfehle ich Ihnen die Altstadt von Hyères. Morgen ist Wochenmarkt.«
»Sehr liebenswürdig. Danke.« Bodin zwang sich zu einem Lächeln.
»Dr. Bodin hat in den letzten Jahren geholfen, das neue Rechtsmedizinische Labor von Avignon aufzubauen«, versuchte Bayet die Situation zu retten. »Ich bin überzeugt, er brennt geradezu darauf, mit Ihnen im Obduktionsraum stehen zu dürfen.«
»Na gut. Wir beginnen mit den Untersuchungen gegen acht Uhr.« Leon erhob sich. »Ich müsste jetzt noch einmal kurz nach unten, um meinem Assistenten ein paar Anweisungen für morgen geben.«
»Aber natürlich«, sagte der Klinikchef.
Auch der Gast hatte sich erhoben. »Ich freue mich auf morgen«, sagte er.
Leon schüttelte ihm kurz die Hand. »Nur eines noch«, sagte er. »Stellen Sie doch bitte Ihren Wagen morgen auf dem Besucherparkplatz ab. Bonne soirée, messieurs.«
Einige Minuten später stand Leon auf dem Parkplatz und öffnete das Verdeck seines Cabrios. Er musste gar nicht mehr in die Rechtsmedizin zurückkehren, er wollte nur raus aus dem Büro des Klinikleiters. Schon Dr. Bayet war schwer zu ertragen, aber dieser Doktor Bodin aus Avignon war eine echte Zumutung. Leon war ein Einzelkämpfer, der nichts dringender brauchte als seine Ruhe. Er wollte allein sein bei seiner Arbeit. Konzentriert auf eine Aufgabe. Er musste hineinhorchen in die Seelen der Verstorbenen, sich inspirieren lassen, auf sein Bauchgefühl achten, Spuren und Zeichen erahnen. Das war der Weg, der ihn zu seinen Erfolgen führte. Die Vorstellung, dass ihm ab morgen ununterbrochen ein ahnungsloser Rechtsmediziner über die Schulter sehen würde, war grauenhaft. Die Zusammenarbeit mit Rybaud war das Äußerste an Teamwork, das Leon in seinen geheiligten Hallen der Rechtsmedizin ertragen konnte.
»Ich habe gehört, Sie haben Unterstützung bekommen.« Neben Leon war Dr. Théo Menez aufgetaucht.
Menez war von erfrischender Offenheit. Leon hatte sich seit dem ersten Tag in der Klinik mit dem Unfallchirurgen verstanden. Inzwischen war eine Art Freundschaft zwischen ihm und dem engagierten Arzt entstanden.
»Das Schicksal will mich strafen.«
»Ist es so schlimm?«
»Schlimmer. Es ist die Heimsuchung.«
Menez lachte und klopfte Leon auf die Schulter. »Keine Sorge. Bodin ist nur ein Wichtigtuer.« Leon sah ihn an. »Ich habe mit ihm zusammen in Aix‑en-Provence Medizin studiert.«
»Und warum rollt Bayet für ihn den roten Teppich aus?«
Dr. Menez sah sich kurz um, als müsste er sich versichern, dass ihnen niemand zuhörte. »Im Haus geht das Gerücht, dass Bayet Sie gerne ablösen würde.«
Leon verschlug es für einen Moment die Sprache. Ihm war klar, dass er sich mit seinem letzten Fall massiven Ärger eingehandelt hatte. Die Exhumierung eines Priesters war ein öffentlicher Skandal gewesen. Aber schließlich hatte er den Fall gelöst, und über seine mögliche Ablösung hatte Bayet nie ein Wort verloren. Allerdings hatte er auch nie davon gesprochen, seinen laufenden Vertrag zu verlängern.
»Wenn Bayet wirklich einen Nachfolger für mich sucht, wieso holt er dann jemand wie Doktor Bodin? Einen Mann ohne jede Erfahrung?«
»Man merkt, dass Sie noch nicht lange in der Provence sind, mein Freund. Sein Vater ist Professor Vincent Bodin vom Ordre des Médecins.«
»Der Vorsitzende der Ärztekammer?«
»Genau der. Der Mann mit den perfekten Verbindungen.«
»Zum Beispiel, wenn man von einer Professur in Marseille träumt?«, fragte Leon.
»Ganz speziell, wenn man von einer Professur in Marseille träumt.« Dr. Menez lachte. »Ich wette, unser guter Dr. Bayet schreibt bereits an seiner Antrittsvorlesung.«
»Danke für die schlechten Nachrichten.« Leons Humor klang etwas angestrengt.
»Die gute Nachricht lautet: Bodin ist ein Blender. Er kann nichts. Wenn Bayet ihm die Abteilung übergibt, fährt er sie in kürzester Zeit gegen die Wand.«
»Ich bin nicht sicher, ob ich mich über diese Information freuen soll«, sagte Leon, verabschiedete sich, stieg ein und fuhr davon. Er schaltete das Radio an. Die ewige Edith Piaf sang: »Non, je ’ne regrette rien.«
5. Kapitel
Die Villa lag versteckt zwischen dichten Palmen, Oleanderbüschen und Pinien. Wo die Vegetation ein wenig durchlässiger war, konnte man das Meer in der Mittagssonne glitzern sehen. Isabelle kniff die Augen zusammen und blinzelte in die Sonne. Das Wasser konnte keine fünfzig Meter entfernt sein. Eine fantastische Lage. Isabelle hatte extra hundert Meter weiter geparkt, um ein Stückchen zu Fuß zu gehen und sich einen Eindruck von der Gegend zu machen. Es war heiß und der Boden war trocken und staubig. Dagegen wirkten die gepflegten Gärten rechts und links der kleinen Straße geradezu tropisch. Von irgendwoher wehte die Nachmittagsbrise den feuchten Hauch einer Sprinkleranlage heran. Es roch nach kühlem Schatten und frischen Blättern. Die Sonne hatte die schmale Straße, die am Rand von Le Lavandou direkt an der Bucht entlangführte, den ganzen Tag aufgeheizt. Isabelle konnte die Hitze noch durch die Sohlen ihrer Schuhe spüren. Schmetterlinge flatterten in den Sonnenstrahlen, die durch die Kronen der mächtigen Pines Parasols fielen, und über allem lag der unvergleichliche Gesang der Zikaden.
Isabelle blieb vor dem Haus mit der Nummer 13 stehen. Zur Straße war das Gebäude durch eine weiße Mauer abgeschirmt, in der ein schwarzes Eisentor eingelassen war. Es war schon über fünf Jahre her, dass Isabelle mit der Mutter der toten Amélie gesprochen hatte. Damals wohnte Delphine Simon noch in einem Einfamilienhaus an einer der Corniches über Saint Claire. Madame Simon hatte sich eindeutig verbessert, dachte Isabelle, als sie die Klingel drückte, an der kein Name stand.
»Hallo …?«, fragte eine zögernde Frauenstimme.
»Capitaine Morell, wir haben telefoniert«, antwortete Isabelle.
»Kommen Sie bitte herein«, sagte die Stimme.
Ein Summen war zu hören, und im gleichen Moment wurde das Tor elektrisch geöffnet. Das Haus war, was man in einem Maklerprospekt als »Architektentraum« bezeichnet hätte. Es bestand aus zwei weißen Würfeln, die durch ein gläsernes Atrium verbunden waren. In der Tür stand eine schmale, schüchterne Frau mit dunklen kurzen Haaren, die sich in dieser prächtigen Villa nicht zu Hause zu fühlen schien. Sie trug ein helles Sommerkleid mit einem schwarzen Gürtel. Dazu hatte sie Tennisschuhe an. Sie war 38, aber die Falten um die Augen und die schmalen Lippen ließen sie älter erscheinen.
Madame Simon begrüßte ihre Besucherin freundlich, aber reserviert, fast etwas verstört. Sie führte Isabelle durch die strahlend helle Eingangshalle, an der offenen Küche vorbei, hinaus auf die Terrasse. Der Boden der Veranda war aus Teakholz, wie auf einem Segelboot, als Balustrade waren hüfthohe Glasscheiben montiert worden, sodass man den freien Blick auf die Bucht und das Meer hatte. Man konnte sich einbilden, man befände sich an Deck einer Yacht und hielt auf die offene See zu.
»Das ist ein fantastisches Haus.« Isabelle sah sich beeindruckt um. Sie hatte, bedingt durch ihre Arbeit, schon einige Villen gesehen, aber diese hier war etwas Besonderes.
»Denis, also Monsieur Legrand, hat es gefunden.«
»Da hatte er aber Glück. Das ist wirklich ein wunderschöner Platz.«
»Mein Mann hat lange nach etwas Passendem für uns gesucht.« Bei der Gastgeberin klang es wie eine Entschuldigung. »Er ist Makler.«
»Ich wusste gar nicht, dass Sie wieder geheiratet haben, Madame …?«
»Legrand«, ergänzte sie. »Das war im vergangenen Herbst. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, Denis und ich.«
»Kennen Sie sich aus Lavandou?«, fragte Isabelle.
»Nein, aus Hyères«, sagte Madame Legrand. »Ich habe bei Moreau, dem Optiker, gearbeitet, nachdem Amélie … nachdem das alles passiert ist. Denis kam eines Tages in den Laden und hat eine Sonnenbrille gekauft.«
Isabelle konnte sich nicht erinnern, dass der Name Denis Legrand während der Untersuchung des Mordes an der kleinen Amélie jemals aufgetaucht wäre. Sie würde dem nachgehen.
»Wir wollten nicht, dass geredet wird«, fügte die Frau schnell hinzu.
»Das kann ich gut verstehen. Es ist sicher schwer, nach allem, was passiert ist, ein normales Leben zu führen.« Isabelle sah ihre Gastgeberin an.
»Ich führe kein ›normales Leben‹ mehr.« Die Gastgeberin wandte sich ab und atmete tief die frische Luft ein, die über das Meer heranwehte. »Vielleicht irgendwann einmal.«
»Was ist aus Ihrem alten Haus geworden?«
»Ich konnte dort nicht länger bleiben. Können Sie das verstehen …?«
»Natürlich«, erwiderte Isabelle. »Sie haben das Haus verkauft?«
»Denis hat sich um alles gekümmert«, erklärte Madame Legrand. »Ich hätte das nicht gekonnt, nachdem Amélie …«, sie unterbrach sich, schüttelte den Kopf und drückte sich mit der rechten Faust gegen die Oberlippe, als könnte sie so die Tränen zurückhalten. »Ich hatte dort immer das Gefühl, sie wäre noch … noch bei mir.«
Es entstand eine kleine Pause, und Isabelle wartete, bis sich Madame Legrand wieder gefangen hatte.
»Ich hatte es Ihnen ja bereits am Telefon gesagt.« Isabelle sah die Frau an, die ihrem Blick auswich. »Die Staatsanwaltschaft wird den Fall noch einmal aufrollen.«
»Ich wünschte, ich könnte das alles vergessen.« Madame Legrand schüttelte den Kopf. »Damals hat der Staatsanwalt gesagt, dass Paul für immer hinter Gitter käme für das, was er getan hat … und jetzt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.«
»Das Revisionsgericht war von seiner Unschuld überzeugt«, erwiderte Isabelle.
»Aber er ist doch immer noch der einzig Verdächtige?« Madame Legrand sah Isabelle an. »Oder etwa nicht?«
»Wir ermitteln nicht mehr gegen ihn«, sagte Isabelle.
»Ich halte das nicht aus.« Madame Legrand drehte sich um, sah aufs Meer und begann zu weinen. »Nicht noch einmal. Bitte, ich … ich stehe das nicht noch einmal durch.«
Isabelle legte der verzweifelten Frau die Hand auf den Arm.
»Wir wollen den Menschen finden, der das getan hat«, sagte Isabelle. »Ich weiß, das ist schlimm für Sie. Aber ich bitte Sie trotzdem, uns zu helfen.«
Die Gastgeberin zog ein zerknülltes Papiertaschentuch aus der Tasche ihres Kleides und tupfte sich die Tränen aus dem Gesicht.
»Darf ich Sie fragen, ob Ihr Ex‑Mann sich bei Ihnen gemeldet hat?« Isabelle klang besorgt, als würde sie mit einer Freundin sprechen.
»Nein, das dürfen Sie nicht!«, rief eine energische Stimme von der Terrassentür her.
Isabelle drehte sich um. Am Eingang zur Veranda stand ein blonder Mann, Mitte vierzig, der sein üppiges Haar zu einer dekorativen Mähne aufgekämmt hatte. Vielleicht weil er hoffte, auf diese Weise jünger zu wirken. Er trug Marken-Jeans und ein Poloshirt. Seine nackten Füße steckten in Dockers aus weichem blauem Leder. Isabelle wusste gleich, wer der Mann war: Denis Legrand.
»Du brauchst nicht zu antworten, Liebes«, sagte der Mann. »Die Polizei hat kein Recht, dir Angst zu machen.« Die letzte Bemerkung richtete er an Isabelle.
»Sie hat mich nur gefragt, ob sich Paul bei uns gemeldet hat, seit er …«, Madame Legrand verschluckte den letzten Teil ihres Satzes.
»Ich möchte Ihrer Frau keineswegs Angst machen. Ich habe sie nur gebeten, uns bei den Ermittlungen zu unterstützen.«
»Sie sehen doch, wie Sie sie mit Ihren Fragen quälen«, sagte Legrand vorwurfsvoll. »Warum kommen Sie überhaupt zu uns? Sie hatten den Mörder doch schon ins Gefängnis gesteckt. Wenn Sie diesen Verbrecher wieder laufen lassen, bitte. Das ist nicht unsere Sache. Aber erwarten Sie nicht von meiner Frau, dass sie Ihnen noch einmal hilft.«
Isabelle zog ihre Visitenkarte aus der Tasche und reichte sie Madame Legrand.
»Wenn Monsieur Simon hier auftauchen sollte oder sich bei Ihnen meldet, geben Sie mir Bescheid. Sie können mich jederzeit unter dieser Nummer erreichen.«
»Na klar, großartig, machen Sie meiner Frau nur richtig Angst.« Monsieur Legrand sah Isabelle wütend an.
»Er hat mich schon angerufen«, sagte Madame Legrand leise.
»Aber Liebes? Das hast du ja gar nicht erzählt.« Legrand ging zu seiner Frau und wollte ihr den Arm um die Schulter legen, aber sie drehte sich von ihm weg.
»Was hat er gesagt?«, wollte Isabelle wissen.
»Nichts«, antwortete Madame Legrand. »Er hat nichts gesagt …«
»Wie, gar nichts gesagt? Was meinst du damit, Chérie?« Legrand klang irritiert.
»Er hat nur geatmet«, sagte Madame Legrand. »Aber ich weiß, dass er es war …« Sie konnte nicht weiterreden.
»Sehen Sie, was Sie anrichten!« Legrand sah Isabelle verärgert an. »Ich bitte Sie zu gehen, meine Frau muss sich jetzt ausruhen.«
Legrand gab die Tür frei und machte eine unmissverständliche Handbewegung in Richtung Ausgang.
»Au revoir, Madame«, sagte Isabelle und folgte dem Hausherrn, während Madame Legrand auf der Terrasse zurückblieb. Vor dem Haus am offenen Tor blieb Isabelle noch einmal stehen.
»Das ehemalige Haus Ihrer Frau hatte die kleine Amélie doch von ihren Großeltern väterlicherseits überschrieben bekommen?«, fragte Isabelle.
»Ja, und? Ich verstehe nicht, warum Sie das interessieren sollte.« Hier draußen hatte die Stimme des Maklers plötzlich einen aggressiveren Ton angenommen.
»Nur so eine Frage«, sagte Isabelle wie nebenbei. »Es gab da doch noch dieses große Stück Land, soweit ich mich erinnere. Wie viel Baugrund war das? Drei Hektar?«
»Warum fragen Sie, wenn Sie doch sowieso alles wissen?«
Isabelle beobachtete den blonden Mann genau. Das Thema war ihm ganz offensichtlich unangenehm. »Nur damit ich das richtig verstehe, Monsieur Legrand: Mit dem Tod der kleinen Amélie fiel alles an Ihre neue Frau, und Sie haben es dann verkauft.«
»Na und?«
»Das Grundstück muss eine Menge Geld gebracht haben.«
»Au revoir, Madame.« Legrand wies die Besucherin vor die Tür.
»Ich bin keine Juristin«, sagte Isabelle betont ahnungslos. »Aber wenn Monsieur Simon unschuldig ist, steht ihm dann nicht dieses Geld zu?«
»Verschwinden Sie!« Legrand sah die Besucherin an, als wollte er sie schlagen, wenn sie noch eine weitere Bemerkung machte.
»Ich denke, wir sollten uns darüber noch einmal in aller Ruhe unterhalten, Monsieur Legrand.«
»Es gibt nichts zwischen uns zu besprechen.«
»Ich würde Sie gerne als Zeugen befragen. Sagen wir, morgen um elf Uhr.« Ohne auf Legrands Protest einzugehen ließ Isabelle den Makler stehen und verließ das Grundstück.
6. Kapitel
Leon hatte sich in sein Cabrio gesetzt und das getan, was er immer tat, wenn er seine Ruhe haben und nachdenken wollte. Er war über Lavandou hinauf in die Hügel des Massif des Maures gefahren, auf einer kleinen Straße, auf die sich nur selten Touristen verirrten. Dort hatte er den Wagen unter einer großen Korkeiche abgestellt und war ein Stück über den Höhenweg gewandert. Hier war er alleine mit seinen Gedanken. Ab und zu blieb er stehen und sah hinunter aufs Meer. Der Blick war atemberaubend, und Leon hatte das Gefühl, als könnte er von diesen Höhen bis nach Nordafrika sehen, wenn ihm der feine Dunst, den die Hitze über dem Meer aufsteigen ließ, nicht die Sicht nehmen würde. Das war natürlich Unsinn, aber es gab Leute, die behaupteten, dass man von den Höhen bei klarer Sicht die Berge von Korsika sehen könnte. Leon hielt auch das für Gerede und er gab sich mit dem Blick auf die Inseln zufrieden, die jetzt wie ferne Schiffe im warmen Orange der Nachmittagssonne schwammen.