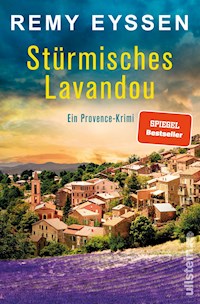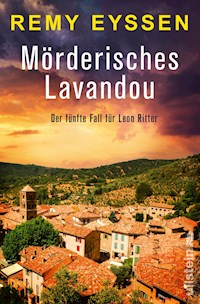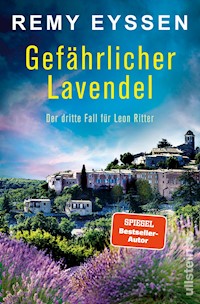
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Frühling in Le Lavandou ist warm und verheißt einen herrlichen Sommer. Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter fühlt sich längst als echter Südfranzose und verbringt gemeinsam mit Isabelle viel Zeit auf seinem Weinberg. Doch die Idylle wird getrübt, als Leon zwei brutal zugerichtete Leichen obduzieren muss. Staatsanwaltschaft und Kommissarin haben schnell einen Verdächtigen zur Hand, doch Leon ist skeptisch und beginnt selbst zu ermitteln. Er kommt einer jahrzehntealten Geschichte auf die Spur und steht plötzlich vor der Frage, ob es gerechte Rache gibt. Da braut sich über der ausgetrockneten Erde der Provence ein apokalyptisches Gewitter zusammen, und Leon darf keine Zeit verlieren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Der Frühling in Le Lavandou ist herrlich, und Leon genießt das südfranzösische Leben auf seinem Weinberg mit Isabelle. Doch so entspannt bleibt es nicht lange: Leon wird zu einer Obduktion gerufen. Der Tote wurde auf brutale Weise gefoltert, doch dank einer DNA-Spur gibt es schon bald einen Verdächtigen. Als jedoch eine weitere derart zugerichtete Leiche auftaucht, ist Leon nicht mehr derselben Meinung wie die Staatsanwaltschaft und begibt sich auf Spurensuche. Und er wird fündig: Als er ein 20 Jahre altes Grab öffnen lassen will, führt das fast zum Bruch mit Isabelle, doch er kann sich durchsetzen. Wenig später steht er vor einer schwierigen Entscheidung: Ist er wirklich auf der richtigen Fährte, oder verrennt er sich in eine Verschwörungstheorie über jahrzehntealte Machenschaften?
Der Autor
Remy Eyssen, geboren 1955 in Frankfurt am Main, arbeitete viele Jahre als Redakteur und freier Autor für Tageszeitungen und Magazine. Anfang der 90er Jahre entstand die erste Zusammenarbeit mit dem ZDF. Seitdem schreibt Eyssen erfolgreich Drehbücher für TV-Serien und Filme für alle großen deutschen Fernsehsender im Genre »Krimi und Thriller«.
Von Remy Eyssen sind in unserem Hause bereits erschienen:
Tödlicher Lavendel
Schwarzer Lavendel
REMY EYSSEN
GEFÄHRLICHERLAVENDEL
Kriminalroman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1517-1
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage April 2017
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Titelabbildung: mauritius images/age/© Jesús Nicolás Sánchez
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Meiner Frau und meiner Tochter.Für ihre Geduld und ihren Rat.
PROLOG
Mittelmeer, Juli 1995
Das angeschlagene Fischerboot kämpfte gegen die Wellen, die sich wie wütende Raubtiere auf den Kutter stürzten. Es war stockdunkel, kalt, und der Sturm brüllte ohrenbetäubend. Nur gelegentlich rissen die Wolken auf und gaben den Vollmond frei, der mit fahlem Licht eine Szene wie aus Dantes Inferno beleuchtete. Die Menschen, die sich an Bord drängten, schrien auf, wenn das Wasser übers Deck schoss und gurgelnd im Niedergang verschwand, der zu dem altersschwachen Dieselmotor führte. Blass vor Angst saßen die Frauen in der Mitte auf den glitschigen Planken, umklammerten ihre Kinder und stützten sich gegenseitig, um nicht von Bord gespült zu werden. Die Schleuser hatten das Boot mit Flüchtlingen so überladen, dass es gefährlich tief im Wasser lag. Der Freibord ragte keinen halben Meter mehr aus der aufgewühlten See, und der Sturm schleuderte einen Wasserschwall nach dem anderen über Deck.
»Gott steh uns bei«, dachte der Mann. Er hatte sich an den Wanten festgeklammert, die den kurzen Mast des Fischerbootes stützten, an dem früher einmal die Netze heraufgezogen worden waren. Jetzt war der Mast verrottet und morsch, wie alles an diesem verdammten Boot. Der Wind war kalt, und der Mann fror erbärmlich in seiner nassen Kleidung.
»Warum sind wir immer noch nicht da? Wir sollten die Küste längst erreicht haben«, dachte er und starrte in die Nacht, während immer neue Wellen heranrauschten. Drei Tage und drei Nächte waren sie bereits unterwegs. Dabei hatten die Schleuser versprochen, dass die Überfahrt keine 24 Stunden dauern würde. Drei Tage und drei Nächte voller Angst und Verzweiflung. Das Trinkwasser war längst aufgebraucht. Der Mann hatte gesehen, wie Flüchtlinge um die letzten Becher mit dem Messer gekämpft hatten.
Hauptsache, seine Frau und das Baby waren einigermaßen sicher, dachte er. In der Dunkelheit konnte er sie zwar nicht erkennen zwischen all den Menschen, aber er wusste, dass sie da waren und dass die Frauen sich gegenseitig halfen.
In diesem Moment war ein metallisches Knirschen aus dem Motorraum zu hören, und dann verstummte mit einem Schlag der Diesel. Für einen Augenblick war es so, als wäre das Herz des Bootes stehen geblieben. Die Menschen flüsterten ängstlich, und die Schleuser schrien Befehle. Taschenlampen wurden eingeschaltet. Aus der Luke zum Motorraum stemmte sich ein drahtiger Junge, keine zwanzig Jahre alt. Seine Hände waren schwarz vom Öl, an seiner Stirn klaffte eine Wunde, und Blut lief ihm über das Gesicht. Der Junge hielt einen rostigen Schraubenschlüssel in der Hand. Als er bedauernd den Kopf schüttelte, traf ihn der Fußtritt eines Schleusers, der eine Kufiya, das traditionelle arabische Tuch, um den Kopf geschlungen hatte. In der Hand hielt er eine Kalaschnikow. Der Junge verschwand erneut unter Deck.
Das aufgewühlte Meer spielte jetzt mit dem steuerlosen Fischerboot wie mit einem Korken. Das Schiff wurde angehoben, gedreht, geschoben, nur um im nächsten Augenblick wieder in ein Wellental abzusacken. Der Mann hörte Frauen laut jammern, andere hockten auf allen vieren am Boden und kotzten sich die Seele aus dem Leib. Eine neue Welle ließ das Boot quer schlagen. Der nächste Brecher würde mit voller Wucht die Flanke des Schiffs treffen – das wäre das Ende. Die Menschen an Deck sahen die aufgewühlte See heranrollen und schrien. Sie drängten zur windabgewandten Seite des Bootes und brachten es in eine gefährliche Schieflage. In diesem Moment feuerte der Schleuser mit seiner Kalaschnikow über die Köpfe der Passagiere hinweg, die sich in Todesangst aufs Deck warfen. Das Boot pendelte zurück. Wasser schoss über die Reling. Die Welle riss die, die stehen geblieben waren, von den Füßen. Verzweifelt versuchten sie, sich irgendwo festzuklammern. Ein Passagier, der einen blauen Plastiksack im Arm hielt, wurde von der Welle wie Abfall über Bord gespült. Ohne einen Laut verschwand der Fremde im dunklen Meer. Niemand sah ihm nach.
Die letzte Welle hatte das Boot gedreht, und jetzt schob die Strömung es wieder in Fahrtrichtung. Doch ohne Motor war das überladene Schiff verloren. Sie würden alle sterben, dachte der Mann und verfluchte sich dafür, dass er seine Familie in so große Gefahr gebracht hatte.
Aus den Augenwinkeln sah der Mann, dass einer der Schleuser einem anderen etwas zurief. »Nur die Kuffar!«, verstand der Mann. Jetzt suchten sie also nach den Ungläubigen, den Christen. Für einen Moment hatte der Mann das Gefühl, ohnmächtig zu werden.
Der Schleuser stieß einem der Flüchtlinge den Lauf der Kalaschnikow in die Rippen. »Bi smi llahi r-rahmani r-rahim …«, begann der Schleuser, auf Arabisch aus dem Koran zu zitieren und fixierte mit lauerndem Blick sein Opfer. Der Flüchtling schaute sich verzweifelt zu den anderen um, alle wichen seinem Blick aus. Er kannte die arabischen Worte nicht, er konnte nicht die Eröffnungssure »Al-Fatiha« aus dem Koran rezitieren, denn er war Christ. Der Schleuser feuerte nur einen Schuss. Blut schoss aus der Kopfwunde des Flüchtlings, als er rückwärts über Bord ins Meer stürzte. »Allahu Akbar!«, sagte der Schleuser und richtete seine Waffe auf den nächsten Passagier.
Gleich würden die Schleuser auch vor ihm stehen, dachte der Mann. Sie würden ihn töten, so wie sie jetzt alle Christen auf diesem Boot töten und über Bord werfen würden. Der Mann flehte zu Gott, dass sie nur seine Frau nicht entdeckten. Dann stand der Schleuser vor ihm, sah ihm in die Augen und richtete den Lauf der Maschinenpistole auf seinen Kopf. Der Mann sah zum Himmel, wo jetzt die Sterne zu sehen waren, so endlos viele Sterne. Dann schloss er die Augen.
1. KAPITEL
21 Jahre später
Leon Ritter nahm die Abkürzung durch die Gärten. Er liebte den Weg zwischen den alten Mauern, wo sich die Smaragdeidechsen auf den Steinen sonnten. Es war erst März, aber trotzdem schon angenehm warm, und die Einheimischen prophezeiten einen heißen Sommer. Die ersten Touristen saßen vor den Cafés und Bistros in der Sonne. Alle Boutiquen, Souvenirshops und Restaurants hatten geöffnet. Die Saison begann vielversprechend, und trotzdem sahen die Bewohner von Le Lavandou argwöhnisch zum blassblauen provenzalischen Himmel hinauf. Es hatte seit Monaten nicht mehr geregnet. Und das Wetter, das die Feriengäste so genossen, bereitete den Menschen, die hier unten am Meer lebten, Sorge. Die Natur brauchte dringend Wasser.
Die Bäume hatten viel zu spät Blätter bekommen, und dort, wo um diese Zeit schon grüne Wiesen stehen sollten, war der Boden trocken und hart wie Beton. Die Oleandersträucher hatten bis jetzt nur vereinzelte Blüten getrieben, und bei den Mimosen, die um diese Zeit längst üppig blühen sollten, hatte es nur zu ein paar kleinen gelben Rispen gereicht. Es war eine Katastrophe. Schließlich begann die Saison jedes Jahr Ende März traditionell mit dem großen Blumenkorso. Ein überregionales Ereignis, zu dem viele Gäste erwartet wurden. Aber dieses Jahr stand es schlecht um das große Fest. Man würde die Blumen in Italien besorgen müssen, quel dommage! Nur der Ginster stand dicht und grün, und Leon musste sich bücken, wenn die Büsche mit den gelben Blüten von oben quer über seinen Weg wucherten.
Hinter den rotbraunen Dächern des kleinen Küstenortes glitzerte das Meer in der Morgensonne. Leon blieb einen Moment stehen, er atmete tief ein und hatte das Gefühl, dass er das Wasser riechen konnte. War er nicht genau deswegen hierhergekommen? Dr. Leon Ritter, erfolgreicher Rechtsmediziner an der Frankfurter Uniklinik, hatte eines Tages alles stehen und liegen lassen, um an die Klinik Saint-Sulpice zu wechseln. Ein Krankenhaus in der Provence, ausgerechnet. Nicht gerade das Sprungbrett zu einer großen Karriere. Doch für Leon war dieser Schritt viel mehr gewesen. Er war seine Rettung, sein Bruch mit der Vergangenheit, seine Flucht vor den schlimmen Erinnerungen, die ihn fast um den Verstand gebracht hatten.
Einige seiner Kollegen an der Uniklinik in Frankfurt hatten ihn gewarnt, er würde sich zu Tode langweilen – sie hatten keine Ahnung. Leon, Sohn eines deutschen Vaters und einer französischen Mutter, genoss das ruhige Leben des Südens. Beim Spaziergang durch die Gärten, dem morgendlichen Café Crème im Bistro, dem unvergleichlichen Blick über das Meer und zu den Inseln wusste Leon, dass er genau richtig entschieden hatte.
Heute war Samstag, und Leon nutzte den freien Tag, um sich im Maison de la Presse die Frankfurter Allgemeine und den lokalen Var-Matin zu kaufen. Zehn Minuten später hatte er sich in seinem Lieblingscafé niedergelassen. Das Chez Miou lag direkt am Bouleplatz. Unmittelbar dahinter führte die Uferpromenade vorbei, und danach kam nur noch die weitgeschwungene Bucht mit dem breiten Sandstrand, für den Le Lavandou so berühmt war.
Der Bouleplatz war das Informationszentrum des Ortes. Ob jemand schwanger, pleite oder krank war, die Spieler am Quai Gabriel Péri wussten immer zuerst Bescheid. Beim Boule wurde über die heimlichen Amouren des Bürgermeisters genauso offen diskutiert wie über die Wettleidenschaft des Apothekers oder das Alkoholproblem des Priesters. Hier am Bouleplatz gab es Ratschläge zu jeder Lebenslage, dazu noch Tipps für günstige Immobilien oder Handwerkerarbeiten, die natürlich nur schwarz vermittelt wurden. Ganz nebenbei gab es im Miou den besten Café Crème im Ort, und gelegentlich wurde auch Boule gespielt.
Leon hatte sich an einem der Tische unter den Platanen niedergelassen und die Zeitung aufgeschlagen. Yolande, die Frau von Jérémy, dem Besitzer des Miou, kam betont langsam zu Leon herüber. Dabei blieb sie zwischendurch stehen und tat so, als müsste sie sich ein paar Krümel von ihrem engen Strickjäckchen wischen, das sich gefährlich knapp über ihrer üppigen Oberweite spannte. Dabei achtete sie darauf, dass der Docteur aus Deutschland ihre Schokoladenseite zu sehen bekam.
»Bonjour, Docteur«, begrüßte Yolande ihren Gast.
»Bonjour, Madame«, antwortete Leon. »Einen Crème und ein Croissant, s’il vous plaît.«
»Sind Männer wirklich so verrückt?«, fragte Yolande und nickte in Richtung des Var-Matin, den Leon auf den Tisch gelegt hatte. Die Schlagzeile lautete: »Juge Lambert – sur la course d’un amour fou?« Der Richter, mit einer Geliebten durchgebrannt?
»Manche Frauen können Männer schon in Versuchung bringen«, antwortete Leon mit einem Lächeln. Und Yolande war nicht ganz sicher, ob das ein Kommentar zu Richter Lamberts vermeintlichem Seitensprung oder ein an sie gerichtetes Kompliment war.
Das Verschwinden von Richter Nicolas Lambert war seit Tagen Gesprächsthema Nummer eins in Le Lavandou. Der Jurist, der sich besonders für die Rechte von Flüchtlingen einsetzte, war vor fünf Tagen zu einem Vortrag an der Universität von Aix-en-Provence gefahren. Aber dort war er nie angekommen. Es fehlte jede Spur von ihm. Zunächst war ein Anschlag durch rechte Extremisten vermutet worden, aber entsprechende Bekennerschreiben blieben aus. Nicolas Lambert war am Nachmittag zu Hause aufgebrochen und seitdem verschwunden. Seine Frau hatte sich vor den neugierigen Reportern in ihre Villa am Meer zurückgezogen. Jetzt suchten die Journalisten verzweifelt nach Neuigkeiten zu diesem mysteriösen Fall. Vielleicht hatten sich deshalb in den letzten Tagen Hinweise verdichtet, die in eine ganz neue Richtung wiesen: Steckte der Richter in einer Midlife-Crisis und war mit einer Geliebten durchgebrannt?
»Un amour fou«, sagte Yolande und bekam einen verträumten Blick, »wie romantisch.«
»Unsinn, es geht um Sex. Es geht immer nur um Sex.« Véronique stand am Tresen und hielt einen Espressoin der Hand. Véronique war 83 Jahre alt und nach Meinung von Leon die beste Boulespielerin des Départements. In ihrem Mundwinkel glimmte die obligatorische Gauloise, die Véronique auch dann nicht ausmachte, wenn sie Jérémys Café betrat. »Mon Dieu«, sagte Véronique, »bei den Männern musst du doch nur die richtigen Knöpfe drücken, und schon verlieren sie den Verstand.«
»Drück mir bloß nicht auf meine Knöpfe«, rief Jean-Claude, der in seinem Rollstuhl durch den Eingang kam und in einer dramatischen Geste beide Hände hob.
»An alten Männern bin ich nicht interessiert«, sagte Véronique. »Das solltest du inzwischen wissen.«
»Vorsicht, Docteur, jetzt sind Sie dran«, rief Jérémy von der Bar her und stellte den Café Crème und den Teller mit dem Croissant auf die Theke. »Wenn sie so redet, ist sie auf Männerjagd.«
»Vielleicht sind die beiden ja in einem diskreten Hotel. Und sie lieben sich, Tag und Nacht.« Bei dieser romantischen Vorstellung seufzte Yolande tief.
»Jetzt krieg dich mal wieder ein«, Jérémy schob das Tablett vor seine Frau. »Und bring dem Docteur seinen Crème.«
»Was heißt diskretes Hotel?«, sagte Jean-Claude. »Diesen Lambert zeigen sie doch ständig im Fernsehen. Der kann sich nicht verstecken. Stimmt’s, Leon?«
»Ich würde ihm jedenfalls wünschen, dass er mit einer schönen Frau unterwegs ist.«
»Wirklich?«
»Unser Docteur ist ein Romantiker«, sagte Véronique zu Jean-Claude, »hast du das nicht gewusst?«
»Klingt nicht so, als würdest du an einen romantischen Liebesausflug glauben.« Jean-Claude versetzte seinem Rollstuhl einen Stoß und rollte näher an Leon heran.
»Ich versuche nur, mir nicht die Alternative vorstellen zu müssen«, sagte Leon, während Yolande ihm das Frühstück brachte.
»Was wäre denn die Alternative?«, fragte Yolande.
»Dass er bereits tot ist.«
In diesem Moment summte Leons Handy. Er klopfte auf die Taschen seines Leinensakkos, konnte das Gerät aber nicht ertasten. Dann sah er das Telefon unter der Zeitung auf dem Tisch liegen. Er warf einen Blick auf das Display. »Dr. Menez« stand da. Leon schaltete das Telefon ein.
»Ritter«, meldete sich Leon. Doktor Menez war der Leiter der Unfallchirurgie in Saint-Sulpice. Wenn der Arzt ihn an einem Samstagvormittag anrief, musste er gute Gründe haben.
»Tut mir leid, ich hoffe, ich habe Sie nicht gestört«, sagte Menez.
»Na ja«, sagte Leon. »Ich sitze gerade bei einem Café Crème in der Sonne am Meer und lese gemütlich meine Zeitung.«
»Ja, also …«, er räusperte sich. »Ich bin in der Klinik. Und es gibt da ein Problem, Docteur, bei dem ich Ihren fachlichen Rat brauchen könnte.«
»Am Telefon?«
»Nein, Sie müssten bitte hierherkommen.«
»Worum geht es denn?«
»Am besten, Sie machen sich selber ein Bild von der Patientin«, sagte Menez.
»Na gut. Ich kann in einer halben Stunde bei Ihnen sein«, sagte Leon und legte auf.
2. KAPITEL
»Was wissen die schon wieder, das wir nicht wissen, merde!«, Thierry Zerna knallte die Zeitung auf den Tisch. Der Chef der Gendarmerie Nationale sah lauernd in die Runde seiner Mitarbeiter. Betretenes Schweigen. Im engen Besprechungsraum war es heiß und stickig.
»Die Typen vom Var-Matin, die saugen sich so einen Scheiß aus den Fingern«, sagte Lieutenant Masclau. »Das bedeutet gar nichts.«
»Gar nichts? Ich bin heute Morgen um Viertel nach sieben vom Staatsanwalt angerufen worden. Der wollte den Namen der Geliebten von mir hören.« Zerna war sauer. Wenn es darum ging, die Lorbeeren zu kassieren, standen Kripo und Staatsanwaltschaft in Toulon immer in der ersten Reihe. Aber kaum gab es irgendein Problem bei den Ermittlungen, dann wurde die Gendarmerie Nationale dafür verantwortlich gemacht.
»Wir haben bereits mit allen in Frage kommenden Personen gesprochen«, sagte Lieutenant Begot. »Die Aussagen liegen Ihnen vor in den Anhängen 16, 25 und …«
»Ja, ja, ja«, unterbrach Zerna und winkte ärgerlich ab, »hab ich gelesen.«
Pascal Begot war ein unerträglicher Klugscheißer, der für drei Monate bei der Gendarmerie in Le Lavandou mitarbeitete. Ein Neffe des Kripochefs in Toulon, der Polizeiarbeit und polizeiliche Strukturen im »ländlichen Bereich« kennenlernen sollte, wie es in dem Schreiben an Zerna hieß. Im Klartext: Pascal Begot sollte sich ein paar schöne Wochen in Le Lavandou machen, bevor er von seinem Onkel auf eine prestigeträchtige Stelle bei der Kripo gesetzt wurde. Ein Punkt, der Commandant Zerna ganz besonders schmerzte, denn er spekulierte seit Jahren auf einen Job bei der Kriminalpolizei in Toulon, bisher vergeblich.
»Ein Tipp aus der Praxis, Lieutenant: Es gibt immer irgendwo irgendjemanden, mit dem man noch nicht gesprochen hat.« Zerna lächelte mit falscher Liebenswürdigkeit und sah seine Stellvertreterin Capitaine Isabelle Morell an, die neben ihm saß. Isabelle war eine attraktive Person. Ein Stückchen größer als Zerna, was der Polizeichef aber nicht als Hindernis ansah, im Gegenteil. Isabelle war dunkelhaarig und strahlte mit ihrem schmalen Gesicht und den hohen Wangenknochen eine gewisse Exotik aus. Und sie war geschieden. Aber dummerweise war sie an Zerna nicht im Geringsten interessiert.
Isabelle hatte längst bemerkt, wie bei Zerna die kleine Ader an der linken Schläfe anschwoll. Ein sicheres Zeichen dafür, dass einer seiner berüchtigten Wutanfälle bevorstand.
»Ich habe den Artikel auch gelesen, Patron. Reine Spekulation, wenn Sie mich fragen«, sagte sie.
»Und die Blumen?«, Zerna zog sich die Zeitung heran, die auf dem Besprechungstisch lag. »Hier«, er tippte auf den Artikel und las vor, »… erinnert sich Blumenhändlerin Monique Jospin (36), dem verschwundenen Richter zur fraglichen Zeit einen Strauß Mimosen verkauft zu haben …« Zerna sah seine Stellvertreterin vorwurfsvoll an und hielt die offenen Hände vor sich wie Christus vor seinen Jüngern. »Und wir, wir stehen da wie die Trottel.«
Commandant Thierry Zerna befürchtete ständig, dass er nicht mit dem angemessenen Respekt behandelt wurde, nicht von seinem Team und schon gar nicht von den Beamten der Kriminalpolizei in Toulon. Das lag nicht nur daran, dass er knapp 1,72 Meter groß war, was er durch Cowboystiefel mit besonders hohen Absätzen zu kompensieren versuchte. Zerna hatte einen Minderwertigkeitskomplex, gegen den er mit ständig neuen Bodybuilding-Programmen ankämpfte. Dass Isabelle seine Annährungsversuche geflissentlich übersah, nahm er inzwischen als Schicksal hin. Aber warum sie sich statt für ihn für diesen Rechtsmediziner aus Deutschland entschieden hatte, blieb ihm ein Rätsel.
»Ich habe bereits mit Madame Jospin telefoniert«, sagte Isabelle beschwichtigend. »Richter Lambert hat öfter Blumen bei ihr gekauft. Und die waren jedes Mal für seine Frau. Ob er allerdings an dem fraglichen Tag Blumen gekauft hat, daran konnte sie sich nicht mehr erinnern.«
»Hier erzählt sie aber was ganz anderes.« Zerna tippte ungeduldig auf den Artikel.
»Sie sagt, die Leute von der Zeitung hätten ihr das in den Mund gelegt«, antwortete Isabelle. »Auf der anderen Seite«, sie warf einen Blick auf das Foto in der Zeitung, »Richter Lambert ist ein attraktiver Mann und im besten Alter.«
»Was wollen Sie damit sagen?«, fragte Zerna.
»Es würde mich nicht überraschen, wenn er tatsächlich eine Geliebte hätte.«
»Na, sehr gut, dann finden Sie das heraus.« Zerna sah seine Mitarbeiter herausfordernd an.
»Zwischen hier und Aix liegen mehr als 100 Kilometer«, meinte Masclau.
»Genau 121 Kilometer«, korrigierte Begot, dessen Uniform aussah, als hätte er sie gerade aus der Reinigung geholt.
»Voilà, dann legen Sie gleich mal los, Begot«, sagte Zerna zu dem Praktikanten, der ihn irritiert ansah.
»Aber wie soll ich …«, Begot blickte hilflos zu Isabelle.
»Lambert fährt einen weißen BMW X4. Das ist ein ziemlich auffälliges Auto«, sagte die stellvertretende Polizeichefin. »Vielleicht steht der Wagen ja öfter vor einem fremden Haus und ist jemandem aufgefallen. Vielleicht hat Lambert mal ein Ticket wegen Falschparkens bekommen. Oder für zu schnelles Fahren. Wenn ja, wo war das? Alles könnte ein Hinweis sein.«
»Aber vielleicht steht Lambert ja auch am Montag wieder in Toulon im Gericht«, sagte Zerna, der es nicht schätzte, wenn jemand anderer als er selbst Ideen entwickelte. »Vielleicht hatte er ja einfach nur die Schnauze voll von Job und Familie und hat sich eine kurze Auszeit gegönnt.« Zerna sah in die Runde. »Dann möchte ich nicht zu denen gehören, die seine Geliebte haben auffliegen lassen.«
»Und wenn es doch eine Entführung war?«, fragte Isabelle.
»Bringen Sie mir einen Hinweis, dass wir es mit einem Verbrechen zu tun haben«, sagte Zerna, »und ich setze die ganze Kavallerie in Gang. Aber bis dahin bleiben wir diskret und ermitteln im Hintergrund. Genau so, wie das Justizministerium es wünscht. Sonst noch was?«
»Die Leute vom Festkomitee wollten mit uns die neue Route für den Umzug besprechen«, sagte Masclau.
»Bitte, Masclau, wir haben jetzt wirklich andere Probleme als den verdammten Blumenkorso«, blaffte Zerna.
Wenige Minuten später saß Isabelle in ihrem Büro. Es hatte sie einen Anruf bei der Gendarmerie Municipale gekostet, und sie wusste, dass sie bei der Idee mit den Strafzetteln nicht weiterkam. Nicolas Lambert schien nicht nur ein braver Familienvater, sondern auch ein vorbildlicher Verkehrsteilnehmer zu sein. Es gab nur einen einzigen Eintrag im Polizeicomputer: Der Richter hatte letztes Jahr vergessen, die obligatorische Versicherungsmarke hinter seine Windschutzscheibe zu kleben.
Es klopfte, und Moma stand schon in der Tür, bevor Isabelle »Entrez« gesagt hatte.
»Da will dich jemand sprechen. Hast du einen Moment?«, fragte er.
Lieutenant Mohammad Kadir, von allen Moma genannt, hatte algerische Eltern. Geboren war er allerdings in Marseille, und in seiner Seele war er französischer als die meisten Franzosen.
»Du weißt doch selber, was hier los ist«, sagte Isabelle.
Moma hielt die Tür nur einen Spaltbreit geöffnet und sah über seine Schulter, so als wollte er einen ungebetenen Gast zurückhalten.
»Madame Simon will dich sprechen, sie hat gesagt, es wäre dringend.«
»Ich weiß schon, der Blumenkorso«, seufzte Isabelle genervt. »Sag ihr, sie soll morgen früh vorbeikommen. So gegen neun Uhr.«
In diesem Moment drängte eine Frau an Moma vorbei, die sich ihre Sonnenbrille in die blonden Haare geschoben hatte. Josette Simon, Leiterin des Fremdenverkehrsamtes, war 34 Jahre alt und eine äußerst attraktive Erscheinung. Sie trug eine blassblaue Bluse, auf deren Brusttasche das Signet von Le Lavandou eingestickt war, die beiden Walfluken. Darüber hatte sie eine blaue Strickjacke gezogen. Der beigefarbene Rock und die Pumps zeigten den Geschmack einer Frau, die wusste, wie man sich elegant kleidete, ohne aufdringlich zu wirken.
»Verzeihen Sie bitte, wenn ich hier so hereinplatze, Capitaine Morell, aber ich würde Sie gerne sprechen.« Sie sah Isabelle an und machte eine kleine Bewegung mit den Augen in Richtung Moma. Ein kurzer Moment des Schweigens entstand, in dem die Besucherin ihren Mut zu verlieren schien. »Ich kann natürlich auch später … ich meine, wenn Sie jetzt keine Zeit …«
»Nein, bitte bleiben Sie«, Isabelle spürte sofort, dass es etwas gab, was die sonst so selbstbewusst auftretende Frau ernsthaft beunruhigte.
»Wollen Sie einen Kaffee, Madame Simon, ich brauche nämlich dringend einen.«
»Danke, gerne«, antwortete die Besucherin. »Sehr nett von Ihnen.«
»Könntest du uns bitte zwei Kaffee holen, Moma?«, sagte Isabelle.
»Versteh schon, geht klar.« Moma schloss die Tür und verschwand.
»Bitte«, sagte Isabelle und wies auf den Besucherstuhl. »Setzen Sie sich doch.«
»Es gibt da etwas, das ich Ihnen sagen möchte …« Madame Simon sah den Var-Matin auf Isabelles Schreibtisch liegen und zögerte. »Ich sehe, Sie haben die Zeitung schon gelesen.«
Isabelle beobachtete die Besucherin. Madame Simon hatte ihre Sonnenbrille abgenommen und hielt sie mit beiden Händen fest. Dabei wich sie Isabelles Blick aus.
»Hat es mit Monsieur Lambert zu tun?«, fragte Isabelle mit Blick zur Zeitung.
Josette Simon nickte, schwieg aber.
»Bitte, Madame Simon, wenn Sie irgendetwas wissen, das uns helfen kann?«
»Ich möchte auf keinen Fall, dass irgendjemand …« Sie unterbrach sich erneut.
»Wir behandeln alle Informationen mit absoluter Diskretion.«
»Monsieur Lambert und ich, wir …«, die blonde Frau räusperte sich und konnte nicht weitersprechen.
Isabelle sah ihre Besucherin an. In diesem Moment brachte Moma ein Tablett mit zwei Tassen Kaffee, das er vor Isabelle auf den Schreibtisch stellte.
»Danke, Moma«, sagte Isabelle, und der Lieutenant verließ den Raum. »Bitte, bedienen Sie sich.« Isabelle schob das Tablett zu ihrer Besucherin hin.
»Wie lange geht die Affäre mit Monsieur Lambert schon?«, fragte sie ganz unverblümt, als wäre das Verhältnis allgemein bekannt.
Madame Simon zuckte zusammen, als hätte sie ein kleiner Stromschlag getroffen. Sie sah einen Augenblick zur Tür, dann zurück zu Isabelle.
»Seit vergangenen Silvester«, sagte sie dann leise. »Seit dem großen Empfang im Rathaus.«
»Wann haben Sie den Richter zum letzten Mal gesehen?«
»Das war letzte Woche. Er schaute bei der Besprechung zum Blumenkorso bei mir vorbei. Nicolas, ich meine Monsieur Lambert, er ist mit im Förderverein.«
»Ja, ich weiß, ich habe Monsieur Lambert dort auch schon getroffen«, sagte Isabelle. »Und was war vergangenen Montag? Haben Sie ihn da auch gesehen?«
Madame Simon schüttelte den Kopf. »Er wollte mich eigentlich abholen. Wir wollten zusammen nach Aix fahren, am Nachmittag. Aber er ist nicht gekommen.«
»Und da haben Sie sich nicht gewundert?«
»Doch, natürlich. Aber ich dachte, dass es Probleme mit seiner Frau gegeben hat. Sie ist sehr eifersüchtig. Ich wollte ihn nicht noch zusätzlich in Schwierigkeiten bringen.«
»Sie haben ihn gar nicht angerufen?«
Madame Simon schien einen Moment mit der Antwort zu ringen. »Doch, einmal, das war so gegen 19 Uhr.«
»Ist er rangegangen?«, fragte Isabelle.
»Ich weiß es nicht«, sagte Josette Simon. Isabelle sah sie irritiert an. »Ich meine: Der Anruf wurde entgegengenommen, aber es hat sich niemand gemeldet.«
»Sind Sie sicher?«
»Ich habe gehört, wie jemand geatmet hat.« Sie sah Isabelle unglücklich an.
»Das war aber nicht alles, oder?«
Madame Simon zuckte hilflos mit den Schultern. »Ich glaube, ich habe noch etwas gehört. Es klang wie ein Stöhnen. So, als ob jemand große Schmerzen erleidet.«
Isabelle schaute die Frau prüfend an.
»Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Ich war aufgeregt, ich … Wem hätte ich denn davon erzählen sollen?« Die Besucherin klang verzweifelt.
»Ist schon in Ordnung, Madame. Jetzt haben Sie es ja mir gesagt. Aber Sie müssen das auch dem Staatsanwalt erzählen.«
»Nicolas hätte sich nie so einfach abgesetzt, wie die im Fernsehen behaupten. Er hat mir noch gesagt, dass er nicht viel Zeit hat, weil er am Montag einen dringenden Termin beim Staatsanwalt hat.«
Madame Simon schluchzte und vergrub ihr Gesicht in den Händen.
3. KAPITEL
Leon hatte nur zwanzig Minuten von Le Lavandou zur Klinik Saint-Sulpice bei Hyères gebraucht. Er stellte seinen dunkelblauen Peugeot Cabriolet Baujahr 1993 auf dem Parkplatz für die Mitarbeiter ab, wo der Klassiker zwischen all den brandneuen BMWs, Peugeots und Citroëns wie ein Denkmal aus einer anderen Zeit wirkte.
Leon lief zum Haupteingang der Klinik, die erst vor wenigen Jahren durch einen modernen Anbau vergrößert worden war. Dabei hatte Klinikchef Dr. Hugo Bayet nicht nur auf einem Hubschrauberlandeplatz für Notfallpatienten, sondern auch auf einer eigenen Rechtsmedizin bestanden. Normalerweise leisteten sich nur große städtische Kliniken, die mit Universitäten verbunden waren, solche Abteilungen. Aber Dr. Bayet verfügte über ausgezeichnete Kontakte zum Präfekten des Départements und über noch bessere Kontakte nach Paris. Und eine eigene rechtsmedizinische Abteilung, so hatte Dr. Bayet gehofft, dazu noch unter der Leitung eines renommierten Pathologen, würde ihn seinem Traum von einem Lehrstuhl an der Medizinischen Universität von Marseille näherbringen. Doch der Klinikleiter wartete noch immer auf seine Professur. Was unter anderem daran lag, dass Dr. Leon Ritter äußerst eigenwillige Methoden an den Tag legte, wenn es um die Forensik ging. Dabei schreckte der Rechtsmediziner aus Deutschland auch nicht davor zurück, sich mit der einflussreichen Staatsanwaltschaft von Toulon anzulegen.
Leon ging auf den gläsernen Eingang der Klinik zu. Um diese Jahreszeit war es noch ruhig in Saint-Sulpice, und auch für den Médecin Légiste, den Rechtsmediziner, gab es nicht viel zu tun. Das würde sich in den kommenden Monaten ändern, wenn Le Lavandou und Umgebung von Tausenden von Touristen gestürmt wurde. Dann nahm auch die Zahl der tödlichen Autounfälle wieder zu, oder die Besucher brachten sich durch Leichtsinn, Alkohol oder einfach nur durch eine ungesunde Lebensweise um.
Schwester Monique kam Leon bereits entgegen, als er die Eingangshalle der Klinik betrat.
»Bonjour, Docteur«, sagte sie aufgekratzt, denn sie verehrte den Arzt aus Deutschland, was sie aber niemals zugegeben hätte. »Dr. Menez erwartet Sie oben auf der Unfallstation. Er hat schon dreimal angerufen.«
»Dann muss ich mich wohl beeilen, damit ich keinen Ärger bekomme.« Leon lächelte Monique an.
»Aber Docteur, er wartet bestimmt gerne auf Sie!« Sie sah ihren Lieblingsarzt mit verschwörerischer Miene an. »Es geht um eine Patientin. Sie wurde überfallen. Schlimm.«
»Wie immer hervorragend informiert, Schwester Monique«, sagte Leon.
»Die Treppe wird heute abgeschliffen. Sie müssen also den Lift nehmen oder über das Rückgebäude nach oben gehen.«
Leon nahm immer die Treppe. Er redete sich ein, dass er auf diese Weise etwas für seine Kondition tat. In Wirklichkeit hasste er enge, geschlossene Räume. Und mit anderen Menschen dicht an dicht in einer Sardinenbüchse zu stehen und auf die Stockwerksanzeige zu glotzen, war für ihn ein Alptraum. Aber heute war die Klinik kaum besucht, und der Lift wartete einladend, leer und mit geöffneten Türen. Leon stieg ein und drückte auf den Knopf für die vierte Etage, als sich noch eine Klinikmitarbeiterin hineindrängte.
»Bonjour, Docteur«, sagte die Frau höflich, die eine orangefarbene Signalweste über der weißen Klinikkleidung trug.
Leon war der Frau schon ein paarmal begegnet. Carole Abadie war eine etwas ruppige, aber freundliche Unfallsanitäterin, die den Krankenwagen fuhr. Gelegentlich war sie auch schon in der Rechtsmedizin vorbeigekommen. Sie trug ihr Haar kurz geschnitten und leuchtend rot gefärbt, was in einem irritierenden Kontrast zur Farbe der Signalweste stand.
Die Türen schlossen sich, und der Aufzug summte nach oben. Zwei Personen hatten reichlich Platz in dem Lift, trotzdem fühlte Leon sich beengt. In diesem Moment ruckelte die Kabine und blieb stehen. Auf der Anzeige leuchtete die »3«, aber die Türen blieben geschlossen.
Die Panik kam ganz plötzlich und überrollte Leon wie eine dunkle Welle. Er ballte die Hände zu Fäusten und versuchte, jeden Gedanken über seine Situation zu verdrängen: Das war ein ganz normaler Lift, gleich würde sich die Tür öffnen, und sie wären da. Nein, sagte eine andere Stimme in ihm, wir hängen fest, und keiner kann uns helfen. Und wenn die Bremsen nicht halten, dann geht es gleich fünfzehn Meter nach unten. Leon spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach. Madame Abadie sah besorgt in seine Richtung.
»Es geht bestimmt gleich weiter. Das sind nur die Leute von der Inspektion, die überprüfen die Funktionen«, versuchte sie, Leon zu beruhigen.
Leon winkte ab. In diesem Moment war er nicht in der Stimmung für Small Talk. Er war mit dem Bekämpfen seiner Panik beschäftigt.
»Sie müssen schön atmen«, sagte die Frau im leutseligen Tonfall aller Krankenschwestern. »Ruhig und gleichmäßig atmen: ein und wieder aus.«
»Danke, ich bin selber Arzt«, presste Leon heraus, und es klang ruppiger, als er beabsichtigt hatte.
Madame Abadie sah betreten zu Boden. Leon musste sich festhalten. Er merkte, wie ihm schwindlig wurde. Gleich würde er in diesem Lift, vor dieser Schwester ohnmächtig zusammensinken. Die gesamte Klinik würde darüber reden.
»Nimm dich zusammen«, beschwor sich Leon. »Das ist nur ein Lift. Immer schön ein- und ausatmen.«
In diesem Moment tat es einen Ruck, und die Kabine fuhr wieder an. Leon spürte, wie ihn die Angst verließ. Sekunden später öffneten sich die Türen im vierten Stock. Erleichtert ging Leon zum Ärztezimmer, wo ihn Dr. Menez erwartete.
»Bonjour, Docteur«, sagte Leon.
»Danke, dass Sie kommen konnten«, antwortete Dr. Menez. »Die Patientin heißt Nathalie Leclerc, ist 25 und kam heute Nacht hierher. Ein Mann hat sie mit einem Messer verletzt und versucht, sie zu vergewaltigen. Sie ist noch ziemlich traumatisiert.«
»Liegt sie hier auf der Station?«, fragte Leon.
»Gleich vorne im Gang links«, antwortete Dr. Menez. Er deutete auf den Tisch, auf dem ein frischgebügelter Ärztekittel lag. »Ich denke, das ist Ihre Größe.«
Ein paar Minuten später stand Leon, zusammen mit Dr. Menez und einer Schwester, im Zimmer von Nathalie Leclerc. Die blonde junge Frau lag im Bett. Leon fiel auf, wie attraktiv die Patientin war, obwohl sie in diesem Moment erschöpft wirkte. Sie hatte Schatten unter den Augen, und Leon konnte am ausgeprägten Ellenbogen und den schmalen Schultern erkennen, dass sie untergewichtig war. Vielleicht magersüchtig, dachte er. Von dem Infusionstropf führte ein Schlauch zu einem Zugang im rechten Arm.
»Das ist der Kollege von der Rechtsmedizin, von dem ich erzählt habe. Er würde sich jetzt gerne Ihre Verletzungen ansehen, wegen der Anzeige«, klärte Dr. Menez seine Patientin auf.
»Natürlich nur, wenn Sie damit einverstanden sind«, ergänzte Leon.
Die junge Frau nickte. »Er hat mich geschnitten, mit einem Messer«, sagte sie leise, und bei der Erinnerung lief eine Träne aus ihrem Auge. »Es war … es war schlimm.«
»Diese Schnitte würde ich mir gerne ansehen«, sagte Leon freundlich. »Ist das in Ordnung?«
Die junge Frau nickte. »Ja«, sagte sie mit einer Stimme, in der man die Tränen hören konnte. »Es ist an den Beinen und an meinem Arm. Hier …« Als sie mit der rechten Hand den Ärmel ihres Klinikkittels hochschieben wollte, stoppte die Infusionsleitung ihre Bewegung.
»Lassen Sie nur, wir machen das schon«, sagte Leon und schob den Ärmel herauf. »Helfen Sie mir bitte mal«, wandte er sich an die Schwester.
Am Oberarm waren ein Hämatom zu sehen und drei Schnitte. Leon fiel auf, dass die Wunden nicht tief waren. Vielleicht hatte der Täter unter Stress gestanden, oder er wollte die Frau mit den Schnitten nur gefügig machen. Aber warum hatte er sie dann nicht vergewaltigt?
Die beiden Schnitte an den Innenseiten des linken Oberschenkels waren tiefer als die am Arm. Auch hier gab es blaue Flecken wie von Schlägen. Und auch hier hatte die Klinge die Epidermis nicht vollständig durchdrungen. Die Wundränder waren glatt, gerade und gleichmäßig. Ein Zeichen, dass der Täter ein sehr scharfes Messer benutzt haben musste, dachte Leon. Scharf und kurz, vielleicht ein Teppichmesser.
»Haben Sie das Messer sehen können?«, fragte er die Patientin.
»Nein, es war ja dunkel. Ich habe nur seine Augen gesehen, als er mich durch diese Maske angeschaut hat.«
»Er trug eine Maske?«
»Ja, so ein schwarzes Ding, wie in den Filmen.«
»Haben Sie sich gewehrt?«, fragte Leon.
Sie wich seinem Blick aus und schüttelte den Kopf. »Es ging alles so schnell. Er hat mich von hinten gepackt und auf den Boden gezogen. Dann hat er gedroht, dass er mich umbringt, wenn ich nicht mit ihm …« Sie presste die Lippen zusammen, und wieder quollen ihr Tränen aus den Augen.
»Schon gut«, sagte Leon und inspizierte den Oberschenkel.
»Ich hab die Augen zugemacht und gebetet, dass es schnell vorbeigeht. Ich hatte wahnsinnige Angst«, sagte die Frau. »Darum habe ich mich nicht gewehrt.«
»Sie müssen sich nicht entschuldigen. Sie haben alles richtig gemacht«, beruhigte Leon die junge Patientin. Dann nahm er die Lupe, die Dr. Menez ihm reichte. Die Verletzungen am rechten Oberschenkel waren nur oberflächlich und sahen eher wie zwei Kratzer aus. Auf dieser Seite gab es auch keine blauen Flecken. Leon nickte seinem Kollegen zu.
»Sie können sie jetzt wieder verbinden«, sagte Dr. Menez zu der Schwester.
»Bitte warten Sie noch mit dem Verbinden«, sagte Leon zur Schwester. »Wir müssten die Verletzungen gleich noch mit der Kamera dokumentieren, und wir werden versuchen, DNA-Spuren zu sichern.«
»Ja natürlich«, sagte die Schwester.
»Muss das genäht werden?« Die junge Frau klang ängstlich.
»Nur der eine Schnitt am linken Oberschenkel«, antwortete Dr. Menez. »Das sind aber nur zwei kleine Stiche. Wir betäuben das vorher. Da werden Sie überhaupt nichts spüren. Die anderen Verletzungen sind zum Glück nicht so tief. Die können wir mit einem speziellen Pflaster kleben.« Dr. Menez zog die Decke wieder über die Beine der Patientin. »Und seien Sie unbesorgt. Es werden keine Narben zurückbleiben.«
»Wie hat er Sie festgehalten?«, fragte Leon die junge Frau.
»Was, was meinen Sie?« Sie klang überrascht.
»Der Täter. Sie haben doch gesagt, er hätte Sie zu Boden gerissen. Wie hat er Sie dann festgehalten?«
Die junge Frau zögerte einen Moment. Die Frage schien sie zu verunsichern. »Na ja, mit den Händen, das heißt …«, sie überlegte einen Moment. »Er hat mich auf den Rücken geworfen, und dann hat er sich auf mich gesetzt und mich festgehalten. Also mit der einen Hand, in der anderen hatte er ja das Messer.«
»Warum hat der Mann aufgehört?«, fragte Leon.
»Ich verstehe nicht«, antwortete die Frau.
»Sie sagten, er wollte Sie vergewaltigen, aber dann sei er weggelaufen, oder?« Leon sah die Patientin an. Sie wirkte jetzt verunsichert. Hatte seine einfache Frage sie aus dem Konzept gebracht, oder hatte sie ihnen nicht die ganze Geschichte erzählt?
»Warum ist der Täter weggelaufen?«, fragte Leon erneut.
»Da kam ein Auto. Es hat ganz in der Nähe gehalten, und es waren auch Stimmen zu hören. Da ist er plötzlich aufgestanden und weggelaufen.«
»Dann hatten Sie aber wirklich Glück«, sagte Leon. »So, das war’s schon.« Er hielt der Patientin die Hand hin.
»Vielen, vielen Dank, Docteur«, sagte die junge Frau und hielt Leons Hand länger, als es notwendig gewesen wäre.
»Sie sollten sich in den nächsten Tagen ausruhen. Besser, Sie sind nicht alleine.« Leon wechselte einen kurzen Blick mit Dr. Menez.
»Ich wohne zurzeit bei meiner Mutter. Sie hat eine Villa bei Cavalière, gleich am Meer.«
»Das ist bestimmt ein guter Platz, um sich zu erholen«, sagte Leon. »Passen Sie gut auf sich auf.«
»Nathalie«, sagte sie. »Ich heiße Nathalie.«
»Wiedersehen, Nathalie«, sagte Leon und dann zu Dr. Menez: »Von mir aus können wir.«
»Ich schaue in einer Viertelstunde noch einmal nach Ihnen«, sagte Dr. Menez zu der Patientin. »Bis dahin ist die Infusion durch.«
Die Ärzte gingen zusammen den Flur hinauf. Dann blieb Dr. Menez stehen.
»Also, was denken Sie?«
»Ich denke, dass wir keine Spuren von dem Unbekannten mit dem Messer finden.«
»Sie haben Zweifel an der Geschichte?«
»Schwer zu sagen. Aber sie hat sich auf keinen Fall so zugetragen, wie sie es beschrieben hat.«
»Aber die Patientin hat Schnittverletzungen. Und sie ist eindeutig traumatisiert. Und die Hämatome an Armen und Beinen sind doch eindeutig.«
»Da kann sie sich auch irgendwo gestoßen haben. Magersüchtige Menschen ziehen sich schneller Hämatome zu als normalgewichtige. Das liegt am Mangel an Unterhautfett, die feinen Blutgefäße werden leichter gequetscht.«
»Wir wissen nicht, ob sie unter Essstörungen leidet.«
»Ist nur so ein Gefühl«, sagte Leon. »Ist Ihnen die Richtung der Schnitte aufgefallen?«, fragte Leon.
»Was meinen Sie?«
»Am linken Arm: Das Messer wurde seitlich, außen angesetzt und dann nach innen gezogen. Genauso am linken Bein. Kleine Schnitte, nicht besonders tief.«
»Und was schließen Sie daraus?«
»Es sind genau die Stellen, die man erreichen würde, wenn man ein kurzes, scharfes Messer in seiner rechten Hand hielte.«
»Sie meinen, sie hat sich selber verletzt?«, fragte Dr. Menez.
»Ich glaube nur nicht an den großen Unbekannten mit dem Messer«, sagte Leon. »Ich werde mir später noch die Fotos ansehen.«
»Welche Frau würde sich mit dem Messer verletzen und erzählen, dass sie beinahe vergewaltigt worden ist?«
»Eine Frau mit einer verletzten Persönlichkeit. Eine Frau, die auf sich aufmerksam machen will, die psychische Probleme hat.«
4. KAPITEL
Der Mann weinte. Nicht wegen der Schmerzen. Die Schmerzen machten ihn zwar beinahe wahnsinnig, aber sie bewiesen ihm auch, dass er noch lebte. Dass dies kein böser Traum war und dass dies auch nicht der Hades war, das Schattenreich tief unter der Erde, vor dem er sich als Kind immer gefürchtet hatte. Nein, er weinte wegen der Demütigung, die er in den letzten Tagen erfahren hatte. Wegen seiner absoluten Hilflosigkeit. Und weil dieser Teufel ihn an den Abgrund geführt hatte. Dorthin, wo er dachte, dass sich seine Seele befände. Aber da war nichts, nur schwarze Leere.
Und dann war da sein Körper, der ihn so jämmerlich im Stich gelassen hatte. Sein Körper, auf den er immer stolz gewesen war. Den er konsequent trainiert hatte, egal, wie sehr ihn sein Job als Richter forderte. Jeden Morgen zwanzig Minuten Joggen oder Schwimmen im Meer, je nach Jahreszeit. Das war sein eisernes Programm. Wenn er früher Zeitungsberichte gelesen hatte über Guantanamo oder die Kerker arabischer Terroristen, hatte er sich oft gefragt, wie es wohl wäre, gefoltert zu werden. Könnte man das aushalten? Könnte man seine Peiniger dadurch besänftigen, dass man ihnen freiwillig alles sagte, was sie hören wollten? Wäre man bereit, Frau und Kinder zu verraten, nur damit die Folterknechte von einem abließen? Oder würde man auf den Knien um Gnade flehen und ihnen Geld anbieten? Aber so war es nicht. Der Mann hatte die bittere Erfahrung gemacht, dass sein Körper die entsetzlichen Torturen durchstand. Als würde der Überlebenswille gegen all die Grausamkeiten, die Schmerzen und Demütigungen immer wieder neu aufstehen. Ihn aus der Ohnmacht reißen, ihn zum Überleben zwingen.
Der Mann versuchte, ganz ruhig dazuliegen, auch die kleinste Bewegung jagte einen stechenden Schmerz durch seinen Körper. Wenn er die Augen öffnete, konnte er die verrosteten Rohre und den verbeulten Kupferkessel sehen. Aus den Rissen der schmutzigen Betonwand wucherte schwarzer Schimmel. Davor stand der Stuhl mit den Kabeln und den Metallklemmen, durch die der Teufel den Strom gejagt hatte. Das war der Moment gewesen, in dem er gedacht hatte, es wäre vorbei, als er geglaubt hatte, er würde sterben. Es war der Moment, als er nur noch schreien konnte und sehnsüchtig auf seinen Tod gewartet hatte. Als er gelernt hatte, dass er kein Held war. Er musste an die Actionfilme denken, die er so liebte. An den Moment, wenn man aus dem Kino kam und sich fühlte, als hätte man selber gerade die Welt gerettet, als wäre man stark und unverletzlich. An Augenblicke, in denen er sicher gewesen war, egal, wie sehr die Bösen einem zusetzten, niemals könnten sie seinen Stolz und seinen Willen brechen. Diesen innersten Kern, der die ganze Existenz zusammenhielt, das unspaltbare Atom der Seele.
Da hatte er sich noch eingebildet, dass er irgendwie durchkommen würde. Dass die Tortur irgendwann ein Ende fände. Dass er eines Tages wieder am Strand stehen würde und den Sand und das schäumende Meerwasser unter den Füßen fühlen könnte. Dass die Brüche und Wunden verheilen würden. Dass die Quetschungen abschwellen würden und die Verbrennungen eines Tages wieder verschwunden wären. Er hatte sein Geheimnis nicht preisgegeben. Aber dann hatte der Teufel den Schmerz tief in seinen Körper hineingetragen. Er hatte in ihm gewütet und getobt. Hatte ihn entlanggeschickt auf dem schmalen Grat zwischen unerträglicher Qual und erlösendem Tod, wie auf einer Rasierklinge.
In diesem Moment hatte der Mann gewusst, dass er dem Schmerz nichts mehr entgegensetzen konnte. Er hatte sich bepisst, und Kot war ihm die Beine hinuntergelaufen und an seinem Körper festgetrocknet. In diesem Moment hatte der Mann zum ersten Mal geweint. Weil er wusste, dass jetzt die ganze Wahrheit aus ihm hervorbrechen würde, die er ein halbes Leben lang so gut verborgen hatte. Tief in sich eingeschlossen, ein allerletztes Geheimnis. Aber der Teufel würde diese Wahrheit aus ihm herausreißen. Der Teufel konnte tun, was er wollte. Der Teufel hatte seine Seele zerbrochen. In diesem Moment hatte der Mann aufgegeben und alles erzählt. In diesem Moment war dem Mann nichts mehr geblieben, nicht einmal seine Erinnerungen. In diesem Moment hatte er nur noch sterben wollen.
5. KAPITEL
Leon fuhr entspannt über die Route du Vin, die Département-Straße zwischen La Londe und Cabasson, die sich in engen Kurven durch die Weingüter schlängelte. Er hätte auch die Schnellstraße nehmen können, auf der man Le Lavandou in der halben Zeit erreichte, aber schließlich war Samstag, und er wollte sich ein wenig vom verdienten Feriengefühl gönnen. Außerdem konnte er so am Château Léoube haltmachen und Isabelle eine Kiste Rosé mitbringen. Der »Secret« vom Weingut Léoube war unvergleichlich, fand Leon, zartrosa wie der Himmel über der Provence kurz vor Sonnenaufgang. Im Geschmack erinnerte der Wein an exotische Früchte, und wenn man an ihm roch, meinte man, die warme Frühlingsbrise zu spüren, die vom Meer herüberwehte.
An der Abzweigung zum Weingut hielt Leon an und stellte den Motor ab. Er hatte das Dach geöffnet und konnte jetzt den Wind in den Ästen der Pinien rauschen hören. Die Luft roch frisch und würzig. Der Blick über das Weingut von Léoube auf das glitzernde Meer versetzte Leon in beste Laune. Er verschränkte die Hände hinter dem Kopf, lehnte sich zurück und genoss für einen herrlichen Moment die warme Frühlingssonne im Gesicht. Leon lächelte, genau so hatte er sich den Job des Rechtsmediziners in der Provence vorgestellt.
Leon hatte seinen unvorhergesehenen Besuch in der Klinik genutzt, um noch etwas Büroarbeit zu erledigen. Die Abteilung für Rechtsmedizin war von Anfang an unterbesetzt gewesen. Leon hatte schon vor Monaten beantragt, noch eine weitere Assistentenstelle zu schaffen, aber die Klinikleitung hatte abgelehnt. Die Mittel waren knapp und mussten anderweitig eingesetzt werden. So stapelten sich während der Woche Gutachten und Laborberichte auf Leons Schreibtisch, die er an seinen freien Wochenenden abarbeiten musste. Als er nach vier Stunden im Büro zurück zu seinem Auto kam, entdeckte er einen Zettel, den jemand unter seinen Scheibenwischer geklemmt hatte. Darauf stand eine Telefonnummer. Daneben war ein Herz gezeichnet, und darunter stand: Appelez-moi!
Wer war die geheimnisvolle Unbekannte, die darum bat, angerufen zu werden?, fragte sich Leon. Vielleicht die neue Anästhesistin, der er vor einigen Tagen in der Kantine einen Kaffee spendiert hatte? Weil man sich mit ihr so interessant über Klöster und Kirchen der Provence unterhalten konnte. Hatte sie ihn beim Abschied nicht auf diese besondere Weise angelächelt, wie es nur Frauen konnten? Mit diesem Lächeln, bei dem man nie genau wusste, ob es tatsächlich etwas bedeutete. Aber bei dem man sich so vieles vorstellen konnte. Eine attraktive Person, diese Anästhesistin, das musste Leon zugeben. Aber würde die Kollegin wirklich neben ihre Telefonnummer ein Herzchen auf einen Zettel malen?
Leon musste lächeln. Er benahm sich, als wäre er zwanzig. Dabei lebte er in einer festen Beziehung, und Isabelle war eine wunderbare Frau. Aber sie forderte ihn gelegentlich auch heraus. Dafür bewunderte er sie – meistens jedenfalls. Im Grunde genommen waren sie beide so unterschiedlich, wie man nur sein konnte. Da war auf der einen Seite die zupackende, agile Stellvertretende Polizeichefin, die sich seit ihrer Scheidung vor einigen Jahren alleine um ihre halbwüchsige Tochter kümmerte. Und dann gab es ihn, den Rechtsmediziner. Leon ging die Dinge gerne ruhig an. Er beobachtete und machte sich ein genaues Bild, bevor er eine Entscheidung fällte. Er wusste, dass diese Eigenschaft Außenstehenden etwas schrullig erschien. Aber wenn er sich erst einmal auf eine bestimmte Richtung festgelegt hatte, dann blieb er auch auf seinem Weg, egal, was die anderen sagten. Und der Erfolg seiner Methode gab ihm recht.
Nach dem Unfall seiner Frau vor sechs Jahren war Leon in ein schwarzes Loch gestürzt. Lange wollte er ihren Tod nicht akzeptieren, arbeitete bis zum Umfallen, nur um nicht an sie denken zu müssen, und wäre beinahe an dem Verlust zerbrochen. Bis er eines Tages beschlossen hatte, neu anzufangen, sich neuen Herausforderungen zu stellen und die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Als er den Job in der Klinik Saint-Sulpice angeboten bekam, betrachtete er das als Wink des Schicksals und akzeptierte sofort. Aber ganz so leicht wurde er die Vergangenheit nicht los. Es kostete ihn viel Kraft zu vergessen – bis er Isabelle begegnete. Und schließlich war er mit ihr zusammengezogen. Inzwischen verbrachten sie die Woche in Isabelles Haus in Le Lavandou und die Wochenenden in dem romantischen Bauernhaus, das Leon von seiner Tante übernommen hatte. Er hatte es liebevoll restauriert und in ein wahres refuge romantique verwandelt. Ein kleines Paradies mit eigenem Weinberg, keine fünfzehn Kilometer von der Küste entfernt, inmitten der Hügel der Provence.
Warum hatte er also den Zettel nicht einfach weggeworfen?, dachte Leon. Er war ein glücklicher Mann und bestimmt nicht auf der Suche nach Abenteuern. Oder vielleicht doch? Wenn er ganz ehrlich mit sich war: Wann hatte ihm zum letzten Mal eine Frau einen Zettel mit ihrer Telefonnummer unter den Scheibenwischer geklemmt? Es fühlte sich gut an, ein schmeichelhaftes Kompliment. Leon beschloss, den Zettel noch eine Weile zu behalten, einfach so. Er drehte das Radio lauter. Auf seinem Lieblingssender Nostalgie sang Michel Sardou »La maladie d’amour«.
Isabelles Haus lag an einem Hang oberhalb des Ortskerns. Leon hatte sich beeilt, nach Hause zu kommen, denn er hatte Isabelle versprochen, sie zur Party anlässlich des bevorstehenden Blumenkorsos zu begleiten. Wie jedes Jahr fand die Einladung zwei Wochen vor dem Umzug in der Villa der Sorels statt. Diese Einladung war mit Abstand das wichtigste gesellschaftliche Ereignis in Le Lavandou, und wer geladen war, gehörte definitiv dazu. André Sorel war Philosophie-Professor an der Sorbonne und pendelte ständig zwischen Paris und Le Lavandou hin und her. Er wurde allgemein bewundert, umso mehr, seit er vor einigen Jahren Mitglied in der hochangesehenen Académie française geworden war. Die erlauchte Gesellschaft galt traditionell als Olymp der französischen Intellektuellen. Und die Zahl ihrer Mitglieder war auf vierzig begrenzt. In den Kreis der »Unsterblichen«, wie sich die »Académiciens« selber nannten, konnte nur jemand aufsteigen, wenn zuvor ein anderes Mitglied verstorben war. Da hatte Professor Sorel Glück gehabt, denn er war erst 42, als ihm die große Ehre widerfuhr. Auf diese Weise würde er dieses Privileg noch einige Jahrzehnte genießen können. Die Tatsache, dass die Party bei den Sorels stattfand, hatten die Gäste allerdings der Frau des Professors zu verdanken. Emilie Sorel war nicht nur eine emsige Unterstützerin diverser Charity-Events, sondern auch Erbin eines Cognac-Imperiums und damit wichtigste Sponsorin des jährlichen Blumenkorsos. Was den Stadtrat aber nicht davon abhielt, sich regelmäßig beim Professor für die Zuwendungen zu bedanken.
Leon hasste große Feste. Sie waren laut und bevölkert von Menschen, die er nicht kannte. Außerdem gab es Drinks, die ihm Kopfweh bereiteten, einfallslose Häppchen und belanglosen Small Talk. Leon bevorzugte die Ruhe auf der heimischen Terrasse mit einem guten Glas Wein und einem anregenden Gespräch. Aber dafür hatten die Partys auch ihre erfreulichen Momente. Zum Beispiel, wenn betrunkene Millionärsgattinnen in den Pool stürzten und vom peinlich berührten Ehemann geborgen werden mussten – eine Art von Entgleisung, die offenbar zu jeder gelungenen Party an der Küste gehörte. Manchmal eskalierte die Sache auch, so wie im letzten Jahr, als sich der Landschaftsgärtner der Sorels mit der Gattin des Optikers in einem der Gästezimmer vergnügte. Dummerweise war dem Ehemann der Flirt seiner jungen Frau nicht entgangen, und er erwischte die beiden in flagranti, so dass der Gärtner nur mit einem Handtuch bekleidet von der Party flüchten musste. Ein Zwischenfall, der nicht nur den Blumenkorso um eine weitere Legende bereicherte, sondern auch in Cafés und Bistros von Le Lavandou das ganze folgende Jahr für dauerhaften Gesprächsstoff sorgte.
Isabelle hatte Leon darum gebeten, auf das Fest mitzukommen. Er war schließlich kein Einheimischer, hatte sie ihn erinnert, und darum könne er auch nicht beurteilen, was für eine Auszeichnung es war, von den Sorels eingeladen zu werden. Leon war es zwar völlig egal, wie die Sorels seinen gesellschaftlichen Status einschätzten, aber um Isabelle einen Gefallen zu tun, hatte er schließlich zugestimmt. Er würde also seinen Anzug anziehen, und irgendwo zwischen seinen Sachen musste auch noch die seidene Krawatte sein, ein Erbstück seines verstorbenen Vaters.
Als Leon die Haustür öffnete, wartete Isabelle bereits im dunkelblauen Kleid mit den weißen Punkten auf ihn.
»Ich dachte schon, du kommst nicht«, sagte sie. »Wir müssen in einer halben Stunde bei den Sorels sein.«
»Du hast gesagt, das wäre eine Riesenparty. Da merkt doch kein Mensch, wann wir kommen.«
»Wenn man bei den Sorels eingeladen ist, kommt man nicht zu spät«, sagte Isabelle in übertriebenem Lehrerinnen-Ton.
»Ich bin der schrullige Doktor aus Deutschland. Die Menschen erwarten von mir, dass ich zu spät komme. Das gehört zu meinem Image.« Leon lächelte sie an, während er immer noch die Weinkiste zwischen den Händen hielt. »Ich habe uns was mitgebracht.«
Isabelle warf einen Blick auf die Kiste. »Château Léoube, du bist ein Schatz!« Sie gab ihm einen Kuss auf den Mund. »Und jetzt zieh dich um.«
»Gibt es etwas Neues vom liebestollen Richter?«, fragte Leon, während er die Weinkiste in die Küche trug.
Isabelle war ihm gefolgt. »Heute ist eine Frau bei mir im Büro aufgetaucht. Sie hat behauptet, sie sei die Geliebte von Lambert.«
»Wirklich? Glaubst du ihr?«
Isabelle nickte.
»Jemand, den ich kenne?«
»Du weißt, dass ich darüber nicht sprechen kann …«
»Natürlich nicht«, sagte Leon ernst. »Ich dachte, du erzählst mir davon, weil du meine Meinung hören willst.«
»Josette Simon«, sagte Isabelle etwas zu bereitwillig.
»Die wilde Blonde vom Fremdenverkehrsamt?«
»Sie ist Head of Communication«, betonte Isabelle den pompösen Titel.
»Und sie ist außerdem ziemlich sexy.«
»Ach, das ist dir also schon aufgefallen?«
»Er hat Geschmack, der Herr Richter«, erwiderte Leon lächelnd.
»Du bist unmöglich. Ich hätte es dir nicht erzählen sollen.«
»Offenbar hat er sich nicht bei ihr versteckt?« Das war weniger eine Frage als eine Feststellung von Leon.
»Lambert wollte sie an diesem Tag abholen. Sie wollten zusammen nach Aix-en-Provence.«
»Wie romantisch. Lass mich raten: Er ist nicht aufgetaucht, und gemeldet hat er sich seitdem auch nicht mehr«, sagte Leon und sah Isabelle an. »Du weißt, was das bedeutet?«
»Dafür kann es eine Menge Gründe geben«, meinte Isabelle.
»Ein erfolgreicher und gutaussehender Richter verabredet sich mit seiner heimlichen Geliebten zu einem amourösen Wochenende«, dachte Leon laut nach. »Das bedeutet, er muss eine Menge Lügen koordinieren. Er muss seine Frau belügen, er muss seine Mitarbeiter belügen. Und seinem Gastgeber an der Uni in Aix wird er auch nicht die Wahrheit gesagt haben. Bei so einem Seitensprung muss jeder Schritt genau überlegt und perfekt geplant sein.«
»Du machst mir Angst.« Isabelle musterte Leon mit skeptischem Blick.
»Der Mann hat Frau und Kinder, und er riskiert seinen guten Ruf.«
»Ja, ja, der arme sexgestresste Mann«, sagte Isabelle. »Hey, er betrügt seine Frau.«
»Das ist genau der Punkt. Er betreibt einen gewaltigen Aufwand und geht ein großes Risiko ein. Aber dann taucht er bei seiner Liebsten gar nicht auf.«
»Menschen verschwinden gelegentlich.«
»Nein.« Leon sah Isabelle an und schüttelte den Kopf. »Ich glaube, ihr sucht nach einem Toten.«
»Ist der Richter tot?«, fragte eine Stimme aus dem Flur. Lilou hatte den letzten Satz mitgehört. Isabelles Tochter trug ein weites Sweatshirt, und ihre Jeans waren mit den angesagten Rissen und Löchern verziert. Das heißt, sie waren natürlich nicht kaputt, sondern »distressed«, wie die Fünfzehnjährige Leon kürzlich korrigiert hatte. Ihre Haare hatte Lilou zu einem Dutt zusammengedreht, der von einer Klammer in Form einer leuchtend roten Erdbeere zusammengehalten wurde. Die Kopfhörer hatte sie um den Hals gehängt, und in der Hand hielt sie ihr Smartphone, ohne das sie keinen Schritt unternahm.
»Zieh dir wenigstens Sandalen an, wenn du über den kalten Steinboden läufst«, sagte Isabelle mit Blick auf Lilous nackte Füße.
»Jetzt chill mal, Maman«, stöhnte Lilou. »Hat der Richter echt ’ne Geliebte?«
»Das war nicht für deine Ohren bestimmt, Mademoiselle«, antwortete Isabelle.
»Kannst du ihr mal erklären, dass ich bald sechzehn werde?«, wandte sich Lilou hilfesuchend an Leon.
»Ich soll dir sagen, dass deine Tochter eigentlich schon eine alte Frau ist«, sagte Leon zu Isabelle.
»Eine alte Frau mit Blasenentzündung, wenn sie weiter barfuß rumläuft.«
»Wieso glaubst du, dass er tot ist?«, fragte Lilou.
»Das ist eine laufende Ermittlung«, Leon hob entschuldigend seine Hände.
»Also, wenn ihr mich fragt: Erst ist er mit ihr ins Bett gegangen, und dann hat er sich abgesetzt«, sagte Lilou und nahm sich eine Flasche Grapefruitsaft aus dem Kühlschrank. »So machen es doch alle Kerle.«
»Danke für Ihre Einschätzung, Frau Doktor«, sagt Isabelle. »Ich werde das so an meinen Vorgesetzten weitergeben.«
In diesem Moment läutete der Summer an der Haustür.
»Das ist Olivier«, sagte Lilou, während sie zur Tür ging. »Wir wollten noch kurz rüber zu Ingrid, ein paar Freunde treffen.«
Sie öffnete die Tür und begrüßte Olivier mit zwei Küssen rechts und links auf die Wangen. Olivier war zwar ein Mitschüler, aber neben ihm wirkte Lilou eher wie seine ältere Schwester.
»Moment mal, junge Dame. Das war so aber nicht besprochen«, meldete sich Isabelle.
»Ach, komm, Maman. Ihr geht doch auch auf ’ne Party.«
»Wir sind auch schon über sechzehn«, sagte Isabelle.
»Schade eigentlich«, sagte Leon und betrachtete seine Hände.
»Bonsoir, Madame. Bonsoir, Docteur«, sagte Olivier artig. Der Junge war erst kürzlich nach Le Lavandou umgezogen. Seine Mutter hatte sich scheiden lassen und arbeitete jetzt in der Apotheke. Olivier bewunderte Lilou und folgte ihr wie ein junger Hund. Er hatte eine liebenswerte und offene Art, die Leon und Isabelle auf Anhieb mochten. »Ich hab meiner Mutter gesagt, dass ich mit Lilou zu der Party gehe, und sie meinte, das geht in Ordnung.«
»Du bist auch ein Junge, das ist etwas anderes«, sagte Isabelle gereizt.
»Wieso ist das was anderes?«, hakte Lilou sofort nach. Isabelle hob resigniert die Hände. »Sind Ingrids Eltern zu Hause?«
»Was hat das denn damit zu tun?«, fragte Lilou gekränkt.
»Also nicht«, konstatierte Isabelle.
»Eltern haben auf jugendliche Partygäste eine beruhigende Wirkung«, sagte Leon lächelnd.
»Ihr seid ja solche Spießer«, sagte Lilou. »Komm, Olivier, wir gehen nach oben. Da kannst du mir noch mal diese dämlichen Quadratischen Funktionen erklären.«
»Guter Plan.« Leon nickte Olivier aufmunternd zu.
»Im Kühlschrank ist noch Ratatouille von gestern, das könnt ihr euch warm machen«, meinte Isabelle.
Lilou hob gelangweilt die Hand und ging die Treppe hinauf.
»Also, ich liebe Ratatouille. Vielleicht könnten wir uns ja später was holen …«, schlug Olivier vor, während er dem Mädchen in den ersten Stock folgte.
»Wir sind bald wieder zurück«, rief Isabelle den beiden nach.
»Das wissen wir doch gar nicht«, sagte Leon.
»Die sollen gar nicht erst auf die Idee kommen, es sich gemütlich zu machen«, sagte Isabelle und warf noch einen skeptischen Blick in Richtung Treppe.
6. KAPITEL
»Nimm die Finger von dem Ding. Bist du jetzt voll der Spast, oder was?« Eric ließ mit der rechten Hand das Steuer des weißen BMW X4 los und riss Marcel die Pistole aus der Hand, die der sich gerade aus dem Handschuhfach genommen hatte.
Eric war 25 und machte die Ansagen. Er trug heute Abend seinen Blouson aus schwarzem Satin mit dem aufgestickten goldenen Tiger.
Marcel behauptete zwar, er sei schon neunzehn, aber das war gelogen. In Wirklichkeit war er gerade erst siebzehn geworden und hatte trotzdem schon ein Jahr seines Lebens im Jugendknast verbracht. Er bewunderte Eric und war bereit, alles zu tun, was der ihm auftrug.
»Ist die echt, Mann?«, fragte Marcel.
»Klar ist die echt, was denkst du denn? Ist ’ne Beretta.« Er sah den Freund an. »Genau so eine wie die flics haben.«
»’ne Bullenknarre, wow …« Marcel sah bewundernd auf die Pistole, die jetzt schwarz und glänzend auf der Ablage zwischen den Sitzen lag. Vorsichtig griff er danach.
»Pass bloß auf mit dem Teil, sag ich dir.« Eric steuerte den Geländewagen durch die tristen Vororte von Toulon. Hier waren sie mitten in der Banlieue. Die Gegend war fest in der Hand der Marokkaner und Algerier.
Jetzt, in der Dämmerung, waren nur noch die Männer auf der Straße. Viele trugen Djellaba oder Kaftan. Sie saßen am Straßenrand auf Klappstühlen und spielten im Schein der Straßenlaternen Backgammon oder dealten oder taten Wer-weiß-was-Verbotenes. Aus Dutzenden von Lautsprechern drang jammernd der Sound der Rababs, der traditionellen Streichinstrumente des Maghreb. Ab und zu verlangsamte einer der vorbeifahrenden Wagen sein Tempo und hielt kurz an. Dann lief einer der Männer zum Fahrerfenster, und ein paar Euroscheine und das ein oder andere Plastiktütchen Hasch oder Crystal Meth wechselten den Besitzer. Eric nahm den Fuß vom Gas und fuhr langsamer. Die Afrikaner beobachteten neugierig den weißen SUV, der da durch ihr Viertel kurvte. Eric fuhr jetzt kaum mehr als Schrittgeschwindigkeit. Sollten diese Affen ruhig sehen, wer hier die obergeile Karre rumkutschierte.
»Laufen rum wie die verdammten Gespenster«, sagte Eric angewidert mit Blick auf einen Jungen in Djellaba, der sich dem Wagen näherte. »Kommen in unser Land und wissen nicht mal, wie man sich anständig anzieht.« Er drehte den Schild seiner Baseballkappe nach hinten, zog die Sonnenbrille ein Stück nach vorne und sah über die Gläser hinweg. Das war cool, und genau so hatte es Al Pacino in Scarface gemacht.
»Verpiss dich!«, rief Eric dem Afrikaner durch die halbgeöffnete Seitenscheibe zu und wedelte mit der Hand, als wollte er eine lästige Fliege vertreiben. Dann sah er Marcel an. »Alles klar?«