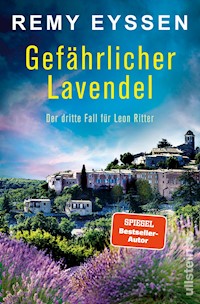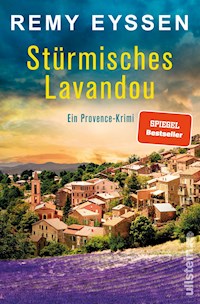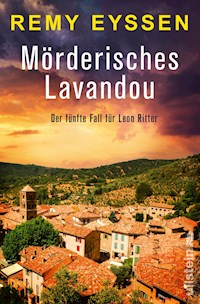3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Grausame Morde erschüttern den provenzalischen Spätsommer Im Ferienörtchen Lavandou ticken die Ohren gewohnt langsam, und auch Leon und Isabelle genießen den nach Pinien duftenden Spätsommer an der Côte d'Azur. Die Idylle wird jäh unterbrochen, als die Leiche einer Frau aufgefunden wird. Die Tat erinnert an einen Mord, der die Gemeinde vor vielen Jahren erschüttert hat. Doch der Mann, der damals verdächtigt wurde, ist in einer Nervenheilanstalt untergebracht. Als Leon und Isabelle ihn vor Ort befragen, gibt er sich arglos – und die beiden haben das Gefühl, etwas Entscheidendes zu übersehen. Als eine zweite Frau auf dieselbe bestialische Weise umgebracht wird, läuft den Ermittlern die Zeit davon. Längst hat Leon keinen Zweifel mehr: Er hat es mit einem Serienmörder zu tun, der solange zuschlagen wird, bis Leon ihn stoppt ... Remy Eyssens Provence-Krimis sind wie ein Kurzurlaub in Südfrankreich: Wellenrauschen, kühler Rosé, warmer Wind, der die provenzalischen Hügel hochweht – und menschliche Abründe, denen Leon Ritter und Isabelle Morell auf den Grund gehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Verräterisches Lavandou
REMY EYSSEN, geboren 1955 in Frankfurt am Main, arbeitete als Redakteur u.a. bei der Münchner Abendzeitung. Anfang der Neunzigerjahre entstanden seine ersten Drehbücher. Bis heute folgten zahlreiche TV-Serien und Filme für alle großen deutschen Fernsehsender im Genre Krimi und Thriller. Mit seiner Krimireihe um den Gerichtsmediziner Leon Ritter begeistert er seine Leserinnen und Leser immer wieder aufs Neue und landet regelmäßig auf der Bestsellerliste.
Von Remy Eyssen sind in unserem Hause bereits erschienen:Tödlicher Lavendel · Schwarzer Lavendel · Gefährlicher Lavendel · Das Grab unter Zedern · Mörderisches Lavandou · Dunkles Lavandou · Verhängnisvolles Lavandou · Stürmisches Lavandou · Trügerisches Lavandou
Remy Eyssen
Verräterisches Lavandou
Ein Provence-Krimi
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.E-Book-Konvertierung powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.ISBN 978-3-8437-3181-2
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
Leseprobe: Trügerisches Lavandou
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Meiner Frau und meiner Tochter
für ihre Geduld und ihren Rat
Prolog
Der Mann glitt wie ein Schatten durch die Nacht. Ein Blick zum Himmel. Wolkenfetzen flogen am Mond vorbei. Ein stetiger Mistral brach sich mit lautem Rascheln in den harten Blättern der Korkeichen. Der Mann war stehen geblieben. In seinem Parka war er zwischen den Bäumen kaum zu erkennen. Er schnupperte in den Wind, wie ein wildes Tier, das Witterung aufnimmt. Der Zeitpunkt war perfekt gewählt. Die Menschen schliefen, genau wie ihre Tiere.
Der Mann roch den Dung von Pferden. Verdammte Viecher, dachte er. Spielzeuge für reiche, verzogene Mädchen. Sie würden schon sehen, was er mit diesen überflüssigen Biestern machte. Bei ihm kamen sie nicht ungeschoren davon. Er würde den verzogenen Prinzessinnen zeigen, was ihre Gäule wirklich wert waren – rein gar nichts. Pferde waren nichts als ein blöder Haufen von Knochen und Muskeln. Genauso neurotisch gestört wie ihre Reiterinnen. Aber er würde aufräumen mit den verdammten Viechern und mit den Weibern – vor allem mit den Weibern. Der Mann sah zu der Koppel hinüber, wo im Mondlicht eine dunkelbraune Stute ihren Kopf schüttelte, dass die Mähne flog.
Das Geräusch von zwei Männern, die den Pfad heraufkamen, riss den nächtlichen Eindringling aus seinen Fantasien. Der Mann drängte sich tiefer in den Ginster, der hier in der Senke des Hügels dicht wie ein Zaun war. Die Männer ließen kurz ihre Taschenlampen aufleuchten. Nichts, nur das Rauschen der Bäume. Als die Männer an ihm vorbeiliefen, kamen sie so nahe, dass er sie hätte berühren können. Er lächelte böse. Sie würden ihn nicht erwischen. Sie hatten ihn noch nie erwischt. Weil sie nicht verstanden, was er hier tat. Er räumte auf, er machte den Menschen Angst. Das tat so gut.
Die Männer waren in Richtung Bauernhof verschwunden. Fantasielose Nachtwächter, waren zu früh zurück ins Haus gegangen. Sie verpassten den besten Teil seines Besuchs. Er hatte einen genauen Plan, und von dem würde er keinen Millimeter abweichen. Der Plan war brutal, das wusste er. Aber so spielte nun mal das Leben. Er war der Ausputzer, er reinigte die Welt von ihren widerlichen Schmarotzern. Er hatte sich auf eine schmerzhafte, blutige Mission begeben, und sie war noch lange nicht zu Ende.
Der Mann hörte ein Schnauben. Es war die Stute. Hatte wahrscheinlich mehr gekostet, als er in zehn Jahren verdienen konnte. Hinterlistig waren diese Viecher. Deswegen mussten sie entsorgt werden. Getilgt und vernichtet, wie Müll.
Der Mann folgte dem Pfad und versuchte dabei, im Schatten der Bäume zu bleiben. Das Mondlicht schien hell, jetzt, wo die Wolken verschwunden waren. Er musste vorsichtig sein. Normalerweise schliefen die Menschen um diese Zeit, aber wer weiß. Er konnte bei seinem Vorhaben keine Beobachter gebrauchen.
In diesem Moment sah er das Pferd. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. Er spürte, wie ihn die Aufregung erfasste, jetzt wo das Pferd aus der Dunkelheit auf ihn zugetrottet kam. Das Tier war so groß und stark. Die Muskeln würden ihm nun auch nicht mehr helfen, dachte der Mann. Er bestimmte über das Schicksal dieses Tieres. Das hier war seine Welt, da machte er die Regeln. Jemand hatte ihm erzählt, Pferde würden Schmerzen genauso empfinden wie Menschen. Das war gut, denn genau das wollte er: Schmerzen bereiten.
Der Mann schwang sich auf das oberste Brett des hölzernen Koppelzauns und ließ sich auf der anderen Seite hinuntergleiten. Jetzt stand er dem Tier gegenüber. Keine zwei Meter war er vom Kopf des Pferdes entfernt. Der Mann konnte sehen, wie sich der Sternenhimmel in den großen dunklen Augen des Tieres spiegelte. Er ging einen weiteren Schritt auf sein Opfer zu. Das Pferd schien zu ahnen, dass etwas geschehen würde, aber nicht, was genau. Es schien hin- und hergerissen zwischen Flucht und Erstarrung. Sollte es sich seinem Schicksal ergeben? Die Stute war hilflos ohne ihre Reiterin, die ihr sagte, was sie tun sollte. Sie stieß ein unglückliches kurzes Wiehern aus.
»Ganz ruhig«, sagte der Mann und berührte mit seiner Handfläche die warmen Nüstern des Tieres. Das schien die Stute tatsächlich zu beruhigen. Der Mann lächelte, sie hatte ja keine Ahnung. Sie schnüffelte an seiner Hand und leckte gierig an den beiden Zuckerwürfeln, die er ihr hinhielt. Wieder schnaubte die Stute. Diesmal lauter, drängender. Jetzt musste es schnell gehen. Der Mann griff in die Tasche seines Parkas, und als er die Hand wieder hervorzog, hatte er ein Ausbeinmesser fest im Griff. Die fünfzehn Zentimeter lange schmale Klinge hatte der Mann noch am Abend geschliffen, bis sie rasiermesserscharf war. Damaststahl, dachte er, als er das Messer in seiner Hand ansah. Hundertsechzig Mal gefaltet und handgeschmiedet. Der Griff aus dem polierten Holz einer alten Mooreiche.
Der Mann sog die Luft tief in seine Lunge. Es war dieser Augenblick zwischen Leben und Tod, den er so sehr liebte. Er griff nach der Trense und zwang den Kopf des Tieres nach unten. Dann setzte er ihm das Messer an den Hals und stach mit ganzer Kraft zu. Das Messer glitt tief in die Halsmuskulatur ein und durchtrennte dabei Luftröhre und Schlagader. Eine feine Wolke von Blut schoss aus der Wunde. Die Stute wollte wiehern, aber sie brachte nicht mehr hervor als ein verzweifeltes Gurgeln. Dann brachen ihr die Vorderbeine weg, und mit einem Schnauben stürzte sie zu Boden.
Der Mann ging in die Knie und beobachtete das Pferd, das zuckte und verzweifelt mit den Beinen ins Leere trat. Der Mann wartete einen Moment. Er sah zu dem Bauernhaus, das keine hundertfünfzig Meter entfernt stand. Die Fenster waren dunkel. Nichts rührte sich in dem Gebäude. Er hob das Messer noch einmal und stieß es dem sterbenden Tier unter dem Rippenbogen in den Leib. Blut quoll aus der Wunde, das im Mondlicht wie schwarze Tinte glänzte.
1. Kapitel
Er wusste, dass sie sich über ihn lustig machten. Natürlich. Sie machten Bemerkungen, wenn er seine alte Leica mit dem Stativ aufbaute und auf den Horizont ausrichtete. Der Horizont hatte ihn zeit seines Lebens beschäftigt. Diese imaginäre Linie, die stets vor einem herlief und die man doch nie erreichen konnte. Der Horizont hatte etwas Magisches. Pierre Lagarde verfolgte ihn seit Jahrzehnten. Versuchte den perfekten Augenblick zu erwischen. Den Moment, wenn das erste Licht über die Erdkrümmung kroch, wenn sich die Sonne durch ein fernes Leuchten ankündigte und dann aufstieg. Scheinbar aus den Tiefen des Meeres, höher und immer schneller. Das waren die entscheidenden Sekunden, der Augenblick, wenn alles passte: das Licht am Horizont, der Dunst über dem Meer und der ewige blaue Himmel. In solchen Momenten drückte Pierre Lagarde auf den Auslöser seiner alten Leica IIIa. Aber so weit war es noch nicht.
Sein ganzes Leben hatte er damit verbracht, den richtigen Moment zu finden. Seine Eltern besaßen ein Fotogeschäft. Sein Vater war ein begeisterter Fotograf. Er wusste alles über Verschlusszeiten, Blenden und die Lichtempfindlichkeiten alter Analogfilme. Als seine Eltern vor Jahren bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen waren, hatte Pierre Lagarde das Geschäft geerbt. Es waren die letzten Jahre der anlogen Fotoapparate. Pierre klapperte damals während der Sommermonate die Terrassen der Restaurants ab und schoss Fotos, die sich die Leute am nächsten Tag in seinem Geschäft abholen konnten.
Pierre Lagarde liebte das Fotografieren, aber mit den Handys kam auch das Fotografieren für jedermann. Und die Selfies brachten das endgültige Aus für die Porträtfotos. Eine Zeit lang stand es düster um die Fotografie. Aber seit Monsieur Lagarde den alten Laden seiner Eltern in einen Postershop verwandelt hatte, konnte er sogar davon leben. Zumal er in der Hauptsaison, zwischen Juni und September, zusätzlich noch einen Souvenirladen in seine Räume aufnahm, an dessen Umsatz er beteiligt war. Und da er erst um zehn Uhr dreißig öffnete, blieb ihm genug Zeit, seiner Leidenschaft nachzugehen, der Suche nach dem perfekten Sonnenaufgang.
An diesem Morgen war er früh aufgestanden. Er wusste, dass er zeitig am Strand sein musste, wenn er die Chance haben wollte, auch nur eine einzige gute Aufnahme zu machen. Die Morgendämmerung begann erst gegen fünf Uhr, aber es war besser, man kam früher. Dann war man völlig ungestört, die Touristen lagen noch in ihren Betten, und niemand nervte mit aufdringlichen Fragen.
Es war eine schmale Treppe aus Steinen und Zement, die von den Felsen am Meer den Hügel hinaufführte und die Pierre um diese Zeit in die Bucht gelockt hatte. Er hatte die Stelle zwischen den Klippen erst vor wenigen Tagen zufällig entdeckt. Dort, wo der Pfad sich zu einer kleinen Terrasse verbreiterte. Irgendjemand hatte dort einen Klappstuhl und einen Blechtisch stehen lassen, der mal hellblau gewesen sein musste, bevor die Sonne die Farbe abgeschält hatte.
Ein Platz wie aus einem Bilderbuch, dachte Pierre, ein magischer Platz, und er hatte ihn entdeckt. Er klappte sein Stativ zusammen, hängte sich die Kamera um den Hals und nahm die erste von zwei Dutzend Stufen, die ihn zu seinem Motiv führen sollten.
In diesem Moment brach ein kurzes, entferntes Wetterleuchten durch die Wolken. Monsieur Lagarde hatte bis jetzt noch gar nicht bemerkt, dass das Wetter umgeschlagen war und der Himmel sich zugezogen hatte. Auf das Flackern der fernen Blitze folgte ein leises Grummeln. Es klang nach einem nahenden Unwetter. Der Fotograf war stehen geblieben und sah kritisch zum Himmel. Dann wandte sich Lagarde wieder den Stufen zu. Der Treppenpfad führte an Klippen und Felsvorsprüngen vorbei. Er folgte den Stufen noch ein paar Meter. Dann, als er um den nächsten Felsen bog, blieb der Fotograf abrupt stehen. Unmittelbar vor ihm, keine drei Meter entfernt, stand der kleine Blechtisch, dicht neben einer Strandkiefer. Davor war der Klappstuhl – und darauf saß jemand. Genauer gesagt eine Frau, die weit nach vorne gebeugt, angelehnt an den Stamm des kleinen Baumes dasaß, sodass ihre schlaffen Arme tief auf beiden Seiten herunterhingen und ihre Hände den Boden berührten. Mit der Schulter schien sie sich gegen die Strandkiefer zu stützen. Lagarde konnte die Unbekannte nur schräg von hinten sehen. Sie trug ein helles Kleid, und Lagarde nahm an, dass es sich eher um eine junge Frau handelte. Für einen Augenblick war Lagarde von dem Anblick wie elektrisiert. Um diese Zeit an diesem ungewöhnlichen Platz jemanden anzutreffen, verschlug dem Fotografen für einen Moment die Sprache. Diese Begegnung war so überraschend und unerwartet, dass er sich erst einmal sammeln musste. Wieder flackerte ein fernes Wetterleuchten. Für einen Moment erhellte sich die Szene erneut. Keine Frage, auf dem Stuhl saß eine Frau, dachte Lagarde. Eine Frau, die sich offenbar nicht für den Blick auf das Meer interessierte, sondern vielleicht krank oder einfach nur eingeschlafen war.
»Bonjour.« Pierre Lagarde räusperte sich und wartete. Aber die Klippenbesucherin antwortete ihm nicht. »Ist ziemlich kühl hier oben um diese Zeit«, sagte er.
Diesmal wartete Lagarde ein paar Sekunden. Da war ein Geräusch, als käme jemand näher. Aber niemand antwortete ihm. Pierre Lagarde machte einen entschlossenen Schritt nach vorn.
»Ich … ich fotografiere hier«, erklärte er höflich und machte eine Handbewegung in Richtung Meer.
»Das ist der schönste Blick um diese Zeit. Sagen Sie, geht es Ihnen nicht gut?« Der Fotograf klang besorgt.
Die Angesprochene rührte sich nicht. Der Mond war inzwischen wieder hinter Wolken verschwunden, und es war kaum etwas zu erkennen. Monsieur Lagarde stieg noch eine Stufe höher, warum konnte er das Gesicht der Frau nicht erkennen? Nur ihre Schultern. Wieder ein Geräusch.
Der Fotograf wollte noch einen Schritt näher kommen, aber etwas in ihm sträubte sich. Wieder ein Wetterleuchten. In diesem Moment erkannte Lagarde, dass mit der Fremden auf dem Klappstuhl etwas nicht stimmte.
»Madame?«, sagte Lagarde zögerlich.
Der Fotograf griff in seine Jackentasche und holte sein Handy hervor. Seine Hand zitterte leicht, als er die Taschenlampenfunktion einschaltete. Ein fahles, kaltes Licht erleuchtete die Szenerie. Er ließ den Lichtkegel über den Körper der Frau gleiten. Sie saß auf dem Stuhl und rührte sich nicht. Lagarde ließ den Schein des Handys weiter nach oben wandern. Sie trug ein weißes Kleid mit Kirschmuster. Er folgte mit dem Handylicht den Trägern des Kleides. Wieder ein heller Blitzschlag, jetzt sah er es: Die Frau hatte keinen Kopf.
Einen Moment griffen Lagardes Hände hilflos ins Leere. Als gäbe es dort ein unsichtbares Seil oder irgendetwas, woran er sich festhalten konnte. Er atmete vornübergebeugt und fürchtete, dass er sich erbrechen müsste. Aber er fing sich wieder. Lagarde trat langsam näher an die tote Frau heran. Dabei hielt er das Handy wie eine Waffe mit ausgestrecktem Arm vor sich. Er zwang sich, dorthin zu sehen, wo sich eigentlich der Kopf hätte befinden müssen.
Der Hals der Frau war kurz unter dem Kinn durchgeschnitten worden, und das, was da zu sehen war, waren Muskelfasern, Sehnen und ein Stück vom Rückgrat.
Lagarde wurde schwindelig. Es rauschte in seinen Ohren. Wieder ein Geräusch wie von Schritten. Diesmal ganz in der Nähe. Lagarde ging in die Knie, sah zum Meer, zum Sonnenaufgang. Da traf ihn ein Schlag von hinten gegen den Kopf. Es wurde schwarz um ihn herum, und er stürzte ins Nichts.
2. Kapitel
Leon hatte sich an diesem Morgen freigegeben. Die Rechtsmedizinische Abteilung in der Klinik Saint-Sulpice kam auch mal einen halben Tag ohne ihn aus. Also beschloss er, diesen Tag zu genießen, und dazu gehörte ein frisches Baguette zum Frühstück. Docteur Leon Ritter nahm die Abkürzung in den Ortskern von Lavandou. Er genoss es, den schmalen Pfad entlangzulaufen, der in diesem Jahr besonders grün und üppig war.
Es hatte dieses Jahr bis in den Mai geregnet, jetzt platzte die Natur geradezu vor Saft und Kraft und bunten Blüten. Bougainvilleen und Jasmin quollen über die Mauern, die den Pfad und die Treppen zwischen den Gärten begrenzten. Die ersten Smaragdeidechsen krochen aus den Mauerspalten und wärmten sich in der Morgensonne. Für Leon fühlte es sich an wie ein Spaziergang durch das Paradies. Er hatte es nie bereut, nach Lavandou gezogen zu sein. Es war ein ungewöhnlicher Karriereweg gewesen, von der Medizinischen Fakultät der Uni Frankfurt bis an die Strände des Mittelmeers. Und wenn ihn jemand fragte, warum er die Professur in der renommierten Rechtsmedizin der Uni Frankfurt damals abgelehnt hatte, dann sagte er: Um morgens einen Spaziergang durch das Paradies zu machen. Wo es nach Wacholder, Rosmarin und Eukalyptus roch und man hinter den ockerfarbenen Dächern der Häuser das Meer glitzern sehen konnte.
Der Ort Le Lavandou hatte den Anschluss an den modernen Tourismus verschlafen, sagten die Leute, damals, irgendwann in den Siebzigerjahren. Und Leon erinnerte sich, wie er als kleiner Junge mit seinen Eltern regelmäßig im Sommer eine Tante an der Côte d’Azur besucht hatte. Damals hatten die Fischer in Lavandou noch vom Doradenfang gelebt, und der aufblühende Tourismus war seinen Urlaubern hinterhergestolpert, die sich in Saint-Tropez, Grimaud oder Sainte-Maxime niederließen. Lavandou hatte unter jungen Leuten als rückständig und ein wenig verpennt gegolten. Aber das war schon lange her. Die Menschen in Lavandou waren nicht langweilig und verschlafen, sondern sie ließen sich einfach nicht gern von den neuesten Trends treiben. Auf diese Weise ging es zwar etwas langsamer vorwärts, aber dafür konnten allzu große Bausünden und andere sogenannte Errungenschaften des modernen Tourismus vermieden werden. Und das Wichtigste war: Lavandou hatte seine französische Seele behalten.
»Bonjour, Docteur«, rief Denis, der gerade das Rollgitter vor seinem Eissalon hochschob. Seine gefrorenen Leckereien waren weit über die Grenzen des Ortes hinaus bekannt. Um diese Zeit waren erst wenige Leute auf den Straßen, und man konnte sich kaum vorstellen, wie sich durch die engen Gassen bereits in wenigen Stunden die Touristen drängen würden.
In der Bäckerei Pain du Port standen allerdings schon die ersten Kunden Schlange. Das Brot von Serge Roux wurde von allen geschätzt, was umso erstaunlicher war, weil der Bäcker ein wenig sympathischer Zeitgenosse war. Er war unscheinbar, schmal, aber kräftig. Und er schien ständig schlechte Laune zu haben, als wäre das Leben selbst schon eine Zumutung. Vor einem Jahr war seine Frau gestorben. Seitdem hatte Roux sich noch stärker zurückgezogen. Trotzdem ging Leon gern in die Bäckerei am Hafen. Zum einen weil das Brot wirklich köstlich war, und zum anderen hatte Lilou, seine Stieftochter, über die Semesterferien einen Aushilfsjob bei Serge Roux angenommen.
»Bonjour, Monsieur Roux«, sagte Leon freundlich, als er den Laden betrat und die Tür ein kleines Glockenspiel auslöste.
»Docteur«, brummte der Mann hinter dem Tresen, der sich ein kariertes Küchenhandtuch wie eine Schürze in den Gürtel gesteckt hatte.
In diesem Moment tauchte Lilou aus den Tiefen der Bäckerei auf und schenkte Leon ein breites Lächeln. Sie trug ausgefranste Jeans und ein T-Shirt mit dem Aufdruck Pain du Port. Um den Kopf hatte sie sich ein Tuch geknotet, das ihr etwas von einer Piratenbraut gab.
»Bonjour, Monsieur le Médecin Légiste«, grüßte Lilou ihren Stiefvater mit einem frechen Grinsen.
Leon legte ihr liebevoll die Hand auf die Schulter, als sie sich näherte.
»Pain au Chocolat«, Leon zeigte vier Finger, »quatre.« Freundlich wandte er sich an Monsieur Roux und fragte: »Und, wie macht sie sich?«
Roux antwortete nicht, sondern drehte sich um, wo die Backwaren in einem breiten Regal und Körben zum Auskühlen gelagert waren und hinter denen man weitere Mitarbeiter erkennen konnte.
»Wo bleiben die Pains au Chocolat, verdammt?«, schimpfte Roux.
»Sind gerade fertig, Monsieur«, sagte Lilou und rief dann laut in Richtung Backstube: »Die Pains-Choc, Françoise, allez hopp!«
In diesem Moment kam eine große, kräftige Frau von Anfang zwanzig, die ein noch heißes Backblech vor sich her balancierte, aus den Tiefen der Backstube und bewegte sich dabei etwas ungelenk durch den engen Gang des Verkaufsraums.
»Excusez-moi«, sagte Françoise zögernd zu ihrem Chef. »Sie waren noch zu heiß.«
»Dann sehen Sie zu, dass wir wenigstens schon mal die Croissants verkaufen. Schlafen können Sie zu Hause«, fuhr Roux die junge Frau an.
»Entschuldigen Sie, Patron«, sagte Françoise verunsichert. »Mein Fehler.«
»Das ist Françoise, meine Kollegin«, stellte Lilou die junge Frau vor und zeigte dann auf Leon. »Das ist mein Vater.«
»Madame«, sagte Leon mit gespielter Höflichkeit. Lilou lächelte.
Die Bezeichnung »Vater« entsprach eigentlich nicht ganz der Wahrheit, aber Leon mochte es, wenn Lilou ihn als ihren Vater vorstellte. Er hatte sich immer eine Tochter wie Lilou gewünscht. Eines Tages war er in Lavandou einer Frau begegnet, wie er sie sich immer vorgestellt hatte. Es war die Frau, mit der er vom ersten Augenblick an zusammenbleiben wollte. Und eine Tochter gab es noch dazu. Das war vielleicht für ihn der wichtigste Grund gewesen, in Lavandou zu bleiben: Wegen der Liebe zu Isabelle und ihrer Tochter Lilou. Und wegen des Familienlebens, das sie seit zehn Jahren miteinander führten.
»Ah, und ein Baguette, bitte«, fügte Leon hinzu und deutete auf die Brote im Regal hinter dem Bäckermeister.
In diesem Moment machte Françoise einen unüberlegten Schritt nach hinten und stieß mit der Hüfte gegen ihren Kollegen Antoine.
»Pass auf, Françoise!«, rief Lilou ihrer Kollegin noch zu, aber es war bereits zu spät.
Das Blech rutschte Françoise aus der Hand und schmetterte mit der Kante auf den Boden. Die Pains au Chocolat sprangen wie wilde Frösche über den Boden der Bäckerei.
»Merde alors«, fluchte der Bäcker laut. »Kannst du nicht aufpassen? Träumt hier rum«, schimpfte Roux. »Nur Mist im Kopf. Ist doch wahr.«
»Es tut mir leid.« Françoise war den Tränen nahe.
»Ich … ich mach das schon …«, sagte Antoine, ein dunkelhaariger Kollege, und kniete sich auf den Boden. Ohne seinen Chef oder seine beiden Kolleginnen anzusehen, sammelte er die abgestürzten Pains au Chocolat auf und warf sie in den Mülleimer.
»Danke«, sagte Lilou zu dem jungen Kollegen.
Antoine sagte nichts und sah nur betreten zu Boden.
»Kannst du nicht aufpassen?«, schnappte Roux in Richtung von Françoise. »Was glaubst du, was wir hier tun?«
»Es tut mir wirklich leid, Monsieur Roux«, sagte die junge Frau kleinlaut.
»Wir verkaufen Brot, wir schmeißen es nicht in den Dreck«, Roux konnte seinen Zorn offenbar nur schwer unterdrücken.
»Kann ja mal passieren, Monsieur Roux«, versuchte Leon zu schlichten. Er hatte in seine Tasche zum Geld gegriffen und zählte ein paar Euro ab. »Françoise ist so eine freundliche Person«, sagte er lächelnd. »Ich glaube, manche Kunden kommen vor allem ihretwegen in die Bäckerei.«
»Sie haben gut reden. Klar, Sie müssen ja auch keine Bäckerei führen, in diesen Zeiten«, brummelte Roux vor sich hin.
Antoine schob die restlichen abgestürzten Backwaren mit einem breiten Besen zusammen, Lilou bückte sich und versuchte noch ein paar Pains einzusammeln, die unter das Regal gerutscht waren.
»Lass nur, ich mach das schon«, sagte Antoine, ohne Lilou anzusehen.
»Ist sicher schwierig im Moment, klar. Kann ich mir vorstellen«, entgegnete Leon, während er sich im Geschäft umsah.
Draußen waren die ersten Kunden eingetroffen und stellten sich bereitwillig am Eingang an, um das erste Baguette des Tages noch ofenwarm in Empfang zu nehmen.
»Der Preis für mein Mehl ist seit Corona um dreißig Prozent gestiegen. Dann noch der Strom für die beiden großen Backöfen. Vierzig Prozent teurer.« Der Bäcker streckte Leon die Hand hin und zeigte vier Finger. »Vierzig Prozent!«
Roux schob mit dem Fuß einen Eimer vor Françoise, den er sich von unter dem Tresen geangelt hatte. »Ich will keinen Krümel mehr am Boden sehen.«
»Ich kümmere mich schon, Patron«, stotterte Antoine und kehrte dabei schnell und geschickt die Reste vom Boden.
»Warte, ich helfe dir«, sagte Lilou, die die Diskussion bisher schweigend verfolgt hatte.
»Ich habe gesagt …«, wollte Roux lospoltern, doch als er Leons Blick sah, unterbrach er sich. »Aber beeilt euch. Und sag in der Backstube Bescheid, dass wir noch ein zweites Blech Pains-Choc hier vorne brauchen.«
»Ich bewundere Sie und Ihr Team.« Leon versuchte weiterhin tapfer, die Stimmung ein wenig aufzulockern. Er sah zu Roux und dann zu Lilou. »Ganz ehrlich, wenn ich jeden Tag um fünf aufstehen müsste, um meinen Job zu erledigen … Weiß nicht, ob ich da so konzentriert arbeiten könnte wie Sie.«
Der Bäcker verkniff sich eine weitere Bemerkung. Leon konnte sehen, wie es in ihm arbeitete. Lilou sah Leon dankbar an.
»Dann nehme ich eben vier Croissants«, sagte Leon. »Auch gut, Monsieur Roux.«
Grummelnd nahm der Bäcker die Croissants vom Blech und steckte sie in eine Papiertüte mit dem Aufdruck Pain du Port – depuis 1983.
3. Kapitel
»Meinst du nicht, dass es zu viel für Lilou werden könnte?« Isabelle klang besorgt, als sie in der Küche Müsli zubereitete, während sich Leon um das Rührei kümmerte.
Sie trug die hellblaue Bluse mit den drei Streifen eines Capitaine der Gendarmerie auf den Schulterklappen. Dabei war Isabelle noch viel mehr als nur ein Capitaine de Police. Sie war die stellvertretende Leiterin der Gendarmerie. Und damit die erste Polizeichefin in der fast hundertjährigen Geschichte von Le Lavandou.
Dabei war sie nicht nur erfolgreich, wenn es darum ging, Verbrecher zu jagen. Capitaine Isabelle Morell war auch eine erfahrene Beamtin, die genau wusste, wie man erfolgreich eine Behörde führte, die inzwischen über fünfzig Beamte beschäftigte.
Leon sah liebevoll zu Isabelle hinüber, während er in der Pfanne rührte und verhinderte, dass das Rührei anbrannte.
»Lilou weiß selber, wann es zu viel für sie wird«, beruhigte Leon seine Frau.
»Ich weiß, es ist ungerecht, wenn ich das jetzt sage«, Isabelle trank einen Schluck Tee aus ihrer Tasse, »aber ich konnte diesen Roux noch nie leiden. Schon lange bevor die Sache mit der Fahrerflucht passiert ist.«
»Was die Gendarmerie nie beweisen konnte«, erinnerte sie Leon. »Willst du Tomaten zu deinem Rührei?«
»Ja, unbedingt.«
»Seit dem Tod seiner Frau ist er noch merkwürdiger geworden«, sagte sie dann. »Findest du nicht?«
»Lilou ist einundzwanzig. Wenn sie mit Roux nicht zurechtkommt, geht sie einfach nicht mehr hin. Außerdem hat sie eine nette Kollegin. Françoise, kennst du sie?«
Lilou hatte erst im vergangenen Jahr ihr Baccalauréat, ihr Abitur, gemacht und war gleich an der Uni von Aix-en-Provence angenommen worden. Nun hatte sie bereits ihr erstes Studienjahr in Medizin absolviert.
Leon hatte im Stillen immer gehofft, dass Lilou Ärztin werden würde. Auch er hatte seine berufliche Karriere als Mediziner begonnen, bevor er als Chirurg und Internist in die Rechtsmedizin gewechselt war. Leon war stolz auf seine erfolgreiche Stieftochter.
Isabelle stand an der weit geöffneten Küchentür, die direkt auf die Terrasse mit dem alten, gemütlichen Rattansofa führte, und sah über die Dächer von Lavandou auf das glitzernde Mittelmeer.
»Na?«, fragte Leon. »Immer noch besorgt?«
Isabelle lächelte. Leon hob das Rührei auf einen Teller, den er Isabelle reichte.
»Mit Zwiebeln, Tomaten und ein paar Kapern«, sagte er mit einem warmen Lächeln. »Genau wie Madame es bestellt hat.«
»Ich habe nur gedacht …«, begann Isabelle. Leon sah sie fragend an. »Was, wenn ihr das Studium nicht gefällt? Vielleicht will sie mit dir reden.«
Leon sah Isabelle misstrauisch an. »Du hast doch jede Woche mit ihr telefoniert«, bemerkte er sachlich.
»Du weißt, was ich meine«, unterbrach ihn Isabelle. »Sie bewundert dich. Vielleicht hat sie Fragen zum Studium.«
»Du willst aber nicht unseren Ausflug schon wieder verschieben?«
Leon hatte im Hotel le Manoir ein romantisches Wochenende für sie beide gebucht. Das Manoir befand sich auf der Insel Port-Cros und war eine Mischung aus romantischem Refugium und provenzalischem Herrenhaus. Ideal, um sich für einige Tage zurückzuziehen, gemütlich auszuschlafen und ausgedehnte Spaziergänge auf der Naturschutzinsel zu unternehmen, auf der Autos verboten waren. Außerdem besaß das Manoir eine hervorragende Küche. Sie hatten den Ausflug wegen Isabelles Job schon so oft verschoben, dass sie einfach nicht mehr Nein sagen konnte.
»Ein paar ruhige Tage werden dir guttun«, sagte Leon.
»Ich dachte ja nur …«, begann Isabelle erneut, aber Leon drohte gespielt vorwurfsvoll mit dem Zeigefinger.
»Lilou wird die ganzen Sommerferien hier bei uns sein. Hör also auf, dir Sorgen zu machen«, sagte er. »Da finde ich genug Möglichkeiten, um mit ihr zu reden.«
Leon legte den Arm um Isabelles Schulter und zog sie sanft an sich, als ihr Handy summte. Isabelle sah auf das Display.
»Keine Störungen mehr beim Frühstück«, sagte Leon mit einem Grinsen. »Hatten wir nicht so etwas ausgemacht?«
»Schon, aber du lebst mit einer Polizistin zusammen.« Isabelle lächelte zurück. »Es ist die Zentrale.« Sie hielt das Display so, dass Leon den Anrufer erkennen konnte.
»Capitaine Morell«, meldete sie sich dann.
In diesem Moment summte auch Leons Handy. Er nahm es in die Hand und las die Anzeige auf dem Display. Dann stöhnte er leise, wartete ein weiteres Summen ab und nahm das Gespräch ebenfalls an.
4. Kapitel
Keine fünfzehn Minuten später waren Isabelle und Leon von einem Polizeiauto mit Blaulicht abgeholt worden. Der Fahrer hatte sie eine Bucht weiter am Strand von Cavalière aussteigen lassen. Auf der Küstenstraße parkten inzwischen vier Einsatzwagen der Polizei und ein Krankenwagen. Gaffer fuhren im Schritttempo vorbei, stauten den Verkehr und wurden sofort von der Gendarmerie weitergewunken. Von der Küstenstraße waren es keine zweihundert Meter auf dem schmalen Pfad durch die Klippen bis zu der Stelle, wo die Tote entdeckt worden war. Das Gelände war inzwischen weiträumig abgesperrt. Lieutenant Masclau von der Gendarmerie erkannte Leon und Isabelle schon von Weitem und hielt das blau-weiße Absperrband hoch, damit die beiden passieren konnten.
»Bonjour Capitaine, bonjour Docteur«, grüßte der Lieutenant höflich und deutete zu den Felsen. »Sie liegt …«, Masclau räusperte sich, »das heißt, eigentlich sitzt sie da unter der Strandkiefer, gleich bei den Klippen. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen.«
Leon trug seine abgegriffene Ledertasche bei sich, die eine Art »Grundausstattung« enthielt, wenn er zu einem Tatort gerufen wurde. Er sah zu den neugierigen Urlaubern, die sich auf dem Pfad in den Felsen drängten, um bloß nichts von dem grauenvollen Anblick zu verpassen.
»Die Leute da«, Leon deutete auf die Felsen, »die müssen alle verschwinden. Die zertrampeln uns ja jede Spur.«
»Kümmerst du dich gleich darum, Didier?« Isabelle sah Lieutenant Masclau an. Der Lieutenant gab entsprechende Einsatzbefehle in sein Funkgerät.
»Wo ist der Zeuge?«, fragte Isabelle. »Der Mann, der das Opfer gefunden hat?«
»Lagarde, Pierre Lagarde, der Fotograf«, sagte Masclau. »Behauptet, jemand hätte ihn niedergeschlagen, als er die Leiche entdeckt hat.«
»Könnte er mit der Sache zu tun haben?«, fragte Isabelle ihren Lieutenant.
»Lagarde? Kann ich mir nicht vorstellen«, sagte Masclau. »Ist ein verdruckster Fotograf. Total schüchtern. Wenn Sie ihn sehen, wissen Sie, was ich meine, Capitaine.«
»Leider kann man den Mördern ihre bösen Taten nicht ansehen«, kommentierte Leon. »Und die Harmlosesten sind oft die Gefährlichsten.«
»Wenn Sie das sagen, Docteur«, sagte Masclau mit spöttischem Unterton.
»Wie geht es Lagarde?«, wollte Isabelle wissen.
»Hat einen ordentlichen Schlag abbekommen. War fast eine Stunde weggetreten. Aber es geht ihm wieder gut, habe ich gehört. Der Notarzt hat ihn untersucht und dann nach Hause gebracht.«
»Ist er ansprechbar?«, fragte Isabelle.
»Ich denke schon«, sagte Masclau. »Seine Frau kümmert sich.«
»Gut, ich möchte mit ihm reden«, sagte Isabelle. »Und wenn er hier fotografiert hat, würde ich gern die Bilder sehen.«
»Geht klar«, sagte der Lieutenant. »Ich kümmere mich darum.«
In den Klippen hatte die Polizei inzwischen alle Hände voll zu tun, ungebetene Besucher davon abzuhalten, Selfies mit der Toten zu machen. Aber auch ein paar Beamte der Police municipale, der Verkehrspolizei, die eigentlich für die Absperrung der Straße zuständig waren, hatten sich nah an die Tote herangeschoben. Alle wollten einen Blick auf die kopflose Leiche in den Klippen werfen, um später ihren Freunden und Bekannten von ihrem Abenteuer zu berichten.
Zum Glück hatte sich jemand erbarmt und eine goldene Schutzfolie über die Tote gelegt, die sie vor den gierigen Blicken der Gaffer schützte und ihr einen Rest Würde bewahrte.
Leon beugte sich zu dem Opfer hinab und schob die Folie ein Stück zur Seite. Ein Stöhnen ging durch die Gruppe von Polizisten, die den Médecin Légiste bei seiner Arbeit beobachteten.
Leon hatte in seinem Beruf schon viele Leichen untersucht, und er war nicht leicht aus der Fassung zu bringen. Aber in diesem Fall brauchte er einen Augenblick, um das, was er da vor sich hatte, zu verarbeiten. Eine Tote, deren Kopf abgetrennt worden war.
»Wo bleibt die Sichtblende?«, fragte Leon verärgert. »Bei diesem Zirkus hier kann ich nicht arbeiten.«
»Die Kollegen sind schon dabei«, sagte der Lieutenant mit einer kurzen Kopfbewegung in Richtung der Uniformierten, die zwei Paravents aufstellten, um allzu Neugierigen die Sicht zu nehmen.
Leon war in die Hocke gegangen und betrachtete das Opfer. Ihr Körper war mit großen und kleinen Verletzungen geradezu übersät. Schnitte, Brüche, Hämatome und Verbrennungen verunstalteten den Körper. Wie zum Hohn hatte der Täter, nachdem er sein blutiges Werk getan hatte, ein sauberes weißes Sommerkleid mit Kirschmuster über den zerstörten Körper gezogen. Doch das Schockierendste an dem Bild war die große Wunde, die der Täter seinem Opfer mit einem sehr scharfen Schneidewerkzeug zugefügt haben musste, als er der Frau den Kopf vom Rumpf geschnitten hatte.
»Was für eine verdammte Schweinerei«, sagte eine Stimme, die Leon nur allzu gut kannte. Er sah auf. Vor ihm stand Commandant Zerna, der Chef der Gendarmerie von Le Lavandou.
»Haben Sie so etwas schon einmal gesehen?«, fragte Zerna.
Leon betrachtete einen Moment das Opfer. Dann schüttelte er langsam den Kopf. »So viel Wut …«, sagte Leon nach einer Weile nachdenklich wie zu sich selbst.
»Wissen wir etwas über die Tote?«, fragte der Polizeichef seine Stellvertreterin.
»Wir suchen im Augenblick noch alles ab, von hier bis zur Küstenstraße.« Isabelle blinzelte gegen das grelle Sonnenlicht.
»Und?«, wollte Zerna wissen.
»Bisher nichts«, antwortete Isabelle.
»Gar nichts?«, fragte Zerna ungläubig. »Es kann doch nicht so schwierig sein, diesen Kopf aufzutreiben.«
In diesem Moment begann der Körper der Toten langsam nach vorne zu rutschen. Leon saß in der Hocke, wollte aufspringen, doch dafür war es zu spät.
»Halten Sie sie«, rief er Lieutenant Masclau zu. Aber der bevorzugte es auszuweichen, statt die Frau ohne Kopf anzufassen. Also griff Leon beherzt nach vorne. Er erwischte die Tote genau in dem Augenblick, als sie vom Stuhl stürzte. Für einen kurzen Augenblick hielt er die Frau in seinen Armen, wie ein Mann seine Geliebte, bevor er sie vorsichtig zu Boden gleiten ließ.
»Ich glaube, ich muss gleich kotzen«, sagte Masclau.
Leon ging nicht auf die Bemerkung des Lieutenants ein, sondern betrachtete die Hände der Frau, bevor er begann.
»Es handelt sich um eine Frau von etwa zwanzig bis fünfundzwanzig Jahren«, erklärte Leon dem Polizeichef sachlich. Als befänden sie sich nicht an einem der schönsten Strände der Côte d’Azur, sondern bei einer Obduktion in der Rechtsmedizin. Zerna sah den Rechtsmediziner fragend an.
»Die Haut des Opfers ist hell, europäischer Typ.«
Leon hatte hauchdünne Latexhandschuhe übergestreift, die er immer dabeihatte, wenn er zu einem Tatort gerufen wurde.
»Sonst noch was?«, fragte Zerna, der es nicht so gerne mochte, wenn Leon im Mittelpunkt stand, etwas unwirsch.
»Das Gewicht dürfte bei etwa siebenundvierzig Kilo liegen.« Leon hatte die Hand des Opfers angehoben, betrachtete sie und bewegte sie vorsichtig ein paar Zentimeter hin und her. »Die Leichenstarre hat noch nicht vollständig eingesetzt«, er sah auf seine Uhr, »der Tod ist wahrscheinlich gegen drei Uhr eingetreten.«
»Hier?« Der Lieutenant sah sich um.
»Nein, bestimmt nicht«, antwortete Leon geduldig. »Der Fundort ist nicht der Tatort.«
»Und da sind Sie sich wie immer sicher?«, stichelte Zerna.
»Keine Blutspuren«, antwortete Leon knapp. »Bei diesen Schnitten müsste viel Blut geflossen sein.«
Leon unterbrach seinen kleinen Vortrag, und alle sahen ihn an, als wüsste er etwas, das er ihnen bisher nur noch nicht mitgeteilt hatte. Er betrachtete das Opfer irritiert.
»Die Hände und die Nägel des Opfers sind sehr gepflegt«, fuhr Leon fort. »Zumindest die, die ihr nicht ausgerissen wurden.«
»In dem Alter könnte sie eine Studentin gewesen sein, oder?«, sagte Isabelle.
»Möglich«, sagte Leon. »So gepflegt, wie diese Handflächen und Fingerkuppen sind, hatte sie wahrscheinlich einen Bürojob.«
In diesem Moment begriff Leon, was ihn irritierte. Es waren die Blätter in der offenen Wunde am Hals. Es sah aus, als hätte jemand dort ganz bewusst einen kleinen Zweig zwischen Nackenwirbel und Luftröhre gesteckt.
»Was sind das da für Blätter?«, fragte Masclau, der jede Bewegung von Leon genau beobachtete.
»Keine Blätter«, sagte Leon. »Ein Blütenstand. Hibiskus.«
»Ist wahrscheinlich da hängen geblieben, als der Kerl die Tote hierhergeschleppt hat«, mutmaßte Zerna.
»Hier gibt’s keinen Hibiskus.« Masclau sah sich mit zusammengekniffenen Augen um.
»Und wenn schon. Sehen wir zu, dass die Bestatter die Tote abholen und wir möglichst bald den Strand wieder freigeben können«, sagte der Polizeichef.
»Ich denke, das könnte noch eine Weile dauern«, meinte Leon. »Zwischen den Felsen kann man leicht etwas übersehen.«
»Lassen Sie das mal unsere Sorge sein, Docteur«, sagte Masclau.
Leon zog mit spitzen Fingern die etwa sieben Zentimeter lange Blüte aus der Wunde und steckte sie in eine durchsichtige Asservatentüte. »Das könnte ein Hinweis sein«, sagte er nachdenklich.
»Was für ein Hinweis? Was meinen Sie?« Zerna klang genervt.
»Was, wenn der Täter uns zu einer bestimmten Stelle führen will?«
»Sie denken, das ist eine Botschaft oder so was?«, fragte Masclau.
»Ganz genau.«
»Hier gibt es aber keinen Hibiskus.« Zerna sah sich um.
»Ich habe einen Hibiskus gesehen, als wir den Pfad heruntergekommen sind.« Leon deutete in Richtung Küste.
»Wo genau?«, fragte der Lieutenant.
»Am anderen Ende der Bucht. Knapp oberhalb vom Strand«, Leon deutete vage nach Westen. Dann sagte er zu Zerna gewandt: »Sie können die Tote jetzt in die Rechtmedizin bringen lassen.«
»Das ist doch wohl eher Ihre Aufgabe«, sagte der Polizeichef schlecht gelaunt.
»Ich werde nach dem Hibiskus sehen.« Leon stand auf. »So was lässt mir keine Ruhe.«
»Am Strand? Da ist es heiß wie im Backofen«, sagte Masclau.
»Dann sollten Sie sich einen Sonnenschirm mitnehmen.« Leon ließ seine Aktentasche zuschnappen und lief los. »Auf geht’s.«
»Aber Docteur?« Zerna sah dem Rechtsmediziner sprachlos hinterher.
Es war noch nicht elf Uhr, aber die Sonne brannte bereits seit Stunden erbarmungslos auf die Küste nieder. Leon hatte beschlossen, direkt an der Wasserlinie den Strand entlangzulaufen. Er hatte Schuhe und Strümpfe ausgezogen und kühlte seine Füße in den kleinen Wellen, die das Meer gegen den Strand schickte. Hier, in der Bucht zwischen den Felsen, war der Sand gröber. Ab und zu blieb Leon stehen. Er mochte das Kitzeln an den Fußsohlen, wenn die Strömung des rücklaufenden Wassers einem den Sand unter den Füßen wegzog. Leon genoss diese kleinen Spaziergänge. Er krempelte seine Jeans bis zum Knie hoch und setzte einen Fuß vor den anderen. Das kühle Meer half ihm, seine Gedanken zu ordnen. Leon sah über das glitzernde Wasser und atmete den leicht brackigen Geruch von Seetang und warmem Schwemmholz ein, das der letzte Sturm in die Bucht gespült hatte und das jetzt in der Hitze seine Feuchtigkeit verdampfte.
»Docteur, wir müssen uns beeilen!« Masclau wedelte mit seinem Funkgerät. »Sonst sind die Touristen hier, bevor wir oben an der Straße alle Wege gesperrt haben.«
»Hier irgendwo.« Leon sah sich um. Er hatte gar nicht auf den Lieutenant geachtet und deutete auf einen Einschnitt in den Felsen. »Da geht es nach oben.«
Leon marschierte entschlossen die Stufen zwischen den Klippen hinauf, und der Lieutenant folgte ihm. Der Beamte war überzeugt, dass der kleine Ausflug nur eine weitere spleenige Aktion des eigenwilligen Médecin Légiste aus Deutschland war. In Wirklichkeit war er sicher, dass sie nichts finden würden. Masclau schüttelte genervt den Kopf.
»Na, habe ich zu viel versprochen?« Leon war stehen geblieben.
»Wieso?«, fragte Masclau und sah sich um. »Ich sehe nichts.«
»Aber hören Sie mal.« Leon hob den Zeigefinger wie für ein Kind, dessen Aufmerksamkeit man auf ein bestimmtes Geräusch lenken wollte.
Masclau legte den Kopf schief und konzentrierte sich. »Es summt.«
»Lucilia sericata.« Leon konnte seine Euphorie kaum verbergen.
»Luci- wer?«
»Schmeißfliegen. Wir müssen ganz nahe sein.«
Leon bezeichnete die Schmeißfliegen gern als seine zuverlässigsten Assistenten. Sie konnten den Tod eines Lebewesens kilometerweit wahrnehmen. Ihr Einnisten, die Eiablage und das Entstehen von Maden folgten seit Millionen von Jahren dem immer gleichen zuverlässigen Fahrplan.
Leon folgte aufmerksam dem Pfad durch die Felsen. Ein Gebüsch aus wildem Hibiskus wuchs direkt neben dem Weg und bildete mit seinen ausladenden Blütenzweigen in der flirrenden Hitze einen schattigen Tunnel.
Es dauerte nur Sekunden, bis sich Leons Augen an den Schatten gewöhnt hatten. Dann sah er, was die Fliegen schon vor Stunden entdeckt hatten: den Kopf eines Menschen. Akkurat in eine Felsspalte gezwängt. Wimmelnde Insekten krochen über das tote Fleisch und gaben dem abgetrennten Kopf etwas Lebendiges. Leon trat einen Schritt näher heran. Er wedelte mit der Hand, und ein Schwarm Schmeißfliegen flog mit lautem Summen auf, umkreiste den Kopf, um sich gleich wieder an einer anderen Stelle niederzulassen.
»Verdammte Scheiße!« Masclau zog die Luft ein.
Leon betrachtete fasziniert die Fliegen, die durch Mund und Nase und durch die große offenliegende Halswunde in den Kopf eingedrungen waren.
»Das war wohl kein Unfall«, murmelte Masclau schal.
»Ganz bestimmt nicht«, sagte Leon, während er den Schädel untersuchte. Es war der Kopf einer Frau, einer blonden Frau. Er gehörte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu der Toten, die sie nur wenige Hundert Meter entfernt auf dem Stuhl in den Felsen gefunden hatten.
Sie hatte keinen leichten Tod, dachte Leon, während er die Wunden untersuchte. Jemand hatte mit einem scharfen Messer dem Opfer das Gesicht regelrecht vom Schädelknochen gefetzt. Dutzende von Stichwunden hatten das Gesicht so zerstört, dass man es kaum mehr ausmachen konnte. Die Art der Verletzungen hatte etwas zutiefst Böses und Zerstörerisches. Als wäre der Täter wie von Sinnen gewesen. Auf der anderen Seite war der Mörder planvoll genug gewesen, die Polizei zu dem Kopf zu führen.
»Was geht in einem Menschen vor, der so was tut?«, sprach Leon seine Gedanken laut aus.
In diesem Moment tauchte Zerna auf dem Pfad auf. Er hatte einen Lieutenant und einen Polizeiaspiranten im Schlepptau. Zerna und seine beiden Begleiter blieben wie angewurzelt vor Leon und dem Kopf stehen.
»Oh, verdammt«, sagte Zerna, als er den Kopf sah.
»Wer macht denn so was?«, fragte der junge Polizeiaspirant fassungslos. Er sah zu Boden und schirmte mit der Hand den Blick so ab, dass er den abgetrennten Kopf nicht mehr sehen musste.
»Jemand, der nicht mehr ganz klar in der Birne ist«, sagte Zerna nüchtern und sah den jungen Polizisten an. »Was glauben Sie denn, wer so was tut?«
»Ich … weiß nicht«, stotterte der junge Beamte und versuchte, sich abzuwenden.
»Sie müssen lernen hinzusehen«, forderte ihn der Polizeichef auf, »wenn Sie zur Aufklärung dieses Falles etwas beitragen wollen.«
»Natürlich, ich möchte … also, ich wollte …«, stotterte der Beamte und suchte nervös eine Stelle, wo er seinen Blick verbergen konnte. Als er zum zweiten Mal den Kopf und die Schmeißfliegen sah, musste er würgen. Der junge Mann hechelte mit weit geöffnetem Mund, als er vergeblich versuchte, den Brechreiz zu unterdrücken. Er machte zwei schnelle Schritte zur Seite und übergab sich neben den Pfad.
»Gehen Sie da vorne in den Schatten der Strandkiefern und atmen Sie tief durch«, riet Leon ihm mitfühlend.
»Entschuldigen Sie, ich …«, der junge Polizist ging ein paar Meter weiter, stützte seine Hände auf die Oberschenkel und versuchte, seine Atmung zu kontrollieren.
»Der Täter war immerhin klar genug, uns hierherzulocken«, sagte Leon und sah den Polizeichef an.
»Sage ich doch«, antwortete Zerna. »Ein Spinner.«
»Bestimmt einer von diesen Drogenmackern«, sagte der zweite Polizist. »Die kommen um diese Jahreszeit in Scharen aus Paris und Toulouse.«
»Diese Dealer kennen keine Moral«, der Polizeiaspirant war zurückgekommen.
»Das halte ich für unwahrscheinlich.« Leon hielt seinen Kopf schief wie ein Sammler, der ein neues Kunstwerk begutachtet. »Da ist jemand systematisch vorgegangen. Jemand, der wusste, was er tut.«
»Verschonen Sie mich.« Zerna hob abwehrend die Hände, als wüsste er, was jetzt kommen würde.
»Wer immer das da getan hat«, Leon deutete auf den Kopf mit den Fliegen, »der macht so was nicht zum ersten Mal.«
»Ich bitte Sie«, sagte Zerna, »das können Sie doch gar nicht wissen.«
»Tu ich auch nicht, aber es ist so ein Gefühl.«
»Ein Gefühl«, wiederholte der Polizeichef sarkastisch. »Na klar, unser Médecin Légiste hat so ein Gefühl.«
5. Kapitel
Mit dem Verkauf seines Hauses hätte Lagarde ein Vermögen machen können. Es lag mitten im Ortskern von Le Lavandou und reichte über drei Etagen. Im Parterre gab es ein Ladengeschäft, das Lagarde nur über die Sommersaison kurzzeitig an Pop-up-Stores vermietete. Und auf der Terrasse im ersten Stock konnte man bis zum späten Nachmittag in der Sonne sitzen und aufs Meer sehen.
Lagarde hätte es sich als wohlhabender Hausbesitzer bequem machen können. Aber genau das wollte er nicht. Im Gegenteil, er fürchtete sich sogar vor einem derartigen Leben. Also machte er sich Sorgen. Zum Beispiel redete er sich ein, dass er kaum genug Geld hatte, um sein Leben und das seiner Frau zu finanzieren. Er schimpfte den ganzen Tag über gestiegene Kosten und rechnete sogar die Wasserrechnung nach. Seine Frau ertrug seine Sparsamkeit mit erstaunlicher Ruhe. Sie vertraute den Gesetzen der Natur und hatte gute Karten: Schließlich war sie fast dreißig Jahre jünger als er. Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft, dachte Madame Lagarde, würde sich das alles auszahlen. Als Erstes würde sie dieses scheußliche Haus verkaufen und dann, dann würde ein neues Leben beginnen. Bis dahin ertrug sie ihren Mann und spielte die brave Hausfrau.
Isabelle kannte Pierre Lagarde nur vom Sehen. Sie wusste, dass er als ein wenig verschroben galt. Ein großer, eher untergewichtiger Mann, der nur das Notwendigste sprach und auch bei größter Hitze dunkle Jeans und schwarze Hemden trug. Als junger Mann hatte Lagarde volles blondes Haar getragen, das ihm bis auf die Schultern reichte. Heute waren ihm davon nur ein paar schüttere Strähnen geblieben, die bis zu seinen Augen hingen und hinter denen er sich zu verstecken schien.
Isabelle war zu Fuß zum Haus der Lagardes gegangen. Vom Polizeirevier aus hatte sie keine zwanzig Minuten gebraucht. Sie wurde von Lieutenant Mohamad Kadir begleitet, dessen Familie aus Tunesien stammte und den die meisten Kollegen Moma nannten. Er selbst war in Nizza geboren worden und gab sich gern französischer als die Franzosen in dritter Generation.
»Was denkst du über die Theorie des großen Unbekannten?«, fragte Isabelle ihren Begleiter.
»Weiß nicht«, sagte Lieutenant Kadir, »als Killer kann ich mir Lagarde nur schwer vorstellen.«
»Hast du jemals einen Mörder getroffen, dem man die böse Tat angesehen hat?«, fragte Isabelle und dachte dabei an Leons Worte.
»Wenn du mich so fragst …« Der Lieutenant war stehen geblieben und schien über Isabelles Frage nachzudenken.
»Nicht durch den Laden. Nehmen wir den hinteren Eingang«, sagte Isabelle. »Muss schließlich nicht jeder sehen, dass die Polizei zu Besuch ist. Du weißt ja, wie die Leute sind.«
Wenige Minuten später läutete Isabelle an der hinteren Tür des Lagarde-Hauses. Ein elektrischer Gong war im Inneren zu hören, dann wurde geöffnet.
Elodie Lagarde war eine kleine, etwas füllige Person mit einem skeptischen Blick. Sie öffnete die Tür nur eine Handbreit.
»Ja?«, sagte Madame Lagarde vorsichtig.
»Bonjour«, sagte Isabelle und zog ihren Dienstausweis aus ihrer Uniformbluse. »Ich bin Capitaine Morell, das ist Lieutenant Kadir. Sie sind Madame Lagarde?«
»Ja.«
»Wir müssen mit Ihrem Mann reden«, sagte Isabelle.
»Jetzt passt es nicht«, sagte Madame Lagarde. »Es geht ihm nicht gut.«
»Wir müssten aber dringend mit ihm sprechen«, mischte sich der Lieutenant ein. »Jetzt gleich.«
»Wissen Sie, was Pierre erlebt hat, da draußen in den Felsen?«
»Genau deswegen sind wir hier, Madame«, sagte Isabelle. »Ihr Mann ist ein wichtiger Zeuge.«
»Können wir jetzt bitte reinkommen?« Die Ungeduld in Kadirs Stimme klang nur unterschwellig mit, während er freundlich, aber entschlossen die Haustür aufhielt.
Madame Lagarde wollte sich beschweren, als sie von ihrem Mann unterbrochen wurde.
»Wer ist da gekommen, Elodie?« Pierre Lagarde erschien in der Tür.
»Das sind Leute von der Polizei«, antwortete sie. »Ich habe ihnen schon gesagt, dass du nichts weißt.«
Lagarde beugte sich ein Stück in Richtung Isabelle, dabei legte er den Kopf schief, sodass die Polizistin das große Pflaster sehen konnte, das von seinem Hinterkopf bis zum Halsansatz reichte.
»Er hat nichts mitbekommen … Sag ihnen, dass du nichts gesehen hast«, forderte seine Frau ihn auf. »Mein Mann soll sich ausruhen, hat der Arzt gemeint. Ich hab gleich gesagt: Du gehörst in die Notaufnahme.«
»Ich gehe nicht ins Krankenhaus. Müssen wir das schon wieder diskutieren?« Ohne auf die Bemerkung seiner Frau einzugehen, wandte er sich an Isabelle und ihren Kollegen: »Gehen wir ins Wohnzimmer.«
Im Wohnzimmer hingen große Fotos an den Wänden. Der Strand am Morgen, der Strand am Abend, Schwemmholz, Möwen, Wellen, Strandkiefern und Fischerboote im Hafen. Nur Menschen waren auf den Bildern keine zu sehen. Das fiel Isabelle sofort auf.
»Eindrucksvoll«, sagte sie, der kein treffenderes Adjektiv einfiel. »Haben Sie die alle gemacht? Ist sicher eine Menge Arbeit.«
»O ja«, sagte Lagarde. »Sie brauchen viel Geduld, wenn Sie gute Fotos machen wollen.«
»Pierre ist manchmal den ganzen Tag draußen, um zu fotografieren.«
»Verstehe«, sagte Isabelle, »waren Sie heute Morgen auch wegen der Fotos unterwegs?«
»Natürlich, was denken Sie denn?«
»Allein?«, fragte Isabelle, ohne zu antworten.
»Ich bin immer allein am Wasser.«
»Heute Morgen offenbar nicht«, sagte Isabelle, und Lagarde zuckte mit den Schultern.
»Ich habe niemanden gesehen«, sagte er.
»Aber Sie haben doch etwas gehört?« Die ausweichende Art des Mannes irritierte Lieutenant Kadir.
»Es hat geknirscht, als ob jemand mit Schuhen über Kies geht.«
»Und dann?«
»Dann habe ich den Schlag abbekommen, und alles war dunkel. Als ich wieder zu mir gekommen bin, war die Sonne schon draußen.«
»Da müssen Sie aber eine ganze Weile ohnmächtig gewesen sein«, sagte Kadir.
»Der Arzt hat gemeint, ich wäre ungefähr zwei Stunden weg gewesen.«
»Ich möchte Sie bitten, in den nächsten zwei Tagen bei uns auf der Wache vorbeizukommen«, sagte Isabelle, »damit wir Ihre Aussage protokollieren können.«
Der Fotograf griff in die Tasche seines Morgenmantels und zog einen Speicherchip hervor, den er Isabelle reichte.
»Was ist das?«, fragte sie.
»Die Fotos von heute Morgen«, sagte Lagarde. »Die wollten Sie doch sehen.«
»Das musst du nicht machen«, sagte Madame Lagarde zu ihrem Mann.
»Jetzt lass es gut sein, Elodie«, beschwichtigte er.
Isabelle und Moma war klar, dass ihr Besuch zu Ende war.
6. Kapitel
Es war bereits später Vormittag, als Leon mit seinem Peugeot-Cabriolet, das Dach zurückgeklappt, auf den Parkplatz der Klinik Saint-Sulpice einbog. Er hatte sich an diesem Tag bewusst Zeit gelassen für die Fahrt zur Klinik. Er war über die Küstenstraße gekommen, ohne Stress. Im Château de Brégançon hatte er einen Karton Rosé »Cuvée Isaure« gekauft. Isabelle liebte diesen Rosé mit seinem beerigen und zugleich ein wenig sandigen Geschmack. Es handelte sich um einen dieser Weine, die das Aroma einer ganzen Landschaft in sich trugen.
Leon hatte seinen Wagen im Schatten einer großen Platane abgestellt. Er schloss das Verdeck, um den Wein so gut es ging vor Wärme zu schützen. Falls die Temperatur heute noch weiter anstieg, könnte er immer noch den Karton in sein klimatisiertes Büro stellen.
Leon hätte schon vor einer Stunde hier sein können, aber er hatte seinen Arbeitsbeginn hinausgezögert. Nicht weil er es mit einem verstörenden Mord zu tun hatte, sondern weil es ihn manchmal Überwindung kostete, seine Abteilung für Rechtsmedizin im Souterrain der Klinik zu betreten. Vor allem an warmen Sommertagen wie diesem.
Leon war Rechtsmediziner aus Leidenschaft und stolz darauf. Aber der Gang in die durch Kunstlicht beleuchteten Räume der Rechtsmedizin war immer auch ein Besuch des Bösen. Es war sozusagen die erste Tür auf dem Weg in die Hölle. Ein Pakt mit dem Teufel. Man musste lernen, böse zu denken, wenn man die Täter verstehen wollte, die so etwas taten. Es waren die scheinbar belanglosen Spuren am Opfer, die halfen, einen Täter zu erkennen und sein Motiv für die blutige Tat zu verstehen. Leon kannte sich. Er fühlte sich wie ein Jäger. Hatte er erst einmal Witterung aufgenommen, dann packte ihn das Jagdfieber, und er würde so lange in der Unterwelt bleiben, bis er Antworten auf seine brennenden Fragen fand.
Leon nahm die Tüte mit den beiden übrig gebliebenen Croissants vom Frühstück vom Beifahrersitz und ging zum Haupteingang der Klinik. Mit einem hydraulischen Zischen fuhren die Glastüren auseinander und schlossen sich wieder hinter ihm, als er das Gebäude betrat. Die Halle war maßlos unterkühlt, wie üblich. Am Empfang saß eine Schwester.
»Bonjour, Madame!« Leon war zur Patientenanmeldung gegangen und schwenkte die Tüte von Pain du Port. »Ich habe Ihnen etwas mitgebracht, Schwester Monique«, sagte er mit einem herzlichen Lächeln.
Die Schwester war Anfang vierzig. Leon konnte ihr ansehen, dass sie davon träumte, schlanker zu sein, aber darüber würde natürlich ein Mann wie Leon niemals eine Bemerkung machen. Schwester Monique war zuvorkommend und liebenswürdig, jedenfalls solange sie es mit dem Docteur zu tun hatte, ihrem Docteur. Ansonsten konnte sie durchaus resolut sein. Zum Beispiel wenn es darum ging, die Patientenanmeldung zu organisieren.
»Sie wissen doch, dass ich gerade auf Diät bin«, sagte Schwester Monique mit Blick auf die Tüte der Bäckerei.
»Sehr vernünftig. Solange man es nicht übertreibt«, sagte Leon ganz im Tonfall des engagierten Doktors. »Vielleicht nehmen Sie nur ein Pain-Choc und geben das zweite an eine Kollegin weiter«, sagte er und fügte dann im Flüsterton hinzu: »Die sind von Pain du Port.«
Schwester Monique schnappte sich mit schnellem Griff die Stückchen und ließ sie vor sich unter dem Tresen verschwinden.
»Danke«, sagte sie.
»Es gibt keine Diät, die man nicht auch mal unterbrechen darf«, sagte Leon, und Monique lächelte dankbar.
»Sie werden oben erwartet.« Die Schwester deutete in Richtung Decke. »Dr. Bayet persönlich. Er hat einen Mann vom Investoren-Board dabei.«
Leon ärgerte sich, er hatte den Termin völlig vergessen. Dabei war das Meeting von Dr. Bayet angekündigt worden. Die Klinik Saint-Sulpice war lange Zeit ein etwas verschlafenes Provinzkrankenhaus gewesen. Bis das Département entschieden hatte, die Einrichtung umzubauen und auf den neuesten Stand der Medizintechnik zu bringen, indem man einer Gruppe von Investoren die Finanzierung dieses Projektes überließ. Das war vor sieben Jahren gewesen.
Ab und zu schickte der Klinikvorstand jemanden von einer Unternehmensberatung, der sich über die Arbeit des Hospitals informierte und dem Vorstand Vorschläge zur Reduktion der Kosten vorlegen sollte. Im Klartext hieß das: Es sollte gespart werden wo immer möglich. Und Leon ahnte auch schon, wo die Gesellschaft entsprechendes Einsparpotenzial sah.
Leon nahm die Treppe in den sechsten Stock, wo Klinikchef Dr. Hugo Bayet sein Büro hatte. Er klopfte an eine schwere Holztür.
»Ja, bitte«, kam es kurz angebunden aus dem Büro von Madame Koenig, der Chefsekretärin der Geschäftsleitung. Eine strenge Person, die stets im Hosenanzug herumlief und von Dr. Bayet gern eingesetzt wurde, wenn es darum ging, den Mitarbeitern unangenehme Nachrichten zu überbringen. Dass sie im Vorzimmer bereits auf Leon wartete, machte ihn mehr als skeptisch.
»Der Termin war schon vor einer halben Stunde angesetzt«, sagte Madame Koenig im Ton einer gestressten Oberlehrerin mit einem demonstrativen Blick auf ihre Uhr. Sie ging zur Tür von Dr. Bayet, klopfte und öffnete.
»Docteur Ritter wäre jetzt da«, sagte sie.
»Kommen Sie herein, Docteur Ritter«, rief Klinikchef Bayet mit falscher Fröhlichkeit in der Stimme. Er wies auf den Herrn neben ihm, der den weißen Kittel eines Arztes trug. »Das ist Monsieur Mendez von der Société des Cliniques Provençales.«
»Wir hatten Sie schon früher erwartet, Docteur Ritter.« Monsieur Merdez reichte Leon die Hand.
»Tut mir leid, aber uns ist leider ein Mordopfer dazwischengekommen.«
»Wir haben bereits davon gehört«, sagte Klinikchef Bayet, »eine scheußliche Sache.«
»Das ist wahr«, antwortete Leon sachlich. »Wir stehen ziemlich unter Druck bei dieser … Sache.« Leon betonte den Ausdruck »Sache«.
»Natürlich.« Bayet wandte sich an seinen Gast. »Wie Sie bestimmt wissen, hat Docteur Ritter mit seiner Abteilung herausragende Untersuchungen durchgeführt, die zur Lösung einiger äußerst komplizierter Kriminalfälle geführt haben.«
»Ja, ich hörte davon«, sagte Monsieur Merdez. »Aber … ist nicht genau das die Aufgabe einer rechtsmedizinischen Abteilung, die Staatsanwaltschaft mit korrekten Untersuchungsberichten zu versorgen? Ich denke, wir müssen trotzdem über Ihre Abteilung sprechen.«
»Dann müsste ich schnell noch dem Staatsanwalt und der Mordkommission von Toulon Bescheid geben.« Leon sah, dass Merdez einen fragenden Blick an Dr. Bayet richtete. »Wegen der Verzögerung.«
»Ich mache den Herren einen Vorschlag«, versuchte Dr. Bayet, zu vermitteln. »Wir lassen Dr. Ritter zunächst seine Untersuchung machen und treffen uns dann später wieder hier in meinem Büro. Sagen wir, gegen siebzehn Uhr?«
»Na ja. Ich möchte einer so dringenden Untersuchung natürlich nicht im Wege stehen«, sagte der Besucher und klang leicht angefasst.
»Sehr gut, wir sehen uns dann später«, sagte Leon und verließ das Büro.
Er nahm die Treppe vom sechsten Stock bis ins Souterrain. Leon behauptete stets, dass er den Lift aus sportlichen Gründen mied, in Wirklichkeit litt er unter Klaustrophobie und konnte Aufzüge schlichtweg nicht ertragen. Besonders schlimm wurde es, wenn er mit Fremden in der Enge eines Aufzuges eingeschlossen war.
Leon war Dr. Bayet dankbar dafür, dass er das Meeting so kurzfristig auf den Nachmittag verschoben hatte. Ihm war klar, dass dieser Merdez von der Société mit schlechten Nachrichten gekommen war. Und Leon sollte der Empfänger dieser Nachrichten sein. Die Klinik Saint-Sulpice hatte regelmäßig Besuch von Unternehmensberatern. Das Ziel dieser sogenannten Spezialisten war immer das gleiche: Verschlankung des Personalstandes, wie es immer so elegant formuliert wurde, und Senkung der Kosten.
Die Abteilung von Leon war in der Tat alles andere als profitabel. Das Problem war, dass eine Klinik immer Leistungen an lebenden Patienten abrechnen und so für Umsatz sorgen konnte. Doch in der Rechtsmedizin gab es nun einmal keine lebenden Patienten. Wer bei Leon in der Abteilung landete, war bereits tot. Es gab natürlich die Gutachten, die für Versicherungen, Polizei oder bei Gewalttaten erstellt wurden, aber das Geld für die Abteilung war immer knapp. Der einzige Umstand, der bisher verhindert hatte, dass die Abteilung nicht schon längst aufgelöst worden war, bestand in Leons hervorragenden Verbindungen zur Verwaltung des Département Var und der Tatsache, dass die Abteilung von höchster Stelle in Saint-Sulpice implantiert worden war. Das hieß im Klartext: Die Abteilung genoss den Schutz von Toulon und dem dortigen Präfekten. Deshalb war seinerzeit die Genehmigung für die Modernisierung der Klinik an den Bau einer Rechtsmedizinischen Abteilung gekoppelt worden. Diese Abteilung zu schließen, war also nicht so einfach, aber die Investoren versuchten es immer wieder und wurden von Mal zu Mal erfindungsreicher. Sie versuchten, die Rechtsmedizinische Abteilung und ihren Leiter zu diskreditieren, warteten nur darauf, Leon und seiner Abteilung Fehler oder Versäumnisse nachzuweisen. Was nicht einfach war, denn sosehr Leon das Laissez-faire-Lebensgefühl des Südens schätzte, umso pingeliger war er, wenn es um seine Arbeit und »sein« Institut ging.
Wenige Minuten später betrat Leon die Abteilung der Rechtsmedizin. Die kühle und ruhige Atmosphäre stand im krassen Gegensatz zu der Hektik in den Stockwerken über ihnen. Hier im Souterrain herrschten, auch wenn das Wetteramt mal wieder eine Rekordhitze verkündete, immer angenehme einundzwanzig Grad Celsius. Allerdings gab es keine Fenster, lediglich ein paar Oberlichter im Obduktionsraum. Anfangs war Leon besorgt gewesen, dass es ihn bedrücken würde, so ganz von der Außenwelt abgeschlossen zu sein. Doch das Gegenteil war der Fall. Die ruhige Atmosphäre der Abteilung sorgte für eine innere Ruhe in ihm, und er genoss die künstliche Abgeschiedenheit. Die Untersuchungsräume waren wie alle OP-Räume in der Klinik hellblau gekachelt, pedantisch sauber und medizintechnisch auf dem neuesten Stand.
Im Gang kam Leon sein Assistent entgegen. Der Mitarbeiter trug genau wie Leon einen Arztkittel mit Namensschild auf der Brusttasche: Olivier Rybaud, Assistant Médical.
»Bonjour, Docteur«, sagte Rybaud.
»Bonjour, Professeur«, begrüßte Leon seinen Assistenten, ein kleines Spiel zwischen den beiden.
»Der Mann von der Société war hier«, sagte Rybaud.
»Hab ihn schon gesehen.« Leon winkte ab. »Ich denke, er wird uns in Ruhe lassen. Wenigstens heute.«
»Die Bestatter haben die Frau gebracht.«
»Wann?«
»Ist eine knappe halbe Stunde her.« Rybaud sah auf seine Uhr. »Ich habe sie in der Eins vorbereitet.«
»Sehr gut. Dann lassen Sie uns gleich anfangen.«
Leon betrat den Obduktionsraum. Vor ihnen im Licht der LED-Lampen hatte Rybaud ein hellblaues OP-Tuch über die Tote gelegt.
Der Körper des Opfers sah merkwürdig unfertig aus, als wäre er zu kurz, dachte Leon.
In diesem Moment schob Rybaud den Rollwagen, auf dem eine polierte Wanne aus Edelstahl stand, zum Sektionstisch. Leon nickte seinem Assistenten zu, und der zog das weiße Tuch von der Wanne. Da lag der Kopf des Opfers.
Als hätte jemand eine Puppe bauen wollen, aber die Zeit hatte nicht gereicht, dachte Leon, als er den Torso und den Kopf betrachtete.