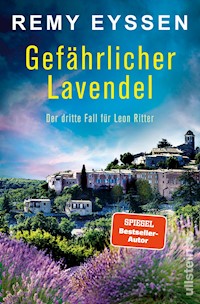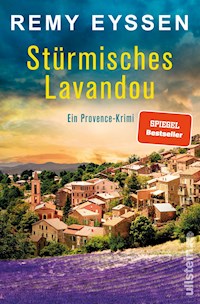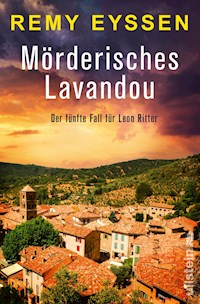
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Feriensaison in Le Lavandou ist zu Ende, und der kleine Ort sollte sich vom sommerlichen Trubel erholen. Auch Rechtsmediziner Leon Ritter hat nun mehr Zeit, um seinen Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen: Café au lait trinken und Boule spielen. Da verschwindet eine Hotelangestellte in den einsamen Hügeln der Provence, und kurz darauf wird ihre Leiche gefunden. Damit sind auch Leon Ritters Hoffnungen auf einen beschaulichen Spätsommer dahin. Schnell gibt es einen ersten Verdächtigen, doch Leon zweifelt an dessen Schuld. Er stellt eigene Nachforschungen an und steht deshalb bald selbst in der Kritik. Die einzige, die noch zu ihm hält, ist seine Lebensgefährtin, Capitaine Isabelle Morell, doch plötzlich ist die stellvertretende Polizeichefin verschwunden...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mörderisches Lavandou
Der Autor
Remy Eyssen, geboren 1955 in Frankfurt am Main, arbeitete zunächst als Redakteur bei der »Münchner Abendzeitung«, später als freier Autor für Tageszeitungen und Magazine. In den Neunzigerjahren entstanden die ersten Drehbücher. Es folgten zahlreiche Arbeiten für TV-Serien und Filme bei allen deutschen Fernsehsendern.In unserem Hause sind vom Autor bereits erschienen: Tödlicher Lavendel · Schwarzer Lavendel · Gefährlicher Lavendel · Das Grab unter Zedern
Das Buch
Es ist Oktober, und die Feriensaison in Le Lavandou ist beendet, die Strandcafés schließen, und die Einheimischen gönnen sich ihren wohlverdienten Urlaub. Während sich die kleine Stadt an der Küste vom Trubel der Sommermonate erholt, verschwindet jedoch eine Hotelangestellte in den Hügeln der Provence. Auch Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter hatte sich auf die ruhige Jahreszeit gefreut und wollte seinen Lieblingsbeschäftigungen mehr Zeit widmen: Zeitung lesen, Café au Lait trinken und Boule spielen. Mit der beschaulichen Ruhe ist jedoch schlagartig Schluss, als eines Morgens mitten in Lavandou ein menschlicher Fuß gefunden wird. Leon glaubt nicht an die Schuld des Verdächtigen, der bald festgenommen wird, und gerät zusätzlich selbst ins Visier der Ermittler. Schließlich beginnt ein riskanter Wettlauf gegen die Zeit. Wird es ihm gelingen, dem Täter rechtzeitig das Handwerk zu legen?
Remy Eyssen
Mörderisches Lavandou
Kriminalroman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Mai 2019© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2019Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, München (Himmel);Getty Images / © Juergen Richter / LOOK-foto (Dorf)E-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-8437-2073-1
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
Empfehlungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Meiner Frau und meiner Tochterfür ihre Geduld und ihren Rat
Prolog
Die Frau lief den schmalen Pfad entlang, der sich viele Kilometer weit über die Höhen des Massif des Maures schlängelte. Vorbei an den immergrünen Ginsterbüschen und unter den gewaltigen Esskastanien hindurch, aus deren Früchten man in dieser Gegend Maronencreme herstellte. Von hier oben reichte der Blick weit über das Naturschutzgebiet bis hinunter zur Küste. Im Osten konnte man im Dunst des Nachmittags die schneebedeckten Gipfel der Alpes Maritimes erahnen. Vor sich, genau im Westen, sah die junge Frau jetzt die flache Sonne, die sich hinter Toulon auf das Meer zu senken schien.
Doch die junge Frau konnte den Zauber dieser grandiosen Landschaft nicht genießen. Die Frau hatte Angst. Was hatte sie sich nur dabei gedacht, hier oben zu laufen? Sie hätte wissen müssen, dass sie zu dieser Jahreszeit ganz allein auf ihrer Lieblingsstrecke sein würde. Hätte wissen müssen, dass es Anfang Oktober schon viel früher dunkel wird. Verdammt, sie hätte gar nicht hierherkommen sollen. Die Läuferin war professionell ausgerüstet: halblange Jogginghose, atmungsaktives Shirt und eine federleichte Gore-Tex-Jacke gegen den Wind. Doch sie lief unsicher, stolperte, fing sich wieder und versuchte verzweifelt ihren Rhythmus zu finden. Sie warf einen gehetzten Blick über die Schulter. Folgte ihr jemand?
Die Läuferin versuchte, sich ganz auf den Pfad zu konzentrieren, der jetzt bergan führte. Ihr Atem ging stoßweise. Ihre Schritte waren unbeholfen, sie fürchtete, erneut zu stolpern. Noch ein Fehltritt und sie würde stürzen. Irgendwohin zwischen die Dornen der Zistrosen und die harten Zweige der Rosmarinbüsche. Seit einer Viertelstunde fühlte sie den stechenden Schmerz im linken Fuß – bei jedem Schritt. Sie hätte den Lauf längst abbrechen müssen. Sie wollte sich doch schonen, wollte mehr Verantwortung zeigen. Ja, verdammt, sie wusste, dass sie auf sich achten musste, gerade jetzt. Aber sie konnte sich nicht schonen. Jetzt musste sie laufen, so schnell sie konnte. Sie hatte Angst, panische Angst. Die junge Frau verlor für einen Augenblick den Halt, glitt mit dem Fuß von einem glatten Felsen ab und taumelte. Sie unterdrückte einen Schrei, als ihr der Schmerz wie ein Messer in das Fußgelenk fuhr. Es ist bestimmt nur eine Zerrung, beruhigte sie sich, nur eine Zerrung.
Auf keinen Fall durfte sie in Panik geraten. Vielleicht bildete sie sich ja alles nur ein. Das Knacken kam vom Wind in den Ästen. Das Rascheln waren Kaninchen und Dachse, die sie mit ihrem einsamen Lauf aufscheuchte. Es gab niemanden, der ihr folgte. Sie war einfach nur überempfindlich. Das hatte auch der Arzt gesagt. War das ein Wunder? Die Beerdigung ihrer Mutter lag noch kein halbes Jahr zurück. Und trotzdem griff sie gelegentlich noch zu ihrem Handy, um sie anzurufen. Ob dieser Impuls jemals verschwinden würde? Sie hatte sich das anfangs nicht eingestehen wollen, aber mit dem Tod der Mutter hatte sie auch einen Teil ihrer Selbstsicherheit verloren. Die war einfach verschwunden, wie Wasser im Sand.
»Wir schaffen das schon, du musst Geduld haben«, hatte ihr Vater gesagt. Aber die Tränen in seinen Augen sagten, dass er den eigenen Worten nicht glaubte.
Die junge Frau versuchte, regelmäßiger zu atmen. Sog die warme Oktoberluft ein und ließ sie langsam wieder aus der Lunge herausströmen. Zwei Schritte ein-, vier Schritte ausatmen. Wäre es nach ihr gegangen, hätte sie bestimmt nicht den Job in Lavandou angenommen. Aber sie hatte es ihrer Mutter versprochen, kurz vor deren Tod. Das Hotel in Arles konnte ihr Vater unmöglich allein führen und ihr fehlte die Erfahrung. Also war sie in Le Lavandou gelandet. Sechs Monate Praktikum in einem Viersternehotel. Am Anfang dachte sie, sie würde es keine Woche aushalten. Das war jetzt vier Monate her. Sie hätte das Hotel der Eltern nicht so früh übernehmen wollen. Sie wollte erst mal herumreisen. New York, Paris, London, Singapur. Es gab so viele aufregende Orte auf der Welt.
In diesem Moment hörte sie es wieder. Das Schnaufen. Jemand folgte ihr, jetzt war sie ganz sicher. Sie beschleunigte ihre Schritte. Sie konnte nicht mehr weit von der Lichtung entfernt sein, wo sie den Wagen abgestellt hatte. Vierunddreißig Minuten dauerte der Lauf bis zu ihrer Umkehrmarke und dann wieder vierunddreißig Minuten zurück zum Parkplatz. Wenn sie in Form war. Aber jetzt war sie nicht in Form, jetzt musste sie sich zwingen, überhaupt weiterzuhumpeln.
Das waren Schritte, die sie da hörte. Ganz eindeutig. Der Kerl war jetzt hinter ihr. Oder wollte sie sich etwa einreden, sie hätte den Mann nicht gesehen. Wie er da hinter den Kiefern stand und auf sie wartete. Wie ein böser Schatten, der sich zwischen den Bäumen aufzulösen schien. Nein, das war keine Einbildung. Der Mann beobachtete sie seit Tagen. Der Scheißkerl wusste genau, dass sie hier entlangkam.
Er war ihr gefolgt. War so dicht hinter ihr gewesen, dass sie ihn atmen hören konnte. Da hatte sie ihr Tempo beschleunigt. Sie war gut trainiert. Hatte es beim Halbmarathon in Nizza immerhin auf Platz 85 geschafft. Sie wäre dem Kerl leicht davongelaufen. Aber da war dieses Loch im Boden. Nur ein paar Zentimeter weiter nach rechts und sie hätte sich den Fuß nicht umgeknickt. Beim Stadtlauf wäre das das Aus gewesen. Sie hätte sich an den Rand der Strecke gesetzt und entspannt gewartet, bis die Sanitäter sie aufsammelten. Aber das hier war kein Marathon. Hier lief sie nicht für eine dämliche Medaille, hier lief sie um ihr Leben. Das wusste sie. Das sagte ihr der Instinkt.
Der Fuß schmerzte jetzt ununterbrochen. Sie spürte, wie er immer weiter anschwoll, kaum noch in den Schuh passte. Sie versuchte, sich nicht vorzustellen, was mit ihrem Fußgelenk geschehen war. Versuchte, den Schmerz auszublenden.
Solange du in Bewegung bist, wird er dich nicht erwischen, sagte sie sich immer wieder, wie ein Mantra. In diesem Moment hörte sie das Knirschen kleiner Steine. Das war er! Höchstens ein oder zwei Kurven hinter ihr. Sie presste die Lippen aufeinander, um den Schmerzensschrei zu unterdrücken, als sie sich erneut den Fuß vertrat. Irgendetwas in ihrem Gelenk tat einen Knacks. Der Schmerz war scharf und hell. Aus, das war’s. Sie konnte ihren Fuß nicht mehr kontrollieren. Aber sie musste ihn aufsetzen, wenn sie vorwärtskommen wollte, immer und immer wieder. Es fühlte sich an, als würde sie über glühende Kohlen laufen.
Die Sonne verschwand hinter dem Horizont. Für ein paar Minuten leuchtete der sandige Boden in warmem Rot. Der Wind frischte auf, als die Dämmerung aus den Büschen kroch. Sie würde es nicht schaffen, dachte die junge Frau verzweifelt. Sie würde den Parkplatz nicht erreichen, bevor es dunkel wurde. Das Hinken war jetzt stärker geworden. Sie griff sich einen abgebrochenen Ast, der am Boden lag, und stützte sich damit ab, während sie mühsam weiterhumpelte. Würde sie jemand vermissen, wenn sie jetzt einfach stehen blieb und ihr unausweichliches Schicksal akzeptierte? Sollte der Kerl doch kommen. Sollte er doch mit ihr machen, was er wollte. Für einen kurzen Augenblick war sie bereit, einfach aufzugeben. Aber dann lief sie weiter, als hätten sie ihre düsteren Gedanken mit neuer Energie versorgt. Der Pfad senkte sich, und plötzlich konnte sie in der Dämmerung den Parkplatz erkennen, der keine zweihundert Meter mehr entfernt war.
In diesem Moment wurden die Geräusche hinter ihr lauter. Erst ein Poltern, als würde jemand stolpern. Dann das laute Knacken von Zweigen, gleich neben ihr im Gebüsch. Im nächsten Augenblick brach ein Wildschwein durch den Ginster. Es preschte nur Zentimeter entfernt an ihr vorbei, schoss vor ihr den Pfad entlang, stürzte sich zwischen die dornigen Büsche der Macchia und verschwand krachend im Unterholz, so schnell, wie es aufgetaucht war.
Die junge Frau war vor Schreck stehen geblieben. Kaum war das Tier verschwunden, schien die Landschaft in einer geradezu andächtigen Stille zu versinken. Nur die Abendbrise, die feucht und warm vom Meer heraufkam, verursachte ein Rauschen in den Zweigen der Bäume. Die junge Frau fühlte sich plötzlich leicht und befreit. Wie ein Soldat, der auf wundersame Weise als Einziger den Angriff des Feindes überlebt hat. Mit einem Mal schien alle Panik von ihr abzufallen. Sie lief ein paar unbeschwerte Schritte den Pfad entlang, bis die Schmerzen im Fuß sie daran erinnerten, dass sie die letzten Minuten nicht geträumt hatte.
Der vierzig Jahre alte, cremefarbene Citroën DS, der ihrem Freund gehörte, stand noch dort, wo sie ihn vor anderthalb Stunden abgestellt hatte. Der Wagen war etwas heruntergekommen, aber er funktionierte noch immer einwandfrei. Die junge Frau hinkte zu dem Auto, das einsam unter den großen Kastanien parkte. Der Schuh schnitt schmerzhaft ins Fleisch. Sie wollte den verdammten Joggingschuh nur noch loswerden. Sie stützte sich auf die Motorhaube und zerrte den Schuh von ihrem nackten Fuß. Sofort spürte sie Erleichterung. Jetzt einfach nur noch einsteigen und losfahren. Der Oldtimer hatte ein Automatikgetriebe, sie würde also ihren linken Fuß schonen können. Am besten, sie fuhr direkt in die Klinik. Für einen Moment stellte sie sich vor, wie sich Ärzte und Schwestern um sie kümmern würden. Sie würde in einem sauberen Bett liegen, und vielleicht würde die Röntgenaufnahme ja zeigen, dass die Verletzung gar nicht so schlimm war.
Die junge Frau öffnete die Tür, setzte sich hinter das Steuer und zog vorsichtig das linke Bein in den Wagen. Der Schmerz im Gelenk war in ein dumpfes Pochen übergegangen. Es war Zeit, hier wegzukommen. Sie startete den Motor und schaltete das Licht an. Die Scheinwerfer erfassten den leeren, staubigen Platz. Sie schaltete die Automatik auf »Marche arrière« und drehte sich um. In diesem Moment stockte ihr der Atem, und eine Welle eisiger Kälte lief durch ihren Körper. Hinter ihr auf der Rückbank saß der Mann.
Es dauerte nur eine Sekunde, bis die Frau ihre Hand zum Türgriff bewegte, doch der Mann war schneller. Er schlang ihr seinen rechten Arm um den Hals und zog sie zwischen den Sitzen hindurch nach hinten. Er drückte ihr die Luft ab. Die Frau strampelte und schlug um sich. Doch der Mann war stark und kannte keine Gnade. Die Frau merkte, wie die Kräfte sie verließen. Sie strampelte und spürte erneut einen rasenden Schmerz im linken Fuß, als unter ihrem Tritt die Seitenscheibe zersplitterte.
Sie stieß einen einzigen verzweifelten Schrei aus. Aber sie wusste, in der Einsamkeit der Provence würde sie niemand hören. In ihrem Kopf setzte ein Rauschen ein, und dann versank die Welt hinter einem schwarzen Schleier.
1. Kapitel
Leon hatte den Weg zwischen den Häusern eingeschlagen. Er führte den Hügel hinunter, direkt in den Ortskern von Le Lavandou, wo man zwischen den Dächern das Meer glitzern sehen konnte. Der Pfad ging vorbei an Gärten, in denen es im Frühling und Sommer üppig blühte. Jetzt war das Gras braun, die meisten Blumen waren vertrocknet und die dicken Lavendelstauden von ihren Besitzern bis auf die grauen Strünke heruntergeschnitten. Aber die blühenden Bougainvilleen und die Oleanderbüsche erinnerten Leon daran, dass es auch im Oktober in der Provence noch angenehm warm sein konnte, weil das Meer die Wärme des Sommers gespeichert hatte. Und wenn der Wind aus dem Norden jetzt gelegentlich schon kühl übers Land wehte, dann sorgte das Meer wie eine riesige Zentralheizung dafür, dass die Büsche und Blumen bis in den Winter hinein blühten.
Leon blieb einen Moment stehen und genoss den Ausblick auf die blaue Bucht und die Fähre, die gerade zu den Inseln ablegte. Dann nahm er die letzten Stufen, überquerte die Avenue de Provence und kam am Kriegerdenkmal vorbei, an dem ein vertrockneter Lorbeerkranz lehnte. Eine verblichene Erinnerung an den 15. August, den glorreichen Tag, an dem die Einwohner von Le Lavandou bis heute die Befreiung von den deutschen Besatzern feierten. Allerdings hatte das Fremdenverkehrsamt dafür gesorgt, dass die Feier in den letzten Jahren immer bescheidener ausfiel. Eine Bescheidenheit, die vor allem den gut zahlenden Feriengästen aus Deutschland geschuldet war. Inzwischen waren die Zeitzeugen so gut wie alle verstorben. Und so verblasste die kollektive Erinnerung an das historische Ereignis schneller als die Farben der Trikolore, die jemand um den trockenen Kranz gewunden hatte.
Der beginnende Herbst sorgte für entspannte Ruhe in der kleinen Küstenstadt am Meer. Viele Geschäfte waren geschlossen. Ihre Besitzer befanden sich im wohlverdienten Urlaub. Die schmalen Gassen, in denen sich in den Sommermonaten die Touristen drängten, lagen verlassen da. Nur ein paar Pensionäre saßen zu dieser frühen Stunde auf den Bänken der Uferpromenade, blinzelten in die warme Sonne und sprachen mit ihren Toutous, ihren Hündchen, die sie mit Keksen fütterten.
Früher hatte Leon seine Zeitung regelmäßig bei Michel im Tabac-Laden unten an der Promenade gekauft. Aber seit sich Michel als Kandidat für die radikalen Gardiens de la patrie hatte aufstellen lassen, mied Leon den Kiosk am Meer. Inzwischen kaufte er seine Frankfurter Allgemeine lieber in der Petite Librairie bei Monsieur Nortier. Der hatte die Buchhandlung vor eineinhalb Jahren von zwei alten Schwestern übernommen, die in Pension gegangen waren. Leon mochte das altmodische Geschäft, das neben Zeitungen auch Bücher und Schreibwaren im Sortiment hatte. Hier hatte ihm seine Mutter, als er noch ein zehnjähriger Junge gewesen war, während der Sommerferien die Comic-Hefte von Hergé mit den Abenteuern von Tintin gekauft. Die Geschichten von Tim und Struppi lagen noch heute im Schaufenster.
Als Leon den Laden betrat, setzte die Tür über eine Metallfeder ein Glockenspiel in Gang. Im hinteren Teil des Geschäfts konnte Leon Madame Auteuil, die pensionierte Lehrerin, erkennen, die eine Kiste Bücher in ein Regal stapelte und sich dabei mit Monsieur Nortier stritt. Als der große Mann die Tür hörte, winkte er Leon zu und eilte nach vorn.
Monsieur Nortier war Ende vierzig, knapp einen Meter neunzig groß und etwas übergewichtig. Auf dem großen Körper saß ein Kopf, der viel zu klein schien für diesen massigen Mann. Leon war aufgefallen, dass der Buchhändler immer ein wenig schwitzte, nervös war und zu rötlichen Augenrändern neigte, was Leon auf eine Schilddrüsenüberfunktion zurückführte. Wenn Nortier durch seinen Laden ging, fürchtete Leon jedes Mal, er könnte einen der Ständer mit den Postkarten oder den Taschenbüchern umreißen. Doch Monsieur Nortier bewegte sich geschickt, wich jedem Hindernis im letzten Moment aus und war von übertriebener Freundlichkeit. Leon mochte Nortier nicht besonders, aber er legte auch in den Sommermonaten zuverlässig für ihn die FAZ zurück.
»Bonjour, Monsieur Nortier«, grüßte Leon, als er den Laden betrat.
»Ah, Docteur.« Nortier griff unter den Ladentisch und zog eine Frankfurter Allgemeine hervor. »Voilà, die habe ich schon für Sie zur Seite gelegt.«
»Merci, très gentille.« Leon nahm die Zeitung in die Hand, betrachtete kurz die erste Seite und lächelte zufrieden.
»Gute Nachrichten?«, erkundigte sich Nortier.
»Sehr gute Nachrichten.« Leon klemmte sich die Zeitung unter den Arm und legte vier Euro auf die Glasschale. »Regen und Kälte in ganz Deutschland.«
»Bei uns soll es die ganze Woche so schön bleiben.« Der Buchhändler duckte sich ein wenig und sah mit schief gelegtem Kopf durch die Schaufensterscheibe nach oben zum blassblauen Himmel hinauf.
»Vive la France.« Mit einem Lächeln verließ Leon das Geschäft.
Er hatte sich diesen Tag freigenommen. Das Ende der Feriensaison bedeutete auch für den Rechtsmediziner weniger Arbeit. Keine Herzinfarkte leichtsinniger Touristen, die zu viel Wein in der Sonne genossen hatten, keine Motorradunfälle von reiferen Herren, die auf zu großen Maschinen ihre zweite Jugend auszuleben versuchten, und keine ertrunkenen Badegäste, die die Meeresströmungen unterschätzt hatten. Leon überließ das Rechtsmedizinische Institut von Saint-Sulpice an solchen Tagen der Obhut seines Assistenten und genoss etwas freie Zeit. Mit der Zeitung würde er sich in sein Stammbistro setzen. War das nicht genau der Grund, weshalb er damals die Universitätsklinik in Frankfurt verlassen und den Job in einer Provinzklinik bei Hyères angenommen hatte? Wenn er ehrlich war, dachte Leon, war das nicht der einzige Grund gewesen.
Leon beschloss, einen Umweg am Meer entlang zu machen. Er zog sich Schuhe und Strümpfe aus und ging barfuß durch den kühlen Sand. Immer wieder blieb er stehen, blickte auf die spiegelglatte See und sah den Wellen zu, wie sie auf den Sand schwappten. Die flache Sonne, das ewige Rauschen des Meeres und der schier endlose Blick in die Ferne. All das hatte eine eigenartig beruhigende Wirkung auf Leons Gemüt. Genauso musste es hier schon bei der Erschaffung der Welt ausgesehen haben, dachte er. Gemächlich spazierte er an den geschlossenen Strandcafés vorbei, die von ihren Besitzern mit dicken Brettern gegen die Winterstürme gesichert worden waren. Liegestühle lagen festgezurrt in Drahtverschlägen hinter den Hütten. Und die zusammengefalteten Sonnenschirme erinnerten Leon an verpuppte Schmetterlinge, die nur auf die erste Frühjahrssonne warteten, um wieder zu schlüpfen.
Das Chez Miou war bestimmt nicht das eleganteste Café in Le Lavandou. Ganz im Gegenteil. Es war, höflich ausgedrückt, etwas in die Jahre gekommen. Die Wände hätten längst einen neuen Anstrich gebraucht, die Toilette endlich ein funktionierendes Schloss und die Stühle eine neue Bespannung. Aber gerade dafür liebte Leon diesen Ort: für seine Unvollkommenheit und dafür, dass er direkt neben dem Bouleplatz lag.
»Was ist los, mon ami? Heute noch keine Toten aufgeschlitzt?«, begrüßte Jérémy den Gast. Der Wirt stand hinter der Bar und polierte die Weingläser, die er zur Kontrolle im Sonnenlicht drehte.
»Bonjour«, sagte Leon und setzte sich auf einen der Korbstühle, von denen um diese Jahreszeit die meisten frei waren. Nur an den Wochenenden kamen jetzt noch Touristen. Die waren meist aus dem Umland, tranken einen Wein und gingen am Strand spazieren, um dann beizeiten wieder zu verschwinden. Wer jetzt ins Miou kam, war ein Einheimischer. Oder er tat wenigstens so, wie Antoine, der Maler, der gleich am Eingang saß und so auffällig wie möglich in seinen Skizzenblock zeichnete. In der Hoffnung, dass einer der Besucher dem Künstler einen Wein spendierte.
»Hören Sie gar nicht auf ihn, Docteur.« Yolande, die Kleinstadtschönheit, die ihre Blusen und Röcke immer eine Nummer zu eng trug, schob sich auf Leon zu. »Ein Café crème und ein Baguette für den Docteur, richtig?«
»Sie können meine Gedanken lesen, Madame«, sagte Leon.
»Ich kenne alle Ihre geheimen Wünsche.« Yolande schenkte Leon einen Blick, den sie für zweideutig hielt, während ihr Mann sie nicht aus den Augen ließ. Aber statt zur Bar zurückzugehen, blieb sie noch einen Moment stehen und reckte sich, um nicht vorhandenen Staub von einer Wandlampe zu wischen. In Wirklichkeit tat sie das nur, um sich dem »Docteur« von ihrer Schokoladenseite zu zeigen. Doch der war längst in den Leitartikel der FAZ vertieft.
In diesem Moment betrat ein kleiner, drahtiger Mann in hellen Jeans, dunkelblauen Lederslippern und Wildlederjacke das Bistro. Michel, der Besitzer des Tabac-Ladens, schien es eilig zu haben.
»Gibst du mir schnell einen«, sagte er. Jérémy griff nach einem der Weingläser und schenkte einen Rosé ein. »Ich hab einen Termin in Toulon«, erklärte Michel in wichtigem Ton, in der Hoffnung, dass einer der Gäste nachfragte, worum es sich denn dabei handele. Véronique tat ihm den Gefallen. Sie war Anfang achtzig und hatte noch bis vor fünf Jahren ein Fischerboot besessen und Doraden gefangen. Selbst im Bistro nahm sie die Gitanes nicht aus dem Mund. Nach Leons Einschätzung war sie die beste Boulespielerin weit und breit.
»Ein kleiner Besuch bei deinen reaktionären Freunden?«, fragte Véronique provozierend.
»Ich werde wieder kandidieren«, sagte Michel zu Yolande, die ihn über die Schulter ansah. »Und diesmal stehen meine Chancen mehr als gut.«
»Gott behüte uns.« Véronique hielt Jérémy ihr Glas hin, und der goss wortlos noch etwas Pastis nach.
»Wenn von unseren Kirchtürmen erst mal der Muezzin ruft, dann wird das Gejammer groß sein«, sagte Michel. »Aber kommt dann bloß nicht zu mir.«
»Oh bitte, Michel. Zu dir und deinen Faschisten würde ich nicht mal kommen, wenn sie mir eine Moschee in den Vorgarten bauen würden.« Véronique nahm einen Schluck Pastis.
»Ganz genau, Véronique.« Leon hatte amüsiert von seiner Zeitung aufgeschaut. »Fragen Sie ihn doch mal, wie die letzten Umfragen waren.«
»Das können Sie gar nicht beurteilen, Docteur. Sie sind ja nicht mal Franzose.« Michel wurde ätzend, wenn er spürte, dass der Gegner ihm überlegen war. Er schlug sich auf die Brust. »Die Herzen der Südfranzosen schlagen eben anders.«
»Ich weiß nicht. Das wäre mir bei meiner Arbeit bestimmt schon mal aufgefallen.« Leon versuchte den Ton locker zu halten.
»Jetzt mach aber mal halblang, Michel.« Das war Jean-Claude, der mit seinem Rollstuhl hereingefahren kam und die letzten Sätze gehört hatte. Auf dem Schoß lag wie immer sein Yorkshire-Terrier Henry. »Der Docteur ist wenigstens ein halber Franzose. Und ich wette, er zahlt dafür doppelt so viele Steuern wie du.«
»Wisst ihr eigentlich, was sie mit der alten Schule an der Route Nationale bei La Londe vorhaben?« Michel machte eine dramatische Pause und sah in die Runde. »Das wird eine Moschee.«
»Red doch keinen Quatsch«, sagte Véronique.
»Soweit ich gehört habe, soll dort ein Kulturzentrum entstehen«, mischte sich Antoine ein. Der Maler lehnte sich zurück und warf den dunkelblauen Schal über seine Schulter. Seine dunklen Haare wellten sich unter einem ausgefransten Strohhut. Leon war sicher, dass der Künstler sich seine Dauerwelle beim Friseur legen ließ. Antoine trug weite Leinenhemden und schwarze Jeans, die er bis über die Knöchel hochgekrempelt hatte. Seine bloßen Füße steckten in Ledersandalen.
»Woher wollen Sie das wissen? Sie sind doch gar nicht von hier.« Michel klang jetzt eine Spur aggressiver.
»Monsieur Legrand hat schon in Paris ausgestellt«, nahm Yolande den Künstler in Schutz. »Das stimmt doch, oder?«
»Ich habe dort an der Kunstakademie unterrichtet«, korrigierte der Maler in gespielter Bescheidenheit.
»Malen Sie denn nur Hände?« Yolande räumte bei Antoine das Kaffeegeschirr vom Tisch und spähte dabei auf seinen Skizzenblock, auf dem verschiedene Darstellungen von Händen zu erkennen waren.
»Das sind Skizzen«, erklärte Antoine. »Hände sind besonders kompliziert. Mindestens so kompliziert wie Gesichter.«
»Oh, vielleicht wollen Sie ja mal meine Hände malen.« Yolande hielt Legrand ihre gespreizten Finger hin, als wollte sie einer Freundin ihren Nagellack vorführen.
»Kommen Sie doch zu meiner Vernissage«, schlug Legrand vor. »Mittwoch im Rathausfoyer ab achtzehn Uhr …«
»Yolande, Eis und Café für die Nummer vier.« Jérémy hatte seine Frau genau beobachtet, und es war an der Zeit, den Flirt mit dem Maler zu beenden.
»J’arrive, j’arrive«, seufzte Yolande. Sie kam an den Tresen und schnappte sich das Tablett, um es zu einer Gruppe von Gästen zu bringen, die draußen in der Sonne saßen. Natürlich nicht ohne noch einmal so nahe wie möglich an Antoines Tisch vorbeizugehen.
»Ich glaube, allein zu leben hat doch was für sich«, meinte Jean-Claude, der den kurzen Flirt beobachtet hatte. Dann wandte er sich Leon zu. Er wirkte nervös.
»Ist irgendwas?«, fragte Leon.
»Es gibt da eine Sache, da bräuchte ich mal deinen Rat, Leon.«
In diesem Moment summte Leons Handy.
»Moment.« Leon zog das Smartphone aus der Sakkotasche und warf einen Blick auf das Display. »Ist die Klinik.« Er tippte auf die Annahmetaste. »Ritter? Wann war das? Nein, lassen Sie alles, wie es ist. Ich komme direkt rüber.« Er legte auf.
»Ich dachte, du hast heute frei«, sagte Jean-Claude.
»Ist dringend. Ich muss los.« Leon stand auf, nahm seine Zeitung, klemmte einen Fünf-Euro-Schein unter die Kaffeetasse und ging Richtung Ausgang.
»Unterwerfung!«, rief Michel in diesem Moment vom Tresen herüber. »Das ist es, was wir tun. Wir geben unser geliebtes Frankreich auf. In zwanzig Jahren werden uns die Muslime aus unserer Heimat vertrieben haben!«
Leon winkte mit der Zeitung, ohne sich noch einmal umzudrehen.
»Sie werden es auch noch begreifen, Docteur«, rief ihm Michel nach. »Aber dann wird es zu spät sein!«
2. Kapitel
Isabelle saß hinter ihrem Schreibtisch und musste sich zwingen, wenigstens den Anschein zu erwecken, als würde sie ihrer Besucherin zuhören.
»Wir reden hier über nichts Geringeres als die Zukunft unserer Stadt«, sagte Madame Berthier und zupfte ihre hellblaue Strickjacke zurecht.
Isabelle betrachtete die Frau mit den auffallend blonden Strähnen in den Haaren und den zu grell geschminkten roten Lippen. Seit zwanzig Minuten saß diese Person vor ihr und quälte sie mit ihrem Vortrag über die Verleihung der »Fleur d’Or«, der Goldenen Blume, und die damit verbundene strahlende Zukunft von Le Lavandou. Isabelle drehte das Metallschild auf ihrem Schreibtisch so, dass die Besucherin es lesen musste. »Capitaine Isabelle Morell« stand darauf in weißen Buchstaben auf schwarzem Grund. Und das war keine Selbstverständlichkeit. In der hundertjährigen Stadtgeschichte von Lavandou war Isabelle die erste stellvertretende Polizeichefin der Gendarmerie nationale. Und genau das war auch der Grund, warum Commandant Zerna, der Polizeichef, Frauen wie Madame Berthier vom Fremdenverkehrsamt nicht selbst empfing, sondern zu ihr schickte.
»Ihrer Meinung nach wäre es also besser, wenn die Stuntshow am großen Kreisverkehr sich einen anderen Platz für ihr Winterlager suchen würde«, unterbrach Isabelle ihre Besucherin. »Da habe ich Sie doch richtig verstanden?«
»Nicht würde, diese Leute müssen da weg. Und zwar heute noch.« Jetzt hielt es Madame Berthier nicht mehr auf dem Stuhl. Sie stand auf und beugte sich über den Schreibtisch. »Verstehen Sie denn nicht, was auf dem Spiel steht? Die ›Fleur d’Or‹ ist eine europaweit begehrte Auszeichnung. Unbezahlbare PR für unsere Stadt. Aber wenn das Komitee sieht, dass schon am Stadtrand die Zigeuner lagern …« Sie ließ den Satz in der Luft hängen, als wüsste jeder Mensch, was das bedeutete.
»Soweit ich informiert bin, handelt es sich bei diesen Leuten weder um Sinti noch um Roma«, unterbrach Isabelle. »Sondern um eine Stuntshow, die Autocrashs vorführt.«
»Sie wissen, was ich meine, Madame … Capitaine«, sie sah auf das Schild.
»Ich werde sehen, was ich tun kann«, sagte Isabelle ungerührt.
»Ich bitte Sie. Verstehen Sie doch, wie wichtig diese Auszeichnung für uns, was sage ich, für die ganze Region ist.«
In diesem Moment klopfte es an die Tür.
»Ja …?«, rief Isabelle, dankbar für die Unterbrechung.
Die Tür öffnete sich und ein Polizist mit maghrebinischen Gesichtszügen erschien, den die Streifen auf den Schulterklappen als Lieutenant auszeichneten.
»Entschuldige, Isabelle«, sagte Lieutenant Mohammad Kadir, genannt Moma, freundlich.
»Was gibt’s denn, Moma?«
»Es geht um eine Vermisstenanzeige. Hast du einen Moment?« Er deutete mit einer kurzen Kopfbewegung hinter sich, wo ein etwa fünfzigjähriger Mann ungeduldig darauf wartete, vorgelassen zu werden.
»Diese Leute müssen da verschwinden«, versuchte es die Frau vom Fremdenverkehrsamt noch einmal.
»Danke, ich habe Sie durchaus verstanden, Madame«, entgegnete Isabelle knapp. »Wir werden uns darum kümmern. Dann melden wir uns bei Ihnen.«
»Uns bleibt nicht viel Zeit …«, versuchte es Madame Berthier erneut.
»Würden Sie uns jetzt bitte allein lassen.« Isabelle war aufgestanden und wies zur Tür. Madame Berthier verschwand kommentarlos. In diesem Moment drängte sich ein Mann an Moma vorbei in Isabelles Büro.
»Verzeihen Sie, Madame. Aber es geht um meine Tochter.« Der Mann hielt Isabelle die Hand hin. »Bonnet, Robert Bonnet.«
»Capitaine Morell«, sagte Isabelle.
Dem Mann standen Tränen in den Augen. Er schien leicht zu zittern. Wie jemand, der fror, weil ihn Sorge und Angst geschwächt hatten. Der Besucher war ganz offensichtlich kein Tourist. Er trug einen teuren grauen Sommeranzug, ein hellblaues Hemd und eine dunkelblaue Seidenkrawatte. Dort, wo ihm am Hals der Schweiß herunterrann, zeichneten sich dunklere Flecken auf dem Kragen ab. Sein Gesicht war blass vor Stress. Er hat so traurige Augen, dachte Isabelle.
»Sie ist weg«, sagte der Mann, als könnte er es selbst nicht glauben. »Dabei ist heute ihr Geburtstag. Ihr zweiundzwanzigster …«
»Ihre Tochter ist also verschwunden?«
»Das versuche ich die ganze Zeit zu erklären. Wissen Sie, was Ihre Kollegen gesagt haben?« Der Mann deutete empört in Richtung Tür. »Ich soll in zwei Tagen wiederkommen.«
»Da haben die Kollegen recht. Bei Erwachsenen warten wir mindestens achtundvierzig Stunden, bevor wir etwas unternehmen. Es sei denn, es liegen Hinweise für ein Verbrechen vor.« Isabelle sprach betont nüchtern. Sie kannte die Statistik. Ständig verschwanden irgendwelche Leute. Aber mehr als fünfundneunzig Prozent der Vermissten tauchten innerhalb von achtundvierzig Stunden wieder auf. Natürlich gab es auch Fälle, die tragisch endeten. Und in diesem Fall beschlich Isabelle das ungute Gefühl, Monsieur Bonnet könnte sich zu Recht Sorgen machen.
»Françoise hat nicht angerufen. Verstehen Sie?« Der Mann schwankte hin und her, als wollte er sich jeden Augenblick umdrehen und aus ihrem Büro laufen. »Wir haben nicht telefoniert. Dabei ist doch heute ihr Geburtstag.«
Bonnet zog das Foto einer attraktiven jungen Frau aus der Tasche und reichte es Isabelle. »Das war letztes Jahr. Da war ich mit Françoise in Paris.«
»Setzen wir uns. Und Sie erzählen mir alles der Reihe nach.« Isabelle deutete auf die Besucherecke mit den beiden Sesseln.
»Ich kann mich nicht setzen«, sagte der Mann. »Sie müssen etwas unternehmen, jetzt sofort. Verhaften Sie diesen Roussel.«
»Bitte, Monsieur …«, Isabelle deutete noch einmal auf die Sitzecke, »ich muss mehr über Ihre Tochter wissen, wenn ich Ihnen helfen soll.«
Kurz darauf saß der Mann zusammengesunken in einem der Sessel. Isabelle hatte Moma Kaffee aus der Kantine bringen lassen. Bonnet war jetzt etwas ruhiger, aber es fiel ihm sichtlich schwer, sich zu konzentrieren. Er rührte wie abwesend in seinem Kaffee und sah immer wieder schweigend aus dem Fenster. Wenn Isabelle ihn etwas fragte, antwortete er nicht, sondern redete einfach drauflos.
Isabelle verstand immerhin so viel, dass die Familie Bonnet ein Hotel in Arles besaß. Sein einziges Kind, Tochter Françoise, absolvierte zurzeit eine Ausbildung in einem Hotel in Le Lavandou. Sie wollte praktische Erfahrungen sammeln, um dann in den Familienbetrieb in Arles einzusteigen.
»Sie haben einen Monsieur Roussel erwähnt.« Isabelle sah ihren Besucher an. »Wer ist das?«
»Der Mann, der meine Tochter entführt hat«, sagte Bonnet erschöpft.
»Das ist aber nur eine Vermutung von Ihnen?«
»Wie würden Sie das nennen, wenn sich so ein mieses Schwein an Ihre Tochter heranmachen würde?«, fragte der Mann aufgebracht. »Und dann ist plötzlich Ihr Kind verschwunden?«
Für eine Sekunde hatte der Mann Isabelle aus der Fassung gebracht. Die Vorstellung, dass jemand ihrer Tochter etwas antun könnte, gehörte zu den wenigen Dingen, die ihr wirklich Angst machen konnten.
»Monsieur Roussel ist also der Lebensgefährte Ihrer Tochter?«, fragte Isabelle schnell.
»Lebensgefährte, dass ich nicht lache«, sagte Monsieur Bonnet. »Er kontrolliert sie. Françoise ist ihm vollkommen ausgeliefert.«
»Ihre Tochter ist zweiundzwanzig, haben Sie gesagt?« Es war mehr eine Feststellung als eine Frage, die den Mann daran erinnern sollte, dass sie hier über eine erwachsene Frau sprachen.
»Früher, da war Françoise ganz anders.« Jetzt klang der Mann enttäuscht und hilflos. »Als Chantal noch lebte …« Er unterbrach sich und schüttelte den Kopf.
»Ihre Frau?«, fragte Isabelle vorsichtig.
»Sie wurde krank. Die Ärzte konnten nichts tun … « Bonnet vollendete den Satz nicht und starrte vor sich hin, dann sah er Isabelle an. »Ich bitte Sie, Sie müssen sie finden.«
»Das werden wir, ganz bestimmt«, erwiderte Isabelle und fragte sich, wie sie da so sicher sein konnte. »Dieser Roussel …«
»Pierre Roussel. Ein widerlicher Mensch. Ich verstehe nicht, was sie an ihm findet. Wirklich nicht.«
»Haben Sie eine Adresse von Monsieur Roussel?«, fragte Isabelle.
»Adresse?« Monsieur Bonnet schnaubte verächtlich. »Der hat keine Adresse. Der lebt in einem Wohnwagen, außerhalb von Le Lavandou.« Er machte eine vage Handbewegung in Richtung Fenster.
»Da gibt es doch bestimmt eine Straße oder Kreuzung?«, sagte Isabelle.
»Der Kerl gehört zu so einem Autozirkus. Die lagern bei dem großen Kreisverkehr draußen an der Département-Straße. Bitte reden Sie mit ihm.«
3. Kapitel
In den Räumen der Rechtsmedizin im Tiefgeschoss der Klinik Saint-Sulpice herrschten Tag und Nacht, Sommer wie Winter gleichbleibende einundzwanzig Grad Celsius. Leon war das nur recht. Genauso wie das Kunstlicht, das einen die Tageszeit vergessen ließ. Leon empfand das diffuse Dauerlicht, die blassgrün gekachelten Räume und den silbrig glänzenden Obduktionstisch als eine Oase der Ruhe. Er gehörte nicht zu den Rechtsmedizinern, die während der Arbeit laute Rockmusik oder Wagner-Opern hörten. Leon liebte die Konzentration und die Einsamkeit mit den Toten, die er als seine Patienten bezeichnete.
Leon trug über seinen blauen OP-Hosen und dem kurzärmeligen Hemd die obligatorische Einmal-Plastikschürze. Seine Handschuhe waren aus hauchdünnem Latex. Für seine Kollegen ein leichtsinniger Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften. Aber Leon waren die Vorschriften egal. Er hatte sich noch nie bei der Arbeit verletzt, und er hatte auch keine Angst, dass er sich mit ansteckenden Krankheiten infizieren könnte. Dr. Leon Ritter ging bei der Arbeit äußerst umsichtig vor, und er verließ sich bei der Untersuchung auf das empfindliche Gespür seiner Fingerspitzen.
Leon zog das grüne Tuch von dem Toten, der vor ihm auf dem Tisch lag, und betrachtete den Mann. Leicht übergewichtig, dachte er. Die Schatten um die Augen könnten auf einen beginnenden Leberschaden hinweisen. Jemand, der viel Zeit hinter seinem Schreibtisch verbracht hatte und gerne üppig aß und trank. Er schätzte den Toten auf fünfzig bis dreiundfünfzig Jahre.
Fragend sah Leon zu dem hageren Mann hinüber, der auf der anderen Seite des Tisches stand und jede seiner Bewegungen genau beobachtete. Olivier Rybaud war sein Assistent. Leon mochte den zuverlässigen Mitarbeiter, der wenig sprach und immer genau zu wissen schien, was Leon im nächsten Augenblick für seine Arbeit benötigte. Leon musste nicht auf das schmale Band mit dem Barcode sehen, das der Tote um sein linkes Fußgelenk trug. Ein Blick zu Rybaud, und er erfuhr alles, was er wissen wollte.
»Name: Nicolas Durand, zweiundfünfzig Jahre, fünfundachtzig Kilogramm, Größe: ein Meter achtundsiebzig«, referierte der Assistent. »Sie haben ihn zusammen mit seiner Frau in seinem Haus entdeckt. Madame Durand ist noch in der Kühlkammer. Außerdem wurden im Schlafzimmer jede Menge Medikamente gefunden.«
»Suizid …« Das war keine Frage, die Leon da stellte, sondern eher ein laut geäußerter Zweifel. »Hat das ein Arzt bestätigt?«
»Nein, aber die Polizei ist sich ganz sicher. War alles ziemlich eindeutig, haben sie gesagt.«
»Die Polizei sollte unsere Untersuchung abwarten, bevor sie sich in irgendwelche Theorien verrennt.« Leon umrundete langsam den Toten.
Es gab ein ehernes Gesetz bei Leichenfunden, danach musste immer ein Arzt den Tod eines Opfers bestätigen. Und wenn der Mediziner Zweifel hatte, musste er die Behörde informieren, und dann kam der Tote zu Leon auf den Tisch. Aber die Polizisten vor Ort spielten sich gerne auf und stellten selbst die Diagnose, was leicht zu Irrtümern führen konnte.
Leon betrachtete den Toten, ohne ihn zu berühren. Er »sprach« mit dem Opfer, wie er es nannte. Nach Leons Theorie waren die Toten in der Lage, ihre Geschichte zu erzählen, wenn man ihnen nur genau genug »zuhörte«. Diese wenig wissenschaftliche Ansicht sorgte bei vielen seiner Kollegen für spöttische Bemerkungen. Natürlich meinte Leon das nicht wörtlich. Auf der anderen Seite – seine Aufklärungsquote bei Gewaltverbrechen war legendär.
»Commandant Zerna hat die beiden Leichen herbringen lassen«, sagte Rybaud.
Leon warf Rybaud einen skeptischen Blick zu. Mit Polizeichef Zerna von der Gendarmerie nationale in Le Lavandou verband ihn ein etwas kompliziertes Arbeitsverhältnis. Rybaud griff zu einer durchsichtigen Plastiktüte, die auf einem der Rollwagen lag, und hob sie in die Luft.
»Beruhigungstabletten, Kopfschmerztabletten, Schmerzmittel«, sagte der Assistent. »Alles, was man für einen soliden Selbstmord braucht. Im Polizeibericht steht, dass die Frau auf dem Bett lag und der Mann am Boden. Vielleicht wollte er noch raus aus der Nummer, aber dafür war es in jedem Fall zu spät.«
»Hmmm«, brummte Leon nur und zog die beleuchtete Lupe zu sich heran, die mit einem Gelenkarm an der Decke befestigt war. Er betrachtete die Fingerspitzen des Toten. Behutsam griff er nach dem Handgelenk und bewegte die Finger unter der Lupe hin und her.
»Wissen wir, ob das Ehepaar zu Abend gegessen hat?«, fragte Leon seinen Assistenten.
»Soweit ich weiß, hatten sie etwas gekocht, und dazu gab es einen Sancerre.«
»Einen Sancerre …?« Leon sah von der Lupe hoch. »Selbstmörder kochen doch nicht und trinken Sancerre zum Abendessen. Ich vermute, es gibt keinen Abschiedsbrief.«
»Nein, aber …«
»Dachte ich mir«, kam ihm Leon zuvor. Er ging zum Kopf des Mannes. Leon nahm ein Wattestäbchen und drückte es leicht auf eines der geschlossenen Augen des Opfers.
»Es gibt einen Brief von der Bank.« Rybaud reckte sich ein wenig, um zu sehen, was Leon da tat. »Die Durands hatten einen Installationsbetrieb in Collobrières. Und der scheint pleite zu sein.«
»Stand das etwa auch im Polizeibericht?«
»Hat mir einer von den Bestattern erzählt. Ist der Bruder meines Schwagers.« Rybaud sah seinen Chef an. »Die Bank hat den Durands die Kredite gestrichen.«
Leon schmunzelte. Eine der großen Qualitäten von Rybaud war, dass er immer bestens informiert war. Leon schob mit dem Daumen der freien Hand vorsichtig das Augenlied über das Wattestäbchen, sodass er die Unterseite mit der feuchten Schleimhaut betrachten konnte. Und dann sah er sie, die punktförmigen Einblutungen in der Bindehaut. Ein sicheres Zeichen für Sauerstoffmangel. Dieser Mann war erstickt. Leon zog die Lupe zum Hals des Toten herunter. Doch er konnte keine Würgemale feststellen.
»Haben Sie etwas gefunden?«
Leon richtete sich auf. »Hellrote Male unter den Fingernägeln, außerdem Einblutungen in der Bindehaut.«
»Glauben Sie, er wurde erdrosselt?«
»Fest steht im Augenblick nur, dass er an Sauerstoffmangel erstickt ist«, sagte Leon. »Und ich kann keine Anzeichen sehen, dass dabei Gewalt angewendet worden wäre.«
»Aber die Tabletten? Die beiden haben jede Menge Pillen genommen.«
»Das vermutet die Polizei. Ich bin sicher, dass wir in den Mägen der beiden Opfer nichts außer einem Abendessen und ein paar Schmerztabletten finden werden.«
Leon bückte sich, sodass er den unten liegenden Teil des Brustkorbs sehen konnte. »Helfen Sie mir bitte mal.«
Rybaud drückte mit einer Hand die Schulter des Toten zurück, mit der anderen hob er den Brustkorb ein paar Zentimeter an. Jetzt waren die Totenflecken zu sehen, sie waren hellrot.
Leon begriff sofort die Bedeutung dieser ungewöhnlichen Verfärbung. Normalerweise waren Totenflecken, die dort entstanden, wo der Leichnam seinen tiefsten Liegepunkt hatte, dunkelblau bis schwarz. Die Flecken am Rücken dieses Opfers erinnerten dagegen eher an einen Sonnenbrand. Monsieur Durand war ganz offensichtlich an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Ein heimtückischer Tod. Kohlenmonoxid war geruchlos und unsichtbar.
Der verhängnisvolle Abend der Durands war für Leon leicht zu rekonstruieren. Das Ehepaar war beim Abendessen, als es das tödliche Gas eingeatmet hatte. Die ersten Symptome der Vergiftung waren Schwindel und Schweißausbrüche gewesen, ähnlich wie bei einer beginnenden Grippe. Dann kamen die Kopfschmerzen dazu und den Betroffenen wurde schlecht. Vielleicht dachte das Ehepaar, dass es sich mit dem Essen den Magen verdorben hatte. Da die beiden sich die Symptome nicht erklären konnten, nahmen sie Schmerzmittel, statt ins Freie zu gehen und mit der frischen Luft den Kohlenmonoxid-Anteil in ihrem Blut wieder herabzusetzen. Sie ahnten in diesem Moment nicht, dass sie in einer tödlichen Falle saßen und nur noch Minuten zu leben hatten. Das eingeatmete Kohlenmonoxid blockierte den lebenswichtigen Sauerstofftransport der roten Blutkörperchen in die feinsten Verästelungen ihrer Adern. Das führte zu einem inneren Ersticken und einem Kollaps der Organe. Bereits nach wenigen Minuten konnten die Opfer ihre Umgebung nicht mehr richtig wahrnehmen. Dann hörten sie Rauschen und bekamen Krämpfe. In der letzten Phase, kurz vor ihrem Tod, lagen sie nur noch apathisch zuckend da und erstickten.
»Informieren Sie sofort die Polizei«, forderte Leon seinen Assistenten auf. »Sie sollen dringend die Heizung im Haus der Durands überprüfen. Und sie sollen die Feuerwehr mitnehmen. Die müssen den Kohlenmonoxid-Gehalt messen und den Kaminabzug kontrollieren.«
Rybaud verschwand im Büro, und im nächsten Moment hörte Leon seinen Assistenten mit der Polizei telefonieren.
Für Leon war der Fall klar. Sie hatten schließlich Anfang Oktober. Da konnte es nachts schon empfindlich kühl werden. An solchen Abenden stellten die Menschen zum ersten Mal nach den warmen Sommermonaten wieder ihre Gasheizungen an. Dabei konnte es vorkommen, dass die Kamine durch Pflanzenreste oder Tierkadaver verstopft waren. Wurde dann die Heizung gestartet, konnte der Kamin keinen richtigen Zug entwickeln. Dann sank das schwere Kohlenmonoxid-Gas nach unten und breitete sich in der Wohnung aus. Leon beschloss, noch in dieser Woche einen Handwerker anzurufen und seinen Kaminabzug kontrollieren zu lassen. Nur um auf Nummer sicher zu gehen.
4. Kapitel
Der Mann lief die letzten hundert Meter zu Fuß. Er ging immer zu Fuß, weil er dann am besten nachdenken konnte. Der kurze Weg würde ihn seinen Zorn vergessen lassen. Er war schwach geworden, dabei hasste er Schwäche. Andere konnten sich vielleicht Schwäche leisten, er nicht. Er konnte das ganze Gerede über Mitgefühl und Nächstenliebe nicht ausstehen. Als wären die Menschen nur auf der Welt, um sich um ihre Nächsten zu kümmern. Scheiße, um ihn hatte sich auch niemand gekümmert. Und das war auch gut so. Seine Welt war ein Moloch, in dem nur die Starken und die Entschlossenen überlebten.
Er hatte seine Lektion früh gelernt: Nur Disziplin zählte. Wichtig war die Kontrolle und am allerwichtigsten war die Kontrolle über sich selbst. Kontrollverlust war Schwäche. Und genau dafür hasste er sich. Weil er wusste, dass er gelegentlich die Kontrolle verlor. Dann fühlte er eine Sehnsucht in sich aufsteigen, die köstlich und verachtenswert zugleich war. Er versuchte jedes Mal dagegen anzukämpfen. Manchmal gelang ihm das über Monate und manchmal sogar über Jahre hinweg. Aber er wusste jedes Mal, dass er über kurz oder lang diesen inneren Kampf verlieren würde. Die Sehnsucht war wie eine Droge. Ein Rausch, den man genoss und für den man sich gleichzeitig verachtete.
Auch jetzt spürte er, wie diese Sehnsucht wieder stärker und stärker wurde. Er konnte sich regelrecht dabei beobachten, wie er in sein Verderben lief, wie er alle guten Vorsätze aufgab. Dann redete er sich jedes Mal ein, dass es nichts schaden konnte, wenn er einen Schritt weiterging und noch einen und noch einen. Bis er vor dem Abgrund stand.
In diesen Momenten gab er jede Zurückhaltung auf. Er verdrängte jeden Gedanken an die Konsequenzen und genoss, was auf ihn zukam. Obgleich er wusste, dass es falsch war und böse. Es war »unnatürlich«, hatte ihm mal ein Priester gesagt. Aber es war dennoch stärker als jedes andere Gefühl. Es war eine Sucht, eine Leidenschaft, und gleichzeitig würde es irgendwann sein Untergang sein. Er belog sich, wenn er sich einredete, dass er eine Mission verfolgte. Es gefiel ihm einfach, »sie« zu kontrollieren. Es war leichter, über die Stunden nachzudenken, die ihn erwarteten, wenn er seine Opfer mit einem neutralen »sie« bezeichnete. Dann konnte er die Vorbereitungen genießen, die fast so erfüllend waren wie die Exerzitien selbst. Natürlich war auch ein Teil Rache bei dem, was er tat. Rache für das, was seine Mutter ihm angetan hatte, dafür, dass die Natur ihn verhöhnt und Gott ihn belogen hatte.
Er erinnerte sich, wie er als kleiner Junge eine Schildkröte im Garten auf den Rücken gedreht hatte. Er hatte dem Tier nicht geholfen, sondern es zappeln lassen. Er verachtete die Schildkröte dafür, dass sie nicht mehr von selbst auf die Füße kam. Er verachtete ihre Schwäche, ihre Unvollkommenheit. Dafür hatte sie Strafe verdient. Jeden Tag hatte er nach ihr geschaut und sie beobachtet. Am dritten Tag bewegte sie sich nicht mehr, und am vierten Tag krabbelten die ersten Ameisen in den Panzer und begannen die Schildkröte in kleine, stecknadelkopfgroße Stückchen zu zerlegen und fortzuschaffen. Diese Beobachtung hatte ihn damals in einen regelrechten Rausch versetzt. Es war seine Rache für alles, was ihm die Natur angetan hatte.
Der Anstoß dazu entsprang seinem tiefsten Inneren. Es war eine Mischung aus Verachtung und dem Gefühl absoluter Macht. Die Tat hatte etwas Göttliches. Allein die Erinnerung jagte dem Mann köstliche Schauer über den Rücken. Er sehnte sich immer wieder zurück zu diesem unvergleichlichen Augenblick. Diese Sucht beherrschte ihn bis heute. Das war der Grund, warum er »sie« gelegentlich einfing. Damit er sie beobachten konnte, wenn sie hilflos vor ihm lagen und begriffen, dass es für sie nur noch einen Weg gab. Den in die ewige Dunkelheit. Wenn sie sich dann aufgaben, wenn sie anfingen zu schreien. Genau das war der Moment, für den es sich zu leben lohnte. Der Moment, der ihm Erlösung brachte.
Der Mann hatte das alte Haus erreicht. Es schien sich regelrecht in den Hügeln zu verstecken, als würde es vor dem Bösen zurückschrecken. Dabei liebte der Mann das Haus. Nichts hatte sich hier verändert, seit er es vor dreißig Jahren verlassen hatte. Hier war sein Zuhause. Hier fühlte er sich sicher. Hier konnte er seine wildesten Sehnsüchte ausleben.
5. Kapitel
Sie hätten genauso gut zu Fuß gehen können, dachte Isabelle. Sie sah zu Didier, der mit genervtem Gesichtsausdruck hinterm Steuer saß und darauf wartete, dass die Maschine des Straßenbauamtes endlich zur Seite fuhr und sie durchließ. Aber der orangefarbene Wagen sprühte in aller Ruhe einen neuen Streifen nach dem anderen auf die Straßenmitte.
»Ist der jetzt verrückt, oder was?« Didier schaltete das Blaulicht und die Sirene des Streifenwagens ein. Was dem Fahrer vor ihnen einen solchen Schreck einjagte, dass er auf die Standspur abbog und eine Linie quer über die Straße zog.
»War das jetzt nötig?«, fragte Isabelle. »Wenn wir gelaufen wären, hätten wir keine zehn Minuten gebraucht.«
»Ich gehe doch nicht zu Fuß zu einem Einsatz.«
»Wäre vielleicht ganz gesund.« Isabelle sah kurz zu ihrem Kollegen hinüber, über dessen rundem Bauch das Uniformhemd der Gendarmerie nationale spannte.
»Du verstehst das nicht«, sagte Lieutenant Didier, der bis heute darunter litt, dass Isabelle ihn auf der Karriereleiter überholt und es bis zur Capitaine gebracht hatte. »Das hat etwas mit Respekt zu tun.«
»Ist ʼne Männersache, ich verstehe.« Isabelle deutete mit dem Finger geradeaus. »Es ist gleich da vorn, zweite Ausfahrt.«
Der Einsatzwagen hielt vor einer Ansammlung bunt lackierter Schrottautos. Davor stand ein hellblauer Pick-up auf mannshohen Ballonreifen, die ihn wie ein Kinderspielzeug aus der Welt der Riesen erscheinen ließen. Über den Fahrzeugen war ein Schild zwischen zwei Fahnenmasten aufgespannt, dessen Farbe die Sonne ausgeblichen hatte. »Les Cascadeurs« stand darauf. Hinter den Fahrzeugen befand sich der Parcours, ein mit Strohballen abgegrenztes Oval von knapp einhundert Metern Länge, auf dem einige Hindernisse errichtet und eine künstliche Erhebung aufgeschüttet worden war. Über diesen Parcours raste gerade eine Art Beach Buggy mit laut röhrendem Motor, der eine mächtige Staubwolke hinter sich herzog.
»Suchen Sie jemand Bestimmtes?« Vor den Polizisten war ein großer Kerl aufgetaucht, der Isabelle an Obelix erinnerte. Er trug eine abgewetzte Lederhose mit Fransen und eine speckige Weste. Der Mann hatte seine Haare nach hinten zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Dazu trug er einen wilden Bart, in den er sich einen kleinen Zopf und eine Holzperle geflochten hatte.
»Wir möchten Pierre Roussel sprechen«, sagte Isabelle. »Der arbeitet doch hier?«
»Wer will das wissen?«, fragte der Mann mit dem Bart.
»Was soll der Quatsch?« Didier tat einen energischen Schritt nach vorn, schließlich trugen sie die Uniform der Gendarmerie nationale. »Ist Roussel hier oder nicht?«
In diesem Moment hatte der Dune Buggy den Parcours verlassen und kam herangeknattert. Hinter dem Steuer, gesichert mit doppelten Gurten und Helm, saß ein blonder Mann von Mitte dreißig. Das Gefährt stoppte vor der Gruppe, der Fahrer stieg aus und schob sich die Motorradbrille in die Stirn. Er musterte kurz Isabelle, dann beugte er sich über das Fahrzeug und drückte ein paarmal mit der Hand auf das Gaspedal, was den Motor aufheulen ließ.
»Die Scheißzündung stimmt immer noch nicht, Denis«, rief er dem Bartträger zu. »Bei viertausend Umdrehungen ist Schluss. Keine Power, nichts mehr.«
»Ist nicht mein Problem«, meinte Obelix.
»So wird das aber nichts. Da setze ich mich nicht mehr rein.«
Isabelle fiel auf, wie nervös der Fahrer war. Der Mann betrachtete den Motor des Buggys, der jetzt im Leerlauf vor sich hinblubberte, und kratzte mit dem Daumennagel einen imaginären Flecken vom verchromten Überrollbügel.
»Die hier wollen dich sprechen.« Mit einer Kopfbewegung wies der Bartträger in Richtung Isabelle und Didier.
»Sind Sie Pierre Roussel?«, fragte Didier.
»Kommen Sie wegen der Genehmigung?« Es lag etwas Hoffnungsvolles in der Frage.
»Welche Genehmigung?« Isabelle sah zu Didier hinüber.
»Na, erst gibt die Stadt uns die Genehmigung, dass wir hier aufbauen können, und jetzt sollen wir plötzlich wieder verschwinden.«
»Es geht nicht um die Genehmigung«, sagte Didier.
»Eins sage ich Ihnen gleich: Wir sind hier und wir bleiben hier.«
»Ich sehe mir mal die Zündung an.« Der Mann mit dem Bart war in den Buggy gestiegen und fuhr zu einem roten Transporter, der als mobile Werkstatt diente.
»Wo können wir uns in Ruhe unterhalten?«, fragte Isabelle freundlich.
»Wieso? Worüber sollen wir uns unterhalten?« Roussel sah Isabelle irritiert an.
»Entweder hier oder auf der Wache. Ihre Entscheidung.« Didier hatte keine Lust auf weitere Diskussionen.
»Ich wohne da vorn.« Roussel deutete auf einen verbeulten, silbernen Air-Stream-Wohnwagen, vor dessen Tür ein Klapptisch und ein Regiestuhl aufgebaut waren. Daneben stand eine Kühlbox mit Eis, in der ein paar Dosen Bier schwammen. Sie gingen zu dem Wagen.
»Kennen Sie Françoise Bonnet?«, fragte Isabelle.
»Warum interessiert Sie das?« Roussel fischte sich eine Dose aus dem Wasser und öffnete sie mit einem Zischen. Dann wischte er sich die nassen Hände an seiner staubigen Jeans ab.
Irgendetwas hatte dieser Mann zu verbergen. Isabelle war aufgefallen, dass Roussel immer wieder zur Straße sah, wo der Streifenwagen stand, so als müsste er sich überzeugen, dass nicht noch mehr Polizei auftauchte.
»Sie kennen sie also«, stellte Didier fest. »Ist sie Ihre Freundin?« Roussel antwortete mit einem Schnaufen, das man auch als verächtliches Lachen deuten konnte.
Er sieht gut aus, dachte Isabelle. Aber beim zweiten Hinsehen wirkte er nicht wie jemand, auf den man sich verlassen würde. Sie versuchte, sich den Stuntman und die wohlerzogene Tochter des Hoteliers als Paar vorzustellen. Es gelang ihr nicht.
»Wann haben Sie Françoise Bonnet zum letzten Mal gesehen?«, fragte Isabelle freundlich.
»Gestern, vorgestern. Was weiß ich denn?« Roussel klang genervt. »Was ist das überhaupt für ʼne blöde Frage.«
In diesem Moment packte Didier den Mann an seiner Lederjacke und riss ihn zu sich. Roussel, der gerade zu einem Schluck aus der Dose ansetzte, spritzte das Bier übers Kinn, von wo es auf seine Jacke tropfte. Jetzt war sein Gesicht nur noch Zentimeter von dem des Lieutenant entfernt.
»Wenn Madame Capitaine dich was fragt, antwortest du«, herrschte ihn Didier an. »Ist das klar?«
Am nächsten Wohnwagen ging die Tür auf, und ein dicker Mann mit nacktem Oberkörper sah zu ihnen herüber.
»Machen die Flics Ärger?«, fragte der Mann.
»Gehen Sie wieder rein. Sonst bekommen Sie gleich Ärger«, sagte Isabelle cool. Sie sah, wie Didier mit seiner rechten Hand zum Halfter griff und mit dem Daumen die Sicherungsschlaufe von seiner Sig Sauer löste. In diesem Moment schloss der dicke Mann wieder seine Tür.
»Ganz ruhig«, sagte Isabelle und sah kurz ihren Partner an. Dann wandte sie sich an den Stuntman. »Also, wo könnte sich Françoise Bonnet zurzeit aufhalten?«
»Keine Ahnung, echt nicht«, sagte Roussel. »Sie hat gesagt, sie will zu Freunden nach Aix. Ich hab ihr sogar noch meine Karre geliehen.«
»Wann war das? Wann genau ist sie nach Aix-en-Provence gefahren?«, fragte Didier.
»Gestern, nein, vorgestern«, Roussel klopfte mit dem Handrücken demonstrativ seine Lederjacke dort ab, wo ihn Didier gepackt hatte.
»Und Sie haben sich gar nicht gewundert, dass sie nicht zurückkam?« Isabelle sah den Mann an.
»Mon Dieu. Ich dachte, sie ist halt in Aix geblieben. Hat ihr da vielleicht gefallen.« Der Stuntman sah zu Boden, als hätte er was verloren.
»Und seitdem haben Sie nichts von ihr gehört?«, fragte Isabelle. »Sie hat nicht mal auf dem Handy angerufen?«
»Wir sind befreundet, nicht verheiratet.«
»Was ist das für ein Auto, das Sie ihr geliehen haben?«, wollte Didier wissen.
»Ein Citroën. Ein DS, cremefarben.«
»Oh, là, là, und der fährt noch?«, fragte Didier spöttisch.
»Wenn man ihn gut pflegt.« Roussel sah den Lieutenant herausfordernd an. »Dafür müssen Sie natürlich Ahnung von Motoren haben.«
»Scheint Sie nicht zu beunruhigen, dass Ihre Freundin verschwunden ist?«, ging Isabelle dazwischen.
»Freundin, Freundin.« Roussel klang genervt. »Sie war ein paar Mal bei mir im Wohnwagen. Was bedeutet das schon?«
»Dass sie Sie mag …?«, sagte Isabelle und ließ es wie eine Frage klingen.
Der Stuntman warf die leere Bierdose in eine Mülltüte. »Sie ist ʼne hysterische Kuh.«
»Françoise Bonnet ist seit achtundvierzig Stunden verschwunden.« Der Ton von Isabelle wurde schärfer. »Und Sie waren offenbar der Letzte, der mit ihr Kontakt hatte.«
»Merde, ich wollt ihr nur helfen.« Roussel hob die Hände. »Ich wette, morgen ist sie wieder da.«
»Ach ja, und woher wollen Sie das wissen?«, fragte Didier lauernd.
»Am besten, Sie kommen jetzt doch mit aufs Revier.« Isabelle machte eine Handbewegung in Richtung Streifenwagen.
»Aber ich hab doch nichts …« Roussel unterbrach sich. »Ich verlange einen Anwalt.«
»Wieso, ich dachte, Sie haben nichts zu verbergen. Kommen Sie«, sagte Isabelle, als würde sie Roussel auf einen Kaffee einladen. »Wir brauchen nur Ihre Zeugenaussage.«
»Das ist alles …?« Roussel klang misstrauisch.
»Zumindest für den Augenblick«, sagte Didier und nahm den Stuntman sicherheitshalber am Arm, als sie gemeinsam zu ihrem Einsatzfahrzeug gingen.
6. Kapitel
Wenn Leon schon seinen freien Tag an den Job verloren hatte, konnte er auch gleich noch den liegen gebliebenen Bürokram erledigen. Er schrieb einen Obduktionsbericht, unterzeichnete den Einsatzplan der Mitarbeiter für die nächsten beiden Wochen, und zuletzt schickte er noch eine Materialbestellung für das Labor an die Klinikleitung.
Als Leon schließlich das Institut verließ, war es Nachmittag geworden. Die Sonne hatte den Parkplatz aufgeheizt, und die Wärme des Oktobertages umhüllte ihn wie ein Mantel nach den letzten Stunden in den klimatisierten Räumen der Rechtsmedizin. Er ging zu seinem Peugeot Cabriolet und klappte das Dach zurück. Der Wagen war über fünfundzwanzig Jahre alt, aber noch immer tadellos in Schuss. Er hatte ihn vor einigen Jahren einem Kollegen abgekauft, der einen Job in Kanada angenommen hatte. Leon hatte sich nie viel aus Autos gemacht, aber dieser Wagen war etwas Besonderes. Er hatte eine Seele, und er war wie gemacht für das warme Klima der Côte d’Azur mit den durchschnittlich dreihundert Sonnentagen im Jahr.
»Ich habe eins gefunden, Docteur!« Der Mann in der grünen Latzhose kam von den Oleanderbüschen herüber und hielt eine große Gartenschere in der Hand, mit der er Leon zuwinkte. Er hatte ein blasses Gesicht und einen rasierten Schädel, auf dem er eine Baskenmütze trug. Gegen Sonnenbrand, wie er Leon erklärt hatte. Der Mann war für seine Größe eindeutig zu mager, dachte Leon, und in seinem Gesicht konnte er ein feines Geflecht roter Äderchen erkennen. Möglicherweise Zeichen einer Leberschädigung als Folge von zu viel Alkohol. Dafür war er eigentlich noch zu jung. Leon schätzte den Mann auf Ende dreißig.
»Bonsoir, Monsieur Talbot«, sagte Leon. »Was haben Sie gefunden?«
»Na, dahinten, Sie wissen schon … Ihr Bremslicht.« Der Mann in der grünen Latzhose deutete auf Leons gesplittertes Rücklicht.
In der Peugeot-Werkstatt hatten sie ihm erklärt, dass das Ersatzteil für seinen Wagentyp nicht mehr vorrätig und wahrscheinlich auch nicht zu beschaffen sei. Jetzt stand dieser merkwürdig verschlossene Mann vor ihm und hatte offenbar das gesuchte Ersatzteil gefunden. Was Leon nicht wirklich überraschte.
Joseph Talbot war der Gärtner der Klinik, aber eigentlich war er viel mehr als das. Er reparierte alles. Egal, ob die Klimaanlage nicht ansprang oder der Schließmechanismus der Eingangstür klemmte, ob die Kaffeemaschine tropfte oder das Dach von Leons Cabrio klapperte, Monsieur Talbot war immer mit dem passenden Werkzeug zur Stelle. Niemand konnte genau sagen, woher dieser Mann kam. Jemand hatte ihn empfohlen, und der Klinikdirektor hatte ihn sofort als Gärtner und Assistenten des Hausmeisters übernommen. Er war im vorletzten Sommer einfach aufgetaucht, und seitdem hatte er mit seinen geschickten Händen ausgesprochen segensreich in der Klinik Saint-Sulpice gewirkt.
Talbot war Ende dreißig, aber nach seinem etwas verwahrlosten Äußeren zu urteilen, hätte er auch gut zehn Jahre älter sein können. Er redete nicht viel, und wenn er etwas sagte, dann neigte er dazu, Grenzen zu überschreiten. Seine Bemerkungen sollten witzig sein, waren aber meist nur peinlich. Talbot war kein Mensch, mit dem man mehr Zeit als unbedingt nötig verbrachte, und trotzdem tat er Leon leid. Monsieur Talbot war geschickt und einfallsreich, aber gleichzeitig auf eine befremdliche Art hilflos.
»Sie wollen doch nicht, dass Sie einer von hinten anbumst, oder, Docteur?«, sagte Talbot.
»Und Sie sind sicher, dass das Rücklicht passt?«, fragte Leon. »Die von Peugeot haben gesagt …«
»Die haben keine Ahnung«, unterbrach ihn Talbot. »Die kennen heute nur noch ihre Computer. Reinstecken, Fehler auslesen und Rechnung stellen. Ist doch so, oder?«
Nur einmal war es Leon gelungen, mit Talbot ein kurzes persönliches Gespräch zu führen. Das war, als Leon dem Gärtner den Tipp gegeben hatte, sich auf Diabetes untersuchen zu lassen. Ihm war aufgefallen, dass Talbot sich an den Dornbüschen Verletzungen zugezogen hatte, die nicht richtig heilten. Außerdem kam Talbot leicht ins Schwitzen, und er kratzte sich häufig. Zusammengenommen konnten diese Symptome auf einen Diabetes hinweisen. Leon hatte im Laufe seines Medizinerlebens gelernt, dass es einem viele Leute übel nahmen, wenn man ihnen einen ärztlichen Ratschlag gab. Das war bei Monsieur Talbot nicht so gewesen. Der Gärtner wollte Leon gar nicht mehr gehen lassen. So erfuhr Leon, dass der Mann aus der Gegend von Orange stammte und dass ihn der Tod seiner Mutter sehr bewegt hatte. Außerdem mochte Monsieur Talbot den Süden nicht besonders, weil ihm die Hitze im Sommer zusetzte und die Menschen so eigenartig seien. Schließlich gelang es Leon, das Gespräch mit der Bemerkung abzubrechen, dass er zu einer dringenden Untersuchung in die Rechtsmedizin müsse und Talbot sich wegen des Diabetestests einfach in der Internistischen Abteilung bei Dr. Menez melden sollte. Seit dieser Begegnung betrachtete der Gärtner Leon als seinen Vertrauten.