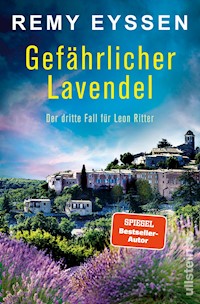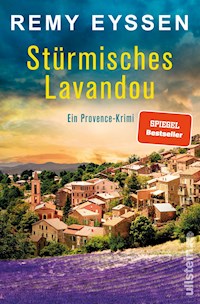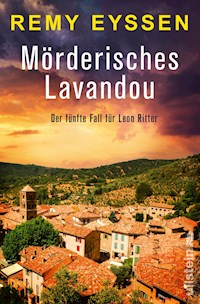9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Duftende Lavendelfelder, azurblaues Meer und ein dunkles Geheimnis Schließlich ist es doch noch Sommer geworden in Le Lavandou. Nach einem verregneten Mai genießen die Menschen die Sonne auf den belebten Terrassen der Bistros. Doch eines Morgens wird die Urlaubsidylle jäh zerrissen: Am Strand wurde die Leiche eines Jungen angespült, er trägt ein Kleid und ist wie ein Paket in einer Plastikplane verschnürt. Die Spuren führen Rechtsmediziner Leon Ritter und Capitaine Isabelle Morell bis zu einem katholischen Internat, in dem niemand so recht über die Vergangenheit sprechen will. Es bleibt nicht bei diesem einen Mord, und der Täter ist Leon näher, als er es für möglich hält …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Verhängnisvolles Lavandou
REMY EYSSEN, geboren 1955 in Frankfurt am Main, arbeitete als Redakteur u.a. bei der Münchner Abendzeitung. Anfang der Neunzigerjahre entstanden seine ersten Drehbücher. Bis heute folgten zahlreiche TV-Serien und Filme für alle großen deutschen Fernsehsender im Genre Krimi und Thriller. Mit seiner Krimireihe um den Gerichtsmediziner Leon Ritter begeistert er seine Leserinnen und Leser immer wieder aufs Neue und landet regelmäßig auf der Bestsellerliste.
Von Remy Eyssen sind in unserem Hause bereits erschienen:Tödlicher Lavendel · Schwarzer Lavendel · Gefährlicher Lavendel · Das Grab unter Zedern · Mörderisches Lavandou · Dunkles Lavandou · Verhängnisvolles Lavandou · Stürmisches Lavandou · Trügerisches Lavandou · Verräterisches Lavandou
Kleine Wellen plätscherten an den Strand, und der Sand rauschte leise, wenn sie sich wieder zurückzogen. Isabelle hatte ihren Wagen an der Straße abgestellt. Ein Pfad aus Holzbohlen führte durch Büsche von Zistrosen und Wacholder zum Strand hinunter. Eine Smaragdeidechse wärmte sich auf einem Felsen. Leon atmete tief ein. In der Luft lag der unverkennbare Geruch von Meer, Sand und Sonnenöl. Es hätte so ein idyllischer Platz sein können, wenn da nicht die Polizeiabsperrung und die blauweißen Einsatzfahrzeuge der Gendarmerie Nationale mit ihren rotblauen Blinklichtern gewesen wären. »Bonjour, Capitaine«, erklang Lieutenant Didier Masclaus Stimme. »Docteur«, wandte er sich an Leon. Leon antwortete nicht. Er war stehen geblieben und nahm die Szene in sich auf. Das Opfer erinnerte ihn an eine überdimensionale Puppe, die jemand bis zur Brust in den Sand eingegraben hatte. Seufzend ging er in die Hocke.
Remy Eyssen
Verhängnisvolles Lavandou
Ein Provence-Krimi
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Mai 2021© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, München (Himmel);© Stefan Damm / mato images (Hafen, Dorf)Autorenfoto: privatE-Book-Konvertierung powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor. ISBN 978-3-8437-2540-8
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Meiner Frau und meiner Tochterfür ihre Geduld und ihren Rat
Prolog
Es war still im Collège, dem alten, dunklen Internatsgebäude mit seinen endlos langen Gängen – totenstill. Der Mistral rüttelte an den Dachbalken und trug die Glockenschläge der Kirchturmuhr herüber. Zwei Uhr in der Nacht. Wie lange hatten sie sich über ihn hergemacht in dem Kellerraum? Der Junge hatte jedes Zeitgefühl verloren. Er wollte nur noch zurück in sein Zimmer, sich in seinem Bett unter der Wolldecke verkriechen, die sogar jetzt im Sommer noch zu dünn war, um ihn in den kühlen Nächten zu wärmen. Er wollte sich nur noch verstecken, sich ganz klein machen, sodass sie ihn nie wiederfinden würden. Wie der Mann aus dem alten Film, den er im Fernsehen gesehen hatte. Der war auch immer kleiner geworden, bis er zuletzt durch die Maschen des Fliegengitters hinaus in eine fremde, neue Welt hatte marschieren können.
Der Junge betete, dass ihm niemand in den Gängen begegnen würde. Er hatte Angst, dass jeder ihm ansehen konnte, was ihm angetan worden war. Dass diese widerlichen Schweine ihn erniedrigt und gebrochen, ihn ganz tief in seiner Seele verletzt hatten. Sie waren zu fünft über ihn hergefallen. Fünf kräftige Männer gegen einen kleinen Jungen. Am Anfang, als sie ihm die Schlafanzughose herunterziehen wollten, da hatte er sich noch gewehrt. Hatte getreten und geschrien, aber dann kam der Knebel. Was hätte er denn tun sollen? Er war doch erst zehn Jahre alt.
Der Junge und sein Zimmergenosse Émile hatten sich geschworen, sich von den Erziehern nichts mehr gefallen zu lassen. Sie waren fest entschlossen. Sie waren nicht solche Weicheier wie andere Jungs in ihrem Alter, das stand mal fest. Er kannte seinen Zimmergenossen erst seit ein paar Monaten, aber Émile war schon jetzt sein bester Freund. Die ersten Wochen hatte der Junge oft geweint, wenn er nachts allein in seinem Zimmer lag und durch das offene Fenster die Sterne funkeln sah. Wenn er sich so unendlich einsam fühlte. Aber dann bekam er einen Mitbewohner ins Zimmer, Émile. Der Junge war zwar ein halbes Jahr jünger als er, aber er hatte den Mut, den Erziehern zu widersprechen, auch wenn er dafür regelmäßig Schläge mit dem Gürtel bezog. Der Junge bewunderte Émile, und er war glücklich, ihn als Freund zu haben. Mit ihm konnte er sogar davon träumen, eines Tages, wenn sie größer und stärker geworden wären, aus dem Collège abzuhauen.
Es war die Idee seiner Tante Catherine gewesen, ihn hierher ins Internat zu bringen. Nicht, weil er ein schwieriges Kind, besonders aggressiv oder gar schlecht in der Schule gewesen wäre. Der Grund, warum er in dem katholischen Internat landete, waren seine »schwierigen familiären Umstände«, wie der Mann vom Sozialamt gesagt hatte. Das klang für den Jungen gerade so, als wäre es seine Schuld, dass die Dinge so waren, wie sie eben waren.
Seinen Vater hatte der Junge nie kennengelernt. Er wuchs bei seiner Mutter auf, wenn man das so nennen konnte. In Wirklichkeit kümmerte sich niemand um ihn. Er hatte seine Mutter lieb, das war klar. Gelegentlich war sie auch wirklich herzlich und manchmal sogar liebevoll. Solange sie nicht getrunken hatte. Betrunken war sie unerträglich, und betrunken war sie eigentlich die meiste Zeit. Manchmal verschwand sie einfach und ließ ihn allein in der Wohnung zurück. Irgendwann wurde sie dann von der Polizei wieder nach Hause gebracht. Dann erklärte der Junge jedes Mal den Beamten, dass sie eine Pflegerin vom Sozialamt hätten, die gleich kommen würde. Dann ließen die Beamten ihn in Ruhe und zogen wieder ab.
Das waren die Augenblicke, die er am meisten fürchtete: Wenn er mit seiner betrunkenen Mutter allein war und sie davon abhalten musste, bis zur Besinnungslosigkeit weiterzutrinken. Er hatte Angst, dass die Behörden ihm seine Mutter eines Tages wegnehmen könnten. So wie die Gendarmerie gelegentlich bei Leuten anrückte, um ihnen ihre Katzen oder Hunde wegzunehmen, wenn die Besitzer nicht mit ihnen fertigwurden. Der Junge hatte Angst, dass man das vielleicht auch mit seiner Mutter machen könnte.
Also redete er sich ein, dass seine Mutter nur krank war und dass sich schon bald alles zum Guten wenden würde. Aber nichts wendete sich zum Guten. Im Gegenteil, es wurde von Jahr zu Jahr schlimmer. Bis seine Mutter dann eines Tages gar nicht mehr nach Hause kam. Nach drei Tagen fand der Junge sie in der Dachkammer des Mietshauses, in dem sie wohnten: besinnungslos und verdreckt zwischen einem Haufen leerer Flaschen. Das war der Augenblick, als die Behörde seine Mutter nicht mehr zurückbrachte, sondern sie in die Klinik für Suchtkranke eingeliefert hatte. Er dagegen kam zu Tante Catherine, und die kannte einen Priester. Und so landete der Junge, drei Tage vor seinem zehnten Geburtstag, in einem katholischen Internat in den Hügeln der Provence.
Die Schule war kein guter Platz für einen kleinen Jungen, der seine Eltern verloren hatte. Von Anfang an hatte der Junge Geschichten gehört, dass die Erzieher die »Neuen« drangsalieren würden. Aber man konnte sich angeblich auch Vergünstigungen erkaufen, hieß es unter den Älteren. Man brauchte nur »ein wenig nett« zu den Erziehern zu sein. Daraufhin hatten alle gelacht. Der Junge fragte sich, was »nett« zu bedeuten hatte. In dieser Nacht kamen sie zum ersten Mal.
Plötzlich spürte er wieder die Schmerzen im Bauch, als wäre etwas in seinem Inneren zerrissen. Er wäre am liebsten in sein Zimmer gerannt, aber das konnte er nicht. Er spürte die Stiche, wenn er sich hastig bewegte, als hätte er Nägel verschluckt. Also schleppte er sich langsam und unter Schmerzen den langen, düsteren Flur entlang, immer in der Angst, dass die Erzieher plötzlich wieder auftauchen würden, um ihn noch einmal abzuholen. »Ad Officium divinum«, zum mitternächtlichen Gebet, hatten sie gesagt, als sie ihn mitten in der Nacht geweckt hatten. Doch es war nicht das Gebet in der Schulkapelle, zu dem er geführt worden war. Es war die Waschküche im Keller. Da stand der große Tisch, auf dem tagsüber Bettwäsche gefaltet wurde.
Was wollen wir hier?, hatte der Junge noch gefragt, als er von hinten gepackt und auf den Tisch gedrückt wurde. Er versuchte verzweifelt, sich zu wehren. Erinnerungen holten ihn ein. Er wollte diese Bilder verdrängen, aber sie kamen einfach, überfielen ihn regelrecht, verdrängten alles andere. Er sah die verzerrten Gesichter der Männer. Ihr gemeines Lachen und ihr Stöhnen und Grunzen, als sie sich über ihn beugten. Den Schweiß ihrer nackten Körper und diesen anderen Geruch, den er nie vergessen würde, von Pisse und Vanille, den die dampfenden Körper von sich gaben, wenn sie das Testosteron ausschütteten.
Bitte nicht, ich will nicht, hatte er gefleht. Lasst mich in Ruhe. Aber sie waren wie Tiere. Er spürte den Schmerz, als würde in ihm etwas zerreißen. Sie hatten ihm gezeigt, dass der Mensch keine Gnade, kein Mitgefühl mehr kannte, wenn er nur noch seinen Trieben gehorchte.
Irgendwann hatte einer der Kerle ihn nach draußen getragen und auf einen Haufen ungewaschener Bettlaken geworfen, wie ein Bündel schmutziger Wäsche. Wieder stiegen Bilder in ihm hoch. Er wollte, dass sie verschwanden, ein für alle Mal. Er wollte sie aus seinem Gedächtnis streichen, aber das gelang ihm nicht. Sowie er seine Augen schloss, waren sie wieder da. Und er schwor sich, dass er niemals darüber sprechen würde, was in dieser Nacht geschehen war, nicht mal mit seinem besten Freund Émile.
Als der Junge fast lautlos die Zimmertür öffnete, sah er, dass das Bett von Émile leer war. Er knipste die Nachttischlampe an. Émiles Bett war frisch bezogen. Die dünne Wolldecke, akkurat gefaltet, lag genau auf die Bettkante am Fußende ausgerichtet. Das kleine Regal, auf dem Émile eine Sammlung seiner liebsten Star-Wars-Figuren aufgebaut hatte, war leer, genauso wie sein Spind. Auf Émiles Nachttisch lag die Bibel, das war alles. Was war geschehen, wohin hatten sie Émile gebracht?
Der Junge krabbelte unter die zerschlissene Wolldecke und rollte sich zusammen wie eine verwundete Katze. Irgendwann am frühen Morgen, noch bevor die Sonne aufgegangen war, hörte er Geflüster im Hof und das Schlagen einer Autotür. Er schob sich vorsichtig ans Fenster und spähte nach draußen. Seine Peiniger standen unten und luden etwas in den Kofferraum.
Am nächsten Tag erzählten sie, Émile sei abgehauen. Durchgebrannt mit einem gestohlenen Motorroller und dabei tödlich verunglückt. Der Junge hatte diese Geschichte niemals geglaubt. Er wusste, dass die Männer logen. Denn Émile hatte ihm etwas dagelassen: sein Basecap von Olympique Marseille. Mit einem Autogramm des unvergesslichen Torschützenkönigs Jean-Pierre Papin. Die Kappe war Émiles ganzer Stolz und sein kostbarster Besitz gewesen. Sie lag unter dem Kopfkissen des Jungen, als hätte Émile genau gewusst, dass er von dieser Nacht nie wieder zurückkehren würde.
Kapitel 1
25 Jahre später
Schließlich war es doch noch Sommer geworden in Le Lavandou. Heftige Regenfälle hatten in den letzten beiden Monaten dafür gesorgt, dass stinkendes Abwasser unter den Gullydeckeln hervorgequollen war und mehrfach Schlammlawinen die Hauptstraße blockiert hatten. Selbst die ältesten Einheimischen konnten sich nicht an einen so trostlosen verregneten Frühling erinnern und unkten, dass es im Sommer nicht besser würde. Die Jüngeren machten die weltweite Klimakatastrophe für das Unwetter verantwortlich, andere sahen darin ein Zeichen des Herrn als Antwort auf die überzogenen Immobilienpreise in der Provence.
Doch seit zwei Tagen bliesen Ausläufer eines kräftigen Hochs über der Iberischen Halbinsel den Regen ins Landesinnere. Inzwischen strahlte die Sonne vom Himmel, als hätte es nie Regen gegeben. Der Ginster wucherte grün wie selten. Die Mimosen blühten gelb und üppig wie seit Jahren nicht mehr. Die ganze Vegetation schien von Blüten und Blättern überzuquellen und überzog die Côte d’Azur mit einem Hauch von Karibik. Die Wettervorhersage hatte auch für die nächste Woche wolkenlosen Sonnenschein angekündigt. Also saßen Besucher und Einheimische vor den Cafés und Bistros, tranken Café Crème oder einen Pastis zum Aufwachen und waren sich einig, dass ihnen ein wunderbarer Sommer bevorstand.
Es war noch früh, und Louisa hatte beschlossen, ganz zum Ende des großen Strandes von Le Lavandou zu laufen. Denn für das, was sie vorhatte, brauchte sie nicht nur Platz, sondern so wenige Zuschauer wie möglich. Louisa nannte sich im Internet Louisa Lavandou, und als Beruf gab sie Influencerin an. So stand es zumindest auf ihrer Visitenkarte, die sie sich mit blauer Schrift auf rosa Kärtchen hatte prägen lassen. War ja klar, dass ihre Eltern wenig von ihren Berufsplänen hielten. Wenn es nach ihnen ging, würde sie die nächsten Jahre im Supermarkt an der Kasse sitzen, den pickeligen Filialleiter heiraten und zwei Kinder bekommen. Nein danke. Aber was hatte sie erwartet? Ihr Vater fuhr als Busfahrer jeden Tag viermal die Strecke Toulon – Le Lavandou, und ihre Mutter arbeitete in der Pâtisserie in der Rue Général de Gaulle. So ein Leben wie ihre Eltern würde sie niemals führen, das hatte sich Louisa geschworen. Sie war schließlich siebzehn Jahre alt, und sie lebte in einer neuen Welt mit neuen Chancen, Geld zu verdienen. Eine Welt, von der ihre Eltern rein gar nichts verstanden. Sie würde ihnen zeigen, wie man heute zu Wohlstand kam. Wie man all die tollen Dinge erleben konnte, die ihre Eltern nur aus dem Fernsehen kannten. Wenn sie ehrlich zu sich selbst war, kannte auch Louisa diese Sachen nur aus dem Fernsehen, aber dafür hatte sie gewaltige Träume. Darum hatte Louisa vor sechs Monaten ihren Instagram-Account eröffnet. Sie hatte sich ein Ziel gesetzt: Sie würde das bekannteste Gesicht der Provence werden. Bewundert von Tausenden von Followern und überschüttet mit Werbeaufträgen für Produkte aller Art, die sie auf ihrem Account vorstellen würde. Es war einfach toll, erfolgreich zu sein, dachte Louisa, und es war ganz simpel, wenn man nur wusste, wie man es angehen musste. Louisa war sich sicher, dass sie den richtigen Weg kannte. Sie würde schon nach kürzester Zeit in einem pinkfarbenen Cabriolet die Küste entlangbrausen, von einem Event zum nächsten. Und ihre Follower würden sie mit Likes überschütten, weil sie sie an ihrem fantastischen Leben teilhaben ließ. Jeden Tag würde sie ihnen einen Clip servieren. Einen kleinen Videoschnipsel aus ihrem bunten, glamourösen Leben.
Das war im vergangenen Herbst gewesen. Seitdem hatte sich nicht viel getan auf Louisas Profil. Sie hatte schnell begriffen, dass sie nicht die einzige blonde Siebzehnjährige mit blauen Augen und großen Träumen war, die ihr Geld als Influencerin verdienen wollte. Verdammt, warum hatte eine aufgespritzte Kuh wie diese Kim Kardashian 150 Millionen Follower und sie nur 268? Und warum wurde ein ehemaliges Model wie Heidi Klum mit Werbeaufträgen zugeschüttet? Während sie sich bis heute abmühte, die Sonnencreme wenigstens umsonst vom Hersteller zu bekommen, wenn sie sich das blöde Zeug schon für ihre Follower auf die Haut schmieren sollte. Also hatte sie beschlossen, das Beste aus ihrer Situation zu machen und täglich einen kurzen Videoclip am Strand zu produzieren und ins Netz zu stellen. Werbeaufträge hin oder her.
Louisa lief barfuß durch den warmen Sand, in den die Regenfluten Muster gespült hatten, die wie ein Geflecht aus Adern aussahen. Louisa blieb stehen und sah sich um. Hier, am Ende der Bucht, war sie ganz allein. Hinter ihr die Felsen und drei große Palmen, vor ihr der leere Beach und das glitzernde Meer. Sie breitete ihr Handtuch aus, das das Logo eines örtlichen Hotels trug. Dann setzte sie sich auf ihre Unterschenkel, drückte ihr Kreuz durch, streckte die linke Hand mit dem Handy so weit von sich, wie sie nur konnte, und blickte dann über ihre Schulter direkt in die Linse der Kamera.
»Guten Morgen, ihr Süßen«, säuselte sie. »Für alle, die im Moment das Meer nicht rauschen hören können«, sie schwieg ein paar Sekunden, »das war eben original Mittelmeerrauschen.«
Sie brach ab, um den Ausschnitt zu begutachten, den sie für ihren heutigen Post gewählt hatte. Alles perfekt, außer dieses dunkelgrüne Ding da im Hintergrund. Rund zwanzig Meter weiter bei den Felsen mündete ein Überlaufkanal ins Meer. Wasser floss hier nur, wenn es in den Hügeln heftig schüttete. Dann wurden die Regenmassen über diese Kanäle direkt ins Meer abgeleitet, um Überschwemmungen auf den Küstenstraßen und im Hinterland zu vermeiden. Normalerweise waren diese Kanäle, die nur etwa drei Meter breit waren, versandet, und man konnte sie leicht übersehen. Aber die gewaltigen Regenmengen der letzten Tage hatten sie frei gespült, und offenbar war auch ein längliches Paket vom Wasser mitgerissen worden. Und dieses Paket ragte jetzt in Louisas Bild, genau dort, wo die Influencerin ihren Followern südfranzösische Strandatmosphäre vermitteln wollte. Sie hätte sich natürlich auch einen anderen Platz suchen können, aber Louisa beschloss, das Problem selbst in die Hand zu nehmen.
Das Paket war irgendwie an der gemauerten Öffnung des Kanals hängen geblieben. Das nachfließende Wasser hatte es ein Stück weit in den Sand eingeschwemmt, sodass jetzt nur etwa vierzig Zentimeter davon zu sehen waren. Was immer sich in dem Paket befand, jemand hatte es sorgfältig in zwei dunkelgrüne Mülltüten für Gartenabfälle gesteckt und mit Klebeband verschlossen. Zunächst dachte Louisa, es würde genügen, ein paar Handvoll Sand auf das Paket zu werfen und es so unsichtbar zu machen. Doch der Sand rieselte an der Plastikfolie herunter wie Wasser. Also würde sie das Paket nehmen und es einfach einen halben Meter zurück in den Kanal werfen, und schon wäre es nicht mehr zu sehen.
Sie griff nach der Plastiktüte und zog. Nichts rührte sich. Offenbar steckte das Paket doch tiefer im Sand, als sie gedacht hatte. Sie packte erneut zu, diesmal fester, und richtete sich auf, ohne die Plastikverpackung loszulassen. Mit einem knisternden Geräusch, als ob Papier zerriss, löste sich das Klebeband von der Verpackung. Louisa zog noch einmal, und nach einem plötzlichen Ruck hielt sie nur noch die Mülltüte in den Händen, der Rest war im Sand stecken geblieben.
Für einen kurzen Moment war Louisa wie erstarrt. Direkt vor ihr ragte ein etwa zehnjähriges Mädchen in einem hellen Sommerkleid aus dem Sand. Ihr Gesicht war aufgedunsen vom Verwesungsprozess, und an ihrer Stirn klaffte ein rundes Loch von der Größe eines Fünfcentstücks.
Louisa wollte weglaufen, nur fort von diesem Geschöpf aus der Unterwelt. Aber etwas hielt sie zurück, machte es ihr unmöglich, die Flucht zu ergreifen, zwang sie stattdessen, die Tote anzustarren, ihr genau in ihre milchig grauen Augen zu sehen. Verschmierter Lippenstift um den kleinen Mund, schwarzer Kajalstift um die Augen. Und plötzlich begriff sie: Das war gar kein kleines Mädchen. Das war ein kleiner Junge, und er trug nichts als das helle Sommerkleid. Jetzt fing Louisa an zu schreien.
Kapitel 2
»Ich habe fast eine halbe Stunde im Bistro auf dich gewartet.« Isabelle sah ihre siebzehnjährige Tochter Lilou an, die eine Tasse dampfenden Tees in den Händen hielt.
»Ich habe es vergessen«, sagte Lilou. »Das kann doch mal passieren.«
Lilou trug eine Jeans, die sie sich über dem Knie abgeschnitten hatte, und darüber ein weites T-Shirt mit dem Aufdruck: Save the Planet! Ihre schönen dunklen Haare hatte sie sich wie üblich zu einem Dutt zusammengedreht, der von einer Haarklammer in Form einer dicken Erdbeere gehalten wurde.
Leon beobachtete Isabelle und Lilou von der Terrasse aus. Hier hatte er sich für den ersten Tee des Tages in einen der alten Korbstühle gesetzt und über die Dächer von Le Lavandou aufs Meer gesehen. Das tat er jeden Morgen, wenn es das Wetter zuließ. Es war seine tägliche Meditation. Einfach nur still dasitzen und den Möwen nachschauen, die sich von der Meeresbrise die Küstenlinie entlangtreiben ließen.
»Okay, mir ist was dazwischengekommen«, sagte Lilou im leicht genervten Ton, der Eltern signalisieren sollte, dass kein weiterer Gesprächsbedarf bestand.
Leon erhob sich und schlenderte in die Küche.
»Wir hatten das schon vor einer Woche verabredet«, sagte Isabelle.
»Morgen, Lilou«, Leon wollte ihr einen Kuss auf die Wange geben, aber sie wich ihm aus.
»Euch kommt doch auch ständig etwas dazwischen«, Lilou klang jetzt etwas patzig.
Leon betrachtete Isabelle und ihre Tochter. Kam es ihm nur so vor, oder war Lilou inzwischen tatsächlich so groß wie ihre Mutter? An den Kindern siehst du, wie alt du geworden bist, dachte Leon und war sich nicht sicher, ob das eine gute oder eine schlechte Erkenntnis war.
»Ich wollte gerade Rührei machen«, sagte Isabelle.
»Lass mich das machen«, Leon nahm eine eiserne Pfanne vom Haken und stellte sie auf den Gasherd. »Rührei mit frischen Tomaten und klein gehackten Zwiebeln, nach Art des Hauses. Für dich auch, Lilou?«
Leon hatte die Kühlschranktür geöffnet und den Karton mit den Eiern herausgenommen.
»Rührei? Zum Frühstück? Willst du mich vergiften?« Lilou hatte sich etwas Milch auf ihr karges Müsli geschüttet, das sie im Stehen löffelte. Sie war erst kürzlich wieder zu den Vegetariern übergelaufen. Nicht zum ersten Mal. Leon war sicher, dass sie es auch diesmal nicht lange durchhalten würde, und versuchte gelegentlich, sie in Versuchung zu führen.
»Ist vielleicht keine so schlechte Idee. Was denkst du, Isabelle?«, sagte Leon.
»Sehr witzig«, Lilou mochte es nicht, wenn man sich über sie lustig machte.
»Solange wir keine Spuren hinterlassen, spricht nichts dagegen«, antwortete Isabelle mit gespielt ernster Stimme und konnte auf dem Gesicht ihrer Tochter wenigstens ein kleines Lächeln auslösen.
»Ich hoffe, du vergisst nicht das Konzert am Freitag«, sagte Isabelle.
»Am liebsten würde ich nicht hingehen.« Lilou hatte diesen Satz leise durch ihre zusammengepressten Zähne gezischt.
»Nicht dein Ernst«, Isabelles Stimme hatte jetzt einen strengeren Ton. »Das ist ein Charity-Konzert, da kann man nicht einfach …«
»Ja, ja, ich weiß«, unterbrach Lilou ihre Mutter.
»Außerdem ist der Auftritt eurer Klasse fest eingeplant. Da kannst du doch nicht einfach hingehen und sagen, dass du im Chor nicht mehr mitsingst.«
Lilou sah ihre Mutter genervt an. Sie wusste, wie wichtig Isabelle die Veranstaltung zur »Hilfe für die Kinder von Mali« war. Die Presse würde da sein, sogar das Fernsehen und jede Menge Promis aus der Gegend. Trotzdem hätte sie alles dafür gegeben, dort nicht hingehen zu müssen. Sie hatte weiß Gott Besseres zu tun.
»Was ist nur plötzlich los mit dir?«, fragte Isabelle.
»Lass mich raten«, Leon schlug drei Eier in die Pfanne. »Es geht um einen Mann …?«
Lilou antwortete nicht auf Leons Bemerkung, was sofort Isabelles Aufmerksamkeit erregte.
»Wirklich?«, fragte Isabelle. »Wer ist es?«
»Sei nicht so neugierig«, meinte Leon.
»Ich muss los«, Lilou schien das Gespräch unangenehm zu sein.
»Es ist aber niemand aus deiner Klasse, oder?«, fragte Isabelle.
»Ganz sicher nicht«, sagte Lilou herablassend. »Die sind mir viel zu kindisch.«
»Dann ist er also älter?«, fragte Isabelle.
»Was soll das werden, Maman? Wir sind nicht bei dir auf der Wache!«
Leon grinste. Er wusste, wie hartnäckig Isabelle sein konnte, wenn es darum ging, einen Verdächtigen zu vernehmen. Das war eine ihrer Fähigkeiten, die dazu beigetragen hatten, dass Isabelle Morell zur stellvertretenden Polizeichefin von Le Lavandou berufen worden war.
»Du kannst ihn doch einfach mal mitbringen«, sagte Leon.
»Natürlich, damit du ihn sezieren kannst«, meinte Lilou trocken. »Kann man hier nicht mal in Ruhe sein Müsli essen?«
»Nicht, solange man mit dieser lästigen Familie zusammenlebt«, entgegnete Leon.
»Ich kann es gar nicht erwarten, endlich mein Bac zu machen.« Lilou gab ein leises Stöhnen von sich. Nach dem Baccalauréat, dem Abitur, würde sie sofort ausziehen.
»In einem Jahr«, sagte Leon.
»Nur noch zehn Monate«, korrigierte Lilou.
»Wie schade«, meinte Leon.
Als er Isabelle kennengelernt hatte, war ihre Tochter Lilou zwölf Jahre alt gewesen. In den Jahren war Lilou ihm ans Herz gewachsen, und er betrachtete sie wie seine eigene Tochter. Er mochte ihre freche, selbstbewusste Art, und er hatte sich oft gefragt, wie sich Isabelles und sein Leben wohl verändern würde, wenn Lilou nächstes Jahr zum Studieren in eine andere Stadt zöge.
»Wie heißt er denn?«
»Ihr kennt ihn sowieso nicht.«
»Gibt es irgendeinen Grund, warum du uns seinen Namen nicht sagen willst?«, fragte Isabelle.
»Du bist so was von misstrauisch.« Lilou blickte Hilfe suchend zu Leon.
Isabelle war immer in Sorge, wenn es um Lilou und neue Freunde ging. Kein Wunder, sie hatte vor einigen Jahren erleben müssen, wie ihre Tochter entführt wurde. Damals überlebte Lilou nur mit viel Glück und der Hilfe von Leon.
»Muss ein toller Kerl sein«, sagte Leon, während er Isabelle einen Blick zuwarf, »wenn sie dafür das Konzert sausen lassen will.«
»Will sie doch gar nicht«, sie sah Lilou an. »Oder, ma petite?« Isabelle wollte den Arm um die Schulter ihrer Tochter legen, aber die drehte sich weg.
»Wird bestimmt ein wunderbarer Abend«, sagte Leon. »Sogar ich gehe hin. Und du weißt, was ich von solchen Veranstaltungen halte.«
»Ich habe trotzdem keine Lust«, sagte Lilou, und Isabelle merkte, dass ihre Tochter ihnen irgendetwas verheimlichte.
»Das kann nur Liebe sein«, Leon verdrehte die Augen in Richtung Zimmerdecke und seufzte theatralisch.
»Ihr seid so doof«, sagte Lilou.
Isabelles Handy auf dem Küchentisch summte. Sie griff nach dem Smartphone, sah den Namen des Anrufers und nahm den Anruf entgegen.
»Morell … Ja, ich weiß, wo das ist. Gib uns zehn Minuten, Moma, und sperrt großräumig ab. Ich will keine Touristen mit ihren Handys sehen.« Sie legte auf. »Sie haben am Strand ein totes Kind gefunden«, sagte Isabelle. »Sie wollen auch den Gerichtsmediziner vor Ort haben.«
»Ciao, Frühstück«, Leon deckte seinen Teller mit dem Rührei ab. Dann schob er alles in den Kühlschrank. Isabelle lächelte.
Kapitel 3
Während die meisten Touristen noch beim Frühstück saßen, stand die Sonne bereits hoch am wolkenlosen Himmel. Das Meer lag ruhig da, wie ein Bergsee. Kleine Wellen plätscherten mit sanftem Klatschen an den Strand, und der Sand rauschte leise, wenn sie sich wieder zurückzogen. Isabelle hatte ihren Wagen weiter oben an der Straße abgestellt. Ein Pfad aus Holzbohlen führte durch Büsche von Zistrosen und Wacholder zum Strand hinunter. Eine Smaragdeidechse wärmte sich auf einem Felsen. Leon atmete tief ein. In der Luft lag der unverkennbare Geruch von Meer, Sand und Sonnenöl. Es hätte so ein idyllischer Platz sein können, wenn da nicht die Polizeiabsperrung und die blau-weißen Einsatzfahrzeuge der Gendarmerie nationale mit ihren rotblauen Blinklichtern gewesen wären.
Vor dem Hochwasserkanal am Strand hatten sich inzwischen einige Dutzend Schaulustige versammelt. Als der Polizist, der die Absperrung überwachte, Leon und Isabelle kommen sah, hielt er ihnen das rot-weiße Flatterband hoch.
»Bonjour«, sagte der Beamte höflich. »Der Patron und die anderen sind da hinten.«
Der Polizist deutete zu den tragbaren Sichtschutzwänden, die die Gendarmerie am Auslass des Kanals aufgestellt hatte, um die Gaffer mit ihren Handys abzuwehren.
»Bonjour, Capitaine.« Zerna, der Polizeichef, war den beiden ein paar Schritte entgegengekommen. »Bonjour, Docteur«, begrüßte er Leon.
»Bonjour, hoffentlich sind nicht alle Spuren zertrampelt«, Leon sah mit skeptischem Blick zum Fundort der Leiche hinüber.
»Wir haben versucht, das Schlimmste zu verhindern. Aber es waren schon einige Personen hier, als wir kamen«, Zerna ging voraus, die anderen folgten.
»Bonjour, Docteur«, Lieutenant Didier Masclau schloss sich der kleinen Gruppe an.
»Ich glaube, es ist ein Junge. Hat aber Klamotten von einem Mädchen an«, sagte Zerna und deutete auf die Wunde an der Stirn des Kindes. »Ist das eine Schusswunde?«
»Diese Typen werden immer perverser«, schimpfte Masclau. »Liegt am Internet, wetten?«
Leon antwortete nicht. Er war stehen geblieben und nahm die Szene in sich auf, als würde er sie mit einer inneren Digitalkamera fotografieren. Das Opfer erinnerte ihn an eine überdimensionale Puppe, die jemand bis zur Brust in den Sand eingegraben hatte. Das Gesicht war geschwollen, der Hals aufgedunsen. Die Augen waren milchig und schienen sich tief in den Schädel zurückgezogen zu haben. Das dunkle Mal auf der Stirn sah ihn wie ein Auge an.
»Wer hat die Plastikfolie abgenommen?«
»War keiner von uns«, sagte Masclau.
»Das war die Zeugin«, erklärte Zerna. »Sie wollte den Sack aus dem Weg schieben und hat dabei das Paket aufgerissen. Was für eine Schweinerei.«
»Wo ist die Zeugin?«, wollte Isabelle wissen.
»Sitzt oben im Krankenwagen«, antwortete Masclau. »Hat sich ihre Sommerferien wohl auch anders vorgestellt.«
»Ich werde gleich mal mit ihr reden«, Isabelle warf dem Lieutenant einen Blick zu.
»Wohin führt der Kanal?«, wollte Leon von Isabelle wissen, aber die zuckte nur mit den Schultern.
»Das ist der Batailler. Der geht hoch bis nach l’Angueiroun«, mischte sich Masclau ein.
»Zu dem Weingut?«, fragte Leon.
»Ganz in die Nähe. Da ist es natürlich kein Kanal mehr. Da gibt es nur noch das Bachbett«, sagte Masclau. »Liegt die meiste Zeit des Jahres mehr oder weniger trocken, so wie jetzt. Ist ein ganzes Stück bis hier runter. Sicher sechs oder sieben Kilometer.«
Ein paar besonders Neugierige hatten inzwischen versucht, über die Dünen zu dem Tatort zu gelangen. Isabelle lief ihnen entgegen, als die Ersten über die Absperrung steigen wollten.
»Bleiben Sie hinter den Bändern, das hier ist Sperrgebiet«, rief sie den Gaffern zu. »Didier, nimm dir noch zwei Beamte, und kümmere dich darum.«
»Bitte, treten Sie auch zurück«, sagte Leon zu den Polizisten, die ihm über die Schulter sahen. Die Beamten gehorchten.
Leon kniete sich in den Sand und öffnete seine verschlissene Ledertasche, die er immer mit sich trug, wenn er zu einem Tatort gerufen wurde. Er streifte sich Latexhandschuhe über und holte eine kleine Blumenschaufel aus der Ledertasche. Vorsichtig begann er, den Sand um das Opfer zur Seite zu schieben. Dabei achtete er darauf, weder das Opfer noch die Plastiktüten zu beschädigen. Alles hätte eine Spur sein können.
Das Kind war acht, vielleicht zehn Jahre alt. Das Wasser hatte die Haut der Leiche verfärbt und aufquellen lassen. Trotzdem erkannte Leon sofort die braune Pigmentierung der Haut. Nordafrika, vielleicht aus dem arabischen Raum, dachte er. Er würde diese Beobachtungen aber vorerst für sich behalten. Das Interesse der Gendarmerie am Tod eines kleinen Kindes war höher, wenn sie nicht wusste, dass es sich bei dem Opfer um einen Flüchtling handeln könnte.
Der Rechtsmediziner sah den Kanal hinauf. Die überwiegende Zeit des Jahres lag der künstliche Wasserlauf trocken, hatte Masclau ihm erklärt. Bei Starkregen konnte sich das Bachbett jedoch blitzschnell in einen tosenden Fluss verwandeln, wusste Leon.
Es war schwer zu sagen, wie weit das Opfer von den Fluten der letzten Wochen mitgerissen worden war. Die Fliegen hatten die Leiche noch nicht gefunden. Normalerweise dauerte es keine zwei Stunden, bis die Fliegen einen toten Körper ausgemacht hatten, auch wenn er einen Kilometer oder mehr von den Insekten entfernt war. Möglich, dass die Leiche durch die Plastiksäcke davor bewahrt worden war. Außerdem war sie für einige Zeit vom Regenwasser bedeckt gewesen. Eine natürliche Sperre gegen Insekten. Inzwischen war der Kanal aber bis auf ein Rinnsal wieder trocken. Die Luft war warm, und die Verwesung hatte verstärkt eingesetzt.
Leon wedelte mit der Hand die Fliegen zur Seite, die auf dem Gesicht des Opfers gelandet waren und versuchten, ihre Eier in Mund und Nase abzulegen.
»Ein Junge?«, fragte Zerna, und Leon nickte. Er hatte schon mit einem kurzen Blick erkannt, dass es der kräftige Körper eines Jungen war, der da vor ihm in dem Kleid steckte.
»Ausländer?«, fragte Masclau sofort.
»Das kann ich jetzt wirklich noch nicht sagen«, Leon hatte das Opfer inzwischen bis zur Hüfte ausgegraben. Die Mülltüte lag neben ihm im Sand. Wie die abgestreifte Haut eines Reptils, dachte Leon. Der Junge trug ein Kleid, das mit roten Kirschen bedruckt und einmal weiß gewesen war. Der Stoff war zerrissen und voller schmutziger, dunkler Flecken. Leon betrachtete die Wunden an Hals und Brust des Opfers.
»Mon Dieu«, Polizeichef Zerna deutete auf die dunkel angelaufenen Hämatome. »Was haben die mit dem Kind gemacht?«
»Schläge, vermute ich«, Leon sah Zerna an. »Die anderen Stellen sind Schnitte und könnten von einem Messer stammen.«
»Können Sie sagen, wie lange er schon tot ist?«
»Schwierig, solange wir nicht genau wissen, wo und unter welchen Umständen er gestorben ist.«
»Ich weiß, ich weiß«, Zerna winkte mit einer kleinen Handbewegung ab, so als müsste er Leon überzeugen, dass er auch eine ungenaue Schätzung akzeptierte.
»Mindestens vier Tage«, sagte Leon. »Vielleicht auch eine Woche.«
»Wie können Sie das dann so genau wissen?« In der Frage von Masclau lag eine unüberhörbare Skepsis.
»Die zweite Totenstarre hat bereits nachgelassen«, erklärte Leon geduldig. »Außerdem denke ich, dass er vom Regenwasser hierhergeschwemmt worden ist. Und der Regen hat vor drei Tagen aufgehört.«
»Commandant Zerna …!«, rief in diesem Moment eine helle, laute Stimme.
Über den Sand kam eine Frau in Jeans und weißer Seidenbluse gelaufen. Sie war barfuß. Ihre Gucci-Schuhe trug sie wie eine kostbare Monstranz vor sich in der Hand. Jeder wusste, wer diese Person war, und niemand hatte gewagt, sie aufzuhalten. Madame Berthier, die Leiterin des Fremdenverkehrsamtes von Le Lavandou, war dafür verantwortlich, dass jedes Jahr aufs Neue möglichst viele zahlungswillige Touristen kamen, um die Kassen der einheimischen Geschäfte zu füllen. Sie hatte eine unangenehme Art, immer so laut zu sprechen, dass ihre Stimme alle übrigen Gespräche überlagerte. Sie war nicht leicht zu übersehen und schon gar nicht zu überhören.
»Commandant Zerna«, wiederholte sie. »Ich muss Sie sprechen, dringend sprechen.«
»Madame Berthier …?«, sagte Zerna betont erstaunt. »Das hier ist ein Polizeieinsatz.« Aber das schien Madame Berthier nicht im Geringsten zu interessieren.
»Wissen Sie denn nicht, dass wir heute hier unsere ›Exposition à la plage‹ haben?«, der Vorwurf war nicht zu überhören.
Zerna sah Hilfe suchend nach Isabelle.
»Junge Designer der Côte d’Azur zeigen ihre Sommermode«, sagte Isabelle schnell. »Aber das kann man doch bestimmt weiter nach vorne verlegen«, sie deutete mit einer vagen Bewegung den Strand hinunter.
»Das hier ist unser Motiv!« Madame Berthier hob die Hände vors Gesicht, als hielten sie eine imaginäre Kamera. »Die Palmen, die Felsen und im Hintergrund die Jachten. Das ist Le Lavandou, das ist unsere ›Message‹, das wollen die Gäste sehen.«
»Im Moment ist das hier erst mal ein Tatort«, Zerna klang leicht genervt. »Wir haben einen Toten.«
Madame Berthier warf einen schnellen Blick zu dem toten Jungen im Sand und zuckte erschrocken zurück.
»Der muss weg«, sagte Madame Berthier, merkte aber sofort, dass sie zu weit gegangen war. »Ich meine … der Tote, den bringen Sie doch sicher bald weg. Bei der Sonne und der Hitze … Vielleicht könnte man die Untersuchung etwas beschleunigen.«
»Darüber entscheidet unser Rechtsmediziner«, sagte Isabelle mit einem Blick zu Leon.
»Monsieur le Médecin Légiste«, Madame Berthier war plötzlich die Freundlichkeit in Person, als sie Leon ansprach. »Sie würden mir und vor allem unserer Stadt einen riesigen Gefallen tun.«
»Sie zerstören gerade mögliche Tatortspuren«, Leon deutete auf Madame Berthiers nackte Füße, die eine deutliche Spur im Sand hinterlassen hatten.
»Oh«, sagte die Frau und machte zwei schnelle Schritte zurück. »Tut mir leid.«
»Eine oder zwei Stunden werden wir bestimmt noch hier sein«, sagte Leon.
»Wie furchtbar!« Madame Berthier drehte sich um und stapfte davon. Leon war nicht klar, ob sie seine Arbeit oder die Zeit gemeint hatte.
Vom Strand her näherte sich ein großer Traktor. An der Seite des Fahrzeugs stand »DELBOS – Jardinage – Fleurs et Arbres«. Es stoppte etwa zehn Meter von der Gruppe entfernt. Der Motor wurde abgeschaltet, die Fahrerkabine öffnete sich, und heraus stieg ein großer, drahtiger Mann von etwa fünfzig Jahren. Seine Haut war dunkel, wie bei jemandem, der viel im Freien arbeitete. Er trug Jeans und ein kariertes Hemd. Auf dem Kopf hatte er ein Basecap. Er hätte ein Gärtner sein können, aber dafür wirkte sein Äußeres zu gepflegt, dachte Leon. Die meisten Leute kannten die große Gärtnerei Delbos, die kurz vor der Einfahrt nach Le Lavandou an der Küstenstraße lag, weil sie sich auch um die zahlreichen städtischen Beete und Grünanlagen kümmerte. Der Mann grüßte kurz und kam auf Zerna und Masclau zu.
»Wie kommt der denn hierher?«, raunte Zerna seinem Lieutenant zu.
»Keine Ahnung«, antwortete Masclau.
»Was will der? Ist das hier eine öffentliche Bushaltestelle, oder was?« Zerna setzte ein falsches Lächeln auf.
»Commandant …?«, sagte der Besucher höflich.
»Sie wissen, dass Sie mit Ihrem Traktor in einen gesperrten Bereich gefahren sind, Monsieur Delbos.«
»Ich dachte, Sie brauchen …«, der Unternehmer unterbrach sich und sah zu Leon, der den Toten untersuchte. »Ist das da etwa ein … verdammt noch mal?«
»Also, warum sind Sie hier?«, fragte Zerna.
»Sie haben mich doch angerufen«, sagte Delbos. »Wir sollten für die Polizei etwas ausgraben. Ich wusste ja nicht, dass es so etwas …«, er deutete auf die Leiche.
»Haben Sie Monsieur Delbos angerufen?«, fragte Zerna seinen Lieutenant.
»Nein, Patron, habe ich nicht. Da hätten wir Sie doch informiert.«
Leon war aufgestanden und mischte sich ein.
»Monsieur Zerna«, sagte Leon. »Es wäre sicher eine gute Idee, den Bereich rund um die Fundstelle der Leiche auszugraben.«
»Wie? Sollen wir jetzt vielleicht den ganzen Strand umgraben?« Masclau sah seinen Chef an.
»Das wird nicht nötig sein«, sagte Leon mit einem mitleidigen Lächeln. »Aber wenn die Bestatter die Leiche abgeholt haben, sollten wir um den Fundort einen Streifen von etwa einem Meter Breite und einem halben Meter Tiefe ausheben. Den Sand müsste man dann durch ein Sieb werfen. Vielleicht haben wir ja Glück und finden eine Spur.«
»Wir haben solche Siebe in der Gärtnerei. Zwei Mann haben das in einer halben Stunde erledigt.«
»Einverstanden. Einer von meinen Leuten wird dabeibleiben.« Der Polizeichef wandte sich an den Lieutenant. »Das machen Sie, Masclau.«
»Ist einen Versuch wert, würde ich sagen.« Leon sah zu den Männern hinüber, die mit einer Bahre vor dem Absperrband warteten. »Die Bestatter können jetzt kommen.«
Kapitel 4
Der Dekan hatte schon vor zwei Stunden sein Haus in den Hügeln über Toulon verlassen und war in die Altstadt gefahren. Dort, am Cours Lafayette, befand sich der alte Sitz des Bistums Toulon, der heute ›Fréjus-Toulon‹ hieß. Die alten Mauern hatten schon so manchem Sturm standgehalten, und Dekan Dr. Vincent Lambert hatte ein kleines Stoßgebet gen Himmel geschickt, dass sie heute auch ihn beschützen mochten. Er wusste, dass dieser Wunsch nicht ganz frei von Anmaßung war. Aber was sollte er tun? Er war an einem Punkt in seinem Leben angekommen, an dem das Schicksal ihn mit einem unlösbaren Konflikt konfrontierte. Oder war es gar nicht das Schicksal, sondern vielmehr seine eigene Schuld?
Er war wie immer durch die elektrische Schranke auf den Hof der Diözese gefahren und hatte dort seinen metallicfarbenen Mercedes GLE auf seinem Parkplatz abgestellt. Der teure SUV war vielleicht etwas extrovertiert für einen Dekan, aber er mochte nun mal schöne Dinge, und er genoss den Luxus. Außerdem zahlte nicht er, sondern die Diözese für den Wagen. Es war ihm gelungen, das Fahrzeug als steuerbegünstigtes »Lieferfahrzeug« in den Fuhrpark der Kirche zu integrieren, wenn auch niemand außer ihm den Mercedes fahren durfte.
Dr. Vincent Lambert fühlte sich dabei nicht als Schwindler. Er »optimierte nur die Möglichkeiten«, wie er es nannte. Er besänftigte sein Gewissen damit, dass er nichts als eine kleine betriebswirtschaftliche Korrektur in der Bilanz der Diözese vorgenommen hatte. Er hatte so viel Sinn für die schönen Dinge des Lebens, warum sollte er sich mit seinen Möglichkeiten nicht ein paar Türen öffnen, die anderen Menschen verschlossen blieben? Schließlich hatte er viel geopfert für die Kirche. Dafür hatte er nie mehr als Gottes Lohn erwartet. War es da nicht nur recht und billig, wenn er gelegentlich auch mal an sich dachte? Ja, er war leichtgläubig gewesen, und ja, er hatte den falschen Menschen vertraut. Wurde er also jetzt vom Schicksal herausgefordert, weil er zu vertrauensselig gewesen war? Sollte er jetzt für die Niedertracht anderer leiden? Ja, es war nicht bei dem Mercedes geblieben – leider …
Der Dekan hatte noch Zeit, bis seine Besucher – oder sollte er lieber sagen: seine Scharfrichter – kommen würden. Also ging er an den Ort, an den er sich immer zurückzog, wenn er nachdenken und dabei Gott um Rat fragen wollte, in die Kathedrale Notre-Dame-de-la-Seds.
Gelegentlich fragte er sich, ob Gott ihm eigentlich wirklich zuhörte, wenn er innere Zwiesprache hielt. Und wenn er es tat, warum er nicht einen Blitz vom Chorgestühl der Kathedrale auf ihn niederschmetterte. Sodass er sich in Staub und grauen Rauch auflöste. Aus irgendeinem ihm nicht verständlichen Grund war Gott wohl einverstanden mit dem, was Vincent Lambert tat. Vielleicht würde er ihm ja eines Tages Einblick in seinen großen Weltenplan gewähren. Vielleicht war das der Grund, warum er ausgerechnet ihn, Dekan Lambert, zum nächsten Bischof machen wollte.
Es hatte immer wieder Momente in seinem Leben gegeben, dachte der Dekan, da hatte er nur an sich gedacht. Da hatte er Dinge getan, auf die er nicht stolz war, wirklich nicht. Aber er hatte dafür auch gebüßt. In schlaflosen Nächten hatte er sich geschämt, war enttäuscht von sich gewesen, verachtete sich. Aber er war nie am Boden liegen geblieben, sondern war immer wieder aufgestanden und hatte weitergekämpft. In solchen Augenblicken hatte er sich immer gesagt, dass Gott die reuigen Sünder liebt und dass er daher mit jeder Sünde seinem Schöpfer ein kleines Stück näher käme. Viele Leute würden das nicht verstehen. Dabei hatte er immer ein gutes, ein gerechtes Leben geführt, nur diesen einen Schritt hätte er niemals tun dürfen. Doch er hatte ihn getan, und jetzt musste er die Konsequenzen tragen. Er hätte sich nie in die Abhängigkeit dieser Leute begeben dürfen. Aber mit wem sollte er sprechen, wem seine Sorgen anvertrauen? Bilder stiegen in seiner Erinnerung auf, die er nicht sehen wollte. Da gab es noch etwas, aber das würde er tief in seiner Seele verschlossen halten. Später einmal würde er beichten. Aber nicht jetzt. Nicht kurz bevor er die Bischofsweihe empfangen würde. Der Augenblick, in dem er endlich die Beachtung erfuhr, um die er so lange gerungen hatte.
Die Kathedrale Notre-Dame-de-la-Seds war im 11. Jahrhundert gebaut worden. So viele Priester, so viele Bischöfe hatte diese Kirche kommen und gehen sehen. Wie würden die Menschen einmal über ihn sprechen? Der Dekan erschauderte bei der Vorstellung, dass auch sein Name in das »große Buch«, das Kirchenverzeichnis, eingetragen werden würde. Zusammen mit all den berühmten Persönlichkeiten, die sich um die Kirche und um den Vatikan verdient gemacht hatten.
Der Papst würde ihn im Petersdom empfangen. Der Heilige Vater und er würden gemeinsam beten. Vincent Lambert schämte sich. Wie konnte er es in seiner Situation wagen, an den Heiligen Vater auch nur zu denken. Jetzt merkte er erst, dass er die ganze letzte Stunde auf der harten Bank gekniet und die geschlossene Bibel in der Hand gehalten hatte. So als könnte er damit das Böse abwehren, das irgendwo im Schatten der Säulen auf ihn lauerte. Er war kein schlechter Mensch, dachte Vincent Lambert, er war nur gelegentlich schwach. Plötzlich spürte der Dekan ein Frösteln. Dann begann er zu zittern. Eine Minute später schüttelte es ihn wie im Fieber. Der vierundfünfzigjährige Kirchenmann ließ sich in die Bank sinken und hoffte, dass ihn niemand beobachtete. Er zitterte, konnte gar nicht mehr aufhören. Dann hörte er die Turmuhr schlagen. Zehn Uhr, Zeit, um zurückzukehren in die Diözese und sich dem Gegner zu stellen. Mühsam erhob er sich von der Bank.
Kapitel 5
Eine Viertelstunde später stand der Dekan im Besprechungsraum des alten Kirchenbaus. Ihm war immer noch kühl. Er versuchte, die ganze Angelegenheit so diskret wie möglich zu halten. Er hätte diese Leute gerne irgendwo außerhalb von Toulon getroffen. Aber die Männer hatten auf einer Besprechung in den Räumen der Kirche bestanden. Deshalb hatte Vincent Lambert seinem Sekretär zwei Banker angekündigt, mit denen er die Finanzierung eines Umbaus besprechen wollte, wegen der schlechten Wärmedämmung der uralten Mauern.
Natürlich waren die Männer keine Banker. Aber sie hatten mit Geld zu tun. Mit viel Geld sogar. Geld, das er dringend benötigte. Auch wenn er keine Ahnung hatte, wie er es ihnen jemals würde zurückzahlen können.
Als er hörte, dass ein Wagen in den Hof fuhr, trat Vincent Lambert ans Fenster. Es war ein weißer Audi mit einem Kennzeichen aus Marseille. Zwei Männer stiegen aus. Der Fahrer war groß und drahtig und schien aus einem nordafrikanischen Land zu stammen. Vielleicht Algerier oder Tunesier, dachte der Dekan. Der Beifahrer war einen guten Kopf kleiner. Er wirkte breiter und kräftiger als sein Begleiter. Er ging zu dem Mercedes des Dekans und sah ins Innere des Wagens. Dann nickte er seinem Fahrer zu und schien ihm etwas zu erklären. Anschließend nahm er eine Aktentasche vom Rücksitz, schloss die Tür, und der Fahrer betätigte mit dem Fahrzeugschlüssel die automatische Türverriegelung. Beide Männer trugen graue Anzüge, die neu aussahen und sicher noch nicht oft getragen worden waren.
Ein paar Minuten später klopfte es.
»Ja bitte«, sagte der Dekan, und die Tür des Besprechungsraums ging auf.
»Die Herren von der Bank«, sagte der Sekretär und ließ sich dabei nicht anmerken, ob er glaubte, was er da sagte.
Der Dekan begrüßte die Besucher mit Handschlag. Die Atmosphäre war frostig.
»Bonjour, Père«, sagte der Kleinere der Männer.
»Monsieur Valdez«, sagte der Dekan höflich. Der Mann antwortete mit einem Haifischlächeln.
»Und Sie sind …?«, wollte der Dekan von dem stummen Besucher wissen, aber der schien nur durch ihn hindurchzusehen.
»Darf ich den Herren etwas zu trinken anbieten?«, fragte der Dekan um Höflichkeit bemüht.
»Nichts, danke«, sagte Valdez, und sein Partner machte stumm eine abweisende Handbewegung.
»Danke, Marcel«, sagte der Dekan. Der Sekretär ging und zog die Tür hinter sich zu.
Vincent Lambert rieb sich nervös die Hände. Was er zu sagen hatte, ging ihm nur schwer über die Lippen. Er würde diese Männer um Geld bitten müssen. Männer, die nicht so aussahen, als wären sie in Geldangelegenheiten besonders entgegenkommend. Er konnte nur hoffen, dass die Besucher gute Christen waren und genug Respekt vor einem Priester hatten, um sich zurückzuhalten.
»Sie haben die Diözese leicht gefunden?«, versuchte der Dekan höflichen Small Talk.
»Lassen wir die Floskeln und kommen gleich zur Sache«, sagte Valdez und setzte sich auf den nächsten Stuhl, sein Begleiter nahm neben ihm Platz. Der Dekan bemerkte, dass Valdez teure hellblaue Wildlederslipper trug.
»Ich habe wenig zu sagen«, begann der Dekan unsicher. »Ich kann Sie nur bitten, mir zu glauben, dass ich alles unternehmen werde, um aus diesem … sagen wir kleinen finanziellen Engpass schnell wieder herauszukommen.«
»Dreihundertfünfundzwanzigtausend«, unterbrach Valdez. Er öffnete die Aktenmappe und zog einen schmalen grünen Ordner hervor, den er aufschlug. »Engpass, sagen Sie. Ich nenne das einen verdammt großen Berg von Schulden.«
Der Priester griff sich mit dem Zeigefinger in den Kragen seines weißen Hemdes und zerrte daran. Plötzlich fiel ihm das Atmen schwer. Als würde ein eisernes Korsett ihm die Brust einschnüren. Vielleicht hätte er doch Soutane und Kollar anlegen sollen. Einem Gottesmann im Priestergewand würden sie bestimmt mit mehr Respekt begegnen.
»Sie sind gut informiert«, der Dekan räusperte sich nervös.
»Wir informieren uns gerne, bevor wir Geld verleihen.«
»Ich werde natürlich alles tun, um diese Summe … Also ich würde nichts schuldig bleiben, sondern so schnell wie möglich zurückzahlen, Sie verstehen …?«
»Würde mich interessieren, was der Erzbischof sagt, wenn er von Ihrem ›Engpass‹ hören würde.«
»Der würde sich sicher fragen, woher ein Mann Gottes so viel Geld hat?«, sagte der Fahrer.
»Das ist meine Privatsache«, der Dekan spürte sein Herz klopfen. »Dafür interessiert sich das Bistum nicht. Warum sollte es auch.«
»Oh, ich denke, der Erzbischof würde sich sogar sehr dafür interessieren, wenn er erführe, woher Sie die Mittel genommen haben.« Der Besucher öffnete die schmale Akte, die vor ihm auf dem Tisch lag. Er ging mit dem Finger eine Zahlenreihe entlang. »Vierzigtausend Euro haben Sie allein für Installationen ausgegeben.«
»Die Rohre in diesen Gebäuden sind alt. Es war teuer, aber notwendig, leider.«
»Blödsinn«, sagte der Fahrer. »Ich dachte immer, Priester dürfen nicht lügen …?«
»Sie haben keine Leitungen reparieren lassen, sondern sich ein Luxusbad in Ihrem Haus über Toulon einbauen lassen, richtig?«
»Mit Marmorboden, Tropical Shower und Whirlpool«, der Fahrer hob mahnend den Zeigefinger. »Echt geiles Teil. Ich habe es mir angeschaut.
»Sie waren in meinem Haus?«
»Natürlich. Was dachten Sie denn? Dass wir einfach so dreihundertfünfzigtausend Euro verleihen, ohne zu fragen, wofür? Wir haben auch Ihr Schlafzimmer gesehen«, sagte der Besucher.
»Rundbett, Ultra-Flachbildschirm 77 Zoll«, der Fahrer stieß einen bewundernden Pfiff aus. »Da werde ich auch Dekan …«
»Umbauten in Küche und Wohnzimmer über fünfzigtausend. Und der überdachte Pool mit Gegenstromanlage hat allein hundertzehntausend gekostet.« Der Besucher sah von den Papieren auf und blickte aus dem Fenster nach draußen zu der großen Platane vor dem Haus. »So eine Gegenstromanlage wollte ich auch immer haben. Konnte ich mir aber leider nicht leisten.«
»Sie waren wirklich in meinem Haus? Sie wissen, dass das Hausfriedensbruch ist?«
»Sie können ja die Polizei rufen«, sagte der hagere Mann.
Der Dekan wischte sich die Handflächen nervös mit einem Taschentuch ab.
»Vielleicht war es ein Fehler, dass ich Sie angerufen habe.«
»Vielleicht war es ein Fehler, dass Sie die Kasse der Diözese um … wie viel war es doch gleich?«, der Besucher fuhr mit dem Finger auf einem Blatt entlang, als müsste er die Zahlen suchen, die er natürlich genau kannte.
»Ich brauche dreihundertfünfundzwanzigtausend«, die Antwort von Dr. Vincent Lambert kam leise.
»Und Sie brauchen das Geld schnell, wie ich vermute«, der Fahrer beobachtete den gequälten Gesichtsausdruck des Priesters.
»Ich habe gesehen, dass Sie eine Menge Reisen unternommen haben«, der Besucher blätterte in den Unterlagen. »Thailand, Myanmar, Vietnam, sogar die Fidschi-Inseln. Immer in Fünf-Sterne-Hotels.«
»Ja, da kann man viel erleben, in diesen exotischen Ländern«, sagte der Fahrer und leckte sich anzüglich über die Lippen.
»Ich bin auch Historiker«, sagte der Dekan, und es klang wie eine müde Entschuldigung. »Aber das wissen Sie wahrscheinlich schon.«
»Jetzt hat sich die Innenrevision angekündigt, richtig?«, sagte der Besucher. Beim Wort »Innenrevision« zuckte der Dekan kaum merklich zusammen.
»Bis dahin wollen Sie die Konten glattstellen. Zurückgeben, was Sie sich genommen haben.«
»Ich habe mir das Geld nur geliehen.«
»Für einen überaus komfortablen Lebenswandel«, meinte Valdez. »Sie wissen, dass wir Zinsen nehmen. 40 Prozent für ein halbes Jahr.«
»Mon Dieu«, stöhnte Lambert gequält auf.
»Sie können diese Summe niemals zurückzahlen. Oder gibt es eine Geldquelle, von der wir nichts wissen?«
Lambert schüttelte stumm den Kopf. Er wusste, er war diesen Teufeln ausgeliefert.
»Jetzt fragen Sie sich bestimmt, warum wir trotzdem hierhergekommen sind«, der Besucher ließ den Priester keine Sekunde aus den Augen.
»Ist Ihnen warm, Père?«, fragte der Fahrer.
»Wann kommt der Mann von der Innenrevision? In vierzehn Tagen? Das wird knapp.« Valdez klappte den Ordner zu.
Vincent Lambert saß zusammengesunken in seinem Stuhl. Sein Gesicht war blass und wirkte grau. Er sah aus wie ein Delinquent, dem man gerade sein Todesurteil vorgelesen hatte.
»Aber es gibt da vielleicht eine Möglichkeit, Ihr Problem zu lösen«, sagte Valdez wie nebenbei. »Zur Zufriedenheit aller, wie ich ausdrücklich betonen möchte.«
Lambert sah auf, und die Männer schwiegen sich für einige Sekunden an. Dann hielt es der Dekan nicht mehr aus.
»Welche Möglichkeit?«, fragte Lambert mit leiser Hoffnung in der Stimme.
»Die Kirche plant, sich von einem großen Grundstück hinter dem Jachthafen zu trennen.«
»Woher wissen Sie das?«
»Dekan …«, der Fahrer sah ihn zum ersten Mal mitleidig an.
»Drei Hektar ehemaliges Industriegelände mitten in Toulon. Die sogenannte Hafenstadt. Unsere Organisation möchte diesen Grund erwerben und erschließen.«
»Da wird es eine öffentliche Ausschreibung geben. Das ist immer so bei solchen Projekten«, sagte Lambert.
»Richtig, aber in diesem Fall sind Sie der Vorsitzende des Ausschusses, der den Käufer für dieses Grundstück aussucht.«
»Wie stellen Sie sich das vor? Ich kann doch nicht einfach …«
»Sie werden dafür sorgen, dass wir das Land kaufen können, Dr. Lambert. Dafür begleichen wir Ihre Schulden, noch heute. Manus manum lavat, Sie sprechen doch Latein?«
»Aber …«, Lambert sah nervös zwischen den Besuchern hin und her. War er gerade dabei, alle seine Probleme zu lösen, oder manövrierte er sich in neue Schwierigkeiten?
»Wie lautet Ihre Antwort? Ja oder nein?«
Plötzlich spürte der Dekan sein Herz. Die Schläge kamen unregelmäßig. Ihm wurde schwarz vor Augen, und er musste sich mit beiden Händen auf der Tischplatte abstützen.
»Ihre Antwort, Dekan …?«, sagte der Besucher und tippte mit dem Zeigefinger auf die Tischplatte. »Eines noch: Wenn Sie unserem Deal zustimmen, dann ist das verbindlich und nicht mehr rückgängig zu machen. Wir sind sehr altmodisch in diesen Dingen.«
»Ausgesprochen altmodisch.« Als sich der Fahrer zurücklehnte, konnte der Priester zum ersten Mal sehen, dass der Mann eine Waffe in einem Schulterhalfter trug.
Der Dekan saß vornübergebeugt in seinem Stuhl. Er hatte die Hände zu Fäusten geballt, sodass seine Fingerknochen weiß hervortraten. Plötzlich stand die Lösung seiner Probleme so dicht vor ihm. Diese Männer würden zu ihrem Wort stehen und zahlen, das stand für ihn außer Frage. Und die Ausschreibung? Die würde sich über Monate hinziehen. Bis dahin konnte noch so viel geschehen. Vincent Lambert blickte auf und sah seine Besucher an.
»Ich denke, ich sollte auf Ihren Vorschlag eingehen«, sagte der Dekan mit belegter Stimme und räusperte sich.
»Ist das ein Ja oder ein Nein?«, wollte Valdez wissen.
»Es ist ein Ja«, sagte Lambert erschöpft, und seine Besucher wechselten einen schnellen Blick.
Kapitel 6
Natürlich hätte Leon die Nationalstraße Nummer 98 nehmen können, die durch das Hinterland führte und Le Lavandou mit Hyères in einer fast geraden Linie verband. Stattdessen war er auf die »Route de Léoube« abgebogen. Eine Straße, die so schmal war, dass man entgegenkommenden Fahrzeugen über die Bankette ausweichen musste, und die sich in endlosen Kurven durch die Weinberge schlängelte. Man konnte hier nur langsam fahren, und das war auch gut so.
Leon hatte das Dach seines alten Peugeot Cabriolet geöffnet und die warme Brise genossen, die von der Küste kam. Bei einer Abzweigung, die sich irgendwo zwischen großen Feldern von Artischocken verlor, war er rechts rangefahren und hatte den Motor abgestellt. Die Regenfälle der letzten Wochen hatten den Sommer ein Stück weit nach hinten verschoben, dafür stand jetzt die Natur in einer für diese Jahreszeit selten üppigen Blüte. Die Böden waren dicht mit Gras bewachsen, und an den Weinstöcken konnte man zwischen den jungen Blättern die Knospen erkennen. Es roch nach warmer Erde, dem Harz der mächtigen Pinien und nach Meer. Leon hatte sich in seinen Sitz zurückgelehnt und betrachtete den Himmel.
Die Untersuchung des Tatorts am Strand hatte zu keinen weiteren Spuren geführt. Außer einer zerbrochenen Sonnenbrille, zwei ausgequetschten Tuben Sonnencreme und einigen Kronkorken hatten die Gartenarbeiter von Delbos im Sand nichts gefunden. Schließlich hatte Leon die Leiche für die Bestatter freigegeben.
Jetzt musste Leon eigentlich direkt zur Obduktion in die Gerichtsmedizin fahren. Aber etwas beschäftigte ihn. Er wusste nur noch nicht genau, was es war. Darum hatte er angehalten und beobachtete jetzt die Wolken. Es war bisher nur so ein Gefühl, das er nicht richtig greifen konnte. Es versteckte sich irgendwo in den Tiefen seiner Wahrnehmung. Der Anblick des toten Jungen ließ ihn nicht los. Wie das Kind da neben dem Kanal lag. Halb begraben vom Sand, in diesem zerrissenen Sommerkleid, das Gesicht grotesk geschminkt. Ein zehnjähriger Junge, entsorgt in einer Mülltüte. Jemand hatte es als Abfall betrachtet – benutzt und weggeworfen. Ein Kind, das niemand vermisste.
Der tote Junge sollte nie am Strand landen. Er sollte irgendwo anders liegen, eingegraben, gut verpackt, sodass man ihn niemals finden würde. Aber dann kam der Regen. Damit Leon den Mörder finden konnte. Jetzt hatte er die Antwort auf seine Frage: Das hier, das war kein Unfall und kein Totschlag. Das war keine erste Tat. Das hier war die Handschrift eines Serientäters. Leon startete den Motor des Peugeot und fuhr zur Klinik.
Die Klinik Saint Sulpice lag am östlichen Rand von Hyères. Das Krankenhaus stammte noch aus den Sechzigern. Bei der Renovierung vor einigen Jahren hatte man es durch einen modernen Flügel erweitert. Dort, im Souterrain, befand sich auch die Rechtsmedizin. Leiter dieser Abteilung war Dr. Leon Ritter.
Leon betrat den Bau durch die automatische Glastür des Haupteingangs. Am Empfang saß Schwester Monique. Die gute Seele der Klinik und seine Verbündete.
»Bonjour, Docteur«, sagte Monique. »Docteur Baladure hat heute Morgen schon zweimal nach Ihnen gefragt.«
»Bonjour, Monique. Sie sehen gut aus. Irgendwie erholt«, begrüßte Leon sie, und die Krankenschwester strahlte. Monique litt ein wenig unter ihrer Körperfülle, und sie unterwarf sich ständig neuen Diäten, um ihr Gewicht in den Griff zu bekommen. Doch solange sie ihre Leidenschaft für Pain au chocolat nicht zügeln konnte, blieben solche Experimente erfolglos.
»Hat Baladure gesagt, was er wollte?«
»Nein«, Monique griff zum Telefonhörer. »Ich kann ihn aber für Sie anrufen.«
»Nein danke, lassen Sie nur.« Leon winkte ab, Monique lächelte.
Baladure war erst vor zwei Monaten an die Klinik gekommen. Er sollte neue »Umsätze generieren«, wie es bei der Geschäftsführung hieß, indem er in der Klinik eine Abteilung für kosmetische Chirurgie und Schönheitschirurgie aufbaute. Bisher war der Erfolg der neuen Abteilung aber eher mäßig. Baladure war in Tunesien geboren. Nach dem Medizinstudium war er einige Zeit als Notarzt in Paris tätig gewesen. Der Klinik-Klatsch besagte, dass er eine reiche ältere Frau geheiratet hatte. Die hatte ihm ermöglicht, eine Praxis für Schönheitschirurgie zu eröffnen, aber aus irgendeinem Grund hatte die Beziehung nicht gehalten, und mit der Trennung war der Doktor auch seine Praxis los. Danach hatte er zwei Jahre in einer teuren Privatklinik bei Paris gearbeitet. Eine Zeit, über die er gerne und ausführlich sprach. Auf die Ärzte des Midi, wie er den Süden Frankreichs etwas abfällig nannte, sah er mit mitleidigem Lächeln herab.
Leon hatte bisher nur wenig Kontakt mit dem Kollegen gehabt, der mit seinem auffälligen Range Rover gelegentlich Leons Parkplatz blockierte und den Mediziner-Kollegen mit mon frère begrüßte, wie es unter befreundeten Medizinern in Frankreich üblich war. Baladure hatte ihn noch nie in der Rechtsmedizin besucht, und Leon war es nur lieb, wenn es auch so bliebe.
»Er hat mich gebeten, ihm Bescheid zu sagen, wenn Sie im Haus sind«, Monique hielt noch immer den Hörer in der Hand.
»Schwester Monique, würden Sie mir einen ganz großen Gefallen tun? Können Sie mir den Kollegen bitte noch eine Weile vom Leib halten?«
»Bien sûr, Docteur«, sagte sie und sah Leon mit einem wissenden Lächeln an.
Leon nahm die Treppe zum Souterrain. Er mochte keine Aufzüge. Erstens lief man Gefahr, mit Leuten auf engstem Raum zusammenzustehen, die man möglicherweise nicht leiden konnte, und zweitens trainierte Leon mit dem Treppensteigen seine Fitness. Zumindest war das seine Erklärung. In Wirklichkeit litt Leon unter Klaustrophobie, aber das wusste außer Isabelle niemand.
In den Räumen der rechtsmedizinischen Abteilung hielt eine Klimaanlage die Temperatur bei angenehmen 20 Grad. Die Wände waren in blassem Blau gestrichen, was der Abteilung etwas von dem Schrecken nahm, den sie auf viele der Ärzte im Haus ausübte. Für Leon war der Ort genau richtig, um konzentriert zu arbeiten. Niemand kam freiwillig oder gerne in der Rechtsmedizin vorbei, und so hatte er hier meist seine Ruhe.