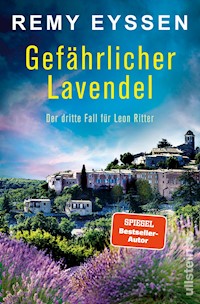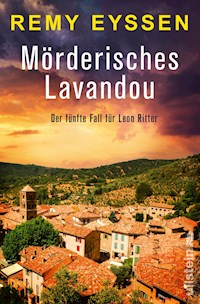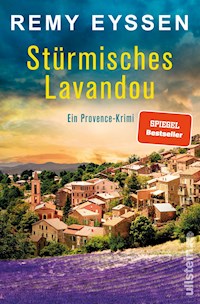
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Gerichtsmediziner Dr. Leon Ritter ermittelt in seinem achten Fall – inmitten blühender provenzalischer Lavendelfelder lauert der Tod Über Le Lavandou liegt der Duft von Pinien und Sonnencreme. Die Vorbereitungen für eine geschäftige Saison in dem südfranzösischen Urlaubsort laufen auf Hochtouren, als eine grauenhafte Entdeckung die Gemeinde erschüttert: Am Strand, wo sich normalerweise Surfer tummeln, wird ein junges Paar ermordet aufgefunden. Rechtsmediziner Leon Ritter übernimmt die Obduktion: Die junge Frau wurde vor ihrer Ermordung missbraucht, und es hat den Anschein, dass der Täter ihren Partner zum Zuschauen gezwungen hat. Der Rechtsmediziner und seine Lebensgefährtin Capitaine Isabelle Morell ermitteln zunächst im Umfeld der Opfer. Doch dann wird ein weiteres Liebespaar auf dieselbe Weise getötet. Hat Le Lavandou es mit einem sadistischen Serientäter zu tun?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Stürmisches Lavandou
Der Autor
Remy Eyssen
Stürmisches Lavandou
Ein Provence-Krimi
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Paperback© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenUmschlagmotive: Allard Schager/Alamy Stock Foto,Stocksy/Sky-Blue Creative, FinePic®, MünchenAutorenfoto: © privatE-Book-Konvertierung powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN 978-3-8437-2711-2
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Meiner Frau und meiner Tochter,für ihre Geduld und ihren Rat
Prolog
Er würde es tun. Er würde Schluss machen mit diesem Monster. Jetzt gleich, ein für alle Mal. Es war nicht seine Schuld, dass seine Mutter nicht mehr da war. War aber vielleicht besser so. Er wusste, dass er gemein klang. Aber nur für Leute, die seinen Vater nicht kannten, die keine Ahnung hatten, was bei ihnen zu Hause los war, wenn dieser widerliche Kerl mal wieder gesoffen hatte. Und das machte er jeden Tag. Wenn er dann in Wut geriet und alles zertrümmerte. Wenn er um sich schlug, nicht mehr zu beruhigen war, weitersoff, bis er das Bewusstsein verlor. Sein verdammter Vater hatte sich das alles selbst zuzuschreiben, dachte der Junge. Hätte der Alte nicht gesoffen, wäre er auch nicht vom Gerüst gefallen. Dann könnte er seinen linken Arm noch richtig bewegen. Er würde nicht ständig seine Jobs auf Baustellen verlieren, weil er sich mit allen anlegte. Es gab keine Bar in der Gegend, in der er noch etwas zu trinken bekam. Und seine Mutter hatte die Wut seines Vaters darüber immer als Erste zu spüren bekommen. Mit ihrem Tod war es noch viel schlimmer geworden. Jetzt musste er die Ausbrüche des Vaters ganz allein ertragen. Sollte er sich doch besaufen, der verdammte Arsch, dachte der Junge. Sich einpissen im Sessel vor dem Fernseher. Wenn er von alleine nicht mehr schnell genug zum Klo kam, weil er zu blau war. Da konnte er so oft nach seiner Frau rufen, wie er wollte. Sie würde nicht wiederkommen, nie mehr. Warum hatte Gott nicht ein Einsehen, dachte der Junge, und ließ den Alten einfach tot vom Sessel rutschen?
Der Junge hätte alles darum gegeben, seine Mutter wieder bei sich zu haben. Hätte alles unternommen, um sie davon abzuhalten, das Schlimmste zu tun. Das, wovon er nie wieder sprechen würde. Das hatte er sich geschworen. Aber was hätte er ausrichten können? Er war noch ein Kind. Er war erst 12 Jahre alt, als sie das verdammte Gift geschluckt hat. E605 stand auf der rostigen Blechdose. »Das brennt einem glatt die Eingeweide weg«, hatte einer der Männer damals gesagt, die seine Mutter auf der Bahre weggetragen hatten.
Bei der Erinnerung an sie spürte er einen Kloß im Hals, und Tränen stiegen ihm in die Augen. Diesen Anblick würde er nie vergessen. Sein ganzes Leben nicht. Wie sie dalag, gleich vorne in der Werkstatt seines Vaters, zwischen den Gartengeräten, ihre Augen zur Decke verdreht. Ihr Gesicht war hellrot angelaufen, und die Zunge quoll ihr aus dem Mund wie ein kleiner Ballon. Der Zementboden hatte sich rot verfärbt durch das Blut, das sie in ihrem Todeskampf erbrochen hatte. Sie war ganz kalt gewesen, als er sie zum letzten Mal berührt hatte, so kalt. In diesem Augenblick hatte er gedacht, die Welt müsste untergehen. Die Erde müsste stehen bleiben. Weil das Unvorstellbare eingetreten war, einfach so. Während sein Vater betrunken in seinem Sessel lag und schlief, hatte er seine tote Mutter in den Armen gehalten.
Der Junge blieb stehen. Hatte sein Vater eben nach ihm gerufen? War der Alte etwa aufgewacht? Er wachte doch sonst nie auf, wenn er erst mal im Vollrausch eingeschlafen war. Der Junge lauschte in die Dunkelheit, aber da war nur Stille. Er hatte das ganze übrige Schlafmittel seiner Mutter in die Flasche mit dem Pernod gemischt, 10 Tabletten. Er durfte jetzt keinen Fehler machen. Sein Vater und er waren ganz alleine hier oben in dem Haus in den Hügeln. Der nächste Nachbar wohnte mehr als einen halben Kilometer entfernt. Diesmal würde er die Sache zu Ende bringen. Unter anderen Umständen hätte er seinem Vater vielleicht noch eine letzte Chance gegeben. Wäre vor dessen Prügel in den Wald geflohen und erst wieder zurückgekommen, wenn der Alte wieder nüchtern wäre. Dann hätte er sich zum wievielten Mal die falschen Versprechen angehört. Das Gejammer vom besseren Leben. Über einen Entzug und einen festen Job.
Doch dann war der Abend mit der Schildkröte gekommen, seiner Schildkröte, Amusandra. Seine Mutter hatte sie ihm geschenkt im Sommer vor ihrem Tod. Sein Vater hatte das Tier vom ersten Moment an gehasst. Schildkröten würden stinken, hatte er gesagt, und außerdem würde sie jede Menge Ungeziefer ins Haus bringen, und ihr Panzer würde verfaulen. Eines Tages, da war seine Mutter bereits nicht mehr bei ihnen, war sie dann verschwunden. Der Junge hatte das Tier überall gesucht. Vor zwei Tagen hatte er sie dann endlich gefunden, oder das, was von ihr noch übrig war. Sein Vater hatte das hilflose Tier in die glühenden Holzkohlen des Garten-Grills geworfen. Dort war sie verkocht in ihrem Panzer und aufgeplatzt wie eine überreife Aubergine im Backofen. Sein Vater hatte nur gelacht, als er das tote Tier entdeckte. In diesem Augenblick hatte der Junge ein neues Gefühl kennengelernt. Plötzlich wusste er, wie sich Hass anfühlte.
Jetzt schlich er mitten in der Nacht durch das dunkle Haus und betete, dass sein Vater tief und fest schlief. Er hatte nur diese eine Chance, ihn für alles büßen zu lassen, was er ihnen angetan hatte. Er hatte sich genau überlegt, wie er es machen wollte. Darüber, was danach aus ihm werden sollte, hatte er bisher nicht nachgedacht. Er wollte nicht weinen. Er hatte schon so oft geweint und im letzten Moment seine Pläne wieder aufgegeben. Wenn er es dieses Mal nicht schaffte, würde er es nie schaffen. Da war er sich sicher. Denke nicht über morgen nach, sagte er sich. Tu‘s einfach. Du kannst das.
Vielleicht war das alles gar nicht wahr. Vielleicht träumte er das nur? Vielleicht hielt er gar kein Feuerzeug in der Hand, und vielleicht schleppte er auch keine Flasche mit Spiritus durchs Haus. Vielleicht würde er gleich in seinem Bett aufwachen, und seine Mutter würde zur Tür hereinsehen und sagen, dass sie ihm Spiegeleier zum Frühstück gemacht hat.
Hör auf rumzuspinnen, ermahnte er sich. Bring es zu Ende, jetzt. Er hasste diesen Mann, aber es war schließlich auch sein Vater. Tränen schossen dem Jungen plötzlich in die Augen. Er konnte nichts dagegen tun. Gut, dass ihn sein Vater jetzt nicht sah. Ein Junge weint nicht, hätte er gesagt und ihm eine Ohrfeige verpasst. Du Schwächling. Der Junge kniff sich mit den Fingernägeln in die Haut seines Handrückens, so fest er nur konnte. Der Schmerz war spitz und scharf und erinnerte ihn daran, dass er sich etwas geschworen hatte. Rache für alles, was sein Vater ihm und seiner Mutter angetan hatte. Wenn er es jetzt nicht tat, würde er den Respekt vor sich selber verlieren, und das war viel schmerzhafter, als sich in die Hand zu zwicken, selbst wenn er es mit ganzer Kraft tat.
Der Junge drückte mit der Schulter vorsichtig die Tür zum Wohnzimmer auf. Jetzt hörte er das schnarrende Atmen seines Vaters. Ein intimes, widerliches Geräusch, das er nicht hören wollte, weil es alles so real machte. Der Alte, der da im Sessel saß und ekelhafte Geräusche von sich gab, war sein Vater. Der klebrig-süße Geruch von Schnaps hing in der Luft, und die Ausdünstungen eines ungewaschenen, schweißnassen Körpers. Es war still im Haus. Der Junge hörte nur das Atmen des Mannes und das Quaken der Kröten, irgendwo da draußen in der mondhellen Sommernacht.
Er trat neben den Sessel und hob die braune Plastikflasche, sodass sie über dem Schlafenden schwebte. Flüssigkeit ergoss sich gluckernd über seinen Vater. Der Junge spürte, wie der Spiritus zwischen seinen Fingern hindurchsickerte und einen öligen Film auf ihnen hinterließ. Dämpfe von Ethanol stiegen auf. Sein Vater stöhnte im Schlaf und bewegte sich. Seine rechte Hand zuckte, als ob sie einen lästigen Moskito verscheuchen wollte.
Jetzt, sagte sich der Junge, jetzt! Und er goss den letzten Rest der Flasche seinem Vater mitten ins Gesicht. In diesem Moment kam der Mann zu sich. Er hustete, keuchte, spuckte die Flüssigkeit aus, die ihm in Mund und Nase gedrungen war. Plötzlich sah er dem Jungen direkt in die Augen. Doch es war zu spät. Instinktiv drückte der Junge den Schieber des Plastikfeuerzeugs nach unten. Die Flamme zündete sofort. Er musste das Feuerzeug nicht einmal an den Mann im Sessel halten. Das Feuer breitete sich mit einem einzigen, dumpfen »Wup« in dem stickigen Raum aus, und im Bruchteil einer Sekunde stand alles in Flammen. Die Flammen rasten über den Boden. Schufen einen See aus Feuer, stürzten sich auf die Vorhänge, die Stühle, das Bord mit dem Fernseher, entzündeten alles, dessen sie habhaft wurden.
Für einige Augenblicke war der Junge wie erstarrt. Er sah, wie sein Vater plötzlich aufstand und wie ein brennender Geist auf ihn zukam. Der Betrunkene schwankte, versuchte, den Flammen zu entkommen. Aber die Hitze machte ihn blind, er konnte den Ausgang nicht finden. Stieß gegen den Esstisch, stürzte, kämpfte sich hoch, grell flackernd wie eine lodernde Fackel. Und alles, was er berührte, erzeugte neue Flammen. Fasziniert und unfähig zu reagieren, starrte der Junge auf das entsetzliche Spektakel. Der betrunkene Mann stürzte erneut. Doch diesmal kam er nicht mehr hoch. Seine Beine zuckten hilflos. Mit den brennenden Händen schlug er verzweifelt auf den Boden ein.
Erst jetzt spürte der Junge ein Beißen in seiner rechten Schulter. Auch er brannte. Der Schmerz löste ihn endlich aus seiner Erstarrung, mit der linken Hand schlug er die Flammen aus. In diesem Moment stieß sein Vater einen wilden Schmerzensschrei aus, der tief aus dem Körper dieses brennenden Menschen hervorzubrechen schien. Der Schrei jagte dem Jungen einen Schauder des Entsetzens über den Rücken, er taumelte rückwärts aus dem Raum und schlug die Tür hinter sich zu. Das Letzte, was er sah, war sein brennender Vater, der sich wie ein verletzter Käfer auf dem Boden wälzte und schrie, einen Schrei, wie der Junge ihn noch nie gehört hatte. Da wusste er, dass sein Vater das Feuer nicht überleben würde.
1. Kapitel
Es gab Menschen, die behaupteten, der Küstenort Le Lavandou hätte seine besten Zeiten hinter sich. Zeiten, in denen noch ganze Familien aus Lyon, Paris, sogar aus dem fernen Brest anreisten, um Urlaub an der Côte d’Azur zu machen. Inzwischen waren es mehr und mehr Pensionäre und Rentner, die das Küstenstädtchen in der Provence bevölkerten. Darum hatte der Stadtrat mit Geld und guten Worten die diesjährigen Kite-Surf-Meisterschaften Mondial du Vent nach Lavandou geholt, mit dem Ziel, den Ort auch für junge Menschen, für Familien und Studierende wieder attraktiver zu machen. Es zeichnete sich bereits ab, dass das Vorhaben der Gemeinde von Erfolg gekrönt war: Die Veranstaltung war eine regelrechte Verjüngungskur für Lavandou. Plötzlich trafen sich wieder Gruppen junger Leute an den Stränden, in den Bars, den Bistros und an den Boule-Plätzen. Die Luft roch nach Sonnenöl, gebrannten Mandeln und heißen Sommernächten. Le Lavandou schien regelrecht aus einem Dornröschenschlaf zu erwachen. Alle waren sich einig: Das würde der perfekte Sommer werden.
Leon war früh aufgestanden. Es erwartete ihn eine Menge Arbeit in der Rechtsmedizin. Isabelle war bereits dabei, Äpfel für das Müsli klein zu schneiden, als er die Küche betrat.
»Bonjour, chérie«, Leon umarmte sie sanft von hinten.
Isabelle sah auf und lächelte. »Äpfel oder Trauben?«, fragte sie.
»Trauben«, antwortete Leon. »Aber nur, wenn ich dir ein Omelett machen darf.«
»Überredet.«
»Wo ist Lilou?«
»Sie hat angeblich die erste Stunde frei«, Isabelle klang wenig überzeugt.
»Aber …?«, Leon spürte, dass Isabelle ihm etwas sagen wollte. Sie sah von den Müslischalen auf.
»Du hast ihnen das Haus gegeben.« Das war eine Feststellung.
»Ich habe Lilou den Schlüssel zum Haus gegeben«, korrigierte Leon. »Ich dachte, dann hätten sie mal ein paar Tage ganz für sich alleine.«
»Für sich alleine? Ich bitte dich, Leon. Lilou ist erst 17.«
»Wie war das noch mit deinem ersten Trip nach Griechenland?« Leon sah Isabelle mit einem breiten Grinsen an und hob schützend eine Hand, als er ihren Gesichtsausdruck sah. »Wie alt warst du damals, als du mit deinem Freund auf diese kleine Insel gefahren bist?«
»Das waren ganz andere Zeiten«, Isabelle versuchte, empört zu klingen.
»Was war denn da so anders?« Leon säuselte übertrieben. »Vollmond, romantische Nächte im Schlafsack am Strand … hmhmhmm.«
»Leon, bitte …« Isabelle sah ihn an, als müsste sie ihn davon abhalten, ein Geheimnis zu verraten. »Es geht doch gar nicht um … darum.«
»Um was denn sonst? Was genau habt ihr denn im Schlafsack am Strand gemacht, was so anders war?«
In diesem Moment betrat Lilou die Küche, der Blick, den sie ihrer Mutter zuwarf, schwankte zwischen Neugier und Amüsement.
»Genau, was habt ihr da gemacht am Strand?«, flötete Lilou. »Bekenne!«
»Lilou, ich bin deine Mutter«, sagte Isabelle. Es sollte vorwurfsvoll klingen.
»Eben drum«, Leon grinste.
»Das geht euch gar nichts an«, würgte Isabelle die beiden ab. Dann musterte sie das Outfit ihrer Tochter und atmete tief durch.
»Jetzt machst du‘s wieder …«, sagte Lilou.
»Was mache ich?«
»Na, dein Polizeigesicht.«
Leon grinste.
»Quatsch, Polizeigesicht. Ich schau dich doch nur an. Warum …« Isabelle unterbrach sich, holte erneut tief Luft und ließ den Blick auf ihrer Tochter ruhen.
Die 17-Jährige trug wie üblich eines ihrer übergroßen T-Shirts, an diesem Tag mit der Aufschrift »There is no Planet B«. Dazu hatte sie ihre Lieblingsjeans knapp überm Knie abgeschnitten. Ihre langen Haare hatte Lilou zum Bedauern ihrer Mutter zu einem lockeren Knoten zusammengefasst, der von einer Plastikspange in Form eines Froschs gehalten wurde.
»Ich meine ja nur, du könntest ja auch mal wieder eines deiner Sommerkleider anziehen – und die Haare offen lassen?« Isabelle sprach betont beiläufig, ein vorsichtiges Lächeln auf den Lippen. »Da siehst du immer so hübsch aus.«
»Die süße kleine Maus von nebenan«, Lilou machte ein Kussmündchen und klimperte theatralisch mit den Wimpern. »Also, was war jetzt mit dem Sex am Strand?«
»Es ist nur …«, sagte Isabelle mit einem Zögern zu Leon. »Das Haus liegt so einsam.«
»Dann kannst du ja deine Schnüffler vorbeischicken«, sagte Lilou frech. »Die können dann genau berichten, was wir so treiben.«
»Das ist nicht witzig«, brummte Isabelle, nun ganz die stellvertretende Polizeichefin von Lavandou.
»Isabelle macht sich Sorgen um dich«, versuchte Leon zu vermitteln.
»Wir schließen nachts Fenster und Türen zu, und ich lege den Schürhaken neben das Bett«, sagte Lilou und gab ihrer Mutter einen Kuss auf die Wange. »Versprochen.«
»Egal, was ihr macht«, sagte Leon, »Hauptsache, ihr vergesst nicht, die Küche zu streichen – Oscar hat es mir versprochen.«
»Typisch alter weißer Mann«, sagte Lilou. »Die Kolonialisten beuten mal wieder die Eingeborenen aus.«
Leon öffnete den Mund zu einer Erwiderung, doch ihm fiel nichts ein – vor dem Frühstück konnte er es mit Lilou nicht gut aufnehmen. Vor einigen Jahren hatte er Le Lézard, ein altes, gemütliches Bauernhaus mit dazugehörigem Weinberg, von einer Tante geerbt. Es hatte sich als Geschenk mit Fallstricken entpuppt: Ständig gab es etwas zu reparieren. Den Wein ernteten zwar die Nachbarn und entschädigten Leon jedes Jahr mit einigen Kisten selbst gekeltertem Rosé, doch das Bestellen des Weinberges war nur ein Bruchteil dessen, was anfiel. Die üblichen Überraschungen bestanden in maroden Stromkabeln, tropfenden Wasserleitungen und verstopften Abflussrohren. Sah man jedoch über diese Ärgernisse hinweg, entsprach das Haus genau dem, was sich der hektische Großstadtmensch, der Leon noch vor ein paar Jahren gewesen war, unter dem Leben auf dem Land vorstellte.
»Wann wolltet ihr denn nach Le Lézard fahren?«, fragte Isabelle und riss Leon damit aus seinen Gedanken. Sie klang ein wenig gekränkt, dass ihre Tochter und Leon sie nicht so genau in die Pläne eingeweiht hatten.
»Oscar kommt mit dem Zug«, sagte Lilou. »Er wird so gegen 18 Uhr hier sein.«
»Nett, dass ich das auch noch erfahre.«
Lilou und Leon wechselten einen schnellen Blick.
»Meinst du, wir dürfen den Méhari haben?«, fragte Lilou ihre Mutter und strich ihr besänftigend über den Arm.
Der Méhari war ein alter, offener Citroën mit einem Stoffdach gegen die Sonne. Genau das Richtige für heiße Sommertage an der Côte d’Azur.
»Zwei Teenager mit meinem Auto unterwegs.« Isabelle wandte sich an Leon. »Jetzt sag halt auch mal was.«
»Ich finde, das klingt nach einer guten Idee«, sagte Leon mit einem Schulterzucken. »Da könnt ihr gleich die Klappstühle für die Terrasse mitnehmen.«
»Vielen Dank, Leon«, sagte Isabelle. »Du bist wirklich eine große Hilfe.«
»Oscar ist schon 23«, sagte Lilou.
»Wenn Oscar heute Abend kommt«, warf Leon beschwichtigend ein, »dann rede ich noch mal mit ihm. Versprochen.«
»Was soll das werden?«, fragte Lilou, »eine Gefährderansprache?«
Leon musste lächeln. Er mochte die selbstbewusste Lilou, die ihm in den sieben Jahren, die er jetzt mit Isabelle zusammenlebte, ans Herz gewachsen war wie eine eigne Tochter.
2. Kapitel
Leon saß in seinem Peugeot Cabriolet und fuhr auf der schmalen Landstraße in Richtung Toulon. Wenn er die Schnellstraße nahm, waren es nur 25 Minuten bis zu seinem Arbeitsplatz an der Klinik Saint-Sulpice. Aber an sonnigen Tagen wie heute nahm er lieber die Landstraße, die sich durch schier endlose Weinberge schlängelte. Auf halber Strecke gab es einen kleinen Parkplatz. Dort, im Schatten einer Gruppe von Platanen, hielt er an, schaltete den Motor ab, atmete tief ein und genoss den Duft von Thymian und Rosmarin, den der warme Wind durch die Landschaft trug. Leon klappte das Dach auf, stellte am Autoradio den Sender »Radio Nostalgie« ein und lauschte dem unsterblichen Charles Trenet, der seinen ewigen Song La Mer zum Besten gab.
Eine halbe Stunde später stellte Leon seinen Wagen auf dem Parkplatz der Klinik ab. Es war eine alte Klinik, die aber vor 10 Jahren renoviert und um einen großen Anbau erweitert worden war. Darin befand sich auch das neue Institut für Rechtsmedizin, das der Pathologe Dr. Leon Ritter leitete.
Leon betrat das Gebäude durch den gläsernen Haupteingang und grüßte Krankenschwester Monique, die hinter dem Tresen saß und den Eingang bewachte. Sie war Ende dreißig, etwas mollig und stets argwöhnisch gegenüber Kollegen. Monique galt als streng, geradezu akribisch, wenn es um die Belange der Klinik ging. Dementsprechend hatte sie nicht viele Freunde innerhalb der Belegschaft. Leon war die große Ausnahme. Er schätzte die Schwester, die auch in der größten Klinikhektik niemals die Nerven zu verlieren schien. Und er wusste nur zu gut, wie fordernd der Krankenhausalltag sein konnte. Er schenkte ihr seine Aufmerksamkeit, und sie war seine heimliche Verbündete, wenn er mal wieder anderer Meinung als die Geschäftsleitung war. Schwester Monique verehrte den Leiter der Rechtsmedizin, was nicht nur daran lag, dass Leon ihr gelegentlich ein Schokoladencroissant mitbrachte. Sie bewunderte den Docteur aus Deutschland, und gelegentlich, wenn er mal wieder ein paar freundliche Worte mit ihr gewechselt hatte, dann stellte sie sich vor, wie es wohl wäre, mit einem Mann wie dem Docteur zusammenzuleben.
»Bonjour, Monique!« Mit einem freundlichen Kopfnicken wollte Leon an der Krankenschwester vorbeigehen.
»Docteur, einen Moment«, sagte Monique und versuchte, ihrer Stimme einen leicht verruchten Unterton zu geben. So wie die Frauen in den alten amerikanischen Schwarz-Weiß-Filmen, die sie so mochte. Sie reichte Leon eine schmale Patientenakte.
»Was ist das?«, wollte Leon wissen.
»Es geht um den Fall Bagaud, Docteur. Die Versicherung braucht das Gutachten noch heute.«
»Heute noch?«
»Docteur Bayet hat extra angerufen und bestand darauf, dass ich Ihnen das persönlich gebe. Und ich sollte Ihnen sagen, dass es eilt.«
Dr. Hugo Bayet war der Leiter und Finanzchef der Klinik. Wenn er sich persönlich für eine Obduktion einsetzte, musste es gute Gründe dafür geben. Die Leiche von Charles Bagaud war erst am Tag zuvor in die Rechtsmedizin eingeliefert worden. Ein 63-jähriger Buchhändler, der mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler gefahren war. Ein tragischer, aber nicht ungewöhnlicher Fall, wie es in jeder Sommersaison einige Dutzend Male vorkam. Die Menschen glaubten immer, dass ein Gerichtsmediziner nur Mordopfer untersuchte. Tatsächlich lagen die Dinge ganz anders: Die Aufgabe der Rechtsmedizin war die Untersuchungen aller Arten unklarer Todesfälle. In Auftrag gegeben wurden solche Obduktionen in der Regel durch die Staatsanwaltschaft. Dazu zählten Untersuchung von Unfallopfern, aber auch Todesfälle in Folge von Erkrankungen oder Verletzungen.
Leon warf einen Blick auf die Akte. Darauf war das Wort »Assurance«, Versicherung gestempelt. Eine Versicherung wollte also die genaue Todesursache eines ehemaligen Kunden wissen. In solchen Fällen ging es in der Regel um Geld, das nur unter ganz bestimmten Bedingungen an Verbliebene ausgezahlt werden musste. Nicht ungewöhnlich, dachte Leon. Schließlich neigten Versicherungen dazu, solche Auszahlungen zu verzögern oder ganz infrage zu stellen. Man würde sehen.
»Merci, Monique«, sagte Leon und nahm die Treppe zum Souterrain.
Die Rechtsmedizin lag im Keller der Klinik. Tag und Nacht waren die Räume auf angenehme 21 Grad gekühlt. Die meiste Zeit des Tages brannte Kunstlicht. Aber ein paar Oberlichter im Gang und im Vorraum der Station sorgten dafür, dass man nicht vergaß, dass es auch noch ein Leben außerhalb des Kellers gab. Für viele Menschen mochten solche Arbeitsbedingungen abschreckend wirken, für Leon waren sie ideal. Hier hatte er seine Ruhe und konnte sich auf seine Arbeit konzentrieren. Hierher verirrte sich kaum einmal ein Kollege aus der Klinik. Darum hielt Leon verblüfft inne, als er die Stimme von Schwester Colette, einer medizinisch-technischen Assistentin aus der Intensivstation, hörte.
»Bitte, Olivier«, hörte er die Frau sagen, »wir haben doch schon so oft darüber gesprochen.«
Leon konnte die MTA-Schwester nicht sehen, aber sie schien hinter der Eingangstür aus Milchglas zu stehen. Unbehaglich verharrte Leon einen Moment: Offensichtlich stritt sie mit seinem Assistenten Olivier Rybaud.
»Ich möchte ja nur, dass wir uns noch mal treffen«, Rybauds Stimme hatte etwas Flehendes. »Meine Güte, Colette, nur reden. Das ist alles, worum ich dich bitte.«
»Ich muss hoch, Olivier. Ich will die Kolleginnen nicht warten lassen.« In diesem Moment summte Colettes hausinternes Funkgerät. »Colette hier. Ich bin gleich oben.« Es folgte eine Pause, dann erklang erneut ihre Stimme. »Es tut mir leid …«
»Du kannst so kalt sein«, hörte Leon seinen Assistenten sagen.
»Bitte, Olivier. Ein anderes Mal, okay?«, sagte Colette.
»Ist es der Typ von der Surfmeisterschaft?«, fragte Rybaud. Colette antwortete nicht.
»Ich habe es doch gewusst.«
In diesem Moment räusperte sich Leon und öffnete die Tür.
»Schwester Colette«, Leon versuchte einen Scherz. »Was hat Sie zu uns in die Unterwelt verschlagen?«
»Ich muss nach oben«, antwortete sie und deutete mit dem Finger zur Decke, als müsste sie Leon zeigen, wo oben und unten war.
»Schade, wir haben so wenig Besuch hier unten«, sagte Leon mit einem Lächeln.
»Ist ein Notfall. Einen schönen Tag noch, Dr. Ritter«, sagte die junge Frau und verschwand.
Rybaud war Colette ein paar Schritte hinterhergelaufen, aber abrupt stehen geblieben, als er seinen Chef sah.
»Bonjour, Monsieur Rybaud«, Leon reichte ihm die Akte. »Alles in Ordnung?«
»Bonjour«, sagte Rybaud etwas zu eilig. Er warf einen Blick auf die Akte. »Ah, der Motorradunfall. Dachte ich mir schon.«
»Können Sie hellsehen?«
»Ich weiß nur, dass Monsieur Bagaud eine kranke Frau zurücklässt«, sagte Rybaud, »und dass er eine Lebensversicherung hatte.«
Für Leon war es keine Überraschung, dass Rybaud über die Lebensumstände eines Toten genau informiert war: Sein Assistent kannte eine Menge Leute in der Gegend. Bei Monsieur Bagaud kam hinzu, dass der Mann über zwanzig Jahre lang die kleine Buchhandlung in Le Lavandou in der Avenue Charles de Gaulle geführt hatte.
»Wissen Sie, ob Bagaud Familie hatte?«
»Soweit ich weiß, gibt es da nur noch Madame Bagaud«, sagte der Assistent und blätterte durch die Patientenakte. »2016 …«
Leon schaute auf. »Was meinen Sie?«
»2016 …«, Rybaud hielt ein Schreiben der Versicherung in der Hand und studierte die Einträge. »Das Jahr, in dem Monsieur Bagaud eine Lebensversicherung abgeschlossen hat.«
»Ist fünf Jahre her«, sagte Leon. »Könnte sich um eine Frist handeln.«
»Eine Millionen Euro«, antwortete Rybaud.
Leon sah seinen Assistenten fragend an.
»Die Auszahlungssumme«, Rybaud reichte ihm den Ausdruck. »Eine runde Million.«
3. Kapitel
Am Strand von Le Lavandou lag Ärger in der Luft. Solange die Einheimischen sich zurückerinnern konnten, war der Strand vor der palmengesäumten Promenade immer groß genug für alle gewesen, aber damit schien Schluss zu sein. Grund dafür waren die Surfmeisterschaften. Bereits in aller Frühe hatten Händler ihre Stände im Sand aufgebaut, wo man von Schäkeln über Müsliriegel bis zur Sonnencreme alles kaufen konnte, um das Surferleben angenehmer zu gestalten. Vielleicht hätte der Strand dennoch Raum für alle bieten können, aber an diesem Morgen wurde eine mobile Open-Air-Bühne aufgebaut, auf der bereits ein DJ seine Verstärkeranlage testete. Laut genug, um jede Konversation im weiteren Umkreis unmöglich zu machen. Jetzt brüllten die Badegäste sich untereinander an, gingen hinter Sonnenschirmen und Sandburgen in Deckung und warteten nur darauf, dass ein Surfer versehentlich auf eines ihrer ausgebreiteten Handtücher trat. Andere Sommergäste brummten ihren Unwillen über die Surfer vor sich hin, die ihre Bretter dicht an dicht auf den Strand gezogen hatten und so den Zugang zum Wasser blockierten.
Die Stimmung war aufgeheizt, selbst zu einem kleinen Handgemenge war es schon gekommen, als Isabelle auftauchte, um nach dem Rechten zu sehen. Eigentlich waren touristische Belange Sache der Gendarmerie municipal, aber in der Saison unterstützten auch mal die Beamten der Gendarmerie nationale ihre Kollegen vom Ordnungsamt.
Die stellvertretende Polizeichefin betrat mit Lieutenant Masclau die Open-Air-Bühne. Flankiert wurden sie von Lieutenant Jacques Peyron, der so dick war, dass Isabelle fürchtete, die Knöpfe seiner Uniform könnten abplatzen, während er die Stufen zur Bühne hochstapfte. Peyron war eine vorübergehende Leihgabe der Gendarmerie von Draguignan an die Kollegen in Le Lavandou, die in der Ferienzeit notorisch unterbesetzt waren und jede Unterstützung brauchen konnten.
Isabelle war mit ihrer kleinen Task Force vor dem DJ stehen geblieben.
»Morell, Gendarmerie nationale«, sagte Isabelle, »können Sie das bitte mal leiser machen?«
Der DJ grinste frech und tippte sich mit den Fingerspitzen gegen die Ohrhörer, um zu zeigen, dass er die Beamtin nicht verstehen konnte. Und dass er auch nicht daran dachte, sich von den Flics etwas vorschreiben zu lassen – schon gar nicht von einer Frau. Masclau tat einen schnellen Schritt nach vorn, griff auf das Mischbord und legte den Schalter um, auf dem »Power-Main« stand. Unter ungutem Krächzen verabschiedete sich die Anlage. Schlagartig herrschte Ruhe am Strand.
»Was … was haben Sie getan?«, der DJ schob sich seine neongrüne Sonnenbrille auf die Stirn. »Der ganze Soundcheck war umsonst. Das können Sie nicht machen. Ich komm ja auch nicht zu Ihnen aufs Revier und …«
»Klappe halten und zuhören«, Masclau deutete auf Isabelle, der die schroffe Art ihres Lieutenants sichtlich unangenehm war.
»Danke, Lieutenant Masclau«, sagte sie mit einem knappen Lächeln und wandte sich dann dem DJ zu: »Sie können Ihren Soundcheck gerne machen, aber erst nach 16 Uhr, wenn es hier ruhiger wird. So wie besprochen.«
»Aber …«, wollte der DJ sie unterbrechen.
»Jetzt spricht Capitaine Morell«, wiegelte Masclau den Jüngeren in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete, ab.
»Außerdem müssen Sie diesen Bühnenaufgang auf die andere Seite verlegen«, Isabelle deutete zu der entsprechenden Stelle. »Hier blockieren Sie den Weg für die Strandbesucher.«
»Ich werde mich beschweren, ich kenne den Bürgermeister«, versuchte der DJ es noch mal.
»Wie schön. Richten Sie Monsieur Robien herzliche Grüße aus«, sagte Isabelle, und dann an Masclau gerichtet: »Sie übernehmen das hier bitte. Ich muss ins Büro.«
Isabelle ließ die Männer stehen und ging zum Streifenwagen, der auf der Promenade oberhalb des Strandes geparkt war. Eng gefolgt von ihrem übergewichtigen Kollegen Peyron.
Neben dem Auto stand eine Frau von Anfang 20, gepflegte lange Haare, die Kleidung unauffällig. Die junge Frau war schlank und durchaus attraktiv, doch es wirkte, als verstecke sie sich vor der Welt. Sie zog ihre Schultern hoch und sah zu Boden, wie jemand, der etwas suchte. Isabelle kannte die junge Frau. Élodie Roussel, 22 Jahre, war die Assistentin des Bürgermeisters. Offensichtlich hatte sie bereits auf Isabelle gewartet.
»Capitaine«, sagte Élodie höflich. »Könnte ich Sie einen Moment sprechen?«
»Aber natürlich«, sagte Isabelle und ahnte schon, worum es ging. »Was kann ich denn für Sie tun?«
Die Frau warf einen schnellen Blick zu Peyron.
Isabelle tat der Frau jedoch nicht den Gefallen, ihren Kollegen fortzuschicken. Sie ahnte schon, dass das ansonsten ein längeres Gespräch werden würde. Madame Roussel fühlte sich einsam. Sie war ängstlich und hatte schon öfter vermutet, dass sie von unbekannten Männern gestalkt wurde. Was sich allerdings jedes Mal als Irrtum herausstellte. Die junge Frau tat Isabelle leid, aber für ihre Verfolgungsgeschichten hatte sie heute keine Zeit. Da war es gut, dass der Kollege aus Draguignan dabeistand und das Gespräch nicht allzu persönlich werden würde.
»Sie müssen mir schon sagen, worum es geht«, sagte Isabelle freundlich, »wenn ich Ihnen helfen soll.«
Madame Roussel sah sich kurz um. »Es gibt jemand, der mich verfolgt«, sagte sie dann im Flüsterton.
»Sind Sie sich da ganz sicher?«, Isabelle versuchte, nicht allzu skeptisch zu klingen.
»Ich weiß, Capitaine«, beschwor Élodie Roussel sie leise. »Wir haben darüber schon öfter gesprochen, aber diesmal …«
»Madame«, unterbrach Isabelle sie vorsichtig, und in ihrer Stimme klang eine sanfte Mahnung durch.
»Diesmal ist es anders. Diesmal weiß ich, wer es ist.« Die junge Frau zögerte. »André Breteuil«, flüsterte sie dann.
»Aus dem Lycée?«, fragte Isabelle überrascht. »Der Geschichtslehrer?«
Mademoiselle Roussel nickte, und Isabelle warf einen schnellen Blick in den Himmel.
»Ich verstehe«, sagte Isabelle.
»Er hat … er hat Dinge von mir gestohlen«, sagte Madame Roussel.
»Was für Dinge?«, wollte Isabelle wissen. Die Assistentin des Bürgermeisters zögerte nervös.
»Meinen Bikini«, es schien sie Überwindung zu kosten. »Ich war schwimmen, im Badeanzug. Als ich zurück zu meinem Handtuch kam, war mein Bikini verschwunden. Ich habe Breteuil in der Nähe gesehen.«
»Das Beste wäre wohl …«, Isabelle tat, als müsse sie nachdenken, dann sah sie ihren Kollegen an. »Lieutenant Peyron, Sie werden sich anhören, was Madame Roussel zu sagen hat. Und dann schreiben Sie mir einen Bericht.«
»Ich muss mich aber um den Strand kümmern«, versuchte der Beamte, die undankbare Aufgabe loszuwerden.
»Ich möchte eigentlich lieber mit Ihnen reden«, wandte Madame Roussel ein, als Isabelle in ihren Streifenwagen einstieg, und Lieutenant Peyron nickte zustimmend.
»Bei Monsieur Peyron sind Sie in guten Händen«, sagte Isabelle durch ihr geöffnetes Fenster. »Ich erwarte einen kurzen Bericht von Ihnen, Peyron, sagen wir bis morgen.« Dann wandte Isabelle sich der Frau zu. »Ich werde Sie dann anrufen, und wir können uns überlegen, was wir in der Sache unternehmen.«
4. Kapitel
Leon ließ sich Zeit mit der Obduktion. Er betrachtete die Opfer von Unfällen oder Gewaltverbrechen nicht als »Beweise«, wie es viele seiner Kollegen taten. Für Leon waren die Menschen, die auf seinem Seziertisch landeten, »Patienten«, und genauso behandelte er sie auch – mit Respekt und Empathie. Zunächst hatte er die Leiche von Monsieur Charles Bagaud nur betrachtet. Er hatte sich mit dem Opfer »unterhalten«, wie er es nannte, versucht, ein Gefühl für ihn zu entwickeln. Denn die Opfer konnten einem viel über sich erzählen, das war Leons Überzeugung. Wie sie gelebt hatten zum Beispiel, und was genau geschehen war in den letzten Sekunden ihres irdischen Daseins. Leon machte, wie er es einmal bei einem Vortrag beschrieben hatte, eine Anamnese mit den Opfern. Denn die Opfer wussten genau, was passiert war. Und wenn man sich nur genug Zeit ließ, davon war Leon überzeugt, konnte man jede Menge Hinweise auf die Wahrheit finden.
Diese Einstellung war ziemlich unkonventionell und hatte ihm schon öfter Spott in Kollegenkreisen eingebracht. Aber auch Anerkennung. Denn Leon war äußerst erfolgreich mit seinen ungewöhnlichen Methoden, und er hatte dazu beigetragen, so manchen Fall zu lösen, den die Polizei bereits abgeschrieben hatte.
Was Leon an diesem Morgen störte, war das Paket auf seinem Schreibtisch. Es zeigte ihm, dass die hauseigene Wäscherei der Klinik noch immer nicht funktionierte: Seit zwei Wochen musste Leon die Arbeitskleidung seiner Abteilung auswärts von der Wäscherei Koenig reinigen lassen, was immer wieder zu Verwechslungen führte. Auf dem Paket stand in großen Buchstaben SAINT-SULPICE.
»Warum liegt das auf meinem Tisch?« Leon klang genervt.
»Kommt von der Wäscherei Koenig«, versuchte Rybaud, seinem Chef zu erklären.
»Das sehe ich«, brummte Leon.
»Das sind aber nicht unsere Sachen.«
»Sondern?«, fragte Leon streng.
»Hotelwäsche«, erklärte Rybaud. »Für die Pension Les Îles d’Or.«
Leon hasste jede Art von Schlamperei in seiner Abteilung, selbst wenn sie von außen kam. Er mochte präzise Abläufe, auf die er sich verlassen konnte. Sich mit so profanen Dingen wie den Fehlern einer Wäscherei zu beschäftigen, das war verschwendete Zeit. Dabei geschah es nicht zum ersten Mal, dass die Wäscherei die Adressdaten verwechselte.
»Ich kann bei ihnen anrufen«, erbot sich Rybaud, »dann holen sie die Wäsche hier wieder ab.«
»Wann soll das sein?«, fragte Leon sauer. »Im August? Ich werde das mitnehmen und Koenig vor die Füße werfen. Der soll seinen Laden besser organisieren, wenn er für eine Klinik arbeiten will.«
Leon schloss seine Bürotür, um das Ärgernis nicht mehr vor Augen zu haben, und widmete sich wieder dem laufenden Fall.
Erneut betrachtete er den auf dem Obduktionstisch aus silberglänzendem Edelstahl liegenden Toten. Der Motorradunfall hatte für zahlreiche Verletzungen gesorgt. Es gab offene Brüche, Schnitte und andere Wunden. Davon abgesehen hatte sich Monsieur Bagaud jedoch gut gehalten für einen 63-Jährigen, der den Großteil seines Lebens mit Bücherlesen und Büroarbeit verbracht hatte, dachte Leon. Der Tote war 180 Zentimeter groß und wog knapp 70 Kilo. Er war schlank und hatte die Muskulatur eines Mannes, der sich gerne bewegte. Obwohl er ihn nie richtig kennengelernt hatte, war Leon dieser Monsieur Bagaud irgendwie sympathisch.
»Sie sagten, er hinterlässt eine Frau?«, fragte Leon seinen Assistenten. »Wird sie die Buchhandlung in Le Lavandou übernehmen?«
Leon war nur ein paar Mal in der kleinen Buchhandlung gewesen. Eine Frau war ihm dort nie aufgefallen.
»Das wird sie nicht können«, antwortete Rybaud. »Sie hat eine Lungenfibrose. Braucht ständig ein Sauerstoffgerät.«
Leon sah seinen Assistenten an und wunderte sich einmal mehr, woher er immer solche Details wusste.
»Na ja, was man eben so hört«, beeilte sich Rybaud hinzuzufügen.
Eine Dreiviertelstunde später war die erste große Untersuchung abgeschlossen. Sie hatte keine neuen Erkenntnisse gebracht: Organisch war der Mann gesund, dachte Leon, wenn man von den erhöhten Leberwerten einmal absah, die auf eine beginnende Leberzirrhose hinweisen könnten. Nicht ungewöhnlich in einer Gegend, in der jährlich durchschnittlich 70 Liter Wein pro Kopf getrunken wurden. Daher gab es auch jede Menge Verkehrsopfer in der Provence, die unter Alkoholeinfluss ihrem Leben ein unfreiwilliges Ende setzten. Allerdings gehörte Charles Bagaud nicht dazu. Zum Zeitpunkt seines Unfalls hatte er 0, 16 Promille im Blut gehabt. Das entsprach einem kleinen Glas Wein und lag weit unter dem, was die Straßenverkehrsordnung als Promillegrenze vorsah.
In der Regel war es der Nachweis von Trunkenheit am Steuer, der die Assekuranzen interessierte. In manchen Lebensversicherungen gab es einen Passus, der bei Unfallfahrten unter Alkohol oder Drogen eine Auszahlung ausschloss. Aber ein 63-jähriger Buchhändler nahm in der Regel keine Drogen.
»Haben wir schon die Werte vom Medikamentenspiegel?«, fragte Leon seinen Assistenten.
Olivier Rybaud reichte seinem Chef einen Computerausdruck. Der Assistent hatte auf die Standard-Substanzen getestet, wie sie in den am häufigsten verabreichten Medikamenten vorkamen. Bluthochdruck, Herzmittel, Blutverdünner.
»Alles im normalen Bereich«, sagte Rybaud.
»Und was ist hiermit?«, Leon tippte auf die vorletzte Zeile im Ausdruck. Ihm war die Unregelmäßigkeit sofort aufgefallen. Ein kleiner Wert, der von der Norm abwich. Es war eine Substanz, die zu den Schmerzmitteln gehörte.
Leon bat seinen Assistenten, den Medikamentenspiegel noch einmal durch die Computeranalyse laufen zu lassen. Diesmal, um nach starken Schmerzmitteln aus der Opioiden-Gruppe zu suchen. Eine halbe Stunde später wurde der Computer fündig. Im Blut des Opfers fanden sich erhöhte Werte von Trimaldin, einem starken, rezeptpflichtigen Schmerzmittel. Allerdings lagen auch hier die Werte im medizinischen Normbereich.
»Monsieur Bagaud litt offenbar unter starken Schmerzen«, Leon betrachtete das Opfer.
»Organisch war nichts auffällig, oder?«, murmelte Rybaud.
Das war im Grunde nicht ganz richtig, dachte Leon. Er hatte etwas vorschnell geurteilt. Statt abzuwarten, bis alle Fakten auf dem Tisch lagen, hatte er bereits eine Hypothese im Kopf gehabt – Fahren unter Alkoholeinfluss. Dabei gab es einen Bereich, den sie bisher noch nicht untersucht hatten – das Gehirn.
Zum üblichen Vorgehen bei Autopsien gehörte neben einer allgemeinen äußerlichen Untersuchung auch die Öffnung der Körperhöhlen: Der Bauchraum und der Brustraum wurden mit einem sogenannten Y-Schnitt von den Achseln bis zum Unterbauch eröffnet. Die dritte Körperhöhle war der Schädel. Dabei wurde der Schädelknochen mit einer kleinen elektrischen Motorsäge geöffnet, das Gehirn entnommen und untersucht.
In diesem Fall wäre die Überprüfung des Gehirns allerdings deutlich aufwendiger, darum hatte Leon die Untersuchung bis zuletzt aufgeschoben.
»Haben wir den Unfallbericht?«, fragte Leon. Der Assistent reichte ihm einen Computerausdruck.
Laut dem vorläufigen Polizeibericht war Monsieur Bagaud mit etwa 120 Stundenkilometer gegen den Pfeiler der Autobahnbrücke bei Puget-Ville geprallt. Es war ein gerades Stück der Autobahn A57, und es gab keine Erklärung, warum der Fahrer ausgerechnet hier von der Straße abgekommen war. Allerdings stand die technische Untersuchung des Motorrades noch aus.
Beim Zusammenprall mit dem Betonpfeiler war der Körper des Mannes zunächst in flachem Winkel gegen den Pfeiler geprallt, dann zurück auf die Straße und anschließend gegen die Leitplanke geschleudert worden. Dabei hatte das Opfer unzählige Brüche, Risse, Prellungen, Schnitte und Platzwunden erlitten.
»Wenigstens war er auf der Stelle tot«, sagte Leon, und es klang fast so, als wäre er erleichtert angesichts der Tatsache, dass Monsieur Bagaud nicht hatte leiden müssen.
»Können wir da sicher sein?«, fragte Rybaud.
»Keine Hämatome«, sagte Leon trocken. »Beim Aufprall wurde der Schädel zertrümmert, was zu einem sofortigen Herzstillstand geführt hat. Sehen wir uns die Schädelverletzungen an.«
Das Gesicht des Opfers war kaum noch zu erkennen. Im Lauf des Unfallgeschehens waren Wangenknochen und Augenhöhlen zertrümmert worden. Der Schädel war über eine Länge von 12 Zentimetern gebrochen und eingedrückt worden. Die Knochenstücke wurden nur noch von der Kopfhaut zusammengehalten.
»Ich brauche das Skalpell und die Säge«, sagte Leon.
Der Assistent reichte ihm die Instrumente. Leon durchtrennte vorsichtig die Kopfhaut mit einem kreuzförmigen Schnitt. Dann setzte er die elektrische Säge an und zog schließlich mit der Pinzette Teile des Schädelknochens heraus, die er in eine Plastikschale legte.
Im nächsten Schritt würde er das Gehirn herauspräparieren, mehrere Schnitte ansetzen und es untersuchen. Doch, Leon stutzte und beugte sich vor, das war in diesem Fall gar nicht nötig: Schon der erste oberflächliche Blick genügte, und Leon konnte sich die Tragödie vorstellen, die sich hinter dem Tod des Buchhändlers verbarg. Leon atmete tief durch. Dieser Mann war kein gesunder Mensch gewesen, ganz und gar nicht.
»Das war kein Unfall«, sagte Leon sachlich.
»Woher können Sie das wissen?«
Leon deutete mit dem Finger auf eine Stelle des offen liegenden Gehirns.
Über dem linken Frontallappen deutete sich eine leicht rötliche Einfärbung an. Rybaud erkannte erst beim zweiten Hinsehen, dass es sich bei der Verfärbung um einen Tumor handelte.
»Glioblastom«, sagte Leon. »Nicht leicht zu erkennen bei den starken Zerstörungen des Schädels.«
»Fortgeschrittenes Stadium …«, konstatierte der Assistent.
»Golfballgröße, Grad 4, würde ich sagen. Er hatte vielleicht noch einen, allerhöchstens zwei Monate.« Leon zog die beleuchtete Lupe heran, die an einem Gelenkarm von der Decke hing. »Operativ war da nichts mehr zu machen.«
»Er muss doch Schmerzen gehabt haben, bei der Größe des Tumors.«
»Sehr starke Schmerzen sogar.«
»Daher das Schmerzmittel«, murmelte Rybaud und blätterte durch die Unterlagen. »Aber sein Hausarzt hat darüber nichts notiert.«
»Er war vielleicht nicht im Bilde«, gab Leon zu Bedenken. »Offenbar hatte Monsieur Bagaud gewusst, dass ein bitteres Ende auf ihn zukam.«
»Sie glauben …?«, der Assistent unterbrach sich. »Suizid?«
»In welchem Monat ist die Lebensversicherung abgeschlossen worden?«, erkundigte sich Leon.
»Moment«, sagte Rybaud und blätterte durch die Unterlagen.
»Unterschrieben wurde sie von Monsieur Bagaud am 5. Dezember.«
»In der Regel haben Lebensversicherungen eine Klausel, nach der der Versicherer bei Suizid innerhalb der ersten fünf Jahre nach Abschluss nicht auszahlen muss«, bemerkte Leon.
»Die fünf Jahre wären in sechs Monate vorbei gewesen«, sagte Rybaud.
»Das hätte bedeutet: Sechs Monate schwerste Schmerzen, vielleicht sogar Koma«, sagte Leon.
»Sie glauben, das wollte er sich nicht antun«, meinte Rybaud. »Kann ich irgendwie verstehen.«
»Gibt es sonst noch jemanden in der Familie?«, wollte Leon wissen.
»Nein, nur die kranke Ehefrau. Sie hat sonst niemand mehr, der sich kümmert.« Er klang bitter.
Lungenfibrose, dachte Leon. Die Frau würde eines Tages ersticken. Ohne die Buchhandlung würde Madame Bagaud Unterstützung beim Sozialamt beantragen müssen. Es sei denn …
»Wir brauchen einen Schnitt durch den Frontallappen«, Leon deutete auf das Gehirn. »Den rechten Frontallappen.«
»Aber dann haben wir keinen Nachweis auf den Tumor …?« Rybaud sah seinen Chef an und unterbrach sich.
»Tumor? Ich gehe nach wie vor von einem Unfall aus«, sagte Leon unbewegt. »Und Sie, Herr Kollege?«
Rybaud sah ihn verblüfft an. »Unfall … Ich weiß nicht … Ja, schon, Sie haben recht.«
»Sehr gut, wir brauchen den Schnitt ja nur der Ordnung halber. Wir wollen uns doch nicht vorwerfen lassen, wir hätten nicht sorgfältig gearbeitet«, sagte Leon und sah seinem Assistenten kurz in die Augen.
Rybaud verstand.
»Was soll ich in den Bericht eintragen?«, wollte Rybaud wissen.
»Alle Organe unauffällig, oder sind Sie anderer Meinung?«
Rybaud deutete ein kurzes Kopfschütteln an, ein verschwörerisches Lächeln auf den Lippen.
»Vernichten Sie bitte alle Proben, die wir nicht mehr brauchen. Ordnung und Sauberkeit sind der Schlüssel zu jeder korrekten Autopsie«, sagte Leon. »Und legen Sie mir den Bericht bitte morgen auf den Tisch.«
5. Kapitel
Das Telefon auf ihrem Schreibtisch summte ununterbrochen. Trotzdem nahm Isabelle jeden Anruf entgegen, ohne je ihren gelassenen Tonfall zu verlieren. Es war schließlich das erste Wochenende der Sommersaison, da hatte die Polizei immer alle Hände voll zu tun, bis sich die Dinge in Le Lavandou wieder eingespielt hatten. Ladenbesitzer beschwerten sich über ihre Nachbarn, weil die ihre Ware auf fremden Stellflächen ausbreiteten. Touristen meldeten Autoeinbrüche. Männer suchten nach ihren Frauen, Eltern suchten nach ihren Kindern, und vom Rosétrinken in der heißen Sonne benebelte Touristen erstatteten Anzeige gegen Hütchenspieler oder andere Trickdiebe. Irgendwie lösten sich die meisten dieser Probleme über kurz oder lang in Wohlgefallen auf. Und was die Kleinganoven anging, da lohnte sich die Strafverfolgung sowieso nicht, und so landeten die meisten Anzeigen umgehend in der Ablage. Wo sie bis zum Ende der Saison auch blieben.
Trotzdem konnten solche Tage ziemlich anstrengend sein. Besonders dann, wenn auch noch die Klimaanlage ausfiel und die Julisonne das Polizeirevier mit den großen Glasscheiben gnadenlos aufheizte. Isabelle hatte die Tür zu ihrem Büro geöffnet und das Fenster aufgeschoben, sodass wenigstens die Nachmittagsbrise für minimale Abkühlung sorgte.
Isabelle gegenüber saß eine junge Frau, das blonde Haar sorgfältig frisiert. Sie war auffällig geschminkt und sah aus, als wäre sie vom nächsten Kosmetiksalon direkt zu Isabelle ins Büro marschiert. Irgendwie war es der Frau gelungen, bis in Isabelles Büro vorzudringen und sie jetzt von der Arbeit abzuhalten.
Isabelle beugte sich vor und schob das Namensschild auf ihrem Schreibtisch so, dass ihre Besucherin es auch lesen konnte. Das Messingschild war Isabelles ganzer Stolz. »Capitaine de Police: Isabelle Morell« stand darauf. Was nicht weniger bedeutete, als dass Isabelle die stellvertretende Polizeichefin von Le Lavandou war. Die erste Frau in der 150-jährigen Geschichte des Ortes, die das geschafft hatte. Allerdings schien sich die Besucherin nicht besonders für Isabelles Rang zu interessieren. Sie war hier, um Anzeige zu erstatten.
Isabelle hatte das Formular auf ihrem Computer aufgerufen, mit dem Anzeigen aufgenommen wurden. Doch mit ihrer Besucherin stellte sich dies als mühsames Unterfangen heraus.
»Der Mann in der Tankstelle hat Sie also bedroht, Madame …?«, fragte Isabelle.
»Bertrand, Amélie Bertrand«, sagte die junge Frau. »Mit diesem Eisendings da hat er mir gedroht. Dabei haben wir ihn nur gefragt, ob er uns den Reifen wechseln kann.«
Isabelle hatte ihre Besucherin zunächst auf 18 Jahre geschätzt, aber sie war bereits 25, wie sie zu Protokoll gab. Sie sieht beneidenswert jung aus, dachte Isabelle und schickte in Gedanken ein stummes: »Warte es nur ab …« hinterher.
»Wie genau hat er Sie bedroht?«, fragte Isabelle.
»Eigentlich hat er nicht mich bedroht. Eher meinen Freund.«
»Hat er nach Ihrem Freund geschlagen?«, fragte Isabelle. »Hat er etwas gesagt?«
»Nein«, jetzt klang die Besucherin fast empört. »Ich möchte Sie mal sehen, wenn einer mit ‘ner Eisenstange auf Sie zukommt, da hat doch jeder Angst.«
Isabelle seufzte leicht genervt. »Welche Tankstelle war das?«
»Die in der Hauptstraße, gleich vor dem Rondell«, erinnerte sich die Besucherin. »Der Typ war echt unheimlich.«
»Ein Mann Mitte dreißig, dünnes schwarzes Haar, Stirnglatze? Circa 1,80 groß?«
»Sie kennen ihn?«, fragte die Besucherin leicht perplex.
»Jeder im Ort kennt Patrick Favre«, erklärte Isabelle. »Der Mann ist geistig etwas zurückgeblieben, aber harmlos.«
Patrick konnte aufbrausend werden, wenn man ihn ärgerte, überlegte Isabelle. Er lebte in den Hügeln bei Bormes im Haus seines Vaters. Der alte Mann hatte Lungenkrebs, wollte sich aber seit Jahren nicht mehr untersuchen lassen. Patrick arbeitete in der Regel die Woche über in der Tankstelle und donnerstags auf dem Markt, um sich etwas dazuzuverdienen.
»Nach Ihnen geschlagen hat er aber nicht«, vergewisserte sich die Polizistin.
»Nein, habe ich doch schon gesagt.«
»Und wo ist Ihr Freund?«
»Draußen, auf dem Wasser. Kitesurfer beim Team Mistral.« Sie sprach den Namen des bekannten Sportartikelherstellers so aus, als würde das alles erklären.
»Wenn er Anzeige erstatten will, müsste er schon persönlich hier vorbeikommen«, sagte Isabelle.
Die blonde Frau erhob sich von ihrem Stuhl, und Isabelle konnte jetzt kleine rote Flecken von Zorn auf ihren Wangen aufflammen sehen.
»Gut, dann unternehmen Sie eben nichts gegen einen Wahnsinnigen, der arglose Touristen bedroht.«
»Ich rede mit ihm, versprochen«, Isabelle war ebenfalls aufgestanden.
»Dieser Mann ist gefährlich«, sagte die Besucherin.
»Nein, eigentlich nicht«, sagte Isabelle freundlich. »Bonne journée.«
Die Besucherin lief aus dem Zimmer und stieß dabei beinahe mit Leon zusammen, der vor dem Büro stehen geblieben war und brav an die Tür klopfte. Ohne sich noch einmal umzusehen, verschwand sie im Gang.
»Ich habe gehört, hier kümmert man sich um gefährliche Männer …?«, sagte Leon, der den letzten Satz von Isabelles Unterhaltung mitbekommen hatte.
»Eigentlich nur, wenn sie gut aussehend und unter 35 Jahre alt sind.«
Leon grinste. »Es ist gleich sechs«, sagte er. »Ich dachte, ich könnte die stellvertretende Polizeichefin vielleicht zu einem Aperitif überreden.«
Isabelle sah zu den Unterlagen, die sich auf ihrem Schreibtisch stapelten. Leon spürte ihr Zögern.
»Mondschein, leise Musik, nur wir beide und das Plätschern der Wellen, dazu ein Glas kühlen Rosé …«, hauchte Leon mit gespielter Verführerstimme. »Und anschließend ein Dinner in der Auberge Provençal.«
»Wer könnte da widerstehen?«, sagte Isabelle und schaltete das Telefon ab, das wieder zu summen begonnen hatte.
Eine Viertelstunde später saßen Leon und Isabelle vor dem Chez Miou, und Yolande stellte zwei Gläser Rosé vor ihre Gäste.
»Du machst so einen zufriedenen Eindruck«, sagte Isabelle. Sie hob ihr Glas. »Was feiern wir?«
»Dass man sogar in meinem Beruf dem Schicksal gelegentlich auf die Sprünge helfen kann«, sagte Leon. »Cheerio.«
»Klingt spannend«, sagte Isabelle. »Verrätst du mir dein Geheimnis?«
»Später vielleicht«, sagte Leon, »jetzt will ich nur hier sitzen und mit dir einen Sommerabend genießen.«
Leon ahnte noch nicht, dass mit der Gemütlichkeit schneller Schluss sein würde, als ihm lieb sein konnte.
6. Kapitel
Er hatte Zeit. Wenn ihn das Leben etwas gelehrt hatte, dann war es, nicht überstürzt zu handeln, sondern abzuwarten. Der erfolgreiche Jäger ist nicht der, der als Erster schießt, sondern der, der geduldig auf seine Chance warten kann. Und war das, was er tat, etwa keine Jagd?
Er hatte eine Aufgabe zu erfüllen. Sie war brutal und blutig, das wusste er. Aber er folgte seinem inneren Kompass, und der zeigte ihm, wann er es tun musste. Wann er Ordnung in das irdische Chaos bringen musste. Wann er die Dinge in die Hand nehmen, ein Leben auslöschen musste. Wann er den Strom der Zeit in eine neue Richtung lenken musste. Eine kleine Veränderung schaffen, die große Auswirkungen haben würde bis in alle Ewigkeit. Er veränderte den Lauf des Universums. Immer dann, wenn er ein Leben auslöschte, dann fanden Vergangenheit und Zukunft für einen kurzen Augenblick zueinander. So wie das Sonnenlicht von einem Brennglas gebündelt wurde, so verdichtete er ein ganzes Leben auf einen kurzen Augenblick. Wenn er es tat, wenn er diesen Menschen zeigte, wer sie wirklich waren, dann empfand er unendliches Glück, und wenn er tötete, dann fühlte er, wie sich ein inneres Feuer in ihm ausbreitete. Aber danach kam wieder die Leere, und er begann, die Menschen zu hassen, die einfach so in den Tag hineinlebten. Dann musste er ihnen zeigen, dass Sorglosigkeit nicht unbestraft bleiben konnte.
Er würde es wieder tun, heute, in dieser Nacht, die so dunkel war, als würde man sich durch schwarzen Samt bewegen. Der Mann fühlte sich beschützt von der Dunkelheit. Die Nacht war sein Freund. Er konnte sehen, was die anderen nicht sahen, denn er hatte ein digitales Nachtsichtgerät dabei, das er wie ein Fernglas an einem Riemen um den Hals trug. Das Gerät machte die Nacht zum Tag. Es war ein Leichtes gewesen, dem jungen Paar bis hierher zu folgen. Bis zum Strand von Brégançon. Ein abgelegener Platz, an den sich in dieser Nacht, in der der Mond erst um kurz vor Mitternacht aufgegangen war, niemand verirren würde. Niemand, bis auf das Liebespaar, das der Mann schon seit Stunden beobachtete.
Der Jäger warf einen Blick auf seine Uhr. Es war eine Stunde nach Mitternacht. Das Pärchen hatte sich in den Dünen ausgezogen und war nackt zum Meer gelaufen, das heute Nacht einen spektakulären Anblick bot. Meeresleuchten hatte eingesetzt. Das Wasser schien so ruhig wie ein Bergsee. Nur dort, wo das Meer in kleinen Wellen auf den Strand lief, glühte es auf mit einem irrealen, bläulich-grünen Licht. Es war das Leuchten von Millionen und Abermillionen fluoreszierender Algen. Ein Schauspiel, wie es nur alle paar Jahre vorkam.
Es wurde Zeit, dachte der Mann. Er griff in die Tasche seiner Jacke und zog ein großes Jagdmesser heraus.
7. Kapitel
Die meisten Menschen werden nachts geboren, und die meisten Menschen sterben auch nachts. Aber das wusste der Surfer mit den sonnengebleichten Haaren und den Sommersprossen nicht, und wahrscheinlich hätte es ihn auch nicht sonderlich interessiert. Das Einzige, was ihn in dieser warmen Sommernacht interessierte, war Amélie. Die bezaubernde Amélie mit dem Lächeln, das sein Herz so viel schneller schlagen ließ. Und jetzt waren sie zusammen hier. Sie war wirklich mitgekommen. In diesem Moment entstieg Amélie dem Meer wie die Venus von Botticelli. Das Wasser, das von ihrem Körper tropfte, hinterließ im Meer eine leuchtende Spur wie aus einer anderen Welt. Einen Moment stand der junge Mann im Meer und starrte Amélie an wie eine überirdische Erscheinung. Er ging auf sie zu und nahm sie in die Arme. Ihre Haut war noch kühl vom Meerwasser. Aber im Moment, als er sie berührte, wurde ihr Körper warm, und er wollte sie am liebsten nicht mehr loslassen. Plötzlich wich Amélie zurück.
»Was hast du?«, fragte der junge Mann mit einem Lächeln.
»Da war etwas«, Amélie flüsterte und deutete zu den Schatten des nahen Seekiefernwäldchens. »Da vorne bei der Hütte.«
»Ach was, hier ist kein Mensch«, sagte er. »Außerdem pass ich auf dich auf.«
Er gab ihr einen Kuss auf den Mund. Sie schmeckte salzig.
»Komm, ich zeig dir was.« Er nahm Amélie an der Hand. Nackt liefen sie zu der Hütte, wo tagsüber Liegestühle vermietet und Pommes frites mit Ketchup verkauft wurden.
Er wollte die Tür aufmachen, aber sie war mit einem Schloss gesichert. Plötzlich wehte eine frische Brise den Strand entlang.
»Lass uns zurückgehen«, sagte die junge Frau und zog sich ihr T-Shirt über.
»Warte«, sagte der Junge. »Nur noch einen Moment.«
Er hatte sich gebückt und einen Stein aufgehoben. Ein kurzer, kräftiger Schlag, und die Halteschrauben rissen aus dem morschen Holz und gaben die Tür der Hütte frei. Der junge Mann griff eine Matratze und trat wieder hinaus in die Sommernacht.
Da stand Amélie im Dämmerlicht der Sterne, und es dauerte einen Moment, bis der junge Mann begriff, was er da sah. Seine Freundin war nicht alleine. Neben ihr stand ein Mann und hielt ihr ein Messer an den Hals.
»Was soll …? Bitte, nicht!«, der Surfer ließ die Matratze fallen. Plötzlich war die Nacht nicht mehr warm und freundlich, sondern feindlich und kalt. Der junge Mann spürte, wie sein Körper zu zittern begann.
»Du tust jetzt genau, was ich dir sage, oder deine Freundin hier stirbt«, der Unbekannte drückte der Frau das Messer an den Hals, sodass sie wimmernd in die Knie ging.
»Hören Sie auf«, sagte der junge Mann. »Bitte, tun Sie ihr nichts.«
»Maul halten, habe ich gesagt. Du willst doch nicht zusehen, wie ihr etwas passiert?« Der Unbekannte ließ den Satz nicht wie eine Frage klingen, eher wie eine Ankündigung.
»Bitte tun Sie ihr nicht weh. Ich mach alles, was Sie sagen.«
»Natürlich wirst du das«, sagte der Mann. Er griff mit der freien Hand in seine Tasche und zog ein Paar Handschellen heraus, die er dem Surfer vor die Füße warf.
»Um dein Handgelenk! Das andere Ende um das Geländer«, der Mann deutete auf die Absperrung, die die hölzerne Terrasse vor dem Kiosk umgab.
Der Surfer tat, was der Mann ihm befohlen hatte.
»Ich habe Geld«, die Stimme des jungen Mannes hatte jetzt etwas Verzweifeltes. »Es ist in der Tasche meiner Jeans. Nehmen Sie es sich und lassen Sie uns gehen, bitte.«
»Ihr geht nirgendwohin.«
Der junge Mann versuchte, sich mit der freien Hand seine Jeans überzustreifen.
»Habe ich das erlaubt?« Die Stimme des Manns klang bedrohlich. Er strich mit dem Messer über den Körper von Amélie. Sie wimmerte nur leise. »Du willst also zusehen, wie ich ihr wehtu, ja, willst du das?«
»Wir haben Sie nicht gesehen«, der junge Mann hielt sich die Hand vors Gesicht, als könnte er damit verhindern, den Unbekannten ansehen zu müssen. »Wir könnten Sie ja nicht mal beschreiben …«
Der Mann mit dem Messer beachtete den Surfer gar nicht. Die Verzweiflung des jungen Mannes und das Wimmern seiner Geisel schienen ihn nicht im Geringsten zu berühren. Er sah zu dem jungen Mann und schüttelte den Kopf, wie ein Lehrer, der mit seinem ungezogenen Schüler sprach.
»Kommen einfach hierher zu uns, an unsere Strände«, der Mann mit dem Messer schien mit sich selber zu reden und schüttelte dabei den Kopf. »Glauben, alles wäre eine einzige große Party. Das Leben wäre nur ein Witz, ja? Im Wasser planschen, saufen und ficken. Alles gehört euch, was? Die Luft, das Meer, die ganze Welt.«
»Bitte, wir wollen doch nur weg von hier.«
»Nein! Ihr bleibt hier. Heute Nacht gehört ihr mir«, sagte der Mann. »Wisst ihr überhaupt, was Leben wirklich bedeutet? Leben ist Enttäuschung und Erniedrigung. Und Schmerz, großer Schmerz. Das müsst ihr begreifen. Ich werde euch dabei helfen.«
Dieses Mal drückte er die Klinge der Waffe Amélie mit solcher Wucht gegen den Leib, dass sie aufschrie und sich vor Schmerzen krümmte.
8. Kapitel
Paul Babin war früh aufgestanden. Was keine besondere Leistung war, wenn man in einem Wohnwagen lebte, an dem der Verkehr vorbeidonnerte. Lastwagen dröhnten keine fünf Meter von ihm entfernt von morgens bis abends und während der Hauptsaison sogar noch bis tief in die Nacht. Babin hatte sich schon überlegt, ganz an den Strand zu ziehen. Irgendwie würde er in seinem Kiosk schon ein Plätzchen zum Schlafen einrichten können. Aber dann wäre er endgültig allein. Weg vom Leben, weg von der Chance, jemals wieder eine Frau kennenzulernen. Er gestand es sich nur ungerne ein, aber die bittere Wahrheit war, dass Claire ihn vor über einem Jahr verlassen hatte und nicht zurückkommen würde. Seitdem lebte er allein. Der Kiosk mit den Grillhähnchen am Strand und der Wohnwagen waren alles, was ihm nach der Scheidung geblieben war. Und als wäre das nicht genug, lief demnächst auch noch der Vertrag für den Standplatz am Strand aus. Babin war sich sicher, dass die Gemeinde den Mietvertrag nicht noch einmal verlängern würde. Längst wartete die Konkurrenz gierig darauf, dass er vom Strand verschwinden würde. Dann würde hier ein richtiges Restaurant gebaut werden. Mit Küche, Terrasse und fließendem Wasser. Entsprechende Anträge stapelten sich bereits beim Bauamt in Lavandou. Aber er würde hier aushalten bis zum letzten Tag. Er würde um seinen Imbiss kämpfen, und wenn es das Letzte war, wofür er kämpfte.
Babin beneidete die anderen Wirte, die in der Bucht von Le Lavandou ihre schicken Strandrestaurants betrieben. Mit Kellnern in weißen Schürzen, die ganze Menüs auf der Terrasse servierten, und die Gäste mit eisgekühltem Rosé auf ihren Liegen unter den Sonnenschirmen versorgten. Natürlich hatten diese teuren Nobelrestaurants Spitzen-Metzgereien, mit denen sie feste Abnahmemengen vereinbart hatten. Babin hatte so was nicht. Es gab zwei Kessel mit heißem Fett, in denen Pommes frites brodelten, und es gab die beiden Drehspieße mit den Hähnchen. Er kaufte – nein, eher: besorgte – sich das Fleisch für seinen Imbiss im Supermarkt. Hähnchen für den Grill und gelegentlich auch mal eine Ladung Currywürste. Musste ja keiner wissen, dass er nur Billigfleisch besorgte, das gerade so abgelaufen war und folglich im Supermarkt nicht mehr verkauft werden durfte. Das verschaffte wiederum Babin die Möglichkeit, seine Ware zu Sonderbedingungen und selbstverständlich ohne Quittung aus dem Supermarkt abzuzweigen. Da traf es sich, dass der Mann im Kühllager des Supermarktes ein Kumpel war. Genauer gesagt ein ehemaliger Zellengenosse, mit dem er ein halbes Jahr im Dracenie, der Justizvollzugsanstalt von Draguignan, gesessen hatte. Strafe für einen Einbruch in ein Bistro. Sie waren damals beide hackevoll gewesen und hatten nichts weiter geklaut als eine Flasche Pastis, die sie gleich noch hinter dem Bistro gekippt hatten. Es hatte keine fünf Minuten gedauert, und schon waren die Flics aufgetaucht. Das war’s dann. Eigentlich nicht der Rede wert, aber genug für ein halbes Jahr Knast, wenn man wie Babin die entsprechenden Vorstrafen hatte.