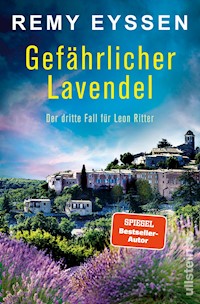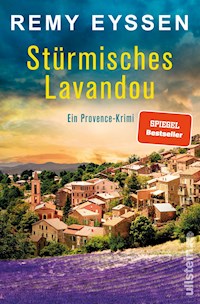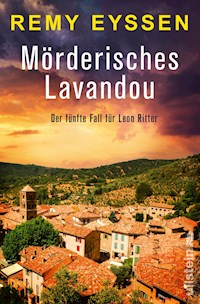9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eigentlich hatte sich Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter auf einen entspannten Job in der Sonne gefreut. Doch kaum im Örtchen Lavandou angekommen, liegt schon sein erster Fall auf dem Tisch. Ein Mädchenmörder geht in der Provence um und alle Spuren laufen scheinbar ins Leere. Leon Ritter, ein Mann mit großem Sinn für Ordnung und Details, versucht die Ermittelungen voranzutreiben. Doch die südfranzösischen Kollegen ermitteln anders. Als die Tochter seiner Kollegin Isabelle Morell entführt wird, wird es heiß in Lavandou, sehr heiß sogar. Und Ritter merkt zu spät, dass auch sein eigenes Urteilsvermögen getrübt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Dr. Leon Ritter ist ein leicht neurotischer Gerichtsmediziner, den es nach dem Tod seiner Frau nach Lavandou in der Provence verschlagen hat. Hier möchte er vor allem das südfranzösische Laissez-faire genießen. Als nacheinander zwei Mädchen aus dem Ferienort verschwinden und einige Tage später tot aufgefunden werden, ist es für Ritter mit der Ruhe vorbei. Er ermittelt auf eigene Faust. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bei dem Ritter nicht nur gegen den Täter selbst antreten muss, sondern auch gegen die örtlichen Behörden, die um jeden Preis den Ruf von Lavandou als Urlaubsparadies aufrechterhalten wollen. Als die Tochter seiner Kollegin Isabell Morell entführt wird, spitzt sich die Lage in Lavandou weiter zu …
Der Autor
Remy Eyssen (Jahrgang 1955), geboren in Frankfurt am Main, arbeitete zunächst als Redakteur bei der Münchner Abendzeitung, später als freier Autor für Tageszeitungen und Magazine. Anfang der Neunzigerjahre entstanden die ersten Drehbücher. Bis heute folgten zahlreiche TV-Serien und Filme für alle großen deutschen Fernsehsender im Genre Krimi und Thriller, unter anderem »Die Kommissarin«, »Der Ermittler« und »Tatort«. Mit der Reihe um den Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter schafft Remy Eyssen es regelmäßig auf die Bestsellerliste.
Von Remy Eyssen ist in unserem Hauseaußerdem erschienen:
Schwarzer Lavendel · Gefährlicher Lavendel
REMY EYSSEN
TÖDLICHERLAVENDEL
Leon Ritters erster Fall
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1094-7
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage April 2015
8. Auflage 2017
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2015
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Titelabbildung: © Arcangel Images/© Colin Hutchings
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Meiner Frau und meiner Tochter,für ihre Geduld und ihren Rat.
PROLOG
Eins, zwei, Papagei,drei, vier, Offizier …
Unter den Bäumen war es so dunkel. Dabei schien der Mond ganz hell, genau wie die Lampe bei den Duschen hinterm Wohnwagen. Die Zweige der Rosmarinsträucher waren hart und trocken und hinterließen kleine Kratzer, als sie Carlas Arme streiften. Es war auch jetzt, mitten in der Nacht, immer noch heiß draußen, und es roch nach Staub und faulem Wasser. Genauso hat es neben den Waschräumen auf dem Campingplatz gerochen, dachte Carla. Wo sie heimlich mit ihren Freundinnen durch das Loch im Zaun geschlüpft ist, rüber zum Wochenmarkt auf dem großen Parkplatz.
Ich habe alles so gemacht, wie du gesagt hast, Mami … ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin auch nicht mehr zu dem Mann gegangen, der den Kindern die Fahrräder aufpumpt … er hat mir Bilder von Delphinen unter den Gepäckträger geklemmt, und zwei grüne Lollies. Ich hab’s dir nicht erzählt. Weil ich die Bilder so gerne behalten wollte.
Carlas Welt stand auf dem Kopf. Die Lavendelbüsche warfen im Mondlicht lange Schatten auf den staubigen Erdboden. Blüten wie aus Watte zogen an ihr vorbei, als würden sie schweben. Jemand trug sie. Aber Carla konnte ihren Kopf nicht heben, konnte sich nicht bewegen. Alles war so schwer. Die Beine, die Arme. Warum war es so laut in der Nacht? Der Gesang der Zikaden klirrte in ihrem Kopf wie in einem Schrank voller Kristallgläser.
Hier dürfen wir nicht hingehen, nicht in die Hügel! Bitte nicht! Hier draußen sind die bösen Männer. Die, die Mädchen holen. Die Männer, vor denen Papa sie immer gewarnt hat, weil sie kleinen Mädchen schrecklich weh tun wollen. Weil sie ganz schlimme Sachen machen. Was für schlimme Sachen, Papa?
Carla hatte im Frühjahr miterlebt, wie ein Hund überfahren wurde, das war schlimm. Der Hund hatte laut geschrien, wie ein Kind. Sie wollte dem Hund helfen. Aber das Schutzblech des Lastwagens hatte dem Tier den Körper aufgerissen. Alles war voll Blut.
Nur noch Matsch, hatte der Mann in dem Laster gesagt. Da kann man nichts machen. Der Köter ist kaputt.
Ein Ginster mit hellen Blüten streifte Carlas Gesicht. Warum gibt es nur grau und schwarz im Mondlicht?
Es ging bergauf. Jemand atmete schwer. Warum konnte Carla nicht sehen, wer sie trug?
Warum bist du nicht bei mir, Mami?
Wenn man Angst hat, muss man ganz feste an einen Reim denken, einen Zauberreim. Das hatte die Frau in der Schule gesagt, zu Hause in Deutschland. Die Frau von der Polizei, die genau erklärt hat, worauf Kinder achten müssen: auf Fremde, die vor dem Schulhof warten und Fotos machen mit ihren Handys. Kinder dürfen auch nie Geschenke annehmen. Und wenn einer sagt, dass er sie mit seinem Auto nach Hause bringen will, dann müssen sie nein sagen. Sogar wenn es ein Nachbar ist. Laut schreien sollten die Kinder, wenn sie jemand anfassen will.
Aber Carla konnte nicht schreien. Sie konnte den Schrei denken, aber er wollte nicht aus ihrem Mund kommen. Kein Ton kam aus ihrem Mund.
Und die Autonummer sollten sie sich merken. Ihr seid doch schlau, hat die Frau von der Polizei gesagt. Kinder sind schlau, und sie können der Polizei helfen. Und wenn man das Zaubergedicht sagt, dann ist auch die Angst ganz schnell weg.
Fünf, sechs, alte Hex,sieben, acht, Kaffee gemacht …
Aber die Angst, die wollte nicht weggehen.
Wo bist du, Mami? Die Bäume wurden immer dunkler. Warum wachte sie nicht endlich auf aus diesem schrecklichen Traum?
Es war genau wie in der ersten Nacht auf dem Campingplatz am Meer. Als sie die unheimlichen Geräusche gehört und das Licht angemacht hat. Sie hat die Lampe genau gesehen. Die brennende Glühbirne hinterm Lampenschirm. Aber es ist nicht hell geworden im Zimmer. Es war nur ein böser Traum. Da hat der Zauberspruch gewirkt.
Neun, zehn, weitergehen,elf, zwölf, junge Wölf …
Da ist sie wieder eingeschlafen, einfach so. Und danach war alles wie vorher. Und morgens gab es Müsli. Mit frischen Erdbeeren, direkt vom Markt, und Toast mit Nutella. Zu Hause gab es nie Nutella. Warum war ihre Hose so feucht? War das Blut?
Bitte, Mami, hilf mir. Es ist so heiß, aber mir ist so kalt.
Dreizehn, vierzehn, Haselnuss,fünfzehn, sechzehn, dann ist Schluss …!
1. KAPITEL
Der Airbus der Lufthansa legte sich 400 Meter über dem Mittelmeer in eine Rechtskurve. Jetzt konnte man sogar schon mit bloßem Auge die Menschen erkennen, die auf ihren weißen Motoryachten durch das tiefblaue Wasser pflügten und eine Ansicht wie auf einer Postkarte boten. Einige Passagiere zückten ihre Handys und fotografierten.
Dr. Leon Ritter hatte nicht das geringste Interesse am postkartenschönen Ausblick auf die Côte d’Azur. Er krallte sich mit beiden Händen in die Sitzlehnen und sehnte den Moment herbei, wenn die Maschine endlich landen würde. Sein Körper stand unter Hochspannung. Er spürte, wie ihm trotz Klimaanlage der Schweiß unterm Hemd ausbrach. Ritter fixierte mit starrem Blick den Griff für den Notausstieg gleich neben seinem Sitz. Er versuchte flach zu atmen, um die aufkommende Übelkeit zu bekämpfen.
Es gab Zeiten, da hatte ihm das Fliegen kaum etwas ausgemacht, aber in den letzten Jahren waren seine Ängste schlimmer geworden. Bis schließlich das geschah, was sein ganzes Leben ändern sollte. Dr. Ritter versuchte die Gedanken zu verdrängen, seinem Gehirn zu verbieten, die schrecklichen Bilder aufzurufen. Aber sie kamen, stürzten auf ihn ein, und er konnte nichts dagegen tun. Ritter atmete schneller, gegen die aufkommende Panik, bis er endlich den erlösenden Stoß spürte, der signalisierte, dass die Räder auf der Rollbahn aufgesetzt hatten.
»Herzlich willkommen in Nizza«, säuselte die Stewardess über Lautsprecher, »die Temperatur beträgt 36 Grad. Und es soll die ganze kommende Woche heiß und sonnig bleiben. Kapitän Bauer und die Besatzung wünschen Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt an der Côte d’Azur.«
Als Leon Ritter mit den anderen Passagieren die Maschine über die Treppe verließ, traf ihn die Hitze wie ein Schlag. Es waren keine fünfzig Meter bis zum Flughafengebäude, aber der aufgeheizte Boden schien sich durch die Sohlen seiner Schuhe zu brennen.
Im Ankunftsterminal waren die automatischen Schiebetüren ausgefallen. Die Reisenden drängten sich vor dem Eingang. Die Sonne glühte vom Himmel, und es gab nirgendwo Schatten. Geschäftsleute begannen sich lautstark zu beschweren und mit ihren Handys gegen die Scheiben zu trommeln. Ein Touristenpaar in bunten Bermudas stöhnte und hielt sich die Bild-Zeitung schützend über den Kopf.
Nur Leon war glücklich – endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Er stand einfach da, schlank und entspannt in seinen Jeans, Poloshirt und einem hellen Leinensakko, zwischen all den aufgebrachten Passagieren, und blinzelte in die Sonne. Je hektischer die Lage wurde, um so ruhiger schien Leon zu werden. Eine besondere Fähigkeit, die ihm schon oft geholfen hatte, in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Er schätzte die Ruhe in den kühlen Kellern der Pathologie, weit weg von der Hektik des Klinikalltags. Hier konnte er sich ganz »seinen Patienten« widmen, wie er die Toten nannte. Zuhören, was die Opfer ihm zu »erzählen« hatten. Das war einer der Gründe, warum Dr. Ritter seinen Beruf als Gerichtsmediziner so liebte.
Nach endlosen Minuten erschien auf der anderen Seite der Glastür ein Techniker. Er stocherte mit einem Schraubenzieher im Schließmechanismus herum. Augenblicke später glitten die Scheiben auseinander und gaben den Eingang zum Empfangsgebäude frei.
Die Klimaanlage hatte die Ankunftshalle in eine Kühlkammer verwandelt, und Leon drängte es Richtung Ausgang, zurück in die Hitze des Sommertages. Doch das Gepäckband rührte sich nicht. Auch nach zehn Minuten war noch kein Koffer aufgetaucht. Das Paar in den Bermudas, das neben Leon Ritter stand, wandte sich an den Mann vom Bodenpersonal.
»Pardon … luggage. Frankfurt … wo, where is our luggage?«, sagte der Deutsche und sah verärgert zu seiner Frau, »… jetzt sag du doch auch mal was.«
»Je ne parle que Français«, antwortete der Mitarbeiter vom Bodenpersonal, ohne die beiden Touristen in ihren Bermudas auch nur eines Blickes zu würdigen.
Hals und Wangen des Deutschen verfärbten sich in zorniges Rot. Bevor er etwas erwidern konnte, sprach Leon den Mann vom Flughafenpersonal an.
»Les bagages de l’avion de Francfort?«, fragte Leon.
Der Angestellte musterte Dr. Ritter kurz und deutete dann mit dem Daumen hinter sich in die Halle, le quatre, die Nummer vier. »Die anderen Bänder funktionieren nicht mehr. Liegt an der Hitze, was für ein Drama.«
Der Deutsche sah dankbar zu Leon. »Der Bursche hat mich genau verstanden, da könnt ich wetten. Sagen Sie, Sie waren doch auch mit uns im Flieger?«
Leon hatte kaum hingehört. Er sah gebannt einer rothaarigen Frau im blauen Sommerkleid hinterher, die mit einer Gruppe von Passagieren zum Ausgang ging. Ihr Gang, die Art wie sie sich die Haare aus dem Gesicht strich, das war wie …
»Die Maschine aus Frankfurt«, insistierte der Mann. »Sie saßen genau vor uns am Gang. War doch so, Marlis«, seine Frau nickte.
Leon sah das Ehepaar an. Der Mann war eindeutig hypertonisch. Der Gesichtsfarbe nach zu urteilen lag sein Blutdruck bei 160 oder drüber. Er hatte sich eine gefährliche Jahreszeit für seinen Urlaub ausgesucht. »Ja, ja in der Zehn-Uhr-Maschine«, Ritter sah noch mal zum Ausgang, aber die rothaarige Frau war verschwunden.
»Wir müssen da lang«, Leon deutete in die Halle, »ganz nach hinten. Das Gepäck wird heute nur auf dem einen Band ausgegeben.«
»Nur ein Band für alle Flieger? – Schöne Scheiße«, meinte der Mann, und seine Frau sah ihn kurz an. »Ist doch wahr. Ist ne arrogante Bande, diese Franzosen.«
»Walter …«, mahnte seine Frau.
Ihr Mann hob in einer übertriebenen Geste die Hände und wandte sich an Ritter. »Das nächste Mal fliegen wir wieder nach Mallorca, da verstehen sie wenigstens Deutsch. Oder nach Marokko. Waren Sie mal in Marokko? Marrakesch ist der Hammer, oder, Marlis?«
Neben dem Gepäckband stapelten sich bereits die Koffer. Es dauerte aber nur ein paar Minuten, bis Ritter seinen blauen Samsonite unter all den übrigen Gepäckstücken entdeckte. Am Griff hatte er ein Leichenerkennungsband aus der Pathologie befestigt, das schloss jede Verwechslung aus.
Wenige Augenblicke später sah sich Leon suchend in der Ankunftshalle um. Wo war der Fahrer, der ein Schild mit seinem Namen hochhalten sollte? Die Klinik hatte versprochen, einen Wagen zu schicken. Er hatte in drei Stunden einen Termin in Hyères. Was sollte das?
Als Leon mit seinem Handy im Verwaltungsbüro des Krankenhauses anrief, meldete sich nur der Anrufbeantworter. Bis 14:30 Uhr war das Sekretariat nicht besetzt – na bravo, willkommen in Südfrankreich. Wenn es etwas gab, das Leon nicht akzeptierte, dann war es Unpünktlichkeit. Er dachte gar nicht daran, zwei Stunden auf dem Flughafen von Nizza zu warten. Er würde sich einen Mietwagen nehmen, sollte doch die Klinik die Rechnung zahlen.
Der Fiat 500, den ihm der Mitarbeiter von Europcar aushändigte, war nicht mal gewaschen.
»Was erwarten Sie?«, sagte der Mann. »Es ist Hauptsaison. Sie können froh sein, dass überhaupt ein Auto frei war.«
Auf der Autobahn stellte Leon fest, dass die Tankanzeige nur auf drei Viertel stand. Idiot von einem Autovermieter! Leon würde zurückfahren und sich diesen blasierten Wichtigtuer mit seiner fetten Armbanduhr und dem falschen Grinsen vorknöpfen. Den Geschäftsführer würde er sich kommen lassen und mit Klage drohen. Einen riesen Zirkus veranstalten. Zuletzt würden sie ihm eines der hübschen Cabrios als Wiedergutmachung anbieten. In diesem Moment fuhr Leon an der letzten Ausfahrt nach Nizza vorbei. Jetzt war es zu spät, umzukehren. Leon blieb ein Gefangener des kleinen roten Fiats, der nach Schweiß, Sonnenöl und feuchter Wäsche roch.
Leon ließ sein Fenster herunter. Der Fahrtwind blies ihm ins Gesicht, heiß wie ein Föhn. Aber das war immer noch besser, als den ranzigen Gestank dieser Kiste atmen zu müssen. In der Seitentasche der Fahrertür entdeckte Leon ein angebissenes Croissant, und auf dem Rücksitz lag ein verschwitztes T-Shirt. Auf dem Hemd war der pralle Hintern einer nackten Frau abgebildet, darunter der Text: »Côte d’Azur – Leben wie Gott in Frankreich«. Leon legte das Hemd auf den Beifahrersitz und faltete es mit spitzen Fingern ordentlich zusammen.
Hinter Nizza führte die Autoroute A 8 in einem weiten Bogen weg von der Küste durchs dünnbesiedelte Hinterland, mitten hinein in die Provence. Kaum hatte der Fiat die Ausfahrten nach Cannes, Fréjus und St. Tropez hinter sich gelassen, wurde es ruhiger auf der Autobahn. Die Touristen quälten sich lieber die vielbefahrene Küstenstraße mit ihren fotogenen Aussichtsplätzen entlang.
Leon fühlte sich in seinem muffigen Mietwagen plötzlich verloren wie ein Astronaut im Weltall. Vielleicht war diese ganze Frankreich-Idee Schwachsinn. Er hätte auf seine innere Stimme hören sollen. Klar, das Angebot hörte sich verlockend an: Médecin legiste, Gerichtsmediziner, an der Klinik von Hyères. Das klang nach Palmen, Meer und kühlem Rosé am Strand bei Sonnenuntergang. Du bist ein verdammter Träumer, dachte Leon, sei doch einmal Realist. Was ist denn so großartig hier unten? Es ist heiß, die Leute sind unzuverlässig, man bescheißt dich mit dem Mietwagen, und zum Frühstück gibt es nicht mal richtige Brötchen. Er würde bestimmt noch den Tag verfluchen, an dem er ja zu dem Job gesagt hatte.
Alles hatte damit angefangen, dass Dr. Ritter auf dem Gerichtsmedizinerkongress in Toulouse einen Vortrag über »Blutspurenmuster-Verteilungsanalyse« hielt. Sein Vortrag gefiel dem Komitee. Die deutsche Gerichtsmedizin genoss einen hervorragenden Ruf. Die Leute sahen Serien wie Crossing Jordan oder CSI im Fernsehen und glaubten deshalb, dass die Amerikaner die Nummer eins sein müssten, wenn es um die Forensik ging. Aber das war falsch, im wirklichen Leben rangierte nicht die amerikanische, sondern die deutsche Rechtsmedizin weltweit an erster Stelle.
Und weil Leon als Sohn einer französischen Lehrerin und eines deutschen Biologieprofessors zweisprachig aufgewachsen war und auch einige Semester lang in Paris an der Universität Descartes studiert hatte, sprach er außerdem ein nahezu akzentfreies Französisch. Das Angebot, das ihm die Klinik gemacht hatte, klang verlockend. Er würde es hauptsächlich mit Routineuntersuchungen zu tun haben und könnte parallel weiter an seiner Studie arbeiten, mit der er sich eines Tages habilitieren wollte.
Jeder seiner Kollegen an der Uniklinik in Frankfurt hätte sonst was gegeben für diesen Job. Aber die Franzosen wollten unbedingt ihn. Und er hatte sich auch noch geschmeichelt gefühlt, dachte Leon. Nur gut, dass es täglich drei Direktflüge von Nizza nach Frankfurt gab. Er würde sich die ganze Sache eine Woche ansehen, und dann nichts wie zurück.
Leon betrachtete die trockene Vegetation, die draußen vorbeizog. Wenn er ehrlich war, ging es ihm gar nicht um den Job. Das war nicht der wahre Grund, warum er zugesagt hatte. Er hatte unterschrieben, weil er die Schnauze voll hatte. Er wollte weg aus Frankfurt, weg von all denen, die sich ständig besorgt nach seinem Befinden erkundigten, weg von seinem kleinen Haus im Taunus, das voller Erinnerungen an Sarah steckte. Sie war nicht mehr da, sie war tot. Er musste die Vergangenheit endlich loswerden. Verdammt noch mal, er war 48 Jahre alt, da hat man das Recht, noch mal neu anzufangen. Das Jobangebot in der Provence erschien Leon wie ein Wink des Schicksals, wie ein Aufbruch in eine andere Welt. Genau das war es, was er wirklich suchte: ein neues Leben.
Aber jetzt, auf der Autobahn Nizza-Toulon fühlte sich das alles falsch an. Leon kam sich vor wie ein Ausbrecher, der feststellt, dass sein Fluchtversuch gescheitert ist. Er fühlte sich plötzlich beschissen, Schweiß rann ihm übers Gesicht, und er spürte sein Herz.
Leon fuhr auf einen Rastplatz, hielt im Schatten einiger Korkeichen, stellte den Motor ab und riss die Autotür auf. Er zwang sich, tief und regelmäßig zu atmen. Nach und nach spürte er, wie sich sein Puls wieder beruhigte. Er lehnte sich auf seinem Sitz zurück und öffnete das Schiebedach. Über sich sah er das flirrende Sonnenlicht, das durch die Blätter der Korkeichen brach. Und er hörte das Zirpen der Zikaden, das wie ein einziger rauschender Klangteppich über der Landschaft lag. Die warme Luft roch auf einmal nach Thymian und Lavendel. Und plötzlich überlief Leon ein kleiner Schauer. Es war dieses besondere Gefühl, das er schon so lange nicht mehr gespürt hatte. Dieser Duft, die Wärme, die Geräusche, das alles sorgte für Erinnerungen. An Ferien, die er als Kind jedes Jahr mit seiner Mutter in Südfrankreich verbracht hatte. Auf einmal hatte er doch das Gefühl, genau das Richtige zu tun, genau am richtigen Platz zu sein.
2. KAPITEL
Es waren die unruhigen Blicke der Mutter, die Polizistin Isabelle Morell stutzig machten. Die Augen der dunkelhaarigen Deutschen wichen ihr aus, wie bei einem Menschen, der ein schlechtes Gewissen hat und der sich davor fürchtet, dass der andere ihm in die Seele schauen könnte.
Was versteckt sie vor mir?, fragte sich Isabelle.
Capitaine Morell saß in einem Büro, von dem aus man gegenüber die Laderampe eines Baumarktes sehen konnte. Es war nur ein kleines Büro, aber Isabelle war stolz auf ihren Raum, ihren Schreibtisch und das Messingschild: »Capt. Morell – stellvertretende Polizeichefin«. Sie war die erste Frau in der hundertjährigen Geschichte des Küstenortes, die es bis in diese Position geschafft hatte. Und es gab eine Menge männlicher Kollegen, denen diese Tatsache immer noch Probleme bereitete. Allen voran Lieutenant Didier Masclau, der in seinem Facebook-Account seine Berufsbezeichnung schon siegessicher auf Capitaine geändert hatte – quel dommage, was für eine Blamage. Anschließend ließ er sich drei Tage krankschreiben.
Isabelle, 43 Jahre alt, hatte ihren eigenen Weg gefunden, um sich Respekt zu verschaffen. Hinter ihrem fast mädchenhaften Auftreten steckte eine Frau mit einem starken Willen und großer Ausdauer. Normalerweise überhörte sie zweideutige Anspielungen ihrer männlichen Kollegen. Aber gelegentlich konnte sie auch ruppig werden, und dann schoss sie schon mal übers Ziel hinaus, was regelmäßig für dicke Luft auf der Wache sorgte.
Der Übersetzer ließ mal wieder auf sich warten, und so radebrechten die verzweifelten Eltern mit Capitaine Morell und dem genervten Didier Masclau auf der stickigen Polizeistation von Le Lavandou, um zu erklären, wann und wo genau sie ihre achtjährige Tochter Carla zum letzten Mal gesehen hatten.
Die Eltern saßen nebeneinander auf der Holzbank, ohne sich zu berühren. Die Frau war Ende dreißig und sah aus, als würde sie seit Jahren gegen ein paar Pfunde zu viel ankämpfen, die sie unter einem weiten, auffällig gemusterten Sommerkleid verbarg. Der Mann war um die vierzig. Ein blasser Typ, in Jeans und offenem Hemd, eine teure Uhr am Handgelenk. Er stand immer wieder auf und lief zum Fenster. Zwischendurch versuchte er seine Frau zu beruhigen, versuchte die Kontrolle über die Situation zu behalten. Isabelle spürte die Spannung, die zwischen dem Paar herrschte.
»Ich dachte doch, Carla schläft bei Miriam, bei ihrer Freundin. Die Familie hat den Stellplatz gleich schräg gegenüber von uns«, sagte die Mutter unter Tränen. »Carla bleibt oft bei Miriam. Darum bin ich gar nicht mehr hin.«
Den letzten Satz hatte sie zu ihrem Mann gesagt. »Du hast doch gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Carla soll ihre Ferien genießen, hast du gesagt«, die Mutter musste wieder weinen. Isabelle musterte sie. »Carla ist doch noch so klein, sie ist erst acht Jahre alt.«
»Susanne, das weiß die Polizei doch schon«, der Mann wollte seiner Frau die Hand auf die Schulter legen, doch die drehte sich demonstrativ von ihm weg.
»Und Sie sind erst heute Morgen angekommen?«, Isabelle wandte sich an den Ehemann.
»Ja, das heißt, ich hatte noch den letzten Flug nach Nizza erwischt, da hab ich im Hotel übernachtet.« Isabelle registrierte den kurzen traurigen Blick, den die Frau ihrem Mann zuwarf.
»Dann waren Sie mit Ihrer Tochter also alleine auf dem Campingplatz?«
Die Mutter nickte, wieder stiegen ihr Tränen in die Augen. Isabelle reichte ihr die Kleenex-Schachtel, die auf der Fensterbank stand. Dankbar zupfte die Frau ein Tuch aus der Box und tupfte sich damit die Tränen fort. Sie war abends von den freundlichen Platznachbarn auf einen Wein eingeladen worden, erzählte sie. Da saßen sie dann bis nach Mitternacht. Wer kann denn schon schlafen bei diesen Temperaturen?
»Geht mir genauso«, sagte Didier, »ich habe jetzt einen Ventilator im Schlafzimmer. Habe ich im Marché Sud gekauft. Ein offre spéciale: 35 Euro. Ist ziemlich laut, aber …«
Isabelle warf Didier einen kurzen Blick zu. »Alkohol« notierte sie. Das war es also, was die Mutter verbergen wollte. Isabelle hatte schon den schwachen Geruch von Alkohol wahrgenommen, als das Ehepaar in ihr Büro gekommen war. Im ersten Moment dachte sie, der Mann hätte vielleicht auf den Schrecken einen Pastis getrunken, aber sie hatte sich geirrt. Es war die Frau. Die Hitze ließ die Leute schwitzen, und die Haut der Frau verströmte diesen verräterischen, leicht säuerlichen Geruch einer durchzechten Nacht.
Ein Kind war verschwunden, dachte Isabelle, der Vater verbrachte die erste Nacht in Cannes, und die Mutter trank zu viel.
»Wir lassen Carla sonst nie aus den Augen«, sagte der Mann und sah kurz zu seiner Frau.
»Wir dachten, der Campingplatz ist sicher, so stand’s im Prospekt. Familiengerecht und sicher.«
Isabelle kannte den Campingplatz. Camp du Domaine, ein mehrere Hektar großes Gelände direkt am Meer. Mit eigenem Supermarkt, Bar und Restaurant. Der Campingplatz war bei Familien sehr beliebt.
Dass Kinder gelegentlich vermisst wurden, war nicht ungewöhnlich in einem Ferienort wie Le Lavandou. Der Ort hatte knapp 6000 Einwohner, aber im Sommer kam noch ein Vielfaches an Touristen dazu. Dann platzte das Städtchen am Meer aus allen Nähten. Normalerweise tauchten vermisste Kinder nach ein paar Stunden wieder auf. Meist auf dem großen Spielplatz von Favière, gleich hinter der Segelschule, oder die Kinder kletterten über die Felsen bis zur Bucht von Saint Clair und vergaßen die Zeit an einem der kilometerlangen Sandstrände. Manchmal verliefen sie sich auch in den engen Gassen der Stadt oder den verschlungenen Pfaden des nahen Nationalparks. Da vergingen oft Stunden. Aber irgendwann konnten die weinenden Kleinen dann immer wieder auf der Gendarmerie ihren glücklichen Eltern zurückgegeben werden. Doch dieser Fall lag anders, das hatte Isabelle in dem Moment gespürt, als das Ehepaar auf der Polizeiwache auftauchte.
»Warum unternehmen Sie nichts?«, sagte der Mann, und Isabelle sah ihn an, »Sie müssen doch irgendwas tun. Straßensperren, Suchmannschaften, was weiß ich.« Dabei strich er sich immer wieder nervös mit beiden Händen durch die Haare.
»Also, was genau hat Ihre Tochter an?«, Polizistin Morell wandte sich wieder an die Mutter.
»Einen Jogginganzug. Pink mit solchen weißen Streifen an den Ärmeln und an der Hose.«
»Hat Ihre Tochter sonst noch etwas mitgenommen?«, die Mutter sah Isabelle fragend an, »Geld?«
»Sie bekommt Taschengeld von uns«, sagte der Vater, »bekommt sie doch, oder?«
»Irgendetwas, woran wir sie erkennen können. Ein Rucksack, eine Tasche?«, fragte Isabelle.
»Nur ihre kleine Tasche mit dem Furby.«
»Mit was?«, fragte Didier.
»Furby, so einen kleinen Stoffvogel«, sagte Isabelle. »Alle Mädchen haben solche Anhänger. An der Tasche, am Rucksack. Haben Sie die nie gesehen?«
»Carlas Furby ist rot mit grünen Ohren. Sie hat ihn am Träger ihrer Umhängetasche befestigt«, sagte die Mutter.
»Das könnte uns schon helfen«, Isabelle machte sich ein paar Notizen. »Sie sagten, Sie hätten ein Foto?«
Die Mutter zog ein Bild aus der Handtasche. Es zeigte ein strahlendes blondes Mädchen auf einem Pony.
»Ein hübsches Mädchen, wirklich«, sagte Isabelle und drehte sich zur offenen Tür. »Moma, kommst du mal?« Ein arabisch aussehender Mann im kurzärmeligen dunkelblauen Uniformhemd der Police nationale kam aus dem Nebenzimmer. Mohamed Kadir, genannt Moma, war der Sohn algerischer Einwanderer. Er war 31 Jahre alt, in Nizza geboren und französischer als die meisten Franzosen. Aber die Leute behandelten ihn trotzdem oft wie einen Ausländer. Immerhin war er inzwischen vom Assistenten zum Sous-Lieutenant aufgestiegen. Dass er überhaupt für die Polizei arbeiten konnte, verdankte er einem Integrationsprogramm, das die Regierung vor einigen Jahren gestartet hatte. Und natürlich Isabelle, die sich dafür eingesetzt hatte, dass Monsieur Kadir in ihrer Abteilung beschäftigt wurde.
»Wir brauchen davon 25 Abzüge«, sagte Isabelle und reichte ihm das Foto des Mädchens, »die gehen an die Einsatzwagen raus.« Und fügte dann halblaut, damit die Eltern sie nicht verstehen konnten, hinzu: »Und gib auch welche an die Küstenwache.«
Moma nickte. »Der Patron will mit dir reden. Er hat gesagt, es sei dringend.«
»Du siehst doch, was los ist. Sag ihm, ich komme später. Die Kollegen sollen als Erstes die Strände überprüfen, dann die Spielplätze und den Platz um das Karussell.«
»Unsere Tochter, also Carla, ist doch nicht auf einem Spielplatz«, der Mann klang jetzt vorwurfsvoll.
»Sie hätte sich längst gemeldet«, sagte die Mutter und wischte sich die Tränen aus den Augen, »warum meldet sie sich denn nicht?«
Isabelle sah auf ihre Aufzeichnungen. »Hat Ihre Tochter ein Handy?«
»Nein, Marcus, mein Mann …«, sie unterbrach sich.
»Eine Achtjährige braucht ja wirklich noch kein Handy«, sagte der Mann.
»Gab es irgendeinen Platz, den Ihre Tochter besonders mochte?«, fragte Isabelle.
»Was ist, wenn das Mädchen entführt wurde?« Der Vater hatte ihr gar nicht zugehört.
»Warum glauben Sie, dass Ihr Kind entführt wurde?« Isabelle sah dem Mann direkt in die Augen. Er wich ihrem Blick aus.
»Weil … Kinder verschwinden doch nicht einfach so.«
»Ist Ihre Tochter schon mal ausgerissen?« Es war nur so eine Ahnung, die Isabelle hatte. Die Mutter protestierte sofort. Carla sei sehr glücklich zu Hause. Und außerdem sei sie sehr reif für ihr Alter. »Carla und ich, wir verstehen uns«, sagte die Mutter, »wir sind wie, wie richtige Freundinnen.«
Isabelle wünschte sich, sie könnte das auch von ihrer Tochter sagen: Freundinnen. Schön wäre es, stattdessen lieferte sie sich mit ihrer fünfzehnjährigen Lilou einen Dauerkampf. Augenblicke der Nähe zwischen Mutter und Tochter waren selten geworden. Die Pubertät forderte ihren Tribut.
»Und letztes Jahr in Hamburg, was war das?«, der Mann hatte das halblaut zu seiner Frau gesagt, und es klang bitter.
»Das war etwas völlig anderes, Marcus«, verteidigte die Mutter ihre Tochter. »Außerdem war Carla nach zwei Stunden wieder da, alles war in Ordnung.«
»Ach ja? Wer wollte denn damals zur Polizei gehen? Du warst fix und fertig«, sagte der Vater.
»Marcus, bitte …«, die Frau sah zu ihrem Mann, dann zu Isabelle. »Damals wollte Carla unbedingt zu ihrem Vater. Also Marcus ist nicht Carlas richtiger Vater, verstehen Sie?«
3. KAPITEL
»Für heute ist kein Termin eingetragen«, die Frau mit den schmalen, grellrot geschminkten Lippen sah Leon über den Rand ihrer Brille an, als wäre er irgendein lästiger Pharmavertreter und nicht der zukünftige Gerichtsmediziner an der Klinik Saint Sulpice. Das Namensschildchen an ihrer Bluse wies sie als »Schwester Monique« aus. Sie bewachte das Vorzimmer von Klinikleiter Dr. Hugo Arnaud. Und sie war gleichzeitig die persönliche Assistentin des Chefarztes, wie sie betonte, was so viel heißen sollte wie: Wer sich mit ihr anlegte, würde sich einen Haufen Probleme einhandeln.
»Dann rufen Sie bitte Doktor Arnaud an und sagen ihm, dass Doktor Leon Ritter aus Frankfurt da ist. Wieso musste Leon dieser Schwester erklären, wie sie ihren Job zu machen hatte?
Er war heute Morgen extra um 10.00 Uhr in Frankfurt abgeflogen, um pünktlich um 15.30 Uhr nachmittags in der Klinik Saint Sulpice zu sein. Genau so, wie es in dem Einladungsschreiben von Dr. Arnaud stand, das er der Schwester auf den Tisch legte, oder eher auf den Tisch warf, was sie erneut mit dem lauernden Blick einer Löwin quittierte. Das Problem war nur, dass die Klinik an diesem Montag keinen Dr. Ritter aus Deutschland erwartete. Heute nicht, und an keinem anderen Tag dieser Woche.
»Doktor Arnaud ist nicht hier«, sagte die Schwester spitz. »Er befindet sich übers Wochenende in Reims, bei seiner Familie.«
»Und was steht hier?« Leon tippte mit dem Finger auf das Schreiben, das er von dem Klinikchef erhalten hatte. Seine Laune wurde von Minute zu Minute schlechter. »Das ist doch das heutige Datum, und es ist genau 15.30 Uhr.«
Schwester Monique und eine weitere Klinikangestellte steckten die Köpfe zusammen und beugten sich über die Dienstpläne. Es wurde hektisch telefoniert. Schließlich musste Monique zugeben, dass sich die Verwaltung um eine ganze Woche vertan hatte. Ein kleiner Irrtum. Man hatte den Médecin légiste erst am kommenden Montag erwartet. Die schlechte Nachricht war, dass man auch erst ab nächsten Montag ein Zimmer für Dr. Ritter reserviert hatte.
»Na wunderbar«, sagte Leon.
»Wir könnten Ihnen bis dahin natürlich ein Zimmer hier in der Klinik herrichten.« Der Vorschlag kam von der älteren Schwester aus dem Nebenzimmer.
»Ein Krankenzimmer?!« Leon traute seinen Ohren nicht.
»Auf Station 4 wäre was frei.« Die Schwester kam mit einer Liste, die sie Monique hinhielt. Neugierig betrachtete sie den gutaussehenden Mediziner mit dem wilden dunklen Haar, in dem sich erste graue Strähnen zeigten.
»Unsere Entbindungsstation«, erklärte die Assistentin, »da ist zu dieser Jahreszeit nicht viel los. Die meisten Frauen bekommen ihre Kinder lieber im Herbst und im Winter.«
»Sie hätten das Zimmer ganz für sich alleine. Mit eigenem Badezimmer und mit Blick Richtung Park«, versuchte die grauhaarige Schwester Leon das Angebot schmackhaft zu machen.
Leon war fassungslos. Da hatte er all seinen Mut zusammengenommen, ein Flugzeug nach Nizza bestiegen, war drei Stunden durch die Provence gefahren, und wofür? Damit er jetzt eine Woche auf der Entbindungsstation verbringen würde. Leon sagte den Schwestern, was er von der Klinik erwartete: ein Zimmer, und zwar in einem ausgezeichneten Hotel, und das sofort und auf Kosten des Krankenhauses. Die Schwestern sahen ihn an, als hätte er nach einem Zimmer im Schloss von Versailles verlangt.
»Es ist Juli, Doktor Ritter«, sagte Monique. Der mitleidige Unterton in ihrer Stimme war nicht zu überhören. »Hochsaison. Es gibt an der ganzen Küste kein einziges freies Hotelzimmer mehr. Heute nicht, und auch nicht die nächsten zwei Monate.«
»Dann bestellen Sie bitte dem geschätzten Kollegen Doktor Arnaud einen freundlichen Gruß«, sagte Leon ganz ruhig, »und sagen Sie ihm, dass Doktor Leon Ritter wieder zurück nach Deutschland geflogen ist.«
Die Schwestern sahen sich erschrocken an. Leon registrierte mit einer gewissen Genugtuung, dass er die Frauen aus dem Konzept gebracht hatte. Eine kleine Rache für das Zimmerangebot auf der Entbindungsstation. Natürlich wäre es für Leon der absolute Alptraum, sich gleich wieder in ein Flugzeug nach Deutschland setzen zu müssen, aber das brauchten Schwester Monique und ihre Kollegin ja nicht zu wissen. Irgendwo würde sich bestimmt ein Hotelzimmer auftreiben lassen. Und dann würde Leon eine Woche Urlaub am Meer machen, auf Kosten der Klinik. Es wäre sein erster Urlaub seit über zwei Jahren. Vielleicht hatte der verschlampte Termin ja auch sein Gutes.
»Die Schwester meines Schwagers vermietet manchmal das Gästezimmer in ihrem Haus«, sagte Monique. »Das ist in Le Lavandou. Nur ein paar Kilometer von hier.«
Keine Viertelstunde später saß Leon in seinem Auto und fuhr nach Le Lavandou. Das Zimmer wurde angeblich von einer Polizistin vermietet, Isabelle Morell, die Leon allerdings nicht persönlich gesprochen hatte. Dafür war ihre Tochter Lilou am Telefon. Das Mädchen hatte Leon erklärt, dass er das Haus nie alleine finden würde. Bevor sie also lange Wegbeschreibungen abgäbe, sollte Leon sie beim Kreisverkehr mit den Wasserspielen am Ortsrand treffen. Der Brunnen wäre scheußlich und nicht zu übersehen.
Kurz darauf stoppte Leon den Fiat auf dem Parkstreifen kurz vor dem Kreisverkehr. Er starrte fasziniert den Brunnen an. Die Konstruktion war tatsächlich von atemberaubender Geschmacklosigkeit. Drei eiserne Walfluken, über die sich Wasser ergoss, ragten aus einem flachen Becken. Ein Kunstwerk, wie es nur der Gemeinderat eines Ferienortes durchwinken konnte.
Es gab natürlich keine Wale vor der Küste von Lavandou, und darum hatte der Stadtrat ursprünglich auch drei springende Delphine bestellt. Schließlich hatte Lavandou vor einigen Jahren in sein Stadt-Logo den Zusatz »Stadt der Delphine« gesetzt. Aber die hatte der Künstler dem Brunnen-Komitee ausgeredet, weil Delphine angeblich out waren. Heute war alle Welt verrückt nach Walen. Wale standen für die Reinheit der Meere. Und so blieben von der Delphin-Idee zuletzt nur die drei Walfluken übrig. Wie überdimensionale Blüten, die in der Hitze vertrocknet sind, dachte Leon, während er das Kunstwerk betrachtete. In diesem Moment klopfte ein junges Mädchen an die Autotür.
»Doktor Ritter?«, sie musterte Leon durch das offene Fenster.
»Ja, und du … Sie sind …?«, Leon war irritiert, das Mädchen am Telefon konnte höchstens vierzehn gewesen sein, diese junge Frau hier sah aber eher wie achtzehn aus.
»Ich bin Lilou, wir haben telefoniert«, erklärte das Mädchen selbstbewusst. »Mama hat noch zu tun. Sie hat gemeint, ich soll Ihnen das Zimmer zeigen.« Lilou trug abgeschnittene Jeans, bei denen die Taschen ein Stück unter den ausgefransten Hosenbeinen hervorblitzten. Über ihr pinkfarbenes Bikinioberteil hatte sie ein weites Hemd gezogen. Lilou umrundete den Wagen und stieg ein.
»Wir müssen einmal um den Brunnen und dann bei dem blauen Zaun rechts. Sind nur ein paar Minuten bis zum Haus.« Lilou hatte ihre Flip-Flops abgestreift und stemmte ihre nackten Füße gegen das Armaturenbrett. Sie nahm das T-Shirt vom Sitz, hielt es mit spitzen Fingern hoch und betrachtete das Motiv mit dem nackten Frauenhintern.
»Sehr hübsch«, sagte sie.
»Ist nicht von mir«, Leon war die Sache peinlich. »Muss der Kerl vergessen haben, der den Wagen vor mir gemietet hat.« Leon erntete einen skeptischen Blick.
»Und Sie sind Arzt?«, Lilou warf das T-Shirt auf die Rückbank.
»Gerichtsmediziner.«
»Echt? So wie im Fernsehen?«
»Du darfst nicht alles glauben, was du im Fernsehen siehst.«
»Jetzt rechts. Rechts! Hier … oh, Mann«, Lilou deutete auf eine schmale Lücke zwischen zwei Häusern.
Leon riss das Steuer nach rechts und schoss in die enge Gasse, die das kleine Auto zu verschlingen schien. Der Fiat stolperte über das Kopfsteinpflaster. Zwischen Außenspiegel und Wand blieben keine zehn Zentimeter. Leon hielt das Steuer fest, jetzt nur nicht anhalten. Nach fünfzig Metern stieß die Gasse auf eine Straße, die sich durch Gärten bergauf schlängelte. Leon wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn.
»Ist ne echte Abkürzung«, meinte Lilou. »Ich wusste, dass das Auto durchpasst.«
»Eine Expertin also.« Leon sah zu dem Mädchen, die sich ihre blonden Haare um den Finger wickelte.
»Sie hocken also im Keller und schnippeln an toten Leuten rum.«
»So ähnlich.«
»Wie eklig ist das denn?« Lilou schüttelte den Kopf, als müsste sie diese schreckliche Vorstellung gleich wieder loswerden. »Da vorne, das Haus mit den blauen Läden, das ist unseres.«
Leon hielt vor einem gepflegten provenzalischen Haus, das am Hang lag und dessen Straßenseite von einer Mauer eingefasst war. Lilou ging voraus. Im Inneren des Hauses war es trotz der Hitze angenehm kühl. Vom Erdgeschoss aus erreichte man eine kleine, schattige Terrasse, die von einer prächtigen Bougainvillea eingeschlossen war.
Das Gästezimmer lag im ersten Stock, der Blick aus dem Fenster ging über den Ort, und als Leon sich etwas herauslehnte, konnte er sogar einen Zipfel des Hafens mit den Booten sehen. Es gab einen kleinen Schreibtisch, ein breites Bett, einen Schrank und einen Stuhl mit einer Sitzfläche aus Bastgeflecht. An der Wand hing ein Werbeplakat aus den 70ern: ein Strand und am Horizont eine Segelyacht hart am Wind.
»Hier geht’s zum Bad«, sagte Lilou und öffnete eine Tür. »Ist zwar nur ne Dusche, aber ein Klo gibt’s natürlich auch. Ganz für Sie alleine. Manchmal läuft’s nicht richtig ab. Dann müssen Sie noch mal spülen.« Leon sah das Mädchen an.
»Danke für den Tipp«, sagte Leon.
»Mama und ich haben das große Bad am Ende vom Gang. Ich lass Sie dann mal.« Lilou verschwand.
Das ganze Ambiente wirkte abgewohnt, aber es verströmte gleichzeitig einen liebenswerten, altmodischen Charme. Eine Mischung aus Rumpelkammer und Familienpension. Leon klappte den Koffer auf und stapelte seine Hemden im Schrank. Dabei achtete er darauf, dass die kurzärmeligen und langärmeligen Hemden getrennt nebeneinander lagen. Bevor er die Schranktür schloss, rückte er den Stapel noch einmal zurecht. Anschließend baute er seine Waschsachen auf der gläsernen Ablage über dem Waschbecken auf. Mit dem Handtuch wischte er durch das Zahnputzglas, dann fuhr er mit der Fingerspitze über den Spiegelschrank. Das Bad war vielleicht nicht das Neueste, aber alles war aufgeräumt und sauber. Leon betrachtete sein Gesicht im Spiegel. Mit dem Finger zog er ein Augenlid herunter und betrachtete aufmerksam seine braune Iris. Dann öffnete er eine seiner Pillendöschen und schluckte eine der kleinen, weißen Magnesiumtabletten. Er sollte eigentlich Uwe anrufen, wegen der Werte. Dr. Uwe Winterberg war sein Urologe, zu dem er regelmäßig zur Vorsorge ging. Beim letzten Test hatte es da eine kleine Auffälligkeit bei seinen Blutwerten gegeben. Nichts »Aufregendes« hatte Uwe gemeint, aber man sollte den Test lieber wiederholen, nur zur Sicherheit. Seitdem hatte Leon nichts mehr von Uwe gehört. Das war jetzt fast eine Woche her. Uwe würde sich doch melden, wenn da was wäre, oder wollte er ihm die erschreckende Diagnose ersparen?
Leon hielt sich nicht für hypochondrisch, eher für vorsichtig. War das ein Wunder? Schließlich waren die meisten Opfer, die er in der Gerichtsmedizin auf den Tisch bekam, eines natürlichen Todes gestorben: Nikotin, Alkohol, Stress und ungesunde Ernährung, das waren die wirklichen Killer unserer Zeit. Leons Vater hatte mit 82 der Prostatakrebs umgebracht, er war nie zur Vorsorge gegangen. Nein, Leon war kein Hypochonder, er achtete nur aufmerksam auf die Vorzeichen.
Als er alles eingeräumt hatte, ging Leon noch einmal zu seinem Koffer, öffnete den Reißverschluss an der Innenseite und nahm ein Foto im Holzrahmen heraus. Das Bild zeigte ihn in einem Garten. Eine auffallend attraktive Frau hatte ihm von hinten liebevoll die Arme um die Brust gelegt, sich an ihn gedrängt und schaute lächelnd über seine Schulter in die Kamera. Die widerspenstigen roten Locken fielen ihr ins Gesicht. Leon sah das Foto an und stellte es auf den Nachttisch. Er hatte Lilou nicht kommen gehört.
»Ihre Frau?«, fragte Lilou und betrachtete das Foto.
Leon fuhr herum. »Kann man das Wasser aus der Leitung trinken?«
»Zurzeit besser nicht. Ist zu heiß. Da kommen Salmonellen und so’n Zeug in die Leitungen – haben sie in der Schule gesagt. Aber wir haben Cola im Kühlschrank, wollen Sie eine?«
Einen Moment später saß Leon mit einer kalten Cola auf einem zerschlissenen, aber umso gemütlicheren Korbstuhl auf der Terrasse und sah über die Gärten und Dächer auf das Mittelmeer, das unter ihnen lag und in der Nachmittagssonne glitzerte. Zwischen den roten Blüten der Bougainvillea schwirrten die Insekten.
4. KAPITEL
Das kleine Mädchen in seinem pinkfarbenen Jogginganzug sah aus, als würde es schlafen. Es lag im Laub zwischen den Felsen, den Kopf mit den blonden Haaren auf einem Polster von Sonnenröschen. Das Kind bewegte sich nicht. Kopf und Hals wurden von wilden Lavendelsträuchern überschattet, aber die Hände und die nackten Füße des Mädchens hatten in der glühende Sonne böse Verbrennungen abbekommen.
Der Mann beobachtete das Mädchen eine Weile aus sicherer Entfernung. Dann lief er einen weiten Bogen und näherte sich dem Kind von hinten. Dabei nutzte er die Deckung der dichten Ginsterbüsche und wilden Rosmarinsträucher. Immer wieder blieb er stehen und beobachtete seine Umgebung, wie ein Raubtier, das sicher sein will, dass ihm kein anderer die Beute streitig macht. Aber hier, in den heißen, trockenen Hügeln des Massif des Maures war der Mann ganz alleine. Er zog den Schirm seiner Baseballkappe tiefer ins Gesicht. Der Schweiß hatte den Stoffrand der Mütze dunkel gefärbt und hinterließ feuchte Spuren auf Schläfen und Nacken.
Direkt hinter dem Mädchen blieb der Mann stehen. Der Blick auf das Kind ließ ihn die Hitze und alle Anstrengungen der letzten Stunden vergessen. Er lächelte, das Schicksal meinte es gut mit ihm.
Der Mann kniete hinter dem Mädchen nieder. Ganz vorsichtig streckte er die Hand aus. Als er mit den Fingerspitzen ihren Nacken berührte, begann er heftig zu atmen. Er wusste, er sollte sich zusammennehmen, sich zurückhalten, aber er spürte, wie eine unbändige Gier ihn ergriff wie eine böse, schwarze Wolke …
5. KAPITEL
Der Weg vom Haus der Morells in den Ortskern führte durch Gärten von Feigen- und Orangenbäumen. Leon hatte Madame Morell am Telefon nicht erreichen können, also beschloss er, die Polizistin kurz in ihrem Büro aufzusuchen, um zu sagen, dass er das Zimmer nehmen würde. Trotz der Hitze ließ Leon den kleinen Fiat beim Haus stehen und ging zu Fuß hinunter in den Ort. Der Weg überquerte die Avenue de Provence und endete am Platz mit dem Gefallenendenkmal.
Vor dem steinernen Obelisken saß ein Mann im Rollstuhl. Er war Ende sechzig, hatte den Kopf glattrasiert und trug an seiner Armeejacke die flammende Lilie, das Abzeichen der Fremdenlegion. Der Mann betrachtete stumm die Namen der Widerstandskämpfer, die mit goldenen Buchstaben in schwarzen Marmor eingraviert waren, dann rollte er aus der glühenden Sonne langsam in Richtung Schatten. An einer Steinschwelle rutschte das äußere Rad vom Weg und versank einige Zentimeter in den Rabatten, die das Denkmal umgaben. Der Rollstuhl war blockiert. Der Mann fluchte und zerrte an den Rädern, vergeblich.
Leon beobachtete ihn. Der Mann bewegte sich schnell in seinem Stuhl. Vielleicht war er mal Boxer oder Ringer gewesen, dachte Leon. Aber jetzt war er nur noch ein alter Mann, der laut fluchte, weil ihn in der glühenden Sonne die Kräfte verließen.
Mit ein paar Schritten war Leon bei ihm. »Kann ich Ihnen helfen?« Er fasste nach den Griffen des Rollstuhls.
»Nein!« fuhr ihn der Mann an. Leon zögerte. Doch dann schien der Mann es sich anders zu überlegen. »Na los, ziehen Sie schon.«
Leon kippte den Stuhl nach hinten und zog ihn dann mit einem kurzen Ruck über die scharfkantige Schwelle in den Schatten einer Platane. »Hier ist es besser«, sagte Leon.
»Schon gut, lassen Sie los«, der Mann griff zu den Radringen und richtete seinen Rollstuhl aus. »Das mach ich selber.«
»Sie waren bei der Fremdenlegion?«
Der Mann im Rollstuhl brummelte etwas, dann betrachtete er Leon. »Sie sind nicht von hier … Deutschland?«
»Mein Akzent, ich weiß«, Leon stellte sich vor den Mann, damit der nicht den Kopf nach ihm verdrehen musste.
»Mein Vater ist im Krieg von den Deutschen abgeknallt worden«, sagte der Mann und deutete auf das Denkmal. »Da steht sein Name: Pasqual Suchon.«
»Tut mir leid, das zu hören.«
»Und den hier«, er klopfte mit beiden Händen auf die Lehnen des Rollstuhls, »verdanke ich auch einem boche.«
Boche war eigentlich eine Beleidigung, aber sie stammte aus einer anderen Zeit. So hatten die Franzosen die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg genannt. Leons Onkel im Elsass hatte den Ausdruck manchmal benutzt.
»Ein Arschloch von Tourist hat mich zusammengefahren, mit seinem beschissenen BMW, können Sie sich das vorstellen? Hat mich auf dem Fahrrad erwischt. Was für eine gewaltige Scheiße.«
»Welcher Wirbel?«, fragte Leon und musterte den Mann mit professionellem Blick.
»Aha, der Monsieur ist vom Fach«, der Mann sah Leon an, »nein, verdammt, nur die Beine. 21 Mal gebrochen. 21 Mal, und das Becken noch dazu. Elf Operationen. Schrauben, Platten und Nägel. In mir steckt mehr Blech als in meinem Peugeot.«
»Können Sie sie bewegen?«, Leon sah auf die Beine des Mannes.
»He, ich kann immer noch im Stehen pissen, wenn Sie das meinen. Aber wenn es so heiß ist, geht mit Laufen gar nichts mehr. Vor ein paar Jahren, da bin ich noch mit dem Rad bis St. Tropez gefahren, hin und zurück, an einem Tag. Aber heute, bordel de cul«.
»Ich kann Sie ein Stück schieben«, sagte Leon.
»Was soll das werden? So ne Art Wiedergutmachung?« Er sah Leon provozierend an, der lächelte nur freundlich. »Na gut. Wenn Sie einen Rosé im Miou spendieren, vergesse ich die Sache mit den Deutschen.« Leon hatte die Griffe des Rollstuhls gepackt. Der Veteran streckte ohne sich umzusehen die Hand nach hinten. »Jean-Claude.«
Leon ergriff die Hand. »Leon. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.«
»Jetzt werden Sie nicht gleich sentimental.« Der alte Mann deutete in Richtung einer kleinen Treppe. »Da runter, allez hopp Fritz, ist nur eine Treppe.«
Leon kippte den Rollstuhl und ließ ihn vorsichtig Stufe für Stufe nach unten rollen.
6. KAPITEL
Isabelle sah den Eltern der kleinen Carla hinterher, wie sie die Polizeiinspektion verließen und die Stufen zur Avenue Paul Valéry hinuntergingen. Der Mann griff nach der Hand seiner Frau, und diesmal zog sie sie nicht zurück. Die beiden würden schon bald wieder hier sein. Hoffentlich könnte sie ihnen dann ihr Kind unversehrt übergeben, dachte Isabelle, während sie zurück in ihr Büro ging. Nicht zu wissen, wo das eigene Kind ist, musste ein Alptraum sein.
»Isabelle.« Polizeichef Thierry Zerna war im Flur aufgetaucht und klang übellaunig. Zerna war 45 und nach einigen erfolglosen Jahren bei der Polizei in Toulon hatte man ihn nach Le Lavandou zurückversetzt. Der Polizeichef tat so, als wäre der Posten für ihn die Erfüllung seiner Träume, aber alle Kollegen wussten, dass er die Versetzung als tiefe Demütigung empfand.
Zerna bekämpfte seinen Frust mit einem knallharten Fitnessprogramm. Er war stolz auf seinen Körper. In der Umkleide achtete er darauf, dass die Kollegen seinen Body sehen konnten. Er hatte jede Menge Muskeln aufgebaut. Aber das änderte nichts an der Tatsache, dass er O-Beine hatte und nur 1,72 Meter groß war. Darüber täuschten weder die Cowboystiefel mit den extrahohen Absätzen hinweg, noch die kurzärmeligen T-Shirts, die er immer eine Nummer zu klein trug, damit sein Bizeps besser zur Geltung kam.
Seit Isabelle und ihr Mann Anthony sich vor zwei Jahren getrennt hatten, versuchte Thierry bei der attraktiven Kollegin zu landen, war aber bisher auf Granit gestoßen.
Isabelle hatte sich eine kurzärmelige Bluse über die Jeans gezogen. Es war heute einfach zu heiß für die Uniform. Bei den anderen würde Zerna einen solchen Regelverstoß nicht durchgehen lassen, aber bei Isabelle machte er eine Ausnahme. Gleichzeitig hasste er sich dafür, dass er ihr diesen Fehler durchgehen ließ, denn er ahnte, dass ihn seine Nachsicht dem Ziel seiner Begierde keinen Millimeter näher bringen würde. Aber das könnte er sich niemals eingestehen.
Thierry tat so, als musterte er seine Stellvertreterin kritisch. Isabelle wusste genau, dass er ihr dabei in Wirklichkeit auf die Brüste schielte, aber sie ignorierte den Blick.
»Haben wir irgendwas Neues über das deutsche Mädchen?«, fragte Zerna, während er sich einen Café crème aus dem Automaten laufen ließ, der in der kleinen Teeküche am Ende des Ganges stand.
Isabelle brachte ihren Chef auf den letzten Stand. Bisher gab es keinerlei Spuren, aber sie waren dabei, eine Suchmannschaft zusammenzustellen. Zerna wollte auf jeden Fall noch den Nachmittag abwarten, falls die Kleine von selber wieder aufkreuzte. Er hatte keinen Bock, seine Leute umsonst loszuschicken.
»Hör dich auf dem Campingplatz um.«
»Darum kümmert sich Moma schon.«
»Nein, geh selber hin. Die Leute reden nicht gerne mit einem … du weißt schon«, Thierry unterbrach sich. »Irgendjemand hat immer etwas gesehen.«
»Das Mädchen ist schon seit über zwölf Stunden verschwunden!«
»Das können wir nicht mit Sicherheit sagen, oder?« Isabelle sah ihren Chef verärgert an. »Schon gut, aber was ich auf keinen Fall brauch, ist ein zweiter Fall Dupont.«
»Der Junge war immerhin unversehrt.«
»Eben, und um das rauszufinden, hast du über 30 000 Euro Steuergelder verballert.« Thierry nahm die Tasse und ging in Richtung seines Büros.
»Jetzt tu bloß nicht so, als hättest du’s bezahlen müssen.« Isabelle hatte den letzten Satz ihrem Chef hinterhergerufen. Du Arsch, dachte sie.
Pascal Dupont war ein sechsjähriger Junge gewesen, der vor fünf Jahren aus einem Hotel in Le Lavandou verschwunden war. Isabelle hatte damals sofort eine aufwendige Suchaktion gestartet, an der sich Polizei, Feuerwehr und sogar ein Militärhubschrauber beteiligt hatten. Bis sich nach 24 Stunden herausstellte, dass das Kind von einer Tante im Hotel abgeholt worden war und quietschvergnügt in St. Tropez am Stand saß.
Okay, Isabelle hatte damals vielleicht etwas vorschnell reagiert, was soll’s. Noch lange kein Grund für Zerna, ihr die Geschichte bei jeder Gelegenheit wieder aufs Brot zu schmieren, nur weil sie sich weigerte, mit ihm ins Bett zu gehen.
»Vorne wartet jemand auf dich.« Moma war im Gang aufgetaucht. »Der Typ ist aus Deutschland, glaub ich.«
»Jemand vom Campingplatz?«
»Hat er nicht gesagt, wollte nur mit dir sprechen.« Moma hob vielsagend die Hände.
»Für so was hab ich jetzt wirklich keine Zeit.«
Isabelle ging mit schnellem Schritt den Gang entlang, und dann sah sie ihren Besucher. Leon stand entspannt im Flur und schien neugierig das Treiben der Polizeibeamten zu beobachten, so wie ein Forscher Insekten betrachtet. Und obwohl er allen im Weg stand, beschwerte sich niemand. Als besäße er eine unaufdringliche Präsenz, die von allen sofort akzeptiert wurde.
Eine Frau von der Verkehrspolizei lächelte dem Mann im Vorbeigehen zu, wie einem alten Bekannten. Der Besucher nickte schüchtern, als wäre ihm so viel Aufmerksamkeit unangenehm, und schien sich im gleichen Moment auf die Broschüren der Polizei zu konzentrieren, die neben ihm auf einem kleinen Ständer lagen: »Sicher durch den Urlaub – Tipps Ihrer Polizei«. Er schob die Flyer zu einem akkuraten Stapel zusammen und richtete ihn so aus, dass man die Überschrift auf den ersten Blick erfassen konnte.
Der Besucher hatte für Isabelle etwas Verletzliches, wie er so dastand. Jemand dem man sich anvertrauen, aber den man gleichzeitig beschützen wollte. Er wirkte lässig in seiner hellen Leinenhose und dem sportlichen Hemd. Nicht das übliche Urlaubs-Outfit, mit dem die Touristen sonst auf der Wache auftauchten. Keine Bermudashorts oder grellgemusterten T-Shirts, in denen die meisten Männer aussahen wie zu groß geratene Schuljungen.
Isabelle sah den Besucher an. Von ihm ging eine Schwingung aus, die bei ihr ein Gefühl auslöste, das sie fast vergessen hatte. Dir fehlt eindeutig ein Kerl, Isabelle, dachte sie und grinste in sich hinein und war im nächsten Moment wieder ganz die routinierte Polizistin.
7. KAPITEL
Leon erkannte Isabelle sofort. Der schmale, leicht gebogene Nasenrücken, der dem Gesicht etwas Orientalisches verlieh, und dazu die blauen Augen. Genau wie bei der Tochter, dachte er. Neugieriger Blick, energischer Schritt, aber kontrolliert. Koordinierte Bewegungen. Eine Frau, die gelernt hatte, sich in einer Männerwelt zu behaupten. Vielleicht ein bisschen arrogant, aber schlau. Dazu kurze, dunkle Haare, die sie strenger erscheinen lassen sollten, als sie in Wirklichkeit war – definitiv nicht sein Typ, aber interessant. Isabelle war vor ihm stehen geblieben.
»Madame Morell?«, sagte er. »Leon Ritter. Ihre Tochter war so nett und hat mir das Zimmer gezeigt.«
»Doktor Ritter, der Gerichtsmediziner aus Deutschland? Meine Tochter war ja ganz begeistert von Ihnen.«
»Weil sie denkt, dass alle Gerichtsmediziner so wären wie die, die man im Fernsehen sieht.«
»Ach, und sind sie das nicht? Enttäuschen Sie mich nicht.«
»Ich wollte Ihnen nur sagen, ich würde das Zimmer gerne nehmen.« Leon war überrascht von Isabelles spöttischer Art, »das heißt, eigentlich bin ich schon eingezogen.«
»Voilà, ein Monsieur, der Fakten schafft«, Isabelle lächelte frech. »Leider kann ich Ihnen keinen Kaffee anbieten. Wir haben im Moment alle Hände voll zu tun.«
»Es wäre nur für eine Woche. Danach hat die Klinik eine Wohnung für mich.«
»Isabelle«, Moma unterbrach das Gespräch, das Handy am Ohr, »ich hab den Campingplatz dran. Die wollen ihre Gäste nicht länger hinhalten.«
»Sag ihnen, wir sind in zehn Minuten da«, sagte Isabelle, »und keiner reist ab, bevor wir nicht mit ihm geredet haben.«
»Ich kann auch später noch mal vorbeikommen«, Leon sah die Polizistin an. »Ich wollte nur von Ihnen wissen, ob das mit der ganzen Woche okay ist?«
»Ja, ja. Lilou sagt Ihnen, wo Sie alles finden«, Isabelle wurde von etwas abgelenkt und sah in Richtung Eingang.
Durch die Glastür war ein großer Mann hereingekommen. Er wirkte nervös und sah sich unsicher um. Trotz des sommerlichen Outfits war sofort zu erkennen, dass er teure Markenklamotten trug. Lieutenant Didier Masclau stellte sich dem Besucher in den Weg. Das war sein Auftritt. Doch der Besucher beachtete ihn gar nicht und ging einfach weiter.
»Ich muss Commandant Zerna sprechen. Jetzt gleich.« Als der Mann sich an Didier vorbeidrängen wollte, griff der nach seinem Arm.
»Das geht aber so nicht.«
»Was soll das? Nehmen Sie auf der Stelle Ihre Hand da weg«, sagte der Besucher im empörten Ton eines Mannes, der es nicht gewohnt war, sich mit Menschen wie Polizist Masclau auseinanderzusetzen.
Leon erkannte den Besucher mit einem Blick, wenn er ihm auch älter als auf den Fotos in Le Monde vorkam. Leon hatte erst kürzlich einen Artikel über ihn gelesen: Jean-Baptiste Duchamp, geschätzt Anfang fünfzig. Laut Zeitung galt Duchamp als schrullig. Er war einziger Erbe der Supermarktkette Marché Sud und damit letzter Spross einer der reichsten Familien des Landes. Der Multimillionär lebte angeblich zurückgezogen in der alten Familienvilla auf Cap Nègre, keine zehn Autominuten von Le Lavandou entfernt. Es hieß, er kümmerte sich dort um seine neunzigjährige Mutter. Für das Unternehmen hatte er sich angeblich nie interessiert. Eine Privatbank in Paris verwaltete sein beachtliches Vermögen, von dem er gelegentlich größere Summen an soziale Einrichtungen spendete.
Isabelle war Duchamp gelegentlich bei offiziellen Veranstaltungen in Le Lavandou begegnet, wo er sich gerne als Sponsor hervortat. Sie hatte ihm ein paarmal die Hand geschüttelt, aber er hatte es nie für nötig befunden, auch nur ein Wort mit ihr zu wechseln. Dass er jetzt bei der Polizei auftauchte, war mehr als ungewöhnlich.
»Schon gut, Didier!«, rief Isabelle dem Polizisten zu, »das ist Monsieur Duchamp.« Der Polizist ließ den Arm des Besuchers erschrocken los, als würde der unter Strom stehen. »Entschuldigen Sie, Monsieur. Ich hatte Sie nicht gleich erkannt. Was für eine Unaufmerksamkeit, absolut mein Fehler.«
»Monsieur Duchamp, Capitaine Morell«, Isabelle reichte dem Besucher die Hand. »Kann ich etwas für Sie tun?« Für einen Moment sah Duchamp die Hand an, ignorierte aber die Begrüßung.
Leon beobachtete Duchamp, der jetzt seine Hände zu Fäusten geballt an den Körper gezogen hatte, wie jemand, der darauf wartete, sich verteidigen zu müssen.
»Ich glaube, es ist ein Mädchen.« Er wirkte verstört.
»Ein Mädchen? Welches Mädchen, Monsieur?«, Isabelles Stimme klang alarmiert.
»Ich hab sie zufällig entdeckt, ganz zufällig.« Duchamp schien in sich hineinzuhorchen, als müsste er nach einer korrekten Beschreibung suchen für das, was er Capitaine Morell sagen wollte. »Wir waren unterwegs. Ich und Régine, am Col de Landon, oben, gleich bei der Route des Crêtes … Régine ist mein Hund.«
»Was ist mit diesem Mädchen?«, wiederholte Isabelle. Duchamp schien durch sie hindurchzusehen.
»Sie ist tot«, sagte er.
8. KAPITEL
Die Wildschweine waren über die Leiche der kleinen Carla hergefallen. Ein Arm war der Länge nach aufgerissen und aus dem Gelenk gedreht. Am rechten Unterschenkel fehlte so viel Fleisch, dass man den blanken Knochen sehen konnte, und auch am Hals gab es tiefe Wunden und Risse.
Leon war neben dem toten Kind in die Hocke gegangen und betrachtete den geschundenen Körper. Das Mädchen trug einen Ohrring aus Plastik in Form eines kleinen Delphins. Leon fiel auf, dass der linke Ohrring fehlte. Ein kleines harmloses Detail, als würde sein Verstand versuchen, in all dem blutigen Schrecken etwas Normales zu finden. Neben dem Körper zwischen den Steinen lag eine vertrocknete Kröte. Isabelle, die hinter Leon stand, musste sich abwenden. Sogar den hartgesottensten älteren Polizeikollegen drehte sich beim Anblick des toten Kindes der Magen um. Leon legte ein Tuch über das Gesicht des Mädchens.
Das hier war kein Platz, an den sich ein kleines Mädchen verirren würde. Die Sandalen des Kindes waren außerdem fast neu und sauber. Einer der Schuhe war vom Fuß gerutscht, an dem auch die Socke fehlte. Von den blutigen Bissspuren abgesehen, wirkte der Jogginganzug auch nicht gerade so, als hätte das Mädchen sich damit durch das Unterholz kämpfen müssen. Leon zog sich die Latexhandschuhe an und untersuchte vorsichtig die tiefen Bisswunden am Bein der Toten.
Die Temperatur in der Senke zwischen den Hügeln des Massif des Maures lag auch jetzt noch, am späten Nachmittag, bei über 35 Grad. Den Polizeibeamten lief der Schweiß in Strömen herunter. Die Vegetation knisterte vor Trockenheit. Rotbrauner Staub, fein wie Mehl, wirbelte durch die Luft.
Über den gedämpften Unterhaltungen der Polizisten hörte Leon noch ein anderes Geräusch, das Summen der Schmeißfliegen, die die Leiche umschwirrten. Sie hatten das Blut des Opfers über viele Hundert Meter weit gerochen. Hatten sich auf den Wunden niedergelassen und bereits ihre Eier abgelegt. Bei dieser Hitze war der Todeszeitpunkt eines Opfers sehr schwer zu bestimmen, aber auf die Schmeißfliegen war Verlass. Der Eiablage nach zu urteilen, lag die Kleine mindestens seit neun Stunden hier oben.
Die Lichtung war voller Menschen. Duchamp war mit Zerna etwa zehn Meter vor der Leiche stehen geblieben. Er sah nicht zu dem Opfer, sondern starrte auf den Boden.
»Sie sind uns eine große Hilfe, Monsieur Duchamp. Wirklich eine sehr große Hilfe.« Zerna wusste, dass die neugierigen Blicke der Zuschauer auf ihn und seinen prominenten Zeugen gerichtet waren. Jetzt konnte der Polizeichef zeigen, dass er sogar mit Multimillionären umzugehen verstand.
»Die Befragung ist eine reine Formsache. Ich könnte natürlich auch zu Ihnen in die Villa kommen.«
»Nein, ich komme in Ihr Büro. Neun Uhr?«
»Wann immer Sie wollen, Monsieur Duchamp. Neun Uhr passt gut.«
»Régine, mein Hund, sie hat gebellt und ist den Pfad hinaufgelaufen. Hat gebellt und gebellt.«
»Hunde haben eine sehr feine Nase«, sagte Zerna, der Hunde nicht leiden konnte.
»Ich wäre sonst wohl nie hier raufgekommen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen …«
»Natürlich, Monsieur Duchamp. Bis morgen, jemand kann Sie zu Ihrem Wagen begleiten.«
»Nein, nein, nicht nötig. Bis morgen.« Duchamp verschwand zwischen den Büschen in Richtung Straße.
Außer der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort. Und wie aus dem Nichts waren sogar einige Zuschauer an dem abgelegenen Platz aufgetaucht. Jeder versuchte den Eindruck zu erwecken, als wäre er beschäftigt, um doch immer wieder verstohlen zu dem Opfer und dem prominenten Zeugen hinüberzusehen. Nur Tony, der Fotograf, hatte sich in die erste Reihe gedrängt. Er hielt die Kamera über den Kopf und schoss ein Bild nach dem anderen, bis Zerna ihn verscheuchte.
Tony trug einen Pferdeschwanz, der nicht verbergen konnte, dass sich die Haare an seinem Hinterkopf schon lichteten. Die Sonnenbrille hatte er auf die Stirn geschoben und das Hemd weit aufgeknöpft, damit die goldene Kette auf seiner braungebrannten Brust besser zur Geltung kam. Seine Arme waren vom Handgelenk bis zur Schulter tätowiert. Normalerweise klapperte Tony abends mit seiner Nikon die Restaurants und Bars von Lavandou ab. Er machte den ganzen Sommer die ewig gleichen Bilder von verliebten Paaren und Eis leckenden Kindern, die sich die Leute dann am nächsten Morgen für sieben Euro pro Stück in seinem Fotoladen in der Rue Charles de Gaulle abholen konnten. Die Bilder von dem toten Mädchen würde er an den Var-Matin verkaufen.
Menschen sind wie Hyänen, dachte Leon, sie werden angezogen vom Geruch des Todes. Er betrachtete das tote Mädchen. Es lag zwischen den Wurzeln einer niedrigen Kiefer. Ganz offensichtlich hatten die Tiere den Körper hierhergezerrt. Es gab Schleifspuren im staubigen Boden und zahllose Fährten, sofern sie nicht schon von Polizisten und Gaffern zertrampelt worden waren.
Etwa vier Meter entfernt, versteckt zwischen den Wacholderbüschen, erkannte Leon eine große, flache Steinplatte. Gleich dahinter ragte ein etwa achtzig Zentimeter hoher Fels aus dem Boden, der am oberen Ende grob behauen war.
»Ist das prähistorisch?« Leon wandte sich an Isabelle.
»Ein Menhir«, sagte die Polizistin, »davon gibt’s jede Menge in den Hügeln. Es heißt, dass das Opferstätten waren, angeblich über 3000 Jahre alt.«
»Die Leute müssen hier verschwinden«, sagte Leon, »die zertrampeln alle Spuren.«
Mit ein paar scharfen Worten schickte Isabelle die neugierigen Touristen weg. Auch die Polizisten mussten für den Gerichtsmediziner den Platz um die Tote räumen.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.