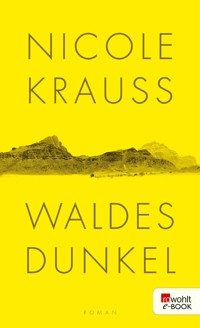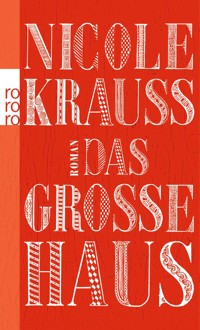
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Über Jahrzehnte jagt der jüdische Kunsthändler Georg Weisz den Habseligkeiten nach, die seiner Familie vor dem Abtransport ins KZ geraubt wurden. Besessen von dem Wunsch, das grauenvolle Geschehen seiner Kindheit ungeschehen zu machen, baut er in seinem Haus in Jerusalem das Zimmer seines Vaters genau so nach, wie er es aus dem Vorkriegs-Budapest in Erinnerung behalten hat. Der Schreibtisch jedoch fehlt. Es ist ein klotziges, Unglück verheißendes Möbelstück, und seine verschiedenen Besitzer – die New Yorker Schriftstellerin Nadia, der chilenische Student Daniel, die deutsche Holocaustüberlebende Lotte – geraten in einen Strudel von Ereignissen, die sie mit Liebe, Verlust und Tod konfrontieren. Nicole Krauss nimmt uns mit auf eine vertrackte Zeitreise in verschüttete Welten. Sie alle leuchten mit der Schärfe ihrer Erkenntnis, der Schönheit ihrer Bilder und der Prägnanz ihrer Kunst, die auslotet, was Sprache sagen kann – und wo sie letztlich schweigen muss. «Das große Haus» ist ein mitreißender Roman über die Gräuel und Schönheiten des 20. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Ähnliche
Nicole Krauss
Das große Haus
Roman
Über dieses Buch
Über Jahrzehnte jagt der jüdische Kunsthändler Georg Weisz den Habseligkeiten nach, die seiner Familie vor dem Abtransport ins KZ geraubt wurden. Besessen von dem Wunsch, das grauenvolle Geschehen seiner Kindheit ungeschehen zu machen, baut er in seinem Haus in Jerusalem das Zimmer seines Vaters genau so nach, wie er es aus dem Vorkriegs-Budapest in Erinnerung behalten hat. Der Schreibtisch jedoch fehlt. Es ist ein klotziges, Unglück verheißendes Möbelstück, und seine verschiedenen Besitzer – die New Yorker Schriftstellerin Nadia, der chilenische Student Daniel, die deutsche Holocaustüberlebende Lotte – geraten in einen Strudel von Ereignissen, die sie mit Liebe, Verlust und Tod konfrontieren.
Nicole Krauss nimmt uns mit auf eine vertrackte Zeitreise in verschüttete Welten. Sie alle leuchten mit der Schärfe ihrer Erkenntnis, der Schönheit ihrer Bilder und der Prägnanz ihrer Kunst, die auslotet, was Sprache sagen kann – und wo sie letztlich schweigen muss. «Das große Haus» ist ein mitreißender Roman über die Gräuel und Schönheiten des 20. Jahrhunderts.
Vita
Nicole Krauss, geboren 1974 in New York, studierte Literatur in Stanford und Oxford sowie Kunstgeschichte in London. Sie begann, Gedichte zu schreiben, und debütierte 2002 mit «Kommt ein Mann ins Zimmer» als Romanautorin. Mit ihrem zweiten Roman «Die Geschichte der Liebe» gelang ihr ein grandioser internationaler Erfolg. Er wurde in 35 Sprachen übersetzt und u. a. mit dem Prix du Meilleur Livre Étranger ausgezeichnet. Krauss ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Brooklyn.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel «Great House» bei Norton, New York.
Die Arbeit der Übersetzerin an diesem Text wurde mit einem Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds e.V. gefördert.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2011
Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Great House» Copyright © 2010 by Nicole Krauss
Covergestaltung Anzinger Wüschner Rasp, München, nach einem Entwurf von Jon Gray – gray318
ISBN 978-3-644-00921-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Sasha und Cy
Eins
Bitte aufstehen
Sprechen Sie mit ihm.
Euer Ehren, im Winter 1972 haben R und ich Schluss gemacht, oder besser gesagt, er hat mit mir Schluss gemacht. Seine Gründe waren unklar, aber es lief darauf hinaus, dass er ein zweites, ein heimliches Ich habe, ein feiges, verabscheuungswürdiges Ich, das er mir niemals zeigen könne, und dass er fortgehen müsse wie ein krankes Tier, bis er sich gebessert und auf einen Stand gebracht habe, auf dem er Gesellschaft verdiene. Ich habe mit ihm gerechtet – ich sei nun fast zwei Jahre seine Freundin, seine Geheimnisse seien meine Geheimnisse, wenn etwas Grausames oder Feiges in ihm wäre, müsste ich es ja wohl wissen –, aber es war sinnlos. Drei Wochen nachdem er ausgezogen war, bekam ich eine Postkarte (ohne Absender) von ihm, auf der stand, er habe das Gefühl, unsere Entscheidung, wie er es nannte, so hart sie auch sein möge, sei richtig gewesen, und ich musste mir eingestehen, dass unsere Beziehung endgültig vorbei war.
Dann wurde alles eine Weile schlechter, bevor es wieder besser wurde. Ich will das nicht weiter vertiefen, als indem ich sage, dass ich nicht mehr vor die Tür ging, nicht einmal zu meiner Großmutter, und ich ließ auch niemanden herein. Das Einzige, was half, war seltsamerweise, dass es draußen stürmte und ich unentwegt mit diesem komischen kleinen Schraubenschlüssel aus Messing, mit dem man die Bolzen an beiden Seiten der antiken Fensterrahmen festzieht, durch die Wohnung rennen musste – wenn die Halterungen sich nämlich bei windigem Wetter lockerten, quietschten die Fenster. Es gab sechs Fenster, und sobald ich die Bolzen an einem festgezogen hatte, fing es durch ein anderes an zu heulen, also rannte ich mit dem Messingschlüssel hin, und dann hatte ich vielleicht eine halbe Stunde Ruhe auf dem einzigen Stuhl, den es noch in der Wohnung gab. Eine Weile zumindest schien es, als bestünde die Welt nur aus diesem Dauerregen und der Notwendigkeit, die Bolzen festzuziehen. Als der Regen sich endlich verzog, machte ich einen Spaziergang. Alles war überflutet, und von diesem stillen, spiegelnden Wasser ging etwas Ruhiges aus. Ich wanderte lange, mindestens sechs oder sieben Stunden, durch benachbarte Viertel, in denen ich noch nie gewesen war und in die ich seither nie zurückgekehrt bin. Als ich nach Hause kam, war ich erschöpft, aber ich fühlte mich von etwas gereinigt.
Sie wusch das Blut von meinen Händen und gab mir ein sauberes T-Shirt, womöglich ihr eigenes. Sie hielt mich für Ihre Freundin oder gar für Ihre Frau. Bisher ist niemand für Sie gekommen. Ich werde nicht von Ihrer Seite weichen. Sprechen Sie mit ihm.
Nicht lange danach wurde Rs Flügel durch das große Wohnzimmerfenster hinaus und nach unten befördert, auf die gleiche Weise, wie er hereingekommen war. So verschwand das letzte Stück seiner Besitztümer und schuf Fakten, denn solange das Klavier da gewesen war, hatte es sich angefühlt, als wäre er nicht wirklich weg. In den Wochen, die ich allein mit dem Klavier lebte, bevor sie kamen, um es abzuholen, habe ich es manchmal im Vorbeigehen gestreichelt, genauso wie ich R gestreichelt hatte.
Ein paar Tage später rief mich ein alter Freund namens Paul Alpers an, um mir zu erzählen, was er geträumt hatte. In dem Traum waren er und der große Dichter César Vallejo in einem Haus auf dem Lande, das Vallejos Familie schon gehört hatte, als er noch ein Kind gewesen war. Es war leer, und alle Wände waren bläulich weiß gestrichen. Das Ganze machte einen sehr friedlichen Eindruck, sagte Paul, und im Traum habe er Vallejo glücklich geschätzt, sich zum Arbeiten an einen solchen Ort begeben zu können. Es sieht aus wie der Vorhof zum ewigen Leben, sagte Paul zu ihm. Vallejo hörte ihn nicht, und er musste es zweimal wiederholen. Schließlich verstand der Dichter, der in Wirklichkeit mit sechsundvierzig Jahren, genau wie von ihm selbst vorausgesagt, mittellos in einem Regensturm gestorben war, und nickte. Bevor sie das Haus betraten, hatte Vallejo Paul eine Geschichte erzählt, wie sein Onkel immer einen Finger in den Matsch tunkte, um sich ein Zeichen auf die Stirn zu machen – irgendwas mit Aschermittwoch. Und dann, sagte Vallejo (sagte Paul), machte er etwas, was ich nie verstanden habe. Zur Veranschaulichung tunkte Vallejo zwei Finger in den Matsch und malte Paul einen Oberlippenbart. Beide lachten. Den ganzen Traum hindurch, sagte Paul, sei das Erstaunlichste das heimliche Einvernehmen zwischen ihnen gewesen, als wären sie seit vielen Jahren miteinander vertraut.
Natürlich hatte Paul beim Aufwachen sofort an mich gedacht, denn wir kannten uns seit unserem zweiten Collegejahr aus einem Seminar über Avantgardedichter. Wir wurden Freunde, weil wir in den Veranstaltungen immer einer Meinung waren, während alle anderen uns widersprachen, mit wachsender Heftigkeit, je weiter das Semester voranschritt, und im Lauf der Zeit war zwischen Paul und mir ein Bündnis entstanden, das nach all den Jahren – mittlerweile fünf – noch spontan aufgegriffen und belebt werden konnte. Er fragte, wie es mir gehe, und spielte dabei auf die Trennung an, von der ihm jemand erzählt haben musste. Ich sagte, abgesehen davon, dass ich den Eindruck hätte, mir fielen womöglich die Haare aus, sei alles ganz okay. Ich erzählte ihm noch, dass außer dem Flügel auch das Sofa, die Stühle, das Bett und sogar das Essbesteck mit R verschwunden waren, da ich, als ich ihn kennenlernte, mehr oder weniger aus einem Koffer gelebt hatte, während er wie ein sitzender Buddha inmitten all der Erbstücke seiner Mutter thronte. Paul sagte, er wisse vielleicht jemanden, einen Dichter, den Freund eines Freundes, der nach Chile zurückgehen wolle und eine Herberge für seine Möbel brauchen könnte. Ein Anruf bestätigte, dass der Dichter, Daniel Varsky, tatsächlich ein paar Gegenstände hatte, von denen er nicht wusste, wohin damit, weil er sie für den Fall, dass er es sich anders überlegen und beschließen sollte, nach New York zurückzukehren, nicht verkaufen wollte. Paul gab mir seine Nummer und sagte, Daniel erwarte, dass ich mich bei ihm meldete. Ich schob den Anruf ein paar Tage hinaus, hauptsächlich, weil ich es irgendwie unangenehm fand, einen Fremden um seine Möbel zu bitten, auch wenn der Weg bereits geebnet war, und weil ich mich außerdem in dem Monat ohne R und seine vielen Besitztümer daran gewöhnt hatte, nichts zu haben. Probleme dämmerten mir nur, wenn doch mal jemand bei mir vorbeikam und ich im Gesicht meines Besuchs gespiegelt sah, dass es, von außen betrachtet, bei mir drinnen, Euer Ehren, erbärmlich auszusehen schien.
Als ich Daniel Varsky schließlich anrief, nahm er nach einem einzigen Klingeln ab. Es lag eine Vorsicht in dieser ersten Begrüßung, bevor er wusste, wer am anderen Ende der Leitung war, die ich später fest mit ihm und, so wenige mir auch begegnet sind, mit Chilenen überhaupt verbunden habe. Er brauchte eine Minute, um zu sondieren, wer ich war, eine Minute, bis ihm das Licht aufging, das mich als Freundin eines Freundes enthüllte und nicht als irgendeine Durchgeknallte, die anrief – wegen seiner Möbel? Sie habe gehört, er wolle die Sachen loswerden? Oder nur auf Leihbasis abgeben? –, eine Minute, in der ich mich fragte, ob ich mich nicht entschuldigen, auflegen und so weitermachen sollte wie bisher, mit nichts als einer Matratze, Plastikutensilien und dem einen Stuhl. Aber als ihm das Licht einmal aufgegangen war (Aha! Natürlich! Tut mir leid! Das steht alles hier und wartet nur auf Sie!), wurde seine Stimme sanfter und lauter zugleich, entfaltete eine Überschwänglichkeit, die ich bis heute ebenfalls mit Daniel Varsky und, im weiteren Sinne, mit allen verbinde, die jenem Dolch entsprungen sind, der auf das Herz der Antarktis zielt, wie Henry Kissinger einmal gesagt hat.
Er wohnte ziemlich weit entfernt, ein ganzes Stück uptown, an der Ecke 101st Street und Central Park West. Ich machte unterwegs Station, um meine Großmutter zu besuchen, die in einem Pflegeheim an der West End Avenue lebte. Sie erkannte mich nicht mehr, aber nachdem ich das verwunden hatte, fand ich wieder Spaß daran, mit ihr zusammen zu sein. Meistens setzten wir uns und redeten auf acht oder neun verschiedene Weisen über das Wetter, ehe wir zu meinem Großvater übergingen, der zehn Jahre nach seinem Tod immer noch ein Faszinosum für sie war, als würde sein Leben oder ihr gemeinsames Leben mit jedem Jahr seiner Abwesenheit ein umso größeres Rätsel. Sie liebte es, auf der Couch sitzend, die Empfangshalle zu bestaunen – Das alles gehört mir?, fragte sie in regelmäßigen Abständen, indem sie mit einer ausholenden Geste den ganzen Raum umschlang – und dabei sämtlichen Schmuck auf einmal zu tragen. Bei jedem Besuch brachte ich ihr einen Schokoladenbabka von Zabar’s mit. Sie aß jedes Mal ein Anstandshäppchen, der Kuchen krümelte auf ihren Schoß und klebte ihr an den Lippen, und sobald ich gegangen war, verschenkte sie den Rest an die Pflegerinnen.
In der 101st Street angelangt, ließ Daniel Varsky mich mit dem Summer herein. Während ich in dem schmuddeligen Eingang vor dem Aufzug wartete, kam mir plötzlich in den Sinn, dass ich seine Möbel vielleicht gar nicht mögen würde, dass sie dunkel oder sonst wie bedrückend sein könnten und es dann zu spät wäre, einen eleganten Rückzieher zu machen. Aber im Gegenteil, als er die Tür öffnete, war mein erster Eindruck Licht, so sehr, dass ich blinzeln musste und sein Gesicht einen Augenblick nur als Silhouette sah. Außerdem roch es nach etwas Gekochtem, das sich später als ein Auberginengericht entpuppte, dessen Zubereitung er in Israel gelernt hatte. Nachdem meine Augen sich angepasst hatten, entdeckte ich überrascht, dass Daniel Varsky jung war. Ich hatte jemand Älteren erwartet, da Paul gesagt hatte, sein Freund sei ein Dichter, und da wir uns selbst, obwohl wir beide Gedichte schrieben oder es jedenfalls versuchten, aus Prinzip nie Dichter nannten – die Bezeichnung Dichter behielten wir denen vor, deren Werke für veröffentlichungswürdig befunden worden waren, nicht nur in dieser oder jener obskuren Zeitschrift, sondern in einem richtigen Buch, das man in der Buchhandlung kaufen konnte. Rückblickend erscheint das als eine beschämend konventionelle Definition dessen, was unter einem Dichter zu verstehen sei, aber damals liefen Paul und ich und andere, die sich ihres hochentwickelten literarischen Feinsinns rühmten, noch mit ungebrochenen Ambitionen durch die Welt, und in gewisser Weise machten die uns blind.
Daniel war dreiundzwanzig, ein Jahr jünger als ich, und wenngleich er noch kein Buch mit Gedichten veröffentlicht hatte, schien er seine Zeit doch besser oder phantasievoller genutzt zu haben; vielleicht könnte man auch sagen, er war von einem Drang erfüllt, andere Orte kennenzulernen, Menschen zu treffen und Erfahrungen zu sammeln, der mich immer, wenn ich ihn bei irgendwem gespürt habe, neidisch gemacht hat. Er war die letzten vier Jahre herumgereist, hatte in allen möglichen Städten gelebt, auf dem Fußboden der Wohnungen seiner Bekanntschaften von unterwegs und manchmal, wenn er seine Mutter, oder vielleicht war es seine Großmutter, überreden konnte, ihm Geld zu überweisen, in eigenen Wohnungen, aber jetzt wollte er endlich nach Hause, um seinen Platz an der Seite jener Freunde einzunehmen, mit denen er aufgewachsen war, die in Chile für Befreiung, die Revolution oder zumindest den Sozialismus kämpften.
Die Auberginen waren fertig, und solange Daniel den Tisch deckte, sollte ich mich umschauen und mir die Möbel ansehen. Die Wohnung war klein, aber es gab ein großes Fenster nach Süden, durch welches das ganze Licht einfiel. Das Erstaunlichste an diesen Räumlichkeiten war das Durcheinander – Papiere überall auf dem Boden, kaffeeverschmierte Styroporbecher, Notizbücher, Plastiktüten, billige Gummischuhe, lose Schallplatten neben leeren Hüllen. Jeder andere hätte sich genötigt gefühlt, Entschuldigen Sie das Durcheinander zu sagen, oder etwas Witziges über den Durchzug einer Herde wilder Tiere, aber Daniel verlor kein Wort darüber. Die einzige mehr oder weniger freie Oberfläche boten die Wände, kahl bis auf ein paar angepinnte Pläne von Städten, in denen er gelebt hatte – Jerusalem, Berlin, London, Barcelona –, und an manche Straßen, Ecken oder Plätze hatte er Bemerkungen gekritzelt, die ich nicht so schnell verstand, weil sie auf Spanisch waren, doch es wäre wohl etwas unpassend gewesen, wenn ich den Hals gereckt und versucht hätte, sie zu entziffern, während mein Gastgeber und Wohltäter das Besteck auslegte. Also wandte ich mein Augenmerk der Einrichtung zu, oder dem, was ich unter dem Durcheinander davon sehen konnte – ein Sofa, einen großen Holztisch mit zahllosen Schubladen, manche größer, manche kleiner, ein zweiteiliges Bücherregal, vollgestopft mit Sachen auf Spanisch, Französisch oder Englisch, und das schönste Stück, eine Art Truhe oder Kiste mit Eisenbeschlägen, die aussah wie von einem gesunkenen Schiff gerettet und nun als Kaffeetisch nutzbar gemacht wurde. Er musste sich alles secondhand beschafft haben, kein Gegenstand wirkte neu, aber jeder einzelne hatte etwas Angenehmes in Einklang mit dem Ganzen, und die Tatsache, dass sie unter Papieren und Büchern erstickten, machte sie nur noch attraktiver. Plötzlich durchflutete mich ein Gefühl von Dankbarkeit gegenüber ihrem Besitzer, als gäbe er nicht ein paar Holz- und Polstermöbel an mich weiter, sondern die Chance zu einem neuen Leben, wobei er es mir überließ, die Gelegenheit zu ergreifen. Es ist mir peinlich zu sagen, aber mir schossen Tränen in die Augen, Euer Ehren, obgleich die Tränen, wie es oft so ist, älteren, dunkleren Gründen entsprangen, die ich verdrängt hatte und die durch das Geschenk, die Überlassung der Möbel eines Fremden, irgendwie aufgebrochen waren.
Wir müssen mindestens sieben oder acht Stunden geredet haben. Vielleicht länger. Wie sich herausstellte, liebten wir beide Rilke. Auch Auden mochten wir beide, ich allerdings mehr als er, und keiner von uns machte sich viel aus Yeats, aber beide hatten wir deswegen insgeheim Schuldgefühle, für den Fall, dass es eine Art persönliches Versagen in jenen Sphären verriet, in denen die Poesie lebt und etwas bedeutet. Die einzige Unstimmigkeit gab es, als ich auf Neruda zu sprechen kam, den einzigen chilenischen Dichter, den ich kannte, was Daniel mit einem Wutausbruch quittierte: Muss das sein?, fragte er. Immer dasselbe auf der ganzen Welt? Wohin ein Chilene auch gehen mag – Neruda war schon da mit seinem Muschelscheiß und hat ein Monopol errichtet. Er starrte mir in die Augen und wartete auf meinen Widerspruch; dabei überkam mich das Gefühl, es müsse dort, wo er herkam, gang und gäbe sein, so zu reden, wie wir redeten, und sogar über Dichtung mit leidenschaftlicher Heftigkeit zu streiten, und ich spürte einen Anflug von Einsamkeit. Aber nur kurz, dann sprang ich auf, um mich zu entschuldigen, und schwor hoch und heilig, die abgekürzte Liste großer chilenischer Dichter zu lesen, die er mir auf die Rückseite einer Papiertüte kritzelte (ganz oben, in Großbuchstaben, die den Rest überschatteten, stand Nicanor Parra), und ich schwor auch, dass mir der Name Neruda nie wieder über die Lippen kommen würde, weder in seiner noch in anderer Leute Gegenwart.
Dann sprachen wir über polnische Poesie, über russische Poesie, über türkische, griechische, argentinische Poesie, über Sappho und die verlorenen Notizbücher von Pasternak, über den Tod Ungarettis, den Selbstmord Weldon Kees’ und das Verschwinden Arthur Cravens, der Daniel zufolge noch am Leben war, in guten Händen bei den Huren von Mexico City. Aber manchmal, in der Senke oder Mulde zwischen einem ausschweifenden Satz und dem nächsten, zog eine dunkle Wolke über sein Gesicht, zögerte einen Augenblick, als wollte sie verweilen, und huschte dann vorbei, um sich hinten im Raum zu verflüchtigen, und in diesen Momenten hatte ich fast das Bedürfnis, mich abzuwenden, denn wir hatten zwar eine Menge über Poesie gesprochen, aber noch kaum etwas über uns selbst gesagt.
Irgendwann sprang Daniel auf und durchwühlte den Schreibtisch mit den vielen Schubladen, machte welche auf und welche zu, auf der Suche nach einem Gedichtzyklus, den er geschrieben hatte. Der Titel war Vergiss alles, was ich je sagte oder so ähnlich, und er hatte den Zyklus selbst übersetzt. Er räusperte sich und begann laut zu lesen, mit einer Stimme, die bei jemand anderem vielleicht affektiert oder sogar komisch gewirkt hätte, angehaucht von einem leichten Tremolo, aber aus Daniels Mund klang sie vollkommen natürlich. Er entschuldigte sich nicht, versteckte sich auch nicht hinter den Seiten. Ganz im Gegenteil. Er richtete sich wie ein Pfosten auf, als zöge er Kraft aus dem Gedicht, und hob häufig den Blick, so häufig, dass mir der Verdacht kam, er habe auswendig gelernt, was er geschrieben hatte. In einem dieser Momente, als wir uns bei einem Wort Auge in Auge trafen, wurde mir bewusst, dass er eigentlich recht gut aussah. Er hatte eine große Nase, eine große chilenisch-jüdische Nase, große Hände mit dünnen Fingern und große Füße, aber zugleich hatte er etwas Zartes an sich, das irgendwie von seinen langen Wimpern oder seinen Knochen kam. Das Gedicht war gut, nicht großartig, aber sehr gut, vielleicht sogar besser als sehr gut, das war schwer zu sagen ohne die Möglichkeit, es selbst zu lesen. Anscheinend ging es um ein Mädchen, das ihm das Herz gebrochen hatte, aber es hätte ebenso gut ein Hund sein können; auf halbem Weg verlor ich den Faden und begann daran zu denken, wie R jeden Abend seine kleinen Füße wusch, ehe er ins Bett ging, weil der Boden in unserer Wohnung schmutzig war, und wenn er mir auch nie sagte, ich solle meine waschen, war das stillschweigend inbegriffen, denn hätte ich es nicht getan, wäre das Bettzeug schmutzig geworden und sein eigenes Waschen vergeblich gewesen. Ich saß nicht gern auf dem Badewannenrand und konnte es erst recht nicht leiden, mit dem Knie am Ohr vor dem Waschbecken zu stehen, während der schwarze Dreck in das weiße Porzellan gespült wurde, aber es war eines der zahllosen Dinge, die man im Leben tut, um Streit zu vermeiden, und jetzt war mir beim Gedanken daran zum Lachen, oder zum Ersticken.
Mittlerweile wirkte Daniel Varskys Wohnung schummerig und aquatisch, die Sonne war hinter einem Gebäude versunken, und die hinter den Dingen verborgenen Schatten fluteten von überall her. Ich erinnere mich an einige sehr große Bücher in den Regalen, erlesene Bände mit hohen Stoffrücken. Ich habe die Titel nicht behalten, vielleicht gehörten sie zusammen, aber irgendwie schien es ein geheimes Einvernehmen zwischen ihnen und der Dämmerung zu geben. Es war, als wären die Wände seiner Wohnung plötzlich mit Filz bezogen wie die eines Kinos, damit kein Ton nach außen und kein anderer nach innen dringt, und in diesem Isolationsbecken, Euer Ehren, in dem, was an Licht übrig blieb, waren wir zugleich das Publikum und der Film. Oder als wären wir allein von der Insel abgeschnitten worden und trieben nun auf hoher See, in dunklen Wassern von unbekannter Tiefe. Ich galt damals als attraktiv, manche sagten sogar schön, obwohl ich immer schlechte Haut hatte, und genau das bemerkte ich, als ich in den Spiegel schaute, das und einen leicht verstörten Ausdruck, eine etwas gerunzelte Stirn, wie ich sie von mir nicht kannte. Aber bevor und auch während ich mit R zusammen war, gab es reichlich Männer, die klar zu verstehen gaben, dass sie gern mit mir nach Hause gehen würden, entweder für eine Nacht oder länger, und als Daniel und ich aufstanden, um ins Wohnzimmer zu gehen, fragte ich mich, was er wohl von mir dachte.
Dies war der Augenblick, in dem er mir erzählte, der Schreibtisch sei, wenn auch nur kurz, von Lorca benutzt worden. Ich wusste nicht, ob das ein Scherz sein sollte, es schien höchst unwahrscheinlich, dass dieser Weltenbummler aus Chile, jünger als ich, in den Besitz eines so kostbaren Gegenstands gelangt sein konnte, aber ich beschloss, ihn ernst zu nehmen, weil ich nicht riskieren wollte, jemanden zu beleidigen, der mir nur Freundlichkeit erwiesen hatte. Als ich fragte, wie er daran gekommen sei, zuckte er mit den Schultern und sagte ohne weitere Erklärung, er habe ihn gekauft. Ich dachte, er würde nun sagen: Und jetzt gebe ich ihn dir, aber das tat er nicht, er gab nur dem einen Bein einen kleinen Tritt, nicht grob, sondern liebenswürdig, voller Respekt, und ging weiter.
Entweder dann oder später küssten wir uns.
Sie spritzte eine neue Dosis Morphium in den Tropf und fixierte eine lockere Elektrode auf Ihrer Brust. Vor dem Fenster breitete sich die Dämmerung über Jerusalem. Einen Augenblick beobachteten sie und ich das grün flimmernde Auf und Ab Ihrer EKG-Kurve. Dann zog sie den Vorhang zu und ließ uns allein.
Unser Kuss war antiklimaktisch. Nicht dass es ein schlechter Kuss gewesen wäre, aber er war nur eine Interpunktion in unserem langen Gespräch, eine in Klammern gesetzte Anmerkung, um einander einer tiefempfundenen Übereinstimmung zu versichern, ein wechselseitiges Angebot, Gefährten zu sein, was so viel seltener ist als sexuelle Leidenschaft oder sogar Liebe. Daniels Lippen waren dicker, als ich erwartet hatte, nicht dick in seinem Gesicht, aber dick, als ich die Augen schloss und sie meine berührten, und den Bruchteil einer Sekunde hatte ich das Gefühl, sie würden mich ersticken. Aber das lag wohl eher daran, dass ich so an Rs Lippen gewöhnt war, dünne, nichtsemitische Lippen, die in der Kälte oft blau wurden. Mit einer Hand drückte Daniel Varsky meinen Oberschenkel, und ich berührte sein Haar, das roch wie ein schlammiger Fluss. Ich glaube, da hatten wir gerade oder nahezu den Sumpf der Politik erreicht, und Daniel Varsky fluchte, zuerst empört, dann fast am Rand der Tränen, über Nixon und Kissinger und ihre Sanktionen, ihre skrupellosen Machenschaften, mit denen sie versuchten, sagte er, alles abzuwürgen, was neu und jung und schön in Chile war, die Hoffnung, die den Doktor Allende den ganzen Weg hinauf in den Palast La Moneda getragen hatte. Lohnerhöhungen bis zu fünfzig Prozent, sagte er, und alle diese Schweine kümmern sich nur um ihr Kupfer und die Multinationalen! Schon beim Gedanken an einen demokratisch gewählten marxistischen Präsidenten scheißen sie sich in die Hosen! Warum lassen sie uns nicht in Ruhe, warum lassen sie uns nicht einfach weiterleben, sagte er, und eine Minute lang war sein Blick fast flehend oder beschwörend, als hätte ich irgendeine Macht über die Dunkelmänner am Steuer des schwarzen Schiffs aus meinem Land. Er hatte einen stark vorspringenden Adamsapfel, der bei jedem Schlucken in seiner Kehle tanzte, und jetzt schien er unentwegt zu tanzen, wie ein ins Meer geworfener Apfel. Ich wusste nicht viel über das, was in Chile vor sich ging, zumindest damals nicht, noch nicht. Eineinhalb Jahre später, nachdem Paul Alpers mir gesagt hatte, Daniel Varsky sei mitten in der Nacht von Manuel Contreras’ Geheimpolizei abgeholt worden, wusste ich es. Aber im Winter 1972, als ich im letzten Abendlicht in seiner Wohnung an der 101st Street saß, während General Augusto Pinochet Ugarte noch der steife, kriecherische Oberkommandierende des Heeres in Santiago de Chile war, der sich von den Kindern seiner Freunde anbiedernd Tata nennen ließ, wusste ich nicht viel.
Seltsamerweise kann ich mich nicht erinnern, wie die Nacht (mittlerweile war es schon eine gewaltige New Yorker Nacht) endete. Offenbar muss es so gewesen sein, dass wir uns verabschiedet haben und ich dann gegangen bin, oder vielleicht haben wir die Wohnung zusammen verlassen, und er hat mich zur Subway begleitet oder mir ein Taxi gerufen, da die Gegend, oder die Stadt überhaupt, damals nicht sicher war. Ich habe einfach keinerlei Erinnerung daran. Ein paar Wochen später hielt ein Umzugswagen vor meiner Wohnung, und die Männer luden die Möbel aus. Zu diesem Zeitpunkt war Daniel Varsky schon in seine Heimat Chile zurückgekehrt.
Zwei Jahre vergingen. Anfangs bekam ich Postkarten. Zuerst waren sie herzlich, ja gelöst: Alles bestens. Ich glaube, ich werde der Chilenischen Gesellschaft für Höhlenforschung beitreten, aber keine Bange, das wird mein dichterisches Streben nicht behindern, wenn überhaupt, werden sie einander befruchten. Vielleicht habe ich das Glück, mir einen Mathematik-Vortrag von Parra anzuhören. Politisch ist die Hölle los, wenn ich nicht zu den Höhlenforschern gehe, gehe ich zur MIR. Pass gut auf Lorcas Schreibtisch auf, eines Tages komme ich zurück und hole ihn ab. Besos, D.V. Nach dem Putsch wurden sie düster, dann kryptisch, und schließlich, ungefähr sechs Monate ehe ich erfuhr, dass er verschwunden war, kamen keine mehr. Ich habe sie alle in einer Schublade seines Schreibtischs aufbewahrt. Ich schrieb nicht zurück, weil es keine Adresse gab. In jenen Jahren habe ich noch Gedichte geschrieben, und ich schrieb einige an oder für Daniel Varsky. Meine Großmutter starb und wurde in irgendeinem Vorort so weit außerhalb begraben, dass niemand sie mehr besuchen konnte. Ich ging mit etlichen Männern aus, wechselte zweimal die Wohnung und schrieb meinen ersten Roman am Tisch von Daniel Varsky. Manchmal vergaß ich ihn monatelang. Ich weiß nicht, ob ich schon von der Villa Grimaldi wusste, mit ziemlicher Sicherheit hatte ich noch nichts von der Calle Londres 38 oder den Cuatro Álamos gehört, auch nicht von der Discoteca, die man wegen der dort verübten sexuellen Gräuel und der lauten Musik, die von den Folterern bevorzugt wurde, Venda Sexy nannte, aber auf jeden Fall wusste ich genug, dass ich zu anderen Zeiten, wenn ich, wie so oft, auf Daniels Sofa eingeschlafen war, Albträume darüber hatte, was sie ihm antaten. Manchmal schaute ich mich um, ließ den Blick über seine Möbel wandern, das Sofa, den Schreibtisch, den kleinen Kaffeetisch, die Bücherregale und Stühle, und war von niederschmetternder Verzweiflung erfüllt, manchmal empfand ich nur eine verdeckte Traurigkeit, und manchmal sah ich mir das alles an und war plötzlich überzeugt, dass es ein Rätsel enthielt, ein Rätsel, das er mir hinterlassen hatte und das ich lösen sollte.
Hin und wieder habe ich Leute getroffen, meistens Chilenen, die Daniel Varsky kannten oder von ihm gehört hatten. Nach seinem Tod erlangte er kurzen Ruhm, er zählte zu den Dichtern, die als Märtyrer gestorben waren, von Pinochet zum Schweigen gebracht. Aber natürlich hatten diejenigen, die Daniel gefoltert und getötet haben, nie seine Gedichte gelesen, womöglich wussten sie nicht einmal, dass er überhaupt welche schrieb. Ein paar Jahre nachdem er verschwunden war, fragte ich mit Paul Alpers’ Hilfe brieflich bei Daniels Freunden an, ob sie vielleicht noch Gedichte von ihm hätten, die sie mir schicken könnten. Ich hatte die Idee, sie irgendwo zu veröffentlichen, um ihm eine Art Denkmal zu setzen. Aber ich bekam nur einen Brief zurück, die kurze Antwort eines alten Schulfreundes, der mich wissen ließ, er habe nichts. Ich musste in meinem Brief etwas über den Tisch geschrieben haben, sonst wäre das Postskriptum allzu merkwürdig gewesen: Übrigens, stand da, möchte ich bezweifeln, dass Lorca diesen Schreibtisch je besessen hat. Das war alles. Ich legte den Brief in die Schublade zu Daniels Postkarten. Eine Zeitlang überlegte ich mir sogar, seiner Mutter zu schreiben, aber am Ende habe ich es nie getan.
Seitdem sind viele Jahre vergangen. Eine Zeitlang war ich verheiratet, aber jetzt lebe ich, nicht unglücklich, wieder allein. Es gibt Momente, in denen eine Art Klarheit über einen kommt, und plötzlich sieht man durch die Wände hindurch in eine andere Dimension, die man vergessen hatte oder bewusst ausklammern wollte, um mit den verschiedenen Illusionen, die das Leben, insbesondere das Zusammenleben möglich machen, weiterleben zu können. Und an dem Punkt war ich angekommen, Euer Ehren. Ohne die Ereignisse, die ich jetzt schildern will, wäre es wohl dabei geblieben, dass ich nicht mehr oder nur sehr selten an Daniel Varsky gedacht hätte, obwohl die Sachen immer noch in meiner Obhut waren, seine Bücherregale, sein Schreibtisch sowie die Truhe aus einer spanischen Galeone, Strandgut von einem Unfall auf hoher See, die einen kuriosen Kaffeetisch abgab. Das Sofa begann zu verrotten, wann, weiß ich nicht mehr, aber ich musste es wegwerfen. Manchmal war mir danach, auch das Übrige abzuschaffen. In gewissen Stimmungen erinnerte es mich an Dinge, die ich lieber vergessen wollte. So fragt mich gelegentlich ein Journalist, der mich interviewen will, warum ich keine Gedichte mehr schreibe. Entweder sage ich, meine Sachen seien einfach nicht gut, vielleicht sogar grässlich, oder ich sage, ein Gedicht habe immer das Potential zur Vollkommenheit, und das habe mich schließlich verstummen lassen; bisweilen sage ich auch, ich fühlte mich in den Gedichten, die ich zu schreiben versuchte, gefangen, was etwa so viel heißt wie zu sagen, man fühle sich im Universum gefangen oder in der Unvermeidlichkeit des Todes, aber nichts davon ist die Wahrheit darüber, warum ich keine Gedichte mehr schrieb, nicht annähernd, nicht wirklich; die Wahrheit ist, wenn ich es erklären könnte, würde ich vielleicht auch wieder welche schreiben. Anders gesagt, Daniel Varskys Schreibtisch, der im Verlauf von fünfundzwanzig Jahren mein Schreibtisch geworden war, erinnerte mich an diese Dinge. Ich hatte mich immer nur als vorübergehende Hüterin betrachtet und war davon ausgegangen, dass einmal der Tag kommen würde, an dem ich, wenn auch mit gemischten Gefühlen, von der Verantwortung befreit würde, mit den Möbeln meines Freundes, des toten Dichters Daniel Varsky, zu leben und über sie zu wachen, und dass ich dann frei sein würde umzuziehen, wohin ich wollte, vielleicht sogar in ein anderes Land. Es stimmt nicht ganz, dass die Möbel mich in New York gehalten hätten, aber wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich sie immer als Entschuldigung benutzt habe, all die Jahre geblieben zu sein, auch nachdem längst klargeworden war, dass es in dieser Stadt nichts mehr für mich gab. Und doch, als der Tag da war, warf er mein zuletzt einsames und ruhiges Leben vollständig aus der Bahn.
Es war 1999, Ende März. Ich saß arbeitend an meinem Schreibtisch, als das Telefon klingelte. Ich kannte die Stimme nicht, die am anderen Ende nach mir fragte. Kühl erkundigte ich mich. Im Lauf der Jahre hatte ich gelernt, mich abzuschirmen, nicht weil so viele Menschen versucht hätten, in meine Privatsphäre einzudringen (manche schon), sondern weil das Schreiben verlangt, mit so vielem achtsam und beharrlich zu sein, dass ein gewisser Unwille zur Verbindlichkeit a priori gegeben ist und auch auf Situationen überschwappt, in denen es nicht nötig wäre. Die junge Frau sagte, wir seien uns noch nie begegnet. Ich fragte nach dem Grund ihres Anrufs. Ich glaube, Sie kannten meinen Vater, sagte sie, Daniel Varsky.
Beim Klang seines Namens durchfuhr mich ein Schauder, nicht nur wegen des Schocks, zu erfahren, dass Daniel eine Tochter hatte, oder wegen der plötzlichen Erweiterung der Tragödie, an deren Rand ich so lange gelebt hatte, oder gar der Gewissheit, dass meine Obhutschaft ein Ende nahm, sondern auch, weil etwas in mir jahrelang auf einen solchen Anruf gewartet hatte und er nun, trotz der späten Stunde, gekommen war.
Ich fragte, wie sie mich gefunden habe. Ich habe beschlossen zu suchen, sagte sie. Aber wie kamen Sie darauf, mich zu suchen? Ich habe Ihren Vater nur einmal getroffen, und das war vor sehr langer Zeit. Durch meine Mutter, sagte sie. Ich hatte keine Ahnung, wen sie meinte. Sie sagte, irgendwann haben Sie ihr einen Brief geschrieben, ob sie noch Gedichte von meinem Vater habe. Wie auch immer, das ist eine lange Geschichte. Ich könnte sie Ihnen erzählen, wenn ich Sie sehe. (Natürlich würden wir uns sehen, sie wusste genau, dass ihr das, worum sie bitten wollte, nicht verwehrt werden konnte, und trotzdem, ihre Zuversicht warf mich um.) In dem Brief stand, Sie hätten seinen Schreibtisch. Haben Sie ihn noch?
Ich blickte durch den Raum auf den Holztisch, an dem ich sieben Romane geschrieben hatte und auf dessen Oberfläche im Lichtkegel einer Lampe die Stapel von Seiten und Notizen lagen, aus denen ein achter werden sollte. Eine Schublade war einen Spalt weit geöffnet, eine der neunzehn Schubladen, manche größer, manche kleiner, deren ungerade Zahl und seltsame Anordnung, wie mir jetzt, da sie mir plötzlich weggenommen werden sollten, bewusstwurde, die Bedeutung einer Art leitenden, wenngleich geheimnisvollen Ordnung in meinem Leben angenommen hatten, einer Ordnung, die in guten Arbeitsphasen eine fast mystische Qualität gewann. Neunzehn Schubladen jeglicher Größe, manche unter der Tischplatte und andere darüber, deren profane Verwendung (hier Briefmarken, dort Büroklammern) einen weitaus komplexeren Entwurf verbarg, die Blaupause dessen, was sich in Zigtausenden von Tagen auf die Schubladen starrenden Grübelns in meinem Geist herausgebildet hatte, als enthielten sie das Fazit eines störrischen Satzes, die dichteste Formulierung, die radikale Ablösung von allem, was ich je geschrieben hatte, die letztendlich zu dem Buch führen würde, das ich immer schreiben wollte und immer verfehlt hatte. Diese Schubladen stellten eine einzigartige, tiefverwurzelte Logik dar, ein geistiges Muster, das sich auf keine andere Weise ausdrücken ließ als durch ihre genaue Zahl und Anordnung. Oder mache ich zu viel daraus?
Mein Stuhl war leicht zur Seite geschwenkt und wartete darauf, mich wieder in Habtachtstellung zu bringen. An solchen Abenden machte ich leicht die halbe Nacht durch, schrieb und starrte in die Dunkelheit des Hudson, solange die Kraft und die Klarheit anhielten. Es gab niemanden, der mich zu Bett rief, niemanden, der einen Lebensrhythmus im Duett von mir erwartete, niemanden, dem ich mich fügen musste. Wäre der Anrufer irgendjemand anders gewesen, ich wäre nach dem Auflegen an den Tisch zurückgekehrt, um den ich im Lauf von zweieinhalb Jahrzehnten gleichsam physisch herumgewachsen war, indem ich meine Haltung durch jahrelanges Über-ihn-gebeugt-Sein an seine Form angepasst hatte.
Einen Augenblick gedachte ich zu sagen, ich hätte ihn weggegeben oder ausrangiert. Oder der Person am Telefon einfach zu erzählen, sie habe sich geirrt: Ich hätte den Schreibtisch ihres Vaters nie besessen. Ihre Hoffnung war verführerisch, sie hatte mir einen Ausweg angeboten – Haben Sie ihn noch? Sie wäre enttäuscht gewesen, aber ich hätte ihr nichts weggenommen, jedenfalls nichts, was sie je besessen hatte. Und ich hätte weitere fünfundzwanzig oder dreißig Jahre an dem Tisch schreiben können, solange mein Geist lebendig blieb und der Drang nicht nachließ.
Stattdessen sagte ich, ohne innezuhalten und die Folgen zu bedenken, ja, ich hätte ihn. Nachträglich habe ich mich gefragt, warum ich diese Worte, die mein Leben fast unverzüglich aus dem Gleis brachten, so schnell ausgestoßen hatte. Und wenngleich die Antwort auf der Hand liegt, dass es schon aus Freundlichkeit geboten und einfach das Richtige war, Euer Ehren, wusste ich, dass ich es nicht aus diesem Grund gesagt hatte. Ich habe geliebten Menschen im Namen meiner Arbeit schon viel größeres Unrecht getan, und die Person, die mich jetzt um etwas bat, war eine vollkommen Fremde. Nein, ich habe es aus demselben Grund getan, aus dem ich es in einer Geschichte geschrieben hätte: weil mir das Jasagen unvermeidlich schien.
Ich möchte ihn gern haben, sagte sie. Selbstverständlich, antwortete ich und fragte, ohne mir die Gelegenheit zu geben, es mir anders zu überlegen, wann sie kommen wolle. Ich bin nur noch eine Woche in New York, sagte sie. Wie wäre es Samstag? Das, rechnete ich mir aus, würde mir noch fünf Tage mit dem Schreibtisch lassen. Gut, sagte ich, obwohl eine größere Diskrepanz zwischen meinem beiläufigen Ton und dem Gefühl der Bestürzung, das mich beim Sprechen überkam, kaum möglich gewesen wäre. Ich habe noch ein paar andere Möbelstücke von Ihrem Vater. Sie können alles haben.
Ehe sie auflegte, fragte ich nach ihrem Namen. Leah, sagte sie. Leah Varsky? Nein, sagte sie, Weisz. Dann erklärte sie sachlich, ihre Mutter, die Israelin sei, habe Anfang der siebziger Jahre in Santiago gelebt. Um die Zeit des Militärputsches habe sie eine kurze Affäre mit Daniel gehabt und bald danach das Land verlassen. Als sie merkte, dass sie schwanger war, habe sie Daniel geschrieben. Sie habe nie eine Antwort von ihm bekommen; er war schon verhaftet worden.
Als in der Stille, die dann folgte, klarwurde, dass wir mit all den verdaulichen Gesprächshäppchen durch waren und nur die für ein solches Telefonat zu sperrigen Brocken übrig blieben, sagte ich, ja, ich hätte den Tisch lange behalten. Ich hätte immer gedacht, eines Tages würde seinetwegen jemand kommen, sagte ich, aber natürlich hätte ich versucht, ihn früher zurückzugeben, wenn ich Bescheid gewusst hätte.
Nachdem sie aufgelegt hatte, ging ich in der Küche ein Glas Wasser trinken. Ins Zimmer zurückgekehrt – ein Wohnzimmer, das mein Arbeitszimmer war, weil ich kein Wohnzimmer brauchte –, begab ich mich an den Schreibtisch, als wäre alles beim Alten. Aber natürlich war es das nicht, und beim ersten Blick auf den Computerbildschirm mit dem Satz, den ich abgebrochen hatte, als das Telefon klingelte, wusste ich, an diesem Abend konnte ich unmöglich weitermachen.
Ich stand auf und setzte mich in meinen Lesesessel. Ich nahm das Buch vom Beistelltischchen, merkte aber, einigermaßen ungewöhnlich, dass meine Gedanken abschweiften. Ich starrte durch den Raum auf den Tisch, wie ich an zahllosen Abenden, wenn ich in eine Sackgasse geraten war und nicht kapitulieren wollte, darauf gestarrt hatte. Nein, Euer Ehren, ich hege keine mystischen Vorstellungen übers Schreiben, das ist eine Arbeit, ein Handwerk wie jedes andere, die Kraft der Literatur, davon bin ich seit jeher überzeugt, liegt im drängenden Willen, sie zu schreiben. Von daher habe ich nie an die Vorstellung geglaubt, der Schriftsteller brauche ein spezielles Ritual zum Schreiben. Notfalls könne ich fast überall schreiben, ebenso gut im Aschram wie in einem belebten Café oder so, habe ich immer betont, wenn ich gefragt wurde, ob ich mit dem Stift oder am Computer schreibe, morgens oder abends, allein oder in Gesellschaft, auf einem Sattel wie Goethe, stehend wie Hemingway, liegend wie Twain und so weiter, als gäbe es ein Geheimnis, um den Safe zu knacken, in dem der Roman, der angeblich in jedem von uns schlummert, voll ausgestaltet und publikationsfertig bereitliegt. Nein, was mich bestürzte, war die Aussicht darauf, meine vertrauten Arbeitsbedingungen zu verlieren; es waren sentimentale Gefühle, die sich Luft verschafften, sonst nichts.
Es war ein Rückschlag. Etwas Melancholisches hing der ganzen Sache an, eine Melancholie, die mit der Geschichte von Daniel Varsky begonnen hatte, aber jetzt zu mir gehörte. Doch es war kein nicht wiedergutzumachendes Problem. Morgen früh, beschloss ich, würde ich losgehen und mir einen neuen Schreibtisch kaufen.
Es war nach Mitternacht, als ich einschlief, und wie immer, wenn ich, in irgendeine Schwierigkeit verstrickt, zu Bett gehe, hatte ich einen unruhigen Schlaf und lebhafte Träume. Aber morgens konnte ich mich, trotz des verschwommenen Eindrucks, durch epische Breiten geschleift worden zu sein, nur an ein Fragment erinnern – einen Mann, der draußen vor meinem Haus stand, zu Tode frierend in dem eisigen Wind, der von Kanada her, direkt vom nördlichen Polarkreis, durch die Schneise des Hudson wehte, und mich, als ich vorbeiging, bat, an einem roten Faden, der ihm aus dem Mund hing, zu ziehen. Von Mitleid gequält, tat ich ihm den Gefallen, aber beim Ziehen häufelte sich der Faden zu meinen Füßen auf. Als mir die Arme erlahmten, blaffte der Mann mich an, ich solle weiterziehen, bis wir nach einer gewissen Zeit, verdichtet, wie es nur in Träumen möglich ist, beide glaubten, am Ende dieser Schnur müsse sich etwas Entscheidendes befinden; oder vielleicht konnte nur ich mir den Luxus leisten, es zu glauben oder nicht, während es für ihn eine Frage von Leben und Tod war.
Am nächsten Tag ging ich nicht los, um einen neuen Tisch zu suchen, auch nicht am Tag danach. Als ich mich an die Arbeit setzte, war ich nicht nur unfähig, die notwendige Konzentration aufzubringen, sondern beim Überfliegen der Seiten, die ich schon geschrieben hatte, fand ich sie ein Geplätscher überflüssiger Worte, denen es an Leben und Authentizität fehlte, ohne einen zwingenden Grund dahinter. Was, wie ich gehofft hatte, ein subtiler Kunstgriff sein sollte, wie er in der besten Romanliteratur verwendet wird, war nur, das sah ich jetzt, eine künstliche Feld-Wald-und-Wiesen-Mischung, ein Kunstgriff, der dazu diente, die Aufmerksamkeit von dem abzulenken, was letzten Endes seicht ist, statt die ungeheuren Tiefen unter der Oberfläche aller Dinge zu enthüllen. Was eine schlichtere, reinere Prosa werden sollte, geschärft durch die Entblößung von allen schmückenden Ornamenten, war in Wirklichkeit eine dumpfe und schwerfällige Masse, ohne Spannung oder Kraft, die in Gegensatz zu nichts stand, nichts auslöste und nichts ausrief. Obwohl ich eine ganze Weile mit dem Mechanismus hinter diesem Buch gekämpft hatte und es mir nicht gelungen war, herauszuarbeiten, wie sich die Teile ineinanderfügten, hatte ich doch die ganze Zeit geglaubt, es stecke etwas darin, ein Entwurf, der sich, wenn ich ihn nur freilegen und von dem Rest trennen könnte, als so feinsinnig und irreduzibel erweisen würde, wie es die Idee eines Romans verlangt, der nur so und nicht anders geschrieben werden kann, um sie auszudrücken. Aber jetzt sah ich, dass ich mich geirrt hatte.
Ich verließ die Wohnung und machte einen langen Spaziergang durch den Riverside Park und den Broadway hinunter, um meine Stimmung aufzuheitern. Bei Zabar’s hielt ich an und holte mir ein paar Sachen zum Abendessen, winkte demselben Mann hinter der Käsetheke, der schon da gewesen war, als ich meine Großmutter besuchen ging, schlängelte mich an den buckligen, schwer gepuderten Alten vorbei, die in großen Einkaufswagen ein Glas Gurken vor sich herschoben, stand in der Schlange hinter einer Frau mit einem ewigen, unfreiwilligen Nicken – ja, ja, ja, ja –, dem überschwänglichen Ja des Mädchens, das sie einst gewesen war, auch wenn sie nein meinte, nein, es reicht, nein danke.
Aber als ich wieder nach Hause kam, war es genau das Gleiche. Am nächsten Tag noch schlimmer. Mein Urteil über alles, was ich im Lauf des letzten Jahres oder vor noch längerer Zeit geschrieben hatte, festigte sich auf eine Weise, die mich krank machte. Alles, was ich in den folgenden Tagen an dem Schreibtisch vollbrachte, bestand darin, das Manuskript samt Notizen in einen Karton zu packen und die Schubladen ihres Inhalts zu entleeren. Da waren alte Briefe, Papierschnitzel, auf die ich Sachen geschrieben hatte, die ich selbst nicht mehr verstand, verstreuter Krimskrams, kaputte Teile längst weggeworfener Objekte, allerhand Elektrozeug, Briefpapier mit dem Aufdruck der Adresse, wo ich mit meinem Exmann S gewohnt hatte – ein Sammelsurium zumeist nutzloser Dinge sowie, unter ein paar alten Heften, Daniels Postkarten. Ganz hinten in einer Schublade fand ich ein vergilbtes Taschenbuch, das Daniel vor so vielen Jahren vergessen haben musste, einen Erzählband von einer Schriftstellerin namens Lotte Berg, den die Autorin mit einer Widmung für ihn versehen hatte, gezeichnet 1970. Ich füllte eine große Tüte mit Sachen zum Wegwerfen; alles andere verstaute ich in einer Kiste, außer den Postkarten und dem Taschenbuch. Diese steckte ich, ohne sie zu lesen, in einen großen braunen Umschlag. Ich leerte all die vielen Schubladen, manche sehr klein, andere, wie gesagt, von durchschnittlicher Größe, bis auf eine: die einzige mit einem kleinen Messingschloss. Wenn man am Tisch saß, befand sich das Schloss direkt oberhalb des rechten Knies. Diese Schublade war, solange ich zurückdenken konnte, immer verschlossen gewesen, und trotz immer neuer Suche habe ich den Schlüssel nicht gefunden. Einmal, in einem Anfall von Neugierde oder vielleicht Langeweile, wollte ich das Schloss mit einem Schraubenzieher aufbrechen, aber dabei habe ich mir nur die Knöchel aufgeschrammt. Oft hätte ich mir gewünscht, eine andere Schublade wäre verschlossen, weil die rechts oben am handlichsten war und ich instinktiv jedes Mal, wenn ich irgendetwas aus einer der vielen Schubladen brauchte, zuerst nach dieser griff, was regelmäßig ein kurzes Unglück in mir weckte, ein Gefühl des Verwaistseins, von dem ich wusste, dass es nichts mit der Schublade zu tun, sondern sich einfach dort eingenistet hatte. Aus irgendeinem Grund habe ich immer angenommen, die Schublade enthielte Briefe von dem Mädchen aus dem Gedicht, das Daniel Varsky mir damals vorgelesen hatte, oder wenn nicht von ihm, dann von einem ähnlichen.
Am folgenden Samstagmittag klingelte Leah Weisz bei mir. Als ich die Tür aufmachte und die Gestalt dastehen sah, verschlug es mir den Atem: Es war Daniel Varsky, trotz der verronnenen siebenundzwanzig Jahre, genau wie er an jenem Winternachmittag, als ich bei ihm klingelte und er mir die Tür aufmachte, dagestanden hatte, nur dass jetzt alles umgekehrt war, wie in einem Spiegel, oder umgekehrt, als wäre die Zeit plötzlich stehengeblieben und schnurrte zurück, indem sie alles Geschehene ungeschehen machte. Dieselbe Hagerkeit, dieselbe Nase und dennoch derselbe Eindruck von etwas Zartem. Dieses Echo von Daniel Varsky streckte nun seine Hand aus. Eine kalte Hand, als ich sie schüttelte, trotz der Wärme draußen. Sie trug eine blaue, an den Ellbogen abgewetzte Samtjacke und einen roten Leinenschal um den Hals, die Enden verwegen über die Schultern geschlungen, wie eine frischgebackene Studentin, die sich, gebeugt von der Last ihrer ersten Begegnung mit Kierkegaard oder Sartre, gegen den Wind durch den Collegehof kämpft. So jung sah sie aus, wie achtzehn oder neunzehn, aber nach dem, was ich mir ausrechnen konnte, musste Leah vierundzwanzig oder fünfundzwanzig sein, fast genau das Alter, in dem Daniel und ich uns kennengelernt hatten. Und anders als bei einer frisch-fröhlichen Studentin lag etwas Ahnungsvolles in der Art, wie ihr das Haar über die Augen fiel, und in den Augen selbst, die dunkel waren, fast schwarz.
Aber drinnen sah ich, dass sie nicht ihr Vater war. Unter anderem war sie kleiner, gedrungener, beinahe koboldhaft. Ihr Haar war kastanienbraun, nicht schwarz wie Daniels. Unter der Deckenbeleuchtung in meinem Flur fielen Daniels Züge hinlänglich von ihr ab, dass ich auf der Straße wohl an ihr vorbeigegangen wäre, ohne etwas Vertrautes zu bemerken.
Sie sah den Tisch sofort und ging langsam darauf zu. Vor der klotzigen Masse, die ihr, so stelle ich mir vor, gegenwärtiger war, als ihr Vater es je gewesen sein konnte, blieb sie stehen, fasste sich an die Stirn und ließ sich auf den Stuhl sinken. Einen Augenblick dachte ich, sie würde weinen. Stattdessen legte sie ihre Hände auf die Oberfläche, schob sie vor und zurück und begann an den Schubladen zu fummeln. Ich unterdrückte meinen Ärger über diese Übertretung, ebenso wie über die folgende, denn sie begnügte sich nicht damit, nur eine Schublade aufzuziehen und hineinzuschauen, sondern schien erst befriedigt, als sie noch in drei oder vier andere geschaut und gesehen hatte, dass alle leer waren. Einen Augenblick dachte ich, ich würde weinen.
Aus Höflichkeit und um jeder weiteren Inspektion des Möbels Einhalt zu gebieten, bot ich ihr einen Tee an. Sie erhob sich von dem Schreibtisch, drehte sich um und ließ ihren Blick durch das Zimmer wandern. Leben Sie allein?, fragte sie. Ihr Ton, oder ihr Gesichtsausdruck, während sie den schiefen Bücherstapel neben meinem fleckigen Lehnstuhl und die Ansammlung schmutziger Tassen auf der Fensterbank betrachtete, erinnerte mich an die mitleidige Art, wie Freunde mich manchmal angesehen hatten, als ich in den Monaten vor meiner Begegnung mit Leahs Vater allein in der von Rs Sachen leergeräumten Wohnung lebte. Ja, sagte ich. Wie möchten Sie den Tee? Haben Sie nie geheiratet?, fragte sie, und ehe ich michs versah, vielleicht aus Verblüffung über ihre unverblümte Frage, antwortete ich mit Nein. Das habe ich auch nicht vor, sagte sie. Nein?, fragte ich. Warum nicht? Nehmen Sie doch sich selbst, sagte sie. Sie sind frei, zu gehen, wohin Sie wollen, zu leben, wie es Ihnen gefällt. Sie steckte sich das Haar hinter die Ohren und ließ ihren Blick erneut über das Zimmer schweifen, als sollte nicht nur ein Tisch, sondern die ganze Wohnung oder vielleicht das Leben selbst auf ihren Namen übertragen werden.
Es wäre, zumindest im Augenblick, unmöglich gewesen, alles zu fragen, was ich über die Umstände von Daniels Verhaftung wissen wollte, wo man ihn festgehalten hatte und ob irgendetwas darüber bekannt sei, wie und wo er gestorben war. So erfuhr ich denn im Lauf der nächsten halben Stunde, dass Leah zwei Jahre in New York gelebt und am Juilliard-Konservatorium Klavier studiert hatte, bis sie eines Tages beschloss, das riesige Instrument, an das sie seit ihrem fünften Lebensjahr gefesselt gewesen war, nicht länger spielen zu wollen, und ein paar Wochen später nach Hause, nach Jerusalem, zurückgekehrt war. Dort lebte sie nun seit einem Jahr und versuchte, sich darüber klarzuwerden, wie es weitergehen solle. Sie war nur nach New York gekommen, um ein paar Sachen abzuholen, die sie bei Freunden untergestellt hatte, und wollte nun alles, zusammen mit dem Schreibtisch, nach Jerusalem verschiffen.
Mag sein, dass es andere Details gab, die ich verpasst habe, denn während sie sprach, begann ich mit der schwer annehmbaren Vorstellung zu ringen, dass ich im Begriff war, den einzigen bedeutsamen Gegenstand meines schriftstellerischen Daseins, die einzige physische Repräsentation all dessen, was ansonsten schwerelos und ungreifbar war, an diese Heimatlose abzugeben, die vielleicht hin und wieder davorsitzen würde wie vor einem väterlichen Altar. Und doch, Euer Ehren, was sollte ich tun? Die Abmachungen waren getroffen, am nächsten Tag würde sie mit einem Umzugswagen wiederkommen, der die Möbel direkt zu einem Schiffscontainer in Newark bringen sollte. Da ich es nicht ertragen konnte, mit anzusehen, wie der Schreibtisch weggefahren wurde, sagte ich ihr, ich sei nicht da, aber ich würde dafür sorgen, dass Vlad, der ruppige rumänische Hausmeister, da wäre, um ihr aufzumachen.
Früh am nächsten Morgen legte ich den braunen Umschlag mit Daniels Postkarten auf den leeren Schreibtisch und fuhr nach Norfolk in Connecticut, wo ich mit S neun- oder zehnmal ein Sommerhaus gemietet hatte und seit unserer Trennung nicht mehr gewesen war. Erst als ich bei der Bibliothek anhielt und aus dem Auto stieg, um mir mit Blick auf den Stadtpark die Beine zu vertreten, wurde mir klar, dass ich mir keinen meiner Gründe dafür, hier zu sein, durchgehen lassen durfte und dass ich obendrein verzweifelt vermeiden wollte, jemanden zu treffen, den ich kannte. Ich stieg wieder ins Auto und fuhr vier oder fünf Stunden lang ziellos über die Landstraßen, durch New Marlborough nach Great Barrington und weiter nach Lenox, lauter Straßen, die S und ich hundertmal entlanggefahren waren, ehe wir aufblickten und merkten, dass unsere Ehe verhungert war.
Im Fahren fiel mir ein, dass S und ich vier oder fünf Jahre nach unserer Heirat bei einem deutschen Tänzer, der damals in New York lebte, zu einem Abendessen eingeladen gewesen waren. Um diese Zeit arbeitete S an einem mittlerweile geschlossenen Theater, wo der Tänzer ein Solostück aufführte. Die Wohnung war klein, gefüllt mit dem ungewöhnlichen Hab und Gut des Tänzers, Sachen, die er auf der Straße gefunden, von seinen rastlosen Reisen mitgebracht oder geschenkt bekommen hatte, alles mit jenem Sinn für Raum, Proportionen, Rhythmus und Anmut arrangiert, der es zu einer solchen Freude machte, ihn auf der Bühne anzuschauen. Tatsächlich war es seltsam und beinahe frustrierend, ihn in Straßenkleidung und braunen Hausschuhen zu sehen, wie er sich so ökonomisch durch die Wohnung bewegte, ohne oder mit nur geringen Zeichen der unglaublichen körperlichen Ausdruckskraft, die er in sich barg, und ich verzehrte mich buchstäblich vor Verlangen nach einem Bruch dieser pragmatischen Fassade, einem Sprung oder einer Drehung, irgendeiner Explosion seiner wahren Energie. Gleichwohl, nachdem ich mich damit abgefunden hatte und mich in seine vielen kleinen Sammlungen vertiefte, erfasste mich das beschwingte, jenseitige Gefühl, das mich manchmal überkommt, wenn ich die Lebenswelten anderer betrete, wenn es mir einen Augenblick absolut möglich erscheint, meine banalen Gewohnheiten zu ändern und so zu leben, ein Gefühl, das sich spätestens am nächsten Morgen verflüchtigt, wenn ich mit den vertrauten, unbeweglichen Konturen meines eigenen Lebens erwache. Irgendwann stand ich vom Esstisch auf, um aufs Klo zu gehen, und im Flur kam ich an der offenen Tür des Schlafzimmers vorbei. Es wirkte karg, nur ein Bett, ein Holzstuhl und ein kleiner Altar mit Kerzen, der in einer Ecke errichtet war. Durch ein großes Fenster nach Süden lag Lower Manhattan schwebend in der Dunkelheit. Die anderen Wände waren weiß, bis auf ein mit Stecknadeln angepinntes Gemälde, ein sprühendes Bild, aus dessen vielen farbenfrohen und hochinspirierten Pinselstrichen manchmal Gesichter auftauchten, wie aus einem Sumpf, hier und dort mit einem Hut auf. Die Gesichter der oberen Bildhälfte standen auf dem Kopf, als hätte der Maler oder die Malerin das Blatt umgedreht oder es beim Malen auf Knien umkreist, um leichter dranzukommen. Es war ein merkwürdiges Prachtstück, stilistisch anders als all die anderen Dinge, die der Tänzer gesammelt hatte, und ich betrachtete es eine oder zwei Minuten lang, ehe ich zur Toilette weiterging.
Das Feuer im Wohnzimmerkamin brannte herunter, es wurde spät. Am Ende, als wir uns die Mäntel anzogen, fragte ich den Tänzer zu meiner eigenen Überraschung, wer das Bild gemalt habe. Er sagte, sein bester Kindheitsfreund habe es gemacht, als er neun war. Mein Freund und seine ältere Schwester, sagte er, obwohl ich glaube, das meiste ist von ihr. Danach haben sie es mir geschenkt. Der Tänzer half mir in den Mantel. Wissen Sie, dieses Bild hat eine traurige Geschichte, fügte er dann, fast nachträglich, hinzu.
Eines Nachmittags tat die Mutter ihren Kindern Schlaftabletten in den Tee. Der Junge war neun und seine Schwester elf. Als sie eingeschlafen waren, trug sie die beiden ins Auto und fuhr mit ihnen in den Wald. Um diese Zeit wurde es dunkel. Sie übergoss das ganze Auto mit Benzin und zündete ein Streichholz an. Alle drei sind verbrannt. Es ist seltsam, sagte der Tänzer, aber ich war immer neidisch darauf, wie es bei meinen Freunden zu Hause war. In dem Jahr ließen sie den Weihnachtsbaum bis April stehen. Er wurde braun, und die Nadeln fielen ab, aber ich lag meiner Mutter in den Ohren, warum wir unseren Weihnachtsbaum nicht auch so lange behalten durften wie die Jörns.
In der Stille, die nach dieser sehr freimütig erzählten Geschichte eintrat, lächelte der Tänzer. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich meinen Mantel schon anhatte und es in der Wohnung warm war, aber mir wurde plötzlich heiß und schwindlig. Ich hätte ihn gern noch viele andere Dinge über die Kinder und seine Freundschaft mit ihnen gefragt, aber ich fürchtete umzukippen, sodass wir uns, nachdem ein anderer Gast einen Scherz über den morbiden Ausklang des Abends gemacht hatte, für das Essen bedankten und uns verabschiedeten. Im Aufzug konnte ich mich nur mit Mühe aufrecht halten, aber S, der leise vor sich hin summte, schien es nicht zu merken.
Zu dieser Zeit dachten S und ich daran, ein Kind zu bekommen. Das hatten wir uns beide von Anfang an vorgestellt. Aber es gab immer Dinge, von denen wir glaubten, wir müssten sie in unserem eigenen Leben, gemeinsam und jeder für sich, erst einmal bewältigen, und so verging einfach die Zeit, ohne einen Entschluss zu bringen oder eine klarere Idee, wie wir es schaffen sollten, mehr aus uns zu machen als das, was wir uns schon mühsam genug erkämpften. Und obwohl ich mir, als ich jünger war, voller Überzeugung ein Kind gewünscht habe, war ich nicht überrascht, als ich mit fünfunddreißig, dann mit vierzig Jahren noch keins hatte. Das mag ambivalent erscheinen, Euer Ehren, und ich nehme an, teilweise ist es das auch, aber da war noch etwas anderes, ein Gefühl, das mich immer begleitet hat, auch wenn sich zunehmend das Gegenteil erwies: dass ich noch Zeit hätte – und immer haben würde. Die Jahre vergingen, vor dem Spiegel veränderte sich mein Gesicht, mein Körper war nicht mehr, was er einmal gewesen war, aber ich mochte nicht glauben, dass die Möglichkeit, ein eigenes Kind zu bekommen, ohne meine ausdrückliche Zustimmung verfiel.
Im Taxi, das uns in jener Nacht nach Hause brachte, war ich in Gedanken bei der Mutter und ihren Kindern. Die sanft über das Nadelbett des Waldbodens rollenden Autoreifen, der auf einer Lichtung abgedrehte Motor, die bleichen Gesichter dieser jungen Maler, die auf der Rückbank schliefen, mit Dreck unter den Fingernägeln. Wie konnte sie das tun?, sagte ich laut zu S. Es war nicht wirklich das, was ich ihn fragen wollte, aber so nahe daran, wie es mir gerade möglich war. Sie hat den Verstand verloren, sagte er einfach, als wäre die Sache damit erledigt.
Kurz darauf schrieb ich eine Geschichte über den Kindheitsfreund des Tänzers, diesen Jungen, der in einem deutschen Wald schlafend im Auto seiner Mutter gestorben war. Ich habe an den Einzelheiten nichts geändert; ich habe nur welche hinzuphantasiert. Das Haus, in dem die Kinder lebten, der süße Duft, der an Frühlingsabenden durch die offenen Fenster strömte, die selbstgepflanzten Bäume im Garten, alles stieg mühelos vor mir auf. Wie die Kinder gemeinsam Lieder sangen, die sie von ihrer Mutter gelernt hatten, wie diese ihnen aus der Bibel vorlas, die gesammelten Vogeleier auf dem Fensterbrett und wie der Junge in stürmischen Nächten zu seiner Schwester ins Bett kroch. Eine große Zeitschrift wollte die Geschichte drucken. Ich rief den Tänzer nicht an, bevor sie veröffentlicht wurde, noch schickte ich ihm ein Belegexemplar. Er hatte sie durchlebt, und ich benutzte sie, indem ich sie so ausschmückte, wie ich es für gut befand. In einem gewissen Licht betrachtet, ist das die Art, wie ich arbeite, Euer Ehren. Als mir ein erstes Exemplar der Zeitschrift geschickt wurde, fragte ich mich einen Augenblick, ob der Tänzer es mitbekommen und wie er sich wohl dabei fühlen würde. Aber ich verschwendete nicht viel Zeit mit dem Gedanken, sondern platzte vor Stolz, meine Arbeit in der illustren Aufmachung der Zeitschrift gedruckt zu sehen. Der Tänzer lief mir in der nächsten Zeit nicht über den Weg, und ich überlegte mir auch nicht, was ich ihm sagen würde, wenn doch. Zudem hörte ich auf, als die Geschichte einmal erschienen war, an die Mutter und ihre im Auto verbrannten Kinder zu denken, als hätte ich sie durch mein Schreiben zum Verschwinden gebracht.
Ich schrieb weiter. Ich schrieb einen weiteren Roman an Daniel Varskys Schreibtisch, und dann noch einen, der sich im Wesentlichen auf meinen im Vorjahr gestorbenen Vater bezog. Diesen Roman hätte ich nicht schreiben können, solange er am Leben war. Wäre er imstande gewesen, ihn zu lesen, hätte er sich mit Sicherheit verraten gefühlt. Gegen Ende seines Lebens hatte er die Kontrolle über seinen Körper verloren und war seiner Würde beraubt, dessen blieb er sich bis zu seinen letzten Tagen schmerzlich bewusst. In dem Roman habe ich diese Erniedrigungen lebhaft geschildert, sogar die Phase, als er sich einkotete und ich ihn sauber machen musste, ein Vorfall, den er so beschämend fand, dass er mir danach tagelang nicht in die Augen sehen konnte, und den er mich, hätte er sich irgend überwinden können, ihn auch nur zu erwähnen, selbstverständlich gebeten haben würde, nie einer Menschenseele zu erzählen. Aber ich beließ es nicht bei diesen quälenden, intimen Szenen, denen mein Vater, wäre er einen Augenblick frei von seinem Schamgefühl gewesen, vielleicht zugestanden hätte, dass sie weniger ihn zeigten als die universelle Misere des Älterwerdens und drohenden Todes – ich beließ es nicht dabei,