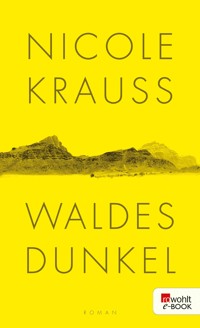9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nicole Krauss' Storys beleuchten jene Momente im Leben von Frauen, in denen die Kräfte von Sex, Macht, Liebe und Gewalt kollidieren. Wenn wir Söhne und Liebhaber, Verführer, Freunde und Gatten zusammennehmen – wie viele Männer hält ein Frauenleben aus? Und was bedeutet es, als Mann und Frau gemeinsam zu leben – oder getrennt? «Ein Mann sein» erzählt von den Zumutungen des Zusammenseins, wenn etwa eine jüdische New Yorkerin von ihrem deutschen Geliebten hören muss, dass er, achtzig Jahre früher geboren, vielleicht ein überzeugter Nazi gewesen wäre. Wenn eine Frau in der Wohnung ihres verstorbenen Vaters einem Unbekannten begegnet, der plötzlich ihr Leben dominiert. Oder wenn die junge Internatsschülerin von der Beziehung ihrer Mitschülerin mit einem älteren reichen Mann erfährt. In allen zehn Storys, geografisch weit gespannt von der Schweiz bis nach Japan, von New York bis nach Tel Aviv, erforscht Nicole Krauss die unkartierten, vielleicht unkartierbaren Regionen zwischen den Geschlechtern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Nicole Krauss
Ein Mann sein
Storys
Über dieses Buch
Nicole Krauss‘ Storys beleuchten jene Momente im Leben von Frauen, in denen die Kräfte von Sex, Macht, Liebe und Gewalt kollidieren. Wenn wir Söhne und Liebhaber, Verführer, Freunde und Gatten zusammennehmen – wie viele Männer hält ein Frauenleben aus? Und was bedeutet es, als Mann und Frau gemeinsam zu leben – oder getrennt?
«Ein Mann sein» erzählt von den Zumutungen des Zusammenseins, wenn etwa eine jüdische New Yorkerin von ihrem deutschen Geliebten hören muss, dass er, achtzig Jahre früher geboren, vielleicht ein überzeugter Nazi gewesen wäre. Wenn eine Frau in der Wohnung ihres verstorbenen Vaters einem Unbekannten begegnet, der plötzlich ihr Leben dominiert. Oder wenn die junge Internatsschülerin von den Beziehungen ihrer Mitschülerin mit einem älteren reichen Mann erfährt. In allen zehn Storys, geographisch weitgespannt von der Schweiz bis nach Japan, von New York bis nach Tel Aviv, erforscht Nicole Krauss die unkartierten, vielleicht unkartierbaren Regionen zwischen den Geschlechtern.
Vita
Nicole Krauss ist die Autorin der Romane «Waldes Dunkel», «Das große Haus», «Die Geschichte der Liebe» und «Kommt ein Mann ins Zimmer». Ihr Werk wurde u.a. im New Yorker, in The Atlantic, in Harper’s Magazine, in Esquire und in The Best American Short Stories veröffentlicht, und ihre Bücher sind in 35 Sprachen übersetzt. Sie lebt in Brooklyn, New York.
Grete Osterwald lebt als freie Übersetzerin aus dem Englischen und Französischen in Frankfurt am Main. Sie wurde mehrfach mit Übersetzerpreisen ausgezeichnet, zuletzt 2017 mit dem Jane-Scatcherd-Preis. Zu den von ihr übersetzten Autoren zählen Siri Hustvedt, Alfred Jarry, Anka Muhlstein, Jacques Chessex sowie Jeffrey Eugenides.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel «To Be a Man» bei Harper, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«To Be a Man» Copyright © 2020 by Nicole Krauss
Die Übersetzerin bedankt sich für die Förderung ihrer Arbeit an diesem Werk durch ein Arbeitsstipendium des Deutschen Übersetzerfonds.
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München,
nach dem Original von Bloomsbury Publishing Plc
Coverabbildung © by Anna Morosini 2011
ISBN 978-3-644-00944-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Sasha und Cy
Die Schweiz
Es ist dreißig Jahre her, dass ich Soraya gesehen habe. In der Zwischenzeit habe ich sie nur ein einziges Mal zu finden versucht. Ich glaube, ich fürchtete mich, sie zu sehen, fürchtete, dass ich versuchen würde, sie jetzt, da ich älter war, zu verstehen, und dass ich sie vielleicht verstehen könnte, was wohl nichts anderes heißt, als dass ich mich vor mir selbst fürchtete: vor dem, was ich hinter meinem Verständnis entdecken würde. Die Jahre vergingen, und ich dachte immer weniger an sie. Ich besuchte die Universität, machte meinen Master, heiratete früher als gedacht und bekam zwei Töchter im Abstand von nur einem Jahr. Wenn Soraya mir, durch eine sprunghafte Assoziationskette flimmernd, überhaupt je in den Sinn kam, tauchte sie genauso schnell wieder ab.
Ich hatte sie kennengelernt, als ich dreizehn war und meine Familie ein Auslandsjahr in der Schweiz verbrachte. Vor dem Aufbruch hätte unser Familienmotto «Macht euch auf das Schlimmste gefasst» lauten können, wenn mein Vater uns nicht ausdrücklich eingeschärft hätte, es sei «Traue niemandem, hüte dich vor jedem». Wir existierten am Rand eines Abgrunds, obwohl unser Haus beeindruckend war. Wir waren europäische Juden, sogar in Amerika, was bedeutete, dass katastrophale Dinge geschehen waren und wieder geschehen konnten. Unsere Eltern stritten heftig, ihre Ehe stand ewig auf der Kippe. Außerdem drohte ständig der finanzielle Ruin; wir wurden gewarnt, das Haus müsse bald verkauft werden. Es war kein Geld mehr hereingekommen, seit unser Vater nach Jahren täglicher Brüllerei mit unserem Großvater aus dem Familienbetrieb ausgeschieden war. Als er wieder zu studieren begann, war ich zwei, mein Bruder vier und meine Schwester noch nicht geboren. Dem Grundstudium folgte eines der Medizin an der Columbia, dann eine Stelle als Assistenzarzt für orthopädische Chirurgie am Hospital for Special Surgery, wenngleich wir nicht wussten, was für eine Spezialität das war. Im Lauf der elf Jahre seiner Ausbildung verbrachte mein Vater zahllose Nächte im Bereitschaftsraum der Notaufnahme, wo er eine grausige Parade von Unfallopfern empfing: von Auto- und Motorradunfällen und einmal vom Absturz eines Avianca-Flugzeugs, das, aus Medellín kommend, die Nase in einen Hügel bei Cove Neck gebohrt hatte. Im Grunde mag er sich wohl an den Aberglauben geklammert haben, die nächtlichen Konfrontationen mit dem Grauen könnten seine eigene Familie davor bewahren. Bis an einem stürmischen Nachmittag im November seines letzten Ausbildungsjahres unsere Großmutter an der Ecke First Avenue und Fiftieth Street von einem rasenden Lieferwagen angefahren wurde und eine Hirnblutung erlitt. Als mein Vater im Bellevue Hospital ankam, lag seine Mutter auf einer Trage in der Notaufnahme. Sie drückte ihm die Hand und glitt ins Koma. Sechs Wochen später starb sie. Weniger als ein Jahr nach ihrem Tod beendete mein Vater seine Assistenzzeit und zog samt Familie in die Schweiz, wo er ein Forschungsjahr über Traumata begann.
Dass die Schweiz – neutral, alpin, ordentlich – über das beste Institut für Traumatherapie auf der Welt verfügt, scheint paradox zu sein. Im ganzen Land herrschte damals die Atmosphäre eines Sanatoriums oder einer Anstalt. Statt gepolsterter Wände gab es den Schnee, der alles umhüllte und dämpfte, bis die Schweizer nach langen Jahrhunderten dazu übergegangen waren, sich instinktiv selbst zu dämpfen. Und genau das war der Punkt: Ein so einzigartig von kontrollierter Zurückhaltung und Konformität besessenes Land mit feinster Uhrwerkstechnik und pünktlichen Zügen musste, so die Folgerung, einen Vorteil für die Not eines zerschlagenen Körpers bieten. Dass die Schweiz auch ein Land vieler Sprachen ist, verschaffte meinem Bruder und mir eine unerwartete Atempause von der gedrückten Stimmung zu Hause. Das Institut befand sich in Basel, wo Schweizerdeutsch gesprochen wird, aber meine Mutter war der Meinung, wir sollten mit unserem Französisch weitermachen. Schweizerdeutsch unterschied sich kaum vom Deutschen, und wir durften uns mit nichts befassen, was auch nur im Entferntesten ans Deutsche erinnerte, die Sprache meiner Großmutter mütterlicherseits, deren gesamte Familie von den Nazis ermordet worden war. Deshalb wurden wir an der École Internationale in Genf angemeldet. Mein Bruder konnte in dem Wohnheim auf dem Campus leben, aber ich, gerade erst dreizehn geworden, war nicht alt genug dafür. Um mich vor dem Trauma zu bewahren, das sich mit allem Deutschen verband, wurde eine Lösung am westlichen Stadtrand von Genf gefunden, und im September 1987 kam ich zur Pension in das Haus einer Aushilfslehrerin für Englisch namens Mrs. Elderfield. Sie hatte strohblond gefärbtes Haar und rosige Wangen wie jemand, der in einem feuchten Klima aufgewachsen ist, wirkte aber trotzdem alt.
Mein kleines Zimmer hatte ein Fenster mit Ausblick auf einen Apfelbaum. Bei meiner Ankunft lagen ringsum abgefallene rote Äpfel, die in der Herbstsonne verfaulten. In dem Zimmer standen ein kleiner Tisch, ein Stuhl und ein Bett, auf dessen Fußende eine zusammengefaltete graue Armeewolldecke lag, alt genug, um in einem Weltkrieg gedient zu haben. Der braune Teppich war an der Türschwelle bis auf das Gewebe abgewetzt.
Zwei andere Pensionsschülerinnen, beide achtzehn, teilten sich das hintere Zimmer am Ende des Flurs. Alle unsere drei schmalen Betten hatten einst Mrs. Elderfields Söhnen gehört, die jedoch erwachsen geworden und längst ausgezogen waren, bevor wir Mädchen kamen. Es gab keine Fotos von den Jungen, sodass wir nie erfuhren, wie sie aussahen, aber wir vergaßen selten, dass sie einmal in unseren Betten geschlafen hatten. Zwischen Mrs. Elderfields abwesenden Söhnen und uns bestand eine fleischliche Verbindung. Auch war nie die Rede von Mrs. Elderfields Ehemann, sofern sie je einen gehabt hatte. Sie war niemand, dem man persönliche Fragen stellte. Wenn Schlafenszeit war, machte sie wortlos unsere Lichter aus.
An meinem ersten Nachmittag saß ich auf dem Fußboden des Zimmers der älteren Mädchen zwischen deren Kleiderhaufen. Von der Schule zurückgekehrt, pflegten sie sich mit einem billigen Herrenparfüm namens Drakar einzusprühen. Aber der starke Duft, der ihre Kleider durchdrang, war mir fremd. Vermischt mit ihrer Körperwärme und dem Eigengeruch schwächte er ab, doch von Zeit zu Zeit dünsteten ihr Bettzeug und die abgeworfenen Shirts eine so geballte Ladung aus, dass Mrs. Elderfield die Fenster aufriss und die kalte Luft alles durchpustete.
Ich hörte zu, wie sich die älteren Mädchen mit verschlüsselten Worten, die ich nicht verstand, über ihr Leben unterhielten. Sie lachten über meine Naivität, waren aber beide immer nur freundlich zu mir. Marie war via Boston aus Bangkok gekommen und Soraya aus dem sechzehnten Arrondissement von Paris, mit Zwischenaufenthalt in Teheran, wo ihr Vater königlicher Ingenieur im Dienst des Schahs gewesen war, bevor die Revolution ihre Familie ins Exil getrieben hatte, zu spät, um Sorayas Spielsachen zu packen, aber früh genug, um den größten Teil des flüssigen Familienkapitals zu transferieren. Wildheit – Sex, Aufputschmittel, die Weigerung, sich zu fügen – war der Grund, weshalb sie beide für ein zusätzliches Schuljahr in der Schweiz gelandet waren, ein dreizehntes Jahr, von dem keine von ihnen je gehört hatte.
Gewöhnlich brachen wir im Dunkeln zur Schule auf. Um die Bushaltestelle zu erreichen, mussten wir ein Feld überqueren, das im November bis auf die herausragenden braunen Stoppeln mit Schnee bedeckt war. Immer waren wir zu spät dran. Immer war ich die Einzige, die etwas gegessen hatte. Immer war jemandes Haar nass, die Spitzen gefroren. Wir kauerten uns unter das Haltestellendach und atmeten den ausgehauchten Rauch von Sorayas Zigarette ein. Der Bus brachte uns an der Armenischen Kirche vorbei zu der orangen Tram. Dann war es eine lange Fahrt bis zur Schule am anderen Ende der Stadt. Wegen der verschiedenen Stundenpläne fuhren wir allein zurück. Nur am ersten Tag, darauf hatte Mrs. Elderfield bestanden, traf ich mich mit Mary für den gemeinsamen Rückweg, aber wir nahmen die Tram in die falsche Richtung und endeten in Frankreich. Danach lernte ich den Weg kennen, und meistens unterbrach ich die Fahrt, bevor ich in den Bus stieg, um mir in dem kleinen Tabakladen neben der Tramstation ein paar Süßigkeiten aus jenen offenen Behältern zu kaufen, in denen es meiner Mutter zufolge von Keimen fremder Leute wimmelte.
Noch nie war ich so glücklich oder frei gewesen. Nicht nur war ich der schwierigen und angespannten Atmosphäre meiner Familie entronnen, sondern auch meiner elenden Schule zu Hause, den bornierten Zicken mit ihren hormonellen Schwankungen, olympiareif in ihrer Grausamkeit. Da ich für den Führerschein zu jung war, hatte es keine Fluchtmöglichkeit außer Büchern und Spaziergängen in den Wäldern hinter unserem Haus gegeben. Jetzt verbrachte ich die Stunden nach der Schule mit Streifzügen durch Genf. Ich hatte nie ein bestimmtes Ziel, endete jedoch oft am See, wo ich die anlandenden Touristenschiffe beobachtete oder Geschichten über Leute erfand, die ich in meiner Umgebung sah, insbesondere jene, die kamen, um auf den Bänken herumzuknutschen. Manchmal probierte ich bei H&M Klamotten an oder bummelte durch die Altstadt, angezogen von dem imposanten Reformationsdenkmal, den unergründlichen Gesichtern wuchtig aufragender Steinprotestanten, von deren Namen ich mich nur an Johannes Calvin erinnern kann. Ich hatte noch nichts von Borges gehört, und doch bin ich dem argentinischen Schriftsteller, der im Vorjahr in Genf gestorben war und in einem Brief zur Erklärung seines Wunsches, in der Stadt seiner Wahl beerdigt zu werden, schrieb, er habe sich dort immer «seltsam glücklich» gefühlt, zu keiner anderen Zeit meines Lebens so nahe gewesen. Jahre später schenkte mir eine Freundin Borges’ Atlas, und ich entdeckte verblüfft ein großes Foto von jenen düsteren Riesen, die ich regelmäßig besucht hatte, alles Antisemiten, die an die Vorsehung und die absolute Herrschaft Gottes glaubten. Darauf blickt Johannes Calvin leicht vorgebeugt zu dem blinden Borges hinab, der mit seinem Stock in der Hand, das Kinn nach oben gereckt, auf dem steinernen Vorsprung sitzt. Zwischen Calvin und Borges, schien das Foto zu sagen, herrsche ein großer Einklang. Zwischen Calvin und mir gab es keinen Einklang, aber auch ich hatte zu ihm aufblickend auf demselben Vorsprung gesessen.
Manchmal, wenn ich durch die Straßen wanderte, spürte ich die starrenden Blicke eines Mannes, oder jemand sprach mich auf Französisch an. Diese kurzen Begegnungen machten mich verlegen und hinterließen ein Schamgefühl. Oft waren es Afrikaner mit blitzend weißem Lächeln, aber einmal, als ich vor dem Schaufenster eines Pralinenladens stand, trat ein Europäer in einem schönen Anzug hinter mich. Er beugte sich so vor, dass sein Gesicht mein Haar berührte, und flüsterte in fast akzentfreiem Englisch: «Ich könnte dich mit einer Hand zerbrechen.» Dann ging er in aller Ruhe weiter, als wäre er ein Boot, das über stilles Wasser segelt. Ich rannte den ganzen Weg zur Tramstation, wo ich um Atem ringend wartete, bis die Bahn kam und gnädig quietschend hielt.
Abends wurden wir um punkt halb sieben zu Tisch erwartet. An der Wand hinter Mrs. Elderfields Platz hingen kleine Ölgemälde mit Alpenszenen, und noch heute steigt mir jedes Mal, wenn ich Bilder von einem Chalet, mit Glocken behängten Kühen oder einer Beeren sammelnden Heidi in karierter Schürze sehen, der Geruch nach Fisch und gekochten Kartoffeln in die Nase. Während der Mahlzeiten wurde sehr wenig gesagt. Vielleicht schien es auch nur so im Vergleich zu dem vielen, was in dem hinteren Zimmer gesagt wurde.
Maries Vater hatte ihre Mutter während seiner Zeit als GI in Bangkok kennengelernt und dann mitgenommen nach Amerika, wo er sie mit einem Cadillac Seville in einem Ranchhaus in Silver Spring, Maryland, einrichtete. Als sie sich scheiden ließen, kehrte ihre Mutter nach Thailand zurück, während ihr Vater nach Boston zog, und die nächsten fünfzehn Jahre wurde Marie zwischen ihnen hin und her gezerrt und gestoßen. Zuletzt hatte sie ausschließlich bei ihrer Mutter in Bangkok gelebt und dort einen Freund gehabt, mit dem sie, heiß und eifersüchtig verliebt, nächtelang tanzen ging und betrunken oder high in Clubs abhing. Als Maries Mutter, am Ende ihres Lateins und mit ihrem eigenen Freund beschäftigt, dem Vater davon berichtete, holte dieser seine Tochter kurzerhand aus Thailand heraus und brachte sie in die für ihre sogenannten Finishing Schools berühmte Schweiz, Internate, wo den Mädchen das Wilde und das Böse ausgetrieben und der Schliff gesitteter junger Frauen verliehen wurde. Die Ecolint war kein solches Internat, aber Marie, so hatte es sich herausgestellt, war bereits zu alt für die eigentlichen Finishing Schools. Aus deren Sicht war sie schon fertig. Und nicht im guten Wortsinn. So ergab es sich, dass Marie für ein zusätzliches Schuljahr auf die Ecolint geschickt wurde. Neben Mrs. Elderfields Hausordnung hatte Maries Vater strenge Anweisungen für ihre Sperrstunden gegeben, und nachdem sie sich an Mrs. Elderfields Kochwein vergriffen hatte, wurden die Ausgehverbote noch verschärft. Infolgedessen verbrachte ich die Wochenenden, an denen ich nicht mit dem Zug nach Basel fuhr, um meine Eltern zu besuchen, oft gemeinsam mit Marie im Haus, während Soraya ausging.
Anders als Marie strahlte Soraya keinen Ärger aus. Zumindest nicht die Sorte Ärger, den man durch Leichtsinn erregt, durch den Drang, jede von anderen gesetzte Schranke oder Grenze ungeachtet der Folgen zu überschreiten. Wenn überhaupt, dann strahlte sie eine Art exquisite, von innen leuchtende Autorität aus. Ihre äußere Erscheinung wirkte adrett und gepflegt. Sie war klein, nicht größer als ich damals, trug ihr glattes dunkles Haar zu einem, wie sie es nannte, Chanel Bob geschnitten, schminkte sich die Augen mit geschwungenem Lidstrich und hatte einen flaumigen Oberlippenbart, den sie nicht zu verbergen suchte, weil sie gewusst haben muss, dass er ihrem Typ einen besonderen Reiz verlieh. Aber sie sprach immer mit gedämpfter Stimme, als wäre sie in Geheimnissen unterwegs, eine Gewohnheit, die sie womöglich in ihrer Kindheit im revolutionären Iran angenommen hatte, oder auch in ihrer Jugend, als ihr Appetit auf Jungen und dann Männer schnell über das hinausgegangen war, was ihre Familie für annehmbar erachtete. Sonntags, wenn keine von uns viel zu tun hatte, schlossen wir uns manchmal den ganzen Tag zu dritt in dem hinteren Zimmer ein, hörten Kassetten und lauschten den mit dunkel-leiser, leicht verrauchter Stimme geschilderten Beschreibungen der Männer, mit denen Soraya zusammen gewesen war, und was sie mit ihnen gemacht hatte. Wenn mich diese Erzählungen nie schockierten, dann zum Teil deshalb, weil ich noch keine richtige Vorstellung von Sex, geschweige denn Erotik hatte, um wirklich zu wissen, was davon zu erwarten sei. Aber es lag auch an der coolen Art, wie Soraya ihre Geschichten erzählte. Sie hatte etwas Unangreifbares. Trotzdem vermute ich, dass sie das Bedürfnis empfand, auszutesten, was eigentlich in ihr steckte, dessen sie sich wie aller natürlichen Gaben mühelos bediente, und was passieren würde, wenn es versagte. Sex, wie sie ihn beschrieb, schien wenig mit Lust zu tun zu haben. Im Gegenteil, es war eher, als setzte sie sich einer Prüfung aus. Nur wenn sie, verwoben in ihre weitschweifigen Geschichten, auf Teheran zu sprechen kam und von Erinnerungen an diese Stadt erzählte, war ein echtes Lustgefühl zu spüren.
November, nach dem ersten Schnee: Es muss schon November gewesen sein, als der Geschäftsmann in unseren Gesprächen auftauchte. Er war Holländer, mehr als doppelt so alt wie Soraya, und lebte in einem Haus ohne Gardinen an einer Gracht in Amsterdam, kam jedoch alle paar Wochen geschäftlich nach Genf. Ein Banker, soweit ich mich entsinne. An die fehlenden Gardinen erinnere ich mich, weil er Soraya erzählt hatte, er ficke seine Frau nur, wenn das Licht brenne und er sicher sei, dass die Leute von gegenüber an der Herengracht sie sehen könnten. In Genf logierte er im Hôtel Royal, und in dessen Restaurant, wohin ihr Onkel sie zum Tee eingeladen hatte, war Soraya ihm zum ersten Mal begegnet. Er saß ein paar Tische entfernt, und während ihr Onkel nicht nachließ, ihr auf Farsi die Ohren darüber vollzudröhnen, wie viel Geld seine Kinder verschwendeten, beobachtete Soraya, wie der Banker kunstvoll seinen Fisch zerlegte. Das Besteck mit äußerster Präzision führend, einen Ausdruck absoluter Ruhe im Gesicht, hob der Mann die Mittelgräte an einem Stück heraus. Als er dazu überging, den Fisch zu verzehren, stockte er nicht ein einziges Mal, um – wie jeder andere – eine kleine Gräte aus dem Mund zu nehmen. Er meisterte den Vorgang perfekt, langsam, ohne ein Anzeichen von Hunger. Aß den Fisch, ohne zu würgen, ohne auch nur flüchtig die Miene zu verziehen, wie man es bei dem unangenehmen Gefühl, das Piksen einer winzigen verschluckten Gräte in der Kehle zu spüren, unwillkürlich tut. Es bedarf einer bestimmten Sorte Mann, um etwas, was eigentlich ein Gewaltakt ist, in Eleganz zu verwandeln. Während ihr Onkel auf der Toilette war, verlangte der Mann nach der Rechnung, bezahlte in bar und erhob sich, sein Sportsakko zuknöpfend. Aber statt direkt durch die zur Lobby führende Flügeltür zu gehen, machte er einen kleinen Umweg an Sorayas Tisch vorbei, auf den er eine Fünfhundert-Franken-Note fallen ließ. Seine Zimmernummer war mit blauer Tinte neben Albrecht von Hallers Gesicht geschrieben, als wäre es Albrecht von Haller selbst, der ihr diese kostbare kleine Information vergönnte. Später, als sie fröstelnd vor Kälte, die durch die offene Terrassentür hereinwehte, auf dem Hotelbett kniete, sagte ihr der Banker, er nehme immer ein Zimmer mit Ausblick auf den See, weil der gewaltige Strahl des Hunderte von Metern aufschießenden Springbrunnens ihn errege. Während sie uns das erzählte, rücklings auf dem Boden liegend, die Füße hoch auf dem Einzelbett von Mrs. Elderfields Sohn, lachte sie und konnte sich nicht mehr halten. Dennoch, trotz des Gelächters, war eine Abmachung getroffen worden. Hinfort würde der Banker, wenn er Soraya seine bevorstehende Ankunft wissen lassen wollte, bei Mrs. Elderfield anrufen und sich als ihr Onkel ausgeben. Die Fünfhundert-Franken-Note bewahrte sie in der Schublade ihres Nachttischchens auf.
Zu dieser Zeit traf Soraya auch andere Männer. Es gab einen gleichaltrigen Jungen, Sohn eines Diplomaten, der sie mit dem Sportwagen seines Vaters abholte und auf einem Ausflug nach Montreux das Getriebe ruinierte. Und einen Algerier Anfang zwanzig, der in einem Restaurant nahe der Schule kellnerte. Sie schlief mit dem Diplomatensohn, wohingegen der wirklich verliebte Algerier sie nur küssen durfte. Da er wie Camus aus armen Verhältnissen kam, projizierte sie eine Phantasie auf ihn. Aber als er nichts über die Sonne zu sagen hatte, unter der er aufgewachsen war, schwanden ihre Gefühle für ihn. Es klingt herzlos, aber später habe ich es selbst erlebt: die plötzliche Abspaltung bei der erschreckenden Erkenntnis, so intim mit jemandem geworden zu sein, der gar nicht ist, was du dir vorgestellt hast, sondern etwas ganz Anderes, vollkommen Fremdes. Als der Banker dann verlangte, dass sie die beiden fallenließ, den Diplomatensohn ebenso wie den Algerier, fiel es Soraya nicht schwer, sich zu fügen. Es befreite sie von der Verantwortung für den Liebeskummer des Algeriers.
Morgens, bevor wir zur Schule gingen, klingelte das Telefon. Wenn sie mit ihren Liebhabern Schluss gemacht habe, wies der Banker sie an, solle sie einen Rock und nichts darunter tragen. Dies erzählte sie uns auf dem Weg über das gefrorene Feld zur Bushaltestelle, und wir lachten. Aber dann blieb sie stehen, um ihr Feuerzeug gegen den Wind abzuschirmen. In der Helligkeit der Flamme sah ich ihre Augen aufblitzen und bekam zum ersten Mal Angst um sie. Oder vielleicht Angst vor ihr. Angst vor dem, was ihr fehlte oder was sie besaß, was sie über den Punkt hinaus trieb, wo andere ihre Grenze ziehen würden.
Soraya musste den Banker zu bestimmten Tageszeiten von dem Münzfernsprecher in der Schule anrufen, auch wenn es für sie bedeutete, sich mitten im Unterricht zu entschuldigen. Jedes Mal, wenn sie zu einer ihrer Verabredungen ins Hôtel Royal kam, lag am Empfang ein Umschlag für sie, der ausgetüftelte Anweisungen enthielt, was sie beim Betreten des Zimmers zu tun hatte. Ich weiß nicht, was passierte, wenn sie sich nicht an die Vorschriften des Bankers hielt oder seinen hohen Ansprüchen nicht genügte. Es kam mir nicht in den Sinn, dass sie zulassen könnte, bestraft zu werden. Noch kaum aus den Kinderschuhen heraus, habe ich damals wohl ganz einfach verstanden, dass sie sich auf ein Spiel eingelassen hatte. Ein Spiel, das sie jederzeit hätte abbrechen und nicht mehr mitspielen können. Dass sie diejenige war, die am besten wissen musste, wie leicht Regeln zu durchbrechen waren, sich in diesem Fall aber ausnahmsweise entschieden hatte, sie zu befolgen – was sonst hätte ich damals von alledem verstehen sollen? Ich weiß es nicht. Genauso wenig, wie ich dreißig Jahre später weiß, ob das, was ich bei der leuchtenden Flamme in ihren Augen sah, Perversität, Leichtsinn, Angst oder das Gegenteil war: ihr unbeugsamer Wille.
In den Weihnachtsferien flog Marie nach Boston, ich fuhr zu meiner Familie nach Basel und Soraya nach Hause, nach Paris. Als wir zwei Wochen später zurückkehrten, war sie irgendwie verändert. Sie wirkte in sich gekehrt, schloss sich ein und verbrachte ihre Zeit Walkman hörend im Bett, las französische Bücher oder rauchte aus dem Fenster. Sooft das Telefon klingelte, sprang sie auf, um abzunehmen, und wenn es für sie war, machte sie die Tür zu und kam manchmal stundenlang nicht wieder heraus. Marie flüchtete sich immer häufiger zu mir, weil es sie, wie sie sagte, in Sorayas Nähe kalt überlief. Wenn wir zusammen in meinem schmalen Bett lagen, erzählte Marie mir Geschichten aus Bangkok, aber so voller Drama das alles sein mochte, konnte sie immer noch über sich selbst lachen und mich zum Lachen bringen. Rückblickend glaube ich, dass sie mich etwas gelehrt hat, was mir, egal wie oft ich es seither vergessen und wieder erinnert habe, immer geblieben ist: etwas über die Absurdität und auch die Wahrheit in den Dramen, die wir brauchen, um uns richtig lebendig zu fühlen.
Dann, von Januar bis April, erinnere ich mich hauptsächlich an Dinge, die mir persönlich zugestoßen sind. Etwa an Kate, ein amerikanisches Mädchen, die älteste von vier Schwestern, mit der ich mich angefreundet hatte und die in einem großen Haus in Champel wohnte, wo sie mir die Playboy-Sammlung ihres Vaters zeigte. An die kleine Tochter von Mrs. Elderfields Nachbarin, bei der ich manchmal babysitten durfte, die eines Nachts schreiend in ihrem Bett auffuhr, weil sie an der Wand eine vom Scheinwerfer eines Autos angestrahlte Gottesanbeterin sah. An meine langen Spaziergänge nach der Schule. An die Wochenenden in Basel, wo ich meine kleine Schwester immer mit Spielen in der Küche unterhielt, um sie von den Streitereien unserer Eltern abzulenken. Und an Shareef, einen nett lächelnden Jungen aus meiner Klasse, mit dem ich eines Nachmittags an den See ging und auf einer Bank herumknutschte. Es war das erste Mal, dass ich einen Jungen küsste, und als er mir die Zunge in den Mund schob, fühlte es sich sowohl zärtlich wie gewalttätig an. Ich grub die Fingernägel in seinen Rücken, und er küsste mich fester, wir krümmten uns ineinander verschlungen auf der Bank wie die Paare, die ich manchmal von ferne beobachtete. Auf der Tramfahrt nach Hause roch ich ihn noch auf meiner Haut, und ein Entsetzen packte mich bei dem Gedanken, ihn am nächsten Tag in der Schule wiedersehen zu müssen. Als es dazu kam, blickte ich an ihm vorbei, als existierte er nicht, aber noch fokussiert genug, dass ich die Röte seiner Verletzung aus dem Augenwinkel sehen konnte.
In dieser Zeit erinnere ich mich auch, Soraya einmal, als ich von der Schule kam, im Badezimmer angetroffen zu haben, wo sie sich gerade vor dem Spiegel schminkte. Ihre Augen glänzten, und sie schien wieder glücklich und locker zu sein, wie seit Wochen nicht mehr. Sie rief mich herein und wollte mir das Haar bürsten und flechten. Ihr Kassettenrecorder stand in unsicherem Gleichgewicht auf dem Rand der Badewanne, und während ihre Finger mit meinem Haar zugange waren, sang sie mit. Und dann, als sie sich nach einer Haarnadel hinter ihr umdrehte, sah ich das violette Mal an ihrem Hals.
Dennoch habe ich nie wirklich an ihrer Stärke gezweifelt. Nie bezweifelt, dass sie alles unter Kontrolle hatte und tat, was sie wollte. Dass sie ein Spiel spielte, dessen Regeln sie zugestimmt, wenn sie sie nicht selbst erfunden hatte. Erst nachträglich wird mir bewusst, wie sehr ich sie so sehen wollte: willensstark und frei, unverletzlich und selbstbestimmt. Aus meinen allein unternommenen Streifzügen durch Genf hatte ich bereits gelernt, dass die Macht, Männer anzuziehen, sobald sie zur Wirkung kommt, mit einer schrecklichen Verletzlichkeit einhergeht. Aber ich wollte glauben, man könnte das Machtverhältnis durch Stärke, Furchtlosigkeit oder etwas, was ich nicht zu benennen vermochte, zu seinen eigenen Gunsten entscheiden. Kurz nachdem die Sache mit dem Banker begann, hatte Soraya uns erzählt, einmal habe seine Frau in dem Hotelzimmer angerufen, worauf er Soraya ins Bad schicken wollte, aber sie habe sich geweigert und stattdessen lauschend auf dem Bett gelegen. Der nackte Banker habe ihr den Rücken zugekehrt, jedoch keine andere Wahl gehabt, als weiter mit seiner Frau zu sprechen, deren Anruf er nicht erwartet hatte. Er sprach holländisch mit ihr, sagte Soraya, aber im gleichen Ton, wie die Männer ihrer eigenen Familie mit ihren Müttern sprechen: ernsthaft, mit einer Spur von Angst. Und während sie lauschte, habe sie gewusst, dass da etwas bloßgestellt wurde, was er nicht bloßzustellen wünschte und das Gleichgewicht zwischen ihnen aus dem Lot brachte. Wenn überhaupt eine, dann zog ich diese Geschichte vor, um zu versuchen, mir das Mal an Sorayas Hals zu erklären.
Es war in der ersten Maiwoche, dass sie nicht nach Hause kam. Mrs. Elderfield weckte uns im Morgengrauen und verlangte, ihr alles zu erzählen, was wir über Sorayas Verbleib wüssten. Marie blickte achselzuckend auf ihren abgeplatzten Nagellack, und ich versuchte, ihrem Fingerzeig zu folgen, bis Mrs. Elderfield sagte, sie werde sowohl Sorayas Eltern als auch die Polizei anrufen, und wenn ihr etwas zugestoßen sei, wenn sie sich in Gefahr befinde und wir auch nur das Geringste zurückhielten, werde man es uns nicht verzeihen, und wir selbst würden es uns nicht verzeihen können. Marie wirkte erschrocken, und als ich ihr Gesicht sah, begann ich zu weinen. Einige Stunden später kam die Polizei. Allein mit dem Kriminalbeamten und dessen Kollegen in der Küche, erzählte ich ihnen alles, was ich wusste, was – wie mir klar wurde, indem ich sprach, den Faden verlor und mich verhedderte – nicht besonders viel war. Nachdem sie Marie befragt hatten, gingen sie in das hintere Zimmer und durchsuchten Sorayas Sachen. Anschließend sah es wie geplündert aus: Alles, sogar ihre Unterwäsche, war über den Fußboden und das Bett verstreut, ein Bild von Missbrauch und Gewalt.
In der folgenden Nacht, der zweiten, die Soraya verschwunden war, gab es einen heftigen Sturm. Marie und ich lagen wach in meinem Bett, keine von uns sprach über die Dinge, die wir befürchteten. Morgens wurden wir von dem Geräusch knirschender Autoreifen auf dem Kies geweckt und sprangen auf, um aus dem Fenster zu schauen. Aber als sich die Tür des Taxis öffnete, war es ein Mann, der zum Vorschein kam, die Lippen unter dem dichten schwarzen Schnurrbart fest zusammengekniffen. In den vertrauten Zügen ihres Vaters offenbarte sich einige Wahrheit über Sorayas Herkunft: Sie stellten die Illusion ihrer Unabhängigkeit bloß.
Mrs. Elderfield ließ uns vor Mr. Sassani wiederholen, was wir bereits der Polizei erzählt hatten. Er war ein hochgewachsener, einschüchternder Mann, das Gesicht knotig vor Ärger, und ich glaube, sie traute sich nicht, es selbst zu erzählen. Am Ende war es Marie, die – ermutigt durch ihre plötzliche Autorität und den Sensationsgehalt dessen, was sie zu berichten hatte – am meisten redete. Mr. Sassani hörte schweigend zu, und es war unmöglich zu sagen, ob er Angst oder Wut empfand. Es muss beides gewesen sein. Er wandte sich zur Tür. Er wollte unverzüglich zum Hôtel Royal. Mrs. Elderfield versuchte ihn zu beruhigen. Sie wiederholte, was man schon wusste: dass der Banker zwei Tage zuvor ausgecheckt hatte, dass sein Zimmer durchsucht und nichts gefunden worden war. Die Polizei tat alles, was in ihrer Macht stand. Der Banker hatte ein Auto gemietet, dessen Spur verfolgt wurde. Man konnte nichts tun, als an Ort und Stelle bleiben und warten, bis es Neuigkeiten gab.
In den folgenden Stunden ging Mr. Sassani grimmig vor den Fenstern des Wohnzimmers auf und ab. Als königlicher Ingenieur im Dienst des Schahs musste er sich gegen jede Art von Zusammenbruch abgesichert haben. Aber dann war der Schah selbst gestürzt, und das weitgespannte und komplexe Gefüge von Mr. Sassanis Leben war wie zum Hohn auf die Physik der Sicherheit zusammengebrochen. Er hatte seine älteste Tochter in die Schweiz geschickt, das verheißungsvolle Land dafür, die Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, aber selbst die Schweiz hatte Soraya keine Sicherheit geboten, und dieser Verrat war offenbar zu viel für ihn. Jeden Augenblick drohte er loszubrüllen oder loszuweinen.
Am Ende kehrte Soraya von allein zurück. Von allein – genau wie sie sich von allein, durch eigene Entscheidung, darauf eingelassen hatte. Sie überquerte das seit kurzem wieder grüne Feld, kam an die Tür, zerzaust, aber heil. Ihre Augen waren blutunterlaufen und das Make-up darum herum verschmiert, aber sie war ruhig. Nicht einmal beim Anblick ihres Vaters zeigte sie sich überrascht, zuckte nur zusammen, als er ihren Namen rief, die letzte Silbe durch einen Seufzer oder Schluchzer erstickt. Er stürzte sich auf sie, und einen Moment lang schien es, als würde er schreien oder die Hand gegen sie erheben, aber sie wich nicht zurück, und stattdessen zog er sie an sich und umarmte sie mit Tränen in den Augen. Er sprach eindringlich, zornig auf Farsi mit ihr, aber sie erwiderte nur wenig. Sie sei müde, sagte sie auf Englisch, sie müsse schlafen. Mit einer unnatürlich hohen Stimme fragte Mrs. Elderfield, ob sie etwas essen wolle. Soraya schüttelte den Kopf, als hätte ihr keiner von uns noch etwas zu bieten, was sie brauchte, und wandte sich in Richtung des langen Flurs, der zum hinteren Zimmer führte. Als sie an mir vorbeiging, hielt sie inne, streckte die Hand aus und berührte mein Haar. Dann, sehr langsam, setzte sie ihren Weg fort.
Am nächsten Tag nahm ihr Vater sie mit nach Paris. Ich erinnere mich nicht, ob wir uns verabschiedet haben. Ich glaube, Marie und ich dachten, sie würde wiederkommen, das Schuljahr zu Ende machen und uns alles erzählen. Aber sie kam nicht wieder. Sie überließ es uns, für uns selbst zu entscheiden, was ihr zugestoßen war, und in meiner Vorstellung sah ich sie in dem Moment, als sie mit einem traurigen Lächeln mein Haar berührt hatte, und glaubte, eine Art Gnade gesehen zu haben: jene Gnade, die einem zuteilwird, wenn man sich selbst an den Rand des Abgrunds getrieben, wenn man sich etwas Dunklem oder einer Angst gestellt und gewonnen hat. Ende Juni lief das Forschungsstipendium meines Vaters aus, und er, nunmehr Traumaexperte, zog mit uns nach New York zurück. Als ich im September wieder in die Schule kam, zeigten die gemeinen Mädchen plötzlich Interesse an mir und wollten sich mit mir befreunden. Eine von ihnen umkreiste mich auf einer Party, während ich ganz still und ruhig in der Mitte stand. Sie bewunderte, wie ich mich verändert hatte, und meine in Europa gekaufte Kleidung. Ich war in die Welt hinausgegangen und wiedergekommen, und obwohl ich nichts sagte, spürten sie, dass ich Dinge wusste. Eine Zeitlang schickte Marie Kassetten mit selbstbesprochenen Bändern, auf denen sie mir alles erzählte, was sich in ihrem Leben ereignete. Aber irgendwann kamen keine mehr, und auch wir verloren den Kontakt. Damit war das Thema Schweiz für mich beendet.
In meiner Vorstellung war damit auch das Thema Soraya beendet: Wie gesagt, habe ich sie nie wiedergesehen und sie nur ein einziges Mal zu finden versucht, in dem Sommer, den ich in Paris verbrachte, als ich neunzehn war. Selbst da gab ich mir keine große Mühe – rief bei zwei Sassanis an, die im Telefonbuch standen, das war alles. Und doch, wenn nicht um ihretwillen, weiß ich nicht, ob ich auf das Motorrad des jungen Mannes gestiegen wäre, der als Tellerwäscher in dem Restaurant gegenüber meiner Unterkunft in der Rue de Chevreuse arbeitete, und mich zu ihm nach Hause in die Außenbezirke der Stadt hätte fahren lassen, oder ob ich mit dem älteren Mann, der eine Etage unter mir wohnte, in eine Bar gegangen wäre, wo er mich als Manager eines Nachtclubs mit einem Job lockte, den er mir, wie ich wusste, nie verschaffen würde, um sich dann, als wir ins Haus zurückkamen, auf dem Treppenabsatz vor seiner Tür auf mich zu stürzen und mich gewaltsam zu umarmen. Auf dem Sofa des Tellerwäschers schaute ich mir einen Film an, nach dessen Ende er mir sagte, es sei gefährlich, mit Männern, die man nicht kenne, nach Hause zu gehen, ehe er mich schweigend in die Stadt zurückfuhr. Und irgendwie gelang es mir, mich von dem Nachtclubmanager loszureißen und mich in die nächste Etage und meine eigene Wohnung zu retten, wenngleich mir für den Rest des Sommers die Angst im Nacken saß, ihm auf der Treppe zu begegnen, und ich nach seinen Schritten lauschte, bevor ich den Mut fasste, meine Tür zu öffnen und die Stufen hinunterzurasen. Ich redete mir ein, diese Dinge zu tun, weil ich in Paris war, um Französisch zu lernen, und beschlossen hatte, mit jedem zu sprechen, der mit mir sprechen wollte. Aber den ganzen Sommer hindurch war mir bewusst, dass Soraya in der Nähe sein könnte, irgendwo in dieser Stadt, dass ich ihr nahe war und nahe an etwas in mir selbst, was mich anzog und mir ein wenig Angst machte, genau wie sie. Sie war bei einem Spiel, das nie ein bloßes Spiel gewesen war, weiter gegangen als irgendjemand, den ich kannte – ein Spiel, bei dem es um Macht und Angst ging, um die Weigerung, sich mit den Verletzlichkeiten, die einem in die Wiege gelegt sind, abzufinden.
Aber ich selbst war nicht fähig, dabei sehr weit zu gehen. Ich glaube, ich hatte nicht den Mut, und nach jenem Sommer war ich nie wieder so keck oder leichtsinnig. Ich hatte einen Freund nach dem anderen, die alle sanft waren und sich ein wenig vor mir fürchteten, dann heiratete ich und bekam zwei eigene Töchter. Die älteste hat das sandfarbene Haar meines Mannes – wenn sie durch ein Kornfeld liefe, könnte man sie leicht aus den Augen verlieren. Die jüngere dagegen sticht hervor, wo auch immer sie ist. Sie wächst und entwickelt sich im Kontrast zu allem, was sie umgibt. Es ist falsch, ja sogar gefährlich zu glauben, jemand könnte sich sein Aussehen im Geringsten aussuchen. Und doch möchte ich schwören, dass meine Tochter etwas mit dem schwarzen Haar und den grünen Augen zu tun hatte, die immer Aufmerksamkeit erregen, sogar inmitten einer Schar anderer Kinder. Sie ist erst zwölf und noch klein, aber schon schauen Männer nach ihr, wenn sie die Straße entlanggeht oder mit der Subway fährt. Und sie duckt sich nicht oder setzt ihre Kapuze auf oder versteckt sich hinter den Kopfhörern, wie ihre Freundinnen es tun. Sie steht aufrecht und still wie eine Königin. Sie hat einen Stolz, der sich nicht kleinhalten lässt, aber wenn es nur das wäre, hätte ich wohl kaum Angst um sie bekommen. Was mich erschreckt, ist die Neugier, ihre eigene Macht zu erproben, wie weit sie reicht und wo ihre Grenze ist. Obwohl die Wahrheit sein mag, dass ich sie, wenn ich nicht um sie fürchte, vielleicht beneide. Eines Tages sah ich es: Wie sie den Blick des Mannes im Geschäftsanzug, der ihr in der Subway gegenüberstand und sie mit den Augen durchbohrte, erwiderte. Ihr Starren war eine Herausforderung. Wäre eine Freundin bei ihr gewesen, hätte sie ihr vielleicht langsam das Gesicht zugewandt, ohne den Blick von dem Mann zu lösen, und etwas zum Kichern gesagt. Das war der Moment, in dem ich mich an Soraya erinnerte, und seitdem fühle ich mich, anders kann ich es nicht nennen, von ihr verfolgt. Von ihr und der Art, wie man jemanden erleben kann und dieses Erlebnis erst ein halbes Leben später reift, aufbricht und sich offenbart. Soraya mit ihrem flaumigen Oberlippenbart, dem geschwungenen Lidstrich und ihrem Lachen, jenem tiefen Lachen, das aus ihrem Bauch kam, als sie uns von der Erregung des holländischen Bankers erzählte. Er hätte sie mit einer Hand zerbrechen können, aber entweder war sie schon gebrochen, oder sie würde nicht brechen.
Sussja auf dem Dach
Die Füße in die Teerpappe gestemmt, zweiundzwanzig Stockwerke über der 110th Street, seinen neugeborenen Enkelsohn wiegend – wie war er dort hinaufgelangt? Keine einfache Sache, wie sein Vater sagen würde. Einfachheit war nicht sein Erbe.
Um von vorne zu beginnen: Brodman war zwei Wochen lang tot gewesen, aber dann, leider, auf diese Welt zurückgekehrt, wo er fünfzig Jahre mit dem Versuch verbracht hatte, unnötige Bücher zu schreiben. Nach der Operation eines Darmtumors hatte es Komplikationen gegeben. An ein Beatmungsgerät angeschlossen, mit Beuteln für jede hinein- oder herauslaufende Flüssigkeit, lag sein Körper fünfzehn Tage lang auf einem fahrbaren Krankenbett und führte einen mittelalterlichen Krieg gegen eine doppelseitige Lungenentzündung. Zwei Wochen lang hing Brodman in der Schwebe, tot und doch nicht tot. Wie das Haus im Buch Levitikus war er vom Aussatz befallen: Sie schabten ihn sauber und nahmen ihn auseinander, Stein für Stein. Entweder würde es helfen oder nicht. Entweder wäre der Aussatz verschwunden, oder er hätte ihn schon ganz durchdrungen.
Während er auf das Urteil wartete, hatte er wilde Träume. Solche Halluzinationen! Vollgepumpt mit Medikamenten, bei steigender Temperatur, träumte er, der Anti-Herzl zu sein,