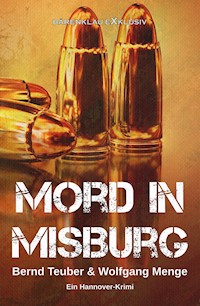3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Frau wird erschossen. Kurze Zeit später sehen Bewohner des Hauses vom Fenster aus einen Mann auf die Straße laufen und identifizieren ihn zweifelsfrei als den Ehemann der Ermordeten. Eigentlich ein klarer Fall!
Doch weit gefehlt: Der vermeintliche Täter hat für die Tatzeit ein handfestes Alibi, ein gusseisernes sozusagen, und auch gar kein Motiv. Beweise, den Mörder zu überführen, werden wie Nadeln im Heuhaufen gesucht und letztlich durch Oberkommissar Iversen, dem Leiter der Mordkommission, auch gefunden …
Wolfgang Menge war Journalist und Drehbuchautor. Er schrieb zwischen 1958 und 1968 nahezu alle Drehbücher für die legendäre Fernseh-Krimiserie »Stahlnetz«, die oft zu sogenannten »Straßenfegern« wurden. Einige davon wurden auch als Kriminalromane publiziert, wie dieser hier vorliegende. Weiterhin schrieb er zahlreiche »Tatort«-Drehbücher. Aus seiner Feder stammt auch die satirische Familienserie »Ein Herz und eine Seele« mit Heinz Schubert als »Ekel« Alfred Tetzlaff in der Hauptrolle, welche deutsche Fernsehgeschichte schrieb.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Wolfgang Menge
Das gusseiserne Alibi
Ein Kriminalroman
aus der Reihe »Im Netz des Verbrechens«
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer nach Motiven, 2023
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Alle Namen und Personen, Firmen und Vorgänge sind frei erfunden. Nur die Verhältnisse sollen an die Bundesrepublik erinnern.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Weitere Romane von Wolfgang Menge sind ebenfalls erhältlich oder befinden sich in Vorbereitung
Das Buch
Eine Frau wird erschossen. Kurze Zeit später sehen Bewohner des Hauses vom Fenster aus einen Mann auf die Straße laufen und identifizieren ihn zweifelsfrei als den Ehemann der Ermordeten. Eigentlich ein klarer Fall!
Doch weit gefehlt: Der vermeintliche Täter hat für die Tatzeit ein handfestes Alibi, ein gusseisernes sozusagen, und auch gar kein Motiv. Beweise, den Mörder zu überführen, werden wie Nadeln im Heuhaufen gesucht und letztlich durch Oberkommissar Iversen, dem Leiter der Mordkommission, auch gefunden …
Wolfgang Menge war Journalist und Drehbuchautor. Er schrieb zwischen 1958 und 1968 nahezu alle Drehbücher für die legendäre Fernseh-Krimiserie »Stahlnetz«, die oft zu sogenannten »Straßenfegern« wurden. Einige davon wurden auch als Kriminalromane publiziert, wie dieser hier vorliegende. Weiterhin schrieb er zahlreiche »Tatort«-Drehbücher. Aus seiner Feder stammt auch die satirische Familienserie »Ein Herz und eine Seele« mit Heinz Schubert als »Ekel« Alfred Tetzlaff in der Hauptrolle, welche deutsche Fernsehgeschichte schrieb.
***
Der Autor Wolfgang Menge
Wolfgang Menge wurde 1924 in Berlin geboren. Er war Journalist und Drehbuchautor. Zwischen 1958 und 1968 schrieb er nahezu alle Drehbücher für die legendäre Fernseh-Krimiserie STAHLNETZ, die oft zu sogenannten »Straßenfegern« wurden. Einige davon wurden auch als Kriminalromane publiziert, wie dieser hier vorliegende.
Weiterhin schrieb er zahlreiche TATORT-Drehbücher. Aus seiner Feder stammt auch die satirische Familienserie EIN HERZ UND EINE SEELE mit Heinz Schubert als »Ekel« Alfred Tetzlaff in der Hauptrolle, welche deutsche Fernsehgeschichte schrieb. Er war bis ins hohe Alter tätig, bevor er 2012 in Berlin verstarb.
Die Edition Bärenklau legt einen Teil aus dem Nachlass des Autors neu auf und veröffentlicht seine Werke als eBook sowie als Printausgabe.
***
Diese Geschichte ist wahr. Sie hat sich so zugetragen, wie sie hier aufgezeichnet wurde.
Deshalb werden Sie auch keinen Detektiven von übermenschlichen Gaben begegnen, sondern Schritt für Schritt mit den Beamten der Mordkommission einer rheinischen Großstadt die Aufklärung eines Verbrechens verfolgen. Es ist nur aufgeschrieben worden, was die Ermittlungen der Beamten tatsächlich ergeben haben. Nur die Namen von Personen und Orten wurden geändert, um überlebende Zeugen und Unschuldige zu schützen.
Sie lesen kein Erzeugnis der Fantasie, sondern einen dramatischen Bericht von der Arbeit Ihrer Polizei.
Ihr Wolfgang Menge
***
Das Zustandekommen dieses Buches verdankt der Autor vielen Privatpersonen und Institutionen.
Sein Dank gilt vor allem:
DR. WEBER, dem Leiter des Landeskriminalamtes von Nordrhein-Westfalen.
JÜRGEN ROLAND, dem Regisseur und Redakteur der Fernsehsendung »Stahlnetz«.
Dem Nordwestdeutschen Rundfunkverband (NWRV), Kriminalbeamten von Dortmund und Düsseldorf.
***
1. Kapitel
Dienstag, der 18. April. Der Sommer hatte dieses Jahr früh angefangen. Es war wärmer; nicht nur wärmer als im vorigen Jahr, denn da hatte um diese Zeit noch Schnee gelegen, und die Straßen waren vereist. Die Autobahnen nach dem Süden und dem Osten mussten fast täglich geräumt oder gestreut werden. Aber in diesem Jahr war der April wärmer als in vielen vorangegangenen Jahren, manche Tage so heiß wie kein anderer, seit man vor mehr als hundert Jahren damit begonnen hatte, die tägliche Temperaturmessung zu registrieren.
Die Nächte machten freilich noch nicht mit. So mussten die Beamten, die in der Kriminalwache auf einen warmen Tag warteten, in dicken Wolljacken dasitzen, denn die Stadtverwaltung hatte sich schnell mit den höheren Tagestemperaturen abgefunden und das Heizen eingestellt.
»Wenn der Winter früh anfängt, dann wird nach dem Kalender geheizt«, murmelte Obersekretär Nehr, der gerade über die Beziehungen zwischen Kalender, Vorschriften und den ständig wachsenden Kohlenhaldenbeständen nachgedacht hatte. »Beim Sommer ist das natürlich anders. Da setzt sich die Verwaltung leichter über die Heizvorschriften hinweg.«
Es war eine ruhige Nacht. Die Mordkommission bestand aus zwölf Beamten; Nehr war einer von ihnen. An manchen Tagen schien es, als sei die Kommission überbesetzt, an anderen hätte man hundert Beamte beschäftigen können. Dann blieb zum Schlafen kaum Zeit.
Die Nacht vom 18. zum 19. April war eine von den ruhigen Nächten.
Bis ein Uhr achtundfünfzig.
Die Mordkommission hat keine besondere Nachtwache. Ihre Beamten haben Nachtdienst mit der allgemeinen Kriminalwache. Dieses Mal war Nehr zufällig dabei. Wenn Beamte der Mordkommission gebraucht werden, holt man sie aus den Betten. Wenn sie verschlafen ’raus kriechen, dann haben sie noch keine Ahnung, wann sie ihr Bett wiedersehen.
Oberkommissar Iversen, der Leiter der Mordkommission, wurde um zwei Uhr aus dem Schlaf gerissen, ebenso die Beamten des Erkennungsdienstes, die für einen bestimmten Fall der Kommission zugeteilt werden.
Um zwei Uhr sechsundvierzig waren alle Beamten, die an dem Fall zu arbeiten hatten, am Tatort eingetroffen.
Der Mord war um ein Uhr einundfünfzig der Revierwache 23 gemeldet worden. Hauptwachtmeister Stahmer hatte sich sofort an den Tatort begeben, sein Kollege Lüttjohann sofort die Kripo und den Arzt alarmiert. Die Leiche war schon zugedeckt.
So wie sie aufgefunden worden war, hatte man sie auf dem Sofa liegen lassen, nur ihr linkes Bein hing herab. Wahrscheinlich war die Frau nach den Schüssen auf das Sofa gesunken, oder sie hatte sich dorthin geschleppt, nachdem die tödlichen Schüsse sie getroffen hatten. Sie war noch im Nachthemd und hatte sich nur eine Jacke übergezogen. Im Haar hingen acht Lockenwickler, aber das würde dem Leichenfriseur die Arbeit kaum erleichtern.
Alle drei Schüsse hatten die junge Frau in die Brust getroffen. »Neun Blutbahnen«, meinte der Beamte des Erkennungsdienstes sachlich.
Iversen hörte nicht hin. Er starrte auf das Gesicht der Toten, die Decke hatte er etwas zurückgeschlagen. Als ob das nun wichtig war, in wie viele Ströme sich das Blut geteilt hatte. Die Frau war tot, eine junge, offenbar hübsche, etwas traurige Frau. Warum wurde sie erschossen?
Iversen gehörte nicht zu jener Gruppe von Beamten, die methodisch an ihre Fälle herangehen. Er versuchte jedes Mal, das Besondere herauszufinden. Dennoch machte er sich nichts vor. Er wusste genau, dass er beim Anblick der Leiche nichts entdecken würde.
Als Nehr ins Zimmer trat und seinen Chef erblickte, fiel ihm auch auf, dass Iversen gar nicht die Tote ansah. Iversen träumte. Selbst als er jetzt die Decke wieder über ihr Gesicht zog, schienen seine Augen irgendetwas jenseits der kalkverputzten Küchenwand zu beobachten.
Sentimentalität war es nicht. Das wusste Nehr, das weiß jeder Polizist. Kriminalbeamte, besonders die von der Mordkommission, kennen keine Sentimentalität, jedenfalls nicht, was Tote betrifft. Für sie sind Menschen, die gewaltsam aus dem Leben schieden, fast, was dem Maurer die Kelle ist. Sie sind Objekte der Arbeit. Wenn sie Pech haben, sehen sie in einer Woche sieben.
Übertriebenes Mitleid würde die Arbeit behindern, ja in manchen Fällen vielleicht sogar die Ermittlung des Täters unmöglich machen. Das ist oft schwer einzusehen. Selbst enge Freunde Iversens zucken manchmal zusammen, wenn sie ihn von seiner Arbeit sprechen hören. Seine Frau hat sich dran gewöhnt. Auch sein Sohn. Nur die Freunde nicht. Sie trauen ihm kein Zartgefühl mehr zu. Die Arbeit hat ihn abgestumpft, meinen sie. Aber das ist Unsinn. Sie ahnen nicht, wie viel Geduld, wie viel Mitgefühl, wie viel Einfühlungsvermögen, wie viel Sympathie nötig sind, um überhaupt erfolgreich arbeiten zu können.
Die Kriminalbeamten, die ihre Karriere bei der Schutzpolizei begannen, haben das oft in ihren ersten Jahren auf den Revierwachen lernen müssen. Wer es nicht gelernt hat, ist kein guter Polizist. Auch davon gibt es genug. Auch sie tragen Uniform. Leider. Den guten ist eben nur die Scheu vor dem Tode abhandengekommen; aber das findet man auch in anderen Berufen.
Endlich trat Iversen einen Schritt zurück und fluchte sofort. Er war mit seinem Schuh in einen Scherbenhaufen geraten. Erst jetzt sah er sich in dem Raum um. Links stand ein Gasherd, daneben ein Tisch mit vier Stühlen. An der rechten Seite das Sofa; quer dazu, neben der Tür, der Küchenschrank, von dem das Oberteil, der Aufsatz, auf den Boden gestürzt war.
Nehr meinte: »Bei uns hat es auch mal so ähnlich ausgesehen. Am 14. Juli 1943.«
Der Fotograf kam durch die offenstehende Tür und ein anderer Beamter des Erkennungsdienstes mit seinem Koffer. Nehr ließ beide durchgehen. Die Spuren waren noch nicht alle gesichert. Nehr ließ sich nicht unterbrechen: »Aber damals war auch nebenan ’ne kleine Bombe gefallen. Ich wollte gerade aufräumen, da gab es wieder Alarm und hinterher nichts mehr zum Aufräumen.«
Der Fotograf hatte die Decke von der Toten ’runtergenommen und stieß jetzt Nehr grinsend in die Seite. »Das Büfett ist dir ’runtergefallen.« Ihm verging das Grinsen sofort, als er den Blick Iversens sah. Er entschuldigte sich schnell: »War ja nur ein Spaß, Herr Iversen.«
»Ich kenn’ auch ein paar Späße«, sagte Iversen leise, »wenn Sie darüber lachen, dürfen Sie wieder welche machen.« Wütend stampfte Iversen aus der Küche heraus. Vom Korridor warf er noch einen Blick hinein.
Er beobachtete die Beamten bei der Arbeit. Der Mann vom Erkennungsdienst brachte an den vorher von seinem Kollegen angekreuzten Stellen kleine Tafeln mit Nummern an und machte sich Notizen.
Später sollte man genau erkennen können, wo man das alles gefunden hatte: die Patronenhülsen, die Einschüsse, das zerbrochene Geschirr und die Blutflecken.
Nehr sagte leise zu Iversen: »Die Frau muss sich ganz schön gewehrt haben.«
Iversen verzog keine Miene: »Niemand lässt sich gern abknallen.«
»Natürlich nicht.«
Aber der Kampf beschäftigte Iversen doch. Er murmelte, als stelle er sich selbst laut ein paar Fragen: »Wenn der Kerl eine Pistole hatte …« Er brach ab und wandte sich um. Doch Nehr wusste, was der Chef hatte sagen wollen. Wie konnte es zu einem Kampf kommen, wenn der Mann eine Pistole hatte. Also war er wahrscheinlich nicht mit der Absicht gekommen, die Frau umzubringen. Vielleicht wollte er etwas anderes. Vielleicht, vielleicht, vielleicht.
Iversen zog eine Schachtel Zigaretten aus der Tasche. Mechanisch hielt er sie Nehr hin. Doch bevor der zugreifen konnte, steckte Iversen die Schachtel wieder in die Tasche.
»Wo ist der Wachtmeister vom Revier?«
»Hauptwachtmeister! – Hauptwachtmeister Stahmer ist bei der Tochter.«
»Bei der Tochter?«
»Die Frau hatte ein Mädchen, vier Jahre alt. Monika heißt sie.«
»Auch das noch.« Iversen zündete sich ärgerlich seine Zigarette an. »Weiß sie schon …?«
Nehr wartete das Ende der Frage nicht ab. Er schüttelte den Kopf: »Ich glaube nicht. Der Stahmer meint, es wäre vielleicht besser, wir würden erst mal abwarten.«
»So, das meint der Stahmer. Und was will er abwarten? Na, ist auch egal. Das hat Zeit.«
Iversen öffnete unvermittelt eine Tür. Sie führte ins Wohnzimmer. Er blickte nur flüchtig hinein. Schien nur selten benutzt worden zu sein. Offenbar lebte die Familie vor allem in der Küche. Das Sofa dort deutete ja auch darauf hin.
Nehr blickte Iversen über die Schulter. Plötzlich fragte ihn Iversen: »Wo ist eigentlich der Ehemann?« Und als Nehr zunächst stumm blieb, setzte er hinzu: »Oder gibt es keinen?«
»Doch, ich glaub’ schon. Aber ich weiß noch nichts über ihn. Ich bin ja auch eben erst gekommen. Er heißt Krützfeld.«
»Wie seine Frau. Das hab’ ich mir schon gedacht.«
»Er heißt Hans. Aber ist offenbar nicht zu Hause.«
»Seh’n Sie, das ist mir auch schon aufgefallen. Beobachtungsgaben und Verstand, das sind die beiden Hauptvoraussetzungen für einen Kriminalisten. Das können Sie in jedem Roman der Gattung leicht erkennen. Sie haben beides, Nehr, in einem Ausmaß, dessen sich kein Dichter erfreuen kann.«
Nehr wurde rot. So war der Chef nur selten. Er muss sich über irgendwas geärgert haben, dachte Nehr. Dabei war Iversen nur unausgeschlafen. Am Abend hatte er Besuch gehabt; Gäste, die kein Ende finden konnten. Er hatte kaum eine Stunde geschlafen.
Doch so schnell ließ sich Nehr nicht einschüchtern: »Ich wollte nur sagen, dass er diese Nacht wohl noch nicht hier war. Sein Bett im Schlafzimmer ist unbenutzt.«
»Hätten Sie mich eine Stunde eher geholt, dann wäre mein Bett auch unbenutzt gewesen, und ich war doch den ganzen Abend zu Hause.«
»Und das Bett Ihrer Frau?«, fragte Nehr und lächelte dabei ein bisschen.
Jetzt musste auch Iversen grinsen: »Nein, das wäre dann auch noch unbenutzt gewesen.«
»Aber vielleicht haben Sie doch recht, Herr Iversen«, begann Nehr jetzt. »Die Leute, die unten wohnen«, er holte sein Notizbuch aus der Tasche und schlug es auf, »sie heißen Butenschön, also die sagen, dass der Ehemann seine Frau erschossen habe. Sie haben ihn gehört und gesehen.«
»So, haben sie? Dann bleibt uns ja kaum was zu tun.«
»Soll ich sie herbestellen?«
Iversen schüttelte den Kopf. »Wir werden ’runtergehen. Ich will mir sowieso das Haus noch mal ansehen.« Draußen war noch alles still. Iversen versteckte seine Hände in den Taschen seines Mantels. »Verflucht kalt noch«, schimpfte er.
»Das hab’ ich schon gemerkt. Es wird nicht mehr geheizt im Präsidium.«
Iversen blieb einen Augenblick vor dem Haus stehen. Dann ging er auf die Straße zu, die etwa achtzig Meter vom Haus entfernt vorüberführte. Eine seltsame Straßenlaterne erhellte nur wenig von der Umgebung. Unter der Laterne parkten drei Autos; alle drei gehörten zur Polizei. Sonst war nichts zu sehen.
Das Haus lag einsam. Es war für eine Familie gebaut worden, jetzt wohnten zwei dort: Krützfeld und Butenschön. Letztere hatten noch Untermieter. Sie wohnten im Erdgeschoss, und die untere Wohnung besaß zwei Zimmer mehr als die darüber liegende.
Ein Zimmer war an Frau Straßburg vermietet, eine Witwe mit ihrem sechzehnjährigen Sohn Oskar. Frau Straßburg benutzte aber ihr Zimmer schon seit zwei Jahren nicht mehr, seit zwei Jahren lag sie im Hospital. Oskar hatte sich etwas der kinderlosen Familie Butenschön angeschlossen. Aber er ließ sich wenig sagen und tat, was er für richtig hielt. Und er hielt manches für richtig, was nicht immer den Beifall des Ehepaares Butenschön fand. Oskar hatte übrigens die Polizei benachrichtigt. Von dem Überfall hatte er freilich nichts gehört, er war nicht einmal aufgewacht, als der schwere Aufsatz des Küchenschranks auf den Fußboden knallte.
Als Iversen an der Straße stand, drehte er sich zum Haus. »Für einen Überfall wie geschaffen. Dunkel, einsam. Ein Täter kann nach allen Seiten entkommen. Er braucht die Örtlichkeiten nicht mal genau zu kennen.«
»Unser Mann wird sie aber gekannt haben. Mindestens wird er Schlüssel gehabt haben müssen, denn das Haus war abgeschlossen worden. Butenschön sagte, er habe um zwölf abgeschlossen, nachdem Oskar nach Hause gekommen war.«
»Ich denke, sie haben mit den Butenschöns noch nicht gesprochen?«
»Hauptwachtmeister Stahmer hat es mir erzählt.«
»So, der weiß das alles schon. Na ja. Also – an die Arbeit.« Iversen brauchte gar nicht zu klingeln. Kaum hatte er das Haus wieder betreten, öffnete sich schon die Wohnungstür der Erdgeschosswohnung. Mit einem Bademantel bekleidet, aus dem unten weite Pyjamahosen herausguckten, die fast die Hausschuhe bedeckten, trat Herr Butenschön in den Hausflur.
Als er Oberkommissar Iversen entdeckte, wollte er die Tür wieder schließen: »Verzeihung, ich dachte, Sie wollten zu mir.«
Iversen nickte. »Das wollten wir auch.«
»So!« Butenschön freute sich. »Das trifft sich gut. Wollen Sie ’reinkommen, oder soll ich nach oben kommen?«
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann bleiben wir lieber hier unten. Oben wird gearbeitet. Außerdem kommt gleich der Leichentransportwagen. Und ich habe eine Leidenschaft für Eichenholzsärge.«
Butenschön riss seine Augen auf. Er verstand die Anspielung Iversens nicht.
Iversen erklärte: »Unsere Särge sind aus Zink.«
»Aus Zink? Ach so.« Offenbar konnte Butenschön auch die Vorzüge von Zinksärgen nicht sofort begreifen. »Also dann.«
Er trat zur Seite und ließ Iversen und Nehr in die Wohnung. »Meine Frau ist im Badezimmer«, erklärte er, während er die Wohnungstür schloss, nachdem er sich noch einmal vergewissert hatte, dass auch nicht in irgendeiner Ecke vielleicht noch jemand gestanden hätte. »Also wir haben alles genau verfolgt«, begann Butenschön noch im Korridor. »Meine Frau und ich.« Iversen tat, als ob er verwundert sei und erfreut:
»Alles? Das ist ja fabelhaft. Das erspart uns einen Haufen unnötiger Arbeit.«
»Na ja, hier ist es ziemlich hellhörig.« Butenschön versuchte, seine Verdienste bescheiden hinzustellen. »Besonders nachts, da versteht man jedes laute Wort. Ich sag’ schon immer meiner Frau, wenn sie mal sagt – sie spricht nämlich immer so laut, das hat sie von ihrem Vater, der sprach auch immer so laut, also ich sag’ ihr immer …« Nehr war robuster. Er unterbrach Butenschön, indem er einfach einen Türgriff packte und so tat, als wolle er die Tür jetzt öffnen. Butenschön packte ihn sofort: »Das ist unser Badezimmer. Meine Frau ist grad drin.«
»Oh, Verzeihung«, sagte Nehr. Wenn die Angetraute des redseligen Herrn auch nur entfernte Ähnlichkeit mit ihrem Mann hatte, dann würde sich Nehr freiwillig die Dame bestimmt nicht ansehen, während sie unter der Brause stand. In der Beziehung war Nehr verwöhnt. Aber mit hübschen jungen Damen hatte er dienstlich ohnehin kaum etwas zu schaffen. Die Verbrechen solcher Damen sind nur selten im Strafgesetzbuch verzeichnet. Und das allein war letzten Endes die Anleitung für seine tägliche Arbeit.
Butenschön führte die Herren jetzt endlich ins Wohnzimmer. Iversen war nicht weiter überrascht. Er blickte sich nur kurz um. Das Zimmer sah so aus wie fast alle Wohnzimmer ehrbarer deutscher Familien. Es war zu klein, zu vollgepfropft mit unnötigen Möbeln, in denen unnötige Gegenstände aufbewahrt wurden. Nicht einmal der Tisch war freigelassen worden. Die selbstgehäkelte Decke wurde von einem Engel bewacht, der porzellanweiß glänzte und nur durch goldene Flügel verziert war. Auf dem Büfett standen Obstschüssel, Aschenbecher, Vase, zwei Familienbilder in Silberrahmen und – darauf schien man stolz zu sein – als Krönung ein Fernsehgerät mit 53-cm-Bildschirm.
Iversen ließ sich nicht erdrücken. Nur Nehr dachte, wie immer bei solchen Besuchen, sehnsüchtig an seine Bude. Alle Möbel, die er besaß, bis auf eine Couch, hatte er an einer Wand untergebracht. Wenn er wollte, konnte er zu Hause sogar auf und ab gehen. Freilich, das muss der Ehrlichkeit halber zugegeben werden: Er wollte nie. Die Stunden in seinem Zimmer brachte er meistens auf der Couch zu. Nur wenn Besuch da war – aber so weit kam Nehr gar nicht mit seinen Gedanken.
Butenschön hatte sich hingesetzt. Dann forderte er mit großzügiger Gebärde seine späten Gäste auf, sich ebenfalls niederzulassen. Nehr hatte in der Ecke einen Sessel erspäht; Iversen dankte: »Ich geh’ lieber ein bisschen auf und ab. Ich hoffe, das stört Sie nicht.«
Natürlich störte es Butenschön, aber er sagte: »Durchaus nicht.« Er saß allein am Tisch und musste sich von einer Seite zur andern drehen, wenn er die Herren, mit denen er zu reden beabsichtigte, dabei ansehen wollte.
»Also«, begann er schließlich.
Nehr wollte sich rächen. »Bevor Sie anfangen, stört es Sie wohl, wenn ich rauche?«
»Aber nein.« Butenschön holte den Aschenbecher, stellte ihn neben Nehr und setzte sich wieder. »Ich rauche auch.«
Nehr dankte, machte aber keine Anstalten, sich eine Zigarette anzuzünden. Als er merkte, dass ihn Butenschön erwartungsvoll anblickte, meinte er trocken: »Ich hatte nur vorsichtshalber gefragt. Falls ich nachher rauchen möchte, dann brauche ich Sie nicht zu unterbrechen.«
»Ach so.«
Endlich griff Iversen ein, der bis dahin aus dem Fenster geblickt hatte. Er ließ die Gardine, die er zur Seite gehalten hatte, wieder zurückgleiten: »Sie hatten sicher schon geschlafen. Ich frage nur, weil Sie noch Ihren Pyjama tragen.«
Butenschön blickte auf seine Beine, als bemerke auch er erst jetzt, dass er einen Pyjama trug. Schließlich antwortete er: »Ja, wir hatten schon geschlafen. Das heißt, ich war kurz nach Mitternacht noch mal zur Haustür gegangen und hatte nachgesehen, ob auch abgeschlossen ist. Oskar war nämlich erst spät gekommen. Und er hat das schon mal vergessen. Ich hab’ es ihm tausendmal gesagt. Aber ein so junger Bengel – na, das können sie sich vielleicht vorstellen. Der Vater tot, die Mutter krank, und er kann hier tun und lassen, was er will. Na ja, er hört ja ein bisschen auf uns. Meine Frau hat einen sehr guten Einfluss auf ihn. Wenn ich auch finde, dass sie manchmal ein bisschen großzügig ist …«
Nehr hatte jetzt seine Zigarettenschachtel aus der Tasche geholt; er reichte sie, etwas widerwillig schien es, Herrn Butenschön: »Aber Sie wollten uns doch sicher nicht von Oskar erzählen?«
Butenschön nahm schnell eine Zigarette: »Nein, natürlich nicht. Ich wollte damit nur sagen, dass ich noch nicht fest geschlafen hatte, als plötzlich, so gegen zwei – kurz vorher muss es sogar gewesen sein, denn ich hab’ gleich nach der Uhr gesehen. Ich wollte sehen, ob ich schon geschlafen hatte. Man weiß das ja nicht immer.«
»Nein, manchmal merkt man es gar nicht.« Ganz kühl kam Iversens Stimme vom Fenster, sodass sich Butenschön fast erschrocken hätte. Doch er hatte sich schnell wieder gefangen.
»Na ja. Da hörten wir also den Lärm von oben. Ich wollte Maria wecken, Maria ist meine Frau. Aber die war schon wach. ›Die krachen sich schon wieder‹, sagte sie. Ich sag’: ›Von mir aus können die sich jeden Tag krachen, nur nicht, wenn ich mal schlafen will!‹«
»Woher haben Sie denn gewusst, dass da oben Krach war? – Ich meine, dass sich die Leute, die Sie hörten, gestritten haben?«, fragte Nehr.
»Na, aber«, Butenschön war etwas ärgerlich. »Das hört man doch, ob sich da jemand streitet oder ob der Krützfeld seiner Frau eine Liebeserklärung macht.«
Jetzt fragte Iversen: »Haben Sie vielleicht, wenn es so laut war, wie Sie sagen, etwas verstanden? Irgendein Wort oder einen Satz?«
»Also, sie hab’ ich verstanden, ihn nicht. Er sprach nicht so laut. Aber ich hab’ genau verstanden, wie sie zweimal hintereinander geschrien hat: ›Hans, lass das!‹ Und das hat meine Frau auch gehört.«
»Herr Krützfeld heißt Hans?«, wollte Iversen wissen.
»Ja, der heißt Hans.«
»Aber Sie haben gehört, dass er geredet hat?«, wollte Nehr nun wissen.
»Sie meinen, dass wir ihn überhaupt gehört haben? Natürlich! Wir haben nur nichts genau verstanden. Aber gehört haben wir ihn schon. Und dann kam der Knall.«
»Die Schüsse?«
»Die Schüsse kamen später. Nein, ich mein’ den Knall. Ich hab’ gedacht, die Decke stürzt ein. Aber es war nur der Aufsatz vom Küchenschrank.«
»Woher wussten Sie denn, dass es der Aufsatz vom Küchenschrank war?«, fragte Nehr weiter.
»Na, das hab’ ich doch gesehen. Später. Nachher. Als wir nach oben gingen.«
Iversen mischte sich jetzt wieder ein. Er tat, als würden ihn Nehrs Fragen nur ärgern: »Sie sagten eben, Sie hätten gehört, wie Frau Krützfeld zweimal ausrief: ›Hans, pass auf!‹ oder so …«
»Hans, lass das!«, verbesserte Butenschön.
Iversen nickte; er hatte nur wissen wollen, ob Butenschön den Satz genau behalten hatte. »›Hans, lass das!‹ also. Gut. Und danach kam der Knall, ich meine das Poltern vom Küchenaufsatz? Stimmt das so? Oder kam vielleicht erst das Poltern und dann der Ausruf?