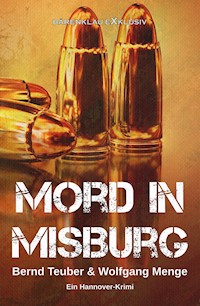3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Am Silvesterabend wird der Polizei der Mord an einem Rentner gemeldet. Die Frau, welche die Anzeige erstattet hat, Untermieterin des Ermordeten, gerät in den Verdacht, die Täterin zu sein. Erschwerend für sie ist, dass sie vor Kriegsausbruch zu fünfzehn Jahren Gefängnis wegen Gattenmordes verurteilt worden war.
Bei der Überprüfung aller Spuren stößt die Kriminalpolizei auf ein Mädchen, das – mit einem grünen Rock bekleidet – den Ermordeten mehrmals besucht haben soll. Die Auffindung dieser Zeugin ist schwierig. Aber ihre Aussage wird für die Polizei von größter Bedeutung sein …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Wolfgang Menge
Die Zeugin im grünen Rock
Ein Kriminalroman
aus der Reihe »Im Netz des Verbrechens«
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Coverbild: © by Christian Dörge, 2023
Korrektorat: Christian Dörge
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Weitere Romane von Wolfgang Menge sind ebenfalls erhältlich oder befinden sich in Vorbereitung
Das Buch
Am Silvesterabend wird der Polizei der Mord an einem Rentner gemeldet. Die Frau, welche die Anzeige erstattet hat, Untermieterin des Ermordeten, gerät in den Verdacht, die Täterin zu sein. Erschwerend für sie ist, dass sie vor Kriegsausbruch zu fünfzehn Jahren Gefängnis wegen Gattenmordes verurteilt worden war.
Bei der Überprüfung aller Spuren stößt die Kriminalpolizei auf ein Mädchen, das – mit einem grünen Rock bekleidet – den Ermordeten mehrmals besucht haben soll. Die Auffindung dieser Zeugin ist schwierig. Aber ihre Aussage wird für die Polizei von größter Bedeutung sein …
***
Der Autor Wolfgang Menge
Wolfgang Menge wurde 1924 in Berlin geboren. Er war Journalist und Drehbuchautor. Zwischen 1958 und 1968 schrieb er nahezu alle Drehbücher für die legendäre Fernseh-Krimiserie STAHLNETZ, die oft zu sogenannten »Straßenfegern« wurden. Einige davon wurden auch als Kriminalromane publiziert, wie dieser hier vorliegende.
Weiterhin schrieb er zahlreiche TATORT-Drehbücher. Aus seiner Feder stammt auch die satirische Familienserie EIN HERZ UND EINE SEELE mit Heinz Schubert als »Ekel« Alfred Tetzlaff in der Hauptrolle, welche deutsche Fernsehgeschichte schrieb. Er war bis ins hohe Alter tätig, bevor er 2012 in Berlin verstarb.
Die Edition Bärenklau legt einen Teil aus dem Nachlass des Autors neu auf und veröffentlicht seine Werke als eBook sowie als Printausgabe.
***
Diese Geschichte ist wahr. Sie hat sich so zugetragen, wie sie hier aufgezeichnet wurde.
Deshalb werden Sie auch keinen Detektiven von übermenschlichen Gaben begegnen, sondern Schritt für Schritt mit den Beamten der Mordkommission einer rheinischen Großstadt die Aufklärung eines Verbrechens verfolgen. Es ist nur aufgeschrieben worden, was die Ermittlungen der Beamten tatsächlich ergeben haben. Nur die Namen von Personen und Orten wurden geändert, um überlebende Zeugen und Unschuldige zu schützen.
Sie lesen kein Erzeugnis der Fantasie, sondern einen dramatischen Bericht von der Arbeit Ihrer Polizei.
Ihr Wolfgang Menge
***
1. Kapitel
Auch am Ende dieses Jahres war den Halbbeamten von den Zeitungen und den Rundfunkstationen nichts Besseres eingefallen als in den Jahren vorher. Zu diesem Festtag des Kalenders schickten sie wie jedes Jahr ihre Reporter auf die Straßen, in Läden, Werkstätten und Büros, um zu ergründen, was sich die Bürger, die Leser, Hörer oder Zuschauer also, wohl für das kommende Jahr wünschten. Freilich hatte sich diesmal noch das Fernsehen in die offenbar beliebte Umfrage eingeschaltet, aber das blieb die einzige Neuheit.
Überraschend war nur, dass die Sehnsüchte, die Hoffnungen, die Sorgen im ganzen Lande ziemlich gleich zu sein schienen. Der Staat, die neue Republik, war noch frisch, vor Kurzem erst notdürftig errichtet, mit neuen Wänden, sodass ein paar Risse niemanden verwundert hätten. Aber die Bewohner waren schon so zufrieden, als hätten sie Hunderte von Jahren an diesem Staat gebaut und ihn nun schließlich fertig; als seien sie endlich am Ziel ihrer ewigen Wünsche.
Eine Hausfrau aus dem Ruhrgebiet sagte es so: »Ich möchte, dass im kommenden Jahr alles so bleibt, wie es dieses Jahr gewesen ist.« Die übrigen Antworten klangen nur wie ein tausendfältiges Echo, sie unterschieden sich bestenfalls im Dialekt.
Freilich kamen da und dort aus einzelnen Städten, aus anderen Landschaften, wirkliche Wünsche zum Vorschein. Aus Berlin zum Beispiel, was niemanden verwunderte, aber auch aus Stuttgart und aus München. Aber die anderen hörten nicht hin, und am Ende merkten sie auch gar nicht, dass man die Sorgen mit ganz anderen Gedanken verband.
Überdies wollte man gesund sein und bleiben oder werden, wenn man krank war, in München genauso wie in Köln oder Berlin. So blieb eine gewisse Gemeinsamkeit erhalten.
Wer von den paar Nachdenklichen im Lande die Hoffnung auf seine Nation noch immer nicht aufgegeben hatte, wurde durch die Antworten verwirrt und erschüttert, je nach Temperament. Doch im Grunde hatte man nichts anderes erwartet. Die Menschen waren mit ihrem Leben zufrieden; sie hatten endlich wieder Wohnungen bezogen die alten waren ihnen vor vielen, fast vergessenen Jahren zerbombt worden, sie hatten genug zu essen, soviel sogar, dass sie, um alles aufzubewahren, dringend riesige Kühlschränke anschaffen mussten.
Das gerade zu Ende gehende Jahr war also zu beneiden. Die letzten Wünsche waren erfüllt worden. Das neue Jahr nahm die Verpflichtung auf sich, alles zu erhalten. Bis dahin fehlten nur noch dreieinhalb Stunden.
Doch als wolle das alte Jahr zeigen, dass es selbst lange nicht so zufrieden war wie die vielen Leute, die da befragt worden waren, machte es einen unerwarteten Seitensprung. In das eintönige Konzert des Wohllebens und der Zufriedenheit fügte es eine kurze Dissonanz. Die publizistischen Einrichtungen, die am Tage vorher noch die Behaglichkeit ihrer Kunden veröffentlicht hatten, mussten nun ein Ereignis melden, dessen überlebende Hauptpersonen, wenn man sie gefragt hätte, bestimmt nicht das kommende Jahr so verbringen wollten wie das alte. Sie wollten im Gegenteil alles ganz anders haben. Freilich wurde das Konzert durch sie kaum gestört, aber die kurze Dissonanz, die wenigen falschen Töne sollten nicht vergessen werden.
Mit diesem aufwendigen Vorbericht soll das Geschehene auf keinen Fall überbewertet werden; er will nur die Aufmerksamkeit erwecken, die er verdient.
*
An diesem 31. Dezember konnten nicht alle Bewohner der Stadt mit Schnaps, Sekt und Knallfröschen das neue Jahr begrüßen oder das alte verabschieden. Nicht jeder konnte mit Lärm und Getöse die Teufel des alten Jahres vertreiben, damit sie nicht mit über die Schwelle des neuen Jahres schritten. Einige hatten ihren Dienst, der keine Pausen kennt. Die Ärzte, die Schaffner der Eisenbahn, der Vorortzüge und Straßenbahnen; die Kellner und Musiker, Taxifahrer und Polizisten.
Polizeimeister Kralow hatte es sich auf seinem Landposten gemütlich gemacht. Er hatte den Ofen vollgeknallt, und durch die gegen Zugluft gut abgedichteten Türen und Fenster sah er die sausenden Raketen mehr, als dass er sie hörte.
Sein Landposten war besonders angenehm, denn er verband die Vorzüge des Landlebens mit den Genüssen der Stadt. Die Straßenbahn brachte ihn, wenn er es so wünschte, in zwanzig Minuten zum Zentrum einer Stadt, dennoch konnte er die Stille genießen und die kraftstrotzende Luft des Landes atmen.
So war Kralow naturgemäß ein bisschen verärgert, als gerade an diesem Abend, an dem er sich zur Ruhe entschlossen hatte und höchstens damit rechnen musste, dass einer der Kanonenschläge entzündenden Bengels sich verletzte, plötzlich abends um zwanzig Minuten vor neun eine aufgeregte Frau in die Wache kam.
Die Frau war offenbar gerannt, denn sie konnte kaum stehen, als sie die Tür wieder hinter sich geschlossen hatte; sie presste ihre rechte Hand an ihr Herz, als habe sie da Schmerzen.
Sie öffnete den Mund, als wolle sie etwas sagen, aber sie kriegte kein Wort heraus. Kralow sah sich das einen Moment mit an, dann stand er auf, kam hinter seiner Barriere hervor und fasste die Frau vorsichtig an die Schulter und zog mit der anderen Hand einen Stuhl heran.
»Beruhigen Sie sich erst mal«, sagte er leise.
Die Frau nickte, sagte aber noch immer nichts. Er drückte sie auf den Stuhl und marschierte wieder auf seinen Platz. Heimlich zog er, während er weiter die Frau beobachtete, seine Stiefel mit den Beinen zu sich heran an den Schreibtisch. Er*hatte sie vorher ausgezogen und sich die neuen Weihnachtspantoffeln angezogen. Die Stiefel drückten, und bei solchen Temperaturen hatte er leicht kalte Füße. Seine Frau verschrieb ihm Wechselbäder. »Deine Füße sind nicht mehr richtig durchblutet«, behauptete sie. Aber von solchen Sachen wollte er nichts wissen. Dann lieber Pantoffeln, wenn es ohnehin keiner sieht. Die Augen immer auf die Frau gerichtet, die sich nun langsam zu beruhigen schien, mühte er sich an seinen Stiefeln ab. »Was ist denn bloß passiert?«, fragte er schließlich.
Die Frau stöhnte.
Endlich hatte er die Stiefel angezogen, und nun sollte alles der Reihe nachgehen. Schließlich bestanden Vorschriften, und es war bereits ganz klar, dass hier eine Meldung zu schreiben war. Ein Vorfall. Kralow öffnete seine Schreibtischschublade, holte ein von ihm selbst vorbereitetes Formular heraus, legte es vor sich auf die Schreibplatte, tauchte einen Federhalter in das Tintenfass. Dieses Tintenfass war übrigens der einzige private Gegenstand in der Wache, sogar der Kalender war vom Präsidium gestellt, dem er hier, am Rande der Stadt, noch unterstand.
Er hob den Kopf und fragte: »Wie heißen Sie denn?« Dabei versuchte er, seiner Stimme einen harmlosen und freundlichen Klang zu geben, was ihm nur mühsam gelang. Formeln beruhigen immer, dachte er. Und er hatte seine Erfahrungen.
»Fräulein Bertha«, antwortete die Frau. Sie versuchte aufzustehen, setzte sich aber gleich wieder hin.
Kralow wurde ärgerlich: »Mit vollem Namen.«
Aber die Frau schien ihn nicht zu verstehen. Sie wiederholte: »Fräulein Bertha.«
Kralow schrieb den Namen Bertha hin, dann stand er auf und ging an die Barriere, beugte sich zur Frau nieder und fragte noch einmal leise, er nahm sich sehr zusammen dabei: »Ich möchte Ihren Vornamen und Ihren Zunamen wissen. Ihren Nachnamen. Verstanden? Fräulein Bertha ist kein Name. Vorname und Nachname, wie es in Ihrem Ausweis steht.«
»Bertha Kurtz«, sagte die Frau sofort.
Befriedigt setzte sich Kralow an seinen Platz. Langsam, aber deutlich malte er den Namen hin.
Bertha Kurtz. Kralow überlegte einen Moment, ob er den Namen schon einmal vorher gehört hatte, aber er konnte sich nicht erinnern. Immerhin war er schon vierundzwanzig Jahre in dieser Gegend. Als er anfing, war dieser Vorstadtteil noch ein Dorf gewesen, aber besonders nach dem letzten Krieg hatte sich ja so viel verändert. Leute, die hier seit Generationen gelebt hatten, waren plötzlich weggezogen, und andere waren hergekommen. Läden, die hundert Jahre lang den Zucker aus Schubladen verkauft hatten, waren durch glitzernde Geschäfte ersetzt worden, in denen man sich die nötigen Dinge selbst aus den Regalen nehmen konnte.
»Sehen Sie, es geht ja«, sagte Kralow zu seiner späten Besucherin, um ihr Mut zu machen. Sie nickte nervös, und es schien, als wolle sie lächeln. Das gelang ihr allerdings nicht.
Kralow blickte auf sein Formular und fragte die nächste Antwort ab: »Geboren?«
»11.1.07.« Bertha Kurtz antwortete jetzt schnell, als habe sie es plötzlich besonders eilig und müsse die anfangs vertane Zeit wieder aufholen.
»Wo?«, fragte Kralow.
»In Hameln.«
Kralow beugte sich über sein Pult, tauchte die Feder wieder ein, las noch mal alles durch und stolperte plötzlich über den Nachnamen. »Wie schreiben Sie eigentlich Kurtz? Ich habe es mit tz…« Aber Bertha Kurtz ließ ihn nicht ausreden.
»Er ist tot«, sagte sie plötzlich und stand dabei auf. Sie stellte sich dicht an die Barriere.
»Alles mit der Ruhe, auch wenn Silvester ist«, sagte Kralow. »Er ist also tot. Wer ist tot?« Und er machte sich bereit, den Namen hinzuschreiben.
»Walter«, stammelte Frau Kurtz. »Walter ist tot.«
Kralow schrieb den Namen hin und fragte weiter: »Walter wer? Oder ist das der Nachname? Tun Sie mir doch einen Gefallen und antworten Sie gleich vollständig.«
»Ja, natürlich.« Frau Kurtz fasste sich wieder an ihr Herz, aber sie musste ihre Geschichte jetzt loswerden. Sie antwortete schnell und hastig. Zu schnell für Kralow, der ja alles mitschreiben wollte und alles so mitschreiben wollte, wie es auf seinem Formular vorgesehen war.
»Ich hab’ eben zu ihm ins Zimmer gehen wollen, weil der Riegel vor war, der ist sonst nämlich nicht zu, wenn er da ist. Weil der Riegel und da lag …«
»Den Nachnamen!«, unterbrach Kralow eindringlich.
»Politz. Walter Politz. Er wohnt nebenan, und ich habe mich sonst immer um ihn gekümmert. Aber Sie hätten ihn mal sehen sollen. Ich hab’ das ja kommen sehen. Ich hab’ immer zu ihm gesagt …«
»Anschrift?«, fragte Kralow.
»Semmelweg 31. Unten an der Brücke. Alles war voller Blut. Ich bin eben schon an der Sparkasse gewesen, da war noch Licht. Und ich hab’ erst mal sein Konto sperren lassen.«
»Konto?«, fragte Kralow verwirrt. Er hatte kaum zugehört, weil er zunächst einmal die wichtigsten Angaben ordnungsgemäß vervollständigen wollte. Jetzt erst war er bereit zuzuhören, was sich eigentlich zugetragen haben mochte.
»Was für ein Konto denn wohl?«, fragte die Kurtz ironisch zurück. »Natürlich sein Konto. Das Konto von Walter.«
»Und das haben Sie sperren lassen?«, wollte Kralow wissen. Er verstand die Zusammenhänge überhaupt nicht.
»Ja, natürlich. Der Mörder hatte es doch sicher auf sein Geld abgesehen.«
Kralows Augen wurden groß und rund, er war so erschrocken, als habe man vor seinen Augen diesen Unbekannten umgebracht. »Mörder?«, murmelte er nur.
Erst jetzt merkte er, dass seine Besucherin nicht nur erregt, sondern auch hysterisch war. Ihre Stimme überschlug sich, als sie ihm ins Gesicht schrie: »Ja, natürlich. Oder glauben Sie, er hat sich selbst den Schädel eingeschlagen?«
2. Kapitel
Kralow war sofort zum Tatort am Semmelweg gefahren. Natürlich hätte er vorher der motorisierten Funkleitstelle Bescheid sagen müssen. Aber er wollte sich erst einmal selbst von dem Vorfall ein Bild machen. An einem Altjahrsabend wollte er nicht gleich einen Mord melden, wenn er sich nicht selbst davon überzeugt hatte. Es war kein Tag wie jeder andere. Außerdem, und das war ja auch wichtig: Vierundzwanzig Jahre war Kralow nun in dieser Gegend Polizist, doch noch niemals hatte es einen Mord gegeben.
Dies war der erste.
Nach so langer Zeit hatte er nicht mehr damit gerechnet, an der Aufklärung eines Verbrechens beteiligt zu werden, das noch immer mehr als jedes andere die Aufmerksamkeit des breiten Publikums auf sich zieht.
Natürlich verzögerte sich dadurch die Ankunft der Mordkommission um mehr als eine halbe Stunde. Noch wusste niemand, ob diese halbe Stunde vielleicht wichtig sein könnte.
Die Funkleitstelle, die schließlich gegen einundzwanzig Uhr von Kralow benachrichtigt wurde, schickte zunächst, wie es üblich ist, einen Kriminalbeamten der Bereitschaft mit einem Streifenwagen an den Tatort. Vom Streifenwagen aus wurde der Chef der Kriminalpolizei, Dr. Krämer, angerufen. Er musste von jedem Mord verständigt werden. Krämer war gottlob noch nicht aus dem Hause gegangen. Er hatte vor, später zu Freunden zu gehen. Aber bis Mitternacht wollte er ruhig zu Hause bleiben und mit seiner Frau feiern. Die beiden hatten an diesem Abend das seltene Glück, allein zu Hause zu sein. Schon das ist ein Grund zu feiern, wenn man fünf Kinder hat. Dass alle weg waren, passierte sonst nicht einmal in den Ferien.
Krämer erkundigte sich sofort, wer an diesem Abend von der Mordkommission zur Bereitschaft eingeteilt sei. Die Betroffenen brauchten freilich nicht im Präsidium zu warten. Aber man musste wissen, wo sie zu erreichen waren. Bedauerlicherweise reichte der Etat nicht aus, um jedem Mitglied der Kommission zu Hause einen Telefonanschluss zu legen.
Krämer war froh, dass wenigstens der Leiter des Dezernats Telefon zu Hause hatte. Dieser Leiter freilich, Peter Brandis, war ausgerechnet an diesem Abend nicht zur Bereitschaft eingeteilt. Er würde irgendwo Silvester feiern.
Aber Dr. Krämer bestand darauf, dass die ganze Kommission alarmiert würde. Den anrufenden Beamten der Funkleitstelle gab er keine Erklärung dafür. Aber jedermann wusste, dass es zu Krämers Prinzipien gehörte, den Mordkommissar von Anfang an die Untersuchungen eines neuen Falles führen zu lassen.
Besonders jetzt vor einem Feiertag würde, sonst der junge Kommissar Brandis noch einen Tag verlieren, bevor er in die Ermittlungen eingreifen könnte. Und man wusste nie, wie entscheidend gerade die ersten Schritte sein mochten.
»Ich komme später selbst an den Tatort«, erklärte Dr. Krämer. »Haben wir genug Fahrzeuge?«, fragte er noch.
»Genügen drei Wagen, Herr Oberrat?«, fragte der Beamte.
»Natürlich. Lassen Sie zuerst Hartwig abholen. Hartwig kann dann Brandis suchen. Der weiß am besten, wo er ihn heute Abend finden kann. Ein anderer Wagen soll Bergner abholen, der dritte Brauer. Die drei zuerst, die können dann die ganze Kommission zusammenholen. Erkennungsdienst muss gesondert zusammengefahren werden.«
»Und wann wollen Sie geholt werden?«
»Wenn die anderen am Tatort sind.«
Dr. Krämer murmelte noch einen Gruß und hängte schnell ein. Seine Frau brauchte keine Fragen zu stellen. Sie wusste schon, dass aus dem ruhigen Abend, aus der gemeinsamen Silvesterfeier wieder einmal nichts werden würde.
»Dazu bist du nun Chef der Kripo und Oberrat geworden, damit du noch weniger Zeit hast als früher«, sagte sie nur. Aber es klang nicht vorwurfsvoll. Und Dr. Krämer lächelte auch nur als Antwort. Die ersten Jahre der Ehe, in denen fast täglich der Konflikt zwischen der Arbeit und den Anforderungen der Frau an die Ehe zu Auseinandersetzungen geführt hatte, waren längst nein, nicht vergessen, aber vergangen. Man hatte sich geeinigt, auf Kosten von Frau Krämer. Denn sie hatte einen Polizisten geheiratet und musste sich nun damit abfinden, einen Polizisten zum Mann zu haben. Das klang sehr einfach und logisch.
Es klang selbstverständlich, aber Frau Krämer hatte viele Nächte durchweint, bis sie sich damit abgefunden hatte.
Brandis, der sie immer wieder an ihren Mann in jungen Jahren erinnerte, war mit seinen fünfunddreißig Jahren noch Junggeselle geblieben. Wenn es auch sonst die Art von Ehefrauen ist, alle Junggesellen über 21 zur Ehe zu überreden zu versuchen, bei Brandis sagte sie nie ein Wort. Selbst wenn ihr Mann die Vorzüge und Genüsse einer Ehe pries, hielt sie den Mund. Sie wusste auch nie, ob ihr Mann das ernst meinte. Wenn sie ihn manchmal fragte, antwortete er nur lächelnd: »Warum soll Brandis es besser haben als die anderen Männer?«
Aber das war nicht seine wirkliche Ansicht.
Frau Krämer konnte sich jedoch Brandis gar nicht mit einer Frau vorstellen. Es musste schon eine sein, die sich für nichts anderes interessierte als für Morde. Denn für Brandis gab es im Leben nichts anderes als den Kampf gegen das Verbrechen.
Wer ihn sah, wäre so leicht nicht drauf gekommen. Aber das ist die Schuld der Filmindustrie, in deren Werken Kriminalkommissare selten so aussehen wie in der Wirklichkeit, was insofern merkwürdig ist, weil die anderen Typen der menschlichen Gesellschaft im Film doch oft der Wirklichkeit nahekommen. Vielleicht liegt es freilich auch daran, dass die Typen des Films zuerst da sind und die entsprechenden Figuren der Wirklichkeit von ihnen geprägt werden. Zuerst gibt es den Teenager auf der Leinwand, erst später auf der Straße. Kriminalkommissare können sich bedauerlicherweise danach nicht richten. Brandis passte, und das war das Auffallende, auch in die äußerliche Wohlgefälligkeit der neuen Menschen des Ruhrgebietes. Sein Gesicht war rundlich, er schien nie ganz glattrasiert, seit er sich einen elektrischen Apparat gekauft hatte; er trug die Hemden, die es in jedem Geschäft gab, die jeder trug; die Krawatten, die jeder trug, und die Anzüge, die jeder trug. Er rauchte Filterzigaretten und kannte keine absonderlichen Leidenschaften.
Er hatte, was ausgedachte Kriminalkommissare auch selten auszeichnet, eine reizvolle junge Freundin; die zweite übrigens in diesem Jahr.
Aber die Sache war genauso ernst wie die anderen Geschichten vorher. Diese hieß Eva.
Eva wohnte in einem der bis in den letzten Kubikzentimeter hinein ausgenutzten Steinbaukästen, bei deren Anblick man sich stets aufs Neue wundert, dass der Erbauer den Mietern nicht noch eine einheitliche Gardinenfarbe vorschreibt. Die Nüchternheit könnte ja durch einen sanften Plisseebogen hier, durch ein raues Dänengrün dort empfindlich gestört werden. Freilich haben die Mieter, abgesehen von den Gardinen, keine Möglichkeit, den Passanten ihre Individualität vorzuführen. Aber sie kommen beim besten Willen nicht gegen den offenbar gewünschten Eindruck von Kahlheit an, der auf wunderliche Weise bei diesen hochgeschossigen Wohnhäusern mit Protzerei vermischt wird.
Doch hatte Eva etwas Ungewöhnliches erwischt: einen großen Raum, der in den anderen eigleichen Wohnzellen durch zwei Wände unterteilt ist. Deshalb hatte sie die Wohnung überhaupt nur genommen, weil dieser Raum eigentlich gar nicht zum Haus passte. Man erwartete ihn nicht.
Sie verdiente genug Geld, um sich ein ganzes Haus mit Garten mieten zu können. Aber hier, von mehreren hundert Menschen bedrängt, von ihren Gerüchen benebelt, von ihren Geräuschen betäubt, lebte sie anonymer. Und das, sagte sie, sei entscheidend für sie.
Es klang ein bisschen widerspruchsvoll, weil sie selten etwas tat, was anonym bleiben sollte. Wenn sie im Leben die Wahl zwischen zwei Wegen hatte, und der eine verlief unauffällig, auf dem anderen aber standen Hunderte Spalier, so würde sie immer den Weg wählen, der ihr die meisten Zuschauer versprach.