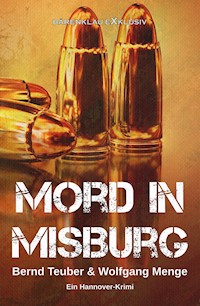4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Dort leben, wo andere Urlaub machen, wer wünscht sich das nicht … Für viele ein Traum, der niemals in Erfüllung gehen wird, für einige ein Traum, der in Erfüllung geht, die Erwartungen und Hoffnungen jedoch enttäuscht werden und für sehr wenige ein Traum, der zum Albtraum wird und manchmal sogar mit dem Tod endet. Vielleicht wird gerade in dem Moment, da Sie hinaus aufs Meer blicken und dort im trüben Dunst einen Frachter erkennen, ein Verbrechen verübt, weil das Opfer dahintergekommen ist, dass sich an Bord eine größere Ladung Heroin befindet. Vielleicht gehen Sie in eine Kunstausstellung und ahnen nicht, dass es sich bei einigen Bildern an der Wand um Fälschungen handelt, an denen das Blut Unschuldiger klebt, aber vielleicht sind Sie auch das nächste Opfer, da Sie die Fälschung erkennen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Wolfgang Menge / Bernd Teuber /
Hans-Jürgen Raben
Regionale Morde:
Hamburg
und
das Heroin
Zwei Hamburg-Krimis
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Kerstin Peschel nach Motiven mit Kathrin Peschel, 2022
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Falsche Kunst – Echter Tod
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Heroin für Hamburg
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
Über die Autoren
Das Buch
Dort leben, wo andere Urlaub machen, wer wünscht sich das nicht …
Für viele ein Traum, der niemals in Erfüllung gehen wird, für einige ein Traum, der in Erfüllung geht, die Erwartungen und Hoffnungen jedoch enttäuscht werden und für sehr wenige ein Traum, der zum Albtraum wird und manchmal sogar mit dem Tod endet.
Vielleicht wird gerade in dem Moment, da Sie hinaus aufs Meer blicken und dort im trüben Dunst einen Frachter erkennen, ein Verbrechen verübt, weil das Opfer dahintergekommen ist, dass sich an Bord eine größere Ladung Heroin befindet. Vielleicht gehen Sie in eine Kunstausstellung und ahnen nicht, dass es sich bei einigen Bildern an der Wand um Fälschungen handelt, an denen das Blut Unschuldiger klebt, aber vielleicht sind Sie auch das nächste Opfer, da Sie die Fälschung erkennen …
***
Falsche Kunst – Echter Tod
Ein Fall für Brock
von Hans-Jürgen Raben
Prolog
Tal der Könige, Ägypten, Februar 1923
Trotz der winterlichen Jahreszeit war die Hitze in diesem Talkessel drückend und schweißtreibend, obwohl die Sonne noch lange nicht ihren Höchststand erreicht hatte.
Johannes Diefenbach schob seinen Tropenhelm in den Nacken und wischte sich mit einem schmutzigen Halstuch über die Stirn. Der herabrinnende Schweiß hatte richtige Furchen in sein staubverkrustetes Gesicht gezogen. In dieser Weltgegend beherrschte der Staub alles. Er drang durch jede Ritze, knirschte zwischen den Zähnen und legte sich wie ein sandfarbenes Tuch über die Kleidung. Der Hobby-Archäologe aus Hamburg hatte sich daran gewöhnt. Dem Staub und dem Sand konnte man hier in der ägyptischen Wüste nicht entkommen.
Er war den Hang so hoch hinaufgestiegen, wie er es für sinnvoll hielt. Es war jedoch kaum anzunehmen, dass es hier oben eine Grabanlage gab. Mit seiner Spitzhacke hatte er in den letzten Wochen fast den ganzen Hang abgesucht, war jedoch immer nur auf Geröll und den darunterliegenden nackten Fels gestoßen. Seine Grabungsmannschaft hatte er bis auf ein paar Männer entlassen müssen. Das Geld, das er zur Verfügung hatte, ging allmählich zu Ende.
Es war in seiner Heimatstadt Hamburg ein harter Kampf mit seinem Vater gewesen, ehe die Familie ihm einen Betrag zur Verfügung gestellt hatte, der für eine Grabungssaison ausreichte. Er musste sich langsam mit der Realität abfinden. Die Grabungslizenz lief ebenfalls Ende des Monats ab. Für eine Verlängerung würde es nicht reichen, auch wenn er sich so weit einschränkte, wie es gerade noch ging. Seine privaten Ersparnisse waren nicht der Rede wert, und die Familie würde nicht noch mehr von ihrem Geld herausrücken.
Er blickte hinüber zu der gewundenen Straße, die zu einer anderen Ausgrabung führte. Wieder ratterte dort ein Lastwagen entlang und wirbelte Staub auf.
Dieser verfluchte Carter! Er hatte erst im letzten Herbst ein Pharaonengrab entdeckt. Dort, wo es niemand vermutet hatte! Sein Gönner – Lord Carnarvon – hatte ihm jahrelang genügend Geld zur Verfügung gestellt. Inzwischen war das Grab des völlig unbekannten Pharaos Tutanchamun offiziell geöffnet worden, und die Welt hatte ihre Sensation. Denn dieses Grab war im Gegensatz zu allen anderen bekannten Pharaonengräbern nicht ausgeplündert. Die Schlagzeilen der Weltpresse überschlugen sich förmlich.
Johannes Diefenbach konnte sehen, wie die Lastwagen die unermesslichen Schätze Tag für Tag abtransportierten und an den Nil schafften. Dort wurden sie per Schiff nach Kairo gebracht.
Jetzt sonnte sich Carter in seinem Ruhm, und er würde sicher Bücher über seine Entdeckung schreiben.
Und er? Johannes Diefenbach? Was hatte er zustande gebracht?
Nichts!
Es war an der Zeit, sich der Wahrheit zu stellen. Sein Vater hatte wohl recht mit seiner Meinung: Er war ein Versager!
Johannes Diefenbach seufzte tief auf und machte sich an den Abstieg über den sanft abfallenden steinigen Hang. Staubfahnen wirbelten an den Stellen hoch, an denen er auftrat. Der Boden war knochentrocken. Hier regnete es so gut wie nie.
Plötzlich stolperte er, ließ die Spitzhacke fallen und ruderte mit den Armen, um sein Gleichgewicht wiederzufinden und nicht zu stürzen. Er blickte nach unten auf seine verdreckten Schuhe.
Der rechte stand auf einer Steinkante, die aussah, als wäre sie bearbeitet worden. Der linke Fuß hatte daneben das lose Geröll zur Seite geschoben und war eingesunken, sodass er dort tiefer stand. Er beugte sich hinunter und fuhr mit den Fingern über die Kante.
Ein seltsames Gefühl stieg in ihm auf. Ja, das war nicht natürlichen Ursprungs! Dieser Stein war tatsächlich von Menschenhand geformt worden. Vielleicht der Beginn einer Treppe? Sein Herz schlug plötzlich schneller.
Mit bloßen Händen zog er die Geröllstücke aus dem Boden und warf sie zur Seite, sodass sie den Hang hinunterrollten. Sein Vorarbeiter, der weiter unten beschäftigt war, wurde aufmerksam und eilte den Abhang empor.
Diefenbach hatte ein Stück des bearbeiteten Steins freigelegt. Ja, das musste der Rand einer Treppe sein!
Er hatte ein Grab entdeckt!
Er wollte jubeln, seine Freude hinausschreien, und wie ein Besessener wühlte er im Boden, bis er tatsächlich etwas entdeckte, was eine erste Stufe sein konnte.
Carter, dachte er, dir werde ich es zeigen.
Sein Vorarbeiter hatte ihn erreicht und starrte auf die Höhlung, die Diefenbach inzwischen geschaffen hatte. Dort sah man den Beginn einer Stufe. Ein Grinsen zog über sein dunkles Gesicht, und die beiden Männer fielen sich in die Arme.
Sie arbeiteten die halbe Nacht, im Schein einer einzigen Petroleumlampe oder teilweise nur im Mondlicht, bis sie nicht mehr konnten und sie sich in ihre Zelte begaben, um ein paar Stunden Schlaf zu bekommen, bis sie am nächsten Morgen weitergraben konnten. Auch die wenigen verbliebenen Arbeiter waren von der Aussicht auf einen großartigen Fund fasziniert und packten tatkräftig an.
Am späten Vormittag hatten sie den größten Teil einer stark beschädigten Treppe freigelegt. Die Kante, über die Diefenbach gestolpert war, gehörte tatsächlich zur Seitenwand einer Treppe. Eine halb eingestürzte Lehmziegelwand versperrte den Weg in einen düsteren Gang, der nur zur halben Höhe mit Steinen gefüllt war. Es war nicht mehr festzustellen, ob der obere Teil der Mauer auf natürlichem Weg eingestürzt oder gewaltsam aufgebrochen worden war.
Diefenbach prüfte jeden einzelnen Ziegel, doch nirgendwo war ein Siegel der Totenstadt zu entdecken, das ihm bewiesen hätte, dass er vor einer Grabkammer stand. Er verdrängte den leichten Anflug von Enttäuschung. Sie mussten einfach weitergraben.
Der Gang führte schräg nach unten, und Diefenbach ahnte, dass er mit seinen wenigen Leuten noch viel Arbeit vor sich hatte, bis sie weiter vorstoßen konnten.
Es dauerte den ganzen Tag, einige Nachtstunden und den nächsten Vormittag, bis Diefenbach mit einer Lampe in der Hand und gefolgt von seinem Vorarbeiter mit dem klassischen Namen Ibrahim vorsichtig den Gang erkunden konnte. Hier lagen deutlich weniger Steine. Die Mauer am Eingang hatte offensichtlich einiges abgehalten, bis sie unter der Last des Gerölls teilweise eingebrochen war.
Nach einigen Minuten waren sie nach Diefenbachs Schätzung in einer Tiefe von vier oder fünf Metern unter der Erdoberfläche in einer Kammer angelangt. Die Wände waren grob behauen. Weder Verputz noch Farbaufträge waren zu sehen. Diefenbach wusste instinktiv, dass die Arbeiten an dieser Grabkammer aus irgendeinem Grund abgebrochen worden waren, und seine Enttäuschung wurde stärker.
Die Kammer war nicht groß, keinesfalls für das Grab eines Pharaos geeignet, sondern höchstens für einen Beamten des Hofes oder eine der Nebenfrauen des Herrschers. Auch Ibrahim schien enttäuscht und ging zwei Schritte vorwärts, bis er vor einem Steinhaufen stand, der den weiteren Weg versperrte.
»Vielleicht ein Erdbeben«, sagte er in seinem gutturalen Englisch.
Diefenbach deutete nach oben. »Die Decke ist eingebrochen. Dort sieht der Fels nicht sehr stabil aus. Da kann noch mehr runterkommen.«
»Ich glaube nicht«, entgegnete sein Vorarbeiter. »Seit ein paar tausend Jahren ist nichts mehr passiert. Es wird jetzt auch halten.«
»Dann sollten wir nachschauen, was sich hinter dem Geröllhaufen befindet.«
Sie mussten den ganzen Tag hart arbeiten, bis sie zwei Dinge gleichzeitig entdeckten.
Der Geröllhaufen verdeckte keinen weiteren Gang, sondern endete an einer massiven Felswand, an der teilweise Bearbeitungsspuren zu sehen waren. Der Fels wirkte spröde und instabil.
»Sie haben die Arbeit abgebrochen, weil es ihnen zu unsicher war«, stellte Diefenbach fest, wobei ihm vor Enttäuschung Tränen in die Augen stiegen. Der Traum vom erfolgreichen Ausgräber war endgültig ausgeträumt. Hier hatte es nie ein Grab gegeben.
Sein Blick fiel auf den Boden, und dort entdeckte er die zweite Überraschung des Tages. Zwischen den verstreut liegenden Steinen lagen die verfärbten Überreste eines menschlichen Skeletts.
Ibrahim zog die Lampe näher heran, und vorsichtig entfernten sie die einzelnen Steine, bis die knöchernen Reste eines vor langer Zeit gestorbenen Menschen vor ihnen lagen. Der Schädel war eingedrückt, der Brustkorb mit den Rippen in viele Teile zerbrochen. Die Knochen waren stark gedunkelt und teilweise fast pulverisiert. Fetzen der ursprünglichen Kleidung waren noch erhalten.
Die Trockenheit der ägyptischen Wüste vermochte es, viele Dinge für eine sehr lange Zeit zu konservieren.
»Was mag da geschehen sein?«, fragte Diefenbach leise.
Ibrahim antwortete nicht. Er hatte offenbar etwas entdeckt und schob mit seinen Händen einige Knochen beiseite.
Unter dem Skelett lag eine Art Dolch. Vorsichtig nahm der Ägypter den Gegenstand hoch und reichte ihn seinem Arbeitgeber.
Diefenbach wischte den Staub ab. Die Waffe war nach seiner Schätzung etwa fünfundzwanzig Zentimeter lang. Der Griff war mit Goldfäden umwickelt, die Klinge schwarz und an den Seitenrändern schartig. Am oberen Ende war sie ziemlich breit und lief keilförmig in einer Spitze aus.
»Das ist Eisen«, sagte Ibrahim.
»Eisen?«, fragte Diefenbach verwundert. »Die Ägypter verwendeten Bronze. Als die Grabkammern hier im Tal der Könige entstanden, kannten sie Eisen überhaupt noch nicht.«
Ibrahim senkte den Blick. »Diese Waffe ist verflucht. Ich habe schon einmal einen Dolch dieser Art gesehen. Der Besitzer starb kurz darauf, nachdem er ihn in sein Heimatland mitgenommen hatte. Sie sollten ihn nicht behalten, Herr.«
Diefenbach drehte den Dolch in seinen Händen hin und her. »Das ist also keine ägyptische Waffe. Wer weiß, aus welcher Zeit sie stammt, und wer der Kerl war, dem sie gehört hat. Vielleicht war es ein Grabräuber, der ebenso wie wir dachte, eine Grabkammer gefunden zu haben. Doch stattdessen wurde er von einem Einsturz überrascht und begraben. Der Eingang wurde dann bestimmt rasch verschüttet und niemand hat sich für die Grabkammer interessiert, da sie leer war. Immerhin sind wir die ersten, die sie nach langer Zeit betreten haben.«
»Wir sollten gehen«, sagte Ibrahim leise. »Dieser Ort gefällt mir nicht.«
Diefenbach hielt die Klinge des Dolches dicht vor die Augen. »Ich brauche mehr Licht!«
Ibrahim hielt die Lampe hoch, und Diefenbach erkannte ganz schwache Zeichen, die vom Griffansatz bis zur Spitze hinunterliefen.
»Das sind keine ägyptischen Hieroglyphen«, stellte er verärgert fest. »Sieht aus wie eine Keilschrift, aber keine, die ich kenne. Noch nicht mal diesen Dolch kann ich zu Hause als Ausgrabungserfolg vorzeigen. Jeder wird sehen, dass er keinesfalls aus Ägypten stammt.«
»Das ist der Fluch!« Ibrahim ließ nicht locker. »Darauf ist die Schrift des Teufels!«
»Was für ein Fluch und was für eine Schrift?«
»Man sagt, dass solche Inschriften den Tod über den Finder oder dessen Familie bringen, wenn er die Waffe behält. Es ist der Fluch eines alten Gottes, und keiner kann ihm entgehen.«
»Das sind Ammenmärchen, mit denen die Kinder erschreckt werden«; erwiderte Diefenbach. »Heutzutage glaubt kein vernünftiger Mensch an solche Geschichten.«
»Wie Ihr meint, doch denkt an meine Worte.«
Diefenbach sah seinen Vorarbeiter an. »Eigentlich wollte ich das Ding hier lassen, weil es nun mal nicht in meine kleine ägyptische Sammlung passt.«
Er lachte kurz auf. »Doch immerhin hätte ich eine Geschichte für meine Besucher, die vielleicht interessanter ist als meine Berichte über erfolglose Ausgrabungen und über das Geld, das ich verschwendet habe.«
»Wollt Ihr jetzt aufgeben, Herr?«
»Mein ägyptisches Abenteuer ist zu Ende«, sagte Diefenbach ruhig. »Es hat viel zu viel Geld gekostet und nichts gebracht. Meine Familie in Hamburg wird mich auslachen, weil ich tatsächlich der Versager bin, für den sie mich immer gehalten hat. Ich nehme das Ding als Andenken mit, und damit meine Freunde sich darüber gruseln können. An mein Leben als Ausgräber wird sich sowieso niemand erinnern, und auch dieser Dolch wird darin keine Rolle mehr spielen.«
Johannes Diefenbach hatte zeit seines Lebens nicht die geringste Ahnung, wie sehr er sich irrte und dass der Fluch des Dolches sich eines Tages in seiner Familie erfüllen würde – wenn auch nicht in seiner Lebenszeit.
1. Kapitel
»Das ist ein interessantes Objekt!«
Der hagere Mann von Mitte fünfzig mit der randlosen Brille in einem gebräunten Gesicht blieb stehen und heftete seinen Blick auf einen unscheinbaren Gegenstand, der in einer Vitrine zwischen anderen Objekten auf dunkelblauem Samt ausgestellt war.
Markus Diefenbach trat einen Schritt nach vorn und musterte den Interessenten unauffällig. Er wusste, dass er selbst einen seriösen Eindruck machte. Das war wichtig, und er hatte mit seinen sechzig Jahren gelernt, dass die äußere Erscheinung für einen erfolgreichen Händler ein wichtiger Trumpf war.
Gut geschnittener Nadelstreifenanzug, Kaschmirschal, englische Maßschuhe und ein Mantel von Zegna. Am linken Handgelenk blitzte eine goldene Patek Philippe Calatrava auf.
Ja, da war Geld, der Mann könnte ein echter Kunde sein.
»Welches Stück darf ich Ihnen zeigen?«
Markus Diefenbach legte so viel Höflichkeit und Charme in seine Worte, wie er es nur vermochte, wenn ein besonders gutes Geschäft ins Haus stand. Sein normaler Umgangston war deutlich ruppiger.
Der Mann deutete auf ein mit Hieroglyphen bemaltes kleines Nilpferd aus blauer Fayence.
Diefenbach lächelte. »Sie kennen sich aus. Ein ziemlich unscheinbarer Gegenstand. Altes Ägypten, mittleres Reich, vermutlich aus der zwölften Dynastie. Eine hervorragende Arbeit, wahrscheinlich eine Votivgabe aus einem Tempel.«
Der Mann nagte an seiner Unterlippe und hob plötzlich den Kopf. Der Blick seiner eisgrauen Augen traf Diefenbach wie eine kalte Dusche, und er wich unwillkürlich einen Schritt zurück.
»Ich gehe davon aus, dass Sie die Echtheit bestätigen können. Ich meine, mit den entsprechenden Gutachten.«
Der Mann sprach Englisch mit einem ganz leichten Akzent. Hier auf der Antikmesse im französischsprachigen Genf war Englisch die bevorzugte Sprache, auch wenn französische und deutsche Wortfetzen zu hören waren. Das Publikum war wie immer international.
Diefenbach nickte eifrig. Er konnte den potentiellen Kunden schwer einschätzen. Teure Kleidung, gerade Haltung, volles und leicht lockiges Haar, kantiges Gesicht. Vermutlich der Inhaber eines Unternehmens, vielleicht auch ein Top-Manager einer großen Firma. Südeuropäer. Doch schließlich war die Herkunft nicht entscheidend. Die Hauptsache war, dass er über Geld verfügte – und daran gab es wohl keinen Zweifel.
»Selbstverständlich verfüge ich über alle notwendigen Unterlagen. Es gibt auch ein Zertifikat, dass dieses Objekt ordnungsgemäß aus Ägypten ausgeführt worden ist. Das war in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts.«
Der Mann richtete seinen Blick wieder auf das kleine Nilpferd. »Ich würde es gern näher betrachten.«
Diefenbach öffnete die Vitrine, nahm das Objekt heraus und stellte es auf die Glasplatte. »Nehmen Sie es ruhig in die Hand.«
Der Mann strich mit den Fingern vorsichtig über die glasierte Oberfläche.
»Zwölfte Dynastie, sagen Sie? Das würde bedeuten, dieses Nilpferd ist ungefähr viertausend Jahre alt.«
Diefenbach nickte, sein Mund wurde trocken. Hatte er etwa einen Experten vor sich?
Schließlich war das Nilpferd erst gut zehn Jahre alt, hergestellt in einer Fälscherwerkstatt in Kairo, die immer hervorragende Qualitätsarbeiten abgeliefert hatte. Das Original befand sich im British Museum in London. Der Fälscher hatte allerdings die Bemalung verändert, sodass die Ähnlichkeit nicht sofort zu erkennen war. Die dazu gehörenden Papiere würden einer forensischen Analyse nicht standhalten – doch welcher Käufer würde eine solche Analyse in Auftrag geben?
»Dann wäre noch die Frage des Preises«, sagte der Mann langsam.
Diefenbach konnte sein Glück kaum fassen. Normalerweise verkaufte er auf einer Antikmesse nur einige Stücke im niedrigen und mittleren Preisbereich. Er besaß ein Sammelsurium der verschiedensten Antiquitäten, unter denen sich keine wirklichen Spitzenstücke befanden, wie sie von anderen Händlern hier angeboten wurden. Deshalb konnte er sich auch nur eine Standardbox von etwa sechs Quadratmetern leisten. Aber auch dafür war die Miete astronomisch hoch.
Wenn es ihm gelang, dieses Nilpferd zu verkaufen, wären alle seine Kosten mehr als gedeckt.
Er griff unter die Vitrine und holte einen Karton heraus, den er ebenfalls auf die Glasplatte stellte.
»Wenn Sie an originalen Stücken aus dem alten Ägypten interessiert sind …«
Er machte eine kunstvolle Pause und öffnete den Deckel des Kartons. Er schlug das Seidenpapier im Inneren zur Seite, und ein wunderbarer Skarabäus von der Größe einer Handfläche wurde sichtbar.
Markus Diefenbach nahm die Käferplastik heraus, legte sie auf seine Hand und drehte sie langsam um. Die gesamte Unterseite war von Hieroglyphen bedeckt.
Der Mann beugte sich vor. »Das ist ebenfalls Fayence, oder? Ein sehr schönes Stück. Wie alt ist es?«
Diefenbach deutete auf die Hieroglyphen.
»Sehen Sie diese Zeichen innerhalb der Umrandung? Das ist die Kartusche von Thutmosis dem Dritten. Er war einer der Pharaonen der achtzehnten Dynastie und einer der bedeutendsten Herrscher des alten Ägypten überhaupt. Mit diesen Skarabäen wurden wichtige Nachrichten im Reich verbreitet. Sie sind sehr gefragt, und sie sind selten geworden. Jeder Sammler möchte ein solches Stück haben.«
»Er ist perfekt erhalten«, stellte der Mann fest. Ein leichtes Misstrauen war aus seiner Stimme herauszuhören.
»Das ist nicht erstaunlich. Der Skarabäus stammt aus einer bedeutenden Hamburger Privatsammlung, die vor einiger Zeit aufgelöst wurde. Die meisten größeren Stücke wurden bei internationalen Auktionen verkauft. Ich konnte jedoch einige kleinere Artefakte erwerben.«
Der Mann nickte. »Eigentlich handelt es sich doch um einen Mistkäfer, wenn ich recht unterrichtet bin.«
»Das stimmt. Dennoch nimmt er in der ägyptischen Mythologie eine wichtige Rolle ein. Unter anderem gilt er als Inkarnation des Gottes Re. Jedenfalls werden Sie nicht so schnell ein ähnlich gut erhaltenes Exemplar finden.«
»In der Tat. Es ist eine Überlegung wert.«
Du sollst nicht überlegen, du sollst kaufen, dachte Diefenbach. Schließlich brauchte er dringend Geld, nicht nur, um die Kosten zu decken. Innerlich verfluchte er kurz seinen unstillbaren Drang, in der Hamburger Spielbank am Roulettetisch Platz zu nehmen. Früher waren die Geschäfte besser gelaufen, heute achteten die Leute mit Geld viel mehr auf ihre Ausgaben. Vor der Finanzkrise hatten sie ihm jeden gewünschten Betrag auf den Tisch gelegt, doch danach …
Der potentielle Kunde nahm den Skarabäus selbst in die Hand und betrachtete ihn von allen Seiten.
»Der Pharao selbst hat ihn in der Hand gehalten …«, sagte er bewundernd.
»Vielleicht«, entgegnete Diefenbach diplomatisch.
Ich weiß jedoch ganz genau, dass ihn ein gewisser Hassan Al-Farad in der Hand gehabt hat, als er ihm in meiner Gegenwart den letzten Schliff gegeben hat. In einer Hinterhof-Werkstatt unterhalb der Zitadelle mit der Mohammed-Ali Moschee in Kairo.
Hassan hatte den Skarabäus nach einer Schwarz-Weiß-Fotografie aus einem alten Bestandskatalog des Ägyptischen Museums in Kairo angefertigt. Anschließend hatte er ihn mit einer farblosen Flüssigkeit künstlich altern lassen. Das war ein faszinierender Vorgang gewesen.
Was allerdings anschließend geschehen war – darüber mochte Markus Diefenbach nicht nachdenken. Der kurze und schauerliche Gedanke verschwand rasch in den Tiefen seiner Erinnerung. Seine Tat lag schließlich auch über zehn Jahre zurück.
»Thutmosis …«, verlor sich der Kunde in seinen Fantasien.
Diefenbach wusste, dass er kurz davorstand, den Mann an die Angel zu kriegen. Vielleicht würde ein kleiner Stoß reichen.
»Heute Vormittag war ein Vertreter des Pariser Louvre hier. Er hat sich den Skarabäus angesehen und fand ihn interessant, weil ein solches Stück ihre Sammlung gut ergänzt hätte. Er wollte sich auf der Messe umsehen und anschließend wiederkommen. Sie wissen: Wer zuerst kommt …«
Der Mann sah ihn mit seinem beunruhigenden Blick an, nestelte an der Brusttasche seines Sakkos und zog eine Visitenkarte heraus. Natürlich Stahlstich, stellte Diefenbach sofort fest.
»Kommen Sie heute Abend in mein Hotel. Sie treffen mich in der Bar. Sagen wir um zwanzig Uhr. Dort können wir über alles reden. Und bringen Sie die beiden Objekte mit. Ich bin sehr interessiert.«
»Aber der Louvre …«
»Die haben genug in ihren Vitrinen!«
»Vielleicht sollten wir noch über den Preis …«
Der Mann winkte ab. »Darüber werden wir uns schon einigen. Ich wohne übrigens im Beau Rivage.«
Wo auch sonst, dachte Diefenbach und starrte auf die Karte in seiner Hand.
Allessandro Tomaselli, Im- und Export, Palermo, Palazzo Speranza. Darunter eine Adresse und eine Telefonnummer.
Palermo?
Ein düsterer Gedanke breitete sich kurz aus, doch er verschwand gleich wieder.
Er kommt also aus Sizilien. Na, und wenn schon. Geld hat keine Heimat. Und seine Villa heißt Hoffnung. Na, wenn das kein Zeichen ist!, ging es Diefenbach durch den Kopf.
*
Das Beau Rivage am Quai du Mont-Blanc zählte zu den luxuriösesten und teuersten Hotels der Schweiz. Es lag im Herzen der Stadt gegenüber dem Springbrunnen mitten im See, der seinen Wasserstrahl über hunderte Meter in die Luft blies.
Markus Diefenbach blieb stehen und ließ seinen Blick über die Fassade des Prachtbaues aus dem neunzehnten Jahrhundert gleiten. Er erinnerte sich, dass hier ganz in der Nähe die Kaiserin Elisabeth – Sissi – erstochen worden war. Ihre letzte Nacht hatte sie im Beau Rivage verbracht.
Er war ein paar Minuten zu früh angekommen und überquerte gemächlich den Platz, sein Köfferchen aus Straußenleder fest in der Hand. Der Türhüter musterte ihn unauffällig, hielt ihm dann aber die Tür auf. Diefenbach hatte es noch nie geschafft, in diesem Hotel abzusteigen. Seine Kunden schätzten eher die Heimlichkeit eines Hinterzimmers, in denen sie ihre Geschäfte abwickelten.
Die Bar gefiel ihm sofort: Antike Möbel, bequeme Sitzgruppen, weiches Licht aus zahlreichen Lampen. Wie viele Prominente mochten hier schon gesessen haben?
Er entdeckte den Italiener sofort. Allessandro Tomaselli saß in einem Sessel direkt gegenüber dem auf Hochglanz polierten Bartresen. Er winkte Diefenbach zu und deutete auf die kleine Couch an der Rückwand, deren zahlreiche Kissen überaus einladend wirkten. Ein kleiner Glastisch mit einer runden Platte befand sich zwischen ihnen.
Diefenbach setzte sich. Sein Blick fiel sofort auf einen glatzköpfigen Mann mit einer dunklen Narbe auf der rechten Wange, der aufmerksam zu ihnen herübersah. Ohne Zweifel gehörte er zu dem Sizilianer, wahrscheinlich dessen Leibwächter.
Vor ihm stand eine Espressotasse, zu seinen Füßen ein normaler Aktenkoffer. Der Barkeeper wischte hingebungsvolle seinen ohnehin spiegelnden Tresen.
»Das ist Gino«, erklärte Tomaselli, der Diefenbachs Blick bemerkt hatte. »Er begleitet mich auf meinen Reisen. Ich habe oft viel Bargeld bei mir. Da ist es gut, jemanden zu haben, der darauf achtet.«
Diese Mitteilung löste ein warmes Gefühl in Diefenbach aus, und er spürte, dass ein gutes Geschäft nicht mehr lange auf sich warten ließ. Der Italiener hatte zumindest niemanden mitgebracht, der nach einem Experten für altägyptische Kunst aussah. Eine Zeit lang hatte er befürchtet, dass so etwas geschehen könnte, und bereits darüber nachgedacht, ob er das Treffen absagen sollte. Letztlich war die Gier größer gewesen als seine Bedenken.
»Haben Sie die Objekte mitgebracht?«, fragte der Italiener. Seine Augen funkelten erwartungsvoll.
Diefenbach legte sein Köfferchen auf den Tisch und ließ die Verschlüsse aufschnappen. »Nicht nur das. Ich habe Ihnen noch ein weiteres Stück mitgebracht, das sicher Ihr Interesse finden wird – zumal es aus Ihrem Heimatland stammt.«
»Aus Sizilien?«
»Nicht ganz. Aus der Toskana.«
»Na, dann zeigen Sie mal her.«
Markus Diefenbach klappte den Deckel seines Aktenkoffers hoch und entnahm ihm einen schmalen, in Seidenpapier gehüllten Gegenstand. Er ging absichtlich langsam vor, da er aus Erfahrung wusste, dass die Neugier seiner potentiellen Kunden damit noch stärker wurde.
Vorsichtig schlug er das Papier zur Seite und stellte eine bronzene Figur auf den Tisch. Sie war etwa dreißig Zentimeter hoch, wirkte sehr dünn und in die Länge gezogen und stellte eine Kriegerfigur dar. Irgendwie ähnelte sie einer Skulptur von Giacometti. Die Bronze besaß eine sehr dunkle, fast schwarze Patina.
»Die Figur stammt aus einem etruskischen Grab«, erläuterte Diefenbach. »Sie ist ungefähr zweieinhalbtausend Jahre alt. Leider fehlt das Schwert, das sie in der Hand hielt. Das weiß man, weil es vergleichbare Figuren gibt. Sie stellen häufig Herkules dar.«
Tomaselli starrte stumm auf die Figur. Dann berührte er sie vorsichtig mit einem Finger.
Es ist immer richtig, dem Kunden erst die echte Ware zu zeigen, dachte Diefenbach.
Die Figur stammte tatsächlich aus einem etruskischen Grab, doch dort war sie nicht legal ausgegraben worden. In der Toskana hatten Raubgräber eine lange Tradition, und die Behörden waren oft machtlos gegen dieses Geschäft mit der alten Kunst, besonders, weil die Objekte in den meisten Fällen sofort das Land verließen. Es war unmöglich, die zahlreichen Fundorte zu überwachen, zumal die Raubgräber mit ihren Suchgeräten immer neue Orte entdeckten, an denen antike Schätze zu finden waren.
Diese Figur war auf dunklen Wegen erst vor Kurzem nach Deutschland gelangt. Diefenbachs Geschäftspartnerin, eine mit allen Wassern gewaschene Expertin eines Münchner Auktionshauses, besaß die Kontakte in die Toskana, sorgte für den Transport und kümmerte sich um die nötigen Papiere. Beim letzten Mal hatte sie es allerdings zu weit getrieben. So etwas ließ er nicht mit sich machen. Sie würde sich noch wundern, wenn er es ihr heimzahlte. Bald, sehr bald!
Er hatte zwar kein Problem damit, jeden anderen über den Tisch zu ziehen, wenn es ihm in den Kram passte, doch er wurde sehr wütend, wenn man das Gleiche mit ihm machte.
»Die Figur stammt aus einer alten Münchner Privatsammlung, die vor einiger Zeit aufgelöst wurde«, behauptete Diefenbach. »Sie wurde in den fünfziger Jahren offiziell in Rom erworben. Ich besitze selbstverständlich die nötigen Papiere, außerdem ein Gutachten über die Echtheit. Sie können also völlig unbesorgt sein, wenn das Objekt nach Italien zurückkommt.«
»Ich kenne da eine ganz berühmte Figur …«
»Die sogenannte Ombra della sera«, unterbrach Diefenbach. »Der Schatten des Abends. Die Figur in ihrer langgezogenen Gestalt sieht aus wie eine moderne Skulptur.«
»Ja, genau die meine ich!« Tomaselli schien ganz aufgeregt. »Leider ist sie unverkäuflich, da sie sich im Museum befindet. Doch Ihre Figur ist auch sehr schön. Ich möchte sie kaufen.«
»Der Preis …«
Tomaselli winkte erneut ab. »Zeigen Sie mir erst die anderen Schätze, die ich mir schon angesehen habe.«
Diefenbach nahm das kleine Nilpferd und den Skarabäus aus dem Köfferchen und packte sie aus.
»Interessieren Sie sich mehr für ägyptische Kunst oder für etruskische?«, fragte er. »Ich könnte Sie mit Stücken aus beiden Sammelgebieten versorgen.«
»Das ist nicht so wichtig. Ich möchte im Prinzip eine Antikensammlung aufbauen. Bis jetzt besteht sie nur aus zwei griechischen Vasen, diversen Münzen und einigen römischen Öllampen. Das beste Stück ist eine beschädigte Statuette eines römischen Kaisers aus Marmor.«
Der Mann ist ein Gottesgeschenk für meine Geschäfte, dachte Diefenbach.
»Wenn Sie Ihre Sammlung erweitern wollen, kann ich Ihnen helfen. Ich habe gute Beziehungen und kann Ihnen sicher die gewünschten Objekte besorgen.«
Nur schade, dachte Diefenbach, dass Hassan Al-Farad nicht mehr in der Lage ist, neue Stücke anzufertigen. Er war einer der Besten in seinem Fach.
Tomaselli hob den Kopf und sah den Deutschen an. In seinen Augen lag für einen kurzen Moment ein Ausdruck, der Diefenbach einen kalten Schauer über den Rücken jagte.
»Sie können mir Ihre Angebote zukommen lassen.« Er beugte sich wieder über die antiken Objekte. »Ich nehme sie.«
»Alle drei?«
»Selbstverständlich!«
Diefenbach nahm aus seinem Koffer einen Stapel Papiere. »Das sind die Unterlagen zu den Exemplaren.«
Bevor er den Gesamtpreis aussprach, fügte er rasch noch fünfzig Prozent hinzu.
Tomaselli zuckte mit keiner Wimper. Er winkte Gino heran und flüsterte ein paar Worte in einem italienischen Dialekt, von dem Diefenbach kein Wort verstand, obwohl er etwas Italienisch sprach.
Gino öffnete seinen Koffer, der mit Geldbündeln vollgepackt war, und zählte den gewünschten Betrag ab, bis ein dicker Stapel Gelscheine vor Diefenbach auf dem Tisch lag. Der Barkeeper hatte seine Bemühungen eingestellt und sah angestrengt herüber, ließ sich aber nichts anmerken. Nicht in diesem Haus.
»Ich danke Ihnen«, brachte der Händler nur stockend heraus. »Ich wünsche Ihnen viel Freude an den Objekten, und es wäre mir eine Freude, Ihnen weiter behilflich zu sein.«
Tomaselli streckte seine Hand aus. »Ihr Koffer gehört sicher dazu.«
Eigentlich nicht, dachte Diefenbach. Doch bei einem solchen Geschäft sollte man nicht kleinlich sein.
2. Kapitel
Der junge Mann öffnete vorsichtig die leicht quietschende Tür. Die Werkstatt war unverändert und sah genauso aus wie vor zehn Jahren. Alles war staubig. Die Werkzeuge für die Bearbeitung aller möglichen Materialien, die wenigen Möbel, die Werkbank, das Regal mit den Flaschen, in denen sich immer noch manch trübe Flüssigkeiten befanden, eine Töpferscheibe und vieles andere mehr.
Sein Blick fiel auf die zerbrochene Sandsteinplatte. Er glaubte immer noch den dunklen Fleck zu sehen, der vom Blut seines Vaters stammte. Die Platte lag noch immer ziemlich genau an der gleichen Stelle, an der der Mörder sie fallen ließ. Sie hatten damals die Polizei nicht gerufen. Seine Mutter hatte gesagt, dass eine solche Meldung nur Scherereien brächte. Der Polizei könne man nicht trauen. Damals hatte er noch nicht geahnt, dass der Grund für diese Vorsicht ein ganz anderer war: Niemand durfte diese Werkstatt sehen.
Heute wusste er, was sein Vater hier gemacht hatte.
Also hatte die Familie damals seinen toten Vater heimlich weggeschafft und ganz früh am nächsten Morgen in eine Grabkammer auf dem großen Friedhof gebracht. Anonym, wie es sich für einen guten Moslem gehörte. Der Nachbarschaft erzählte man, dass sein Vater an einer kurzen und schweren Krankheit verstorben sei.
In der Familie wurde nie wieder über den Vorfall gesprochen.
Bis jetzt!
Amir Al-Farad war jetzt einundzwanzig Jahre alt. Er lebte noch im Haus seiner Familie. Nach einer höheren Schule hatte er eine Ausbildung zum Goldschmied erfolgreich abgeschlossen. Gleich darauf hatte er sich bei einem bekannten Kairoer Juwelier um eine Stelle beworben – und sie auch bekommen. In drei Wochen würde er dort anfangen. Seine ganze Familie war stolz darauf, dass er jetzt einen Arbeitsplatz in einem angesehenen Geschäft besaß und endlich sein eigenes Geld verdiente.
Seine Mutter hatte bereits Andeutungen gemacht, dass es bald an der Zeit sei, eine Frau für ihn auszusuchen. Amir hatte noch kaum Erfahrungen mit Frauen gemacht, doch er war gut erzogen und wusste, dass man sie mit Respekt behandeln musste.
Doch gestern Abend hatte seine Mutter ein Gespräch unter vier Augen mit ihm geführt. Das war selten, denn normalerweise sprachen sie kaum allein miteinander. Der Inhalt dieses Gesprächs war der Grund für seine Anwesenheit in der Werkstatt, die er seit dem Tod seines Vaters nicht mehr betreten hatte. Niemand aus der Familie hatte das getan. Seine Mutter hatte den Schlüssel an sich genommen. Seitdem hing er an einer Kette um ihren Hals.
Gestern nun hatte sie die Kette abgenommen und ihm den alten und inzwischen leicht angerosteten Schlüssel überreicht. Dann hatte sie ihm erklärt, was sie und die Familie von ihm erwarteten. Amir hatte nur stumm genickt.
Er stand noch einige Minuten auf der Schwelle, bevor er einen Schritt in die Werkstatt hinein machte. Eine winzige Staubwolke wirbelte auf.
Auf der Töpferscheibe stand eine halbfertige Vase, schief und krumm geworden, als der weiche Ton in sich zusammensackte. Jetzt war das Material steinhart geworden und nicht mehr zu gebrauchen. Das würde wohl für die meisten Gegenstände in diesem Raum gelten.
Amir hob die beiden Teile der zerbrochenen Sandsteinplatte auf und stellte sie nebeneinander gegen die Wand. Sie war noch nicht bemalt worden, nur die Umrisse der Figuren waren bereits skizziert.
Achtzehnte Dynastie, dachte er unbewusst. Amarna-Periode, die Regierungszeit des Pharao Echnaton und seiner schönen Gemahlin Nofretete.
Sein Vater hatte diese Phase der altägyptischen Kunst besonders geschätzt. Die Replikate, die er angefertigt hatte, verkauften sich gut an Händler oder direkt an Touristen, die sich in diesen Teil der Altstadt verirrt hatten.
Seine Mutter hatte ihm viel über seinen Vater und dessen Interessen erzählt, und Amir hatte alles über die ägyptische Geschichte gelesen, was er in die Finger bekam. Inzwischen verstand er die Begeisterung seines Vaters.
Nun gut, er hatte auch Fälschungen hergestellt.